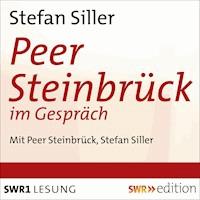10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Sozialdemokratie steckt in einer der schwersten Krisen ihrer Geschichte. Bei den letzten Bundestagswahlen musste die SPD eine herbe Schlappe einstecken. Aber nicht nur sie, sondern fast alle sozialdemokratischen Parteien in Europa sacken in der Wählergunst immer weiter nach unten ab. Was läuft da schief? Peer Steinbrück, streitbarer Sozialdemokrat und Kanzlerkandidat der SPD 2013, sucht in seinen Anmerkungen eines Genossen nach Wegen zu einer erneuerten Sozialdemokratie und nennt mit klarer Kante seine Stichworte: Einhegung des digitalen Kapitalismus, Kampf gegen die wachsende Vermögensungleichheit, Mut zu einer neuen Debatte über Identitätspolitik, Vertiefung der Europäischen Union, mehr Engagement für junge Wähler. Ralf Dahrendorf hat in einem berühmten Aufsatz über das Elend der Sozialdemokratie vor mehr als dreißig Jahren den „dritten Weg“ vorgezeichnet, den Bill Clinton, Tony Blair und Gerhard Schröder dann erfolgreich gingen. Steinbrück entwirft nun eine Agenda für die Sozialdemokratie des 21. Jahrhunderts. Denn in einem sind er und seine Kritiker sich einig: Die Sozialdemokratie wird dringend gebraucht – vielleicht sogar mehr als je zuvor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Peer Steinbrück
Das Elend der Sozialdemokratie
Anmerkungen eines Genossen
C.H.Beck
Zum Buch
«Man muss schon ein sehr blinder Parteisoldat sein, wenn einem in der Reihe von drei knackig verlorenen Bundestagswahlen nicht die Erkenntnis kommt, dass die SPD vor sehr grundsätzlichen Fragen steht.»
Die Sozialdemokratie steckt in einer der schwersten Krisen ihrer Geschichte. Bei den letzten Bundestagswahlen musste die SPD eine herbe Schlappe einstecken. Aber nicht nur sie, sondern fast alle sozialdemokratischen Parteien in Europa sacken in der Wählergunst immer weiter nach unten ab. Was läuft da schief?
In Anlehnung an einen berühmten Aufsatz von Ralf Dahrendorf spürt Peer Steinbrück dem «Elend der Sozialdemokratie» nach und nimmt sowohl soziale und politische Faktoren als auch notwendige Reformen innerhalb der SPD in den Blick. Seine Streitschrift entwirft zugleich eine Agenda für die Sozialdemokratie des 21. Jahrhunderts. Denn in einem sind er und seine Kritiker sich einig: Die Sozialdemokratie wird dringend gebraucht – vielleicht sogar mehr als je zuvor.
Über den Autor
Peer Steinbrück war von 2002 bis 2005 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, von 2005 bis 2009 Bundesfinanzminister in der großen Koalition und wurde 2012 Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl 2013. Seine Bücher Unterm Strich (2010) und Zug um Zug (mit Helmut Schmidt, 2011) waren Bestseller.
Inhalt
Prolog oder Nekrolog?
I: Kalamitäten der SPD
II: Vom Verteilungskonflikt zum Wertekonflikt
III: Krankenwagen der Gesellschaft oder Gestalter von Zukunft?
IV: Hätte hätte Fahrradkette …
V: Über Zivilität und Umgangsformen
VI: Was tun?
Epilog
«Sorge Dich! Einzelheiten später»
Jüdisches Sprichwort
Prolog oder Nekrolog?
Ja, ich weiß: Der Verlierer von 2013 sollte sich mit einer Analyse der Wahlniederlage der SPD vom September 2017 zurückhalten. Für manch einen könnte es so aussehen, als versuchte ich, eigene Verantwortung kleinzuschreiben oder nachzutreten. Es besteht jedenfalls das Risiko, missverstanden zu werden. Aber es geht hier nicht um Aufrechnung, und jeder Anflug von Häme liegt mir fern. Bereits nach der Bundestagswahl vom September 2013 drängte ich auf eine ungeschminkte Ursachenanalyse – nicht zu einer bloßen Aufzählung von Fehlern im arglistigen Blick zurück, sondern zur Sammlung von Lehrmaterial im Vorausblick auf eben diese Bundestagswahl 2017. Aber sowohl über den Koalitionsverhandlungen und der Regierungsbildung im Herbst 2013 als auch nach dem Start in die zweite große Koalition innerhalb von drei Legislaturperioden fehlte meiner Partei dafür offenbar nicht nur die Zeit, sondern auch der Wille.
Natürlich hätte eine Analyse der heftigen Wahlniederlagen der SPD 2009 und 2013, die nicht bloß auf der Oberfläche gesurft wäre, viele Tücken für Programm, Ausrichtung und Organisation der Partei sowie nicht zuletzt für einige Spitzenleute und deren Stellung im parteiinternen Kräftefeld offenbart. Deshalb blieb der Deckel auf dem Topf. Schmerzhafte und unfreundliche Abschiede von Illusionen und Ambitionen wurden niemandem zugemutet. Die SPD konzentrierte sich vier Jahre lange auf solide Sachbearbeitung ihrer Koalitionsaufgaben. Die Quittung wurde ihr am 24. September 2017 ausgestellt.
Einer der Antriebe zu dieser Streitschrift liegt in meiner Sorge, dass sich diese Verdrängung der tieferen programmatischen, strukturellen und organisatorischen Ursachen für den Abstieg der SPD wiederholen könnte. Trotz eines noch größeren Wahldebakels 2017 und im Widerspruch zu den verbalen Bekenntnissen aus vielen Ecken der Partei bis hin zum Parteivorsitzenden Martin Schulz, die SPD müsse neu anfangen oder sich neu erfinden. Was das Führungsdeck dem staunenden Publikum bis zum Abschluss dieser Niederschrift Mitte Dezember 2017 geboten hat, vermittelt den Eindruck, dass der Donner nicht gehört worden ist.
Kaum stand die SPD nach dem Knock-out des Wahlabends wieder auf den Beinen, wurden die alten innerparteilichen Reviere neu abgesteckt. Dabei folgte man der zementierten Gepflogenheit, Personalbesetzungen nach Regional-, Flügel- und Geschlechterproporz vorzunehmen. Als ob der Proporzschlüssel auch für Kompetenz, Ausstrahlung, Urteilskraft und Durchsetzungsvermögen stünde. Die Postenverteilung in der SPD-Bundestagsfraktion und in der Geschäftsführung der Parteizentrale drohte zu einer Farce zu werden.
Den wohltuenden Lichtblick des niedersächsischen Wahlergebnisses Mitte Oktober 2017 verstanden einige schon wieder als Entwarnung. Man müsse den eingeschlagenen Weg nur in Verdoppelung aller bisherigen Anstrengungen und in großer Geschlossenheit fortsetzen – Geschlossenheit als Selbstzweck und Instrument des internen Machterhalts, wie der Journalist Christoph Hickmann schrieb. Im Übrigen befinde sich die Union mit einer geschwächten Angela Merkel und angesichts einer offenen Nachfolgefrage auf einem absteigenden Ast, worüber es im Fall leichter Aufwinde für die SPD ja wieder zu einem Punkt gleicher Augenhöhe kommen könnte – fragt sich nur, auf welchem Niveau. Das hat die Qualität von politischen Sandkastenspielen – wie auch die trickreiche Vorstellung in einigen Köpfen, man solle auf einen weiteren Machtverlust von Angela Merkel setzen, indem man eine große Koalition verweigert und dann ihren Verschleiß in einer Minderheitsregierung abwartet.
Der Wahlniederlage folgte alsbald eine Reihe von Papieren – ich zählte fünf bis hin zum Entwurf eines Leitantrages für den Bundesparteitag auf Initiative des Parteivorsitzenden –, die alle den Begriff «Erneuerung» oder dessen Synonyme zum Wort des Jahres der SPD machten. Die meisten gelangten allerdings viel zu schnell an die Öffentlichkeit, ohne dass sie schon bis zum Kern der Misere der SPD vorstoßen konnten beziehungsweise wollten. Möglicherweise dienten sie in erster Linie der innerparteilichen Aufstellung ihrer Autoren mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen zum Parteivorstand. Die Protagonisten hielten sich mit schmerzhaften Befunden zur Wahlniederlage überwiegend zurück oder segelten in vertrauten Gewässern, um sich nach einer möglicherweise transitorischen Phase mit dem amtierenden Parteivorsitzenden die Startposition für das nächste Rennen nicht zu vermasseln. Man schützte sich durch taktische Einlassungen, hielt den Kopf aber nicht über die Brüstung.
Olaf Scholz, der sich am stärksten exponierte («schonungslose Betrachtung der Lage»), weckte die üblichen Reflexe, die einer unbefangenen Debatte im Wege stehen. Er stieß zwar auch auf Zustimmung, wurde aber bei der Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden auf dem Bundesparteitag der SPD im Dezember 2017 mit 59,2 Prozent abgestraft. Damit bestätigte sich, dass solche Wahlen nicht unbedingt die Anerkennung einer präzisen politischen Grammatik widerspiegeln, über die Olaf Scholz wie nur wenige andere verfügt, sondern vielmehr ein Testat innerparteilicher Empathie und Gesinnungstreue sind.
Das Ensemble der engsten Parteispitze wurde im Dezember in einigen Rollen neu besetzt, aber mit Ausnahme einer Genossin, die bis vor kurzem noch Geschäftsführerin des namhaften bayerischen Landesverbandes war und sich im Paternoster so schnell emporgehoben sah, wie sie sich das selbst gewiss nicht hatte vorstellen können, traten weitgehend bekannte Protagonisten auf. Der eine oder andere, der eigentlich eine Hauptrolle übernehmen sollte, fehlt. Und der eine oder andere, der eigentlich in die Provinz geschickt werden sollte, darf weiterhin überall und jederzeit seine Texte aufsagen – unabhängig davon, ob sie ankommen oder nicht.
Der nunmehr mit knapp 82 Prozent bestätigte Parteivorsitzende Martin Schulz machte die unter seinem Vorgänger durchgeführte Verkleinerung des Parteivorstandes auf 35 Mitglieder rückgängig und kehrte zu einem 45köpfigen Vorstand zurück. Abgesehen von der Frage, ob ein Gremium in nahezu halber Kompaniestärke tatsächlich geeignet ist, zielführend zu beraten, oder nicht eher Gefahr läuft, das Format einer geselligen «Palaverrunde» am Lagerfeuer anzunehmen, darf bezweifelt werden, ob diese Volte der Weisheit letzter Schluss ist. Denn es geht gerade nicht darum, die verschiedenen, teils fest gefügten «Strömungen» der SPD zu sammeln, sondern im Gegenteil das Diffuse einzudämmen, der Partei ein markantes Profil zu geben und Führungsanspruch zu erheben. Das muss keineswegs zu Lasten einer lebendigen, also auch kontroversen innerparteilichen Debatte gehen.
Die Erweiterung des Parteivorstandes lieferte jedenfalls kein Indiz dafür, dass an der Parteispitze für gößere Erkennbarkeit und schärfere Konturen gesorgt wird. Es bleibt bei dem frechen Spruch von Helmut Schmidt: «Jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll, aber alle machen mit.» Abgesehen von den zehn zusätzlichen Mitgliedern, die vielleicht eher einige altgediente hätten ersetzen sollen, wurde der Parteivorstand weitgehend bestätigt. Ob er die Kraft zur Erneuerung hat und vor allem den Willen, alte Pfade zu verlassen und innerparteiliche Denk- und Verhaltensmuster zu überwinden, wird sich erweisen müssen.
Nun muss man der SPD zugute halten, dass zweieinhalb Wochen vor ihrem Parteitag, am Sonntag, den 19. November 2017, spät abends etwas passiert war, was sie offenbar kalt erwischte: das Jamaika-Aus. Die Sondierungen zu einer schwarz-gelb-grünen Koalition waren gescheitert, indem die FDP glattweg vom Platz ging. Mit diesem Datum veränderte sich die politische Grundkonstellation fundamental. Der Druck richtete sich nicht vorrangig auf den Spielverderber FDP, sondern vielmehr auf die SPD, die sich völlig unvorbereitet zeigte, obwohl doch ein solches Szenario – nicht gewünscht und von vielen auch für unwahrscheinlich gehalten – am Kartentisch in seinen Konsequenzen hätte durchgespielt werden müssen. Direkt nach dem Hakenschlag der FDP flüchtete die Führung der SPD – ohne die angekündigte Ansprache des Bundespräsidenten als Herrn des weiteren Verfahrens abzuwarten und ohne Temperaturfühlung mit der Fraktion – unter der Anleitung ihres Vorsitzenden, der die Zugbrücke zur Union mit jedem Interview höher gezogen hatte, in ihre Burg und wiederholte in einem einstimmigen Beschluss, der wie in Beton gegossen schien, dass die SPD «für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung» stehe.
Man konnte den Eindruck gewinnen, dass einige Führungsleute der SPD die scharfe Abgrenzung zur CDU/CSU auf dem Weg vom Wahlabend bis zu dieser Vorstandssitzung bereits als wesentlichen Beitrag zur Erneuerung der Partei (miss)verstanden. Die apodiktische Ablehnung einer Neuauflage der großen Koalition schien den Schmerz über die drastische Wahlniederlage zu betäuben. Während der Parteivorsitzende noch selbstgewiss und entschlossen verkündete, die SPD sei jederzeit auf Neuwahlen eingestellt, und sich selbst fesselte («In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nicht eintreten»), dämmerte es einigen Genossen auch im Licht der unmissverständlichen Ansprache des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier über die Verantwortung der Parteien, dass sich die SPD zwischen Parteiraison und Staatsraison in ein kolossales strategisches Dilemma manövriert hatte. Die Kraftmeierei, für Neuwahlen jederzeit bereitzustehen, wich bei manchen einer Ernüchterung ob der damit verbundenen Konsequenzen.
Ob und wie die SPD-Führung das Wendemanöver hinkriegt und sich aus dem Dilemma zwischen Glaubwürdigkeit und Verantwortung in unruhigen Zeiten befreit, ob sie das Manöver durchsteht, abbricht oder dabei sogar kentert, weil ihr die Mitglieder nicht folgen, ist gegen Ende des Wahljahrs 2017 nicht absehbar. Die Notwendigkeit einer umfassenden programmatischen, strukturellen und organisatorischen Erneuerung der SPD bleibt davon allerdings völlig unberührt. Ob Regierungspartei oder Opposition: Wiederholen sich die Verdrängung und falsche Rücksichtnahme auf innerparteiliche Befindlichkeiten wie nach den Wahlniederlagen 2009 und 2013, dann wird die SPD weiter taumeln, auf unter 20 Prozent fallen und in eine existenziell bedrohliche Lage geraten.
Unabhängig davon, ob am Ende noch einmal eine gemeinsame Regierung mit CDU/CSU zustanden kommen wird oder nicht, bietet der Hinweis auf die große Koalition vielen in der SPD eine bequeme Ausflucht. Die Behauptung, dass der wesentliche Grund für die Wahlniederlagen die Umklammerung der SPD in einer großen Koalition gewesen sei, entlastet die Parteiführung und ist Balsam für die Seele der Partei. Tatsächlich litt die SPD aber weniger an der großen Koalition und an Angela Merkel – mit der sie zwischen 2009 und 2013 ohnehin nicht in einer politischen Wohngemeinschaft lebte – als vielmehr an sich selbst. Sie vertraute ihrer eigenen Erfolgsgeschichte nicht und zeigte sich unfähig, mit ihren Erfolgen zu werben und gleichzeitig eine Deutungshoheit über die gesellschaftlichen und ökonomischen Trends der Zeit zu gewinnen. Stattdessen haderte sie damit, was alles nicht gelungen oder ihr verwehrt worden sei.
Bis Mitte Dezember war nicht zu erkennen, dass irgendein auf Initiative des Parteivorsitzenden gebildeter Personenkreis, auch unter Beteiligung externer Köpfe, sich systematisch mit den Missweisungen, Defiziten und Problemen der SPD beschäftigt – quasi eine kompakte Partei-Enquetekommission. Dann las ich über eine fünfköpfige Arbeitsgruppe, die der neue Generalsekretär Lars Klingbeil berufen hat. Deren Auftrag ist offenbar jedoch darauf begrenzt, die Stärken und Schwächen der SPD-Kampagne 2017 zu analysieren. Der Schiffbruch war aber eben nicht nur auf örtliche widrige Winde zurückzuführen, sondern die Folge eines grundsätzlich falschen Kurses, der nach drei Wahlniederlagen in Folge endlich korrigiert werden müsste.
Angesichts der Präsentation, die sich meine Partei – präziser, die Parteiführung – in den Monaten seit dem Wahltag Ende September geleistet hat, und angesichts der Unklarheit darüber, wie die notwendige Diskussion zur Lage und Zukunft der SPD konkret und zielorientiert geführt werden soll, befürchte ich, dass der Schuss vom 24. September verhallen und ein Erneuerungsprozess sich wieder einmal in verbalen Absichten und ebenso dekorativen wie folgenlosen Veranstaltungen erschöpfen könnte. Die Sorge, dass meine Partei sich wieder verschiedene Deckmäntelchen umhängen wird, statt «schonungslos» in die tieferen Gründe ihrer Misere vorzustoßen, veranlasst mich zu dieser gewiss ebenso umstrittenen wie Streit auslösenden Wortmeldung.
Dabei stehe ich unter dem Eindruck eines Essays, den Ralf Dahrendorf 1987 in der Monatszeitschrift Merkur unter dem Titel «Das Elend der Sozialdemokratie» veröffentlichte. Der Text machte Furore in einer Zeit, in der eine konservative und ordoliberale «Revolution» auf dem Vormarsch und die Sozialdemokratie europaweit auf dem Abstieg war. Dahrendorf konstatierte damals das Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts. Damit meinte er, dass die Sozialdemokraten – trotz aller Totalitarismen – ein Jahrhundert lang der Treibriemen der politischen und sozialen Entwicklung gewesen seien, am Ende aber ihre Kraft verloren hätten – weil sie erfolgreich (!) waren. Sie hatten – so Dahrendorf – ihre historische Mission erfüllt, den Kapitalismus zu zähmen, den Wohlfahrtsstaat zu errichten und dem Proletariat Aufstiegsperspektiven insbesondere durch Bildung zu eröffnen.
Dahrendorf irrte in einem entscheidenden Punkt. In seinem Szenario kam ein erneuter Pendelumschwung zurück zur Sozialdemokratie in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre nicht vor. Nach den Verwüstungen marktideologischer Entfesselungskünstler und den Erstarrungen konservativer Kräfte bekamen die deutschen und nahezu alle anderen sozialdemokratischen Parteien in Europa jedoch eine neue Chance. Allerdings handelte es sich, wie heute nüchtern festzustellen ist, nur um ein Zwischenhoch. Das ist nun vorbeigezogen und hat die Sozialdemokratie in einer noch schlechteren Verfassung und auf einem noch niedrigeren Niveau als Ende der achtziger Jahre zurückgelassen.
Deshalb greife ich den damaligen Befund von Dahrendorf über die Sozialdemokratie auf, so misslich und unerwünscht er für einen Sozialdemokraten auch sein mag: «Eine säkulare politische Kraft hat sich erschöpft. Wichtige Teile des Programms sind realisiert; die sozialen Gruppen, die sie trugen, finden sich damit in neuen Interessenlagen. Die Vertreter dieser politischen Kraft sind auch erschöpft. Es bleibt ihnen nur, auf verbleibende Unvollkommenheiten der von Ihnen geschaffenen Welt hinzuweisen und im Übrigen das Erreichte zu verteidigen. Beides ruft nicht gerade Begeisterungsstürme hervor; es reicht noch nicht einmal, um regierungsfähige Wählermehrheiten zu gewinnen. Das ist das Elend der Sozialdemokratie.»
Diese Sätze hallen aus dem Jahr 1987 in unsere Zeit herüber. Und sind mir Anlass genug, mich mit der Frage zu beschäftigen, wie diesem Elend ein Ende bereitet werden kann.
Das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 beschreibt eine Zäsur und eröffnet ein neues parlamentarisches Kapitel, war aber im Grunde keine Überraschung. Nicht einmal zwei von zehn wahlberechtigten Bürgern haben die SPD gewählt. Das ist für eine Volkspartei nicht weniger als ein Desaster.
Das Wahlergebnis ist eine Zäsur, weil mit der AfD erstmals seit Gründung der Bundesrepublik eine rechtspopulistische Partei mit rassistischen und völkischen Ingredienzien im Bundestag Platz nimmt – als drittgrößte Fraktion, vertreten durch teilweise obskure Abgeordnete. Das ist übel angesichts der historischen Erfahrungen und Hypotheken unseres Landes aus dem 20. Jahrhundert. Aber es ist kein spezifisch deutsches Phänomen. Eine politische Konjunktur rechtspopulistischer oder rechtsradikaler Parteien beobachten wir in vielen europäischen Staaten. In 19 von 28 Mitgliedsstaaten der EU sitzt mindestens eine rechtspopulistische Partei im nationalen Parlament. Dagegen ist Deutschland eher ein Nachzügler. Immerhin haben 87 Prozent der Wähler und 91 Prozent aller Wahlberechtigten die AfD nicht gewählt. Das Wählerpozential des Front National in Frankreich ist dreimal so hoch wie das der AfD in Deutschland.
Der Wahlausgang ordnet die parlamentarische Landschaft neu, weil erstmals seit der ersten Legislaturperiode der jungen Bundesrepublik sechs Fraktionen im Bundestag sitzen. Tatsächlich sind es sieben Parteien, wobei CDU und CSU häufig mehr einer schlagenden Verbindung ähneln als einer Schwesternschaft. Die Aufblähung von 631 auf 709 Abgeordnete geht auf ein Versagen aller Fraktionen des letzten Bundestages (mit Ausnahme von CDU/CSU) zurück; sträflicherweise wollten SPD, Linke und Grüne einem Vorschlag des damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert mit einer Kappungsgrenze der Überhangmandate bei 630 Abgeordneten nicht folgen. Jetzt werden die Platzhalter auf den 709 Sitzen einer Reform des Wahlrechts noch stärker im Wege stehen.
Das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 brachte keine wirklichen Überraschungen. Relativ frühzeitig kristallisierte sich heraus, dass die große Koalition nicht belohnt werden würde. Abgesehen von den Verlusten der Union, die mit 8,6 Prozent größer waren als die Daumenpeilung vor Schließung der Wahllokale auswies, dem tiefen Einbruch der sonst so selbstgewissen CSU in Bayern und einem leicht besseren Abschneiden der Grünen konnte man mit Wahlwetten nicht viel gewinnen.
Mag sein, dass die Union vor Turbulenzen steht, die den einen oder anderen vom Deck fegen und deren Auswirkungen noch nicht absehbar sind. Mag sein, dass Angela Merkel angezählt ist («Wir haben uns ein wenig ein besseres Ergebnis erhofft») und ihren Zenit mit dieser Bundestagswahl überschritten hat. Mag sein, dass ihr moderierender Politikstil auch auf der europäischen Bühne von dem dynamischen Stil des neuen Impulsgebers aus Frankreich überstrahlt wird. Mag sein, dass Angela Merkel im Laufe der neuen Legislaturperiode zurücktritt, weil sie darauf Wert legt, den Schlüssel zum Kanzleramt zu einem selbst gewählten und nicht fremdbestimmten Zeitpunkt weiterzureichen – und das mit jener Selbstverständlichkeit, mit der sie sich von jeher vom Gebaren verletzter männlicher Eitelkeit und Selbsterhöhung zu unterscheiden sucht.
Aber all das sollte bei den Mitgliedern der SPD erstens keine Schadenfreude wecken, dass die bürgerlich-konservative Volkspartei in ihrem Spagat zwischen Willkommenskultur und Sicherheitsverlangen der Bürger ebenfalls tief nach unten gerauscht ist. Auch nach dem ernüchternden Wahlergebnis verfügen CDU/CSU auf jeder Ebene der Alters-, Sozial- und Regionalstruktur (mit Ausnahmen in Sachsen) über den größten Wähleranteil und besetzen unangefochten die Schlüsselstellung für jedwede Regierungsbildung.
Zweitens birgt all das keinerlei Trost für die SPD. Der Erfolg bei der niedersächsischen Landtagswahl war ein wohltuendes Pflaster und hätte Stephan Weil eine Fahrkarte in die Parteispitze sichern müssen. Am Befund, dass das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 ein Desaster für die SPD war, änderte das Niedersachsenergebnis aber nichts. Sie hat nicht nur krachend die dritte Bundestagswahl in Folge verloren, wenn man die Niederlage unter Gerhard Schröder 2005 im Fotofinish nicht mitzählt. Ihr sind seit dem Wahlsieg 1998 auch über zehn Millionen Wähler von der Fahne gegangen. Bei den Zweitstimmen liegt sie – trotz des Einbruchs von CDU/CSU – mit 5,8 Millionen Wählern im Rückstand zur Union. Tatsächlich nähert sich die SPD der Gewichtsklasse der vier kleineren Parteien.
Die Niederlage ist komplett. Die SPD hat ausnahmslos in allen Regionen, in allen sozialen Schichten oder Milieus und in allen Altersklassen verloren. Von Bremen abgesehen, ist sie in keinem der 16 Bundesländer noch stärkste Partei. In acht Bundesländern fiel sie teils deutlich unter 18 Prozent, was in den eigenen Reihen bisher kaum zur Kenntnis genommen wurde. Zu diesen Ländern zählen Bayern und Baden-Württemberg sowie Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, wo insgesamt rund 40 Prozent aller Wahlberechtigten wohnen. Wie will die SPD dann bundesweit je wieder auch nur in die Nähe von 30 Prozent kommen? In vier Ländern wurde sie hinter der AfD und der Linkspartei nur noch vierte (!) Kraft. Von insgesamt 299 Wahlkreisen gewann sie lediglich 59 direkt, in sechs Bundesländern keinen einzigen und in drei Bundesländern nur einen. Auch die Herzkammer der Sozialdemokratie, das Ruhrgebiet, pumpt nicht mehr genug, um die Ausfälle in der Diaspora des Südens und Ostens auszugleichen. Im Ruhrgebiet, wo sie 1998 mit Gerhard Schröder noch 47 Prozent erzielte, fiel sie auf 30,5 Prozent. Bei den unter 30jährigen konnte die SPD nur 19 Prozent aller Wahlberechtigten überzeugen. Fast 22 Prozent der Wähler – also mehr als die SPD für sich gewinnen konnte – haben die Parteien am Rand, AfD und Linkspartei, gewählt, weil sie sich dort offenbar besser verstanden fühlten. 500.000 frühere SPD-Wähler wanderten zur AfD und 700.000 zur Linkspartei, die wiederum – was allerdings weitgehend unbemerkt blieb – mit 420.000 Wählern proportional am meisten von allen Parteien an die AfD verlor.
Das Wort Krise verharmlost, um was es hier geht. Es suggeriert einen vorübergehenden Infekt, der irgendwann abklingt, ein momentanes Formtief, das mit einem schnellen Trainerwechsel ausgebügelt werden kann. Die SPD steht jedoch vor der existenziellen Herausforderung, sich als tragender und treibender politischer Machtfaktor zu behaupten. Die Lage ist nicht ganz so bedrohlich wie 1878 nach dem «Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie» unter Bismarck oder 1933 nach dem «Ermächtigungsgesetz» und dem offiziellen Parteienverbot oder nach der Zwangsvereinigung der OstSPD mit der KPD im Frühjahr 1946, aber ernst genug. Plötzlich taucht auch der Satz von Herbert Wehner wieder auf, der nach dem Machtwechsel im Oktober 1982 auf die Frage, wie lange es wohl dauere, bis die SPD wieder an die Regierung käme, antwortete: «Wenn Sie nicht erschrecken, sage ich Ihnen, es kann fünfzehn Jahre dauern.» Es wurden 16 Jahre.
Nirgends ist in Stein gemeißelt, dass die SPD aufgrund ihrer über 150jährigen Geschichte mit unbestreitbaren Verdiensten für Demokratie, Freiheit, Aufklärung und Friedensstiftung ein mitbestimmender und ausgleichender Faktor in Deutschland und Europa bleiben muss. Das wäre zwar im Sinne einer lebendigen parlamentarischen Demokratie und für die Stabilität unserer Gesellschaft überaus wünschenswert. Aber gewährleistet ist dies angesichts der fortschreitenden Erosion der Parteienlandschaft keineswegs.
Das zeigen viele Bespiele anderer Mitte-Links-Parteien in Europa. In Frankreich ist der Kandidat der Parti Socialiste (PS) im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl Ende April 2017 mit 6,4 Prozent nach Hause geschickt worden, wenige Wochen später kam die Partei bei der Wahl zur Nationalversammlung auf traurige 5,7 Prozent. In den Niederlanden erreichte die Partij van de Arbeid (PvdA) bei der Parlamentswahl im März 2017 lediglich 5,7 Prozent und ist nur noch mit neun Abgeordneten in der Zweiten Kammer vertreten. In Österreich hielt sich die SPÖ bei der Parlamentswahl, musste aber für eine rechtspopulistische Regierung die Bänke räumen. In Italien ist die frühere sozialistische Partei gänzlich von der Bühne verschwunden und in der Demokratischen Partei von Matteo Renzi aufgegangen, oder besser, zu einem Zwitter mutiert. In Griechenland sackte die PASOK bei der Parlamentswahl 2015 auf 6,3 Prozent. In Spanien hat die einst stolze PSOE von Felipe Gonzáles bei der Parlamentswahl im Juni 2016 mit 22,6 Prozent nur wenig besser abgeschnitten als die SPD. Und selbst in den skandinavischen Ländern hat die einst dominante Sozialdemokratie Federn lassen müssen. Die einzige Ausnahme scheint die Labour Party in Großbritannien unter Jeremy Corbyn zu sein, was darauf zurückzuführen sein mag, dass die Briten schon immer zu exzentrischen Anwandlungen neigten (zu den genaueren Ursachen vgl. Kapitel VI).
Die Rückbesinnung auf ihre Mythen und historischen Verdienste sowie das Hohelied auf ihre Grundwerte, mit denen sich auf Parteitagen wie auf Knopfdruck Beifall wecken lässt, werden der SPD bei der Inventur ihrer Niederlagen seit 2009 ebenso wenig helfen wie eine Art Untersuchungsausschuss über die Fehler und Fehleinschätzungen ihres Spitzenpersonals (die es gegeben hat, mich eingeschlossen). Die Wahlniederlage vornehmlich auf den Spitzenkandidaten abzuladen, ist natürlich die leichteste Übung. Und da der Sündenbock kein Herdentier ist, wären alle anderen aus dem Schneider. Das Nervensystem der Partei müsste nicht mit Richtungsfragen gereizt werden. Die Echokammern blieben geschlossen. Alle Landesverbände könnten in ihren Hamsterrädern weiterlaufen.
Der Sinkflug der SPD hat jedoch mit tiefer liegenden Problemen zu tun. Entsprechende Hinweise hat es gegeben. Nur prallten sie bisher an einer Wand aus Selbsthypnose, Geschäftigkeit und Gesinnungstreue ab. Das wird im Schatten des jüngsten Wahlergebnisses so nicht weitergehen können. Der Fehler, nach den Niederlagen 2009 und 2013 nicht gründlicher nach den Ursachen geforscht zu haben, wird sich nicht wiederholen dürfen.