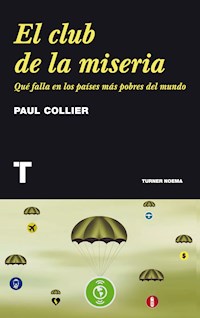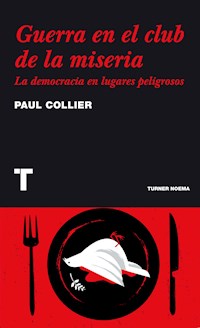22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie der radikale Individualismus unsere Gesellschaft zerreißt - und wie die Politik dagegensteuern kann
Warum werden die demokratischen Gesellschaften der westlichen Welt in ihrem Kern immer weiter ausgehöhlt? Wie war es möglich, dass unter dem Firnis der Demokratie Extremismus und Populismus gedeihen? Die beiden weltweit renommierten britischen Ökonomen Paul Collier und John Kay zeigen in ihrem leidenschaftlichen Debattenbuch, wie der Ethos des extremen Individualismus unser Gemeinwesen zerrüttet – nicht nur durch das noch immer vorherrschende Ideal kapitalistischer Gewinnmaximierung und das Trugbild des Homo Oeconomicus, sondern vor allem durch die permanente Ausweitung individueller Rechte zulasten des Gemeinwohls. Sie führen vor, wohin die Gier des Einzelnen führen kann - und was politisch geschehen muss, um das Auseinanderbrechen der Gesellschaft zu verhindern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wie der radikale Individualismus unsere Gesellschaft zerreißt und wie die Politik dagegensteuern kann
Warum werden die demokratischen Gesellschaften der westlichen Welt in ihrem Kern immer weiter ausgehöhlt? Wie war es möglich, dass unter der Oberfläche scheinbar gefestigter demokratischer Verhältnisse Extremismus und Populismus gedeihen? Die beiden weltweit renommierten britischen Ökonomen Paul Collier und John Kay zeigen in ihrem leidenschaftlichen Debattenbuch, wie das Ethos des extremen Individualismus unser Gemeinwesen zerrüttet – nicht nur durch das noch immer vorherrschende Ideal kapitalistischer Gewinnmaximierung und das Trugbild des Homo oeconomicus, sondern vor allem durch die permanente Ausweitung individueller Rechte zulasten des Gemeinwohls. Sie führen vor, wohin die Gier des Einzelnen führen kann – und was politisch geschehen muss, um das Auseinanderbrechen der Gesellschaft zu verhindern.
John Kay, geboren 1948 in Edinburgh, ist einer der führenden Wirtschaftswissenschaftler Großbritanniens. Er lehrte an der London Business School, der Universität Oxford und der London School of Economics. Er ist Mitglied mehrerer Thinktanks, berät die schottische Regierung in Wirtschaftsfragen und schreibt eine regelmäßige Kolumne in der Financial Times.
Paul Collier, geboren 1949 in Sheffield, ist einer der wichtigsten Wirtschaftswissenschaftler der Gegenwart. Er war Leiter der Forschungsabteilung der Weltbank und lehrt als Professor für Ökonomie an der Universität Oxford. Seit vielen Jahren forscht er über die ärmsten Länder der Erde und untersucht den Zusammenhang zwischen Armut, Kriegen und Migration. Sein Buch Die unterste Milliarde (2008) sorgte international für große Aufmerksamkeit und wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Lionel Gelber Prize und der Corine. Im Siedler Verlag erschienen außerdem Gefährliche Wahl (2009), Der hungrige Planet (2011), Exodus (2014) – eines der wichtigsten Bücher zur Migrationsfrage – sowie Gestrandet (2017, mit Alexander Betts). Paul Collier hat sich kritisch zur Rolle Angela Merkels in der Flüchtlingskrise geäußert und zählt zu den wichtigsten politischen Beratern der aktuellen Bundesregierung. Sein Buch Sozialer Kapitalismus! wurde 2019 mit dem Deutschen Wirtschaftsbuchpreis ausgezeichnet.
Besuchen Sie uns auf www.siedler-verlag.de
Paul Collier und John Kay
Das Ende der Gier
Wie der Individualismus unsere Gesellschaft zerreißt und warum die Politik wieder dem Zusammenhalt dienen muss
Aus dem Englischen von Thorsten Schmidt
Die Originalausgabe erschien 2020unter dem Titel Greed is Dead.Politics After Individualismbei Allen Lane.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Paul Collier and John Kay
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by Siedler Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Fabian Bergmann
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-28204-2V001
www.siedler-verlag.de
Inhalt
Vorwort zur deutschen Ausgabe: Warum jetzt?
1 Was geht hier vor?
Teil I Der Triumph des Individualismus
2 Ökonomischer Individualismus
3 Rechte
4 Von Bürgerrechten zum Ausdruck der eigenen Identität
Teil II Der Staat: Krisensymptome
5 Aufstieg und Fall von Vater Staat
6 Umbrüche in der Parteienlandschaft
7 Wie Labour die Unterstützung der Arbeiter verlor
Teil III Gemeinschaft
8 Der Mensch als Gemeinschaftswesen
9 Kommunitaristische Governance
10 Kommunitaristische Politik
11 Kommunitarismus, Märkte und Unternehmen
12 Ortsgebundene Gemeinschaften
Nachwort: Schutz vor dem Sturm
Danksagung
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Bibliografie
Register
Zum Gedenken an unseren Freund Peter Sinclair, Wirtschaftswissenschaftler und Gentleman, der an COVID-19 verstarb. Wir hoffen, dass ihm dieses Buch gefallen hätte.
»Wir lieben die Kunst mit maßvoller Zurückhaltung, wir lieben den Geist ohne schlaffe Trägheit; Reichtum dient uns der rechten Tat, nicht dem prunkenden Wort, und seine Armut einzugestehen ist für niemanden schmählich, ihr nicht zu entrinnen durch eigene Arbeit (gilt als) schmählicher. Mit derselben Sorgfalt widmen wir uns dem Haus- wie dem Staatswesen, und ist auch jeder von uns seinen eigenen Arbeiten zugewandt, so zeigt er doch im staatlichen Leben ein gesundes Urteil. Einzig und allein bei uns heißt doch jemand, der nicht daran teilnimmt, nicht untätig, sondern unnütz, und nur wir entscheiden in Staatsgeschäften selber oder denken sie doch richtig durch, denn nicht schaden nach unserer Meinung Worte den Taten, sondern vielmehr, sich nicht durch das Wort vorher belehren zu lassen, ehe man an die nötige Tat herangeht. Aber auch dadurch zeichnen wir uns aus, dass wir kühnen Mut und kluge Überlegung bei allem, was wir anfassen, in uns vereinen.«
»Gefallenenrede des Perikles«, wie sie von Thukydides – wobei unklar ist, ob er sie wiedergibt oder selbst verfasste – in seinem Werk Der Peloponnesische Krieg überliefert wurde, Athen, um 430 v. Chr. (Thuk. II, 40, hier zitiert in der Übersetzung von H. Vretska und W. Rinner).
Vorwort zur deutschen Ausgabe:Warum jetzt?
Wir planten Das Ende der Gier, kurz bevor Europa von SARS-CoV-2 heimgesucht wurde; und jetzt, wo sich in Europa eine gewisse Entspannung bei der durch das neue Coronavirus verursachten Pandemie zeigt, nutzen wir die Gelegenheit der deutschen Ausgabe, um in diesem Vorwort unsere Analyse auf den neuesten Stand zu bringen.
Wir beschlossen, dieses Buch gemeinsam zu verfassen, weil wir erkannten, dass zwei Themen aus unseren jeweiligen Fachgebieten eng miteinander verwoben sind. Paul hatte gerade Sozialer Kapitalismus! geschrieben – eine Antwort auf die größer werdenden Spaltungen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt untergraben hatten. Und John hatte soeben zusammen mit Mervyn King Radical Uncertainty (Radikale Ungewissheit) geschrieben, in dem sie sich gegen die Vorstellung wandten, Ungewissheit lasse sich immer probabilistisch beschreiben. Die überzogene Modellgläubigkeit, die aus dieser Überzeugung hervorging, trug direkt zur Weltfinanzkrise von 2008 bei und fördert nach wie vor die Selbstüberschätzung von Politikern und Wirtschaftskapitänen. Der Aufstieg des Individualismus hat die Fähigkeit der Mitglieder einer Gesellschaft geschwächt, gemeinsam auf bestimmte Ziele hinzuarbeiten. Und beide Aspekte wirkten aufeinander ein: Führungskräfte glaubten, sie wüssten, was zu tun sei, misstrauten aber zugleich Menschen, die ihres Erachtens zu egoistisch waren, um gut zusammenzuarbeiten. Allzu oft setzten sie deshalb auf Anreize, die mit genauer Überprüfung verbunden waren. Es zeigte sich, dass diese beiden Themen, die eine Zusammenarbeit zwischen uns nahelegten, wichtig waren, um die Auswirkungen des Virus und die politischen Reaktionen darauf zu verstehen.
Was haben wir alle aus der Pandemie gelernt?
Die Staaten und Gesellschaften Europas und Nordamerikas weisen im Vergleich zu denen auf anderen Kontinenten alle ein hohes Maß an Ähnlichkeit auf, aber die Reaktionen auf den durch das Virus ausgelösten Schock und deren Ergebnisse fielen bemerkenswert unterschiedlich aus. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt – achtzehn Monate nachdem SARS-CoV-2 international Schlagzeilen zu schreiben begann – haben Großbritannien, die Vereinigten Staaten und Frankreich einige der höchsten Sterblichkeitsraten weltweit, während Dänemark und Finnland mit die niedrigsten haben. Vom Beginn der Pandemie bis jetzt entwickelten sich die Sterblichkeitsraten auch mit erstaunlichen Unterschieden. Deutschland hatte in dieser Hinsicht einen guten Start, die Zahlen verschlechterten sich dann allerdings; Großbritannien und die USA erwischten einen schlechten Start, die Raten verbesserten sich mit der Zeit aber. Dänemark und Finnland hatten eine gleichbleibend niedrige Mortalität, während es in Frankreich durchgehend eine recht hohe Sterblichkeit gab. Wie lässt sich das erklären?
Es ist wichtig, glaubwürdige Antworten auf diese Frage zu geben. Man sollte nicht einfach Politiker und Politikerinnen für Fehler verantwortlich machen; eine solche Situation hatte es noch nie gegeben, und Fehler waren unvermeidlich. Vielmehr geht es darum, die Folgen zu verstehen, nicht nur um in Zukunft besser für Pandemien gewappnet zu sein, sondern auch für unser Verständnis politischer, sozialer und wirtschaftlicher Angelegenheiten.
Wir kennen die Epidemiologie von SARS-CoV-2 und COVID-19 nicht – niemand kennt sie. Es gibt Epidemiolog_innen, die für sich beanspruchen, eine Vielzahl an gesicherten Erkenntnissen zu besitzen – grundsätzlich sind ihre Modelle in der Lage, eindeutige Vorhersagen zu machen. Aber ihre Modelle stimmen nicht überein. Derartige Modelle können lediglich die Schlüsselparameter identifizieren – die Anzahl derer, die jede infizierte Person ihrerseits ansteckt, und der Prozentsatz der Infizierten, die einen schweren Krankheitsverlauf haben. Aber zu Beginn der Pandemie kannten wir nicht einmal näherungsweise die Größe dieser Parameter. Wir konnten ihre sich ändernden Werte nur nachträglich erschließen. Hier zeigt sich sowohl der Nutzen als auch die Begrenztheit von Modellen, wenn die Politik mit radikaler Ungewissheit konfrontiert ist.
Im Oktober 2019 veröffentlichte die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore die Ergebnisse einer dreijährigen Studie über die relative Fähigkeit verschiedener Länder, Pandemien zu bewältigen. Ihr zufolge waren die drei am besten gewappneten Länder die Vereinigten Staaten, Großbritannien und die Niederlande. Als sich das Virus dann ausbreitete, waren diese drei in der Frühphase der Pandemie jedoch keineswegs gut gerüstet, sondern zählten vielmehr zu den am schwersten betroffenen Ländern. Es stellte sich heraus, dass soziale und politische Faktoren, die die Reaktionen auf die Ausbreitung des Virus beeinflussten, ein viel größeres Gewicht hatten als die technischen und objektiven Faktoren, die die Johns-Hopkins-Forscher quantifiziert hatten. Die Sterblichkeitsrate bei der COVID-Erkrankung ist altersspezifisch, sodass das Befolgen von Abstandsregeln und die Annahme von Impfangeboten den Mitmenschen oft mehr hilft als einem selbst. Die Folgen von Unterschieden in der relativen Macht des Staates, beim Einfluss von Kultur und Werten und beim Gemeinschaftssinn im Vergleich zu individualistischen Einstellungen betreffen überall auf der Welt den Kern der Probleme, die in diesem Buch erörtert werden.
Die sehr unterschiedlichen Auswirkungen von politischen Maßnahmen und Verhaltensänderungen in verschiedenen Ländern sind bereits hinreichend dokumentiert, sodass man erste Fragen stellen und Hypothesen vorschlagen kann. Die Erfolge der Reaktionen sind in hohem Maße davon abhängig, ob eine Gesellschaft eher gemeinschaftsorientiert oder individualistisch und ob die Regierung dezentralisiert oder zentralisiert ist.
In Übereinstimmung mit der Argumentation in Das Ende der Gier hatten Länder mit stärkerem Zusammenhalt und dezentraler Regierung wie etwa Deutschland, die Schweiz, Dänemark und Finnland anfangs eine viel niedrigere Sterblichkeit als hochindividualistische Länder wie die USA oder stark zentralistische wie Großbritannien und Frankreich. Deutschland hatte frühzeitig eine erfolgreiche Teststrategie, in die zahlreiche Labore eingebunden waren; Großbritannien und die Vereinigten Staaten, die versuchten, die Tests zentral zu steuern, zahlten einen hohen Preis dafür.
Aber damit die anfänglich niedrige Sterblichkeit langfristig Bestand hatte, musste der gesellschaftliche Zusammenhalt durch eine politische Führung gestärkt werden, die Vertrauen bewahrte sowie die Menschen für eine sich rasch verändernde Situation sensibilisierte. Und damit die Sterblichkeit von einem hohen Ausgangsniveau zurückging, mussten Regierungen zügig dazulernen, und dieser Prozess schwankte systematisch in Abhängigkeit davon, ob sie die beiden Kernprinzipien für die Bewältigung von Ungewissheit beherzigten: dezentrale Experimente und Modularität, in diesem Fall also ein Handeln nach einer Art »Baukastenprinzip«, bei dem die für eine erfolgreiche Pandemiebekämpfung geeignetsten Elemente miteinander verbunden werden. In einigen Ländern, insbesondere in Dänemark und Finnland, zeigten sich die Regierenden der Herausforderung, das Vertrauen der Bevölkerung zu bewahren, gewachsen, und es gelang ihnen, die veränderte Situation zu bewältigen, indem sie zu sozialem Zusammenhalt und Solidarität aufriefen.
Das beste Maß für die gesundheitlichen Auswirkungen der Coronapandemie ist vermutlich die sogenannte Übersterblichkeit – wie viele Menschen mehr sind gestorben, als in einem »normalen« Jahr zu erwarten gewesen wäre. Dieser Indikator berücksichtigt die Tatsache, dass Ältere und Vorerkrankte, die das Gros der COVID-Todesfälle ausmachen, möglicherweise mit COVID, aber nicht an COVID verstarben, und er berücksichtigt auch die menschlichen Tragödien, bei denen Krebserkrankungen nicht diagnostiziert oder Schlaganfälle nicht behandelt wurden, weil die Krankenhäuser überlastet waren oder die Angst vor COVID oder ein verfehltes Solidaritätsgefühl die Betroffenen davon abhielten, rechtzeitig ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Übersterblichkeit berücksichtigt selbstverständlich nicht die übrigen sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Krankheit und der Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung: die geschlossenen Veranstaltungsorte; die Unternehmen, die dichtmachten beziehungsweise einen Teil ihrer Kapazitäten stilllegten; die verlorenen Schultage.
Einige Länder meldeten keine oder zumindest keine nennenswerte Übersterblichkeit. Obgleich sich der Ursprung des Virus in China findet, liegen die meisten dieser Länder in Asien und Australasien. All diese Staaten schränkten die inländische und grenzüberschreitende Bewegungsfreiheit ihrer Bürger_innen drastisch ein und führten Systeme ein, um die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Taiwan, Südkorea und Singapur machten sich dabei mit guten Erfolgen die technologische Effizienz eines starken Staates und die Werte von Gesellschaften zunutze, die Familie und Gemeinschaft über das Individuum stellen. Australien und Neuseeland profitierten von der Leichtigkeit, mit der sie ihre Grenzen kontrollieren konnten – Neuseeland blieb fast gänzlich von dem Virus verschont.
Auch die nordischen Länder verzeichneten nur wenige COVID-Todesfälle; bei den dort verhängten Lockdowns profitierte man von dem hohen sozialen Zusammenhalt. Schweden, wo der Bevölkerung nur wenige Beschränkungen auferlegt wurden, hatte zwar eine viel höhere Sterblichkeit als seine skandinavischen Nachbarn, dafür waren die wirtschaftlichen Folgen weniger gravierend als in den meisten anderen europäischen Ländern. Es scheint, dass Dänemark die richtige Balance gefunden hat: mit staatlichen Maßnahmen, die hinreichend streng waren, um den Bürgerinnen und Bürgern klarzumachen, wie wichtig es ist, sich verantwortungsvoll zu verhalten, um ein neues gemeinsames Ziel zu erreichen.
Mithin zeigten sich sehr unterschiedliche Führungsstile. Das totalitäre China, wo der Ausbruch begann, scheint die Ausbreitung des Virus relativ zügig unter Kontrolle gebracht zu haben. Schwedens politische Führung hielt sich im Hintergrund und verließ sich darauf, dass die Wissenschaft die zu ergreifenden Maßnahmen festlegte und der Bevölkerung erklärte, während die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern ein feines Gespür für die öffentliche Stimmung zeigte und die wechselseitige Verantwortung der Menschen füreinander betonte – »wir sind ein Team von fünf Millionen« –, sodass ihre Regierung die öffentliche Meinung für radikale Maßnahmen gewinnen konnte. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán ergriff die Gelegenheit, um sich unbegrenzte Machtbefugnisse zu sichern, aber das Virus bot ihm die Stirn, auch wenn die heimische Presse dies nicht tun konnte.
Die Länder, in denen das Virus die schlimmsten Auswirkungen hatte, waren Indien und lateinamerikanische Staaten. Europa und Nordamerika waren ebenfalls stark betroffen, aber hier gab es ein breites Spektrum an Reaktionen und Erfahrungen. Mitte 2020 führte die Forschungsgruppe More in Common eine internationale Umfrage über die öffentliche Reaktion auf die Ereignisse durch.1 Die meisten Befragten antworteten, sie hätten sich an die Coronaregeln gehalten – und andere hätten dies ebenfalls getan. Auch sagten sie, ein Aspekt gemeinschaftsbezogenen Verhaltens – die Sorge um das Wohl anderer – habe zu-, ein weiterer – ihr Vertrauen in ihre Mitbürger_innen – aber abgenommen. Die Spaltung in ihren Ländern sei stärker geworden. Das trifft zweifellos auf Frankreich zu: Die meisten Franzosen glaubten, sie selbst hätten die Beschränkungen im Allgemeinen befolgt, die meisten ihrer Mitbürger_innen dagegen nicht.
Die Vereinigten Staaten waren in praktisch jeder Beziehung ein Sonderfall. In der Erhebung waren sie das einzige Land, in dem die Befragten nicht der Ansicht waren, die Sorge um das Wohl anderer habe zugenommen, und ihr Vertrauen in das Gesundheitssystem hatte – ebenso wie in Frankreich – ab- und nicht etwa zugenommen. Jedes Alltagsproblem schien parteipolitisch aufgeladen zu sein. Selbst bei einer banalen Frage wie »Würden Sie sich wohlfühlen, während der Pandemie zum Friseur zu gehen?« waren die Ansichten dementsprechend polarisiert: 72 Prozent der Republikaner antworteten mit »ja«, aber nur 37 Prozent der Demokraten.2 Bei gleichem medizinischen Informationsstand öffneten republikanische Gouverneure ihre Bundesstaaten und Schulen, während demokratische in den ihren einen Lockdown verhängten.
Die Bewältigung der Pandemie erfordert eine paradoxe Kombination von sozialer Distanzierung und sozialer Solidarität. Wir müssen Abstand wahren, um das Virus nicht zu verbreiten; wir müssen zusammenkommen, um mit seinen Folgen fertigzuwerden. Man beraubt uns der Gelegenheiten, unseren Freund_innen und Verwandten beizustehen oder unseren Kolleg_innen bei der Arbeit zu helfen; aber wir bieten uns freiwillig an, Lebensmittel auszufahren, und beklatschen Pflegekräfte. In diesem Buch betonen wir, wie wichtig und notwendig Solidarität auch in weniger aufgewühlten Zeiten ist. In dem Maße, wie fortschreitende Impfkampagnen die Gesellschaften von den COVID-Ängsten befreien, haben wir Grund zum Optimismus, dass eine solche Solidarität erneuert werden kann. Die Pandemie hat uns auf eindringliche Weise vor Augen geführt, wie wichtig Gemeinschaft ist.
Die neuen Kulturkriege
Die politischen Differenzen in Europa und Amerika basieren nicht auf abweichendem Kenntnisstand und unterschiedlichen Interpretationen von Informationen, sondern auf tiefgreifenden neuen kulturellen Konflikten. In den USA erreichten sie im Januar 2021 einen Höhepunkt. Hätten die verantwortlichen Politiker_innen die Coronastrategie ihrer jeweiligen Gegenspieler übernommen, dann hätten Republikaner und Demokraten vielleicht ihre Haltung zu Friseurbesuchen ebenfalls einfach ausgetauscht. Rund um die Welt erschienen in Zeitungen und sozialen Medien spektakuläre Fotos. Ein Mann spazierte in einem Star-Wars-Kostüm und mit Wikingerhörnern durch das Kapitol in Washington; ein anderer trug eine Konföderiertenflagge; ein weiterer saß im Büro von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, und hatte einen Fuß auf ihren Schreibtisch gelegt. Die Randalierer nahmen sich selbst auf Video auf und verbreiteten das Filmmaterial weltweit. Das Ereignis war ein Beispiel par excellence für den expressiven Individualismus, den wir in diesem Buch kritisieren, die Verklärung des Selbst in der vermeintlichen Unterstützung eines politischen Anliegens.
Aber der expressive Individualismus ist nicht nur für die Alternative Rechte in den USA bezeichnend, sondern auch für die progressive Linke, wie diese lächerliche Begebenheit aus Großbritannien verdeutlicht:
Als J und sein Team den Mast aufrichteten, ertönte lauter Jubel quer über den Oxford Circus. J sagte dazu: »Dieser Jubel machte mich so euphorisch, wie ich es nur selten erlebt habe« … Mit DJs an Deck, Seepocken, die den Kiel überzogen, und einem Meer von Rebellen, die tanzten, Flugblätter verteilten und rings um den Schiffsrumpf Reden hielten, verkörperte das Boot das gesamte XR-[Extinction Rebellion]-Ökosystem in einer wogenden, fröhlichen und lebenden Einheit.3
»J« war ein Anführer einer Gruppe von Klimaaktivist_innen, und der Mast gehörte zu einem rosafarbenen Boot, das sie im Zentrum von London platzierten und das den Verkehr in der City mehrere Tage lang erheblich behinderte.
Wenn die Organisatoren des Ereignisses es darauf angelegt haben sollten, einen Kulturkrieg zu entfachen, hatten sie Erfolg. Innenministerin Priti Patel fand scharfe Worte: »Diesen Kriminellen, die unsere freie Gesellschaft sabotieren, muss Einhalt geboten werden. Zusammen müssen wir uns alle entschlossen gegen die Guerillataktiken der Extinction Rebellion zur Wehr setzen.«4 Erwartungsgemäß drehte Patel mit ihrer Überreaktion nur weiter an der Eskalationsspirale: Protestierende, die »Weg mit dem Gesetz!« skandierten, blockierten Straßen und brachten so ihren Widerstand gegen Patels Gesetzesvorhaben zum Ausdruck, das eine Ausweitung polizeilicher Befugnisse zur Verhinderung von Massenveranstaltungen vorsah. Der selbstgerechte Narzissmus von »Aktivist_innen« geht manchmal mit einer leichten Selbstverleugnung einher – auf den »Veganuary«, den »veganen Januar«, im Jahr 2021 folgte Toni Petersson, der CEO des schwedischen Hafermilchherstellers Oatly, der in einem Werbevideo in der Pause des Superbowls mitten in einem Getreidefeld »wow, wow, no cow« sang –, allerdings ist rein symbolisches Signalisieren von Tugendhaftigkeit zu einem Anlass echter Sorge an Universitäten geworden.
John begann sein Studium der Wirtschaftswissenschaften im David Hume Tower. Das hässlichste Gebäude der Universität Edinburgh wurde nach ihrem bekanntesten Absolventen benannt, dem Philosophen und Freund von Adam Smith, der maßgeblich mitgeholfen hat, im 18. Jahrhundert die Grundlagen des modernen gesellschaftsphilosophischen und politischen Denkens zu legen. Aber den David Hume Tower gibt es nicht mehr; sämtliche Hinweise auf Hume wurden getilgt. Nicht weil er von den Toten auferstanden wäre, um gegen die Zerstörung des prächtigen George Square zu protestieren, eines steinernen Zeugnisses der schottischen Aufklärung, das einem brutalistischen Gebäude hatte weichen müssen, das dann seinen Namen trug. Nein, das Problem ist Humes Rassenbegriff. In einer Fußnote in einem Werk aus dem Jahr 1753 hatte er geschrieben: »Ich bin geneigt, es für möglich zu halten, dass [N-Wort] den Weißen von Natur aus unterlegen sind.« Wie der führende Historiker der Universität darlegte, war diese Auffassung, von der wir heute wissen, dass sie falsch ist, im 18. Jahrhundert weitverbreitet.5
Sogar Smith selbst droht die Streichung; in seinem Opus magnum beschreibt er die Sklaverei als »allgegenwärtig und unausweichlich«, wenn auch »wohl weniger einträglich als freie Arbeit«. Nicht gerade eine begeisterte Befürwortung der Sklavenhaltung, aber heutzutage ausreichend, um zu fordern, dass ein Ausschuss des Stadtrats von Edinburgh sich mit der Frage befassen solle, ob das öffentliche Gedenken an den Autor des Wohlstands der Nationen noch zeitgemäß sei.
Das gemeinsame Merkmal all dieser Aktivitäten ist die Tatsache, dass sie performativ sind – der Zweck des Protests ist der Protest und das Gefühl der Tugendhaftigkeit oder vielleicht auch schlichtweg der Spaß, den er jenen bereitet, die dabei mitmachen. Zwei Wochen nach dem Eindringen der Rechten auf dem Capitol Hill wurde Joe Biden trotzdem in sein Amt als Präsident eingeführt. Die Polizei schaffte das rosafarbene Boot aus der Londoner Innenstadt weg, und die Erde war kein bisschen kühler als zuvor. Und wenn die Universität Edinburgh David Hume nicht länger ihre Ehrerbietung erweist, mindert dies in keiner Weise den Rassismus der Polizei von Minneapolis. Nur das restriktive Gesetz von Innenministerin Patel bleibt bestehen.
Die Randalierer vom Capitol Hill und die Feiernden auf dem rosafarbenen Boot bilden jeweils eine Art von Gemeinschaft. Aber es handelt sich dabei nicht um die von uns in diesem Buch gelobten Gemeinschaften wechselseitiger Unterstützung, die durch den Austausch von Ideen und Wissen kollektive Intelligenz entwickeln. Es sind Gemeinschaften von Menschen, die sich ganz überwiegend nur mit ihresgleichen austauschen, sich so ihrer Wohlanständigkeit versichern und die moralische Überlegenheit ihrer gemeinsamen Identitäten zur Geltung bringen. Die daraus erwachsene Polarisierung zerstört die größeren Gemeinschaften, aus denen eine Gesellschaft mit starkem innerem Zusammenhalt aufgebaut ist. Die Kämpfer gegen den Sklavenhandel, denen im 19. Jahrhundert dessen Abschaffung gelang, schmiedeten eine Koalition, um ihr Anliegen voranzubringen; dem Mob, der im Vereinigten Königreich heute Statuen stürzt, ist es egal, dass er die breite Öffentlichkeit, die die britische Geschichte mit mehr Stolz als Beschämung betrachtet, vor den Kopf stößt.
Die neuen Kulturkriege werden nicht nur zwischen politischen Parteien, sondern auch in ihnen ausgetragen. Besonders heftig toben sie innerhalb sozialdemokratischer Parteien in Europa und ihrem Pendant in den USA. Sie bestehen heute aus einer langfristig nicht tragfähigen Koalition aus »Progressiven«, die demonstrativ ihre Tugendhaftigkeit zur Schau stellen, und ihrer traditionellen Basis in der Arbeiterschaft, deren Stimmen diesen Parteien erlaubten, während eines Großteils der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die europäische Politik zu dominieren. Diese Wählergruppe wird durch rosafarbene Boote und Kontroversen um Statuen eher abgestoßen. In Frankreich zum Beispiel ist die Parti socialiste nicht nur nicht mehr in der Regierung, sie ist nicht einmal mehr die wichtigste Oppositionspartei, und in Deutschland wackelt der alte Nimbus der SPD als »Volkspartei«. Aber auch der neue demokratische US-Präsident Biden sieht sich dem gleichen Problem gegenüber; die Integrität und die Kompetenz, die ihn so deutlich von seinem republikanischen Amtsvorgänger abheben, halfen ihm nur eine Zeit lang. Die »progressive« Linke seiner Partei ist sogar noch streitbarer als ihre europäischen Pendants und die Entfremdung ihrer traditionellen Arbeiterbasis von der Demokratischen Partei sogar noch extremer. Die britische Labour Party erlitt im Jahr 2019 eine vernichtende Niederlage, und ganz aktuell ist der ehedem sichere Labour-Wahlkreis im nordostenglischen Hartlepool bei einer Zwischenwahl an die Konservativen gefallen. Es geschieht äußerst selten, dass die Opposition bei Zwischenwahlen einen Sitz an die Regierungspartei verliert. Eine französische Präsidentin Le Pen ist nicht länger unvorstellbar.
Der Gipfel der Gier?
Aber wir sehen gute Gründe für Optimismus. Ungeachtet des geistlosen Gehabes von Aktivist_innen gibt es echte neue Ideen und wohldurchdachte Argumente, die kreative Denkanstöße liefern. Noch immer mangelt es nicht an Beispielen verwerflicher Gier. Aber nachdem der Egoismus vierzig Jahre lang auf dem Vormarsch war, werden die 2020er-Jahre vielleicht den »Gipfel der Gier« markieren. Von extremer Selbstbezogenheit kehren wir zurück zu stärkerer Gemeinschaftsorientierung. Dies sind keine Wunschträume; wie wir in diesem Buch zeigen, wendet sich das Blatt gerade.
Ein wackliges Denkgebäude lieferte die Rechtfertigung für den Aufstieg des Egoismus. Auf der politischen Rechten ging die Verherrlichung des Individualismus aus einer verfehlten Kehrtwende in den Wirtschaftswissenschaften hervor: einer Fehldeutung der Evolutionsbiologie, die die Bedeutung menschlicher Handlungsmotivationen herunterspielte und menschliches Wissen überbewertete. Die politische Linke, die lange Zeit die Idee der Solidarität hochgehalten hatte, begann nunmehr, ihre Argumente in Begriffen von Individualrechten zu formulieren – eine verfehlte Wende in der Moralphilosophie, die dazu führte, dass es zu einem regelrechten Wettbewerb im Beklagen von Benachteiligungen und Missständen im Namen neu entdeckter ewiger moralischer Wahrheiten kam. Auch wenn sie politisch nicht zusammenpassen, haben beide Ideen die Rolle der Gemeinschaft heruntergespielt und radikale Ungewissheit ignoriert. Die einzigen Akteure waren Individuen mit Rechten und der Staat mit Verpflichtungen; die Intelligentesten wüssten es am besten und sollten die Entscheidungen treffen. Das besagte wacklige Gebäude zerfällt heute sehr schnell. Das Ende der Gier ist nur ein kleiner Teil einer Revolution in den Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften, die die Gemeinschaft wieder in ihre zentrale Rolle als Keimzelle einer produktiven, prosperierenden Gesellschaft einsetzt. In unserem eigenen Fachgebiet, der Volkswirtschaftslehre, beginnen die wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, die ehrgeizigen jungen Führungskräften jahrzehntelang beibrachten, dass »Gier gut« sei, diese These zu hinterfragen.
In The Upswing beschreibt der Politikwissenschaftler Robert Putnam ebenso wie in Virtue Politics der Historiker James Hankins – beide Bücher erschienen 2020 – Wendepunkte, die seltenen Momente, in denen sich die Richtung des gesellschaftlichen Wandels umkehrt. Putnam führt sie auf die Verbindung einer intellektuellen Revolution mit einem tödlichen globalen Schock zurück, der den neuen Ideen Auftrieb gibt.
SARS-CoV-2 und COVID-19 mögen dazu beigetragen haben, dass wir einen dieser seltenen Momente erreicht haben. Die »intelligenten« Führungsverantwortlichen, die behaupteten zu wissen, was man gegen das Virus tun müsse, wurden gedemütigt: Es ist ein klassischer Fall von radikaler Ungewissheit. Und von Kommunitarismus: Es hat sich gezeigt, dass die erfolgreiche Eindämmung des Virus davon abhängt, ob die Mitglieder einer lokalen Gemeinschaft die Regeln zum Schutz ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger bereitwillig einhalten. Finnland kam vergleichsweise glimpflich durch die Coronakrise, weil die Bevölkerung Coronaempfehlungen freiwillig sehr diszipliniert befolgte; Nordkorea dagegen droht trotz der extremen staatlichen Zwangsmaßnahmen eine Hungersnot.
Deutschland hat massive Anstrengungen unternommen, um die Kluft zwischen Ost und West zu schließen. Aber in vielen anderen Gesellschaften ließen es die Politiker_innen einfach zu, dass globale ökonomische Kräfte tiefe wirtschaftliche Spaltungen zwischen boomenden Metropolen und abgehängten Städten in der Provinz erzeugten. Die Wut, die durch diese langjährige Vernachlässigung ausgelöst wurde, gestaltet die politische Landschaft um, und sogar in Deutschland sind Verwerfungen offenkundig, da ein Drittel der Ostdeutschen rechts- beziehungsweise linksextreme Parteien unterstützt.
In Großbritannien wird jetzt weithin anerkannt, dass es notwendig ist, die extreme Konzentration guter Stellen in London und die Entfremdung der Labour Party von der Arbeitnehmerschaft rückgängig zu machen. Da sich die Schere zwischen den Regionen und London auch und gerade unter Labour-Regierungen immer weiter öffnete, hängen die beiden Probleme eindeutig miteinander zusammen. Die Stimmen einer großstädtischen Elite hatten einen größeren Einfluss auf die Prioritäten von Labour als ihre traditionelle Basis.
Wir wissen, dass die jüngste Konzentration guter Arbeitsplätze in London vermeidbar war, und wir wissen auch, dass sie das nationale Wachstum nicht beschleunigt hat – wir müssen uns zu diesem Zweck nur Deutschland ansehen. Aber leider ist das Bemühen darum, diese Divergenz rückgängig zu machen, ebenfalls ein Beispiel für radikale Ungewissheit – wir wissen im Einzelnen nicht, wie wir dies erreichen können. Sehr wohl wissen wir jedoch, wie wir es nicht zustande bringen: Whitehall kann es nicht den Regionen vorgeben, so wenig wie es Berlin Leipzig vorschreiben könnte oder Paris Marseille. Nur eine kommunitaristische Politikgestaltung – ein gemeinsames Ziel, auf das sich eine Gemeinschaft verständigt hat und das sie geschlossen verfolgt – kann auf das kontextspezifische Wissen zurückgreifen, das notwendig ist, um durch Experimentieren zu lernen. Es ist kein Zufall, dass sich in dem Problem der regionalen Divergenz diese Prinzipien radikaler Ungewissheit und des Kommunitarismus widerspiegeln. Großbritannien steht vor einem gravierenden Problem der regionalen Divergenz, weil es das Land in der OECD mit den am stärksten überzentralisierten politischen und wirtschaftlichen Steuerungs- und Organisationsstrukturen ist. Die Gesellschaft wurde von allzu selbstsicheren, »smarten« Verantwortungsträgern in London geleitet, die sowohl die politischen Maßnahmen als auch die Verteilung der Finanzmittel festlegten. Die öffentlichen Ausgaben für eine breite Palette von Gütern, von der Infrastruktur und Forschung bis zu den Künsten, haben London massiv begünstigt. Auch private Finanzierungen für Unternehmen – sowohl Neugründungen als auch expandierende Mittelständler – sind extrem ungleich verteilt: Zwei Drittel des Wagniskapitals für Kleinunternehmen fließen nach London und in den Südosten, auf die nur ein Fünftel der Bevölkerung Großbritanniens entfällt. Wenn Menschen deshalb wütend sind, ist das voll und ganz gerechtfertigt.
Nachdem wir folgenschwere Krisen durchlebt haben, blicken wir endlich in einer Welt, die sich stark verändert hat, hoffnungsvoll in die Zukunft. Individueller Egoismus hat im Verein mit einer ihre Fähigkeiten überschätzenden Führung »von oben herab« unseren Gesellschaften schwer geschadet. Aber die Zukunft kann anders sein.
Deutschland tritt in die Ära nach Merkel ein. Die Bundeskanzlerin hat sich hervorragend auf kurzfristige taktische politische Kompromisse verstanden. Deshalb hielt sie sich so lange an der Macht. Aber einer langfristigen Strategie wich sie bewusst aus: Für sie war es das Wesen der Politik, die Herausforderungen des Moments zu bewältigen. Das funktionierte so lange recht gut, wie keine neuen strukturellen Belastungen auftraten. Aber die Welt ist heute voll davon. Wie die Frühphase der Coronapandemie zeigte, waren die dezentralen Entscheidungs- und Organisationsstrukturen die größte politische Stärke Deutschlands bei der Bekämpfung des Virus. Doch als die Pandemie voranschritt, versuchte Bundeskanzlerin Merkel wie etliche andere Regierungschefs, die Fäden der politischen Entscheidungsfindung im Bundeskanzleramt zu bündeln. Aber die Ära politischer Führungspersönlichkeiten, die alles selbst entscheiden wollen, ist vorbei: Die Deutschen werden eine neue Politik erfinden müssen, die auch die Belange der einfachen Arbeitnehmer_innen stärker berücksichtigt, auf deren Sorgen eingeht und allen eine aktive Rolle bei der Gestaltung ihrer gemeinsamen Zukunft gibt.
Es herrscht ein neues Verlangen danach, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, und die Einsicht, dass die Fülle der Ängste, die sich im Lauf der Zeit aufgrund von Vernachlässigung anhäuften, nur dadurch bewältigt werden kann, dass man zusammenkommt. Sie, die Leserinnen und Leser, können Teil des Veränderungsprozesses sein: Wir haben dieses Buch geschrieben, um Ihnen dabei zu helfen. Die deutsche Ausgabe von Greed is Dead erscheint in einem entscheidenden Moment.
1Was geht hier vor?
»Ich feiere mich selbst und singe mich selbst«
Walt Whitman, »Gesang von mir selbst«
Wir leben in Gesellschaften, die von Selbstsucht durchdrungen sind. Wie können wir dann vom »Ende der Gier« sprechen? Wir meinen damit Folgendes: Der extreme Individualismus, zu dem sich viele berühmte und erfolgreiche Personen in den letzten Jahrzehnten bekannten und der seine Rechtfertigung in herausragender Leistung oder Prominenz suchte, ist intellektuell nicht länger haltbar. Menschen sind soziale Wesen, und zur Schau gestellte Gier ist nicht nur ärgerlich, sondern auch ansteckend. Den exzessiven finanziellen Forderungen von Managern und den Ansprüchen der Identitätspolitik, dem selbstgefälligen Gehabe von Trump, Putin, Bolsonaro und Kim Jong-un und dem wachsenden Einfluss von Reality-TV-Stars und Influencer_innen ist ein zentrales Merkmal gemein: Es dreht sich immer alles um sie selbst. Einige sind geldgierig, andere gieren nach Aufmerksamkeit. Die libertären Fantasien des Silicon Valley beruhen auf einer ähnlich egoistischen Motivation. Und all dies wurde zu weit getrieben.
Die Ansprachen zweier im Amt aufeinanderfolgender US-Präsidenten markieren den Übergang vom Kommunitarismus der Nachkriegszeit zum anschließenden Aufstieg des Individualismus. Im Jahr 1960 hielt John F. Kennedy, der bei den Präsidentschaftswahlen Richard Nixon besiegt hatte, eine Antrittsrede, die zur ikonischen Formulierung kommunitaristischer Politik wurde. »Und daher sollten Sie, meine amerikanischen Mitbürger, nicht fragen, was Ihr Land für Sie tun kann – vielmehr sollten Sie fragen, was Sie für Ihr Land tun können.«1 Kennedy war schon lange tot, als Nixon 1973 seine zweite Antrittsrede hielt. Nixons Appell an seine Landsleute begann mit einer Wiederholung von Kennedys Aufforderung: »Lassen Sie jeden von uns fragen – nicht nur, was die Regierung für mich tun wird …« Aber das, was nun folgte, war deutlich weniger inspirierend: »… sondern, was ich für mich selbst tun kann«.2
Vierzig Jahre später erreichte das Zeitalter des Individualismus seine unschöne Vollendung. Während des Wahlkampfs für seine Wiederwahl im Jahr 2012 wurde Präsident Obama bei, wie das Wall Street Journal schrieb, »einem Ausbruch ideologischer Freimütigkeit« erwischt, »… nur selten enthüllen Politiker ihre Grundüberzeugungen so unmissverständlich«.3 Für den fanatischen konservativen Talkmaster Rush Limbaugh war das »der entlarvendste Moment der Präsidentschaft Obamas«.4 Was hatte dieser in seinen spontanen Äußerungen verraten?
Wenn du erfolgreich bist, hast du irgendwann von jemandem Hilfe bekommen. Es gab einen großartigen Lehrer in deinem Leben. Jemand hat dabei geholfen, dieses unglaubliche amerikanische System zu erschaffen, das es dir ermöglichte, erfolgreich zu sein. Jemand hat in Straßen und Brücken investiert. Die Firma, die du leitest, hast du vielleicht nicht selbst aufgebaut. Jemand anders hat das getan. Das Internet hat sich nicht selbst erfunden. Das Internet, mit dem heute zahlreiche Privatunternehmen viel Geld verdienen, ging aus einem staatlich geförderten Forschungsprojekt hervor. Damit will ich sagen: Wenn wir erfolgreich sind, dann aufgrund unserer individuellen Initiative, aber auch deshalb, weil wir Dinge gemeinsam tun.5
Sind Sie schockiert über diese banale Verlautbarung des Offensichtlichen? Die Republikaner waren es: Auf ihrem Parteitag würdigten sie einen ganzen Tag lang die Leistungen von Kleinunternehmer_innen und schunkelten voller Stolz, als der Countrymusiker Lane Turner sang: »I Built It« (sinngemäß: »Ich hab den Laden ganz allein aufgebaut«). In der Geschäftswelt manifestiert sich extremer Individualismus als eine materielle Anspruchshaltung: »Ich habe es aufgebaut: Es steht mir zu.« Obama hatte dies durch seine leisen Vorbehalte gegenüber den selbstbewussten Anmaßungen des Besitzindividualismus hinterfragt – die auf John Locke zurückgehende Auffassung, dass Eigentumsrechte nicht durch einen Prozess gesellschaftlicher Kooperation und Übereinkunft erworben werden, sondern dadurch, dass man seine Arbeit mit einer Ressource vermischt. Es ist die Einstellung des Siedlers aus der Frontier-Zeit, der westlichen Expansion der USA im 19. Jahrhundert, der Land einfriedet und es mit einer Schusswaffe gegen Nachbarn, Vertreter der Staatsgewalt und die Ureinwohner verteidigt.
Obamas Nachfolger sollte dann die Krönung des Individualismus darstellen. Bis Januar 2021 wurde das Amt, das ehedem bedeutende Staatsmänner wie Lincoln und Roosevelt innegehabt hatten, von jemandem versehen, dessen vorgebliche staatsmännische Fähigkeiten nur in seinem Kopf existierten. Als Staatsoberhaupt verkörperte er nicht länger die Würde einer bedeutenden Nation – wie es Eisenhower oder Reagan getan hatten oder wie es in Großbritannien die Queen auch weiterhin tut. Für Präsident Trump drehte sich alles um ihn selbst.
Trump war durch Reality-TV-Sendungen berühmt geworden. Aber zumindest hatte er selbst etwas aufgebaut (wenn auch nicht immer dafür bezahlt). Expressiver Individualismus braucht nicht einmal das: Paris Hilton und die Kardashians, PewDiePie und James Charles sind einfach nur berühmt dafür, sie selbst zu sein. Und diejenigen unter ihnen, die den egoistischen Materialismus des modernen Wirtschaftslebens anprangern, sind nicht abgeneigt, ihre vermeintliche moralische Überlegenheit zu genießen. Es hat den Anschein, als könnten Prominente heute keinen Preis mehr entgegennehmen, ohne einem kriecherischen Publikum eine herablassende Moralpredigt zu halten.
An Universitäten rühren ähnliche Ansprüche moralischer Überlegenheit von der anmaßenden Unterstellung her, dass die akademisch Erfolgreichen den anderen auch intellektuell überlegen seien: »Da ich intelligent bin, weiß ich es am besten.« Diese Anmaßung geht so weit, dass ihre Nutznießer andere Meinungen nicht nur nicht hören wollen, sondern bestrebt sind, sie aktiv zu unterdrücken. Den »Unaufgeklärten« soll nicht die Ehre wohldurchdachter Argumente erwiesen werden, vielmehr haben sie es verdient, persönlich verunglimpft zu werden – sie sind Faschisten, Homophobe, Rassisten, Transphobe und Leugner des Klimawandels. In den Medien und unter Fachkräften im öffentlichen Dienst hat ein ähnlicher Anspruch moralischer Überlegenheit einen anderen Ursprung. Wie es die leidenschaftliche Empörung in einer Zeitungskolumne oder bei einer Protestveranstaltung verdeutlicht, ist die Intensität des selbstgerechten Fühlens für viele der Maßstab des moralischen Wertes. Wir haben recht, weil wir bessere Menschen sind, und wir nutzen jede Gelegenheit, um euch das reinzureiben.
Diese unschöne Schroffheit ist das Produkt eines extrem elitären Individualismus – des Triumphs des Selbst auf Kosten der Gemeinschaft –, der weite Teile des modernen politischen und kulturellen Denkens prägt. Aber je mehr wir über unsere Evolution, unsere Psychologie, unsere Anthropologie und unsere Geschichte als Spezies erfahren – und die moderne Forschung hat auf all diesen Gebieten viele neue Erkenntnisse zutage gefördert –, umso deutlicher wird, dass dieser Individualismus die Grundlagen der menschlichen Existenz verkennt.
Die Evolution hat uns mit einer einzigartigen Fähigkeit zur Gegenseitigkeit ausgestattet. Wir sind (größtenteils) keine Heiligen, aber wir sind (größtenteils) auch keine Soziopathen. In der komplexen modernen Welt könnten wir ohne die außergewöhnliche Fähigkeit zur Gegenseitigkeit nicht erfolgreich bestehen: Grundsätzlich hätten wir ohne diese Fähigkeit die Komplexität, die die Moderne überhaupt erst ermöglichte, nicht erschaffen können. Eine gesunde Gesellschaft besteht aus einem riesigen Netz kooperativer Tätigkeiten, das durch wechselseitige Gefälligkeiten und Verpflichtungen aufrechterhalten wird. Einige der Wechselwirkungen finden zwischen Individuen statt, aber die meisten ereignen sich zwischen Personengruppen – in Unternehmen, Kommunalverwaltungen, Hochschulen, Vereinen und Familien. Die Mehrzahl dieser Wechselbeziehungen beruht auf ungeschriebenen Vereinbarungen, nicht auf Rechtsdokumenten.
Die Qualität der wechselseitigen Beziehungen macht in ihrer Gesamtheit den Unterschied zwischen Gesellschaften aus, die sich dynamisch entwickeln, und jenen, die durch Uneinigkeit gelähmt sind, den Unterschied zwischen prosperierenden und primitiven Volkswirtschaften, in denen man den größten Teil seiner Zeit damit verbringt, sich mit Mühe und Not über Wasser zu halten. Aber die Fähigkeit, solche Netze wechselseitiger Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, muss gefördert werden: Die Verherrlichung des Selbst durch die Erfolgreichen hat das Gegenteil getan.
Menschen kooperieren und konkurrieren – und jede dieser Fähigkeiten kann sowohl konstruktiv als auch destruktiv sein. Wir können in konstruktiver Weise miteinander kooperieren, um komplexe Netze sozialer und wirtschaftlicher Beziehungen zu knüpfen, die unser Konsumverhalten, unsere berufliche Leistungsfähigkeit und unsere Freizeitgestaltung verbessern, während sie uns in Krisenzeiten schützen. Wir können aber auch in destruktiver Weise miteinander kooperieren, um anderen Gruppen und Nationen unsere religiösen Überzeugungen, unsere politischen und wirtschaftlichen Werte aufzuerlegen und ihre Ressourcen zu stehlen. Wir können in konstruktiver Weise konkurrieren, um in der Wirtschaft und den Künsten Neues hervorzubringen und den Lebensstandard zu heben, oder in destruktiver Weise, um uns vorrangigen Zugang zu knappen Ressourcen zu verschaffen. Und in den letzten zweihundert Jahren haben Menschen all diese Dinge in einem beispiellosen Ausmaß getan.
Erfolgreiche Gesellschaften – also solche, die stabil sind, Wohlstand schaffen und die Bedürfnisse ihrer Bürger_innen befriedigen – brachten Institutionen hervor, die sowohl Kooperation als auch Konkurrenz in positive Kanäle lenken, um komplexe, dem Gemeinwohl dienliche Ziele zu verwirklichen. Sie sind pluralistisch, aber ihr Pluralismus ist diszipliniert. Um mit Obama zu sprechen: »Wenn wir erfolgreich sind, dann aufgrund unserer individuellen Initiative, aber auch deshalb, weil wir Dinge gemeinsam tun.«
In diesem Buch beschreiben wir zwei Stränge des individualistischen Denkens – einen, der von Ökonomen propagiert wird, und einen zweiten, der von Juristen vertreten wird. Das ökonomische Cluster geht von der Annahme aus, dass (individuelle) Ansprüche auf Eigentumsrechten gründen, die sich von eigenen Anstrengungen herleiten – der sogenannte Besitzindividualismus. Diese Überzeugung wird durch den Marktfundamentalismus ethisch gerechtfertigt – die Auffassung, dass Volkswirtschaften dann prosperieren, wenn man die Fähigkeit von Finanziers und Geschäftsleuten, frei über ihr Eigentum zu verfügen, möglichst wenigen Beschränkungen unterwirft. Diese Doktrinen waren ein Geschenk für diejenigen, die finanziell erfolgreich sind.
»Übrigens ist Gier völlig in Ordnung. Ich will, dass Sie das wissen. Ich halte Gier für gesund. Man kann gierig und trotzdem mit sich zufrieden sein.«6 So sagte es der später wegen Insiderhandel verurteilte Ivan Boesky 1986 zu angehenden BWL-Student_innen an der Universität Berkeley. Im Jahr darauf paraphrasierte Hauptdarsteller Michael Douglas Boeskys Worte in dem Film Wall Street auf diese Weise: »Gier ist gut!« Aber was ist »gut«? In dieser Denkrichtung ist es das Kriterium, anhand dessen das gesellschaftliche Ergebnis beurteilt werden sollte: der Nutzen für den Einzelnen. Demnach wäre das Gemeinwohl schlicht die Summe der Einzelwohle aller Individuen.
Der juristische Strang individualistischer Ideen basiert auf der Einforderung von Ansprüchen: »meine Rechte!« – ein Geschenk für diejenigen, die Vorrechte, aber keine Pflichten gegenüber anderen haben wollen. Die Amerikanische und die Französische Revolution betonten Rechte – die selbstverständlichen Wahrheiten der Unabhängigkeitserklärung, die Verkündung der Forderungen liberté, égalité, fraternité