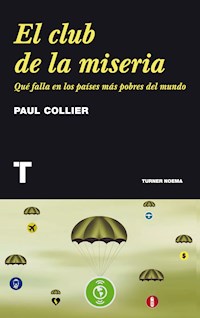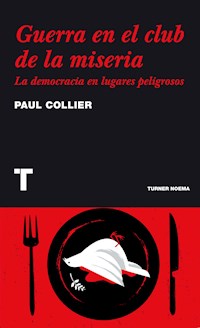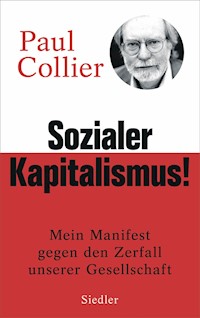15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wohl kaum eine Frage wird heute so heftig debattiert wie die der Einwanderung. Dürfen wir Menschen an der Grenze abweisen und sie wieder in ihre Heimatländer zurückschicken, auch wenn dort Armut und Hunger herrschen? Einwanderungspolitik, schreibt Paul Collier, ist bislang eine Mischung aus viel Emotion und wenig Wissen. In seinem neuen Buch zeigt er, warum es sich lohnt, einen völlig neuen Blick auf die weltweite Migration zu werfen.
Wer darf ins Land kommen und wer nicht? Profitieren wir von der Einwanderung – oder hilft der Massenexodus nur den Migranten selbst? Paul Collier erforscht, welche Kosten und welchen Nutzen die weltweite Migration mit sich bringt: für die aufnehmenden Ländern (vor allem Europa und die USA), für die Einwanderer selbst und für jene Länder, die die Migranten zurücklassen. Vor allem diese Staaten, die oft zu den Ländern der „ärmsten Milliarde“ gehören, müssen wir im Blick behalten, so Collier, wenn wir über die Gewinner und Verlierer von Migration sprechen. Nur so wird es möglich sein, neue, gerechte Einwanderungsregeln zu finden, von denen möglichst viele Menschen profitieren und die keiner Gesellschaft schaden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Paul Collier
EXODUS
WARUM WIR EINWANDERUNG NEU REGELN MÜSSEN
Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Schmidt
Siedler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die englische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »Exodus. Immigration and Multiculturalism in the 21st Century« bei Allen Lane, London.
Copyright © Paul Collier, 2013
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe
2014 by Siedler Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Covergestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg
Lektorat: Nico Schröder, Hamburg
Grafiken: Peter Palm, Berlin
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
ISBN 978-3-641-15125-6V003
www.siedler-verlag.de
Für Pauline, meine wurzellose Kosmopolitin
Inhalt
Prolog
TEIL IDie Fragen und der Prozess
1 Das Migrationstabu
2 Warum die Migration zunimmt
TEIL IIDie Aufnahmegesellschaften – Begrüßung oder Abwehr?
3 Die sozialen Folgen
4 Die wirtschaftlichen Folgen
5 Die falsche Einwanderungspolitik
TEIL IIIMigranten – Klagen oder Dankbarkeit?
6 Einwanderer – die Gewinner der Migration
7 Einwanderer – die Verlierer der Migration
TEIL IVDie Zurückgebliebenen
8 Die politischen Folgen
9 Die wirtschaftlichen Folgen
10 In der Heimat geblieben – und abgehängt?
TEIL VEine neue Einwanderungspolitik
11 Nationen und Nationalismus
12 Eine den Aufgaben gewachsene Einwanderungspolitik
ANHANG
Bibliographie
Register
Prolog
WÄHREND ICH DIES SCHREIBE, sieht er mich an: Karl Hellenschmidt. Auf dem Foto ist er kein junger, mittelloser Einwanderer mehr. Er hat einen Anzug, eine englische Frau und sechs kleine Kinder. Zuversichtlich schaut er in die Kamera, ohne zu ahnen, dass seine Familie bald durch den einwanderungsfeindlichen Rassismus während des Ersten Weltkriegs zerstört werden wird. Nicht mehr lange, und Großbritannien wird in den Kampf ziehen, um die Zivilisation gegen die barbarischen »Hunnen« zu verteidigen. Er ist einer von ihnen. Die Zivilisation in Gestalt des Revolverblatts John Bull nimmt Karl Hellenschmidt in ihre frei erfundene Liste feindlicher Agenten auf. In der Nacht greift ein »zivilisierter« Mob sein Geschäft an und versucht, seine Frau zu erwürgen. Er wird als feindlicher Ausländer interniert; seine Frau erkrankt an einer Depression. Der zwölfjährige Karl Hellenschmidt jr. wird aus der Schule genommen, um das Geschäft zu führen. Und dann, kaum zwanzig Jahre später, bricht wieder ein Krieg aus. Karl Hellenschmidt jr. passt sich an und ändert seinen Namen: Er wird zu Charles Collier.
Viele von uns sind Nachkommen von Einwanderern. Das natürliche Gemeinschaftsgefühl kann leicht in blinde Grausamkeit umschlagen, wie meine Familie sie erleben musste. Aber nicht alle reagieren gleichermaßen auf Einwanderer. Zufälligerweise habe ich dieses Jahr jemanden kennengelernt, dessen Vater auf der anderen Seite jenes antideutschen Aufruhrs stand. Die Erkenntnis, dass unschuldigen Einwanderern Unrecht getan wurde, ist in seiner Familie ebenso weitergegeben worden wie in meiner.
Mein Großvater verließ Ernsbach, ein von Armut geprägtes Dorf in Deutschland, und wanderte in die wohlhabendste Stadt Europas aus: nach Bradford. Dieser Umzug – nicht nur von einem Land in ein anderes, sondern auch vom Dorf in die Stadt – ist typisch für die moderne Migration aus armen Ländern in reiche. Nachdem er in Bradford angekommen war, war die jugendliche Abenteurerlust meines Großvaters jedoch erschöpft, und er ließ sich in einem Viertel nieder, das derart voller deutscher Einwanderer war, dass es »Little Germany« genannt wurde. Diese begrenzte Abenteuerlust zeigt sich auch bei den heutigen Migranten. Ein Jahrhundert später ist Bradford nicht mehr die wohlhabendste Stadt Europas. Vielmehr hat sich die Gunst des Schicksals gewendet, denn heute steht Ernsbach viel wohlhabender da. Eine Ankunftsstadt und eine Stadt voller Spannungen ist Bradford indes geblieben. Der einzige Unterhausabgeordnete der Respect Party, die im Grunde eine Partei islamischer Extremisten ist, stammt, von Einwanderern gewählt, aus Bradford. In diesem Fall sind manche der Einwanderer tatsächlich feindliche Agenten: Vier von ihnen verübten die terroristischen Selbstmordanschläge in London, denen 57 Menschen zum Opfer fielen. Einwanderer können ebenso Hasstäter wie Opfer von Hass sein.
Dieses Buch ist zum Teil eine Fortsetzung meiner Arbeit über die ärmsten Gesellschaften – die unterste Milliarde. Der Drang vieler Menschen, aus diesen Ländern in den reichen Westen auszuwandern, ist sowohl von professionellem als auch von persönlichem Interesse. Ob der daraus folgende Exodus den Zurückgebliebenen Vorteile oder Nachteile bringt, ist eine schwierige, jedoch wichtige Frage. Es handelt sich um die ärmsten Gesellschaften der Welt, und die Einwanderungspolitik des Westens hat ebenso unvermeidliche wie unerkannte Auswirkungen auf sie. Wir sollten uns wenigstens bewusst sein, was wir diesen Gesellschaften in unserer Gedankenlosigkeit antun. Außerdem erlebe ich, wie Freunde von mir hin- und hergerissen sind zwischen der Pflicht, daheimzubleiben, und der Pflicht, Gelegenheiten zu nutzen.
Gleichzeitig ist dieses Buch eine Kritik an der vorherrschenden Meinung liberaler Denker – zu denen ich mich zähle –, dass die westlichen Gesellschaften sich auf eine postnationale Zukunft vorbereiten sollten. Angesichts meiner eigenen Familiengeschichte könnte man erwarten, dass ich ein begeisterter Verfechter dieser neuen Orthodoxie bin. An Grenzen zeigen wir drei verschiedene Pässe vor: ich einen britischen, Pauline einen niederländischen, obschon sie in Italien aufgewachsen ist, und Daniel, der in den Vereinigten Staaten geboren wurde, voller Stolz einen amerikanischen. Meine Neffen sind Ägypter, ihre Mutter ist Irin. Dieses Buch habe ich wie meine vorherigen in Frankreich geschrieben. Wenn es eine postnationale Familie gibt, dann meine.
Aber was wäre, wenn das auf jede Familie zuträfe? Angenommen, die internationale Migration wäre so verbreitet, dass die nationale Identität keine Bedeutung mehr hätte und die Gesellschaften wirklich als postnational bezeichnet werden könnten: Spielte dies eine Rolle? Meiner Meinung nach würde es eine erhebliche Rolle spielen. Ein Lebensstil wie der meiner Familie ist auf potenziell parasitäre Weise von denjenigen abhängig, deren Identität fest verwurzelt ist und die dadurch lebensfähige Gesellschaften bilden, zwischen denen wir wählen können. In den Ländern, mit denen ich mich beruflich beschäftige – den multikulturellen Gesellschaften Afrikas –, hat eine schwache nationale Identität offensichtlich die entgegengesetzten Folgen. Die wenigen großen Führer, wie Julius Nyerere, der erste Präsident von Tansania, haben sich bemüht, eine gemeinsame Identität ihrer Völker zu schaffen. Aber sind nationale Identitäten nicht Gift? Führen sie nicht zum hunnenfeindlichen Aufruhr? Oder Schlimmerem. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Befürchtung geäußert, dass ein Wiedererstarken des Nationalismus nicht nur zum Aufruhr, sondern zum Krieg führen könnte. Deshalb muss ich, wenn ich den Wert der nationalen Identität hervorhebe, diese Ängste auf überzeugende Weise beschwichtigen.
Mehr noch als bei meinen anderen Büchern bin ich einer Vielzahl internationaler Gelehrter verpflichtet. Einige sind meine Kollegen und Partner in der Forschung, andere, die ich nicht persönlich kenne, sind mir durch ihre Publikationen nützlich gewesen. Die moderne Wissenschaft ist in ein breites Spektrum aus Spezialgebieten unterteilt. Selbst innerhalb der Migrationsökonomie sind die Forscher stark spezialisiert. Für dieses Buch habe ich mich mit Fragen aus drei Bereichen beschäftigt: Was bestimmt die Entscheidungen von Migranten? Wie wirkt sich die Migration auf die Zurückgelassenen aus? Und welche Folgen hat sie für die einheimische Bevölkerung in den Aufnahmegesellschaften? Für jede dieser Fragen gibt es Spezialisten. Für mich wurde jedoch immer deutlicher, dass Migration in erster Linie kein ökonomisches Problem darstellt. Es ist ein soziales Phänomen, und dies öffnet, was das akademische Spezialistentum angeht, geradezu die Büchse der Pandora. Die unterschiedlichen Analysen werden von einer ethischen Frage überlagert: An welchem moralischen Maß sollen die verschiedenen Auswirkungen gemessen werden? Die Ökonomen besitzen einen kleinen, formelhaften ethischen Werkzeugkasten mit der Aufschrift »Utilitarismus«, der für ihre typischen Aufgaben alles Nötige bereithält und deshalb zum Standard geworden ist. Aber für die Bearbeitung von Themen wie der Ethik der Migration ist er völlig ungeeignet.
In diesem Buch möchte ich eine stimmige Analyse der Ergebnisse eines breiten Spektrums spezialisierter sozialwissenschaftlicher und moralphilosophischer Forschungen geben. Auf ökonomischem Gebiet stütze ich mich vor allem auf George Akerlofs innovative Sichtweise der Identität und Frédéric Docquiers tiefschürfende Untersuchungen des Migrationsprozesses sowie insbesondere auf Diskussionen mit Tony Venables sowohl über ökonomische Geografie als auch über das Modell, das den analytischen Rahmen dieses Buchs bildet. Auf dem Gebiet der Sozialpsychologie waren mir Gespräche mit Nick Rawlings sowie die Schriften von Steven Pinker, Jonathan Haidt, Daniel Kahneman und Paul Zak von Nutzen. In Bezug auf die Philosophie halfen mir Gespräche mit Simon Saunders und Chris Hookway sowie die Schriften von Michael Sandel weiter.
Das vorliegende Buch versucht, die Frage nach einer angemessenen Einwanderungspolitik zu beantworten. Es erfordert Mut, diese Frage auch nur zu stellen, denn wenn es ein sozialökonomisches Wespennest gibt, dann ist es die Migration. Obwohl sie regelmäßig eine Hauptsorge der Wähler ist, wird sie in der Literatur, von seltenen Ausnahmen abgesehen, entweder aus einer engen, technischen Perspektive oder durch die Brille einer bestimmten Auffassung betrachtet. Ich wollte ein aufrichtiges, allgemeinverständliches Buch schreiben und habe deshalb darauf geachtet, dass es nicht ausufert und sich nicht in einem akademischen Stil verliert. Manchmal sind die Argumente spekulativ und unorthodox. Wo dies so ist, habe ich es angemerkt. Mit solchen Überlegungen hoffe ich, die Spezialisten zu provozieren und zu den notwendigen Forschungen anzuregen, um nachzuweisen, ob sie begründet sind oder nicht. Vor allem aber hoffe ich, dass die in diesem Buch dargelegten Fakten und Argumente eine öffentliche Diskussion über die Migrationspolitik in Gang bringen, die über theatralisch polarisierte und schrill geäußerte Meinungen hinausgeht. Das Thema ist zu wichtig, als es weiterhin auf diese Weise zu behandeln.
TEIL IDie Fragen und der Prozess
1 Das Migrationstabu
DIE MIGRATION ARMER MENSCHEN in reiche Länder ist ein mit vergifteten Assoziationen überladenes Phänomen. Dass in den Ländern der untersten Milliarde weiterhin Massenarmut herrscht, ist eine Schande für das 21. Jahrhundert. Angesichts des Wohlstands anderswo auf der Welt zieht es viele junge Menschen aus diesen Gesellschaften fort. Manchen von ihnen gelingt es, auf legale wie auch illegale Weise. Jede einzelne Auswanderung ist ein Triumph des menschlichen Geistes, des Muts und des Erfindungsreichtums, die nötig sind, um die von den ängstlichen Reichen errichteten bürokratischen Barrieren zu überwinden. Aus dieser emotionalen Perspektive betrachtet, ist jede andere Einwanderungspolitik außer derjenigen der offenen Tür bösartig. Doch die Migration kann man auch als selbstsüchtig bezeichnen, denn wenn Arbeiter denjenigen den Rücken zuwenden, die von ihnen abhängig sind, und die Tatkräftigen die Schwächeren ihrem Schicksal überlassen, dann ignorieren sie die Verantwortung für andere, die unter noch verzweifelteren Umständen leben. Aus dieser emotionalen Perspektive gesehen, darf die Migrationspolitik die von den Migranten unbeachteten Folgen der Auswanderung für die Zurückbleibenden nicht aus dem Blick verlieren. Schließlich kann die Migration sogar als umgekehrter Imperialismus verstanden werden, als Rache der einstmals Kolonisierten. Migranten bilden in den Aufnahmeländern Gruppen, die ursprünglich den einheimischen Armen zur Verfügung stehende Ressourcen abzweigen, mit ihnen konkurrieren und ihre Werte untergraben. Aus dieser wiederum emotionalen Perspektive betrachtet, muss die Migrationspolitik diejenigen schützen, die am Ort bleiben. Die Migration ist ein emotionsgeladenes Thema, doch emotionale Reaktionen auf vermeintliche Folgen können die Politik in jede Richtung lenken.
Noch bevor es zu einer Analyse der Migration kam, wurde sie politisiert. Der Umzug von Menschen aus armen in reiche Länder ist ein einfacher ökonomischer Vorgang, allerdings mit komplexen Folgen. Die staatlichen Maßnahmen hinsichtlich der Migration müssen diese komplizierten Aufgaben bewältigen. Gegenwärtig gibt es in der Migrationspolitik der Herkunfts- wie auch der Aufnahmeländer erhebliche Unterschiede. Manche Herkunftsländer fördern die Auswanderung und halten aktiv die Verbindung zu ihren Diasporagemeinden aufrecht, während andere ihre im Ausland lebenden Bürger als Abtrünnige betrachten. Die Einwanderungszahlen in den Aufnahmeländern unterscheiden sich erheblich: Japan ist eines der reichsten Länder der Welt, für Einwanderer jedoch praktisch unzugänglich. Dubai stellt die andere Seite dar, es zählt mittlerweile ebenfalls zu den reichsten Ländern der Welt, hat aber, um dies zu erreichen, derart viele Einwanderer ins Land geholt, dass sie heute 95 Prozent der Bevölkerung stellen. Auch was die Einwanderer selbst betrifft, bestehen große Unterschiede; für Australien und Kanada beispielsweise ist eine gute Ausbildung weitaus wichtiger als für die Vereinigten Staaten, die wiederum bedeutend anspruchsvoller sind als Europa. Außerdem unterscheiden sich die Rechte von Einwanderern von Land zu Land, von rechtlicher Gleichheit mit den Einheimischen, einschließlich des Rechts, Verwandte nachzuholen, bis zum Status von Vertragsarbeitern. Ebenso unterschiedlich sind die Vorschriften, die Einwanderern auferlegt werden, von der Beschränkung auf bestimmte Wohnorte und der Verpflichtung, die Sprache des Aufnahmelandes zu erlernen, bis hin zur Freiheit, sich in Gruppen mit ein und derselben Sprache zusammenzufinden. Einerseits wird die Assimilation gefördert, andererseits die kulturelle Verschiedenartigkeit erhalten. Ich kenne kein anderes Gebiet der Politik, auf dem die Unterschiede derart deutlich hervortreten – stellt das eine durchdachte Reaktion auf unterschiedliche Umstände dar? Ich bezweifle es. Weit eher vermute ich, dass die Irrungen und Wirrungen der Migrationspolitik auf eine giftige Mischung aus aufgestachelten Gefühlen und verbreitetem Unwissen zurückzuführen sind.
In der Auseinandersetzung über die Migrationspolitik wird viel häufiger über konkurrierende Werte als über widersprüchliche Tatsachen gestritten. Werte können eine Analyse jedoch sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Positiv wirken sie insofern, als normative Beurteilungen, ob nun über die Migration oder ein anderes Thema, nur möglich sind, wenn man sich über seine Werte im Klaren ist. Aber es gibt auch eine negative Wirkung. So zeigt der Moralpsychologe Jonathan Haidt in einer aufschlussreichen neuen Studie, dass sich die Menschen trotz unterschiedlicher moralischer Werte tendenziell in zwei Gruppen aufteilen.1 Er weist nach, dass das moralische Urteil über eine bestimmte Erscheinung, je nachdem, welche Wertegruppe man vertritt, das Denken bestimmt – und nicht umgekehrt. Gründe, die vorgeblich Urteile rechtfertigen und erklären sollen, werden stattdessen genutzt, um Urteile zu legitimieren, die bereits auf der Grundlage der moralischen Einstellung gefällt wurden. Bei keinem bedeutsamen Thema untermauern die Belege nur eine Seite des Meinungsstreits, ganz gewiss nicht, wenn es um die Migration geht. Unsere moralische Einstellung bestimmt, welche Argumente und Beweise wir zu akzeptieren bereit sind. Wir schenken dem winzigsten Strohhalm im Wind Glauben, wenn er unsere Werte bestätigt, während wir Beweise, die für das Gegenteil sprechen, mit Verachtung und Geringschätzung strafen. Was die Migration betrifft, so sind die ethischen Vorlieben polarisiert, und jedes Lager neigt dazu, nur jene Argumente und Fakten anzuerkennen, die sein Vorurteil untermauern. Wie Haidt nachweist, findet sich diese Schieflage bei vielen Themen, aber bei der Migration überlagern sich alle diese Tendenzen. In liberalen Kreisen, in denen man über die meisten Themen am besten informiert ist, war und ist die Migration ein Tabuthema. Die einzige erlaubte Meinungsäußerung ist die Klage über die allgemeine Abneigung gegen sie. In jüngster Zeit haben Ökonomen ein tieferes Verständnis der Struktur von Tabus gewonnen. Deren Zweck besteht darin, ein gewisses Identitätsgefühl zu schützen, indem sie die Menschen vor Fakten abschirmen, die es erschüttern könnten.2 Tabus ersparen es einem, sich die Ohren zuzuhalten, indem sie das Gebiet des Sagbaren einschränken. Differenzen über Tatsachen und Beweismittel können in der Regel dadurch beigelegt werden, dass eine Seite ihren Irrtum einsieht. Hingegen sind Meinungsverschiedenheiten über Werte oftmals unlösbar. Sobald man unterschiedliche Wertvorstellungen als solche erkannt hat, können sie jedoch respektiert werden. Ich bin kein Vegetarier, betrachte Vegetarier aber weder als irregeleitete Schwachköpfe, noch versuche ich, Vegetariern, die bei mir zu Gast sind, zwangsweise Gänseleberpastete einzuflößen. Ich verfolge ein ehrgeizigeres Ziel, nämlich die Menschen dazu zu bringen, ihre Folgerungen zu überdenken, die sie aus ihren Werten ziehen. Wie Daniel Kahneman in Schnelles Denken, langsames Denken zeigt, entziehen wir uns oftmals der Anstrengung, die Fakten auf angemessene Weise zu untersuchen. Stattdessen verlassen wir uns lieber auf vorschnelle Urteile. In vielen Fällen liegt man damit der Wahrheit erstaunlich nahe, aber wir überschätzen dieses Urteilsverfahren. In diesem Buch möchte ich Sie über Ihre wertorientierten, vorschnellen Urteile hinausführen.
Wie alle anderen auch habe ich mich dem Thema der Migration mit wertorientierten Vorurteilen genähert, aber beim Schreiben darüber habe ich versucht, sie beiseitezulassen. In den alltäglichen Gesprächen gewinnt man den Eindruck, dass jeder eine entschiedene Einstellung zu dem Thema hat, die für gewöhnlich mit bruchstückhaften Analysen untermauert wird. Mit Blick auf Jonathan Haidts Forschungsergebnisse vermute ich jedoch, dass diese Ansichten größtenteils nicht das Ergebnis einer souveränen Beherrschung der Tatsachenbelege sind, sondern aus vorgefassten moralischen Einstellungen stammen. Eine auf Beweisen beruhende Analyse ist die Stärke der Volkswirtschaftslehre. Wie viele andere politische Phänomene hat auch die Migration ökonomische Ursachen und ökonomische Folgen, weshalb die Volkswirtschaftslehre bei der Einschätzung politischer Grundsätze an vorderster Front steht. Unsere Werkzeuge versetzen uns in die Lage, bessere fachliche Antworten auf Ursachen und Folgen zu geben, als es mit dem Alltagsverstand möglich ist. Zu dem, was die Menschen am meisten beunruhigt, gehören die sozialen Auswirkungen der Migration. Auch sie können in eine ökonomische Analyse einbezogen werden, und genau dies will ich versuchen. Für gewöhnlich äußern sich Ökonomen jedoch eher abschätzig über diesen Aspekt.
Die politischen Eliten, die tatsächlich die entsprechenden Entscheidungen treffen, sind gefangen zwischen mit Wertvorstellungen behafteten Wählersorgen und einseitigen ökonomischen Modellen. Das Ergebnis ist Verwirrung. Die Politik unterscheidet sich nicht nur von Land zu Land, sondern schwankt auch zwischen der von den Ökonomen befürworteten offenen Tür und der von den Wählern geforderten geschlossenen Tür. In Großbritannien beispielsweise stand die Tür in den 1950er-Jahren offen, 1968 schloss sie sich ein wenig und 1997 wurde sie wieder weit aufgestoßen, während sie jetzt erneut geschlossen wird. Diese Schwankungen fanden parteiübergreifend statt: Labour Party und Conservative Party waren jeweils dafür verantwortlich, dass sich die Tür einmal öffnete und dann wieder schloss. Politiker führen häufig eine harte Sprache, handeln aber weich, während der umgekehrte Fall eher selten ist, und manchmal scheinen ihnen die Neigungen der Wähler geradezu peinlich zu sein. Die Schweiz fällt insofern aus dem Rahmen, als dort die gewöhnlichen Menschen die Macht besitzen, der Regierung eine Volksabstimmung aufzuzwingen. Eines der Themen, bei dem sie diese Macht einsetzten, war, wie kaum anders zu erwarten, die Migration. Der Auslöser einer verbreiteten Beunruhigung war die Frage nach Vorschriften für den Bau von Moscheen. Der Schweizer Regierung war das Ergebnis derart peinlich, dass sie umgehend versuchte, es für unrechtmäßig zu erklären.
Moralische Einstellungen zur Einwanderung sind auf verwirrende Weise mit Ansichten zu Armut, Nationalismus und Rassismus verknüpft. Die aktuelle Haltung zur Immigration ist geprägt von Schuldreaktionen auf verschiedene Verfehlungen, die sich in der Vergangenheit ereigneten. Eine rationale Diskussion über die Migrationspolitik ist erst dann möglich, wenn dieses Knäuel an Motiven entwirrt ist.
Den Armen in anderen Ländern zu helfen ist eine klare moralische Pflicht, und einigen von ihnen zu erlauben, in reiche Gesellschaften auszuwandern, ist eine Möglichkeit der Hilfe. Doch aus der Hilfspflicht kann nicht die Pflicht folgen, einen allgemein freien Grenzverkehr zuzulassen. Tatsächlich wären diejenigen, nach deren Ansicht man es den Armen freistellen sollte, in reiche Länder auszuwandern, wahrscheinlich die Ersten, die gegen das Recht von Reichen, in arme Länder zu ziehen, Einspruch erheben würden, weil es einen unangenehmen kolonialistischen Beigeschmack hätte. Das Argument, die Menschen hätten ein Recht auf Migration, nur weil sie arm seien, vermischt zwei Dinge, die man besser getrennt halten sollte: die Pflicht der Reichen, den Armen zu helfen, und das Recht auf freie Bewegung zwischen den Ländern. Man muss nicht letzteres gewähren, um erstere zu erfüllen. Man kann der Pflicht, den Armen zu helfen, auf vielerlei Weise Genüge tun: Eine Gesellschaft, die es ablehnt, ihre Grenzen für Einwanderer aus armen Ländern zu öffnen, kann sich dafür entscheiden, armen Gesellschaften durch mehr Großzügigkeit auf anderen Gebieten der Politik zu helfen. Norwegen zum Beispiel verfolgt eine recht restriktive Einwanderungspolitik, betreibt gleichzeitig aber eine entsprechend großzügige Entwicklungshilfepolitik.
Der Abscheu vor dem Nationalismus ist eine weit stärkere Nebenwirkung der moralischen Pflicht, den Armen überall auf der Welt zu helfen, als die Forderung nach einem Recht auf Migration. Obwohl der Nationalismus nicht notwendigerweise eine Beschränkung der Einwanderung bedeutet, liegt auf der Hand, dass solche Restriktionen ohne ihn keine Grundlage hätten. Wären die in einem bestimmten Gebiet lebenden Menschen nicht miteinander durch ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl verbunden als mit Ausländern, wäre es absurd, den Zugang für Ausländer zu beschränken: Man würde nicht zwischen »wir« und »sie« unterscheiden. Ohne ein Nationalgefühl fiele es schwer, Argumente zu finden, um die Einwanderung zu beschränken.
Es überrascht nicht, dass der Abscheu vor dem Nationalismus in Europa, wo er wiederholt zum Krieg geführt hat, am größten ist. Die Europäische Union ist der hehre Versuch, diese Vergangenheit zu überwinden. Zur Ablehnung des Nationalismus gehört naturgemäß die Ablehnung der Grenzen: Eines der Kernelemente der Europäischen Union ist die Möglichkeit, sich innerhalb aller Mitgliedsstaaten frei zu bewegen. In den Augen mancher Europäer ist die nationale Identität damit passé – einer meiner jüngeren Verwandten will sich über diejenige des Londoners hinaus auf keine geografische Zugehörigkeit festlegen. Ist die nationale Identität endgültig abgeworfen worden, ist es ethisch nicht mehr zu rechtfertigen, Migranten den Zugang zu verwehren. Warum soll nicht jeder leben, wo er will?
Die nationale Identität wird in höchst unterschiedlichem Maß akzeptiert. In Frankreich, den Vereinigten Staaten, China und Skandinavien ist sie weiterhin stark und politisch neutral, während sie in Deutschland und Großbritannien von der extremen Rechten vereinnahmt worden ist und deshalb ein Tabu darstellt. In vielen Gesellschaften, die nie eine starke nationale Identität ausgebildet haben, bedauert man dies und betrachtet es als Grund zur Sorge. In Kanada sorgte der Historiker Michael Ignatieff jüngst für viel Aufregung, als er den Versuch für gescheitert erklärte, eine sprachübergreifende gemeinsame Identität von frankofonen Quebecern und anglofonen Kanadiern der übrigen Provinzen zu schaffen.3 In Afrika wird die Schwäche der nationalen Identitäten gegenüber den Stammesidentitäten weithin als Fluch betrachtet, den zu besiegen die Aufgabe einer guten Regierungsführung ist. In Belgien, gegenwärtig das Land, das am längsten ohne Regierung war – weil Flamen und Wallonen sich nicht auf eine Koalition einigen konnten –, wurde es nicht einmal versucht, eine gemeinsame Identität zu schaffen. Als bei einem Essen mit einem befreundeten belgischen Botschafter das Gespräch auf seine nationale Identität kam, leugnete er rundweg, sich als Belgier zu fühlen, aber nicht, weil er sich als Flame oder Wallone verstand. Er betrachtete sich vielmehr als Weltbürger. Auf meine Nachfrage, wo er sich am meisten zu Hause fühle, nannte er ein Dorf in Frankreich. Ich glaube nicht, dass irgendein französischer Botschafter so etwas sagen würde. Sowohl Kanada als auch Belgien gelingt es trotz einer schwachen nationalen Identität, hohe Einkommen zu gewährleisten, wobei ihre Lösung einerseits die völlige räumliche Trennung zwischen den verschiedenen Sprachgruppen und andererseits eine radikale Dezentralisierung der politischen Autorität für diese subnationalen Territorien ist. Um die staatlichen Aufgaben zu erfüllen, das heißt aus praktischen Gründen, stellen Kanada und Belgien jeweils zwei Staaten dar, die über eine gemeinsame Identität verfügen, nicht einzelne Staaten ohne eine solche. In Großbritannien ist die nationale Identität aufgrund des relativ jungen multinationalen Zusammenschlusses seiner Bestandteile gestört. Abgesehen von manchen Einwanderern versteht sich niemand in erster Linie als Brite. In Schottland bildet die nationale Identität einen offen geförderten Teil der Leitkultur, während das englische Nationalgefühl eher untergründig wirkt: Es sind weit weniger englische Fahnen zu sehen als schottische.
Das Nationalgefühl hat seine Vorteile. Zwar darf man nicht vergessen, dass es missbraucht werden kann, aber das Gefühl einer gemeinsamen Identität stärkt auch die Fähigkeit zur Kooperation. Die Menschen müssen auf verschiedenen Ebenen in der Lage sein, miteinander zusammenzuarbeiten, auch auf solchen unterhalb und oberhalb der nationalen Ebene. Ein gemeinsames Nationalgefühl ist nicht das einzige Mittel, um dies zu gewährleisten, aber es ist besonders gut dafür geeignet. Dies zeigt sich bei der Steuererhebung und den öffentlichen Ausgaben: Obwohl beide Aufgaben auf vielen staatlichen Ebenen anfallen, ist die nationale bei Weitem am wichtigsten. Wenn ein gemeinsames nationales Identitätsgefühl die Fähigkeit der Menschen zur Kooperation auf dieser Ebene stärkt, bewirkt es also etwas außerordentlich Bedeutsames.
Ein gemeinsames Identitätsgefühl lässt die Menschen auch leichter die Umverteilung von Reich zu Arm akzeptieren und den Rohstoffreichtum teilen. Die Ablehnung der nationalen Identität kann also kostspielig werden, verringert sie doch die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und die soziale Gleichheit. Trotz dieser Vorteile kann es jedoch nötig sein, die nationale Identität aufzugeben. Führt das Nationalgefühl hingegen unvermeidlich zur Aggression, ist der Preis für seine Aufgabe sicherlich annehmbar. Seit dem Niedergang des europäischen Nationalismus hat Europa eine beispiellose Friedenszeit erlebt. Wegen dieses Zusammenhangs heben Politiker wie Bundeskanzlerin Angela Merkel die Symbole der europäischen Einheit hervor, insbesondere den Euro, denn sie sehen in ihnen einen Schutz gegen das Wiederaufleben kriegerischer Auseinandersetzungen. Doch die Auffassung, dass der Niedergang des Nationalismus einen Niedergang der Gewalt nach sich gezogen habe, verkennt die Kausalität, denn die Ablehnung der Gewalt hat umgekehrt den Niedergang des Nationalismus bewirkt. Noch wichtiger ist, dass der Abscheu vor Gewalt die Gefahr der Gewaltanwendung drastisch verringert hat. Die Einstellung zur Gewalt hat sich derart radikal geändert, dass ein Krieg innerhalb Europas heute undenkbar ist.
Nach meiner Meinung ist es nicht mehr nötig, die nationale Identität abzulegen, um sich gegen das Übel des Nationalismus zu schützen. Wenn ein gemeinsames Nationalgefühl nützlich ist, kann es durchaus mit einer in Frieden lebenden Nation im Einklang stehen. Die skandinavischen Länder sind dafür ein gutes Beispiel. Jedes einzelne ist unverhohlen patriotisch gesinnt und konkurriert offen mit seinen Nachbarn. Die Region hat eine kriegerische Geschichte: Schweden und Dänemark haben auf Kosten Finnlands beziehungsweise Norwegens lange Zeit Kriege geführt. Heute steht der anhaltende Frieden außer Frage. Er beruht nicht auf den Institutionen, die die europäische Zusammenarbeit organisieren. Tatsächlich haben diese Institutionen die skandinavischen Länder eher gespalten als vereint. Norwegen ist im Gegensatz zu den anderen drei Ländern, von denen wiederum nur Finnland zur Eurozone gehört, kein Mitglied der Europäischen Union. Die europäischen Institutionen haben diese vier Länder also in drei Blöcke geteilt. Die Lebensstandards in diesen Ländern zählen zu den weltweit höchsten, was sich nicht nur in hohen Privateinkommen niederschlägt, sondern auch in sozialer Gleichheit und einem gut funktionierenden öffentlichen Dienst. Welchen Anteil der Patriotismus und ein gemeinsames Identitätsgefühl daran haben, lässt sich nicht bestimmen, aber beide spielen sicherlich eine Rolle. Die Pflicht gegenüber den Armen und die Furcht vor dem Nationalismus haben möglicherweise zur Verwirrung über die Frage beigetragen, ob Gesellschaften das Recht haben sollten, die Zuwanderung zu begrenzen. Zugleich liefert die Ablehnung des Rassismus den stärksten Grund dafür, die Freiheit der Bewegung zwischen Ländern als Naturrecht zu betrachten. Angesichts der Geschichte des Rassismus sowohl in Europa als auch in Amerika ist dessen leidenschaftliche Ablehnung kaum überraschend und völlig gerechtfertigt. Gleichzeitig befindet sich der Widerstand gegen die Einwanderung in gefährlicher Nähe zum Rassismus, da sich die meisten Migranten aus armen Ländern deutlich von den Bevölkerungen der reichen Aufnahmestaaten unterscheiden. In Großbritannien überschritt in den 1960er-Jahren ein nun schon lange verstorbener Hinterbänkler namens Enoch Powell in einer viel beachteten Rede diese Grenze, indem er mit reißerischen Worten gewalttätige ethnische Konflikte an die Wand malte, um die Zuwanderung von Menschen aus Afrika und Südasien zu verhindern. Mit dieser törichten Rede beendete Powell für mehr als vierzig Jahre jede Diskussion über die Migrationspolitik in seinem Land. Die Ablehnung der Einwanderung war derart eng mit Rassismus verknüpft, dass sie im Diskurs der Mitte nicht geäußert werden konnte. Powell verhinderte mit seiner lächerlichen Voraussage von »Strömen von Blut« aber nicht nur jede Diskussionsmöglichkeit, sondern prägte auch die Furcht der Liberalen vor der angeblich lauernden Gefahr von gewalttätigen Rassenkonflikten zwischen Einwanderern und Einheimischen. Alles, was geeignet schien, diesen schlafenden Drachen aufzuwecken, verbot sich von selbst.
Erst 2010, infolge der massenhaften Einwanderung aus Polen, konnte das Tabu gebrochen werden. Die britische Einwanderungspolitik war in Bezug auf polnische Migranten auffallend liberal. Als Polen der Europäischen Union beitrat, erhielten die Mitgliedsländer für eine Übergangsphase das Recht, die Einwanderung aus Polen zu beschränken, bis die polnische Wirtschaft sich dem gemeinsamen Markt angepasst hatte. Außer Großbritannien verhängten alle großen EU-Staaten solche Beschränkungen. Dass sich die britische Regierung nicht dafür entschied, hing vermutlich mit der von ihren eigenen Beamten gemachten Voraussage von 2003 zusammen: Nur wenige Osteuropäer – nicht mehr als 13000 pro Jahr – würden nach Großbritannien auswandern wollen. Diese Erwartung erwies sich auf spektakuläre Weise als falsch, denn tatsächlich wanderten in den folgenden fünf Jahren rund eine Million Menschen aus Osteuropa nach Großbritannien aus.4 Obwohl Familien wie meine, die den Zustrom erfahrener, hart arbeitender Handwerker als überaus nützlich empfanden, die Neuankömmlinge willkommen hießen, wurde eine Einwanderung dieses Ausmaßes von den meisten abgelehnt, vor allem von Arbeitern, die um ihre Jobs fürchteten. Beide Reaktionen waren zwar egoistisch, aber keineswegs rassistisch, immerhin waren die Polen weiß und christlich. Ein entscheidender und durchaus komischer Augenblick des Wahlkampfs von 2010 war es, als nach einem Podiumsgespräch zwischen Premierminister Gordon Brown und einer von seinen Mitarbeitern ausgesuchten einfachen Wählerin das Mikrofon versehentlich nicht ausgeschaltet wurde. Unglücklicherweise hatte sich die Frau über die jüngste Einwanderungswelle beklagt, und Brown rüffelte nun seine Mitarbeiter wegen der von ihnen getroffenen Auswahl und sah die Frau als engstirnig an. Das Spektakel eines Premierministers, dem so offensichtlich jedes Verständnis für eine weithin als begründet angesehene Sorge fehlte, trug zu Browns schwerer Wahlniederlage bei. Die neue Führung der Labour Party hat sich entschuldigt und erklärt, dass die bisherige Politik der offenen Tür falsch sei. Nun schien es in Großbritannien möglich geworden zu sein, ohne rassistische Anklänge über die Einwanderung zu diskutieren.
Doch dem ist nicht so. Da die Zugehörigkeit zu einer Ethnie mit anderen Merkmalen wie Armut, Religion und Kultur verknüpft ist, kann jeder Versuch, die Einwanderung aufgrund dieser Kriterien zu beschränken, als trojanisches Pferd des Rassismus betrachtet werden. Aus diesem Grund ist eine offene Debatte über die Einwanderung immer noch unmöglich. Ich habe mich erst dazu entschlossen, dieses Buch zu schreiben, als ich überzeugt war, dass eine Trennung der Begriffe Rasse, Armut und Kultur heutzutage möglich ist. Rassismus ist der Glaube daran, dass es genetische Unterschiede zwischen den Rassen gibt, für die allerdings keinerlei Beweise vorhanden sind. Armut betrifft das Einkommen, nicht die Genetik; dass es weiterhin Massenarmut gibt, obwohl die Technologie vorhanden ist, um gewöhnlichen Menschen ein anständiges Leben zu garantieren, ist der Skandal und die große Herausforderung unserer Zeit. Kulturen werden nicht genetisch vererbt, sie sind veränderliche Gruppierungen von Normen und Gewohnheiten, die erhebliche materielle Auswirkungen haben. Die Vorstellung rassisch begründeter Verhaltensunterschiede zurückzuweisen ist ein Zeichen menschlichen Anstands. Die Weigerung, kulturell begründete Verhaltensunterschiede anzuerkennen, wäre dagegen eine engstirnige Leugnung des Offensichtlichen.
Wenn ich die Berechtigung dieser Unterscheidungen hervorhebe, bin ich mir durchaus bewusst, dass meine Auffassung falsch sein kann. Die Frage ist von Bedeutung, da Einkommens- und Kulturunterschiede, wie sich zeigen wird, erheblichen Einfluss auf die Migrationspolitik haben. Sieht man darin einen Ausdruck von Rassismus, fängt man am besten gar nicht erst an, darüber zu diskutieren, wenigstens in Großbritannien. Vielleicht hängt der lange Schatten Enoch Powells immer noch über dem Land. Deshalb lautet meine Arbeitshypothese, dass das Recht, überall zu leben, keine logische Folge aus der Ablehnung des Rassismus darstellt. Es mag ein solches Recht geben, und ich werde mich mit ihm beschäftigen, aber es folgt nicht einfach aus der berechtigten Sorge über Armut, Nationalismus und Rassismus.
Wir müssen drei Gruppen betrachten: die Migranten selbst, die Menschen, die sie in ihren Heimatländern zurücklassen, und die Bevölkerungen der Aufnahmeländer. Wir brauchen Theorien und Beweise dafür, was mit jeder dieser Gruppen geschieht. Die erste Perspektive, diejenige der Migranten, stelle ich bis zuletzt zurück, weil sie die einfachste ist. Migranten müssen erhebliche Kosten aufbringen, um die vielen Hindernisse bei der Auswanderung zu überwinden, erlangen aber auch den größten ökonomischen Vorteil. Sie streichen den Löwenanteil des ökonomischen Gewinns der Migration ein. Einige verblüffende neue Beweise legen nahe, dass dieser Gewinn teilweise und vielleicht sogar erheblich von psychologischen Verlusten aufgewogen wird. Trotz dieser schlagenden neuen Beweise gibt es jedoch noch zu wenige zuverlässige Studien, um die Bedeutung dieses Zusammenhangs schlüssig beurteilen zu können.
Die zweite Perspektive – diejenige der in den armen Ländern zurückgebliebenen Menschen – hat mich ursprünglich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben. Diese Menschen leben in den ärmsten Gesellschaften der Welt, die im vergangenen halben Jahrhundert weit hinter die prosperierende Mehrheit zurückgefallen sind. Nimmt die Auswanderung diesen Gesellschaften Fähigkeiten, an denen es ihnen ohnehin schon mangelt? Oder stellt sie eine Rettungsleine, von der Hilfe zu erwarten ist, und einen Katalysator für Veränderungen dar? Wenn die verschlossene Tür der Maßstab für die Auswirkungen der Migration auf die Zurückgebliebenen ist, dann sind sie durch die Migration tatsächlich besser dran. Gleiches ließe sich von den anderen ökonomischen Wechselbeziehungen zwischen den ärmsten Gesellschaften und der übrigen Welt sagen: Handel ist besser als kein Handel, und Kapitalbewegung ist besser als finanzieller Stillstand. Aber der Maßstab der Unabhängigkeit für die ärmsten Gesellschaften wäre eine nichtssagende, irrelevante Hürde; kein ernsthafter politischer Analytiker würde sie fordern. Der passende Maßstab ist wie beim Handel und Kapitalfluss nicht der Status quo im Verhältnis zur Unabhängigkeit, sondern zur entweder größeren oder geringeren Auswanderung. Ich werde zeigen, dass die Migration aus den ärmsten Ländern zunehmen würde, gäbe es keine Kontrollen: Sie wären mit einem wahren Exodus konfrontiert. Aber über die Migrationspolitik wird nicht in den armen Ländern entschieden, sondern in den reichen. Indem sie ein Maß für die Einwanderung in ihre Gesellschaften bestimmen, geben die Regierungen der reichen Länder unabsichtlich auch das Maß für die Auswanderung aus den armen Ländern vor. Wenn man anerkennt, dass die momentane Migration für diese Gesellschaften besser ist als keine Migration, stellt sich die Frage, ob ihr gegenwärtiges Ausmaß ideal ist. Wäre eine größere oder geringere Auswanderung als die augenblickliche für die armen Länder besser? Bis vor Kurzem war eine solche Frage nicht zu beantworten. Gründliche Forschungen der jüngsten Zeit legen jedoch den Schluss nahe, dass die gegenwärtigen Auswanderungsraten für viele zur untersten Milliarde gehörende Gesellschaften zu hoch sind. Vor einem Jahrzehnt legten ähnliche akademische Bemühungen die Grundlage für ein Umdenken hinsichtlich der Kapitalströme. Da es üblicherweise eine ganze Weile dauert, bis Forschungsergebnisse die Politik verändern, musste man bis November 2012 warten: Erst dann gab der Internationale Währungsfonds bekannt, dass er eine offene Tür für Kapitalströme nicht mehr notgedrungen als beste Politik für arme Länder betrachte. Solche nuancierten Aussagen treiben Fundamentalisten mit politischen Präferenzen, die auf vorgefassten Moralurteilen beruhen, natürlich auf die Barrikaden.
Die letzte Perspektive, diejenige der einheimischen Bevölkerungen in den Aufnahmeländern, betrifft die meisten Leser dieses Buches wahrscheinlich am direktesten. Deshalb werde ich sie zuerst abhandeln. Wie wirken sich Umfang und Tempo der Einwanderung auf die sozialen Interaktionen sowohl zwischen Einheimischen und Einwanderern als auch unter den Einheimischen selbst aus? Welche ökonomischen Folgen hat die Einwanderung auf die unterschiedlichen Berufs- und Altersgruppen unter den Einheimischen? Wie ändern sich die Auswirkungen im Lauf der Zeit? Was die Bevölkerungen der Aufnahmeländer betrifft, erhebt sich das gleiche Problem des Maßstabs wie hinsichtlich der in den Herkunftsländern Zurückgebliebenen. Der angemessene Maßstab ist nicht ein völliger Verzicht auf Migration, sondern etwas mehr oder weniger als der aktuelle Umfang der Einwanderung. Die Antwort fällt offensichtlich je nach Land anders aus: Ein gering besiedeltes Land wie Australien wird zu einer anderen Einschätzung kommen als ein dicht besiedeltes wie die Niederlande. Wenn ich dieser Frage nachgehe, werde ich verdeutlichen, dass die ökonomischen Auswirkungen für gewöhnlich von den sozialen in den Hintergrund gedrängt werden, was zum Teil daran liegt, dass erstere oftmals bescheiden ausfallen. Für die bedürftigste Schicht der einheimischen Bevölkerung ist der Nettoeffekt der Einwanderung häufig negativ.
Zusammen werden diese drei Perspektiven die Grundzüge einer Gesamteinschätzung der Migration liefern. Um von der Beschreibung zur Beurteilung zu gelangen, benötigt man jedoch einen analytischen und ethischen Rahmen. In Studien über die Migration wird das Problem zumeist sowohl analytisch als auch ethisch trivialisiert, da alle wichtigen Auswirkungen in dieselbe Richtung zu zeigen scheinen und entgegengesetzte Wirkungen als »umstritten«, »geringfügig« oder »vorübergehend« abgetan werden. In einer ehrlichen Analyse muss berücksichtigt werden, dass es sowohl Gewinner als auch Verlierer gibt und dass selbst die Gesamtwirkung auf eine einzelne Gruppe nicht eindeutig bestimmt werden kann, denn sie hängt davon ab, wie Gewinne und Verluste gegeneinander aufgerechnet werden. Wenn die einen gewinnen und andere verlieren, wessen Interessen sollen dann Vorrang haben? Viele ökonomische Analysen der Migration geben darauf eine klare, durchschlagende Antwort: Die Gewinner gewinnen weit mehr, als die Verlierer verlieren – also Pech für die Verlierer. Schon am einfachen metrischen Maßstab der Einkommen gemessen überwiegen die Gewinne die Verluste bei Weitem. Aber Ökonomen gehen für gewöhnlich vom Geld weiter zum wesentlich komplexeren Begriff des »Nutzens«, und nach diesem Maßstab ist der Gesamtgewinn der Migration sogar noch größer. Damit ist die Angelegenheit in den Augen vieler Ökonomen erledigt: Die Migrationspolitik sollte einen Kurs verfolgen, durch den der globale Nutzen maximiert wird.
Im fünften Teil dieses Buchs stelle ich diese Auffassung infrage und wende ein, dass Rechte nicht durch den Taschenspielertrick mit dem »globalen Nutzen« ausgehöhlt werden sollten. Nationen sind wichtige, legitime moralische Einheiten; tatsächlich sind es die Früchte erfolgreicher Nationalstaatlichkeit, die auf Migranten anziehend wirken. Schon durch ihre Existenz verleihen Nationalstaaten ihren Bürgern Rechte, insbesondere auch den Armen. Deren Interessen können nicht einfach durch die Beschwörung der Gewinne aus einem »globalen Nutzen« abgetan werden. Die in den Herkunftsländern zurückgebliebenen Menschen befinden sich in einer noch schwierigeren Lage als die Armen in den Aufnahmeländern. Sie sind sowohl bedürftiger als auch weit zahlreicher als die Migranten. Aber im Unterschied zu den Armen in den Aufnahmeländern haben sie keinerlei Aussicht auf Rechte hinsichtlich der Migrationspolitik, denn ihre Regierungen können den Umfang der Auswanderung nicht kontrollieren.
Die Migrationspolitik wird nicht von den Regierungen der Herkunftsländer, sondern von denen der Aufnahmeländer bestimmt. In demokratischen Gesellschaften muss die Regierung die Interessen der Mehrheit ihrer Bürger vertreten, aber es ist durchaus legitim, wenn für die Bürger sowohl die einheimischen Armen als auch die in den ärmsten Ländern lebenden Menschen Gegenstand ihrer Sorgen sind. Deshalb müssen die Regierungen der Aufnahmeländer versuchen, die Interessen der einheimischen Armen mit denen der Migranten und der in den armen Ländern zurückgebliebenen Menschen in Einklang zu bringen.
Eine bunte Mischung fanatischer Fremdenhasser und Rassisten lässt keine Gelegenheit aus, um zu verkünden, dass Migration für die einheimische Bevölkerung schlecht sei. Dies löst verständlicherweise eine Reaktion aus: Um diesen Gruppen bloß keine Schützenhilfe zu leisten, versuchen Sozialwissenschaftler mit aller Kraft nachzuweisen, dass die Migration für jeden gut ist. Damit haben sie den Fremdenhassern unabsichtlich ermöglicht, die zugrunde liegende Frage aufzugreifen: »Ist Migration gut oder schlecht?« Die Kernaussage dieses Buchs lautet, dass dies die falsche Frage ist. Sie zu stellen ist ungefähr so sinnvoll, wie zu fragen, ob zu essen gut oder schlecht sei. In beiden Fällen geht es nicht um gut oder schlecht, sondern darum, wie viel am besten ist. Ein bestimmtes Maß an Migration ist sicherlich besser als keine Migration. Aber so wie übermäßiges Essen zu Fettleibigkeit führen kann, kann auch die Migration übermäßig sein. Ich werde zeigen, dass die Migration, wenn man nicht eingreift, zunehmen und damit wahrscheinlich übermäßig werden wird. Aus diesem Grund sind Migrationsbeschränkungen keine peinlichen Auswüchse von Nationalismus und Rassismus, sondern in allen wohlhabenden Gesellschaften immer wichtiger werdende Werkzeuge der Sozialpolitik. Peinlich ist nicht ihr Vorhandensein, sondern ihre unangemessene Gestaltung. Auch dies ist eine Folge des Tabus, das eine ernsthafte Diskussion über die Migration bisher verhindert hat.
Mit diesem Buch möchte ich das Tabu brechen. Ich weiß genau, dass dieses Unterfangen Risiken birgt – wie jeder Versuch, ein Tabu zu brechen. Die fundamentalistischen Wächter der Orthodoxie stehen mit ihren Fatwas bereit. Doch lassen Sie uns anfangen und als Erstes der Frage nachgehen, warum die Migration zunimmt.
1 Haidt (2012).
2 Benabou/Tirole (2011).
3 Wente (2012).
4 Dustmann u. a. (2003).
2 Warum die Migration zunimmt
NACH DEM AUSBRUCH des Ersten Weltkriegs haben die Länder ihre Grenzen für ein halbes Jahrhundert geschlossen. Kriege und Wirtschaftskrisen behinderten die Migration und hatten zur Folge, dass Einwanderer unwillkommen waren. In den 1960er-Jahren lebten die meisten Menschen in dem Land, in dem sie geboren waren. Aber in diesem halben Jahrhundert der Unbeweglichkeit fand in der Weltwirtschaft eine dramatische Veränderung statt: Zwischen den einzelnen Ländern tat sich eine Einkommenskluft auf.
Innerhalb der einzelnen Gesellschaften ist die Kurve der Einkommensverteilung hügelförmig: Die meisten Menschen befinden sich in der Mitte, während an dem einen Ausläufer die reiche und am anderen die arme Minderheit angesiedelt ist. Der statistische Hauptgrund dafür, dass das Einkommen in der Regel auf diese Weise verteilt ist, ist der Zufall: Die Menschen kommen zu ihrem Einkommen in sich wiederholenden Situationen, in denen sie Glück oder Pech haben, und ein kumulativer Prozess dieser Art erzeugt ein hügelförmiges Ergebnis. Wenn sich das Glück wie bei einer sogenannten »rollenden Wette« beim Pferderennen multipliziert, wird auch der Ausläufer immer länger, auf dem sich die reiche Minderheit befindet, da einige Menschen besonders reich werden. Diese multiplikativen Kräfte der Einkommensgenerierung sind so stark, dass die Verteilung der Einkommen in allen Ländern der Welt von ihnen bestimmt wird.
Doch die Einkommensverteilung zwischen den Ländern sah in den 1960er-Jahren völlig anders aus. Anstelle des Hügels in der Mitte gab es je einen Hügel an den Enden. Die Verteilung war, fachsprachlich ausgedrückt, bimodal; allgemeinverständlich gesagt: Es gab eine reiche und eine arme Welt. Und die reiche Welt wurde in noch nie dagewesenen Dimensionen reicher. Zum Beispiel stieg in Frankreich das Pro-Kopf-Einkommen zwischen 1945 und 1975 auf das Dreifache, weshalb man dort diesen Zeitraum auch die »goldenen dreißig Jahre« nennt. Um zu erklären, wie dieses neue Phänomen zustande kam, haben die Volkswirtschaftler die Wachstumstheorie ersonnen. Aber die arme Welt hatte damals und hat heute immer noch kein solches Wachstum zu verzeichnen. Um diese Spaltung und ihre Dauerhaftigkeit zu erklären, haben die Ökonomen die Entwicklungsökonomie entwickelt.
Vier Säulen des Wohlstands
IN DER DISKUSSION über die Migrationspolitik hängt viel davon ab, das man erkennt, warum manche Länder so viel reicher sind als andere. Deshalb möchte ich kurz darstellen, wie sich die Meinung der Fachleute und meine eigene Ansicht zu dieser Frage entwickelt haben. Als sich die Entwicklungsökonomie noch in den Kinderschuhen befand, lautete die übliche Erklärung für die erstaunlichen Einkommensunterschiede, sie seien in der unterschiedlichen Kapitalausstattung begründet. Arbeiter in Ländern mit hohen Einkommen seien produktiver, weil ihnen für ihre Arbeit wesentlich mehr Kapital zur Verfügung stünde als ihren Kollegen in armen Ländern. Diesen Erklärungsansatz haben die Ökonomen inzwischen fallen gelassen, denn sie mussten eine gravierende Veränderung in ihre Überlegungen einbeziehen: Das Kapital ist international beweglich geworden, es gibt riesige Geldströme über Ländergrenzen hinweg. In die armen Länder fließen sie jedoch kaum. Diese verfügen immer noch über sehr wenig Kapital, aber diese Tatsache kann nicht mehr als Hauptursache ihrer Armut betrachtet werden. Etwas anderes muss sowohl für den Kapitalmangel als auch für die Armut verantwortlich sein. Als mögliche Ursachen sind verschiedene Faktoren erwogen worden: falsche wirtschaftspolitische Entscheidungen, dysfunktionale Ideologien, nachteilige geografische Umstände, eine negative Arbeitsmoral, die Folgen des Kolonialismus und ein Mangel an Bildung. Für die meisten dieser Faktoren lassen sich vernünftige Gründe anführen, doch keiner von ihnen scheint als maßgebliche Erklärung zu taugen. Politische Entscheidungen beispielsweise werden nicht einfach so gefällt, sie sind das Ergebnis eines politischen Prozesses.
Ökonomen und Politologen neigen immer mehr zu Erklärungen, in deren Mittelpunkt die Frage danach steht, wie das betreffende Gemeinwesen organisiert ist. Das heißt: Wie gestalten politische Interessengruppen dauerhafte Institutionen, die anschließend die Entscheidungen beeinflussen.5 Nach einer verbreiteten Auffassung sind die wichtigsten Anfangsbedingungen des Wohlstands diejenigen, unter denen die politischen Eliten ein Interesse daran haben, ein Steuersystem aufzubauen. In Europa etwa brauchten sie, historisch gesehen, Einnahmen, um Militärausgaben zu finanzieren. Umgekehrt bewirkt ein Steuersystem, dass die Regierungen ein Interesse daran haben, die Wirtschaft zu fördern, und sich deshalb veranlasst sehen, die Rechtssicherheit zu stärken. Diese wiederum bringt Menschen dazu, zu investieren, denn sie können darauf vertrauen, dass ihre Produktivvermögen nicht enteignet werden. Investitionen treiben das Wachstum an. Auf diesem sicheren Fundament für Investitionen kümmern sich weitere Institutionen um die Verteilung der Einnahmen. Proteste der vielen Ausgeschlossenen zwingen die Reichen dazu, sogenannten »inklusiven« politischen Institutionen den Vorzug zu geben. Das Ergebnis ist eine »Demokratie der Hausbesitzer«.
In die gleiche Richtung weist die Auffassung, die entscheidende institutionelle Veränderung sei die Verlagerung der politischen Macht von räuberischen Eliten, die nur aus der produktiven Bevölkerung Profite schlagen wollen, hin zu kooperativeren Institutionen, die die allgemeinen Interessen schützen. Eine bedeutende neue Studie von Daron Acemoğlu und James Robinson betrachtet die englische Glorious Revolution von 1688. Sie führte zu einer Machtverschiebung vom König zum Parlament, es war das erste derartige Ereignis in der globalen Wirtschaftsgeschichte, das die industrielle Revolution auslöste und den Weg in Richtung weltweiten Wohlstand ebnete.
Diese Argumentation stellt die politischen und ökonomischen Institutionen in den Vordergrund. Dass demokratische Institutionen wichtig sind, zeigt sich daran, dass ein Wechsel an der Spitze sich nur dann deutlich auf die Wirtschaftsleistung auswirkt, wenn diese Institutionen schwach sind. Gute Institutionen schränken die Unwägbarkeiten ein, die sich ohne sie aus dem Charakter einzelner Führungskräfte ergeben würden.6 Förmliche politische und ökonomische Institutionen sind also wichtig: Länder mit hohen Einnahmen haben bessere Institutionen als solche mit geringen Einnahmen.
Aber demokratische politische Institutionen funktionieren nur, wenn die Bevölkerung hinreichend gut genug informiert ist, um die Politiker zu disziplinieren. Viele Themen sind komplex, wie beispielsweise die Migrationspolitik. Laut Keynes verarbeiten einfache Menschen solche Themen durch sogenannte Narrative – leicht verdauliche Miniaturtheorien, die Erklärungsmuster liefern.7 Solche Narrative verbreiten sich rasch und werden zu Allgemeingut, aber sie können die Wirklichkeit auch weit hinter sich lassen. Ein gutes Beispiel sind die Narrative über Krankheiten. Der Übergang von der Anschauung, dass Krankheiten auf Hexerei zurückzuführen seien, dahin, dass Keime die Verursacher sind, ist die Voraussetzung dafür, dass die öffentliche Gesundheit verbessert wird. In Europa wurde er im späten 19. Jahrhundert vollzogen. In Haiti ist er noch im Gang, doch sogar nach dem jüngsten Erdbeben misstrauten die Menschen noch den Krankenhäusern. Je nach ihrem Inhalt können Narrative Institutionen stützen, ergänzen oder untergraben. Das Narrativ »Die Deutschen tolerieren keine Inflation mehr« bildete das Fundament der Deutschen Mark. Für den Euro ist nirgends in Europa ein ähnliches Narrativ entstanden. Wie die Deutsche Mark besitzt er eine institutionelle Verteidigung, die aus zwei fiskalischen Regeln besteht. Diese wurden jedoch seit seiner Einführung im Jahr 2001 von siebzehn EU-Ländern gebrochen, darunter auch Deutschland. Der Euro ist ein mutiger, vielleicht aber tollkühner Versuch, die unterschiedlichen ökonomischen Narrative Europas an eine gemeinsame neue Institution anzupassen. Aber ein solches Vorhaben geschieht nur langsam und ist ungewiss. Selbst 2012 war die Inflation in Spanien, trotz einer Arbeitslosenquote von 27 Prozent, höher als in Deutschland; zudem hatte die anhaltend hohe Inflation die Wettbewerbsfähigkeit des Landes erheblich geschwächt. Narrative können sich entwickeln, aber sie spielen in jedem Fall eine Rolle.
Während Europa ein Beispiel für unterschiedliche ökonomische Narrative ist, beleuchtet ein Vergleich zwischen den Vereinigten Staaten und dem Südsudan, wie verschieden politische Narrative sein können. US-Präsident Bill Clinton gewann einen Wahlkampf mit dem berühmten Slogan »Auf die Wirtschaft kommt es an, Dummerchen!«. Eine Gesellschaft, die einer solchen Parole zustimmt, wird ein Netz politischer Institutionen nutzen, das sich deutlich von dem eines Landes unterscheidet, in dem das Narrativ »Die Nuer haben den Dinka unrecht getan« lautet.8 Ebenso wird eine Gesellschaft, die an die Aussage »Ausländische Investitionen bedeuten Arbeitsplätze« glaubt, eine nationale Investitionsbehörde völlig anders betreiben als eine Gesellschaft, die der Ansicht ist, »Ausländische Investitionen bedeuten Ausbeutung«. Falsche Narrative verschwinden irgendwann, aber bis dahin kann viel Zeit vergehen. Eine Ursache der großen Einkommensunterschiede könnte also darin bestehen, dass in Gesellschaften mit hohen Einkommen Institutionen von Narrativen gestützt werden, die funktionaler sind als jene, die in Gesellschaften mit niedrigen Einkommen verbreitet sind. Viele der Regeln, die das wirtschaftliche Verhalten bestimmen, sind jedoch informell, weshalb die Analyse über Institutionen und Narrative hinaus auf soziale Normen ausgedehnt werden kann. Zwei entscheidende Normen betreffen die Gewalt und die Kooperation. In einer gewalttätigen Gesellschaft gerät der Rechtsstaat ins Hintertreffen; Haushalte und Unternehmen müssen einen Teil ihrer Kräfte für die Sicherheit aufbringen. In gewisser Weise versuchen sie, dadurch Sicherheit zu erlangen, indem sie sich dafür entscheiden, arm zu bleiben und so weniger Angriffsfläche zu bieten.9 Die Fähigkeit zur Kooperation ist grundlegend für den Wohlstand: Viele Güter und Dienstleistungen sind »öffentliche Güter«, die am effektivsten durch kollektive Anstrengungen bereitgestellt werden. Die sozialen Grundlagen von Frieden und Kooperation sind also wichtig für das Wachstum und nicht direkt eine Folge vorhandener formeller Institutionen. Steven Pinker hat auf überzeugende Weise gezeigt, dass sich auf Gewalt bezogene Normen über viele Jahrhunderte hinweg in einzelnen Schritten radikal verändert haben.10 Ein früher Schritt ist der Übergang von Anarchie zu zentralisierter Macht – ein Weg, den Somalia noch vor sich hat. Ein weiterer Schritt, den viele Regime noch bewältigen müssen, ist der Übergang von Macht zu Autorität. Erst in jüngerer Zeit wurde der Schritt zu mehr Mitgefühl mit den Leiden anderer getan, bei gleichzeitiger Aufgabe der Normen von Klan- und Familienehre, wodurch Gewaltausbrüche an Akzeptanz verloren.
Die Grundlagen der Kooperation sind in spieltheoretischen Experimenten ausgiebig untersucht worden, sodass man heute recht gut über sie Bescheid weiß. Für eine dauerhafte Zusammenarbeit ist Vertrauen nötig. Das Ausmaß, in dem Menschen bereit sind, einander zu vertrauen, unterscheidet sich erheblich von Gesellschaft zu Gesellschaft. Bei einem hohen Maß an Vertrauen arbeiten die Menschen besser zusammen, und die sozialen Kosten der Kooperation sind geringer, da weniger Zwangsmaßnahmen erforderlich sind. Soziale Normen sind also ebenso wichtig wie formelle Institutionen. Die in Gesellschaften mit hohen Einkommen vorherrschenden Normen führen dazu, dass es ein geringeres Maß an zwischenmenschlicher Gewalt und ein höheres Maß an Vertrauen gibt als in denen, die in Gesellschaften mit geringem Einkommen vorherrschen.
Institutionen, Narrative und Normen fördern wiederum die Entstehung effektiver Organisationen, die es den Menschen ermöglichen, produktiv zu sein. Typischerweise beruht hohe Produktivität auf dem Zusammenwirken von Größe und Arbeitsmoral. Ökonomen wissen schon seit Langem, dass Größe produktiv ist: Große Organisationen sind in der Lage, Rationalisierungseffekte hervorzubringen. Aber erst in jüngster Zeit ist ihnen eine überzeugende Analyse der Arbeitsmoral gelungen. Anreize sind offensichtlich wichtig, aber der Nobelpreisträger George Akerlof hat zusammen mit Rachel Kranton neue Ansichten davon gezeigt, wie erfolgreiche Organisationen durch Identität motivieren. Ein effektiv arbeitendes Unternehmen bringt seine Mitarbeiter dazu, Identitäten anzunehmen, die der Produktivität förderlich sind.11 Akerlofs zentrale These ergibt sich aus einer einfachen Frage: »Was macht einen guten Klempner aus?« Für ihn ist weder die technische Ausbildung noch eine gute Bezahlung der entscheidende Punkt, sondern der Identitätssprung zu der Aussage »Ich bin ein guter Klempner«. Für einen Klempner, der diesen Sprung gemacht hat, wäre alles andere, als eine gute Arbeit zu leisten, nicht mit seiner Identität vereinbar. In der Privatwirtschaft zwingt der Konkurrenzdruck Organisationen dazu, ihre Mitarbeiter produktiv zu machen. Akerlof und Kranton zeigen, wie erfolgreiche Unternehmen tatsächlich Zeit und Energie darauf verwenden, dass ihre Mitarbeiter die Unternehmensziele verinnerlichen und so zu »Insidern« zu werden. Im öffentlichen Sektor zwingt die politische Verantwortlichkeit die Organisationen zum gleichen Vorgehen. Je höher der Anteil der Insider, umso produktiver ist die Arbeitnehmerschaft und desto besser geht es allen.
Eine Ursache für die finanzielle Lage armer Länder ist ein Mangel an effektiven Organisationen. Die einen sind zu klein, um Größenvorteile nutzen zu können, die anderen versäumen es – insbesondere im staatlichen Sektor –, ihre Mitarbeiter zu motivieren. Beispielsweise erscheinen Lehrer in vielen armen Ländern häufig nicht zur Arbeit; darüber hinaus mangelt es bei vielen an grundlegenden Fertigkeiten, wie zum Beispiel lesen und schreiben zu können. Die Folgen für den Bildungsstand sind verheerend, wie sich in internationalen Tests gezeigt hat.12 Solche Lehrer haben den entscheidenden Identitätssprung zu der Aussage »Ich bin ein guter Lehrer« offensichtlich noch nicht gemacht, was zum Teil den Organisationen, die sie beschäftigen, anzulasten ist.
Ich bezeichne die Kombination von Institutionen, Regeln, Normen und Organisationen eines Landes als dessen Sozialmodell. Selbst bei Ländern mit hohen Einkommen unterscheiden sich die Sozialmodelle erheblich. Die Vereinigten Staaten haben besonders starke Institutionen und Privatorganisationen, während ihre öffentlichen Organisationen um einiges schwächer sind als die europäischen. Japan wiederum hat wesentlich stärkere, auf Vertrauen beruhende Normen als die USA und Europa. Trotz aller Unterschiede im Detail besitzen jedoch alle Länder mit hohen Einkommen Sozialmodelle, die bemerkenswert gut funktionieren – das liegt wahrscheinlich daran, dass sich die Komponenten anpassen, um miteinander zu harmonieren. Beispielsweise werden sich Institutionen und Normen schrittweise verändern, um einem bestimmten Zustand der Narrative und Organisationen zu entsprechen. Diese Anpassung geschieht jedoch nicht automatisch. Im Gegenteil, über Jahrtausende hinweg gab es Hunderte unterschiedlicher Gesellschaften, bevor sich in einer von ihnen ein Sozialmodell herausbildete, das den Aufstieg des Wohlstands ermöglichte. Selbst die Glorious Revolution von 1688 wurde nicht in der Absicht unternommen, einen entfesselten Wohlstand auszulösen; ihr lag vielmehr eine Mischung aus religiösen Vorurteilen und politischem Opportunismus zugrunde. Das englische Sozialmodell, das im 18. Jahrhundert entstand, wurde in Amerika kopiert und verbessert, und das amerikanische Modell wiederum beeinflusste die soziale Revolution in Frankreich, das seinerseits seine neuen Institutionen mit Waffengewalt in Westeuropa verbreitete. Ich möchte damit einen entscheidenden Punkt hervorheben: Der Wohlstand, den der Westen heute genießt und der sich verspätet in andere Teile der Welt ausbreitet, ist nicht das Ergebnis irgendeines unvermeidlichen Fortschritts. Bis zum 20. Jahrhundert lebten die meisten Menschen überall jahrtausendelang in Armut. Ein hoher Lebensstandard war nicht die normale Belohnung für produktive Arbeit, sondern ein Privileg ausbeuterischer Eliten. Hätte sich nicht zufällig eine Kombination von Umständen herausgebildet, unter denen sich in jüngerer Zeit ein dem Wachstum förderliches Sozialmodell entwickeln konnte, wäre es wahrscheinlich bei diesem trostlosen Zustand geblieben. In armen Ländern sieht es noch immer so aus.
Wenn der Wohlstand der einkommensstarken Länder auf diesem Fundament beruht, hat es drastische Folgen für die Migration. Migranten fliehen zumeist aus Ländern mit nicht funktionierenden Sozialmodellen. Diese Tatsache und ihre Folgen sollte man sich etwas näher anschauen. Zum Beispiel könnte sie einen veranlassen, weniger bereitwillig in das gut gemeinte Mantra einzustimmen, man müsse »Respekt für andere Kulturen« aufbringen. Die Kulturen – oder Normen und Narrative – armer Gesellschaften stehen neben ihren Institutionen und Organisationen doch im Verdacht, die Hauptursache ihrer Armut zu sein. Greift man zu anderen Kriterien als der Frage, ob sie dem Wohlstand förderlich sind, können diese Kulturen im Vergleich mit den Sozialmodellen der einkommensstarken Gesellschaften auch gleich gut oder sogar besser abschneiden – zum Beispiel mögen sie hinsichtlich Menschenwürde, Menschlichkeit, künstlerischer Kreativität, Humor, Ehre und Tugend sogar vorzuziehen sein. Aber die Migranten selbst stimmen mit den Füßen ab und ziehen das einkommensstarke Sozialmodell vor. Die Erkenntnis, dass in den armen Ländern eine ökonomische Dysfunktionalität herrscht, ist jedoch kein Grund, sich gegenüber den dort lebenden Menschen herablassend zu verhalten; Menschen verdienen für beides Respekt: dafür, dass sie in einer feindlichen Umwelt zurechtkommen, und dafür, dass sie in einer freundlichen Erfolg haben. Aber sie sollte uns skeptisch machen gegenüber manchen allzu leichtfertigen Behauptungen des Multikulturalismus: Wenn ein anständiger Lebensstandard etwas Schätzenswertes ist, dann sind, an diesem Kriterium gemessen, eben nicht alle Kulturen gleich.