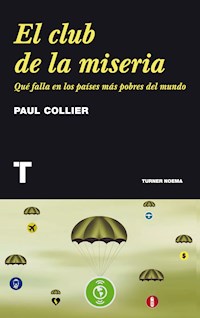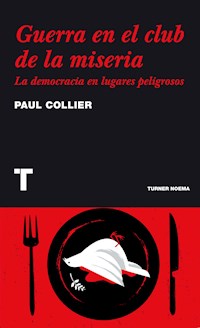9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der vielfach preisgekrönte Longseller jetzt in einer neuen Ausgabe
Die unterste Milliarde – das sind die ärmsten Menschen der Erde, die am weltweit steigenden Wirtschaftswachstum keinen Anteil haben. Ihre Lebenserwartung ist auf fünfzig Jahre gesunken, jedes siebte Kind stirbt vor dem fünften Lebensjahr. Seit Jahrzehnten befinden sich die Ökonomien dieser Länder im freien Fall – ohne Aussicht auf Besserung. In seinem vielfach preisgekrönten Bestseller erklärt Paul Collier, wie es zu dieser krassen Armut gekommen ist und was man gegen sie tun kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Paul Collier
DIE UNTERSTE MILLIARDE
Warum die ärmsten Länder scheitern und was man dagegen tun kann
Aus dem Englischen von Rita Seuß und Martin Richter
Pantheon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel The Bottom Billion. Why the poorest countries are failing and what can be done about it bei Oxford University Press, New York.
Pantheon-Ausgabe Februar 2017 Copyright © 2007 Paul Collier All rights reserved. Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Pantheon Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München,
unter Verwendung einer Abbildung von Harry Hook/Getty Images
Satz: Janß GmbH, Pfungstadt ISBN 978-3-641-20494-5 V002
Für Karl Hellenschmidt, der mir beigebracht hat, wie man denkt
Inhalt
Vorwort
Teil 1 Worum es geht
1. Zurückgefallen und zerfallen: Die unterste Milliarde
Teil 2 Die Fallen
2. Die Konfliktfalle
3. Die Ressourcenfalle
4. Ohne Zugang zum Meer und von schlechten Nachbarn umgeben
5. Schlechte Regierungsführung in einem kleinen Land
Teil 3 Zwischenfrage: Rettung durch Globalisierung?
6. Den Zug verpasst: Die weltwirtschaftliche Marginalisierung der untersten Milliarde
Teil 4 Die Instrumente
7. Rettung durch Entwicklungshilfe?
8. Militärische Intervention
9. Gesetze und Chartas
10. Handelspolitik zur Umkehr der Marginalisierung
Teil 5 Der Kampf um die unterste Milliarde
11. Eine Agenda zum Handeln
Anhang
Forschungsbeiträge, auf denen dieses Buch basiert
Register
Vorwort
1968 studierte ich in Oxford. Dort schloss ich mich den Revolutionären Sozialistischen Studenten Oxfords an, ein Name, der heute nicht einmal mehr ein müdes Lächeln hervorruft. Damals aber schien alles ganz einfach. Nach dem Studium wollte ich meine wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnisse in den Dienst Afrikas stellen. Den neuen Staaten Afrikas fehlte es an vielem, und kaum ein Afrikaner hatte Zugang zu einer Ausbildung wie ich. Viele meiner Kommilitonen in Oxford hatten damals Beziehungen zu Afrika, denn ihre Väter waren in der Kolonialverwaltung tätig gewesen. Ich nicht, mein Vater, der mit Geburtsnamen Karl Hellenschmidt hieß, war Metzger in Yorkshire und hatte die Schule mit zwölf Jahren verlassen. Aber einige dieser kolonialen Verbindungen müssen auf mich abgefärbt haben. Der Vater meines Freundes war Generalgouverneur des kleinen Njassaland gewesen, daher begann ich mich für dieses Land zu interessieren. Und was ich las, ließ in mir den Entschluss reifen, dorthin zu gehen. Umbenannt in Malawi, war es das ärmste Land des Kontinents. Es ist einfacher, ein Land umzubenennen als umzugestalten. Fünfunddreißig Jahre später ist es immer noch bettelarm. Ob das in weiteren fünfunddreißig Jahren sehr viel anders sein wird, wage ich zu bezweifeln, es sei denn, dass … Das vorliegende Buch handelt von diesem «Es sei denn, dass».
Malawi hat sich in den letzten fünfunddreißig Jahren kaum verändert – und ich mich in gewisser Weise ebenso wenig. Nach wie vor beschäftige ich mich mit Afrika, jetzt im Rahmen einer Professur in Oxford. Davor war ich Professor in Harvard und Direktor der Forschungsabteilung der Weltbank. Joseph Stiglitz hatte mich geholt, um die ärmsten Länder näher ins Blickfeld zu rücken. Mein erster Einsatz für die Weltbank führte mich nach Äthiopien. Ich war frisch verheiratet, und es war meine Hochzeitsreise, wenn auch in Begleitung von Joe anstelle meiner Frau. Zum Glück brachte sie Verständnis auf. Sei es aus Zufall oder weil sich Gleichgesinnte anziehen, hatte sie nach dem Studium in Malawi gearbeitet.
Das vorliegende Buch handelt von den Malawis und Äthiopiens dieser Welt, einer Minderheit unter den Entwicklungsländern, die heute das Schlusslicht des Weltwirtschaftssystems bilden. Einige, wie Malawi, rangierten schon immer ganz unten. Anderen, wie Sierra Leone, ging es einmal besser als Indien oder China. Die Länder, die heute das Schlusslicht bilden, sind nicht nur die allerärmsten, sie haben auch kein Wirtschaftswachstum und weichen damit vom Entwicklungsmuster der meisten anderen Länder ab. Sie haben den Anschluss verpasst. Mit dem steilen Wirtschaftswachstum ehemals armer Staaten wie Indien und China wurden das globale Bild der Armut verwischt und divergierende Entwicklungen übertüncht. Sicher, damit es einigen Ländern vergleichsweise besser ging, musste es anderen vergleichsweise schlechter gehen. Aber der Niedergang der Länder, die heute das Schlusslicht bilden, übersteigt jede Verhältnismäßigkeit. In vielen Fällen ist er absolut. Viele dieser Länder fallen nicht nur zurück, sie zerfallen regelrecht.
Mein Forschungsschwerpunkt der letzten Jahre war der Bürgerkrieg. Ich wollte verstehen, warum Gewaltkonflikte zunehmend in afrikanischen Ländern mit niedrigem Einkommen ausbrechen. Im Laufe der Zeit entwickelte ich das Konzept der «Konfliktfalle». Es besagt, dass bestimmte wirtschaftliche Bedingungen ein Land für einen Bürgerkrieg anfällig machen und dass, ist ein solcher Krieg erst einmal im Gange, die Spirale der Gewalt zur Falle wird, aus der sich das Land nur schwer wieder befreien kann. Diese Theorie der Konfliktfalle war eine Erklärung dafür, warum bestimmte Länder heute am untersten Ende der Weltwirtschaft stehen. Aber das war nicht die ganze Geschichte. Malawi hatte in den Jahrzehnten seit seiner Unabhängigkeit keinen einzigen Bürgerkrieg erlebt und sich trotzdem nicht weiterentwickelt. Dasselbe gilt für Kenia und Nigeria – Länder, über die ich Bücher geschrieben habe und die mit Malawi oder auch miteinander kaum etwas gemeinsam haben. Auch glaube ich nicht, dass Armut an sich bereits eine Entwicklungsfalle darstellt. Diese Fehlentwicklungen vollzogen sich vor dem Hintergrund eines globalen Entwicklungsfortschritts: Der Mehrzahl der Menschen gelingt es, sich aus der Armut zu befreien. Seit 1980 befindet sich erstmals in der Geschichte die globale Armut auf dem Rückzug. Aber das Problem beschränkte sich nicht auf Afrika allein. Auch andernorts blieb der Entwicklungsfortschritt aus, in Haiti, Laos und Birma, in den Ländern Zentralasiens und, am spektakulärsten, in Afghanistan. In Anbetracht der Verschiedenheit all dieser Länder kann es keine für alle gleichermaßen gültige Erklärung für das Scheitern der wirtschaftlichen Entwicklung geben.
Die selbstverständliche Akzeptanz einiger monokausaler Theorien zu diesem Problem hat unter den Akademikern das Spezialistentum gefördert. Sie sind ohnehin darin geschult, ein grelles, aber eng begrenztes Schlaglicht auf ein Problem zu werfen. Ich für meine Person dagegen habe im Laufe meiner wissenschaftlichen Tätigkeit Bücher über die Entwicklung ländlicher Räume, über Arbeitsmärkte, makroökonomische Schocks, Handelspolitik und Gewaltkonflikte geschrieben. Eine Zeitlang arbeitete ich mit Joseph Stiglitz zusammen, der sich für alles interessierte und oft etwas Geniales zu sagen hatte. Dieses breite Themenspektrum hat seine Vorteile. Ich erkannte, dass es vier verschiedene Fallen gibt, die das Scheitern der Länder in absoluter Armut erklären können. Betroffen sind eine Milliarde Menschen. Wenn nichts unternommen wird, werden sich diese Länder in den kommenden Jahrzehnten noch weiter von der Weltwirtschaft abkoppeln und ein Ghetto des Elends und der Unzufriedenheit bilden.
Diese Länder haben grundlegend andere Probleme als die anderen sogenannten «Entwicklungsländer» – also praktisch alle außer den reichen Ländern mit nur einem Sechstel der Weltbevölkerung –, um die wir uns in den vergangenen vierzig Jahren gekümmert haben. Der Begriff «Entwicklungsland» wurde so definiert, dass er fünf der sechs Milliarden Menschen weltweit einschloss. Aber nicht alle Entwicklungsländer sind gleich. Die wirtschaftlich gescheiterten kämpfen mit gravierenden Problemen, die die erfolgreichen, aufstrebenden Länder nicht kennen. Tatsächlich haben wir uns bisher mit dem weniger komplizierten Teil der globalen Entwicklung befasst; der schwierigere wartet noch. Aber wir müssen weitermachen, weil ein Ghetto mit einer Milliarde verelendeter Menschen von einer Welt im Wohlstand immer weniger hingenommen werden kann.
Bedauerlicherweise besteht die Lösung nicht darin, diesen Ländern unser Geld zu geben. Das wäre relativ einfach, schließlich ist ihre Zahl begrenzt. Abgesehen von ein paar wichtigen Ausnahmen kann Entwicklungshilfe, zumindest in der bisher praktizierten Form, diese Länder nicht wirklich voranbringen. Der Wandel dieser Gesellschaften muss von innen kommen, wir können ihn nicht von außen verordnen. In all diesen Ländern gibt es Kämpfe zwischen den Mutigen und Unerschrockenen, die eine Veränderung wollen, und den Kräften, die ihre Interessen verteidigen und sich diesem Wandel entgegenstellen. Bisher waren wir vorwiegend Zuschauer dieses Kampfes. Wir können sehr viel mehr tun, um die Reformer zu stärken. Aber dazu müssen wir Instrumente nutzen – militärische Interventionen, internationale Standards und handelspolitische Maßnahmen –, die bisher anderen Zwecken dienten. Die Organisationen, die den Einsatz dieser Instrumente kontrollieren, kennen weder die Probleme der ärmsten Milliarde, noch haben sie ein Interesse daran, sie zu lösen. Sie – und auch die Regierungen – werden lernen müssen, dieses breite Spektrum politischer Maßnahmen zu koordinieren.
Solche Denkanstöße eröffnen Horizonte über alle politischen Gräben hinweg. Die Linke wird erkennen müssen, dass Optionen, die sie bisher abgelehnt hat, zum Beispiel militärische Interventionen, Handel und Wachstumsanreize, entscheidende Maßnahmen sein können, um seit langem angestrebte Ziele zu verwirklichen. Die Rechte wird erkennen müssen, dass, anders als bei der globalen Armutsbekämpfung, das Problem der ärmsten Milliarde nicht automatisch durch globales Wachstum lösbar ist und dass das Versäumnis, es zu lösen, für unsere Kinder sicherheitspolitisch ein Albtraum sein wird. Wir können und wir müssen Abhilfe schaffen. Aber dafür müssen wir gemeinsam handeln.
Wir alle haben umzudenken – nicht nur die Entwicklungsagenturen, auch die demokratische Öffentlichkeit, deren Votum Gestalt werden lässt, was machbar ist. Ohne eine informierte Wählerschaft werden die Politiker auch in Zukunft die Ärmsten der Armen nur als Gelegenheit für ein öffentlichkeitswirksames Foto ansehen und keinen echten Wandel in Gang setzen. Dieses Buch ist ein Versuch, zum Umdenken beizutragen. Es soll lesbar sein, weshalb ich auf Fußnoten und den sonst üblichen wissenschaftlichen Apparat verzichtet habe. Die Lektüre soll Spaß machen, was nicht heißen kann, dass das, was ich zu sagen habe, amüsant ist. Meine Ausführungen stützen sich auf eine Vielzahl von Forschungsberichten und Arbeitspapieren, die in Fachzeitschriften veröffentlicht und in wissenschaftlichen Kreisen diskutiert wurden. Einige dieser Materialien sind am Ende des Buches aufgelistet.
Wissenschaftliche Forschung gleicht nicht selten einer langwierigen Suche. Am Anfang steht eine Frage, auf die es keine Antwort zu geben scheint. Zum Beispiel: Wie viel Entwicklungshilfe fließt in die Rüstungsausgaben? Oder: In welchem Umfang fließt Kapital aus dem afrikanischen Kontinent ab? Wie würden Sie, der Leser, vorgehen, um Antworten auf solche Fragen finden? Etwa die Armeen sämtlicher Dritte-Welt-Länder fragen, woher ihr Geld stammt? Oder bei den Schweizer Banken anklopfen und bitten, ihre afrikanischen Konten offenzulegen? Es gibt noch einen anderen Weg, den Weg der Statistiken. Statistiken widerlegen die grob gerasterten Bilder, die uns oft glauben machen, wir wüssten über die Welt Bescheid. Bei Rebellion zum Beispiel denken wir sofort an Che Guevara, der als Poster an den Wänden der Studentenbuden meiner Generation allgegenwärtig war. Das Poster ersetzte eigenständiges Denken. Unsere Vorstellungen über die Probleme der ärmsten Länder sind geprägt von solchen Bildern – Bildern von edlen Rebellen, hungernden Kindern, herzlosen Unternehmern, betrügerischen Politikern. Diese Bilder nehmen unser Denken in Beschlag – und auch das Denken der Politiker, die tun, was wir von ihnen verlangen. Ich möchte die Leser von diesen Bildern wegführen, einige werde ich ganz zertrümmern. Mein Werkzeug dafür sind statistische Daten.
Bei meinen statistischen Analysen stand mir ein Team junger Mitarbeiter zur Seite, mit denen der Leser auf den folgenden Seiten Bekanntschaft machen wird. Eine von ihnen, Anke Hoeffler, hat einen bedeutenden Anteil an diesem Buch. Wir arbeiten seit zehn Jahren zusammen, ein eingespieltes Duo, bei dem ich die Rolle des ewig nervigen Professors spiele, während Anke sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und unbeirrt weitermacht. Wenn man an Morse und Lewis aus der berühmten englischen Krimiserie denkt, liegt man gar nicht so falsch. Wie bei diesen beiden Fernsehhelden gibt es auch in unserer Forschung viele Fehlstarts. Doch obwohl ich, wie Morse, in Oxford lebe, arbeite ich, anders als er, mit einem internationalen Team. Wie man vielleicht schon erraten hat, kommt Anke aus Deutschland. Zu meiner Arbeitsgruppe gehören aber auch Måns aus Schweden und Lisa aus Frankreich. Steve ist irischstämmiger Amerikaner, Cathy Afroamerikanerin, Victor kommt aus Sierra Leone und Phil aus Australien. Das sind nur einige aus einer langen Liste, aber es reicht wohl, um eine Vorstellung zu vermitteln. Allen meinen Mitarbeitern gemeinsam ist eine geduldige, gewissenhafte Beharrlichkeit und die Intelligenz, die man braucht, um sich komplexe Fertigkeiten anzueignen. Ohne sie gäbe es dieses Buch nicht, denn es gäbe keine Ergebnisse, auf die ich mich stützen könnte. Das vorliegende Buch ist das große Bild, das sich ergibt, wenn man alle Punkte miteinander verbindet. Aber jeder dieser Punkte ist eine Geschichte für sich. Es ist zwar kein Buch über wissenschaftliche Forschungsmethoden, aber ich hoffe, der Leser bekommt einen Begriff von der modernen wissenschaftlichen Arbeitsweise und eine Ahnung von dem elektrisierenden Gefühl, wenn man eine schwierige Frage gelöst hat.
Teil 1 WORUM ES GEHT
Kapitel 1 Zurückgefallen und zerfallen: Die unterste Milliarde
Die Dritte Welt ist kleiner geworden. Vierzig Jahre lang stand in der Entwicklungspolitik die reiche Welt mit einer Milliarde Menschen einer armen Welt mit fünf Milliarden Menschen gegenüber. Die Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die den Entwicklungsfortschritt bis 2015 definieren, sind symptomatisch für dieses Denken. Aber 2015 wird sich zeigen, dass dieses Entwicklungskonzept überholt ist. Denn die meisten dieser fünf Milliarden, rund 80 Prozent, leben in Ländern, die sich tatsächlich entwickeln, oft mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Die eigentliche Herausforderung der Entwicklungspolitik besteht darin, dass eine Gruppe von Ländern am untersten Rand immer weiter zurückfällt und oft regelrecht zerfällt.
Diese Länder ganz unten gehören zwar zur Welt des 21. Jahrhunderts, aber ihre Lebenswirklichkeit ist die des 14. Jahrhunderts: Bürgerkrieg, Seuchen, Analphabetismus. Die meisten dieser Länder liegen in Afrika und Zentralasien, ein paar wenige in anderen Regionen. Noch in den neunziger Jahren, rückblickend das goldene Jahrzehnt zwischen dem Ende des Kalten Kriegs und dem 11. September 2001, gingen die Einkommen in den Ländern dieser Gruppe um 5 Prozent zurück. Wir müssen uns daran gewöhnen, das vertraute Zahlenverhältnis auf den Kopf zu stellen: insgesamt fünf Milliarden Menschen leben heute bereits im Wohlstand oder sind auf dem Weg dorthin, eine Milliarde fällt immer weiter zurück.
Dieses Problem geht nicht nur die eine Milliarde Menschen an, die unter den Bedingungen des 14. Jahrhunderts leben und sterben. Es geht uns alle an. Die Welt des 21. Jahrhunderts mit ihrem materiellen Wohlstand, ihren globalen Verkehrsströmen und wirtschaftlichen Vernetzungen wird von diesen großen Inseln des Chaos in Zukunft immer weniger unberührt bleiben. Und das Problem drängt schon jetzt. Je weiter sich diese eine Milliarde von einer zunehmend komplexeren Weltwirtschaft abkoppelt, desto schwieriger wird es, sie noch zu integrieren.
Und doch wird dieses Problem geleugnet – von denen, die das Geschäft der Entwicklung betreiben, wie auch von denen, die für den entsprechenden Medienrummel sorgen. Das Geschäft der Entwicklungshilfe wird von den Entwicklungsagenturen und von Unternehmen besorgt, die für deren Projekte die Verträge bekommen. Sie werden gegen diese Eine-Milliarde-These mit der Beharrlichkeit bürokratischer Apparate kämpfen, die ihre Existenz gefährdet sehen, denn sie sind damit zufrieden, wie es ist. Allein die althergebrachte Lesart von den fünf Milliarden, die der Entwicklungshilfe bedürfen, verschafft ihnen die Legitimation, überall zu sein – überall, nur nicht bei der untersten Milliarde. Denn dort, ganz unten, geht es harsch zu. Die Entwicklungsagenturen haben Schwierigkeiten, Mitarbeiter in den Tschad oder nach Laos zu beordern; die glanzvollen Posten sind Länder wie Brasilien und China. In jedem größeren Land mit einem mittleren Einkommen unterhält die Weltbank ein großes Büro, in der Zentralafrikanischen Republik hat sie keinen einzigen Vertreter. Es ist also kaum zu erwarten, dass diejenigen, die das Geschäft der Entwicklungshilfe betreiben, freiwillig umdenken.
Der mediale Entwicklungshilferummel wird von Rockstars, Prominenten und Nichtregierungsorganisationen besorgt. Zu ihrer Ehrenrettung muss gesagt werden, dass sie tatsächlich die Not jener ärmsten einen Milliarde im Blick haben. Dank dieses Rummels steht Afrika heute auf der Agenda der G8. Aber kein Medienspektakel ohne Slogans, Bilder und starke Emotionen, und deshalb klingen die Botschaften zwangsläufig simpel. Die Not der untersten Milliarde eignet sich bestens zum plumpen Moralisieren, einer Lösung des Problems ist dies bedauerlicherweise nicht dienlich. Dafür bedarf es konzertierter Maßnahmen, von denen einige unserem spontanen Gefühl zuwiderlaufen. Um eine solche Agenda zu formulieren, muss man seine Augen und Ohren den Bildern und Tönen verschließen, die ans Herz gehen, aber bisweilen den Verstand nicht erreichen.
Und die Regierungen dieser ärmsten Länder? Die herrschenden Bedingungen bringen Extreme hervor. Einige dieser politischen Führer sind Psychopathen, die sich den Weg an die Macht freigeschossen haben, andere sind Halunken, die sich die Macht mit Geld erkauft haben, wieder andere gehören zu den Wagemutigen, die trotz aller Widrigkeiten ihr Land in eine bessere Zukunft führen wollen. Selbst das Bild eines modernen Staates, das die politischen Führer dieser Länder in der Öffentlichkeit abzugeben bemüht sind, ist oft nur Fassade; als würden sie vom Drehbuch ablesen. Sie sitzen an internationalen Verhandlungstischen wie der Welthandelsorganisation, aber sie haben nichts zu verhandeln. Sie bleiben auf ihren Plätzen, selbst wenn in ihrem Land der GAU längst stattgefunden hat. Die Regierung Somalias blieb auf der internationalen Bühne noch jahrelang offiziell «vertreten», obwohl Somalia selbst längst keine funktionierende Regierung mehr hatte. Man darf also nicht erwarten, dass sich die Regierungen dieser untersten Milliarde zusammenschließen und einen Strategieplan erarbeiten. Schurken die einen, Helden die anderen, und einige sind nur noch als Phantome existent. Damit unsere Welt auch in Zukunft bewohnbar ist, müssen die Helden ihren Kampf gewinnen. Aber die Schurken verfügen über die Gewehre und das Geld, und bisher haben sie stets die Oberhand behalten. Und das wird auch so bleiben, solange wir unser Grundkonzept nicht radikal ändern.
Alle Gesellschaften waren einmal arm. Den meisten gelingt es heute, einen Weg aus dieser Armut zu finden. Warum nicht allen? Die Antwort lautet: Entwicklungsfallen. Armut wird nicht zwangsläufig zur Falle, sonst wären wir alle heute noch arm. Man könnte sich den Entwicklungsprozess bildlich veranschaulichen: In den modernen globalisierten Gesellschaften gibt es phantastische Aufstiegsleitern. Aber es gibt auch Rutschen, und einige Gesellschaften sind auf diese abschüssige Bahn geraten. Die Länder ganz unten bilden zwar eine unglückliche Minderheit, aber sie rutschen immer weiter ab.
Entwicklungsfallen und die Länder, die in ihnen gefangen sind
Nehmen wir an, das Land, in dem Sie leben, ist bettelarm, es herrscht wirtschaftliche Stagnation, und nur wenige Menschen haben eine Schulbildung. Es ist gar nicht so schwer, sich das vorzustellen, wir brauchen nur an unsere Vorfahren zu denken. Durch harte Arbeit, Sparsamkeit und Intelligenz kann mit der Zeit jede Gesellschaft der Armut entkommen, es sei denn, sie steckt in einer Falle. Über solche Fallen, die Fortschritt verhindern, wird in akademischen Kreisen gern debattiert, und der Graben der divergenten Standpunkte verläuft, kaum verwunderlich, zwischen Rechten und Linken. Die Rechten neigen dazu, die Existenz solcher Entwicklungsfallen rundweg zu leugnen und zu behaupten, jedes Land, das eine gute Wirtschaftspolitik betreibe, könne die Armut überwinden. Die Linken wiederum neigen dazu, den globalen Kapitalismus für die Armutsfalle verantwortlich zu machen.
Das Konzept der Entwicklungsfalle ist nicht neu, in jüngster Zeit wurde es mit den Arbeiten des Ökonomen Jeffrey Sachs in Verbindung gebracht. Sachs’ Forschungsschwerpunkt bildet die Frage nach den Auswirkungen von Malaria und anderen Krankheiten. Malaria hält ein Land in der Armut fest. Der potentielle Markt eines armen Landes wiederum ist für Pharmaunternehmen nicht attraktiv genug, um riesige Geldsummen in die Forschung und Entwicklung eines Impfstoffs zu investieren. Dieses Buch handelt von vier Fallen, die bisher weniger Beachtung fanden: die Konfliktfalle, die Ressourcenfalle, die Falle eines Landes ohne Zugang zum Meer und umgeben von schlechten Nachbarn und die Falle der schlechten Regierungsführung in einem kleinen Land. Wie so viele heute aufstrebende Entwicklungsländer sind auch die Länder, um die es in diesem Buch geht, arm. Was sie indes von den erfolgreichen unterscheidet ist, dass sie aus diesen Fallen nicht herausfinden. Tatsächlich aber gibt es Wege aus diesen Fallen, und im Laufe der Jahre konnten sich einige Länder aus ihnen befreien und haben begonnen aufzuholen. In jüngster Zeit allerdings ist dieser Aufholprozess ins Stocken geraten. Die Länder, die sich erst im Laufe der letzten zehn Jahre aus den Fallen befreit haben, sehen sich mit einer neuen Schwierigkeit konfrontiert: Der Weltmarkt ist heute neuen Wettbewerbern gegenüber sehr viel feindseliger eingestellt als noch in den achtziger Jahren. Die Länder, die erst in jüngster Zeit ihren Fallen entkommen sind, haben womöglich den Zug verpasst und befinden sich jetzt in einer Art Zwischenzustand, einer Schwebe, in der das Wachstum durch äußere Faktoren behindert wird; darauf werde ich bei der Erörterung der Globalisierung näher eingehen. Als sich Mauritius in den achtziger Jahren aus den Fallen befreite, schoss das Pro-Kopf-Einkommen steil nach oben und erreichte ein mittleres Niveau. Als das benachbarte Madagaskar es zwanzig Jahre später endlich auch schaffte, den Fallen zu entkommen, sprang der Entwicklungsmotor nicht an.
Die meisten Länder tappen nicht in die Fallen, von denen in diesem Buch die Rede ist. Der Rest mit einer Gesamtbevölkerung von rund einer Milliarde sitzt darin fest. Ein paar grundsätzliche begriffliche Differenzierungen vorab: Eine der Fallen ist der fehlende Zugang zum Meer, obwohl die Charakterisierung eines Landes als Binnenstaat allein nicht ausreicht, damit daraus eine Falle wird. Aber wann ist ein Land ein Binnenstaat? Man möchte meinen, ein Blick in den Atlas genügt. Aber wie steht es beispielsweise mit einem Land wie Zaire, das sich nach der verheerenden Herrschaft Präsident Mobutus verständlicherweise in Demokratische Republik Kongo umbenannt hat? Es ist realiter ein Binnenstaat, obwohl es über einen winzigen Küstenstreifen verfügt. Und ein Land wie der Sudan wiederum hat zwar eine nennenswerte Küste, der Großteil seiner Bevölkerung aber lebt fernab im Landesinnern.
Bei der Definition dieser Fallen musste ich manchmal etwas willkürlich verfahren, um den Preis, dass gewisse Grauzonen entstanden. Die meisten Entwicklungsländer sind unverkennbar auf dem Weg zum Erfolg. Einige steuern unverkennbar auf ein schwarzes Loch zu. Bei anderen lässt sich die Entwicklung nicht genau einschätzen. Vielleicht ist Papua-Neuguinea ein aufstrebendes Land. Ich hoffe es, und entsprechend habe ich es klassifiziert. Es gibt jedoch Experten, die darüber nur fassungslos den Kopf schütteln. Ermessensentscheidungen sind immer angreifbar. Aber damit ist noch lange nicht die zugrunde liegende These in Frage gestellt: dass es nämlich ein schwarzes Loch gibt, und dass viele Länder auf dieses schwarze Loch zusteuern und nicht auf dem Weg zum Erfolg sind. Im Laufe dieses Buches werden wir solchen Ermessensentscheidungen noch öfter begegnen. Gehen Sie aber vorerst getrost davon aus, dass ich die argumentativen Entscheidungslinien so gezogen habe, dass sie Angriffen standhalten.
Entsprechend meinen Definitionen lebten im Jahr 2006 rund 980 Millionen Menschen in solchen Fallen-Ländern. Da deren Bevölkerung stetig wächst, wird diese Zahl zu dem Zeitpunkt, da Sie dieses Buch lesen, auf rund eine Milliarde gestiegen sein. 70 Prozent dieser Menschen leben in Afrika, und die meisten Afrikaner leben in Ländern, die in der einen oder anderen dieser Fallen feststecken. Afrika ist somit der Kontinent, auf dem sich diese Probleme bündeln. Das hat der Rest der Welt inzwischen erkannt. Man denke nur daran, wie Kommissionen zur internationalen Entwicklungspolitik im Laufe der Zeit ihren Schwerpunkt verlagert haben. Die erste größere Entwicklungshilfekommission wurde 1970 unter Vorsitz eines ehemaligen kanadischen Ministerpräsidenten einberufen. Im Brennpunkt der Pearson-Kommission standen globale Entwicklungsprobleme. 1980 folgte eine Kommission unter Leitung eines ehemaligen deutschen Bundeskanzlers. Die Brandt-Kommission hatte dieselbe globale Perspektive. 2005, als der britische Premierminister Tony Blair beschloss, eine Entwicklungshilfekommission zu gründen, hatte sich der Fokus bereits auf Afrika verengt: Es war eine Kommission für Afrika, nicht für Entwicklungspolitik. 2006 beschloss der deutsche Bundespräsident Horst Köhler, eine eigene derartige Initiative ins Leben zu rufen. Um Tony Blair nicht zu kopieren und ein Jahr nach ihm schon wieder eine Kommission für Afrika zu gründen, nannte Köhler seine Initiative ein «Forum», dennoch war es ein Forum für Afrika. In Wirklichkeit aber ist Afrika nicht gleichbedeutend mit der Dritten Welt. Südafrika zum Beispiel zählt nicht zur untersten Milliarde – es befindet sich ganz klar nicht in der verzweifelten Lage des Tschad. Umgekehrt hat ein Großteil der Binnenstaaten Zentralasiens irritierend viele Ähnlichkeiten mit dem Tschad. Die Länder der untersten Milliarde bilden also keine einheitliche Gruppe, die man unter einem einfachen geographischen Kürzel fassen könnte. Ein geographisches Kürzel wäre allenfalls «Afrika +», wobei das «+» für Länder wie Haiti, Bolivien, die zentralasiatischen Staaten, Laos, Kambodscha, den Jemen, Birma und Nordkorea steht. Sie alle stecken immer noch in einer Entwicklungsfalle fest oder haben sich viel zu spät daraus befreit.
Nach meiner Definition fallen achtundfünfzig Länder in diese Kategorie, und sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind klein. Die Gesamtzahl der Menschen, die in diesen Ländern leben, ist geringer als die Bevölkerung Indiens oder Chinas. Und weil ihr Pro-Kopf-Einkommen sehr niedrig ist, ist das Einkommen eines solchen Landes eine zu vernachlässigende Größe. Die meisten Städte der reichen Welt verfügen über ein höheres Einkommen. Da kein Land gern einer solchen Gruppe zugerechnet werden möchte und weil Stigmatisierung den Misserfolg gleichsam vorprogrammiert, verzichte ich hier auf eine Liste dieser Länder. Bei der Erörterung der Entwicklungsfallen werde ich aber zahlreiche Beispiele nennen.
Wie geht es diesen Ländern der untersten Milliarde? Betrachten wir zunächst, wie die Menschen leben oder vielmehr sterben. Die durchschnittliche Lebenserwartung dieser untersten Milliarde beträgt fünfzig Jahre, in den anderen Entwicklungsländern sind es siebenundsechzig Jahre. Die Kindersterblichkeit – der Anteil der Kinder, die vor Vollendung des fünften Lebensjahres sterben – beträgt 14 Prozent, in den anderen Entwicklungsländern sind es 4 Prozent. Der Anteil der Kinder mit chronischer Mangelernährung beträgt in den Ländern der untersten Milliarde 36 Prozent gegenüber 20 Prozent in den anderen Entwicklungsländern.
Die Bedeutung des Wachstums für die Entwicklung
Gab es diese Kluft zwischen der untersten Milliarde und den übrigen Entwicklungsländern schon immer, oder hat sie sich erst mit den Entwicklungsfallen aufgetan? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die statistischen Daten, mit deren Hilfe in der Vergangenheit die als «Entwicklungsländer» definierten Staaten beschrieben wurden, aufschlüsseln. Ein hypothetisches Beispiel: Prosperia hat eine große Wirtschaft mit 10 Prozent Wachstum, aber nur eine kleine Bevölkerung. Katastrophia hat eine kleine Wirtschaft mit 10 Prozent Minuswachstum, aber eine große Bevölkerung. Der gängige Ansatz – den beispielsweise der Internationale Währungsfonds in seinem World Economic Outlook verfolgt – besteht darin, aus den Daten zur Größe einer Volkswirtschaft einen Durchschnittswert zu ermitteln. Diesem Ansatz entsprechend treibt die große, boomende Wirtschaft von Prosperia den Durchschnittswert nach oben, so dass beide Länder im Aggregat als «aufstrebend» klassifiziert werden. Das Problem dabei ist, dass die wirtschaftliche Entwicklung auf Grundlage der durchschnittlichen Einkommenseinheit beschrieben wird, nicht auf Grundlage des durchschnittlichen Einwohners. Die meisten Einkommenseinheiten hat Prosperia, aber die meisten Menschen leben in Katastrophia. Um zu ermitteln, wie der durchschnittliche Einwohner in den Ländern der untersten Milliarde lebt, müssen wir mit Zahlen arbeiten, denen nicht das Einkommen eines Landes, sondern dessen Bevölkerung zugrunde liegt. Macht das einen Unterschied? Ja, und zwar dann, wenn die Diskrepanz zwischen den ärmsten Ländern und den übrigen sehr groß ist. Das ist die These dieses Buches. Denn errechnet man Durchschnittswerte anhand des Einkommens, fallen die ärmsten Länder durch den Rost. Die konkreten Lebensumstände ihrer Bevölkerung zählen nicht viel, eben weil die Leute arm sind. Ihr Einkommen ist eine zu vernachlässigende Größe.
Und was ergeben die korrekten Durchschnittswerte? Die Entwicklungsländer, die nicht zur untersten Milliarde gehören – also die mittleren vier Milliarden – verzeichnen ein kontinuierlich wachsendes Pro-Kopf-Einkommen. In Zehnjahreszeiträumen gerechnet, betrug das jährliche Wachstum in den siebziger Jahren 2,5 Prozent – eine hoffnungsvolle, aber keineswegs spektakuläre Entwicklung. In den achtziger und neunziger Jahren stieg die Wachstumsrate auf 4 Prozent und zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf über 4,5 Prozent pro Jahr. Diese Wachstumsraten klingen vielleicht nicht sensationell, aber sie sind historisch ohne Beispiel. In diesen Ländern werden die Kinder ein grundlegend anderes Leben führen als ihre Eltern. Selbst wenn die Bevölkerung immer noch arm ist, keimt in diesen Gesellschaften Hoffnung auf: die Zeit ist auf ihrer Seite.
Und wie steht es mit der untersten Milliarde? Betrachten wir auch hier Zehnjahreszeiträume. In den siebziger Jahren stieg ihr Pro-Kopf-Einkommen um 0,5 Prozent jährlich. Absolut betrachtet, ist das eine leichte Verbesserung, aber dieses Wachstum war praktisch kaum spürbar. Angesichts der starken Schwankungen der individuellen Einkommen in diesen Ländern wurde die leichte Aufwärtstendenz des Gesamtwachstums aufgehoben. Das Grundgefühl solcher Gesellschaften war die Angst, den Anschluss zu verlieren, und nicht Hoffnung, die sich aus gesamtgesellschaftlichem Fortschritt speist. In den achtziger Jahren aber schnitt diese untere Milliarde noch sehr viel schlechter ab, der Wachstumsrückgang betrug 0,4 Prozent jährlich. Absolut betrachtet, waren diese Länder Ende der achtziger Jahre wieder da, wo sie 1970 gewesen waren. Wer über diesen ganzen zwanzigjährigen Zeitraum hinweg in einem dieser Länder lebte, kannte nur die Erfahrung individueller Instabilität: einigen ging es besser, einigen schlechter. Es gab keinen Grund zu allgemeiner, die ganze Gesellschaft erfassende Hoffnung. Dann kamen die neunziger Jahre. Sie gelten heute als das goldene Jahrzehnt zwischen dem Ende des Kalten Kriegs und dem 11. September 2001 – das Jahrzehnt boomender Märkte ohne ein Wölkchen am Horizont. Für die unterste Milliarde war es keine goldene Zeit. Ihr absoluter Wachstumsrückgang beschleunigte sich auf 0,5 Prozent jährlich. Am Ende des Jahrtausends waren sie noch ärmer als noch 1970.
Ist dieses deprimierende Abschneiden womöglich nur ein Artefakt der Daten? Meiner Ansicht nach ganz im Gegenteil: das eigentliche Problem, unter dem die Erhebung wirtschaftlicher Daten in den ärmsten Ländern leidet, ist doch, dass deren wirtschaftlicher Niedergang unterschätzt wurde. Für die Länder, die tatsächlich zerfallen sind, existieren keine brauchbaren Daten. Schätzungen zum wirtschaftlichen Niedergang dieser Länder in den neunziger Jahren lassen unberücksichtigt, was sich beispielsweise in Somalia oder in Afghanistan abgespielt hat. Und diese Länder unberücksichtigt zu lassen, kommt der Behauptung gleich, ihre Entwicklung entspräche exakt dem Durchschnitt der ausgewerteten Gruppe. Und ich wäre, gelinde gesagt, überrascht, wenn das stimmen sollte. In den ersten vier Jahren dieses Jahrzehnts stieg das Wachstum der untersten Milliarde um etwa 1,7 Prozent – ein Wert immer noch weit unterhalb der Wachstumsrate der übrigen Entwicklungsländer, absolut betrachtet jedoch eine deutliche Verbesserung. Diese positive Entwicklung beruht jedoch wahrscheinlich auf Kurzzeiteffekten, ausgelöst durch die Entdeckung von Rohstoffen, die die unterste Milliarde exportiert, und die aktuell hohen Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt. Bezüglich wirtschaftlicher Entwicklung ist der Shootingstar unter den Ländern der ärmsten Milliarde Äquatorialguinea. Vor der Küste dieses kleinen Landes, in dem Putsch und Korruption an der Tagesordnung sind, wurde kürzlich Erdöl entdeckt, das nun die wichtigste Einnahmequelle darstellt. Selbst wenn man in diesen neuesten Zahlen einen Hoffnungsschimmer sähe – was meines Erachtens eine Fehlinterpretation wäre –, fällt die höchste Wachstumsrate der untersten Milliarde immer noch sehr viel geringer aus als die niedrigste Wachstumsrate der übrigen Entwicklungsländer. Die Ärmsten der Armen sinken auf das Niveau von 1970 zurück.
Was bedeuten nun diese beiden Wachstumsraten im Vergleich? In den siebziger Jahren vergrößerte sich die Kluft zwischen der untersten Milliarde und den übrigen Entwicklungsländern um jährlich 2 Prozent. Damit war selbst damals das Hauptmerkmal der Gesellschaften der untersten Milliarde der wirtschaftliche Rückschritt, nicht die Aufwärtsentwicklung. Aber es kam noch schlimmer. In den achtziger Jahren vergrößerte sich diese Kluft auf 4,4 Prozent und in den neunziger Jahren sogar auf erstaunliche 5 Prozent jährlich. Im Verlauf dieser drei Jahrzehnte fiel also die unterste Milliarde massiv und immer schneller immer weiter zurück. Selbst geringe Unterschiede in der durchschnittlichen Wachstumsrate, sofern sie über Jahre und Jahrzehnte konstant bleiben, summieren sich und führen schließlich zu enormen Diskrepanzen im Lebensstandard. Diese Wachstumsdiskrepanz hat die meisten Länder der untersten Milliarde bereits heute ins globale Abseits gedrängt.
Das war nicht immer so. Bevor die Globalisierung Ländern wie China und Indien gigantische Wachstumschancen bescherte, waren sie ärmer als viele der Länder, die heute in den Entwicklungsfallen feststecken. Aber China und Indien konnten sich rechtzeitig befreien, um die globalen Märkte zu erobern. Anderen, bis dahin keineswegs so armen Ländern gelang dies nicht. In den vergangenen zwei Jahrzehnten entstand so ein verwirrendes Bild. Einige ursprünglich arme Länder wachsen stetig, weshalb es den Anschein hat, als gäbe es nicht wirklich ein Problem: die ärmste eine Milliarde scheint genauso schnell zu wachsen wie der Rest. In den kommenden zwei Jahrzehnten aber wird das wahre Ausmaß des Problems zutage treten, weil die Länder, die Stagnation oder wirtschaftlichen Niedergang nicht überwinden können, noch weiter zurückfallen. Der durchschnittliche Bewohner eines dieser Länder verfügt heute nur über etwa ein Fünftel des Einkommens, das der durchschnittliche Bewohner eines der anderen Entwicklungsländer hat, und diese Kluft vergrößert sich zusehends. Man stelle sich vor, diese eine Milliarde säße in einem Zug, der langsam einen Hügel hinunterrollt. Im Jahr 2050 wird die Kluft der wirtschaftlichen Entwicklung nicht mehr zwischen einer Milliarde Menschen in den reichen Ländern und fünf Milliarden in den Entwicklungsländern verlaufen, sondern zwischen der in den Fallen festsitzenden einen Milliarde und dem Rest der Menschheit.
Bisher habe ich das Problem der untersten Milliarde anhand von Wachstumsraten zu verdeutlichen versucht: die Wachstumsrate dieser Länder war, absolut betrachtet, negativ, im Vergleich gesehen blieb sie massiv hinter den übrigen Entwicklungsländern zurück. Heute wird von Beseitigung der Armut und von der Umsetzung der anderen Millenniums-Entwicklungsziele gesprochen, nicht von Wachstumsraten. Viele, denen die Entwicklungspolitik am Herzen liegt, sprechen lieber über die Schulbildung von Mädchen als über wirtschaftliches Wachstum. Ich begrüße dieses Engagement für die Schulbildung von Mädchen und alle anderen Ziele. Das Unbehagen, wenn es um Wachstum geht, teile ich jedoch nicht. Während meiner Zeit als Direktor der Forschungsabteilung der Weltbank trug eine der umstrittensten Veröffentlichungen den Titel «Wachstum ist gut für die Armen». Einige NGOs (Nichtregierungsorganisationen) reagierten regelrecht allergisch, und dies war das einzige Mal in fünf Jahren, dass der Präsident der Weltbank, Jim Wolfensohn, mich anrief und mir seine Bedenken mitteilte. Doch das zentrale Problem der untersten Milliarde ist ja gerade ihr fehlendes Wachstum. Ihm muss unsere Aufmerksamkeit gelten, und diesen Mangel zu beheben muss die wichtigste Herausforderung künftiger Entwicklungspolitik sein. Damit die reiche Welt mit ihren Strategien das Wachstum dieser Gesellschaften stärker fördern kann, brauchen wir den Einsatz all jener, denen die Armen dieser Welt am Herzen liegen. Und die, denen es wirklich um die Sache geht, werden sich mit Wachstum beschäftigen müssen.
Ich sage nicht, dass uns gleichgültig sein sollte, auf welche Art und Weise eine Volkswirtschaft wächst. Vom Wachstum Äquatorialguineas beispielsweise profitiert nur eine Handvoll seiner Bewohner, aber das ist die Ausnahme. Normalerweise kommt das Wachstum eines Landes der breiten Bevölkerung zugute. Die übertriebenen Vorbehalte von Entwicklungspolitikern gegenüber dem Faktor Wachstum lassen sich schon daran ablesen, wie dieser Begriff heutzutage gewöhnlich eingekleidet wird. In aktuellen Strategiepapieren taucht «Wachstum» fast ausnahmslos in Kombination mit «nachhaltig» und «für die Armen» auf. Doch in den allermeisten Fällen besteht das Problem der untersten Milliarde nicht darin, dass sie das falsche, sondern dass sie überhauptkein Wachstum haben. Dieses Misstrauen gegenüber dem Wachstum hat das strategische Denken regelrecht unterminiert. Einmal konsultierte mich einer der weltweit führenden Bankenexperten, den man gebeten hatte, ein Land der untersten Milliarde zu beraten. Er brauchte einen stichhaltigen Beleg dafür, dass eine Bankenreform den Ärmsten in diesem Land unmittelbar helfen würde, weil er das Gefühl hatte, dass man seinen Rat sonst nicht annehmen würde. Die ungleich stichhaltigere Aussage, dass nämlich eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums vonnöten sei, würde, so glaubte er, niemanden überzeugen. Das Wachstum in den Ländern der untersten Milliarde anzukurbeln wird ohnehin schwer genug werden, auch ohne derartige Komplizierungen.
Wir werden die Armut erst dann überwinden, wenn in den Ländern der untersten Milliarde ein Wachstumsprozess in Gang kommt, und das wird nicht geschehen, wenn man aus jedem dieser Länder ein neues Kuba macht. Kuba ist ein stagnierendes, egalitäres Land mit niedrigem Einkommen und guten Sozialleistungen. Wenn also die unterste Milliarde Kuba nacheifern würde, würde das ihre Probleme lösen? Ich glaube, die große Mehrheit der Menschen, die in diesen ärmsten Ländern – und übrigens auch in Kuba – lebt, würde dies als fortgesetztes Scheitern ansehen. Nach meiner Überzeugung bedeutet Entwicklungspolitik, den Menschen die Hoffnung zu geben, dass ihre Kinder in einer Gesellschaft leben werden, die mit dem Rest der Welt Schritt halten kann. Nimmt man ihnen diese Hoffnung, werden die Klügeren von ihnen all ihre Kraft darauf verwenden, ihrer Gesellschaft zu entfliehen, statt sie voranzubringen; eine Million Kubaner haben dies bereits getan. Um diesen Aufholprozess zu schaffen, brauchen die Länder, die heute das Schlusslicht bilden, radikal steigende Wachstumsraten. Die lange Phase ihrer Stagnation lässt ahnen, dass dies nicht leicht werden wird. Was können wir tun, außer uns Sorgen zu machen?
Guter Wille allein reicht nicht: die Probleme anpacken, auch wenn sie kompliziert sind
Das Problem der untersten Milliarde ist ernst, aber lösbar. Es sollte uns weit weniger entmutigen als das, was die Menschheit im 20. Jahrhundert in ihrem Kampf gegen Krankheiten, Faschismus und Kommunismus zu bewältigen hatte. Aber es ist kompliziert, wie die meisten schwierigen Probleme. Die Veränderung muss aus den Gesellschaften dieser untersten Milliarde selbst kommen, doch wir können mit unseren Maßnahmen dazu beitragen, dass die Aussicht auf Erfolg wächst und damit auch der Anreiz für diese Länder, die Probleme anzupacken.
Wir brauchen eine Vielzahl politischer Instrumente, um die Länder der untersten Milliarde zu ermutigen, Schritte zur Veränderung zu unternehmen. Bisher haben wir diese Instrumente nur unzureichend genutzt, ihr Einsatz könnte also verbessert werden. Die größte Herausforderung besteht darin, dass eine strategische Lösung der Kooperation verschiedener Regierungsbehörden bedarf, die nicht immer zur Zusammenarbeit bereit sind. Die Entwicklungspolitik ist in der Regel Sache der Entwicklungsministerien, die in der Hackordnung fast aller Regierungen ganz unten stehen. Das US-Verteidigungsministerium nimmt keine Ratschläge von der US-Entwicklungsbehörde (USAID) an, und das britische Handels- und Wirtschaftsministerium hört nicht auf das britische Entwicklungsministerium. Für eine kohärente Entwicklungspolitik brauchen wir aber einen ressortübergreifenden Ansatz. Um dieses hohe Maß an Koordination zu erreichen, müssen sich die Regierungschefs selbst des Problems annehmen. Und weil der Erfolg nicht nur davon abhängt, was die Vereinigten Staaten oder irgendein einzelnes anderes Land tut, müssen die Regierungen der wichtigsten Staaten gemeinsam handeln.
Das einzige Forum, bei dem die Regierungschefs der führenden Staaten regelmäßig zusammenkommen, ist der G8-Gipfel. Die Probleme der untersten Milliarde sind als Thema der G8 ideal, aber es müssen alle verfügbaren politischen Maßnahmen ausgeschöpft werden. Und das bedeutet, über die Agenda von Gleneagles 2005 hinauszugehen, die eine Verdoppelung der Entwicklungshilfe versprochen hat. Afrika stand beim G8-Gipfel in Deutschland 2007 auf der Tagesordnung und wird erneut ein Schwerpunkt des nächsten Gipfels in Japan sein. Und «Afrika +» sollte auf der G8-Agenda bleiben, bis sich die unterste Milliarde vollständig aus den Fallen befreit hat. Dieses Buch entwirft für die G8 eine wirksame Strategie.
Teil 2 DIE FALLEN
Kapitel 2 Die Konfliktfalle
In jeder Gesellschaft gibt es Konflikte, das gehört zum Wesen der Politik. Das Problem der untersten Milliarde ist nicht der politische Konflikt an sich, sondern die Form, in der er ausgetragen wird. Einige dieser Länder blicken auf eine lange Geschichte gewalttätiger innerer Auseinandersetzungen zurück, sei es eine anhaltende Periode der Gewalt (ein Bürgerkrieg), sei es eine kurzzeitige Episode (ein Putsch). Diese beiden Formen des politischen Konflikts sind kostspielig und können sich wiederholen. Sie können ein Land in Armut gefangenhalten.
Bürgerkrieg
73 Prozent der Menschen in den Ländern der untersten Milliarde haben in jüngster Zeit einen Bürgerkrieg erlebt oder sind aktuell in einen verstrickt. Viele Länder haben zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Geschichte einen Bürgerkrieg erlebt – die Vereinigten Staaten im 19., Russland Anfang des 20. und Großbritannien im 17. Jahrhundert. Doch wie diese Beispiele zeigen, muss ein Bürgerkrieg nicht zwangsläufig zur Falle werden. Der amerikanische, russische und englische Bürgerkrieg war zwar grausam, aber die Konflikte endeten recht schnell und wiederholten sich nicht. Für Länder mit niedrigem Einkommen jedoch ist die Gefahr, dass ein Krieg zur Falle wird, ungleich größer. Das entdeckte ich in meiner Zusammenarbeit mit Anke Hoeffler, meiner ehemaligen Doktorandin und jetzigen Kollegin. In Ankes Doktorarbeit ging es um Wachstumsquellen, damals ein beliebtes Thema der Wirtschaftswissenschaften. Einer der Faktoren, die bekanntermaßen Wachstum verhindern, ist Krieg. Während ich über Ankes Arbeit nachdachte, kam mir der Gedanke, dass es doch interessant wäre, die Frage einmal umzudrehen. Statt das Wachstum eines Landes in Abhängigkeit von Krieg und Frieden zu untersuchen, könnten wir fragen, ob und in welcher Weise die Anfälligkeit eines Landes für Gewaltkonflikte von seinem wirtschaftlichen Wachstum abhing.
Ursachen von Bürgerkriegen
Wodurch werden Bürgerkriege verursacht? Rebellenbewegungen rechtfertigen ihren Kampf gewöhnlich mit einem ganzen Katalog von Missständen: politische Unterdrückung, Ausbeutung, fehlende Partizipation. Das ist das Lieblingsthema politisch motivierter Wissenschaftler, die die Rebellen oft zu Helden verklären. Ich habe gelernt, diesem Gerede von Missständen zu misstrauen und als reinen Selbstzweck anzusehen. Die Ursachen für einen Bürgerkrieg zu ermitteln ist ein schwieriges Unterfangen. Schließlich sind sich die Historiker nicht einmal einig, was den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat. Die meisten Kriege haben mehrere Ursachen: politische Akteure, Hass, Fehler. Wir wählten einen statistischen Ansatz und betrachteten ein ganzes Spektrum möglicher Ursachen: soziale, politische, geographische und wirtschaftliche.
Der erste und grundlegende Schritt einer statistischen Analyse besteht darin, sich brauchbare Daten zu beschaffen. An der Universität Michigan, seit vielen Jahren ein Zentrum für Datensätze zu derartigen politischen Fragestellungen, fanden wir eine umfassende Liste zu Bürgerkriegen. Laut der Definition, die dieser Liste zugrunde liegt, ist Bürgerkrieg ein innerer Konflikt mit einem Minimum von 1000 Todesopfern, von denen jeweils mindestens 5 Prozent auf das Konto einer der beiden Konfliktparteien gehen. (Wenn man Kriterien verwendet, die andere definiert haben, unterliegt man wenigstens nicht der Versuchung, die Definitionen so hinzubiegen, dass sie den erwarteten Ergebnissen entsprechen.) Die Zahl von 1000 Bürgerkriegstoten mag willkürlich erscheinen, aber irgendwo muss man schließlich die Grenze ziehen. Denn zwischen einem lokal beschränkten Konflikt mit einem niedrigen Gewaltpotential, bei dem, sagen wir, fünfzig Menschen ums Leben kommen, und einem Krieg mit Tausenden von Toten gibt es einen großen Unterschied. Diese Liste zu Bürgerkriegen nun verglichen wir mit einer Fülle sozioökonomischer Daten, gegliedert nach Ländern und Jahren, um diejenigen Faktoren zu ermitteln, die die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegs in einem bestimmten Land für die kommenden fünf Jahre erhöhen bzw. verringern können.
Unsere Arbeit wurde ausgesprochen kontrovers diskutiert, nicht zuletzt deshalb, weil es in der Regel gerade die politisch engagierten Wissenschaftler sind, die sich mit Konfliktforschung beschäftigen. Und diese Leute sympathisieren mit den Rebellenbewegungen, sofern sie nur vorgeben, den Kampf gegen akute Missstände zu führen, auch wenn sie dabei mit extremen Mitteln gegen – das mag sein – verabscheuungswürdige Regime vorgehen. Diese Wissenschaftler empfinden die statistische Untersuchung der Frage, ob es zwischen objektiven sozialen Missständen und Ungerechtigkeiten und der Tendenz zur Rebellion einen Zusammenhang gibt, schon fast als Beleidigung, weil sie von vorneherein wissen, dass es einen solchen Zusammenhang gibt. Zugegeben, gelegentlich haben wir absichtlich ein wenig Öl ins Feuer gegossen. Einem unserer Aufsätze gaben wir den Titel «Greed and Grievance» (Gier und Leid), einem anderen «Doing Well out of War» (Vom Krieg gut leben), um anzudeuten, dass die Motive von Rebellen möglicherweise so wenig heroisch sind wie diejenigen der Regierung, gegen die sie kämpfen. In weniger politisierten akademischen Kreisen jedoch wurde unsere Arbeit ernstgenommen und oft zitiert. Wir erreichten die Sphäre der Politik – ich wurde zu einem Vortrag vor der UN-Generalversammlung eingeladen –, und die Medien berichteten.
Man hat uns auch aufgefordert, anhand unseres Modells vorherzusagen, wo die nächsten Bürgerkriege stattfinden werden; offenbar interessierte sich die CIA dafür. Aber so dumm waren wir nicht. Man hätte unsere Prognosen für eine Vorverurteilung bestimmter Länder verwenden können und damit genau denen geschadet, denen ich helfen wollte. Auch hätten unsere Prognosen womöglich den Misserfolg dieser Länder gleichsam vorprogrammiert. Aber auch grundsätzlich gilt: unser Modell ist ungeeignet, Prognosen zu treffen. Ich kann zwar die typischen strukturellen Faktoren benennen, die den Ausbruch eines Bürgerkriegs wahrscheinlicher werden lassen, sowie – was viel interessanter sein kann – diejenigen Faktoren, die eher zu vernachlässigen sind. Daraus ergibt sich dann zwar ein Grundmuster der am meisten gefährdeten Länder, aber wir können nicht prognostizieren, ob es im nächsten Jahr in Sierra Leone erneut zu einem Bürgerkrieg kommt oder nicht. Das hängt von einer Vielzahl kurzfristiger Ereignisse ab.
Einen ersten Zusammenhang stellten wir fest zwischen dem Bürgerkriegsrisiko und dem Einkommensniveau des jeweiligen Landes. Die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegs ist in Ländern mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen sehr viel höher. Geht das Pro-Kopf-Einkommen eines Landes um die Hälfte zurück, steigt dessen Bürgerkriegsrisiko auf das Doppelte. Man könnte fragen, ob wir nicht Ursache und Wirkung verwechseln – Krieg ist es doch, der ein Land arm macht und nicht umgekehrt; Armut macht doch ein Land nicht anfällig für Krieg? Tatsächlich ist beides zugleich richtig: Im Bürgerkrieg sinkt das Einkommen, gleichzeitig steigt bei niedrigem Einkommen die Gefahr eines Bürgerkriegs. Der deutlichste Beleg dafür ergibt sich aus der Kolonialzeit, als in vielen Ländern eine jahrzehntelang erzwungene Friedensperiode herrschte. Das fast zeitgleiche Ende des Kolonialismus in vielen Ländern mit sehr unterschiedlichen Einkommensniveaus war wie ein natürliches Experiment, anhand dessen man die Auswirkung des Einkommens auf die Entstehung von Bürgerkriegen untersuchen konnte.
Der Zusammenhang zwischen niedrigem Einkommen und Bürgerkrieg mag als eine Selbstverständlichkeit erscheinen. Man muss nur die Zeitung aufschlagen, um zu sehen, dass die Länder, in denen es Gewaltkonflikte gibt, mit hoher Wahrscheinlichkeit arm sind. Aber nicht alle Konfliktforscher gründen ihre Arbeiten auf empirische Daten. Manche Sozialwissenschaftler, besonders die politisch engagierten, wissen genau, wonach sie suchen, und das finden sie dann auch.
Was macht ein Land sonst noch anfällig für einen Bürgerkrieg? Nun, geringes Wachstum oder, schlimmer noch, wirtschaftliche Stagnation oder rückläufiges Wachstum. Um einen Näherungswert zu geben: In einem typischen Land mit niedrigem Einkommen beträgt das Bürgerkriegsrisiko rund 14 Prozent, über einen Zeitraum von fünf Jahren betrachtet. Jeder Prozentpunkt mehr Wachstum verringert dieses Risiko um einen Prozentpunkt. Wenn also ein Land um 3 Prozentpunkte wächst, sinkt das Risiko von 14 auf 11 Prozent. Wenn die Wirtschaft um 3 Prozentpunkte schrumpft, steigt das Risiko auf 17 Prozent. Auch an dieser Stelle könnte man fragen, ob wir nicht Ursache und Wirkung verwechseln: ob es nicht die Erwartung eines Bürgerkriegs ist, die den wirtschaftlichen Niedergang verursacht. Liegt ein Bürgerkrieg in der Luft, ziehen sich die Investoren zurück, und die Wirtschaft schrumpft. Könnte es, so der Einwand, nicht sein, dass es zwar den Anschein hat, als verursache rückläufiges Wachstum einen Bürgerkrieg, dass es aber in Wirklichkeit die Erwartung eines Bürgerkriegs ist, die dieses negative Wachstum verursacht?
Der Einwand lässt sich entkräften, wenn wir eine Variable genauer betrachten, die zwar das Wachstum beeinflusst, aber in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit einem Bürgerkrieg steht, und wenn wir prüfen, ob die Auswirkungen dieser Variablen einen Bürgerkrieg mehr oder weniger wahrscheinlich machen. In einkommensschwachen Ländern kann zwar ein Witterungsschock (zu viel oder zu wenig Regen) das wirtschaftliche Wachstum beeinflussen, aber nicht unmittelbar das Bürgerkriegsrisiko. Potentielle Rebellen sagen nicht: «Es regnet, blasen wir den Aufstand ab.» Die Auswirkungen derartiger Wetterunbilden auf das Wachstum sind also über jeden Zweifel erhaben: die Erwartung eines Bürgerkriegs spielt hier keine Rolle. Trotzdem erhöht ein durch einen Witterungsschock ausgelöster wirtschaftlicher Rückschlag die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegs.
Wenn also niedriges Einkommen und geringes Wachstum ein Land für einen Bürgerkrieg anfällig machen, so ist es doch vernünftig, sich zu fragen, warum dies so ist. Es gibt mehrere Erklärungsmöglichkeiten. Meine Erklärung ist, dass niedriges Pro-Kopf-Einkommen Armut und geringes Wachstum Hoffnungslosigkeit bedeutet. Junge Männer, die in hoffnungsloser Armut leben, sind für eine Rebellenarmee billig zu haben. Das Leben selbst ist nicht viel wert, und sich einer Rebellenbewegung anzuschließen, eröffnet ihnen zumindest eine geringe Chance auf Reichtum. Im Jahr 2002 entführte eine kleine Rebellengruppe auf den Philippinen ausländische Touristen. Eine Französin, die unter den Entführten war, schilderte später, wie sie den Brief mit den Forderungen der Entführer an die Behörden formulierte. «Was soll ich schreiben?», fragte sie. «Eine Million Dollar pro Tourist.» Das war es, was die Rebellen verlangten. Die Frau schrieb das auf, und dann fragte sie: «Sonst noch etwas?» Eine lange Pause, dann eine politische Forderung: «Die Absetzung des Bürgermeisters von Jolo.» Und zuletzt noch: «Zwei Taucheruhren.» Das war die Liste der «absolut gerechtfertigten» Missstände dieser Rebellengruppe.
Touristen zu entführen war zwar bedauerlich, aber unumgänglich, um soziale Gerechtigkeit durchzusetzen. Die Vereinigten Staaten lehnten es ab, die amerikanische Geisel freizukaufen, die europäischen Regierungen kamen den Geldforderungen der Entführer nach; der libysche Staatschef Muammar al-Gaddafi fungierte als Vermittler. Die Folge war ein starker Zustrom junger Männer zu den Rebellengruppen. Diese Art der Rekrutierung hat große Ähnlichkeit mit dem Eintritt in eine Drogengang in den Vereinigten Staaten. Eine berühmt gewordene Studie über eine solche Gang in Chicago konnte zeigen, dass die jungen Männer sich deshalb der Gang anschlossen und bereit waren, mehr oder weniger umsonst irgendwelche Dienste zu leisten, weil es eine – wenn auch geringe – Chance auf das große Geld gab, sofern es ihnen nur gelang, in der Hierarchie der Gang aufzusteigen.
In einem Land mit einer schwachen Wirtschaft ist oft auch der Staat schwach, und somit sind Aufstände nicht allzu schwer zu organisieren. Der Rebellenführer Laurent Kabila, der mit seinen Truppen durch Zaire zog, um die Staatsgewalt an sich zu reißen, erklärte einem Journalisten, in Zaire sei Rebellion eine einfache Sache: Man brauche lediglich 10000 Dollar und ein Satellitentelefon. Das klang nach effekthascherischer Übertreibung, doch dann fuhr er fort: In Zaire seien die Menschen so arm, dass man sich mit 10000 Dollar eine kleine Armee aufbauen könne. Und das Satellitentelefon? Nun, das bringt uns zum dritten und letzten wirtschaftlichen Risikofaktor eines Bürgerkriegs: den Rohstoffen eines Landes.
Die Abhängigkeit eines Landes von Rohstoffexporten – Erdöl, Diamanten etc. – erhöht das Bürgerkriegsrisiko beträchtlich. Deshalb brauchte Kabila ein Satellitentelefon: um mit den Förderfirmen Abmachungen zu treffen. Als Kabila die Hauptstadt Kinshasa erreichte, hatte er Verträge im Volumen von angeblich 500 Millionen Dollar in der Tasche. Dass internationale Konzerne Rebellenbewegungen massiv mit Geld unterstützten, um im Fall ihres Sieges Konzessionen zur Rohstoffförderung zu erhalten, ist mehrfach geschehen. Auf diese Weise kam offenbar auch Denis Sassou-Nguesso, der gegenwärtige Präsident der Republik Kongo (nicht zu verwechseln mit der Demokratischen Republik Kongo, dem ehemaligen Zaire) an die Macht. Die natürlichen Ressourcen eines Landes helfen also, Gewaltkonflikte zu finanzieren, ja, ihretwegen werden manchmal sogar solche Kriege entfesselt. Ein Beispiel sind die sogenannten Konflikt- oder Blutdiamanten, laut UN-Definition «Rohdiamanten, deren Abbaugebiete von Gruppen kontrolliert werden, welche gegen eine rechtmäßige und völkerrechtlich anerkannte Regierung opponieren. Diese Diamanten werden von den Rebellen verkauft, um regimefeindliche militärische Aktionen zu finanzieren.» Die Nichtregierungsorganisation Global Witness hat auf diese Verflechtungen aufmerksam gemacht, mit großem Erfolg. Nach Jahren des Leugnens war der weltgrößte Diamantenproduzent De Beers zu weitreichenden Maßnahmen bereit, um das Problem zu bekämpfen, und wurde damit zu so etwas wie einem Vorzeigeunternehmen.
Niedriges Einkommen, geringes Wachstum und die Abhängigkeit von Primärgütern also machen ein Land anfällig für Bürgerkriege. Aber sind das tatsächlich die wahren