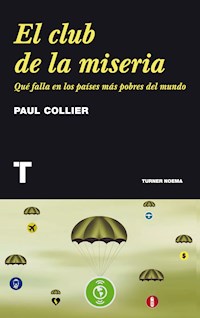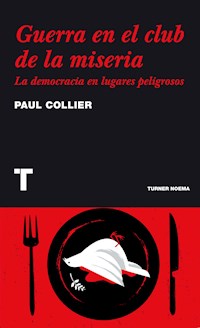9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Plädoyer des Wirtschaftsbuchpreisträgers für eine wirksame Entwicklungspolitik
Eine Milliarde Menschen leben in den ärmsten Ländern der Erde, die zugleich auch die undemokratischsten Staaten der Welt sind. Warum ändert die Entwicklungshilfe der reichen Industrienationen daran nichts? Und warum führen Wahlen in armen Ländern oft zu noch mehr Armut und Krieg statt zu Wohlstand und Frieden? Der Ökonom und Bestsellerautor Paul Collier untersucht die entscheidende Funktion von Wahlen in den ärmsten Ländern der Erde und zeigt, was wir tun müssen, um die Demokratisierung dieser Staaten wirklich zu unterstützen. Statt ein friedliches, demokratischeres Gemeinwesen zu schaffen, enden Wahlen in armen Ländern meist in der Festigung des herrschenden Regimes oder gar in Putschen und Bürgerkriegen. Collier plädiert deshalb für einen radikalen Wandel in unserem Bemühen um eine Demokratisierung armer Staaten. Statt mit der Durchführung von Wahlen nur demokratische Fassaden aufzubauen, müssen die reichen Industriestaaten den Ländern der »untersten Milliarde« mehr internationale Sicherheit bieten, damit sie ihren eigenen Weg zur Demokratie finden. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn wir völlig neu über humanitäre und militärische Interventionen nachdenken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Paul Collier
Gefährliche Wahl
WIE DEMOKRATISIERUNG IN DEN ÄRMSTEN LÄNDERN DER ERDE GELINGEN KANN
Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Schmidt
Siedler
Die englische Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Wars, Guns, and Votes. Democracy in Dangerous Places« bei The Bodley Head, London und HarperCollins, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © Paul Collier 2009
All rights reservedCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2009
by Siedler Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbHUmschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
ISBN 978-3-641-28505-0V001www.siedler-verlag.de
Für John Githongo und seinen Kampf
Inhalt
VORWORT Demokratie an gefährlichen Orten
TEIL I Die Realität verleugnen Demokratie im Delirium
KAPITEL 1 Wahlen und Gewalt
KAPITEL 2 Ethnopolitik
KAPITEL 3 Friedenssicherung und Wiederaufbau
TEIL II Die Realität akzeptieren Schmutzig, brutal und lang
KAPITEL 4 Waffen – Öl ins Feuer
KAPITEL 5 Kriege – Die Politökonomie der Zerstörung
KAPITEL 6 Putsche – Eine unkontrollierbare Waffe
KAPITEL 7 Kernschmelze an der Elfenbeinküste
TEIL III Die Realität verändern Verantwortlichkeit und Sicherheit
KAPITEL 8 Staatenbildung und Nationenbildung
KAPITEL 9 Lieber sterben als sich helfen lassen?
KAPITEL 10 Über die Veränderung der Realität
Dank
Anhang
Die unterste Milliarde
Bibliographie
Register
VORWORT Demokratie an gefährlichen Orten
MÖGLICHERWEISE WIRD MEIN SOHN DANIEL, der jetzt sieben Jahre alt ist, das Ende aller Kriege erleben. Aber er könnte auch auf dem Schlachtfeld sterben. Warum beide Szenarien für Kinder von heute eine realistische Aussicht darstellen, ist Thema dieses Buchs. Wie Krankheiten begleiten Kriege die Menschheit seit ihrer Entstehung. Krankheiten werden heute besiegt: Dank des wissenschaftlichen Fortschritts und staatlicher Programme wurden die Pocken 1977 ausgerottet. Was den Krieg angeht, sieht es so aus, als wäre die Weltwirtschaft zum ersten Mal in der Geschichte in der Lage, die für den Weltfrieden nötigen materiellen Voraussetzungen zu schaffen. Aber der globale Wohlstand erhöht auch die Risiken: Eine vernetzte Welt ist anfälliger für die Reste chaotischer Gewalt. So wie bei der Ausrottung der Pocken wissenschaftliche Erkenntnisse von der Öffentlichkeit umgesetzt wurden, muss der wachsende Wohlstand genutzt werden, um der ganzen Welt Frieden zu bringen.
Das vorliegende Buch handelt von Macht. Warum Macht? Weil in den kleinen, armen Ländern am unteren Ende der Weltwirtschaft, in denen eine Milliarde Menschen leben, Gewalt der bevorzugte Weg zur Macht ist. Politische Gewalt ist sowohl ein Fluch an sich als auch ein Hindernis für ein verantwortungsvolles und rechtmäßiges Regieren. Denn wo Macht auf Gewalt beruht, zieht sie die arrogante Annahme nach sich, eine Regierung habe zu herrschen und nicht zu dienen. Zum Beweis genügt ein Blick auf die offiziellen Porträts politischer Führer. In gefestigten Demokratien lächeln sie bei dem Versuch, ihren Herren, den Wählern, zu gefallen. In den Gesellschaften der untersten Milliarde lächeln die Regierenden nicht: Ihre offiziellen Porträts starren mit einer drohenden Grimasse von jedem öffentlichen Gebäude und jeder Schulzimmerwand. Nach dem Abzug der Kolonialmächte sind sie nun die Herren ihres Landes. Dieses Buch wird der Frage nachgehen, warum politische Gewalt in den Ländern der untersten Milliarde so verbreitet ist und was getan werden kann, um sie einzudämmen.
Seit dem Ende des Kalten Krieges sind zwei außergewöhnliche Veränderungen eingetreten, die dazu führen könnten, dass wir uns endgültig von der politischen Gewalt abwenden. Beide Veränderungen haben ihren Ursprung im Untergang der Sowjetunion. Zum einen darf heute ein immer größerer Teil der untersten Milliarde wählen. Die Bilder der Volksaufstände in Osteuropa verstärkten in den Entwicklungsländern den Wunsch nach politischen Veränderungen. In Westafrika konstituierten sich Anfang der 1990er Jahre überall Nationalversammlungen. 1998 überwand Nigeria, der bevölkerungsreichste Staat Afrikas, die Militärdiktatur. So wie an der Wende des ersten Jahrtausends die Führer der europäischen Kleinstaaten plötzlich allesamt zum Christentum übertraten, konvertierten an der zweiten Jahrtausendwende die Führer der Kleinstaaten der untersten Milliarde zum Glauben an Wahlen. Vor dem Ende des Kalten Krieges waren die meisten Führer der untersten Milliarde durch Gewalt an die Macht gekommen – durch einen erfolgreichen bewaffneten Kampf oder einen Staatsstreich. Heute sind die meisten Staatsoberhäupter aufgrund eines Wahlsiegs an der Macht. Wahlen sind die institutionelle Technologie der Demokratie. Sie besitzen das Potential, Regierungen sowohl verantwortungsvoller als auch legitimer zu machen. Wahlen sollten der politischen Gewalt den Todesstoß versetzen.
Die zweite ermutigende Veränderung ist die Verbreitung des Friedens. In den dreißig Jahren vor dem Ende des Kalten Krieges brachen gewalttätige Konflikte schneller aus, als sie beendet wurden, so dass nach und nach immer mehr Bürgerkriege tobten. Hatten diese Konflikte einmal begonnen, erwiesen sie sich als äußerst langlebig. Bürgerkriege dauerten in der Regel zehnmal länger als zwischenstaatliche Kriege. Doch dann endeten diese grausamen, sich hinziehenden Bürgerkriege einer nach dem anderen. Im Südsudan und in Burundi wurden Friedensabkommen ausgehandelt, in Sierra Leone schlichteten internationale Friedenstruppen den Konflikt. Nach dem Ende des Kalten Krieges konnte sich die internationale Gemeinschaft endlich dafür stark machen, die ständigen gewaltsamen Machtkämpfe zu beenden.
Eine Welle von Friedensabkommen verstärkte die Welle der Wahlen und schien eine schöne neue Welt zu versprechen: ein Ende des gewaltsamen Machtstrebens. Aber woher sollen wir wissen, wie sich diese Veränderungen langfristig auswirken werden? Können wir mehr tun, als spekulieren? Ich glaube, ja. Obwohl das Zusammentreffen dieser tiefgreifenden Veränderungen beispiellos ist, können sie anhand von Erfahrungen aus der Vergangenheit analysiert werden, denn es gab in der untersten Milliarde bereits Wahlkämpfe und Postkonfliktsituationen. Im Folgenden werden diese historischen Erfahrungen genutzt, um die gegenwärtig stattfindende Geschichte zu analysieren. Beim Lesen dieses Buchs werden Sie vielleicht verwundert feststellen, wie schnell sich die Forschungsfront vorwärts bewegt. Ich habe dieses Gefühl jeden Morgen, wenn ich mich auf dem Weg zur Arbeit frage, ob Pedro, Anke, Dominic, Lisa, Benedict oder Marguerite das Problem, auf das wir am Vorabend gestoßen waren, vielleicht schon gelöst haben. Ich hoffe, auch Sie werden einen Eindruck davon bekommen.
Politische Gewalt ist eine Form des Machtkampfs. Heute betrachten wir sie jedoch als unzulässig: Macht soll kein Recht setzen. In den Gesellschaften mit hohem Einkommen hat man im Lauf des vergangenen Jahrhunderts die Prinzipien der Demokratie verinnerlicht und sie in zunehmendem Maß als universale Maßstäbe anerkannt. Der Weg an die Macht sollte durch Stimmzettel und nicht durch Schüsse erkämpft werden. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die einkommensstarken Demokratien sogar noch einen Schritt weiter gegangen: Statt die Prinzipien der Demokratie nur als allgemein gültig anzusehen, werden sie nun aktiv gefördert und verbreitet. Trotz des Streits über den Irak und der Frage, ob die aktive Förderung der Demokratie bis zur Erzwingung eines Regimewechsels gehen darf oder ob man es bei gewaltloser Ermutigung und Anreizen belassen sollte, stimmt die internationale Gemeinschaft in Bezug auf das Ziel überein. Und sie hat beachtliche Erfolge vorzuweisen: In der kurzen Zeitspanne von weniger als zwei Jahrzehnten hat sich die Demokratie in der gesamten einkommensschwachen Welt verbreitet. Aber welche Folgen hat dies für den Frieden?
Die gute Nachricht lautet, dass die Welt sicherer geworden ist. Tatsächlich ist das ein Prozess, der trotz der Katastrophen der Weltkriege schon seit Beginn der Menschheitsgeschichte voranschreitet, wenn auch mit einigen Rückschlägen. Im Gegensatz zum Bild des edlen Wilden waren die frühen Gesellschaften mörderisch. Einen friedlichen Garten Eden, aus dem wir vertrieben wurden, hat es nie gegeben: Der Frieden ist nach und nach geschaffen worden, Jahrtausend um Jahrtausend, Jahrhundert um Jahrhundert und Jahrzehnt um Jahrzehnt. Der Wunsch, vor politischer Gewalt geschützt zu sein, war stets ein grundlegendes Bedürfnis der menschlichen Gemeinschaft. Die großen archäologischen Hinterlassenschaften des Altertums, wie die Chinesische Mauer und das von den alten Jüten quer über Jütland zur Abwehr anderer germanischer Stämme errichtete massive Bollwerk, sind beeindruckende Beweise für die überragende Bedeutung, die eine Gemeinschaft ihrer Verteidigung beimaß. Dies gilt bis in die jüngste Zeit, immerhin wendete die reichste Gesellschaft der Welt, die der Vereinigten Staaten, vierzig Jahre lang bis zu neun Prozent ihres Nationaleinkommens auf, um sich gegen die von der Sowjetunion ausgehende Bedrohung zu verteidigen.
Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist eine Ära zu Ende gegangen. Auch wenn es anders wirkt: Das letzte Jahrzehnt ist recht friedlich gewesen. Gemessen wird das in einer gruseligen wissenschaftlichen Nische anhand der Todesfälle im Zusammenhang mit Kampfhandlungen (»battle-related deaths«). Die Datenbank »Armed Conflict Dataset« führt Buch sowohl über die wirklich großen Konflikte, diejenigen, die mindestens tausend solcher Todesfälle pro Jahr verursachen, als auch über die kleineren, in denen immerhin noch mehr als fünfundzwanzig Menschen zu Tode kommen. Aufgrund dieser Daten kommt man zu folgenden Ergebnissen: In der Periode des Spätkolonialismus – von 1946 bis 1959 – gab es in jedem Jahr rund vier große Krieg und elf kleinere Konflikte. Zwischen der Entkolonialisierung und dem Ende des Kalten Krieges im Jahr 1991 fand eine gnadenlose Eskalation statt. 1991 waren sage und schreibe 17 Kriege und 35 kleinere Konflikte im Gang. Wäre die Gewalt weiterhin in diesem Tempo eskaliert, wäre unser Leben heute ein Alptraum. Stattdessen erwies sich das Jahr 1991 als Wendepunkt. Die Welt ist heute nicht so friedlich wie zur Zeit des Spätkolonialismus, aber es wird nur noch in fünf großen Kriegen und 27 kleineren Konflikten gekämpft. Diese Trendwende hängt scheinbar mit dem Sieg der Demokratie zusammen: Wo die Menschen eine (Wähler-)Stimme haben, greifen sie nicht zum Gewehr.
Ich bin mittlerweile zu der Überzeugung gelangt, dass dieser beruhigende Glaube eine Illusion ist. Unsere Betrachtung der politischen Gewalt beruht auf einer Verleugnung der Realität. Dies führt unter anderem dazu, dass es eine schöne neue Welt von Wahlkämpfen in ethnisch gespaltenen Gesellschaften gibt, von denen einige erst kürzlich einen jahrelangen Bürgerkrieg überstanden haben. Seit 1991 ist es immer mehr in Mode gekommen, sich mit Wahlen als sichtbarem Zeichen von Demokratie zu schmücken. Präsidenten, die nicht gewählt worden waren, begannen wie Auslaufmodelle auszusehen und sich vermutlich auch so zu fühlen. Aber es war mehr als eine Mode: Viele Geldgeber wandten sich von nicht gewählten Regierungen ab. Deshalb fasste sich so mancher amtierende Präsident ein Herz und stellte sich zur Wahl, wobei sich einige in dem sicheren Gefühl wähnten, dass sie vom Volk geliebt würden. Manchmal jedoch entschieden sich die Wähler anders als erwartet.
Angesichts solcher Undankbarkeit lernten die Präsidenten mit der Zeit, sich den neuen Umständen anzupassen. Ein oder zwei Staatschefs kamen allerdings bei dem Versuch zu Fall. Der Erste war der anständige Autokrat Kenneth Kaunda in Sambia, der sich 1991 zur Wahl stellte und mit Pauken und Trompeten verlor. Während ich dies schreibe, sind die aktuellsten Wahlen in einem Land der untersten Milliarde diejenigen in Kenia im Dezember 2007, und in Kürze wird in Simbabwe gewählt werden. In den Jahren nach Kaundas Abwahl lernten die amtierenden Präsidenten, wie man eine Wahl gewinnt. In der kenianischen Wahl gewann der amtierende Präsident Kibaki, was im Land jedoch nicht als Triumph der Demokratie gefeiert wurde. Koki Muli, der Chef des kenianischen Instituts für Erziehung zur Demokratie, hat Kibakis Wahlsieg vielmehr als Staatsstreich bezeichnet.* Was die Wahl in Simbabwe angeht, sind Sie mir gegenüber im Vorteil, da Sie das Ergebnis kennen. Ich habe keine Ahnung, wer die Wahl in den Vereinigten Staaten im November 2008 gewinnen wird, aber vom Ausgang des simbabwischen Urnengangs habe ich eine recht genaue Vorstellung: Ich bin mir sehr sicher, dass Präsident Mugabe wiedergewählt wird. Die Präsidenten haben ein ganzes Arsenal von Techniken entdeckt, die es ihnen ermöglichen, an der Macht zu bleiben, auch wenn sie zur Durchführung von Wahlen genötigt sind. Diese Wahlen finden in einem Umfeld statt, das geprägt ist von schwachen demokratischen Kontrollen, ethnischen Spaltungen und den nach Konflikten üblichen Spannungen.
Der große Erfolg der internationalen Gemeinschaft nach dem Ende des Kalten Krieges, die Beendigung der Bürgerkriege der postkolonialen Ära, ist zugleich eine beunruhigende Schwachstelle. Die Zeit nach einem Konflikt ist immer gefährlich. In der Vergangenheit ist in solchen Fällen oft innerhalb eines Jahrzehnts die Gewalt erneut ausgebrochen. Seit den 1990er Jahren verlässt sich die internationale Gemeinschaft in zunehmendem Maß auf Wahlen als Heilmittel für Spannungen und Hassgefühle in Nachkriegszeiten. Tatsächlich besteht sie sogar auf ihrer Durchführung. Immerhin wird eine Wahl dem Sieger Legitimität verleihen, und aufgrund der Notwendigkeit, möglichst viele Wähler für sich zu gewinnen, wird sich der Sieger wahrscheinlich an breite Bevölkerungsschichten gewendet haben. Diese beruhigende Strategie beruhte allerdings auf der Verleugnung einer immer offensichtlicher werdenden Tatsache.
Wenn man sich mit dem Problem der politischen Gewalt beschäftigt, muss man begreifen, warum kleine und arme Länder so gefährlich sind. Will man sich der Realität der politischen Gewalt stellen, muss man ihre Mechanismen kennen: Waffen, Kriege und Putsche. Ich weiß, dass Schusswaffen keine Menschen töten; Menschen töten Menschen. Eine Regierung kann ohne den Einsatz von Gewehren ein sehr wirkungsvolles Pogrom durchführen. Bei dem Gemetzel in Ruanda wurden Macheten benutzt. Aber in einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen organisierten Gruppen gewinnt in der Regel diejenige, die über mehr Schusswaffen verfügt: Mit ihnen lässt sich wesentlich leichter Gewalt ausüben. Deshalb werde ich mit den Gewehren beginnen, mit dem absurden Bild, das beide Seiten, Angebot wie Nachfrage, bieten. Einerseits sorgt ein Schwarzhandel mit Kalaschnikows für das Angebot, andererseits verstärken Rüstungswettläufe im Kleinformat die Nachfrage.
Noch gibt es Kriege auf der Welt, aber sie finden heute »anderswo« statt. Reiche Länder kämpfen nicht mehr gegeneinander und zerfleischen sich nicht mehr selbst. Auch bei den Ländern mit mittlerem Einkommen sind Kriege praktisch verschwunden. Sogar die großen armen Länder sind heute relativ sicher: China und Indien besitzen zwar große Armeen, aber sie haben sie seit über vierzig Jahren nicht mehr gegeneinander eingesetzt. Es mag der Welt nicht gelingen, die Verbreitung von Atomwaffen einzugrenzen; im Lauf der Zeit verspüren immer mehr Mittelmächte den Wunsch, auf der Weltbühne mitzuspielen, indem sie Nuklearwaffen erwerben. Aber in den vergangenen sechzig Jahren ist ein Erstschlag mit Atomwaffen zu einem regelrechten Tabu geworden, das, soweit ich sehen kann, kein Staat brechen wird.
Seit zwischen den mächtigsten Staaten Frieden eingekehrt ist, hat sich das Ausmaß der Kriegführung verringert. Heute kommt es allenfalls zu kleinen Kriegen in kleinen Ländern. Für gewöhnlich ist die Gewalt nach innen gerichtet: Das jeweilige Land zerfleischt sich selbst, während die übrige Welt zuschaut. Gelegentlich werden andere Staaten hineingezogen, meistens Nachbarn und manchmal Regionalmächte. Gelegentlich intervenieren ausländische Mächte – um ein Chaos im Land zu verhindern wie in der Demokratischen Republik Kongo, Invasoren zu vertreiben wie im ersten Irakkrieg oder einen Regimewechsel zu erzwingen wie im zweiten Irakkrieg. Anlass zur Sorge gibt die Tatsache, dass eine große Gruppe kleiner Länder strukturell gefährlich bleibt. Kriege der untersten Milliarde sind schmutzig, brutal und lang. Es sind Bürgerkriege, deren Opfer überwiegend Zivilisten sind und die zehnmal länger dauern als internationale Kriege. Die Häufigkeit von Bürgerkriegen hat zwar abgenommen, aber nur aufgrund von Friedensabkommen; die Ursachen für neue Konflikte sind weiterhin vorhanden. Neben den nicht beigelegten Konflikten brachen 2004 vier neue Kriege aus. Im folgenden Jahr sah es mit nur einem neuen Krieg etwas besser aus. Doch es war alles andere als ein friedliches Jahr, denn es begannen acht neue kleine Konflikte. 2006 wurde es mit drei neuen Kriegen wieder ungemütlicher.
Politische Gewalt muss nicht in der Form von Kriegen (mit den dazugehörigen »Todesfällen im Zusammenhang mit Kampfhandlungen«) ausgeübt werden, um ihr Ziel, die Machtergreifung, zu erreichen. Tatsächlich ist die verbreitetste und effektivste Form politischer Gewalt, das gleichsam chirurgische Mittel des Staatsstreichs, oft erfolgreich, ohne einen einzigen Todesfall zu verursachen. Das Militär, dessen Aufgabe der Schutz der Bevölkerung vor organisierter Gewalt ist, befindet sich manchmal in der bequemen Lage, sie selbst auszuüben. Seit 1945 haben weltweit rund 357 erfolgreiche Militärputsche stattgefunden. Und auf jeden erfolgreichen Putsch kamen mehrere gescheiterte. In Afrika, für das eine umfassende Zählung vorliegt, gab es neben 82 erfolgreichen 109 gescheiterte Staatsstreiche sowie 145 geplante, die bereits im Keim erstickt wurden. Das sind rund sieben chirurgische Eingriffe pro Land. In vielen Staaten ist es für einen Präsidenten wahrscheinlicher, sein Amt durch das Militär zu verlieren, als auf irgendeine andere Art abzutreten.
Waffen, Kriege und Putsche prägen das Leben der Menschen in der untersten Milliarde und zerstören Gesellschaften, die auf eine positive Entwicklung hoffen. Der Staatszerfall der Elfenbeinküste, des afrikanischen Landes, das einst in höchsten Tönen gepriesen wurde, ist eine Folge des über ein Jahrzehnt andauernden, ruinösen Zusammenwirkens aller drei Mechanismen.
Ist es denn wichtig, ob politische Gewalt in ihren unterschiedlichen Formen das wichtigste Mittel für den Weg an die Macht bleibt? Vielleicht war ja das ganze Konzept der Verbreitung unserer demokratischen Werte in diesen Gesellschaften bloß eine Selbsttäuschung, und man sollte diese Staaten besser sich selbst überlassen. Aber natürlich ist es wichtig, und zwar aus mehreren Gründen.
Zum einen sind unsere demokratischen Werte universell: Regierungen sind nicht dazu da, um ihre Bürger zu unterdrücken; sie sollen ihnen dienen. Aber unsere Gesellschaften haben lange gebraucht, um vom dienenden Bürger zum dienenden Staat zu gelangen, und in den Gesellschaften der untersten Milliarde wird dieser Wandel vermutlich ebenfalls lange dauern. Wir haben offenbar die Schwierigkeiten unterschätzt und die falschen Merkmale der Demokratie in den Vordergrund gestellt: die Fassade anstelle der grundlegenden Infrastruktur. In diesem Buch werde ich zeigen, dass man dort, wo sich der Aufbau der demokratischen Infrastruktur als unmöglich erweist, durch die Errichtung reiner Fassaden die Entstehung von politischer Verantwortung nicht etwa beschleunigt, sondern untergräbt.
Außerdem ist es wichtig, ob in den gespaltenen Gesellschaften der untersten Milliarde politische Macht durch Gewalt gewonnen wird, da die Folgen dessen in der Regel furchtbar sind. Die politisch starken Männer in gespaltenen Gesellschaften sind selten visionäre Führer; vielmehr handeln sie zumeist eigennützig oder im Interesse einer eng begrenzten Gruppe an Unterstützern. Visionäre Führung ist wichtig, aber ihre Aufgabe besteht darin, Staaten in Nationen zu verwandeln. Der grundsätzliche Fehler, den wir bislang bei der Staatenbildung gemacht haben, war die fehlende Einsicht, dass gut funktionierende Staaten nicht nur auf gemeinsamen Interessen, sondern auf einer gemeinsamen Identität basieren. Eine solche Identität ensteht nicht von selbst; sie wird politisch erzeugt, und dies ist die Aufgabe politischer Führung.
Und es spielt eine Rolle, weil gewaltsame Machtkämpfe enorm kostspielig sind. Kriege und Staatsstreiche sind kein Kaffeekränzchen, sondern kehren die Entwicklung von Staaten um. Kriege können hinsichtlich der Opferzahlen klein sein, aber die zunehmende Einbeziehung der Zivilbevölkerung – tatsächlich verwischt die Trennlinie zwischen Zivilisten und Kombattanten zusehends – bedeutet, dass auch kleine Kriege höchst nachteilige Folgen haben können. Aber politische Gewalt ist nicht nur ein Fluch für die Gesellschaft, in der sie ausgeübt wird, sondern auch ein internationales Übel. Insbesondere schädigt sie die unmittelbaren Nachbarn, was tiefgreifende Folgen für die staatliche Souveränität hat.
Das übergreifende Problem der untersten Milliarde besteht darin, dass ihre Gesellschaften in der Regel zugleich zu groß und zu klein sind – zu groß in dem Sinn, dass sie zu unterschiedlich sind, um bei der Erzeugung öffentlicher Güter zusammenzuarbeiten, und zu klein in dem Sinn, dass sie bei der Bereitstellung des wichtigsten öffentlichen Guts, der Sicherheit, keinen Größenvorteil nutzen können. Diese Probleme zu erkennen, sollte jedoch vor allem dem Zweck dienen, bei der Suche nach wirksamen Lösungen zu helfen. Besteht das Problem darin, dass Gesellschaften zu groß sind, um eine gleichsam angeborene Identität zu besitzen, dann geht es beim Aufbau des Staats nicht in erster Linie um die Schaffung von Institutionen, wie es das heute bevorzugte Patentrezept vorsieht. Grundlegend ist vielmehr die Schaffung einer Nation, was mehr visionäre Führerschaft erfordert, als in den meisten dieser Gesellschaften geleistet wurde.
Besteht das Problem darin, dass Gesellschaften zu klein sind, um die wichtigsten öffentlichen Güter bereitzustellen, dann ist es sinnlos, die nationale Souveränität für unantastbar zu erklären. Angesichts der strukturellen Defizite ihrer Staaten haben die Menschen, die zur untersten Milliarde gehören, kaum eine andere Wahl, als internationale Hilfe in Anspruch zu nehmen, um die Versorgung mit grundlegenden öffentlichen Gütern zu gewährleisten. Bis zu einem gewissen Grad könnten diese Staaten dies auch tun, indem sie ihre Souveränitäten vereinen, was diese Länder jedoch bislang auffälligerweise nirgendwo getan haben. Dieses Ausbleiben von Kooperation ist seinerseits symptomatisch: Ein großer Teil der internationalen Hilfe für die unterste Milliarde wird von Ländern geleistet werden müssen, die bereits gelernt haben, bei der Bereitstellung von öffentlichen Gütern zu kooperieren, das heißt von den einkommensstarken Ländern. Die eifersüchtige Verteidigung der Souveränität durch die Regierungen der untersten Milliarde beschränkt jedoch das Ausmaß dessen, was internationale Hilfe realistischerweise leisten kann. Der Hauptvorschlag, den ich in diesem Buch unterbreite, ist eine Strategie, bei der durch eine kleine Intervention der internationalen Gemeinschaft die politische Gewalt im Innern der Gesellschaften der untersten Milliarde im Zaum gehalten wird. Diese mächtige, bisher so zerstörerische Kraft kann in ihr Gegenteil verkehrt und zum Schutz der Demokratie genutzt werden anstatt zu ihrer Verhinderung.
Um die den Gesellschaften der untersten Milliarde innewohnende politische Gewalt in eine nützliche Kraft zu verwandeln, wird eine internationale Schutztruppe von sehr begrenztem Umfang nötig sein. Seit der Intervention im Irak sind internationale Missionen zur Friedenssicherung mit Truppen aus einkommensstarken Ländern sowohl bei den Wählern dieser Länder als auch bei den beunruhigten Regierungen der untersten Milliarde verpönt. Aber begrenzte militärische Interventionen erfüllen eine wichtige Aufgabe, indem sie sowohl die Sicherheit als auch die Verantwortlichkeit der jeweiligen Regierung den Bürgern gegenüber gewährleisten, also zwei wesentliche Voraussetzungen für eine positive Entwicklung bieten.
Mir ist bewusst, dass ich einen Drahtseilakt vollführe. Diejenigen, in deren Augen sich die Staaten der untersten Milliarde in einer unheilbaren Malaise befinden, werden die Vorschläge in diesem Buch vermutlich als kostspieligen Idealismus betrachten. Diejenigen, nach deren Ansicht diese Gesellschaften Opfer eines Neoimperialismus sind, werden meine Vorschläge als verkappten Imperialismus ansehen. Vor allem aber werden diejenigen, die innere politische Gewalt jeglicher Art als illegitim ablehnen, den Gedanken, sie nutzbar zu machen, als Bruch mit einer fundamentalen Überzeugung zurückweisen. Aber die Vorschläge, die ich in diesem Buch machen werde, entspringen keinem kostspieligen Idealismus; sie beruhen auf Analysen und Tatsachen. Genauso wenig öffnen sie dem Imperialismus eine Hintertür. Die unterste Milliarde hat die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen, einschließlich des legitimen Anspruchs auf eine nationale Identität. Auch die Grundfesten der Demokratie werden durch meine Vorschläge nicht erschüttert. Ich sage lediglich, dass auf dem Weg, den wir gegenwärtig verfolgen, weder ein Nationalgefühl noch Demokratie geschaffen werden können. Dieser Weg führt in eine Sackgasse. Denn die Souveränität für unantastbar zu erklären, hat nur zur Folge, dass unechte Demokratien geschützt werden. Genauso, wie die einkommensstarke Welt der untersten Milliarde einen Malaria-Impfstoff zur Verfügung stellen sollte, sollte sie in den dortigen Gesellschaften für Sicherheit und Verantwortlichkeit der Regierungen sorgen. Alle drei Dinge sind öffentliche Güter, bei denen andernfalls eine chronische Unterversorgung besteht. Doch erst wenn diese Güter in ausreichendem Umfang vorhanden sind, können die Gesellschaften der untersten Milliarde ihren Anspruch auf wahre Souveränität erfüllen.
Im Kampf gegen die politische Gewalt sind unsere Illusionen am unauflöslichsten mit unseren Hoffnungen und Strategien verknüpft, und hier erweisen sich unsere Fehler, die in diesen Illusionen begründet sind, am kostspieligsten. Jede der von mir untersuchten Veränderungen besitzt ein enormes Hoffnungspotential. Aber jede von ihnen ist ein zweischneidiges Schwert: Sie alle können auch Entwicklungen auslösen, die zu einem wesentlichen Anstieg der Gewalt führen. Doch es geht in diesem Buch nicht darum, dass auch alles schiefgehen könnte. Soweit es die modernen Forschungsmethoden erlauben, glaube ich zeigen zu können, was darüber entscheidet, ob die Demokratie transformativ oder destruktiv sein wird. Beunruhigender ist, dass sie in den Gesellschaften der untersten Milliarde das Ausmaß der politischen Gewalt bisher nicht verringert, sondern vergrößert hat. Mit meinen Schlussfolgerungen will ich jedoch keinesfalls jene mutigen Menschen verunglimpfen, die für ihre demokratischen Rechte kämpfen. Ich bin kein Verteidiger der Diktatur. Aber wir müssen uns von unseren Illusionen verabschieden, um herausfinden zu können, durch welche Maßnahmen wir das zweifellos vorhandene Potential der Demokratie als Kraft des Guten freisetzen können.
* »Kibaki Win Spurs Kenya Turmoil«, in: The Financial Times, 31. Dezember 2007, S. 6.
TEIL I Die Realität verleugnen Demokratie im Delirium
KAPITEL 1 Wahlen und Gewalt
IN UNSERER ZEIT HAT EINE GROSSEPOLITISCHE Veränderung stattgefunden: die Verbreitung der Demokratie in den Ländern der untersten Milliarde. Aber handelt es sich wirklich um Demokratie? Sicherlich werden in diesen Ländern, nicht zuletzt auf amerikanischen und europäischen Druck hin, jetzt Wahlen abgehalten. Als sichtbarste Komponente der Demokratie werden sie kurzerhand als deren definierendes Merkmal behandelt. Doch eine wirkliche Demokratie besteht nicht nur aus Wahlen mit mehreren Kandidaten; sie setzt auch Regeln für das Verhalten der Gewählten: Betrug wird bestraft. Außerdem verfügt sie über Kontrollmechanismen, welche die Macht der Regierung nach ihrer Wahl beschränken: Sie kann die Unterlegenen nicht unterdrücken. Die große politische Veränderung mag auf den ersten Blick wie eine Verbreitung der Demokratie aussehen, ist aber in Wirklichkeit eine Verbreitung von Wahlen. Wenn der Macht der Sieger keine Grenzen gesetzt sind, werden Wahlen zu einer Frage von Leben und Tod. Ist dieser Kampf selbst keinen Verhaltensregeln unterworfen, sind die Beteiligten letztlich genötigt, zu extremen Mitteln zu greifen. Das Ergebnis ist keine Demokratie, sondern, wie ich sie bezeichne, eine democrazy, also eine Demokratie im Delirium.
Das politische System, aus dem diese defekte Demokratie entsteht, ist die Diktatur. Meist umgaben sich die Diktatoren nicht einmal mit dem Schleier einer Ideologie. Ihren Höhepunkt erreichte die persönliche Herrschaft in der Gestalt des zairischen Präsidenten Mobutu, dessen außergewöhnliches Regierungssystem Michela Wrong in ihrem Buch Auf den Spuren von Mr. Kurtz beschreibt. Persönliche Herrschaft bedeutete in diesem Fall ethnische Günstlingswirtschaft und Zersetzung der staatlichen Institutionen. Mobutus Macht beruhte auf Gier und Furcht: Ergebenheit konnte mit unermesslichem Reichtum belohnt werden und schon der Verdacht auf eine oppositionelle Haltung wurde mit Folter bestraft. In den Diktaturen, in denen es eine Ideologie gab, war sie marxistisch, wie diejenige des Derg-Regimes in Äthiopien und der MPLA in Angola, beides grauenvolle, zerstörerische Regime, die von westlichen Linken erwartungsgemäß erhebliche Unterstützung erfuhren. Häufiger war die marxistische Ideologie jedoch nur Dekor, Floskeln, derer man sich in den politischen Führungszirkeln bediente, genauso, wie es im 19. Jahrhundert üblich war, in den Salons christliche Versatzstücke zu benutzen. In Simbabwe, wo diese Vorspiegelei üblich war, gab es ein Politbüro, und jeder wurde als Genosse angesprochen. Solche undemokratischen Regime schienen zu gewalttätiger Opposition geradezu aufzurufen. Sowohl Mobutu als auch der Derg wurden durch eine Rebellion gestürzt, und die MPLA sah sich mit einem riesigen Aufstand unter Führung der UNITA konfrontiert.
In den 1990er Jahren fielen die Autokratien überall in Afrika, Lateinamerika und Asien wie Dominosteine um. Mancherorts nahmen sich die Bürger ein Beispiel an Osteuropa und gingen in Massen auf die Straße; das erstaunlichste Beispiel dafür ist der Sturz von Präsident Suharto in Indonesien. In anderen Fällen knüpften ausländische Geldgeber weitere Hilfsleistungen an die Bedingung der Etablierung einer Demokratie; das beste Beispiel dafür ist Kenia, wo die diplomatische Gemeinschaft erkannte, dass sie Präsident Moi unter Druck setzen konnte. Manchmal spürten Autokraten auch, dass der Wind sich drehte, und beschlossen, ihr Fähnlein danach zu hängen. Außerdem umgeben sich Autokraten für gewöhnlich mit Speichelleckern, was wahrscheinlich auf seine Weise die Demokratisierung gefördert hat. Denn was wird ein Autokrat, der über Demokratisierung nachdenkt, sein Umfeld fragen? Im Grunde wird es für ihn nur eine einzige Frage geben: Wenn ich Wahlen abhalte – werde ich gewinnen? Und was werden die Speichellecker aus seiner Umgebung darauf antworten? Wahrscheinlich haben sie keine Ahnung, denn es ist nicht ihre Aufgabe, die öffentliche Meinung einzuschätzen. Aber auch wenn sie vermuten oder wissen, dass die Bevölkerung den Präsidenten verabscheut, haben sie ein Problem. Haben sie ihm nicht jahrelang gesagt, dass die Menschen ihn lieben würden? Wer ihm die Wahrheit gesagt hatte, war zumeist die längste Zeit sein Berater gewesen.
Mindesten drei Autokraten erlebten auf diesem Weg ein Fiasko: Suharto in Osttimor, Kaunda in Sambia und Mugabe in Simbabwe. Alle drei hielten Wahlen ab, weil sie von ihrem Sieg überzeugt waren. Suharto verlor dabei Osttimor, da sich die Menschen mit überwältigender Mehrheit für die Unabhängigkeit entschieden. Kaunda erging es kaum besser: Er erhielt nur rund 20 Prozent der Stimmen; manche hatten ihn also tatsächlich geliebt, vor allem die Bewohner seiner Heimatregion, die er bei der Zuteilung von Staatsgeldern bevorzugt hatte. Als sich das Wahlergebnis abzeichnete, war er natürlich wütend über die Undankbarkeit der Menschen. Wer weiß, was geschehen wäre, wenn nicht Jimmy Carter an der Spitze einer Wahlbeobachtergruppe im Land gewesen wäre. Als die ersten Ergebnisse bekannt wurden, ahnte Carter, was er tun musste. Er eilte zum Präsidentenpalast, um Kaunda seines Mitgefühls zu versichern – immerhin hatte er eine ähnliche Erfahrung hinter sich –, und blieb dort, bis es zu spät war, um die Abstimmung annullieren zu lassen. Durch Carters Anwesenheit im Palast hatte Kaunda keine andere Wahl, als die Niederlage hinzunehmen. Ob er dies ohne Carter getan hätte, ist fraglich. Angeblich ist er anschließend kreuz und quer durch Afrika gereist, um die Präsidenten davor zu warnen, den gleichen Fehler zu begehen.
Und Präsident Mugabe? Mitte der 1990er Jahre war er dem Trend gefolgt und hatte eine Verfassung eingeführt, die ein Mehrparteiensystem vorsah und die Amtszeit des Präsidenten begrenzen sollte. Viele Diktatoren, die einer Begrenzung ihrer Amtszeit zustimmten, taten dies in dem Glauben, die Verfassung vor dem Ende ihrer Präsidentschaft auf die eine oder andere Weise ändern zu können. So wurden Amtszeitbegrenzungen zu Zeitbomben. Das spektakulärste Bespiel einer erfolgreichen Umgehung der Verfassung ist die Methode des russischen Ex-Präsidenten Putin: Man erspare sich die Mühe, die Amtszeit zu verlängern, wechsle einfach ins Amt des Ministerpräsidenten und verlagere die effektive Macht auf diesen neuen Posten. Der nigerianische Präsident Obasanjo scheiterte ebenso wie der sambische Präsident Chiluba bei dem Versuch, seine Amtszeit zu verlängern, während es den Präsidenten des Tschad und von Uganda, Deby und Museveni, gelang. Präsident Mugabe entschied sich für eine Verfassungsänderung, um die Begrenzung der Amtszeit aufzuheben und die präsidialen Machtbefugnisse beträchtlich zu erweitern. Dafür brauchte er jedoch einen Volksentscheid – den er verlor. Leider fiel das Referendum nicht mit einer Präsidentenwahl zusammen, und so blieb Mugabe im Amt in dem Wissen, dass er eine demokratische Wahl verlieren würde. Auf das Problem, vor dem er nun stand, werde ich später zurückkommen. Vorläufig möchte ich beim Thema der Verbreitung der Demokratie bleiben. In einem Land nach dem anderen stellten sich die Regierungen zur Wahl. Die einen siegten, andere verloren, aber in jedem Fall konnte die Opposition sich jetzt besser Gehör verschaffen.
WIEALSOHATSICHDIESEVERBREITUNGder Demokratie auf die Anfälligkeit für politische Gewalt ausgewirkt? Selbstverständlich sollte die Gewalt nachlassen. Doch so selbstverständlich es aussehen mag, hilft es im Allgemeinen, die Grundlagen dessen, was wir zu wissen glauben, einmal aufzuschreiben. Soweit ich sehe, gibt es zwei Gründe für die Annahme, dass die Demokratie das Auftreten von politischer Gewalt verringert, zwei Gründe, die einander ergänzen und gegenseitig verstärken: Verantwortlichkeit und Legitimität. Das Konzept der Verantwortlichkeit funktioniert wie folgt: In Demokratien haben Regierungen keine andere Wahl, als zumindest zu versuchen, der Bevölkerung das zu geben, was sie will. Wird die Arbeit der Regierung für gut befunden, wird sie wiedergewählt; wird sie als schlechter eingeschätzt als die Versprechen der Gegenkandidaten, verliert die Regierung ihre Macht. Auf jeden Fall sind die Regierungen bestrebt, gute Arbeit zu leisten, weil sie den Wählern gegenüber in der Verantwortung stehen. Diktatoren mögen sich dafür entscheiden, ebenso gute Arbeit zu leisten, aber in ihrem Fall ist es eben dies: ihre eigene Entscheidung. Demokratische Regierungen haben diese Wahl nicht. In der Praxis entscheiden sich Diktatoren freilich oft genug für etwas völlig anderes, man denke nur an Mobutu. Die Demokratie zwingt also die Regierung zu besseren Leistungen, da sie die politischen Führer in die Verantwortung nimmt. Warum sollte dies wiederum die politische Gewalt verringern? Ganz einfach: weil weniger Anlass zur Klage besteht. Wenn eine Regierung gut für die Bevölkerung sorgt, neigt diese weniger dazu, sich mit Waffengewalt gegen sie aufzulehnen.
Welche Auswirkungen hat nun die Legitimität? Gewählt zu sein, gilt heute als einzige Legitimation für das Regieren. Damit erwerben Regierungen, zumindest der Demokratietheorie zufolge, aber auch gewisse Rechte. Eine legitime Regierung besitzt das Mandat zu tun, was sie angekündigt hat, und dies berechtigt sie, die Opposition bei der Verwirklichung ihres Programms zu überstimmen. In Demokratien werden diese Regeln allgemein anerkannt, weshalb die Opposition in ihrer Ablehnung des Programms einer gewählten Regierung legitimerweise nicht so weit gehen kann, zu politischer Gewalt zu greifen. Dies ist ein weiterer Grund für ein geringes Maß an politischer Gewalt. Auch wenn es extreme Gegner geben sollte, die der Regierung das Recht, ihr Programm zu verwirklichen, verweigern wollen, wird es ihnen schwerfallen, eine Massenbasis für eine gewalttätige Opposition zu finden. Sie können nicht mehr behaupten, ihr Kampf sei gerecht.
Die Demokratie sollte daher einen doppelten Schutz gegen politische Gewalt bieten: Zum einen gibt es weniger Anlass zur Klage, und zum anderen dürfte es allen, die dennoch Klage führen, schwerfallen, die Menschen zum gewalttätigen Kampf gegen die Regierung zu überreden.
Wir sind so sehr davon überzeugt, dass die Demokratie die Antwort auf politische Gewalt darstellt, dass es fast als unverschämt erscheint, an der Realität zu überprüfen, ob diese Annahme richtig ist. Dass die Demokratie den Frieden fördert, ist eine der Grundgewissheiten der politischen Welt geworden; tatsächlich dürfte sie zu den wenigen Überzeugungen gehören, die quer durch das politische Spektrum von allen geteilt werden. George Soros und George Bush sind sonst nicht in vielem einer Meinung, aber in diesem Punkt dürften sie vermutlich ebenso übereinstimmen wie Millionen anderer Menschen.
Als die Länder der untersten Milliarde sich zu demokratisieren begannen, war ich ebenso begeistert wie alle anderen. Die folgenden Jahre waren jedoch schwieriger, als ich erwartet hatte. Ich habe nicht viel übrig für Außenstehende, die sich zu besserwisserischen Richtern aufschwingen. Veränderungen sind schwierige Prozesse, die häufig auf starken Widerstand stoßen. Es ist nicht so, dass die Gesellschaften der untersten Milliarde meine Erwartungen nicht erfüllt hätten. Vielmehr begann ich zu argwöhnen, dass ich Dinge übersehen hatte, die im Rückblick offensichtlich wurden. Tatsächlich hatte es von Anfang an Zweifler gegeben, aber ihre Stimmen waren im Lärm der Begeisterung für die Demokratie untergegangen. Im Wesentlichen regte sich bei mir der Verdacht, dass Theorien, die für weiterentwickelte Länder durchaus zutrafen, überdehnt worden sein könnten. Vielleicht fehlen in den Gesellschaften der untersten Milliarde einfach die nötigen Voraussetzungen, damit sich die Effekte der Verantwortlichkeit und der Legitimität entfalten konnten. Ich muss gestehen, dass ich diese Zweifel nur widerstrebend zuließ. Aber es war Zeit, sich die Wirklichkeit anzuschauen.
Man sollte annehmen, dass das Verhältnis von Demokratie und politischer Gewalt ein gut erschlossenes akademisches Gebiet ist. Zu meiner Überraschung stellte ich jedoch fest, dass dies nicht zutraf. Stattdessen war diese Frage in den modernen Sozialwissenschaften eine regelrechte Terra incognita geblieben: Ich konnte nicht eine einzige veröffentlichte Studie über dieses Thema aufspüren. Also machte ich mich zusammen mit dem jungen Schweizer Wissenschaftler Dominic Rohner an die Arbeit.
Für die Periode seit 1960 fanden wir Daten für buchstäblich alle Länder auf der Erde. Wie wirkte sich die Demokratie, wenn man andere Faktoren, die wahrscheinlich ebenfalls eine Rolle spielten, herausrechnete, auf das Auftreten von politischer Gewalt aus? Anfangs konnten wir keinen Zusammenhang feststellen, was mir völlig unwahrscheinlich zu sein schien: Etwas so Wesentliches wie das politische Regime musste einfach eine Rolle spielen. Dann dämmerte uns, dass möglicherweise nicht über die gesamte Skala der ökonomischen Entwicklung derselbe Zusammenhang vorhanden war. Immerhin unterschieden sich die Gesellschaften der untersten Milliarde durch ihre Armut erheblich von anderen Demokratien. Vielleicht wirkte sich die Demokratie in armen Ländern anders auf die Gewaltneigung aus als in reichen Ländern. Nachdem wir uns dieser Möglichkeit bewusst geworden waren, zeigte sich, dass das politische Regime stets eine Rolle spielt. Tatsächlich hatte die Demokratie in armen Ländern den entgegengesetzten Effekt wie in reichen Ländern. Deshalb – wegen der beiden entgegengesetzten Wirkungen – hatte es zuerst den Anschein gehabt, als gäbe es überhaupt keinen Effekt. Um welche beiden Wirkungen handelte es sich?
Wir fanden heraus, dass die Demokratie in Ländern mit mittlerem Einkommen das Risiko des Auftretens von politischer Gewalt systematisch verringert. Die Annahme, dass die Demokratie Gesellschaften durch die Beachtung von Verantwortlichkeit und Legitimität befriedet hatte sich bestätigt. Aber in einkommensschwachen Ländern macht Demokratie die Gesellschaft gefährlicher. Als wäre Armut allein nicht schon schlimm genug, bringt die Demokratie diesen Ländern zusätzliche Probleme. Während Demokratie in wohlhabenden Gesellschaften die bereits vorhandene Sicherheit festigt, verstärkt sie in armen Ländern die vorhandenen ernsten Gefahren.
Wenn die Demokratie arme Länder gefährlicher macht, wohlhabende dagegen sicherer, dann muss es eine Einkommensschwelle geben, an der keinerlei Wirkung eintritt. Diese Schwelle liegt bei einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von rund 2700 Dollar, was einem Tagesverdienst von rund sieben Dollar entspricht. Die Gesellschaften der untersten Milliarde liegen allesamt unterhalb dieser Schwelle, die meisten von ihnen sehr weit darunter.
Nach meiner Ansicht lautet die Hauptfolgerung aus diesen Ergebnissen, dass die Theorie, nach der Verantwortlichkeit und Legitimität die Grundpfeiler der heilsamen Wirkung der Demokratie auf die Gesellschaften der untersten Milliarde seien, etwas übersehen müsse, und zwar etwas von der Größe eines Elefanten. Ein großer Teil dieses Buchs ist der Suche nach diesem Elefanten gewidmet. Aber ich habe noch nicht alle Resultate unserer Recherche angeführt.
Wie erwähnt, bedeutet ein höheres Einkommen mehr Sicherheit. Es stellte sich jedoch heraus, dass die mäßigende Wirkung eines höheren Einkommens davon abhängt, ob die Gesellschaft demokratisch ist. Noch auffallender war, dass in Gesellschaften, die reich werden, ohne demokratisch zu sein, die Neigung zu politischer Gewalt zunimmt. Demokratien werden mit steigendem Einkommen sicherer, Autokratien gefährlicher. Man kann sich beide Entwicklungen als zwei Geraden vorstellen, von denen die eine, die zeigt, dass Demokratien bei steigendem Einkommen sicherer werden, aufwärts weist, während die andere, die zeigt, dass Autokratien gefährlicher werden, abwärts weist. Die Einkommensschwelle, an der keine Wirkung auf die Gewaltneigung eintritt – 2700 Dollar –, ist einfach der Punkt, an dem die beiden Geraden sich kreuzen. Schaut man sich die Gesellschaft mit der erstaunlichsten Einkommensentwicklung in unserer Zeit, die chinesische, im Hinblick darauf an, dann stellt man fest, dass sie diese Schwelle inzwischen überschritten hat: Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen Chinas ist mittlerweile auf mehr als dreitausend Dollar gestiegen. Gemäß unserer Formel ist also mit einem Anstieg der politischen Gewalt in China zu rechnen, wenn sich das Land nicht demokratisiert.
Nachdem wir anfangs ziemlich großzügig über eine Vielzahl statistischer Probleme hinweggesehen hatten, wandten wir uns ihnen zu und prüften, ob unsere Ergebnisse standhielten. Zum Beispiel wirken sich wahrscheinlich sowohl Konflikte als auch das politische Regime auf das Pro-Kopf-Einkommen eines Landes aus. Die Kausalität könnte also unserer Interpretation entgegengesetzt verlaufen. Doch wir stellten erleichtert fest, dass dies nicht zutraf: Unsere Ergebnisse erwiesen sich zumindest in diesem Punkt als stichhaltig. In der kleinen Welt der statistischen Untersuchung politischer Gewalt waren James Fearon und David Laitin in Stanford unsere wichtigsten Konkurrenten. Wie wir hatten sie ein Modell der Gewalt auslösenden Faktoren entwickelt, das sich allerdings im Detail von unserem unterschied. Ihr Modell auf unsere Annahme anzuwenden, dass Demokratie in Gesellschaften der untersten Milliarde die Gewaltneigung verstärkt, war daher ein guter Test. Zum Bedauern für diese Gesellschaften bestand sie auch diese Prüfung. Das in meinen Augen bemerkenswerteste Ergebnis erhielten wir, als wir eine Reihe unterschiedlicher Formen politischer Gewalt untersuchten, von Attentaten über Aufstände, politische Streiks und Guerillaaktivitäten bis zu brutalen Bürgerkriegen. Zu meinem Erstaunen galt für sie alle dasselbe Muster: Bei geringem Einkommen verstärkt die Demokratie die politische Gewalt.
Ich glaube jedoch nicht, dass dieser Zusammenhang unveränderlich ist: Später werde ich erläutern, wie es uns gelingen kann, dass die Demokratie auch in Gesellschaften der untersten Milliarde funktioniert. Aber überlegen wir einmal, welche Folgen es hätte, wenn der Zusammenhang zwischen Einkommen, Demokratie und politischer Gewalt nicht verändert werden könnte. Dann würden unsere Ergebnisse den Schluss nahelegen, dass es, um den gesellschaftlichen Frieden zu wahren oder zu schaffen, eine bevorzugte Reihenfolge von wirtschaftlichen und politischen Veränderungen gäbe: Das ideale Stadium für die Demokratisierung wäre erreicht, wenn eine Gesellschaft bereits einen gewissen wirtschaftlichen Entwicklungsstand hätte.
Beim Nachdenken über diese Ergebnisse drängte sich Dominic und mir die Frage auf: Warum? Genau genommen waren es drei Fragen: Warum hängt die mäßigende Wirkung der Demokratie, erstens, von der Höhe des Einkommens ab? Welche Eigenschaft des Einkommens bewirkt, dass es in reicheren Gesellschaften den Frieden fördert? Zweitens stellte sich die umgekehrte Frage: Warum werden Autokratien bei steigendem Einkommen gefährlicher? Die dritte Frage schließlich betraf den rätselhaftesten unserer Befunde, dem zufolge die Demokratie, über die vom Einkommen abhängige Wirkung hinaus, das Gewaltrisiko erhöht. Wie eine nicht greifbare dunkle Materie fand sich diese Tendenz in allen Gesellschaften wieder. Was hatte es damit auf sich? Keine einfachen Fragen.
Den entscheidenden Ausgangspunkt für die Beantwortung dieser Fragen fand ich durch eine einfache psychologische Technik: Ich versetzte mich in die Lage eines ehemaligen Diktators eines Landes der untersten Milliarde, der der Forderung ausländischer Geldgeber, sein Land zu demokratisieren, nachgegeben hatte. Ich stellte mir die Frage, wie ich bislang den Frieden aufrechterhalten hatte und wie die Demokratisierung mein Problem nun veränderte. Selbstverständlich war ich nicht der Erste, der darüber nachdachte, wie ein Diktator sich am geschicktesten an der Macht hält. Herodot berichtet, dass der junge Periander, nachdem er sich zum Tyrannen von Korinth aufgeschwungen hatte, einen Gesandten ausschickte, um den alten, erfahrenen Tyrannen von Milet, Thrasybulus, um Rat zu fragen. Hatte Thrasybulus, der sich schon so lange an der Macht hielt, einen Tipp für jemanden, der erst am Anfang der Tyrannenkarriere stand? Thrasybulus spazierte mit dem Gesandten über ein Weizenfeld und köpfte, während er sich mit ihm unterhielt, ständig Ähren, die aus der Masse der Halme herausragten. Der Bote kehrte verwirrt nach Korinth zurück, doch Periander verstand die Botschaft.
Obwohl sich die Sozialwissenschaften in den zweieinhalbtausend Jahren seit Herodot weiterentwickelt haben, fasst diese Episode die Technik der Machterhaltung recht gut zusammen. Verallgemeinert bedeutet die Botschaft des Thrasybulus, dass es darauf ankommt, präventiv zu handeln, das heißt, potentiell gefährliche Personen auszuschalten, bevor sie in Aktion treten. Wirkt sich die Demokratie auf meine Fähigkeit aus, solche Säuberungen durchzuführen? Nun, das unangenehme Problem bei präventiven Säuberungen ist, dass sie nicht mit dem Rechtsstaat vereinbar sind, schließlich besteht diese Machterhaltungstechnik darin, Menschen zu bestrafen, die nichts getan haben. Ein solches Vorgehen steht im Widerspruch selbst zu bescheidenen Formen der Demokratie.
Dass die Möglichkeit, Säuberungen durchzuführen, unter demokratischen Verhältnissen verloren geht, war eine plausible Erklärung für die dunkle Materie. Wenn Staatsführer keine präventiven Säuberungen mehr vornehmen können, sind sie weniger gut in der Lage, die politische Gewalt im Zaum zu halten. Das könnte ein Grund dafür sein, warum die Demokratie, über die mit der Höhe des Einkommens zusammenhängenden Wirkungen hinaus, die Gefahr des Auftretens von politischer Gewalt erhöht. Herodot hatte uns eine Hypothese gegeben; jetzt war es an der Zeit, sie zu überprüfen.
Wir benutzten eine riesige Datenbank über politische Säuberungen. Es ist unglaublich, aber über solche Dinge wird Buch geführt, Land für Land und Jahr für Jahr. Wir wollten herausfinden, ob die Demokratie, abgesehen von anderen Einflüssen, Säuberungen erschwert. Wie zu erwarten, verringerte selbst ein geringes Maß an Demokratie die Häufigkeit von Säuberungen drastisch. Möchte man den inneren Frieden also durch Repression sichern, stellt die Einführung demokratischer Strukturen einen erheblichen technologischen Rückschritt dar.
Schauen wir uns ein aktuelles, praktisches Beispiel aus der realen Welt an, das zeigt, wie sehr die Demokratisierung die Friedenssicherung erschweren kann – den Irak. Wie unzulänglich das gegenwärtige Regime auch sein mag, es ist erheblich demokratischer als dasjenige von Saddam Hussein. Dennoch herrschte Hussein über ein relativ friedliches Land. Es war zwar kein angenehmer Zustand, aber doch eine Art Frieden, und er beruhte ganz offensichtlich nicht auf dem Konsens der Bevölkerung, sondern auf präventiver Repression.
Eine wahrscheinliche Erklärung der dunklen Materie, des höheren Risikos von politischer Gewalt in Demokratien, dürfte also die Schwächung der Repressionstechniken sein. Aber warum wird dann die Nettowirkung der Demokratie mit steigendem Einkommen immer positiver? Ich denke, das liegt an den Prinzipien, die ich am Anfang genannt habe: Verantwortlichkeit und Legitimität. Umgekehrt besteht der Grund dafür, dass diese Prinzipien in der untersten Milliarde das Risiko der politischen Gewalt nicht verringern, einfach darin, dass die Demokratie in diesen Ländern weder Verantwortlichkeit noch Legitimität garantiert. Warum ist das so?
IMLAUFDERJAHREHATTEICH einige überaus kluge Studenten, aber der zweifellos klügste von ihnen war Tim Besley, der später die American Economic Review herausgegeben hat und heute als hoch angesehener Professor an der London School of Economics lehrt. Sein Buch Principled Agents? stellt den ernsthaftesten theoretischen Ansatz dar, die Frage zu beantworten, ob Politiker durch den Zwang, sich zur Wahl stellen zu müssen, diszipliniert werden. Das Buch ist kompliziert, aber ich will versuchen, seine wesentlichen Aussagen hier wiederzugeben. In Gesellschaften wie den unseren fällt die Beantwortung von Tims Frage leicht: Wenn amtierende Politiker nicht einmal versuchen würden, die Erwartungen der Wähler zu erfüllen, würde es uns auffallen. Das Handeln politischer Führer wird von den Medien aufmerksam beobachtet, und würde ein Politiker auf Kosten der einfachen Wahlbürger stets nur seine eigenen Interessen verfolgen, würde er nicht wiedergewählt werden. Aber Politiker wollen an der Macht bleiben. Hoffen wir, zum Teil auch deswegen, weil sie eine gewisse Berufung verspüren, Gutes zu tun, aber ganz offensichtlich deswegen, weil sie sich für diesen Lebensweg entschieden haben: Politik ist ihr Beruf, und sie wollen nicht arbeitslos werden. Politische Führer sehen sich also, von den Medien belauert und vom eigenen Machtstreben angetrieben, genötigt, sich nach Kräften für das Gemeinwohl einzusetzen.
Aber in Gesellschaften der untersten Milliarde herrschen häufig völlig andere Verhältnisse. Angenommen, die Wähler wissen kaum etwas über die Alternativen, vor denen sie stehen. Selbst das bisherige Handeln der amtierenden Politiker, das sie über sich ergehen lassen mussten, kann in der Regel unterschiedlich beurteilt werden. Möglicherweise gibt es mildernde Umstände für schlechte Ergebnisse; möglicherweise ist nicht die Regierung an ihnen schuld. In den instabilen Wirtschaften der untersten Milliarde ist dies allzu oft tatsächlich der Fall: Sie werden regelmäßig von Erschütterungen heimgesucht, die lokal nicht beherrschbar sind. Ein typisches Ereignis dieser Art ist der Preisverfall bei den Exportgütern eines Landes, gefolgt von einem Zusammenbruch der Wirtschaft. In mindestens drei afrikanischen Demokratien ist dies vor einer Wahl geschehen. In allen drei Fällen hatte die amtierende Regierung gute Arbeit geleistet. Benin traf es vor der Wahl von 1996, durch die ein Reformpräsident sein Amt verlor. In Uganda geschah es vor der Wahl von 1998, nachdem der Weltmarktpreis für Kaffee abgestürzt war, und Madagaskar litt vor der Wahl von 2006 unter einer Kombination aus fallenden Exportpreisen und steigenden Preisen für Erdölimporte. Wie sollten die Wähler unterscheiden, ob das Wirtschaftschaos, das sie erlebten, Folge einer unvermeidlichen äußeren Erschütterung oder aber des Unvermögens ihrer Regierung war? Natürlich versuchten die Regierungen es ihnen zu erklären, aber Regierungen suchen stets nach Ausflüchten. Wieso sollten die Wähler ihnen Glauben schenken?
Abgesehen vom Problem der mangelnden Information, werden viele Wähler allein aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit für oder gegen die amtierende Regierung stimmen, ohne deren Leistungsbilanz überhaupt zu beachten. Die Wahlentscheidungen der untersten Milliarde beruhen zumeist auf der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe. Da diese Gesellschaften für gewöhnlich in ethnische Gruppen gespalten sind, stellt die Volkszugehörigkeit die bei weitem einfachste Grundlage dar, politische Loyalität zu organisieren. Das Problem dabei ist, dass sich diese Loyalität, da sie nicht themenbezogen ist, auch nicht auf Leistungen bezieht. Die Wähler schließen sich einfach zu Blöcken rivalisierender ethnischer Identitäten zusammen, die für oder gegen eine Regierung abstimmen. Infolgedessen ist der Stimmenanteil, den ein amtierender Politiker erhält, kaum von seiner Leistung abhängig: Nur wenige Stimmen werden mit Blick darauf abgegeben, was er vorzuweisen hat. Den Menschen fehlt also nicht nur das Wissen, politische Leistungen zu beurteilen, sondern es gibt auch nur wenige Wähler, die ihre Entscheidung auf solch ein Urteil stützen.
Darüber hinaus kann auch der Handlungsspielraum der Regierungen relativ eng sein, wozu mitunter ihre eigenen Mängel beitragen. Insbesondere nach jahrelanger Erfolglosigkeit mag eine Regierung das Vertrauen in ihre eigene Fähigkeit, entscheidend in ökonomische Entwicklungen einzugreifen, verloren haben.
Und letztlich müsste eine Regierung, die sich für eine anständige Politik entschieden hat, auf eine äußerst lukrative Verhaltensweise verzichten. Die Wirtschaft zu schikanieren, mag den einfachen Menschen schaden, aber es schafft viele Nischen und dunkle Ecken für die persönliche Bereicherung und die Belohnung treuer Gefolgsleute. Wenn diese Möglichkeiten versiegen, hat der Staatsführer kein Mittel mehr in der Hand, um sich die Loyalität seiner Anhänger zu sichern.
Worauf all das hinausläuft? Wenn den Wählern immer mehr Informationen vorenthalten werden, wenn Identitätspolitik immer mehr Stimmen zu Wahlblöcken zusammenfasst, wenn das Vertrauen der Regierung in ihre eigene Gestaltungsfähigkeit abnimmt und es immer kostspieliger wird, von einer schlechten Regierungsführung abzuweichen, dann ist ein Punkt erreicht, an dem amtierende Politiker sich nicht mehr durch den Gedanken an die nächste Wahl schrecken lassen. Und wenn Politiker auch ohne eine positive Leistungsbilanz gute Chancen haben, Wahlen zu gewinnen, dann – und das ist Tim Besleys niederschmetterndste Aussage – wird sich eine andere Art von Menschen für die Laufbahn des Politikers entscheiden. Wenn man durch Anständigkeit und Kompetenz keinen Wahlvorteil erlangt, dann werden anständige und kompetente Kandidaten entmutigt, und Gauner werden an ihre Stelle treten.
Ein deprimierendes Anzeichen für diese Entwicklung ist die Tatsache, dass demokratische Politik in den Ländern der untersten Milliarde Kandidaten mit Vorstrafen anzieht. Man sollte meinen, dass Vorstrafen einen Kandidaten von vornherein diskreditieren. In Amerika, Großbritannien und der übrigen reichen Welt dürfte dies auch zutreffen. In den Gesellschaften der untersten Milliarde sieht es jedoch anders aus. Dort fehlen den Wählern einfach die Informationen, um Vorwürfe auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen: Entweder ist die Presse geknebelt, oder sie ist zu frei, und es wird zu viel mit Schmutz geworfen, ohne sich um Beweise zu kümmern, als dass die Wähler noch etwas von dem glauben könnten, was man ihnen sagt. Oder die Wähler fühlen sich ethnischen Blöcken zugehörig und wählen jeweils ihre eigenen Politiker, auch wenn es sich um Kriminelle handelt.
Ein Grund, warum die Wahl in ein politisches Amt für Kriminelle so attraktiv ist, besteht offensichtlich darin, dass nur Menschen mit krimineller Energie die Gelegenheit zur Korruption ergreifen werden, die sich in einem solchen Amt bietet. Manchmal gibt es aber noch einen weiteren Grund: Ein politisches Amt verleiht Immunität vor Strafverfolgung. Es liegt auf der Hand, für wen dies besonders wichtig ist. Für die Anständigen bedeutet Immunität lediglich Schutz vor bösartigen Angriffen, denen sie letztlich wohl sowieso standgehalten hätten. Für Kriminelle dagegen bedeutet sie Freiheit statt Gefängnis. Manchmal wird daraus eine regelrechte Farce. Nach den Gouverneurswahlen von 2007 in Nigeria kam es zu einem Wettlauf zwischen der Polizei und einem Kandidaten, der die Wahl zum stellvertretenden Gouverneur gewonnen hatte. Die Frage war, ob er es schaffen würde, sich in seinem neuen Amt vereidigen zu lassen, bevor man ihn verhaftete. Es stand auf Messers Schneide, ob er in der Amtsvilla des stellvertretenden Gouverneurs oder aber hinter Gittern landen würde.
Wenn anständige Menschen erkennen, dass sie wahrscheinlich nicht gewinnen werden, und sich deshalb gar nicht erst als Kandidaten aufstellen lassen, haben die Wähler nicht einmal die Möglichkeit, sich für einen anständigen Politiker zu entscheiden. Deshalb hat es auch kaum Sinn, sich über die Kandidaten zu informieren, was dem Teufelskreis eine weitere Drehung hinzufügt.
Besley bewegt sich mit seiner Analyse in einem Grenzbereich der Demokratieforschung. Aber im Vergleich mit den Wahlkämpfen, wie man sie aus den Ländern der untersten Milliarde kennt, erscheint selbst die von ihm geschilderte Welt als wohlgeordnet. Immerhin halten sich die Politiker in ihr noch an die Regeln; sie haben es lediglich mit schlecht informierten Wählern zu tun.
Ich will mich erneut in die Lage eines altgedienten Autokraten versetzen, der auch unter demokratischen Verhältnissen seine Macht behalten will. Welche Optionen stehen ihm offen? Als Erstes muss er sich, so schwer es ihm auch fällt, eingestehen, dass das Volk ihn nicht liebt. Anstatt für die von ihm vollbrachten Wunder dankbar zu sein, scheint den Menschen in zunehmendem Maß bewusst zu werden, dass ihr Land während seiner langen Herrschaft auf der Stelle getreten ist, während sich andere Länder, die eine ähnliche Ausgangsposition hatten, weiterentwickelt haben. Manche seiner Kritiker können sogar überzeugend erklären, warum das seine Schuld sei. So weit ist es also gekommen. Kopfschüttelnd greift er zu seinem goldenen Füllfederhalter und stellt eine Liste seiner Handlungsoptionen auf. Da er systematisch vorgehen will, notiert er zu jeder von ihnen das Pro und Kontra.
Option 1Ein neues Kapitel beginnen und gut regieren
PRO
Das ist wahrscheinlich das, was die meisten Menschen wollen. Es wäre eine echte Veränderung, du würdest dich möglicherweise besser fühlen und vielleicht sogar etwas hinterlassen, worauf deine Kinder stolz sein können.
KONTRA
Du hast keine Ahnung, wie du das anstellen sollst. Mit den Fähigkeiten, die du dir im Lauf der Jahre angeeignet hast, geht es nicht. Sie bestehen im Wesentlichen darin, eine große Zahl von Menschen um die Futtertröge der Patronage zu scharen. Mein Gott, du müsstest wahrscheinlich diese verdammten Berichte der Spendenorganisationen lesen. Und selbst wenn du wüsstest, was verändert werden muss, wäre der Beamtenapparat nicht in der Lage, es zu verwirklichen. Schließlich hast du über Jahre hinweg dafür gesorgt, dass jeder, der auffiel oder sogar anständig war, vor die Tür gesetzt wurde: Anständige Menschen sind nicht so leicht zu steuern. Ja, auch du hast deinen Herodot gelesen. Aber schlimmer noch, Reformen könnten gefährlich sein. Deine Freunde, die schleimerischen Parasiten, mit denen du dich umgeben hast, könnten nicht einverstanden sein und eine Palastrevolte anzetteln, um dich zu ersetzen. Der Außenwelt gegenüber würden sie es wahrscheinlich als Reform deklarieren! Aber einmal angenommen, du ziehst das wirklich durch und wirst zum guten Regenten. Würde man dich wählen? Wenn du an all die Politiker aus reichen Ländern denkst, denen du im Lauf der Jahre begegnet bist und die dich oft genug über die Notwendigkeit belehrt haben, verantwortungsvoll und gut zu regieren: Was ist aus ihnen geworden? Wie haben sie sich in Wahlen gehalten? Grob geschätzt, haben sie nur in rund 45 Prozent der Fälle gewonnen. Du hättest also, wenn du dich auf diese Option einlässt, eine Chance von 45 Prozent.
Die erste Option sieht nicht besonders attraktiv aus, so sehr die ausländischen Botschafter eine gute Regierungsführung auch glorifizieren mögen. Im Vergleich zu deinen glücklicheren Kollegen aus den reichen Ländern würden dir die offensichtlichen Schwierigkeiten, vor denen du ständest, wenn du gut regieren wolltest, die Wahlchancen verhageln. Du könntest jetzt endlos über die Ungerechtigkeit des Lebens jammern, aber Selbstmitleid bringt dich nicht weiter. Du musst das Beste aus dem machen, was du hast. Und du hast gegenüber deinen Kollegen in den reicheren Ländern einen potentiellen Vorteil: Du musst dich zwar zur Wahl stellen, wirst aber weit weniger genau unter die Lupe genommen als sie. Lässt sich so nicht eine Strategie finden, mit deren Hilfe du trotz schlechten Regierens gewinnen kannst?
Option 2Die Wähler belügen
PRO
Du kontrollierst die meisten Medien; es ist also relativ einfach. Darüber hinaus besitzt die Bevölkerung weder Bildung noch Vergleichsmöglichkeiten, um beurteilen zu können, wie schlimm es wirklich steht. Du kannst ihnen also ruhig weiterhin erklären, wie glücklich sie sein sollen, dich als Präsident zu haben.
KONTRA
Da du das seit Jahren machst, glauben dir die Menschen kein Wort mehr.
Mit anderen Worten: Lügen lohnt sich sicherlich, aber es genügt nicht, um die Wahl zu gewinnen.
Option 3Eine Minderheit zum Sündenbock machen
PRO
Das funktioniert! Du kannst entweder Minderheiten im eigenen Land oder ausländische Regierungen für all unsere Probleme verantwortlich machen. Präsident Mugabe in Simbabwe ist dafür ein gutes Vorbild. Hasspolitik hat eine lange und in Wahlen ziemlich erfolgreiche Tradition. In den meisten Gesellschaften der untersten Milliarde gibt es ethnische Minderheiten, die man anprangern kann, und wenn alle Stricke reißen, kann man immer noch Amerika die Schuld geben. Außerdem kann man der eigenen Gruppe eine Vorzugsbehandlung versprechen.
KONTRA
Einige deiner besten Freunde gehören ethnischen Minderheiten an. Tatsächlich haben sie dich im Gegenzug für Vergünstigungen seit Jahren finanziell unterstützt. Du bevorzugst Geschäftsleute aus ethnischen Minderheiten, weil sie, wie reich sie auch sein mögen, nie eine politische Gefahr für dich darstellen werden. Die ethnischen Kerngruppen sind diejenigen, die du auf Abstand halten musst. Und wenn du die Minderheiten zu sehr verschreckst, werden sie ihr Geld ins Ausland schaffen.
Mit anderen Worten, die Sündenbocktaktik ist zwar wirkungsvoll, wird aber von einem bestimmten Punkt an ziemlich kostspielig.
Option 4Bestechung
PRO
Mit Bestechungen spielst du einen deiner entscheidenden Vorteile gegenüber der Opposition aus – du hast mehr Geld.
KONTRA
Kannst du dich darauf verlassen, dass die Empfänger sich an ihr Wort halten? Werden sie tatsächlich für dich stimmen? Immerhin gibt es da draußen eine Menge skrupelloser Leute.
Du bist dir also nicht sicher. Wenn es doch nur ein zuverlässiges Forschungsergebnis gäbe! Bei der Suche im Internet stolperst du über einen gewissen Pedro Vicente vom Zentrum für afrikanische Wirtschaften in Oxford. Du fängst an, die Seite zu überfliegen, bist aber rasch gefesselt, und das mit Recht, denn Vicente hat in São Tomé und Principe, das direkt vor der Küste deines eigenen Landes liegt, eine randomisierte, kontrollierte Untersuchung über Wahlbestechung durchgeführt.
Du stellst fest, dass sein Hauptinteresse der lästigen Frage galt, ob man Bestechungen unterbinden kann. Dann stößt du auf den für dich wichtigen Teil: In einigen Bezirken konnte die Korruption zwar durch Überwachung von außen eingeschränkt werden, aber nicht in allen, und in diesen Bezirken erhielten in der Regel die Kandidaten, die Bestechungsgelder gezahlt hatten, mehr Stimmen als die Mitbewerber. Bestechung funktioniert!
Tatsächlich gibt es zwei Arten von Bestechung: im kleinen und im großen Stil. Bestechung im Kleinen ist teuer und schwierig, kann aber die Anstrengung wert sein. Ihr Vorteil besteht darin, dass man gezielt die Taschen jener Wähler füllen kann, die für den Sieg ausschlaggebend sind. Dem kenianischen Präsidenten Moi, zum Beispiel, gelang es, indem er sich intensiv um Schlüsselwähler kümmerte, mit einem Stimmenanteil von nur 37 Prozent eine Wahl zu gewinnen.
Warum wirkt sich Bestechung nicht negativ aus? Wenn man die britische Labour Party bei dem Versuch ertappen würde, einzelnen Wählern für ihre Stimme Geld zu zahlen, wäre der politische Schaden immens. In vielen Gesellschaften sieht man Wahlen jedoch etwas anders: Wenn Politiker schon während ihrer Amtszeit nichts leisten, erwartet man von ihnen, dass sie sich wenigstens in der kurzen Periode, in der die Wähler eine gewisse Macht besitzen, spendabel zeigen. Bargeld lacht, könnte man sagen. Jedenfalls ist es besser als Wahlversprechen.
Aber auch wenn Politiker Schmiergeld anbieten können, ohne in die Kritik zu geraten, wie können sie sicher sein, dass die Wähler sich an die Abmachung halten? Immerhin ist die Stimmabgabe geheim. Was soll die Wähler davon abhalten, das Geld zu nehmen und dann für die Opposition zu stimmen?
In Kenia erkannte die Opposition, dass es ihr nur schaden würde, wenn sie den Wählern sagte, dass es falsch sei, sich bestechen zu lassen. Deshalb versuchte sie es gar nicht erst. Stattdessen riet sie den Menschen, das Geld der Regierung einzustecken, ihre Stimme aber der Opposition zu geben. Warum ist eine solche Empfehlung kein sehr wirkungsvolles Gegenmittel? Die Regierung hält zwei Trümpfe in der Hand, die disziplinierend wirken. Der eine ist paradoxerweise die Moral: Einfache, anständige Menschen fühlen sich häufig schlecht, wenn sie Geld von jemandem annehmen und dann das eingegangene Versprechen brechen. Das Argument der Opposition, dass ein Übel das andere aufhebe, ist geschickt, aber moralisch nicht ganz sauber. Der andere Trumpf ist die Angst vor Entdeckung: Denn wie geheim ist die Stimmabgabe wirklich? In Simbabwe verbreiteten Präsident Mugabes Leute das Gerücht, die Regierung würde erfahren, für wen man gestimmt habe. Angesichts des ständigen Machtmissbrauchs der Regierung ließ sich das nicht als leere Drohung abtun.
Eine einzelne Stimme entscheidet natürlich nicht darüber, wer regieren wird. Realistisch gesehen hat sie nicht den geringsten Einfluss auf das Ergebnis. Für die Opposition zu stimmen, ist deshalb das Risiko der Entdeckung, so klein es auch sein mag, nicht wert. Es könnte den Wähler in Schwierigkeiten bringen und wäre daher unverantwortlich für einen Erwachsenen, der unter ohnehin schon prekären Verhältnissen eine Familie durchbringen muss.
An diesem Punkt seiner Überlegungen angelangt, wird der Präsident vielleicht einen Kassensturz durchführen. Wie viel kostet es, den Durchschnittswähler zu bestechen, wie viele Stimmen muss er kaufen, und wie viele kann er sich leisten? In manchen Gesellschaften wird er sich zufrieden zurücklehnen, weil er über genügend Mittel für diese Strategie verfügt. In anderen wird er darüber nachdenken müssen, ob es nicht eine billigere Art des Wählerkaufs gibt. Und es gibt sie: Bestechung im großen Stil.
Sie besteht darin, dass man nicht für einzelne Stimmen zahlt, sondern für ganze Stimmblöcke. In armen, ländlichen, traditionsgebundenen Gesellschaften ist die blockweise Stimmabgabe weit verbreitet. Die führenden Lokalgrößen geben die Richtung vor, und ihre Empfehlung wird von niemandem ernstlich in Frage gestellt. Bei der Stimmauszählung stellt sich häufig heraus, dass in vielen Dörfern alle Bewohner für denselben Kandidaten gestimmt haben. Wenn das Stimmverhalten von Lokalgrößen abhängt, dann ist es ganz offensichtlich billiger, sich gleich deren Unterstützung zu erkaufen, als um einzelne Stimmen zu buhlen.
Alles in allem ziehst du nun den Schluss, dass Bestechung dein Mittel der Wahl ist. Die Frage ist nur, ob du genug Geld hast, um auf diese Weise einen Sieg zu erringen. Deshalb denkst du noch ein bisschen weiter nach.
Option 5Einschüchterung
Die meisten Politiker versuchen sich bei den Wählern einzuschmeicheln, aber es gibt auch die diametral entgegengesetzte Technik – Einschüchterung.
PRO