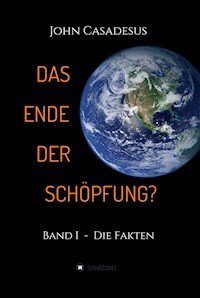
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das "Ende der Schöpfung" beinhaltet eine umfassende, detaillierte und topaktuelle Dokumentation sämtlicher Klimafakten (Stand 2016), die den durch den Menschen verursachten Klimawandel zweifelsfrei beweisen. Zudem werden die vielfältigen Gefahren einer fortschreitenden Erderwärmung aufgezeigt bis hin zur Vernichtung der Schöpfung. Durch folgende Punkte zeichnet sich dieses Buch aus: a) Alle Klimafakten beruhen auf seriösen und international anerkannten Quellen der Klimawissenschaft. b) Große, übersichtliche Bilder und Graphiken dienen zur Veranschaulichung der Fakten, darunter 50 farbige Abbildungen. c) Eine klare, übersichtliche Gliederung des umfangreichen Stoffes sowie das Hervorheben wichtiger Absätze erleichtert das Lesen und die Orientierung. d) Das Buch ist ausschließlich auf wissenschaftlichen Fakten aufgebaut. Damit erhält der Leser ein einzigartiges "Klimalexikon", das ihn sachlich und fachlich über die topaktuelle Faktenlage des Klimawandels informiert. In Band 2 folgt dann unter dem Untertitel "Die Chancen" u.a. eine ausführliche Bestandsaufnahme der emissionsfreien Energiequellen. Dies umfasst sowohl den aktuellen Stand der Technik und Anwendung als auch die wirtschaftlichen und politischen Möglichkeiten, die Erderwärmung mit Hilfe dieser Technologien zu begrenzen. U.a. werde ich dort auf die große Chance der Menschheit eingehen, mit einer Kombination aus Zukunftsinvestitionen, Innovationen, technologischem Fortschritt, intelligenter Energieeffizienz, kluger Kooperation und sinnvoller Koordination, nur kleinen Einschränkungen des Komforts und der Lebensweise sowie einer zielgerichteten Gesetzgebung die globale Erderwärmung zu begrenzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Der Klimawandel
Das Ende der Schöpfung?
Band I - Die Fakten
Meiner Frauundmeinen Söhnen gewidmet
John Casadesus
ISBN 978-3-7345-2380-9 (Paperback)
ISBN 978-3-7345-2381-6 (Hardcover)
ISBN 978-3-7345-2382-3 (e-Book)
© 2016 John Casadesus
Abbildung Front-Cover: Quelle NASA, File:BlueMarble-2001-2002.jpg
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Der Klimawandel – Die Grundfakten
Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur
Anstieg des Kohlenstoffdioxidgehalts der Atmosphäre
Rückgang des arktischen Meereises
Abschmelzen der weltweiten Gletscher
Anstieg des globalen Meeresspiegels
Veränderungen in der Tierwelt
Verlängerung der Vegetationsperioden
Ökosysteme
Arktis, Antarktis und Grönland
Ökosystem Weltmeere
Ökosystem Gebirge
Flora und Fauna
Tierwelt
Pflanzenwelt
Tropenwälder
Kalte Regenwälder
Holzverbrennung fördert Klimaerwärmung
Zerteilte Wälder sterben schneller
Waldschäden durch Trockenheit
Klimaerwärmung und Schädlinge
Krankheiten und Klimawandel
Klimaerwärmung und konkurrierende Pflanzenarten
Extreme Wetterereignisse
Fakten und statistische Daten zu extremenWetterereignissen
Berichte und Analysen zu extremenWetterereignissen zwischen 2002 und 2015
Einzelberichte von extremenWetterereignissen zwischen 2002 und 2015
Fazit
Extreme Wetterereignisse - Bilanz und Prognose
Nordatlantische Oszillation (NAO)
Hauptursache des Klimawandels
Der Treibhauseffekt
Treibhauseffekt und Kohlenstoffkreislauf
Treibhausgase
Kohlenstoffdioxid
Methan
Distickstoffmonoxid (Lachgas)
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW)
Fluorkohlenwasserstoffe (FKW)
Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid
Weitere zum Treibhauseffekt beitragende Stoffe
Entwicklung der weltweiten Triebhausgasemissionen
Treibhausgasemissionen nach Sektoren
Treibhausgasemissionen nach Ländern
Das Kyoto-Protokoll
Kippelemente des Erdklimas
Eiskörper
Strömungssysteme
Ökosysteme
Fazit
Die Irrtümer der Klimaskeptiker
Das Ende der Schöpfung?
Einleitung
Globale Naturkatastrophen
Sibirischer Trapp
5 vor 12
Eiszeiten
Auftauchen des Homo sapiens sapiens
CO2-Gehalt und Eiszeiten
Die Schöpfung Gottes
Fazit
Bedeutende Zitate und Fakten
Stellen- und Literaturverzeichnis
Abkürzungen
Einleitung
2015 wärmstes Jahr seit 1880
Quelle: NOAA, NASA
Für 2015 meldete die NOAA wieder einen neuen Temperaturrekord. Damit übertraf 2015 das bisherige Rekordjahr 2014 um weitere 0,16 °C und ist damit das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1880. Die weltweite Durchschnittstemperatur stieg auf 14,8 °C, 0,9 °C mehr als der langjährige Durchschnitt im 20.Jahrhundert (13,9 °C), der in der Infografik als Nulllinie dient. Die fortschreitende Erderwärmung wird damit eindrucksvoll bestätigt: 9 der 10 wärmsten Jahre seit 1880 fallen in den Zeitraum 2000 bis 2015. Diese starke Häufung am Ende der Zeitskala ist ein eindrucksvoller Beweis für die globale Erderwärmung infolge des Treibhauseffekts.
Und die Temperatur steigt weiter rasant: Die Monate Januar bis Juli 2016 waren mit Abstand die wärmsten Monate, die je seit 1880 gemessen wurden. Dabei markiert der Februar mit +1,35°C gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1951 – 1980 einen absoluten Temperaturspitzenwert, der weit außerhalb der Schwankungsbreite liegt...
Als Einstieg in das Thema Klimawandel zwei Zitat-Absätze aus der Enzyklika „laudato si“ von Papst Franziskus:
1. “Laudato si’, mi’ Signore – Gelobt seist du, mein Herr”, sang der heilige Franziskus von Assisi. In diesem schönen Lobgesang erinnerte er uns daran, dass unser gemeinsames Haus wie eine Schwester ist, mit der wir das Leben teilen, und wie eine schöne Mutter, die uns in ihre Arme schließt: “Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter.”
4. Acht Jahre nach Pacem in terris sprach der selige Papst Paul VI. 1971 die ökologische Problematik an, indem er sie als eine Krise vorstellte, die „eine dramatische Folge“ der unkontrollierten Tätigkeit des Menschen ist. „Infolge einer rücksichtslosen Ausbeutung der Natur läuft er Gefahr, sie zu zerstören und selbst Opfer dieser Zerstörung zu werden.“ Auch vor der FAO sprach er von der Möglichkeit einer „ökologischen Katastrophe als Konsequenz der Auswirkungen der Industriegesellschaft“ und betonte „die Dringlichkeit und die Notwendigkeit eines radikalen Wandels im Verhalten der Menschheit“, denn „die außerordentlichsten wissenschaftlichen Fortschritte, die erstaunlichsten technischen Meisterleistungen, das wunderbarste Wirtschaftswachstum wenden sich, wenn sie nicht von einem echten sozialen und moralischen Fortschritt begleitet sind, letztlich gegen den Menschen.“
Mit der Enzyklika „laudato si“ hat Papst Franziskus als erstes katholisches Kirchenoberhaupt engagiert in die aktuelle Klimadebatte eingegriffen. Er machte klar, dass vor dem Hintergrund der erdrückenden und beunruhigenden Faktenlage es oberste Pflicht eines jeden Christen sowie jedes Menschen guten Willens ist, sich nicht nur engagiert für den Klimaschutz einzusetzen, sondern auch selber aktiv mit seinem Verhalten für die Erhaltung von Gottes Schöpfung beizutragen.
Was die Weltgemeinschaft angesichts der äußerst besorgniserregenden Klimawandel-Entwicklung der letzten 35 Jahre bisher an wirksamen Maßnahmen zur Eindämmung der Erderwärmung mittels Begrenzung der globalen Treibhausgas-Emissionen sowohl verbindlich vereinbart als auch bisher umgesetzt hat, entspricht in keinster Weise der Dramatik der Fakten. Eine wichtige Rolle spielt hierbei bis heute der massive Widerstand seitens von Unternehmen und Staaten, deren Geschäftsmodell auf dem Verkauf von fossilen Energieträgern wie Erdöl, Erdgas und Kohle beruht. Die panikartigen Abwehrreaktionen führten dabei so weit, dass Klimawissenschaftler über Jahre massivem Psychoterror ausgesetzt waren und sind. Leider erinnert dies fatal an dunkelste Zeiten der Menschheitsgeschichte, als man Menschen, die unbequeme Wahrheiten sagten, einsperrte oder umbrachte. (In manchen Staaten ist dies leider auch heute noch der Fall...).
Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Grund ist u.a. die zum großen Teil hohe Komplexität der Folgen der Erderwärmung. Dies erleichterte es u.a. sogenannten „Klimaskeptikern“, durch gezielte Desinformation über Jahre Verwirrung in der Weltöffentlichkeit zu erzeugen.
Dieses Buch soll zum einen durch eine umfassende und detaillierte Dokumentation der Klimafakten jegliche eventuell noch bestehenden Zweifel an dem durch Menschen verursachten Klimawandel ausräumen. Zum anderen sollen die vielfältigen potentiellen Gefahren eines fortschreitenden Klimawandels aufgezeigt werden. In Band 2 werde ich dann auf die große Chance der Menschheit eingehen, mit einer Kombination aus Zukunftsinvestitionen, Innovationen, technologischem Fortschritt, intelligenter Energieeffizienz, kluger Kooperation und sinnvoller Koordination, nur kleinen Einschränkungen des Komforts und der Lebensweise sowie einer zielgerichteten Gesetzgebung die globale Erderwärmung zu begrenzen.
Warum gibt es Hoffnung? „Ist doch eh alles zu spät…“ Vollkommen untergegangen in der allgemeinen Medien-Berichterstattung ist vor ein paar Monaten die erste Meldung einer sensationellen Entwicklung: Die Ozon-Löcher über Arktis und Antarktis schrumpfen seit wenigen Jahren! Vor dem Hintergrund, dass die Zerstörung der schützenden Ozonschicht katastrophale Auswirkungen auf das gesamte Leben auf der Erde gehabt hätte, ist es unverständlich, dass diese Meldung nicht bei allen Zeitungen groß auf dem Titelblatt erschienen ist.
Diese positive Entwicklung zeigt exemplarisch, was eine entschiedene global bindende Vereinbarung bewirken kann. Nachdem zu Beginn der siebziger Jahre die Wissenschaft entdeckte, dass FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe), die damals in hohem Maße als Treibgas in Spraydosen verwendet wurden, die Ozonschicht zersetzen, brauchte die Weltgemeinschaft nur einige Jahre, um in den 80er Jahren ein weltweites Verbot der Produktion und des Einsatzes von FCKW zu beschließen.
Viele ähnliche Erfolgsgeschichten gab es seither, wie z.B. die einst von der Autoindustrie heftig bekämpfte Einführung des geregelten Katalysators in Deutschland bzw. Europa per Gesetz mit Argumenten wie: „Die Katalysatoren halten nur bis 160 km/h“, „der Umsatz bricht ein“, „die Autos werden zu teuer“, „Altautos sind nicht nachrüstbar“, „die Autoindustrie kann die Einführung bis 1986 nicht finanzieren“ … Alle diese Gegenargumente der Autoindustrie von 1983 haben sich als kompletter Unfug in Folge herausgestellt, absolut nichts hat sich von den Katastrophen-Szenarien der Autobosse bewahrheitet. Im Gegenteil, nach Einführung des geregelten Katalysators ab 01.01.1986 erlebte die Autobranche einen nie geahnten Nachfrageboom, Porsches bretterten nach wie vor mit 250km/h über die Autobahn, Altautos waren nach kurzer Zeit nachrüstbar... Der ADAC vollzog innerhalb weniger Jahre einen 180°-Schwenk und setzte sich 1990 schließlich an die Spitze der Katalysator-Bewegung.
Die größte Erfolgsstory ist jedoch - trotz aller Mängel - das sogenannte „Erneuerbare Energien Gesetz“ (EEG), ohne das es die grüne Revolution bei der Energieversorgung Deutschlands nicht gegeben hätte. Mittlerweile wird über 30% des Strombedarfs aus nichtfossilen und nicht atomaren Energieträgern gedeckt. Deutschland ist damit in Sachen Klimaschutz zum Vorreiter und Vorbild für die gesamte Welt geworden.
Was erwartet den Leser in diesem Buch? Zur Einstimmung habe ich das aktuelle Klimageschehen in einem Bericht kurz zusammengefasst:
Klimabericht 2014:
Alarmierende Meldungen sandte die WMO - die Weltorganisation für Meteorologie - im Januar 2015 über den Globus. Das Jahr 2014 markierte einen weiteren Wärmeweltrekord: Seit Beginn der Klimaaufzeichnungen im Jahr 1880 war die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Erde noch nie so hoch. Noch nie waren die Ozeane so warm wie 2014. Auch die Vielzahl von extremen Wetterereignissen im letzten Jahr war außergewöhnlich. Wissenschaftler der US-Raumfahrtbehörde NASA sowie der Nationalen Ozean- und Atmosphärenverwaltung (NOAA) bestätigten diese Beobachtungen auf einer Pressekonferenz. Damit fallen die zehn wärmsten Jahre - mit Ausnahme von 1998 - alle in den Zeitraum ab dem Jahr 2000.
Für die NASA analysierten Experten des Goddard Institute of Space Studies (GISS) die Messreihen der globalen Oberflächentemperatur. „2014 ist das letzte Jahr in einer Reihe warmer Jahrzehnte“, konstatiert GISS-Direktor Gavin Schmidt. „Zwar können chaotische Wetterereignisse die Reihenfolge individueller Jahre beeinflussen, doch der Langzeittrend lässt sich klar einem Antrieb des Klimasystems zuordnen, der von den Treibhausgas-Emissionen durch den Menschen bestimmt wird.“ [1]
Bemerkenswert sind vor allem die jüngsten Messergebnisse aus den Ozeanen: „Mittelt man die Temperaturwerte für den Atlantik, den Pazifik, den Indischen Ozean und das Mittelmeer, dann sieht man: Genauso wie die Kontinente erwärmen sich auch die Meere immer weiter. 2014 war bisher das Jahr mit der höchsten globalen Meeresoberflächen-Temperatur“, so der Meteorologe Omar Baddour, Leiter der Abteilung für Datenmanagement bei der WMO. „Die Daten der WMO zeigen, dass die Weltmeere in 2014 Rekordmengen an Wärmeenergie gespeichert haben, die sie in der Folgezeit wieder an die Atmosphäre abgeben können und damit die Erderwärmung weiter beschleunigen.“ [2]
Zudem gab es 2014 eine große Überraschung: Zwischen Juni und Oktober waren Nordatlantik und Nordpazifik ungewöhnlich warm, ja sogar unerklärlich warm: „Das ist auch der Grund dafür, dass die Ozeane in diesem Jahr insgesamt besonders warm sind. Warum die Meerestemperaturen auf der Nordhalbkugel derzeit so hoch sind - diese Frage versuchen Forscher jetzt zu beantworten. Im Moment wissen wir es noch nicht.“ Bemerkenswert war in 2014 auch die Vielzahl von extremen Wetterereignissen. Es wurden z.B. viel mehr Überschwemmungen als in den vergangenen Jahren auf fast allen Kontinenten registriert, in Afrika, Europa, Asien, Südamerika und in den USA.
Damit verbunden waren Rekord-Niederschläge: Auf dem Balkan fiel im September zweieinhalb mal so viel Regen (+150%) wie sonst üblich, in Südfrankreich die drei- bis vierfache Menge (+200-300%). Die Türkei litt sogar unter mehr als dem Fünffachen der normalen Niederschlagsmenge (+400%). In Marokko schüttete an nur vier Novembertagen die gesamte Regenmenge eines ganzen Jahres vom Himmel. Dies ist ein eindeutiges Anzeichen für einen allgemein erhöhten Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphäre infolge der globalen Erderwärmung.
Die GISS-Temperaturangaben beruhen auf Messungen von6.300 weltweit verteilten Wetterstationen, Bojen und Schiffen. Hinzu kommen Daten von Forschungsstationen in der Antarktis. Einflüsse wie den „Wärmeinseleffekt“ in Städten, in denen höhere Temperaturen herrschen als auf dem platten Land, rechnen die NASA-Forscher heraus. Den Temperaturanstieg geben sie im Vergleich zu der globalen Durchschnittstemperatur der Jahre 1951 bis 1980 an, die als Referenzwert dient.
Allerdings beobachteten die Klimatologen starke regionale Temperaturabweichungen weltweit, u.a. aufgrund von extremen Wetterereignissen. So war es in Teilen des Mittleren Westens und an der Ostküste der USA ungewöhnlich kühl, während Alaska und die drei westlichen Staaten Kalifornien, Arizona und Utah laut NOAA jeweils die wärmsten Perioden seit Aufzeichnungsbeginn 1880 hatten.
Sehr beunruhigend am neuen Temperaturrekord ist, dass 2014 kein El-Niño-Jahr war. Bei diesem Klimaphänomen verschieben sich die pazifischen Windsysteme. Als Folge davon schwächt sich der kalte Humboldtstrom vor der Westküste Südamerikas ab und eine Schicht warmen Oberflächenwassers wandert von Südostasien durch den tropischen Ostpazifik nach Südamerika. Vor dessen Küsten erwärmt sich das Meer, während in australischen und indonesischen Gewässern die Wassertemperatur sinkt. Dieses Wetterphänomen beeinflusst das Wetter weltweit. In der Regel zeichneten sich El-Niño-Jahre in der Vergangenheit durch hohe weltweite Durchschnittstemperaturen aus.
Im vergangenen Jahrzehnt häuften sich die kalten La-Niña-Ereignisse, der wärmere El Niño trat dagegen seltener auf – zuletzt von Juli 2009 bis Ende April 2010. Er ging mit einem kräftigen Anstieg der Temperaturen im Pazifik einher, was dazu beitrug, dass 2010 zum neuen Wärme-Rekordjahr wurde. In den Folgejahren gab es nun eine große Überraschung: La Niña war so ausgeprägt wie noch nie die beherrschende Klimalage im Pazifik. Während der kalten La-Niña-Phasen kehren sich die Verhältnisse um; dies führt zu Starkregen und Überschwemmungen in Australien – wie 2011 in Queensland, wo die ergiebigsten Niederschläge seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen wurden.
Dieser Bericht über das weltweite Klima in 2014 gibt einen Vorgeschmack auf das, was den Leser in diesem Buch erwartet. Was an obigen Ausführungen auffällt, ist, dass das gesamte Wettergeschehen doch ziemlich komplex und gleichzeitig unübersichtlich ist. In der Regel ist das weltweite Klima in El-Niño-Jahren warm und in La-Niña-Jahren kühl. Das Jahr 2014 scheint sich jedoch an dieses Gesetz nicht gehalten zu haben. Auch die ungewöhnliche Aufheizung der nördlichen Ozeane gibt im Moment Rätsel auf.
Eines der Grundprobleme beim Thema „Klimawandel“ ist, dass die Folgen extrem umfangreich und gleichzeitig hochkomplex sind. Aus diesem allgemeinen Grundproblem ergeben sich zahlreiche Folgeprobleme. So ist es außer Klimawissenschaftlern - den Topexperten - praktisch keinem anderen Menschen möglich, die gesamte Tragweite und Brisanz des aktuellen Klimawandels aufgrund seiner außerordentlichen Komplexität - sowohl global als auch regional - auch nur annähernd sicher zu beurteilen.
Die Grundfakten der globalen Klimaerwärmung sind für jeden relativ einfach zu verstehen (s.S. 15-25). Eine große Herausforderung stellen die vielfältigen Folgewirkungen und Rückkoppelungseffekte dar, deren genaue Vorhersage sogar für Klimawissenschaftler manchmal schwierig ist. Aber wenn jemand aufgrund der unübersichtlichen Lage des globalen Klimageschehens überhaupt eine glaubwürdige faktenbasierte Aussage in diese Richtung machen kann, dann sind es die Klimaforscher. Die Politiker, d.h. die Entscheidungsträger für ein weltweites Klimaabkommen, haben praktisch keine andere Wahl, als den Topexperten zu glauben, wollen sie eine sinnvolle und nachhaltige Vereinbarung treffen. Wenn sie ihreEntscheidungen vorrangig auf ihr Gefühl und ihre eigene Meinung gründen, kann dies fatale Folgen für die Weltgemeinschaft haben, falls dieseMeinung nicht mit den Fakten der Klimawissenschaft übereinstimmen sollte.
Dies ist einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Es soll u.a. als objektive Informationsquelle über alle Tatsachen und Hintergründe dienen, die mit dem aktuellen Klimawandel zu tun haben. Dabei waren folgende Punkte für mich wichtig:
1)Alle Klimafakten beruhen auf seriösen und international anerkannten Quellen der Klimawissenschaft.
2)Große, übersichtliche Bilder und Graphiken zur Veranschaulichung der Fakten; darunter sind 54 farbige Abbildungen
3)Klare, übersichtliche Gliederung des umfangreichen Stoffes
4)Wichtige Absätze sind fettgedruckt hervorgehoben. Dies erleichtert das Lesen und die Orientierung.
5)Klare wissenschaftliche Faktenorientierung
Damit erhält der Leser ein einzigartiges „Klimalexikon“, das ihn sachlich und fachlich über die aktuelle Faktenlage des Klimawandels umfassend und detailliert informiert. In Band 2 folgt dann unter dem Untertitel „Die Chancen“ u.a. eine ausführliche Bestandsaufnahme der emissionsfreien Energiequellen. Dies umfasst sowohl den aktuellen Stand der Technik und Anwendung als auch die wirtschaftlichen und politischen Möglichkeiten, die Erderwärmung mit Hilfe dieser Technologien zu begrenzen.
Der Klimawandel - Die Grundfakten
Folgende fundamentalen Fakten sind aufgrund umfangreicher, detaillierter Messergebnisse inkl. Vergleichsmessungen zahlreicher Klimaforscher, Institute sowie Organisationen seit langem unstrittig:
•Die Durchschnittstemperatur auf der Erde hat sich in den letzten 200 Jahren um maximal 1°C erhöht.
•Der CO2-Gehalt der Atmosphäre hat sich in den letzten 200 Jahren fast verdoppelt.
•Der Meeresspiegel ist im Verlauf der letzten 130 Jahre um ca. 25 cm angestiegen.
•Der massive Anstieg der Treibhausgase in den letzten 40 Jahren korreliert mit der Temperaturerhöhung.
a) Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur
Man sieht an folgendem Diagramm der NASA sehr deutlich den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur seit Beginn der Industrialisierung 1880. Dabei markieren die schwarzen Punkte die jährliche globale Durchschnittstemperatur auf der Erde zum jeweiligen Zeitpunkt, während die rote Linie den gemittelten Temperaturverlauf darstellt. Auffallend an dem Diagramm sind die deutlich erkennbaren starken jährlichen Temperaturschwankungen.
Dies hängt u.a. damit zusammen, dass CO2 und die anderen Treibhausgase nicht alleine für das Weltklima verantwortlich sind, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart. Stattdessen wird von einem Zusammenspiel externer Faktoren wie der Sonne und interner Rückkopplungen des hochkomplexen Klimasystems ausgegangen, bei denen neben den Treibhausgasen auch viele andere Faktoren eine Rolle spielen.
Deshalb ist es nicht überraschend, wenn es zeitweise zu einer Entkopplung zwischen steigendem CO2-Gehalt in der Atmosphäre und der globalen Durchschnittstemperatur kommt. Dies kann man an folgender Graphik sehr gut für den Zeitraum 1940-1975 erkennen. Diese vorübergehenden Abkühlungsphasen sind auf natürliche Schwankungen im Klimasystem zurückzuführen.
Globaler Temperaturindex - Oberflächentemperaturen Land und See 1880-2014 - Quelle: NASA - Goddard Institute for Space Studies -http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/
Allerdings ergibt sich ein offensichtlicher logischer kausaler Zusammenhang zwischen dem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur und der starken Zunahme des CO2 und anderer Treibhausgase in der Atmosphäre in den letzten 120 Jahren. Dies zeigt das Diagramm über den CO2-Anstieg im nächsten Abschnitt deutlich (s.a.S. 256).
Wissenschaftler des IPCC simulieren seit Jahren mit extrem aufwendigen Rechenverfahren die Vergangenheit, Gegenwart sowie die Zukunft des Klimas auf der Erde. Damit ist es möglich, Projektionen für die wahrscheinliche Klimaentwicklung bis zum Jahre 2100 zu erstellen. Kernaussagen dieser Projektionen: Wenn sich die Menschheit in den nächsten 85 Jahren so verhält wie in der Vergangenheit, kann die Durchschnittstemperatur auf der Erde um bis zu 5°C ansteigen. Die Polkappen, das Grönlandeis sowie die weltweiten Gletscher könnten dadurch soweit abschmelzen, dass sich in Folge der Meeresspiegel um bis zu 1,5 m erhöhen würde. Nach neueren Modellberechnungen ist sogar ein Anstieg von bis zu 4 - 7 m bei einem kompletten Verschwinden des Grönlandeises möglich.
b) Anstieg des Kohlenstoffdioxidgehaltes in der Atmosphäre
Das Bild zeigt den Verlauf der CO2-Konzentration in der Atmosphäre während der letzten 400.000 Jahre.[3][4][5][6][7] Quelle: Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:VerlaufKohlendioxidgehalt-2012-08-05.png/File:Carbon_Dioxide_400kyr.png
Man sieht an dieser Kurve eindeutig eine sprunghafte Zunahme der Kohlenstoffdioxid-Konzentration in der Atmosphäre seit dem Beginn der Industrialisierung. DerCO2-Gehalt ist in diesem vergleichbar kurzen Zeitraum signifikant höher als zu jedem anderen Zeitpunkt während der letzten 400.000 Jahre. Mittlerweile gibt es schon Daten, die eine noch größere Zeitspanne (bis zu 2.000.000 Jahren) umfassen, während derer die CO2-Konzentration niedriger war als heute. Zum Vergleich: Vor ca. 100.000 Jahren trat der Homo sapiens sapiens auf die Bühne, vor ca. 5.000 Jahren wurden die großen ägyptischen Pyramiden errichtet, vor ca. 2.000 Jahren wurde Jesus Christus geboren. Aber erst in der im Vergleich dazu kurzen Zeitspanne von knapp 150 Jahren hat es diesen dramatischenAnstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre gegeben.
Die obige Kurve reicht sehr weit in der Erdgeschichte zurück, bis zu 400.000 Jahre vor unserer Zeit. Obwohl sie eine sehr ähnliche Form hat, ist sie nicht mit der „Hockeyschläger“-Kurve von Mann (Mann et al. 1999) (s.S. 313 ff) zu verwechseln, welche die globalen Erdtemperaturen der letzten 1.000 Jahre zur Grundlage hat.
Die Dramatik dieser Fakten ist bis heute nicht ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit gelangt. Dabei belegt kaum eine andere Zeitgraphik den signifikanten Klimawandel so eindeutig.
c) Rückgang des arktischen Meereises
Quelle: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration/ USA)
Mit Ausnahme der weltweiten Gletscherschmelze zeigen sich an kaum einem anderen Klimaphänomen die unmittelbaren Folgen der Erderwärmung so deutlich wie beim seit vielen Jahren zu beobachtenden dramatischen Rückgang des arktischen Meereises. Dies hängt u.a. auch damit zusammen, dass sich das Polarmeer viel stärker erwärmt als andere Ozeane. Direkt betroffen davon sind u.a. die Eisbären, die ihren jahrtausendealten Lebensraum verlieren. Sie weichen inzwischen aufs Festland aus.
Satellitenaufnahmen aus den Wintern der Jahre 1989, 2007 und 2012 zeigen den dramatischen Rückgang der Eisbedeckung in der Arktis. Die Aufnahmen wurden von der NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration/ USA)2012 veröffentlicht.
Das folgende Diagramm zeigt den längerfristigen Trend beim arktischen Meereis, wobei hier nicht die Eisausdehnung, sondern das Eisvolumen dargestellt ist. Dieser Wert ist erheblich aussagekräftiger, da der Abschmelzprozess des arktischen Meereises ja nicht nur die Eisbedeckung, sondern insbesondere auch die Eisdicke beeinflusst.
Abnahme des arktischen Meereisvolumens im Zeitraum 1978 – 2015Quelle: NSIDC (National Snow and Ice Data Center/ USA)
Man erkennt sehr deutlich die Abnahme des Meereisvolumens seit 1978. Dabei sieht man analog zu den Temperaturmessungen, dass das Abschmelzen des Meereises kein linearer Prozess ist. Dafür sind die Zusammenhänge sowie die Interaktion der verschiedenen Meeresströmungen untereinander sowie mit anderen Klimafaktoren zu komplex. Betrachtet man z.B. das kurze Zeitintervall zwischen 1982 und 1987, so kann man dort eine leichte Zunahme des Meereises feststellen.
Danach jedoch nimmt das Meereis innerhalb der natürlichen Schwankungsbreite (grauer Bereich) bis 2013 kontinuierlich ab. Die kurzzeitige Zunahme des Meereises seit 2013 liegt immer noch innerhalb der natürlichen Variationszone, wie man deutlich an obigem Diagramm sieht. Deshalb ist es vollkommen verfrüht, hier von einer „Trendumkehr“ zu sprechen, wie manche Klimaskeptiker schon unken. Nur bei der Betrachtung längerer Zeiträume kann man einen eindeutigen Trend markieren. Im Übrigen ist dies unter Klimawissenschaftlern schon lange eine gesicherte Erkenntnis. U.a. konnte man diese kurzfristigen Schwankungen schon bei den globalen Temperaturwerten oben erkennen.
Die Messungen der NSIDC belegen fundamental und eindeutig die fortschreitende Erderwärmung. Diesen Zusammenhang zu leugnen, würde bedeuten, die Erkenntnisse der Grundlagenphysik in Frage zu stellen und im weiteren Sinne die Naturwissenschaften insgesamt. Schon mit 14 Jahren lernen Schüler, dass Eiswürfel, wenn man sie in warmes Wasser legt, schmelzen. Die Wärmeenergie geht vom wärmeren Körper (Wasser) auf den kälteren Körper (Eiswürfel) über. Umso wärmer das Wasser ist, desto schneller schmilzt der Eiswürfel. Dies ist einfache allgemeine Wärmelehre.
d) Abschmelzen der weltweiten Gletscher
Weltweit schrumpfen die Gletscher. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen (ca. 1% aller Gletscher), wie beispielsweise die Gebirgsgletscher in Norwegen. Die Ursache hierfür hängt damit zusammen, dass diese Gletscher in den Zugbahnen der Tiefdruckgebiete der Westwindzone liegen. Die Tiefs verursachen Niederschläge, die in den Höhenlagen der norwegischen Gebirge häufig als Schnee fallen und dadurch auch die örtlichen Gletscher wachsen lassen. Die wachsenden Gletscher in Norwegen widersprechen also keinesfalls dem Befund einer globalen Erwärmung.
Quelle: NSIDC; Graphik Robert A. Rhode; Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons-Commons-https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glacier_Mass_ Balance_ German.png; Dyurgerov, Mark B. and Mark F. Meier (2005). Glaciers and the Changing Earth System: A 2004 Snapshot". Institute of Arctic and Alpine Research, Occasional Paper 58
Auch dieses Phänomen kann jeder in den Gebirgen jährlich vor Ort nachverfolgen. Bereits mit bloßem Auge sind diese Fakten zu erkennen. Dies ist ebenfalls ein physikalischer Prozess, der durch Wärmeübertragung ausgelöst wird.
e) Anstieg des globalen Meeresspiegels
Seit dem Beginn der Industrialisierung bis heute hat sich der Anstieg des globalen Meeresspiegels deutlich beschleunigt. Im gesamten 18. Jahrhundert betrug er nur ca. 2 cm, im 19. Jahrhundert bereits 6 cm, im 20. Jahrhundert schließlich 19 cm.
Der gemessene Anstieg des Meeresspiegels betrug im 20. Jahrhundert 1,7 ± 0,5 mm pro Jahr, zwischen 1961 und 2003 jährlich 1,8 ± 0,5 mm. Aufgrund von Satellitenmessungen konnte man zwischen 1993 und 2003 schon einen durchschnittlichen Anstieg um 3,1 ± 0,7 mm pro Jahr feststellen. Gegenüber den Jahrzehnten zuvor bedeutet dies eine Zunahme um fast 100% (IPCC)!
Anstieg des globalen Meeresspiegels seit 1870; der gemessene Anstieg des mittleren Meeresspiegels zwischen 1870 und 2009 beträgt ca. 25 cm
Blaue Kurve: Rekonstruierte Daten (Jahresmittel) von Church & White (2006); Kurzbeschreibung Rohdaten (Jahresmittelwerte, überarbeitete Version mit Daten bis 2002); Änderungen gegenüber den Rohdaten: Wert von 1870 als Null definiert, mm in cm umgerechnet.
Rote Kurve: Satellitendaten, Kombination aus Daten von TOPEX/Poseidon, Jason-1 und Jason-2/OSTM; Kurzbeschreibung Rohdaten; Änderungen gegenüber den Rohdaten: Jahres-Mittelwerte berechnet, mm in cm umgerechnet. Auf jeden Wert die Differenz (1993-Wert (blaue Kurve) - 1993-Wert (rote Kurve)) aufgeschlagen, um die Kurven besser vergleichbar zu machen. Werte als SVG
Quelle: public domain - El Grafo eigenes Werk 2010/ Church & White (2006)/Satellitendaten, Kombination aus Daten von TOPEX/Poseidon, Jason-1 und Jason-2/OSTM – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sealevel-rise_1870-2009_de.svg
Der kontinuierliche durchschnittliche Anstieg des globalen Meeresspiegels seit Beginn der Industrialisierung ist signifikant. Dabei spielt nicht nur das fortschreitende Abschmelzen der weltweiten Eismassen eine bedeutende Rolle, sondern auch die mit steigender Erwärmung zunehmende Ausdehnung des Meerwassers. Wissenschaftler gehen aufgrund ihrer Modellberechnungen mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Anstieg des globalen Meeresspiegels durch eine Destabilisierung des grönländischen Eisschildes dramatisch beschleunigt werden könnte.
Je nach Anstieg wären die weltweiten Auswirkungen gravierend. Drohen die gewaltigen Eismassen Grönlands ihre Stabilität zu verlieren, könnte es zu einem Anstieg des Meeresspiegels um durchschnittlich 5 – 7 m bis zum Ende des Jahrhunderts kommen. Auch bezüglich der Antarktis gibt es inzwischen alarmierende Anzeichen einer zunehmenden Destabilisierung und Abschmelzens der Eisschilde. (s.S. 29)
f) Veränderungen in der Tierwelt
Auch in der Tierwelt kann man signifikante Veränderungen aufgrund des Klimawandels beobachten. Am sichtbarsten wird dies zurzeit am Verhalten der Vögel. Viele Vogelarten in Europa und Nordamerika brüten im Mittel 6 bis 14 Tage früher als noch vor 30 Jahren. Bei den Zugvögeln in den mittleren Breiten wird in den letzten Jahrzehnten ein zunehmend späterer Wegzug, ein früherer Heimzug, eine Verkürzung der Zugstrecken oder häufigeres Überwintern im Brutgebiet beobachtet. So kommen Zugvögel nun um 1,3 bis 4,4 Tage pro Jahrzehnt früher an. In Deutschland kann man seit wenigen Jahren beobachten, dass bestimmte Singvögel-Arten sich nicht mehr auf den jährlichen Vogelflug in ihr Winterquartier begeben. Sie bleiben in Deutschland, da die Winter seit Jahren im Schnitt immer milder werden.
Tiere, die früher nur in tropischen oder subtropischen Regionen zuhause waren, wandern zunehmend in höhere Breiten ein. Kälteliebende Arten ziehen sich immer mehr in die engere Umgebung der Pole zurück. Das gilt für Land- und Meeresbewohner gleichermaßen. So haben Tropeninsekten mittlerweile den Weg nach Deutschland gefunden, sehr zur „Begeisterung“ der dortigen Bevölkerung.
D.h. im Klartext, die gesamte Tierwelt wird in einem relativ kurzen Zeitraum durcheinandergebracht, mit unabsehbaren Folgen…Wie empfindlich die Tierwelt auf Umweltveränderungen reagiert, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen, sieht man derzeit am dramatischen Bienenund Hummelsterben.
g) Verlängerung der Vegetationsperioden
Eine zunehmende Erderwärmung führt zu einer Verstärkung des Treibhauseffekts, unter dem Pflanzen erwiesenermaßen gut gedeihen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Pflanzen auch genügend Wasser und Sonnenlicht erhalten. In den gemäßigten Breiten hat sich die durchschnittliche Vegetationsperiode der Pflanzen in den letzten Jahrzehnten weltweit um ca. 14 Tage verlängert. Am obigen Beispiel Deutschland sieht man die Verlängerung dieser Periode anhand der Laubentfaltung sowie der Laubverfärbung zwischen 1951 und 2000.
Ökosysteme
Arktis, Antarktis und Grönland
Seit 10-15 Jahren schmilzt das Eis am Nordpol alarmierend schnell. Dies zeigt sich u.a. daran, dass im arktischen Sommer verschiedene Passagen mittlerweile praktisch eisfrei sind. Ursache ist, dass sich das Polarmeer viel stärker erwärmt als die anderen Weltmeere.
Zunächst erscheint dies vorteilhaft, vor allem für die Wirtschaft, da sich durch die Befahrbarkeit dieser Seerouten Transportwege zum Teil erheblich verkürzen. Die Summe der Nachteile für die Tierwelt und die Meeresströmungen sowie die globale negative Beeinflussung des Weltklimas überwiegen diese Vorteile allerdings bei weitem. Warum?
a) Golfstrom, globale Meeresströmungen
Die sogenannte Atlantische Meridionale Umwälzbewegung (AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation), zu der auch der Golfstrom gehört, bestimmt wesentlich das relativ milde Klima mit gemäßigten Temperaturen in Europa. Der Mechanismus ist relativ einfach: Warmes Oberflächenwasser wird vom Süden nach Norden bis in die Nähe von Grönland transportiert, kühlt sich dort ab und strömt nach dem Absinken als kaltes Tiefenwasser wieder nach Süden. In der folgenden Abbildung sind die wichtigsten weltweiten Meeresströmungen abgebildet. Man sieht u.a. deutlich, dass die meisten globalen Meeresströmungen miteinander zusammenhängen.
Diese Störung kann infolge der fortschreitenden Erderwärmung irgendwann ausgelöst werden, indem das zunehmende Abschmelzen der gigantischen inländischen Eismassen Grönlands die Meereisbildung immer mehr behindert. Dies würde im Extremfall dazu führen, dass das warme Oberflächenwasser, das aus dem Süden herantransportiert wird, nicht mehr absinkt und damit das Kreislauf-Förderband des Golfstroms zusammenbricht. Voraussetzung dafür ist, dass die Dichte dieses Oberflächenwassers, ausgelöst sowohl durch verminderte Eisbildung als auch infolge der Verdünnung durch salzfreies Schmelzwasser der Grönland-Gletscher, nicht mehr groß genug ist, damit es absinken kann. Damit wäre der Kreislauf unterbrochen, mit insgesamt nicht absehbaren Folgen für das Klima weltweit. Die große Gefahr hierbei ist allerdings nicht eine weitere Eiszeit (s.S. 361 ff), sondern das Versiegen sämtlicher Meereszirkulationen bei einer ungebremsten weiteren Erderwärmung und als Folge die Mutation der weltweiten Ozeane zu einer einzigen gigantischen sauerstofffreien Todeszone. Dies würde die Vernichtung praktisch sämtlichen Lebens auf der Erde auslösen, wie es vor 250 Millionen Jahren während der globalen Katastrophe des Sibirischen Trapps passierte (s.S. 348ff).
Quelle: www.raonline.ch
Das generelle Problem ist die genaue Prognose, wann und unter welchen Klimabedingungen ein Versiegen des AMOC eintreten würde. Es ist nämlich schwierig für die Klimawissenschaft, dies aufgrund der vielfältigen Wechselwirkungen sowie der Komplexität aller weltweiten Klimafaktoren mit hoher Wahrscheinlichkeit vorherzusagen. Das Einzige, was die Weltgemeinschaft tun kann, ist, das Risiko des Eintretens einer solchen Katastrophe zu minimieren.
Wie potentiell das Risiko ist, haben einige Klimaforscher schon 2003/ 2004 anhand verschiedener Einflussfaktoren berechnet, unter ihnen der bekannte Klimawissenschaftler Stefan Rahmstorf, Professor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Preisträger des mit einer Million Dollar dotierten Jahrhundertpreises der James-S.-McDonnel-Stiftung. „In manchen berechneten Szenarienversiegt der Nordatlantik-Strom, in anderen - gleichermaßen plausiblen - nicht“, sagt Rahmstorf, „nach jetzigem Stand kann man nur sagen, dass das Risiko vorhanden und nicht verschwindend gering ist.“ Laut seinen eigenen Ergebnissen würde der Golfstrom Mitte des kommenden Jahrhunderts versiegen und dann ca. 1.000 Jahre still liegen. Rahmstorf hat im Übrigen als einziger Wissenschaftler das Abschmelzen der Grönland-Gletscher in seine Untersuchungen miteinbezogen.
Dieser Zusammenhang wird durch eine kürzlich erschienene neue Studie zum Thema Golfstrom von Rahmstorf und Kollegen eindrucksvoll untermauert:
Aus einer Presseinfo vom April 2015:
Golfstrom soll langsamer geworden sein
Forscher des bekannten Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) haben zusammen mit internationalen Wissenschaftlern im Fachblatt Nature Climate Change eine Studie veröffentlicht, in der deutliche Anzeichen für eine Abschwächung des Golfstroms beschrieben werden. Die Annahme, die unter Klimawissenschaftlern schon seit längerer Zeit diskutierte Störung sei eine Fiktion, ist ein Irrtum. „Jetzt haben wir starke Belege dafür gefunden, dass dieses atlantische Förderband sich in den vergangenen hundert Jahren tatsächlich verlangsamt hat, besonders seit 1970“, sagte Leitautor Stefan Rahmstorf vom PIK. [8]
Die globale Erderwärmung ist der Studie zufolge die Hauptursache für die beobachtete Abschwächung des Golfstroms. Riesige Eismassen auf Grönland schmelzen wegen der Klimaerwärmung mit unvermindertem Tempo ab. Dies führt dazu, dass gigantische Mengen zusätzlichen Süßwassers in den Nordatlantik fließen. Dies bewirkt eine nachhaltige Störung der ozeanischen Umwälzbewegung (s.o.). Dieser Prozess könnte durch eine fortschreitende Klimaerwärmung noch verstärkt werden. „Der vom Menschen ausgelöste Masseverlust des grönländischen Eisschilds scheint den Golfstrom zu verlangsamen und dieser Effekt könnte noch zunehmen, wenn die weltweiten Temperaturen weiter steigen“, sagt Jason Box von der Geologischen Forschungsanstalt von Dänemark und Grönland.
Die Wissenschaftler warnen vor „massiven Folgen“ für Mensch und Umwelt. U.a. muss mit nachhaltigen Störungen der Ökosysteme in den Meeren, einem regionalen Meeresspiegelanstieg an der Ostküste der USA sowie signifikanten Wetterveränderungen in Nordamerika als auch in Europa gerechnet werden.
Dass das totale Versiegen des Golfstroms eine reale Möglichkeit sein kann, zeigen wissenschaftliche Untersuchungen der letzten Eiszeit: Während der Schmelzphase der letzten Eiszeit trat innerhalb kurzer Zeit eine erneute Vereisung großer Teile Europas ein (Dansgard-Oeschger-Ereignisse). Der Grund: Eine gewaltige Schmelzwasserflut stoppte den wärmenden Nordatlantikstrom (AMOC, s.o.). Wissenschaftler von der University of Massachusetts in Amherst haben nun anhand von Modellsimulationen herausgefunden, dass für den Klimawechsel vor ca. 12.900 Jahren nicht nur entscheidend war, wie viel Schmelzwasser aus der Arktis in den Atlantik strömte, sondern auch, wo dies genau geschah. Das Schmelzwasser floss nicht, wie bisher von der Wissenschaft vermutet, auf Höhe des Sankt-Lorenz-Stroms in den Atlantik, sondern 4.000 Kilometer weiter nordwestlich über den Mackenzie-Fluss ins arktische Meer. „Die Ursache der damaligen Abkühlung genau zu kennen, ist wichtig, um zu verstehen, wie sich unser Klima in der Zukunft ändern könnte“, sagte Alan Condron von der University of Massachusetts.
Vor diesem Hintergrund erhält folgende Meldung vom August 2014 eine besondere Brisanz:
Das Eis in Grönland und in der Antarktis schmilzt schneller als je zuvor. Forscher des Alfred-Wegener-Instituts berichten in der Zeitschrift „The Cryosphere“, dass jedes Jahr etwa 500 km³ Eis verloren gingen. Seit 2009 habe sich der jährliche Eisverlust in Grönland verdoppelt, in der Westantarktis verdreifacht. [9]
Quelle: Pressemitteilung des Helmholtzzentrums für Polar- und Meeresforschung (Alfred-Wegener-Institut) vom August 2014
b) Meeresspiegelanstieg
Es gibt verschiedene wissenschaftliche Prognosen, wie stark der Meeresspiegel bis Ende dieses Jahrhunderts ansteigen wird. Ich möchte mich auf die Projektionen beziehen, die vom wissenschaftlich weltweit anerkanntesten Forschungsinstitut auf diesem Gebiet, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), stammen. Nach der neuesten Studie von Rahmstorf und Vermeer (2009) beträgt der wahrscheinliche Anstieg des Meeresspiegels bis 2100 je nach Emissionsszenario zwischen 100 und 140 cm.[10]
Der Anstieg des Meeresspiegels bis 2100. Rot sind die Messdaten (Church & White 2006); bunt zeigen die verschiedenen Anstiegswahrscheinlichkeiten je nach Emissionsszenario (B1, A2, A1FI); Basis der Daten ist eine semiempirische Abschätzung. Quelle: Vermeer & Rahmstorf (2009)
Die verschiedenen Projektionen B1, A2, A1FI zeigen deutlich, dass der künftige Anstieg des Meeresspiegels vor allem von der Entwicklung der menschengemachten Treibhausgas-Emissionen abhängt. Dabei kommt die semiempirische Abschätzung von Rahmstorf und Vermeer je nach Emissionsszenario (B1, A2, A1FI) auf Anstiege zwischen ca. 1,00 und 1,40 m für den Zeitraum 1990-2100. Man erkennt zudem an obiger Graphik, dass dies signifikant von den entsprechenden Werten aus dem IPCC-Bericht („AR4“), denen prozessbasierte Modelle zugrunde liegen, abweicht.
Um die wissenschaftliche Professionalität und Aussagekraft dieser Projektionen zu untermauern, möchte ich im Folgenden kurz auf die wissenschaftliche Vorgehensweise sowie die weltweite Reputation des PIK auf dem Forschungsgebiet „Meeresspiegelanstieg aufgrund des Klimawandels“ eingehen. [10a]
Meeresspiegel in der Erdgeschichte
Große Eismassen bedeckten auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit die nördliche Hemisphäre. Gegen Ende der Eiszeit stieg die globale Temperatur um 5°C. In der Folge schmolzen zwei Drittel des Eises ab und der globale Meeresspiegel stieg um 120 m. Dieser Anstieg endete erst vor ca. 4.000 Jahren. Das verbliebene Drittel des Eises findet sich noch heute auf Grönland und der Antarktis. Schmilzt dieses Eis komplett ab, würde der globale Meeresspiegel um weitere 65 m ansteigen. Mit Klimamodellen simuliert das PIK komplette Eiszeitzyklen sowie das Wachsen und Schrumpfen des Eises. In Zusammenarbeit mit US-Wissenschaftlern arbeitet das PIK daran, die Entwicklung des Meeresspiegels über die vergangenen Jahrtausende aus Proxydaten zu rekonstruieren.
Projektionen des künftigen Meeresspiegelanstiegs
Zur Berechnung des zu erwartenden Anstiegs des Meeresspiegels aufgrund eines bestimmten zukünftigen Temperaturanstiegs wurde vom PIK die „semiempirische“ Methode entwickelt. Diese Methode nutzt einen einfachen physikalisch motivierten Zusammenhang zwischen globaler Temperatur und Meeresspiegel, der mit Hilfe von Daten aus der Vergangenheit kalibriert wird. Außerdem werden in regionalen Meeresspiegelprojektionen auch regionale Abweichungen, die z.B. durch die Schwerkraft der schrumpfenden Eisschilde ausgelöst werden, berücksichtigt.
Meeresströmungen und thermische Ausdehnung
Das PIK nutzt globale Ozeanzirkulationsmodelle, um z.B. die thermische Ausdehnung der Ozeane infolge der Erderwärmung oder die Wirkung veränderter Meeresströme auf den regionalen Meeresspiegel zu untersuchen.
Dynamik der kontinentalen Eismassen
In Zusammenarbeit mit der University of Alaska haben Wissenschaftler des PIK das Parallel Ice Sheet Model (PISM) entwickelt, ein innovatives numerisches Modell der Kontinentaleisdynamik. Dieses Modell wird insbesondere zur Untersuchung der Stabilität des Antarktischen Eisschildes verwendet. Zusätzlich haben Forscher des PIK das Eismodell Sicopolis an das hauseigene Erdsystemmodell CLIMBER-2 gekoppelt und damit die Stabilität des grönländischen Eisschildes bei vergangenen und künftigen Klimaänderungen untersucht.
Auswirkungen auf die Küste
Zurzeit wird zusammen mit dem Europäischen Klimaforum und den Universitäten Southampton und Kiel das integrierte Modell DIVA entwickelt. DIVA ist ein globales Modell, das sowohl die Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs auf alle Küstennationen kalkuliert als auch die Kosten und den Nutzen möglicher Anpassungsmaßnahmen. Es projektiert eine Vielzahl von sozialen, ökologischen und ökonomischen Auswirkungen für die Zukunft, wie z.B. die Erosion von Stränden, die Überschwemmung von Küsten, Sturmflutschäden, Migration von Betroffenen, die Veränderung von Küstenökosystemen sowie das Eindringen von Salzwasser in die Unterläufe der Flüsse.
Weltweite Kooperation
Das PIK arbeitet mit führenden Meeresspiegelexperten aus der ganzen Welt zusammen, z.B. in gemeinsamen Fachpublikationen u.a. mit Anny Cazenave (CNES, Frankreich), John Church (CSIRO, Australien), Ben Horton (Univ. of Pennsylvania) und Bob Nicholls (Univ. of Southampton). Die Publikationen des PIK zählen zu den meistzitierten in der Fachwelt: Unter den mehr als 9.000 (!) Meeresspiegel-Fachpublikationen der letzten fünf Jahre belegte das PIK die Ränge 1, 2 und 3(*). Zahlreiche umfassende Berichte berufen sich auf die Meeresspiegelprojektionen des PIK, u.a. der Antarctic Science Report, die Copenhagen Diagnosis, der Arktisbericht des AMAP sowie der Klimabericht der Weltbank.
(*) Laut Abfrage aller Publikationen in der Datenbank ISI Web of Science zum Suchwort „sea level“ ab dem Erscheinungsjahr 2007, durchgeführt am 21.11.2011.
Reputation und Anerkennung
Eine Reihe von Staaten, u.a. die Niederlande sowie die US-Bundesstaaten Kalifornien und North Carolina, setzen die semi-empirische Methode des PIK für ihre Küstenschutzplanung ein. Ergebnisse des PIK finden sich in Empfehlungen des US Army Corps of Engineers wieder. In einer Reihe von globalen und kontinentalen Studien wird das weltweit einzigartige DIVA-Modell genutzt, wie z.B. in einer Weltbankstudie sowie dem Umweltzustandsbericht der Europäischen Umweltagentur.
Prof. Levermann wurde zu einem der Leitautoren für das Meeresspiegel-Kapitel des Weltklimarates IPCC berufen; Prof. Rahmstorf beriet die Delta-Kommission der holländischen Regierung. PIK-Grafiken finden sich z.B. bei der US-Regierung ebenso wie im Garnaut-Review für die australische Regierung.
Die Untersuchungen fanden auch ein breites Medienecho: BBC und CNN berichteten im Rahmen ihrer TV-Nachrichtensendungen über die Forschungsergebnisse des PIK. Das Wochenmagazin der britischen Financial Times porträtierte 2009 Prof. Rahmstorf auf der Titelseite als „Mr sea level rise“. Die New York Times stellte 2010 die Ergebnisse des PIK in einer großen Titelgeschichte zum Meeresspiegel heraus.
Quelle: www.pik-potsdam.de
(Um Missverständnissen vorzubeugen: Der Autor hat keine wie auch immer gearteten engeren Beziehungen, Kontakte oder sonstigen Kooperationen mit dem PIK!)
Der 5. Klimareport des IPCC aus dem Jahre 2013 bestätigt grundsätzlich die Projektionen des PIK. Der Meeresspiegel wird aller Wahrscheinlichkeit nach bis 2100 schneller ansteigen als während der letzten 50 Jahre. Die Ausdehnung des wärmer werdenden Meerwassers (30 – 55%) sowie die schmelzenden Gletscher (15 – 35%) sind hauptverantwortlich für den Anstieg des Meeresspiegels. Wegen der Ausdehnung des wärmeren Meerwassers wird der Meeresspiegel auch nach 2100 noch für viele Jahrhunderte ansteigen. Unter bestimmten Bedingungen könnte er bis zum Jahr 2300 um mehr als 3 m zunehmen. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass durch ein beschleunigtes Abschmelzen der Eisschilde auf Grönland und in der Antarktis der Anstieg noch deutlich höher ausfällt. [11]
Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines solchen „Worstcase-Falles“ kann die Klimawissenschaft nach heutigem Wissensstand noch nicht abschätzen. Was man allerdings aufgrund neuerer Forschungsergebnisse weiß, ist, dass das Verschwinden des grönländischen Eisschildes bei einer Temperaturerhöhung zwischen 1 und 4°C ausgelöst werden könnte und zu einem Meeresspiegelanstieg von bis zu 7 m führen würde.
Man kann aus dieser Zusammenfassung aus dem 5. Klimareport des IPCC folgende klare Rückschlüsse ziehen:
- Der Meeresspiegel wird auch bei verminderter Erderwärmung mehrere Jahrhunderte weiter ansteigen; projektiert sind von Klimaforschern bis zu 3 m in 2300.
- Das Beunruhigende an den mittel- und langfristigen Projektionen bezüglich des Anstiegs des Meeresspiegels ist, dass man nicht zeitlich exakt die verschiedenen Faktoren vorhersagen kann, die diesen Anstieg stark beschleunigen könnten, wie z.B. ein plötzlicher unvorhersehbarer Zusammenbruch des antarktischen Eisschildes. Dies könnte zusammen mit einem Abschmelzen des grönländischen Eisschildes im ungünstigen Fall einen Anstieg des Meeresspiegels von bis zu 7 m in den nächsten Jahrhunderten verursachen.
Folgende Karte zeigt am Beispiel von Norddeutschland und den Niederlanden die unmittelbaren Folgen. Man sieht deutlich, wie stark die Küstengebiete schon bei einem Meeresspiegelanstieg von „nur“ 1 m überschwemmt werden: Von den Niederlanden bleibt nicht mehr viel übrig. Ganze Landstriche verschwinden in der Nordsee. Auch große Teile der deutschen Nordsee-Küstengebiete werden großflächig vom Meer bedeckt. Das Meer frisst sich teilweise tief ins Landesinnere von Niedersachsen: Bremen und Oldenburg werden Küstenstädte!
Dies sind aber nicht die einzigen Folgen eines Anstiegs des Meeresspiegels um 1m. Auch die Veränderungen im Landesinneren wären massiv.
Überflutungsgebiete an der deutschen Nordseeküste und in den Niederlanden bei einem Anstieg des Meeresspiegels um 1 m
Quelle: http://flood.firetree.net
Durch eindrückendes Wasser von der Nordsee würden nicht nur die heutigen Küsten überschwemmt, sondern auch große Teile im Landesinnern, da die Flusspegel ebenfalls ansteigen und damit über die Ufer treten. Dies hätte u.a. zur Folge, dass die Gebäude in den bedrohten Gebieten starken Wassereinbrüchen ausgesetzt wären.
Weiterhin werden bei einem Anstieg um 1 m auch viele Südseeinseln - einzigartige Naturwunder mit atemberaubender Schönheit, Anmut und Vegetation - im Meer verschwinden sowie große Küstengebiete weltweit unbewohnbar. Die Kosten der gigantischen Umsiedlungen wären unkalkulierbar, auf jeden Fall sehr hoch…
Eine neue Studie eines internationalen Klimaforscher-Konsortiums bestätigt den beschleunigten Meeresspiegelanstieg in den letzten 150 Jahren:
Schnellerer Anstieg des Meeresspiegels als je zuvor
Viele Jahrhunderte stieg der Meeresspiegel kaum oder nur sehr langsam. Seit Ende des 19. Jahrhunderts änderte sich die Situation jedoch. Seitdem steigt der globale Meeresspiegel ohne Unterbrechung stetig und signifikant an. Dies fanden Klimaforscher anhand einer genauen Untersuchung von Ablagerungen an der US-Atlantikküste heraus. Das Besondere an dieser neuen Studie (2011) ist, dass sie die erste durchgehende Rekonstruktion von Veränderungen des Meeresspiegels über einen Zeitraum von ca. tausend Jahren ist. Ein internationales Forscherteam zieht in der US-Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences aus den umfangreichen Untersuchungen das Fazit, dass während dieses langen Zeitraums eine Korrelation zwischen der Höhe des Meeresspiegels und der globalen Durchschnittstemperatur festzustellen ist. Diese neuen Daten bestätigen die physikalisch begründete Annahme, dass der Meeresspiegel umso schneller steigt, je wärmer das globale Klima wird.[12]
„Die neue Untersuchung bestätigt unser Modell des Meeresspiegelanstiegs. Die Daten der Vergangenheit schärfen damit unseren Blick in die Zukunft”, sagt Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, einer der Autoren der Studie. Bisher gab es nur wissenschaftliche Belege für den Zusammenhang zwischen Lufttemperatur und Meeresspiegelanstieg in den vergangenen 130 Jahren. Nun konnte das erste Mal aufgrund geologischer Untersuchungen der beschleunigte Anstieg des Meeresspiegels mit dem Beginn der Industrialisierung in Zusammenhang gebracht werden, so Rahmstorf: „Der Mensch heizt mit seinen Treibhausgasen das Klima immer weiter auf, daher schmilzt das Landeis immer rascher und der Meeresspiegel steigt immer schneller.”
„Der Anstieg des Meeresspiegels ist eine potenziell desaströse Folge des Klimawandels, weil steigende Temperaturen das Eis an Land schmelzen lassen und das Wasser der Ozeane erwärmen“, sagt Benjamin Horton von der University of Pennsylvania. Dabei werden nur zwei einfache physikalische Gesetze bestätigt: Wird Wasser erwärmt, dehnt es sich aus. Deswegen führt allein die fortschreitende Klimaerwärmung zu einem Anstieg des globalen Meeresspiegels. Die zweite wichtige Ursache für den Meeresspiegelanstieg ist das Abschmelzen der weltweiten Gebirgsgletscher sowie großer Eismassen auf Grönland und in der Antarktis, wodurch zusätzliches Wasser ins Meer gelangt.
In Bohrkernen aus Salzwiesen an der nordamerikanischen Küste haben die Wissenschaftler fossile Kalkschalen von Einzellern untersucht. Menge und Art dieser Kalkschalen zeigen den Wasserstand vergangener Jahrhunderte an, weil die Arten jeweils in einer ganz bestimmten Höhe im Gezeitenbereich leben. Diese in North Carolina gewonnenen Daten stimmen weitgehend mit Hafenpegeldaten überein, soweit diese zurückreichen. Außerdem wurden sie durch eine unabhängige Rekonstruktion bestätigt. Unabhängig von örtlichen Schwankungen des Meeresspiegels, die vom globalen Meeresspiegel leicht abweichen können, sind sich die Forscher weitgehend sicher, dass die Ergebnisse mit hoher Annäherung die Veränderungen des globalen Meeresspiegels wiedergeben.
Dabei kann man vier Phasen unterscheiden. Von 200 vor bis 1000 nach Christus war der Meeresspiegel weitgehend stabil. Um etwa 5 cm pro Jahrhundert stieg er ab dem 11. Jahrhundert 400 Jahre lang. Mittels Modellrechnungen konnten die Wissenschaftler diesen Anstieg mit der mittelalterlichen Warmperiode erklären. Darauf folgte eine weitere stabile Periode mit kühlerem Klima, die im späten 19. Jahrhundert endete.
Seit diesem Zeitpunkt, der weitgehend mit dem Beginn der Industrialisierung zusammenfällt, ist der Meeresspiegel infolge der globalen Erderwärmung um ca. 20 cm gestiegen. Das heißt, dass der Meeresspiegel in den letzten ca. 150 Jahren um ein Vielfaches schneller angestiegen ist als zu jedem anderen Zeitpunkt während der letzten 2.000 Jahre.
Zu den Autoren der Studie zählen neben Rahmstorf und Horton auch Andrew Kemp (Yale University), Jeffrey Donnelly (Woods Hole Oceanographic Institution), Michael Mann (Pennsylvania State University), Martin Vermeer (Aalto University School of Engineering, Finland). Die Studie wurde unter anderem unterstützt von der US-amerikanischen National Science Foundation.
c) Folgen des Meeresspiegelanstiegs
Außer der unmittelbaren Gefahr für tiefer liegende Küstengebiete hat der Anstieg des Meeresspiegels noch zahlreiche andere gravierende Folgen. Dazu zählen die Erosion von Küstengebieten, ein höheres Auflaufen von Sturmfluten sowie die Versalzung von Grundwasser durch das Eindringen von Meerwasser. Die Gefährdung ist dabei stark von den Küstenformen abhängig. Steile Felsküsten sind durch Erosion weniger bedroht als Sandküsten oder Deltas. Das Problem ist, dass gerade flache Küsten und insbesondere Deltas weitverbreitete Siedlungsgebiete sind.
Von einem künftigen Meeresspiegelanstieg werden vor allem niedrig liegende Küstenregionen bedroht. Ca. 2 Millionen km2 Land liegen weltweit weniger als 2 m über der mittleren Hochwasserlinie. Das Besondere an dieser Zone ist, dass sie nicht nur aus besonders artenreichen Ökosystemen besteht, sondern auch ein bevorzugtes Siedlungsgebiet des Menschen ist. Ca. 60 Millionen Menschen lebten 1995 auf Landflächen, die weniger als 1 m über dem Meeresspiegel lagen. Bis zu 5 m über dem Meeresspiegel wohnten damals weltweit ca. 275 Millionen Menschen. Acht der zehn größten Städte der Welt liegen in niedrigen Küstengebieten. Dort wächst zudem die Bevölkerung doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt. Man schätzt deshalb, dass bis zum Ende des 21. Jahrhunderts ca. 130 Millionen Menschen in den tiefen Küstenbereichen bis zu 1 m und 410 Millionen in Gebieten bis 5 m über dem Meeresspiegel leben.[13]
Die Verteilung der globalen Landfläche (ohne Antarktis) und der Bevölkerung im Jahre 1995 in Abhängigkeit von der Höhe über der mittleren Hochwasserlinie. Quelle: WIKI Bildungsserver/ Klimawandel. Bild neu gezeichnet nach Nicholls, R. J. Tol, R. S. J. und Vafeidis, A.T. (2005): Global Estimates of the Impact of a Collapse of the West Antarctic Ice Sheet: An Application of FUND. Working Paper FNU-78. Universität Hamburg, Zentrum für Marine und Atmosphärische Wissenschaften.
Stark gefährdet durch einen Anstieg des Meeresspiegels sind die großen und dicht besiedelten Deltagebiete der Erde wie etwa das Mississippi-Delta, das Po-Delta, das Nil-Delta, das Ganges-Brahmaputra-Delta usw. Dabei haben die Deltas ein zusätzliches Problem, das den durch den Klimawandel verursachten Meeresspiegelanstieg signifikant verstärkt.
Aufgrund des Baus von großen Staudämmen im Landesinneren ist die Ablagerung von Sedimenten in vielen Deltas deutlich zurückgegangen. 2530% der Sedimentfracht der Flüsse, die normalerweise in den flachen Deltagebieten abgelagert werden, werden von etwa 45.000 Staubecken weltweit zurückgehalten. Am Gelben Fluss (Hwangho) in China gingen die Sedimentablagerungen seit den 1950er Jahren sogar um 90% zurück. Da Deltas sich von Natur aus absenken, falls dies nicht durch einen ständigen Sedimentzufluss der Flüsse ausgeglichen wird, ist die unmittelbare Folge ein relativer Anstieg des Meeresspiegels.
Dieses Absinken wird in den dicht besiedelten Deltas vielfach durch die Entnahme von Grundwasser sowie durch die vielen Bauten der stark wachsenden Städte zusätzlich beschleunigt. Gegenwärtig sind diese Prozesse je nach Delta für eine Anstiegsrate des Meeresspiegels von 0,5 bis 12,5 cm pro Jahrzehnt verantwortlich. Dies führt dazu, dass Deltaküsten zusätzlich durch Erosion und Sturmfluten verstärkt gefährdet sind. Hinzu kommt eine zunehmende Versalzung sowohl der Oberflächengewässer als auch des Grundwassers mit gravierenden Folgen für die Landwirtschaft und die Wasserversorgung. [14]
Sandküsten
Auch Sandküsten, die oft die Außenfront von Deltas bilden, sind von Meeresspiegelanstieg und Erosion betroffen. Etwa 20% der globalen Küstenlinien bestehen aus Sandstränden und anderen sandigen Küstenformen. Auch wenn der Meeresspiegel nur geringfügig ansteigt, kann der Rückzug der Strandlinie groß sein, da Strände oft in einem sehr flachen Winkel ansteigen. Wegen des globalen Meeresspiegelanstiegs sind Schätzungen zufolge derzeit ca. 70% der weltweiten Sandstrände aufgrund von Erosion auf dem Rückzug. Stürme spielen hierbei eine geringere Rolle, da die zerstörten Küstenlinien in der Regel durch Strömungen und Ablagerungen wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. [15]
Küstennahe Feuchtgebiete
Eine weitere vom Meeresspiegelanstieg betroffene Küstenform sind küstennahe Feuchtgebiete wie Salzmarschen, Watten und Mangroven. Feuchtgebiete haben jedoch eine besondere Eigenschaft: Sie können aufgrund von Sedimentation und Pflanzenwachstum mit einem langsamen Anstieg des Meeresspiegels vertikal mitwachsen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein seewärtiger Rückgang durch eine Wanderung landeinwärts wettgemacht werden kann, wenn die angrenzenden Gebiete tief liegen und nicht durch Dämme abgesperrt sind. Hierbei gibt es jedoch das Problem, dass wegen der kontinuierlichen Bevölkerungszunahme in den Küstenbereichen zum Schutz immer mehr Dämme und Schutzanlagen gebaut werden, welche die landwärtige Migration von Feuchtgebieten behindern.
Zu den besonders bedrohten Feuchtgebieten gehören die Mangrovenwälder, die gegenwärtig ca. 8% bzw. 181.000 km2 der weltweiten Küstengebiete ausmachen.Mangrovenwälder findet man in tropischen und subtropischen Deltagebieten, Ästuaren, Lagunen und anderen Küsten im Gezeitenbereich. Sie sind nicht nur wertvolle Ökosysteme mit zahlreichen Fisch- und Vogelarten, sondern schützen auch die Küstenlinien vor Erosion durch Wellen und Sturmfluten. Viele Mangrovenwälder sind durch Holzgewinnung, die Anlage von Aquakulturen sowie Reis- und Kokosplantagen schon heute in ihrem Bestand stark dezimiert worden. Es besteht die Gefahr, dass bei einem weiteren Ansteigen des Meeresspiegels die küstennahen Mangrovenwälder landeinwärts gedrängt werden. Allerdings ist dies sowohl aufgrund von Landwirtschaft als auch infolge von Schutzanlagen in den Küstengebieten oft nicht möglich, so dass als Folge nur ein Schrumpfen der Mangrovenwälder bleibt.
In Ausnahmefällen könnten einige Mangrovenwälder dem Meeresspiegelanstieg trotzen: Höhere Sedimentablagerungen zwischen den Mangrovenwurzeln könnten den Anstieg zum Teil ausgleichen. Die bei einer Flut hereingespülten Sedimente könnten bei Ebbe, wenn sich das Wasser zurückzieht, von den dichten Wurzeln der Mangroven teilweise zurückgehalten werden. [16]
Korallenriffe
Die weltweiten Korallenriffe sind als ein weiterer sehr effizienter Küstenschutz infolge des Meeresspiegelanstiegs gefährdet. Ihre Gesamtfläche wird auf ca. 255.000 km2 geschätzt. Neben dem tropischen Regenwald zählen Korallenriffe mit zum artenreichsten Lebensraum der Erde. Nach Schätzungen leben dort zwischen 0,5 und 2 Mio. verschiedene Arten. Korallenriffe wirken als Barrieren und somit als Wellenbrecher und Schutz der tropischen Küsten vor Erosion.Eine wichtige Nahrungsquelle vieler Küstengemeinden ist der Fischreichtum der Korallenriffe. Außerdem liefern sie wertvolle Baustoffe und dienen zudem als Tourismusattraktion.
Etwa 50% der Korallenriffe - in einigen Gebieten Südostasiens sogar über 80% - sind durch industrielle Entwicklung, Umweltverschmutzung, Tourismus, Verstädterung sowie Überfischung schon stark gefährdet. Zusammen mit der fortschreitenden Klimaerwärmung und Versauerung der Ozeane entsteht daraus für zahlreiche Korallenriffe eine existenzielle Bedrohung. Dazu zählt insbesondere die gefährliche „Korallenbleiche“, die in den vergangenen Jahren an Riffen im Indischen Ozean, Pazifischen Ozean und in der Karibik vermehrt beobachtet wurde.
Auch der Meeresspiegelanstieg an sich stellt eine direkte Gefahr für die Korallen dar. Gesunde Korallenriffe könnten mit einem Anstieg des Meeresspiegels von 10 mm pro Jahr durchaus mithalten, wie das vertikale Wachstum in der Nacheiszeit gezeigt hat. Unter Wissenschaftlern bestehen allerdings große Zweifel, ob dies auch für die derzeitigen stark gestressten Korallenriffe zutrifft. [13]
Presseinfos zum Thema Meeresspiegelanstieg:
Nordseetiden steigen und steigen
In der Nordsee steigt das mittlere Tidehochwasser kontinuierlich an. Hans-Gerd Coldewey vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz in Norden berichtet, dass das Hochwasser von etwa 5,95 auf derzeit 6,20 m seit 1900 gestiegen ist. „Das ist eine Folge der Erderwärmung und einfache Physik. Denn je wärmer das Wasser wird, desto mehr dehnt es sich aus.“ (August 2004)
Das Grundwasser versalzt
Falls der Meeresspiegel wirklich um bis zu 23 cm steigen sollte, wie die Autoren des neuesten IPCC-Berichts warnen, würde dies nicht nur dieKüstenregionen treffen. Auch das Grundwasser könnte stärker als bisher ver-mutet in Mitleidenschaft gezogen werden, so Forscher der Ohio State University. Das Grundwasser vermischt sich mit dem Salzwasser des Meeres anscheinend wesentlich komplexer als bisher gedacht. Unter bestimmten Bedingungen dringt die Zone von gemischtem Brackwasser bis zu 50% weiter ins Land hinein als die oberirdischen Flutmassen. Für viele Küstenregionen, deren Trinkwasserversorgung in der Regel vom Grundwasser abhängt, würde dies hiermit zu einem Problem. [17](November 2007)
Meeresspiegel steigt viel stärker als erwartet
Kaum hatte man sich bei der Klimakonferenz auf Bali auf einen Kompromiss geeinigt, da wird von derWissenschaft bereits vor einem noch schnelleren Anstieg des Meeresspiegels um bis zu 1,6 m gewarnt. Dieser Wert liegt ca. 100% über den bisherigen Schätzungen aus dem aktuellenWeltklimabericht des IPCC, berichten Forscher in „Nature Geoscience“.[18]
„Bis heute sind keine zufriedenstellenden Daten vorhanden, die den Meeresspiegelanstieg in seiner vollen Komplexität erfassen und erklären können“, sagt Eelco Rohling vom National Oceanography Center der Southampton University. Deswegen versuchen Forscher, durch die Untersuchung von Bohrkernen aus Tiefseesedimenten mehr Informationen zu erhalten. Bis zur letzten Warmphase der Erde vor etwa 124.000 bis 119.000 Jahren reichen diese Klimaarchive zurück.
Nur ca. 3 - 5°C war es in Grönland damals wärmer als heute. In 50 bis 100 Jahren könnte es einen ähnlichen Temperaturanstieg bei weiter andauernder Erderwärmung im Vergleich zu heute geben. Zu einem Meeresspiegelanstieg um ca. 1,6 m innerhalb von nur 100 Jahren führte damals insbesondere die Gletscherschmelze in der Antarktis und auf Grönland.
„Unsere Ergebnisse liefern starke Argumente dafür, dass die Prognosen, die im IPCC-Bericht stehen, zu niedrig sind“, sagt Rohling. Eine Ursache dafür könnte sein, dass vor allem die Ausdehnung und das Abschmelzen des Eises an der Oberfläche berücksichtigt worden ist, nicht aber der Einfluss dynamischer Eisschichtenprozesse. (Dezember 2007)
Verschwinden einer Hauptstadt
Bis 2050 droht die mauretanische Hauptstadt Nouakchott von der Landkarte zu verschwinden. 80% der Stadt könnten bereits in 10 Jahren dauerhaft überflutet sein, berichten mehrere Studien im Auftrage der Regierung. Große Teile von Nouakchott befinden sich unterhalb des Meeresspiegels. Mehrere Faktoren begünstigen diese bedrohliche Entwicklung: Zum einen gibt es viel zu wenig Abwasser- und Abflusssysteme, zum anderen steigt der Meeresspiegel kontinuierlich an. Da die lokale Bauindustrie Sand aus den schützenden Dünen gewinnt, ist hier auf Dauer mit einem Verlust an Schutz zu rechnen. Ein zusätzliches Risiko stellt vermutlich auch der neue Hafen dar, den chinesische Investoren bauen und der die Küstenlinie verändern wird.
Große Teile der Stadt standen während der Regenzeit 2007 bereits unter Wasser. Anfang dieses Jahres wurden nun weitere Viertel überflutet.Als auch nach mehreren Wochen das Wasser noch nicht abgeflossen war, setzte Präsident Mohamed Ould Abdel Aziz eine Expertenkommission ein.
Die Lage wird mittlerweile für die Stadt immer kritischer. Das Meer dringt derzeit ca. 25 m pro Jahr in Richtung Nouakchott vor. Zum Erhalt der Dünen hat die Regierung deswegen ein 8-Millionen-Dollar-Notprogramm beschlossen. Inzwischen wird ein neuer Schutzdeich errichtet. Um die Erosion von Boden und Küste einzudämmen, wird zudem rings um die Stadt mit Hochdruck ein neuer Grüngürtel angelegt.
(September 2011)
Ökosystem Weltmeere
Bei der allgemeinen öffentlichen Diskussion geht der Einfluss der in den letzten Jahrzehnten dramatisch gestiegenen Treibhausgas-Konzentrationen in der Atmosphäre auf das Ökosystem der Weltmeere meistens unter. Dabei weiß man in der Wissenschaft schon lange, dass den weltweiten Ozeanen in Bezug auf die Folgen einer globalen Klimaerwärmung eine überragende Bedeutung zukommt.
Das große Problem hierbei sind die vielfältigen komplexen Einflüsse des Klimawandels, vor allem die diversen Rückkopplungseffekte, die sich gegenseitig verstärken.
Erwärmung der Ozeane
Die Weltmeere erwärmen sich zwar langsamer als die Erdatmosphäre, nehmen aber insgesamt eine wesentlich größere Wärmemenge auf: Über 90% der von 1971 bis 2010 aufgenommenen Wärmeenergie wurde in den Ozeanen gespeichert, davon über 60% in den oberen 700m. [19]
Entwicklung des Gesamtwärmebudgets der Erde; Hellblau: Erwärmung der Wassersäule 0–700 m; Dunkelblau: Erwärmung der Wassersäule 700–2000 m; Braun: Erwärmung der Eis- und Landflächen sowie der Atmosphäre. Quelle: Nuccitelli et al.(2012) -Public domain - https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Change in total heat content of earth.svg
Aufgrund des Anstiegs der Treibhausgaskonzentrationen hat die Erde zwischen 1971 und 2010 eine Energiemenge von 274 ZJ (1 Zettajoule= 1021 Joule) absorbiert. Davon sind 93% von den Ozeanen absorbiert worden. Der obere Ozean (0-700 m) hat 64%, der tiefere (700-2000) 29% der Wärme aufgenommen. 3% der Energiemenge sind in das Schmelzen von Eis gegangen, ebenfalls 3% in die Erwärmung der weltweiten Landoberfläche sowie 1% in die Erwärmung der Atmosphäre.[20]
Man sieht an obiger Graphik deutlich die alles dominierende Wärmeaufnahme der Ozeane (hellblaue und dunkelblaue Fläche). Dagegen ist die Wärmeaufnahme der Eis- und Landflächen sowie der Atmosphäre in der Gesamtbetrachtung fast vernachlässigbar. Die Ozeane sind durch ihr großes Volumen und ihre hohe Wärmekapazität das mit Abstand größte Wärme-Reservoir im Klimasystem der Erde. Die Wärmeaufnahme durch den Ozean stellt daher zunächst einen Puffer bei Klimaänderungen dar und verlangsamt beim gegenwärtigen Klimawandel deutlich die Erwärmungsrate der Atmosphäre.[21]
Die Situation wird zusätzlich dadurch verschärft, dass auch der Anstieg der Wärmeaufnahme durch die Ozeane viel stärker ist als die vom Menschen direkt wahrnehmbare Erwärmung der Eismassen, der Landflächen sowie der Atmosphäre, wie man in obiger Graphik deutlich erkennen kann. D.h. die Menschen können mit ihren Sinnen gar nicht unmittelbar und offensichtlich die eigentliche Dramatik der direkten globalen Erderwärmung wahrnehmen. Dies mag auch ein Grund für die Diskrepanz der Einschätzung von ca. 98% der Experten (s.S. 297) - der forschenden Klimawissenschaftler weltweit - und des restlichen Teils der Bevölkerung sein. Wir sehen und spüren nur einen sehr kleinen Teil (7%) der wirklichen Wärmeaufnahme der Erde und damit der Erderwärmung, da den allergrößten Teil der Wärme die Ozeane absorbieren.
Der tiefere Ozean
Interessant und gleichzeitig alarmierend ist folgender Befund, der in letzter Zeit vermehrt diskutiert worden ist: Seit ca. 1995 scheint sich der tiefere Ozean stärker erwärmt zu haben als die oberen Schichten. Vorher war es umgekehrt. Die folgende Graphik gibt einen deutlichen Hinweis hierauf.
Ozeanerwärmung in den oberen 700 m (rot) und in den oberen 2000 m (schwarz) im 5-Jahresmittel bis zur Periode 2008-2012Quelle: NOAA/NESDIS/NODC
Dies könnte u.a. auch eine der Ursachen für den verminderten Anstieg der Oberflächentemperaturen für diesen Zeitraum sein. Diskutiert wird zurzeit in der Klimawissenschaft, dass diese Verschiebung durch eine Änderung der Passatwinde sowie deren Wirkung auf großräumige Ozeanwirbel ausgelöst worden sein könnte.[22]
Fazit:
Das beunruhigende Resümee dieser Fakten ist: Die Weltmeere heizen sich weiter stark auf. Da das ganze Klimageschehen u.a. auch und gerade in den Ozeanen äußerst komplex ist, muss man extrem wachsam sein, um die Gefahr des Eintretens nicht mehr umkehrbarer Prozesse zu minimieren.
Mittelmeer heizt sich immer stärker auf
Fünfmal schneller als andere Meere und Ozeane erwärmt sich das Mittelmeer. Nach einer Studie der Universität Alicante und der US-Raumfahrtbehörde NASA stieg die Wassertemperatur an der Oberfläche des Mittelmeers von 1993 bis 2003 um 0,75°C. „Dies ist eine bedeutende Differenz“, sagte die Leiterin des Forscherteams, Isabel Vigo. Andere Meere haben sich in dieser Zeit durchschnittlich nur um 0,15°C erwärmt.
Was dies für das gesamte Ökosystem des Mittelmeeres dauerhaft bedeutet, kann man nur erahnen. Auf jeden Fall nichts Gutes, wie man schon jetzt an der massenhaften Verbreitung des hochgiftigen Kugelfisches sieht.
Weniger Phytoplankton in wärmeren Ozeanen
Wissenschaftler haben mit Satelliten die Auswirkungen des Klimawandels in den Ozeanen untersucht. Sie haben beobachtet, dass die Menge an Plankton, das als wichtige Nahrungsquelle für Fische und Schalentiere dient, durch steigende Wassertemperaturen in großen Bereichen signifikant zurückgeht. Dies trägt nicht nur zur nachhaltigen Gefährdung von Fisch-Populationen in den Weltmeeren bei, sondern führt aufgrund sich selbstverstärkender Rückkoppelungsprozesse auch zu einer Beschleunigung der Erderwärmung.
Über einen Zeitraum von fast zehn Jahren beobachtete der NASA-Satellit „Orbview2“ die Weltmeere aus 705 Kilometer Höhe. Seine biooptischen Instrumente untersuchten dabei die Farben der Ozeane und registrierten Unterschiede von feinsten Farbnuancen. Daraus kann man Rückschlüsse auf die Verteilung von photosynthetisch aktiven Kleinstlebewesen - dem sogenannten marinen Phytoplankton - in den Ozeanen ziehen. US-amerikanische Ozeanologen und Botaniker haben die Satellitenbeobachtungen ausgewertet und berichteten davon im Fachmagazin „Nature“. Dabei zeigt die Studie einen klaren Zusammenhang zwischen Ozeanproduktivität und Meereserwärmung. Laut Studienleiter Michael Behrenfeld von der Oregon State University ist die Kernaussage: „Steigende Temperaturen verursachen eine verminderte Produktion von marinem Phytoplankton.“
Erstmalig konnten Wissenschaftler mit Hilfe von Satelliten die Entwicklung der Algen über einen längeren Zeitraum von fast zehn Jahren beobachten. Durch Forschungsschiffe hatte man bisher nur Momentaufnahmen erhalten, so der Ozeanograf Scott Doney von der Oceanographic Institution in Woods Hole (US Bundesstaat Massachusetts) in „Nature“.[23]
Temperatur und Plankton: Klimawandel beeinflusst Nahrungsketten; die beiden Bilder zeigen Veränderungen der Wassertemperatur an der Oberfläche (oben) und der Planktonaktivität zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2004. Gebiete mit erhöhten Meerestemperaturen sind rot gekennzeichnet. Sie stimmen weitgehend mit den Meeresregionen überein, in denen das Phytoplankton weniger aktiv war (ebenfalls rot gekennzeichnet). Sank die Meerestemperatur (blaue Bereiche), so erhöhte sich auch die Produktivität des Phytoplanktons (grün). Quelle: NASA
Die Wissenschaftler beobachteten zunächst eine starke Algenzunahme, die an eine Kaltphase des Klimaphänomens ENSO (El Niño - Southern Oscillation) gekoppelt war. Anschließend verringerte sich die Konzentration von Phytoplankton kontinuierlich über mehrere Jahre, als die Erde in eine ausgedehnte Enso-Warmphase eintrat. Eine Erklärung der Forscher für diese verminderte Produktivität lautet so: Phytoplankton schwebt in den oberen, sonnendurchfluteten Schichten, da es zum Leben u.a. Licht für die Photosynthese braucht. Zusätzlich benötigt die Alge jedoch auch Nährstoffe aus den tieferen, kälteren Wasserschichten. Erwärmt sich nun die Oberflächenschicht, dehnt sie sich aus. Dies führt zu einer verringerten Durchmischung mit der unteren kälteren Nährstoffschicht, so dass die Algen insgesamt weniger Nährstoffe aufnehmen können.
Michael Behrenfeld glaubt, dass sich die Verteilung der Biomasse in den Ozeanen in Zukunft drastisch verändern könnte. In tropischen Meeren und gemäßigten Breitengraden stülpe sich wärmeres Oberflächenwasser über kaltes Tiefenwasser, blockiere so den Zustrom von Nährstoffen und bremse dadurch das Planktonwachstum. In kälteren Meeresgegenden dürfte die Erwärmung dagegen die teils sehr heftigen, strudelartigen Strömungen bremsen und damit die Nährstoffzufuhr verbessern. In diesen Meeresbereichen müsste es demnach mehr Phytoplankton geben.
Beides kann man sehr gut an den beiden Satellitenbildern oben erkennen. In einem breiten Gürtel um den Äquator entspricht eine Erwärmung des Meereswassers (rot) einer Abnahme des Phytoplanktons (rot). In dieser warmen Zone ist der Ozean „permanent geschichtet“. In den kälteren Meeresgebieten zum Nord- und Südpol hin kann man das genaue Gegenteil beobachten: Die blauen Bereiche kälteren Wassers korrelieren hier deutlich mit einer Zunahme der Phytoplanktons (grün).
Anhand der Langzeitmessungen mit Hilfe des Spezialsatelliten „Orbview 2“ konnte damit erstmals gezeigt werden, dass die weltweite Entwicklung des Phytoplanktons eng an die globale Klimaerwärmung gekoppelt ist.





























