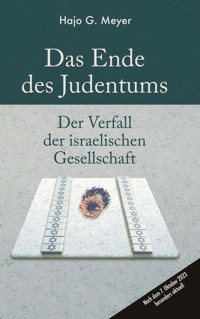
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hajo G. Meyer beschreibt in seinem Buch, Das Ende des Judentums seine Abscheu vor dem moralischen Verfall der heutigen israelischen Gesellschaft. Meyer ist ein prominentes Mitglied von Eine andere Jüdische Stimme, eine Bewegung, die die Jüdische Loyalität zu Israel dazu benutzt über Israel kritisch nachzudenken. Weitere Informationen: https://nahost-bücher.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Chris
Was dir nicht lieb ist,
das tue auch deinem Nächsten nicht –
dieses ist die ganze Thora.
Rabbi Hillel (1. Jahrhundert v.Chr.)
Inhalt
Dankwort
Vorwort
EINS
Autobiografischer Hintergrund
Was meine Jugend erzählt
1. Geschichtsschreibung und Trauma
Gehirnwäsche
Über Geschichtsschreibung
Geschichte als Modell für heutige Ereignisse
2. Eine untergegangene Welt, das deutsche Judentum
Einleitung
Soziale Umwelt
Großeltern, Eltern und Verwandtschaft
Das Judentum in meiner Familie
Zufriedene, erfolgreiche jüdische Bürger
3. Das Ende einer Welt, Hitler an der Macht
Einleitung
Auswirkungen auf meine Familie
Jude in der Schule mit Nazis
Zu spät... keine Hoffnung mehr
4. Flüchtling in den Niederlanden
Einleitung
Wieder ohne Hoffnung, ohne Zukunft
Hurra, Arbeitsdorf Wieringen
Doch wieder zur Schule
Reifeprüfung und Leben im Versteck
5. Beinahe Endstation Auschwitz
ZWEI
Déjà-vu, die Albträume eines in Deutschland geborenen Juden
Was die Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten erzählt
1. Einleitung – Über die Schwierigkeit der Kommunikation
Mein eigener Filter
Die Filter des Lesers
Der Kurzschluss näher untersucht
Jede Diskriminierung auf Grund der ethnischen Herkunft ist verwerflich
2. Warum dann doch dieser Vergleich?
Ähnliche Signale auch aus Israel
Die Unterschiede zwischen beiden Situationen
Gibt es auch Parallelen?
Ein traumatisiertes Volk kommt an die Macht
Einkreisungskomplex und heiliger Boden
Die Übertreibung der Bedrohung
Kollektive Verantwortung und kollektive Strafen
Kollektive Verantwortung und Kollektivschuld
Entmenschlichung des Gegners
Verrat von innen
Drohende Deportation
Erniedrigung
Epilog
DREI
Lehren aus Auschwitz –
Was die Hölle mir erzählt
1. Entstehungsgeschichte des Holocaust
Einleitung
Auschwitz und Xenophobie
Hass
Deutschland
Antisemitismus
Hitlers Erfolg
Unmerklich zunehmende Diskriminierung
Verrat am kulturellen Erbe
Lehre aus der Entstehungsgeschichte
2. Meine Lagererfahrung und ihre Folgen
Lernen in Auschwitz
Lehren aus persönlichen Erfahrungen
Leiden und seine Folgen – Folgen für den Einzelnen
Folgen für das jüdische Volk insgesamt
Lehren aus Auschwitz
Ethische Sinngebung
VIER
Allgemeine Begriffsverwirrung –
Was nachlässige Denker und Betrüger uns zu erzählen versuchen
1. Sorgfältige Begriffsbestimmung als Korrektiv gegen trügerischen und manipulativen Wortgebrauch
Missbrauch der Vieldeutigkeit
Euphemismen und übertriebene Anschuldigungen
2. Der Zweite Weltkrieg als moralischer Bezugspunkt
Leichtfertiger Wortgebrauch
Von der Herkunft abhängige Bedeutungszuweisung
Darf man den Holocaust heranziehen?
3. Jüdischer Selbsthass
Einleitung
Antisemitismus
Jüdischer Selbsthass als Folge des Ghettos und der Emanzipation
Ein radikales Heilmittel: der Revisionismus
‚Eine andere jüdische Stimme‘
Vorwurf an die falsche Adresse
4. Zionismus, Rassismus, Rassendiskriminierung, Antisemitismus und die israelische Politik
Zionismus und Rassismus
Der Zionismus ist ein Anachronismus
Demokratischer jüdischer Staat
Arabischer Antisemitismus
5. Kritik an Israel
Paranoide Angst
Warum steht Israel im Brennpunkt?
Identifikation mit jüdischen Mitbürgern
Keine andere saudi-arabische Stimme
FÜNF
Die Antisemitismuskeule
Was ein Spuk erzählt
1. Antisemitismus vor 1967
Einleitung
Definition des Spuks
Wurzeln des Antisemitismus
Das auserwählte Volk
Das hässliche Entlein
Die selbstgewählte Absonderung in der Diaspora
Die christliche Kirche als treibende Kraft des Antisemitismus
Der komplexe Charakter des Antisemitismus
Verschiedene Grade der Virulenz
Antisemitismus als Problem des Antisemiten
Die Juden, beinahe zweitausend Jahre lang hilflose Opfer
2. Antisemitismus nach 1967
Der Staat Israel im antisemitischen Kräftefeld
Israel im Kreuzfeuer
Haben die Juden ein Monopol auf Leiden?
Latenter und virulenter Antisemitismus
Ist der Antisemitismus manchen Juden (unbewusst) willkommen?
Antisemitismus als Deus ex machina
Ist Kritik an Israel gleichbedeutend mit Antisemitismus?
Epilog
SECHS
Das Ende des Judentums, das Ende einer Geschichte –
Was die Zukunft Ihnen erzählen könnte
1. Ein persönlicher Abriss des klassischen Judentums
Einleitung – Demographie versus Ethik
Die zwei Seiten des Judentums
Die Schattenseiten des klassischen Judentums
Die positiven Leistungen des klassischen Judentums – Sabbat und soziale Ethik
Intellektuelle Tradition
2. Überleben
Einleitung
Das Festhalten an den religiösen Vorschriften war sinnvoll
Reformation
Folgen des Dreißigjährigen Krieges
Die Hofjuden
Aufklärung
Moses Mendelssohn
Mendelssohns Schüler
3. Herausforderungen der Emanzipation und neuer Antisemitismus
Eine Schockwelle in der Geschichte – ein Überblick
Eine detailliertere Betrachtung
4. Die erste Reaktion auf die Emanzipation
Bildungs- und Glaubensreform
Die Wissenschaft des Judentums
Unerwartete Herausforderungen, der Vorwurf des Legalismus
Ethik als die Essenz des modernen Judentums
Das Erbe des amerikanischen Judentums
5. Die andere Antwort auf den neuen Antisemitismus: Zionismus
Nationalismus in Europa
Der ‚Bindestrich-Jude‘
Die Geburt des neuen jüdischen Nationalismus
Die Ereignisse in Russland
Die ersten Pioniere, die erste Alija
Herzl als Katalysator
Die Braut ist schon vergeben
Jüdischer Sozialismus
Widerlegung von Vorurteilen und Pervertierung guter Eigenschaften
6. Der Holocaust
Einleitung
Fast zwei Jahrtausende tat das jüdische Volks nichts Falsches
Die verheerenden Folgen des Holocaust
Irrationale Ängste
Gedenken und sequentielle Traumatisierung
Eine mögliche Ergänzung zur Theorie von Keilson
Paranoia und Macht
7. Die Desillusion über Israel
Vor 1933 wenige Zionisten
Massale Bekehrung zum Zionismus
Nicht eingelöstes Versprechen
8. Schlussfolgerung: völliges Scheitern
Die Juden
Zionismus
Gott hat versagt
9. Das Ende des Judentums, das Ende einer Geschichte
Die Bedeutung des bisherigen Überlebens
Der Untergang Israels als jüdischer Staat
10. Einige Szenarien für die kommenden Jahrzehnte
Groß-Israel ohne Palästinenser
Verbessertes Oslo-Abkommen
Zweivölkerstaat
Und die Roadmap?
Das Ende des Judentums in der Diaspora
Mehr Macht – eine gefährliche Entwicklung
Epilog
SIEBEN
Gedanken über das Wesen des Bösen
Was Goethe, Hannah Arendt und andere Philosophen,wie auch Mein Leben, erzählen
1. Einführung
Polyinterpretabilität und klassische Größe
Nötige Neudeutung
2. Weltumfassendes Werk mit Lücke
Aufklärung im Kantschen Sinne
Theodizee
Das zwischenmenschliche Böse
Am Anfang war die Tat
3. Substitution zwischenmenschlicher Grundethik
Eichmann und die Banalität des Bösen
Substitution des Guten
4. Mephisto als erster Repräsentant des Bösen in Faust
5. Das radikal Böse bei Arendt
Arendts Kampf mit dem Begriff
Mein Versuch es zu fassen: „Die Substitution des Guten“
Kann die Gefahr der Substitution eingeschränkt werden?
Gottesglaube und Gleichwertigkeit aller Menschen
Humanitäre Werte als Bastard von Bibel und Aufklärung
6. Das radikal Böse in Faust
7. Das Böse in der Person des Dr. Faust
8. Faustischer Drang und Ahrendt’s Wissenschaftsbesessenheit
9. Epilog, Aspekte des Bösen in der heutigen Welt
ANHANG
Anmerkungen
Namensregister
Dankwort
Gefühle der Dankbarkeit haben, wenn sie nicht eine bestimmte Person betreffen, sondern allgemeiner Art sind, etwas mit religiösen Empfindungen zu tun. Wäre ich gläubig – quod non –, würde ich in diesem Moment dazu neigen, das einzige Gebet des Judentums aufzusagen, das ich bewundere: das so genannte Sche hechajanu, mit dem man zu besonderen Gelegenheiten seinen Dank dafür ausspricht, daß man es bis zu diesem Augenblick geschafft hat und dass man ihn bewusst erlebt.
Mein Dank gilt zuerst Oscar van Gelderen, meinem holländischen Verleger, der mich aufgrund einiger Zeitungsartikel dazu aufforderte, dieses Buch zu schreiben. Meine Ehefrau, Christiane Tilanus, die nach vielen Jahren als Chefin der Entbindungsstation eines großen Krankenhauses alles von der Geburt von Menschenkindern weiß, erwies sich als ideale Helferin bei der Geburt meines Geisteskindes. Ohne ihre unablässige Kritik, ohne ihre Inventivität und Kreativität hätte das Buch, wenn es denn überhaupt das Licht der Welt erblickt hätte, anders ausgesehen. Mein Dank geht weiterhin an den Kunsthistoriker Loek Tilanus, der den Text kritisch durchgesehen und hilfreiche Verbesserungsvorschläge gemacht hat. Sein Rat: Schrei ben heißt Weglassen. Auch einem anderen Historiker, Wiebe Brouwer, möchte ich danken für die Lektüre der ersten Fassung und für seine Hinweise zur Struktur des Buches. Wie viel Dank ich dem Journalisten Peter Day vom BBC-Rundfunk schulde, kann nur ermessen, wer die von ihm korrigierte, von mir in Englisch geschriebene erste Fassung des 6. Kapitels einsehen könnte. Schließlich schulde ich dem Rundfunk-Journalisten Job de Haan Dank, der mich nach der Lektüre einer frühen Fassung ermutigte weiterzumachen. Meine beiden Redakteure, Adriaan Krabbendam und Maarten van der Werf, hatten einen unentbehrlichen Anteil am Zustandekommen des Buches. Last but not least danke ich meinem Sohn Leo Meyer, der in einem späten Stadium den Text sehr genau durchgearbeitet hat. Auch seine zahlreichen Vorschläge waren sehr hilfreich beim Suchen nach klaren und sorgfältigen Formulierungen.
Meinem deutschen Verleger, Abraham Melzer, danke ich für den Mut, ein so kontroverses Buch zu veröffentlichen, und zwar ausschliesslich auf Grund eines Telephongesprächs und von ein paar kurzen Artikeln, die ich in deutscher Sprache liegen hatte. Wir waren uns allerdings schnell darüber einig, dass unsere Einstellung zu den in diesem Buch berührten Themen und Problemen sich erstaunlich ähnelt.
Meinen beiden Übersetzern danke ich für das zügige Tempo der Arbeit, ihr sich Einleben in meine Gedankenwelt und die höchst angenehme Zusammenarbeit.
Für die Redaktion des von mir auf Deutsch verfassten siebten Kapitels danke ich meiner Lektorin beim Melzer Verlag, Frau Heike Simon.
Selbstverständlich bin ich allein für den Inhalt des Buches verantwortlich.
Vorwort
Dies ist ein Band Essays. Essays, in denen eine ganze Reihe von Themen behandelt werden, vom Leben in einer deutsch-jüdischen Familie vor dem Zweiten Weltkrieg bis hin zum Tod von Palästinensern an den von israelischen Soldaten bewachten Checkpoints; Überlegungen zur historischen Betrachtungsweise überhaupt, sowie Betrachtungen über das Wesen des Judentums, über den Antisemitismus von der Antike bis zum Anti-Israelismus heute; über den Judenhass, aber auch über den Selbsthass und den Hass gegen alles, was nicht jüdisch ist; ja, auch über die Apotheose allen Hasses, die systematische, industrialiserte Vernichtung eines ganzen Volkes, den Holocaust, und schließlich auch über den verantwortungsvollen Gebrauch von Begriffen und über die Sinngebung des Leidens. Speziell für die vorliegende Deutsche Übersetzung ist eine philosophische Betrachtung über das Wesen des Bösen als siebtes Kapitel zugefügt. Die übrigen Kapitel sind zwischen Ende 2000 und Mitte 2003 als Essays entstanden und wurden zum Teil, meist in gekürzter Form, in Zeitungen veröffentlicht. Sie lassen sich daher auch als selbstständige Artikel lesen.
Was all diese Essays miteinander verbindet, ist an erster Stelle die Person ihres Autors. Es sind Essays, persönliche Betrachtungen. Aber von einer höheren Warte aus ist ihnen noch mehr gemeinsam. Sie alle umkreisen die Themen Judentum, Holocaust und Israel. Dies gilt auch für die Betrachtung über das Böse. Die Entstehungsgeschichte der einzelnen Kapitel bringt es mit sich, dass Wiederholungen nicht ganz zu vermeiden waren. Aber ich habe versucht, ein Thema möglichst aus verschiedenem Blickwinkeln zu betrachten. Da man dieses Buch nicht unbedingt von Anfang bis zum Ende lesen muss, enthält es eine ausführliche Inhaltsangabe.
Noch etwas zur Anordnung des Stoffs. Wie gesagt, es handelt sich um eine Anzahl subjektiv gefärbter Betrachtungen über objektive Ereignisse, wie bereits aus der Wahl der Titel und Untertitel hervorgeht. Darin folge ich dem Beispiel Gustav Mahlers, der den einzelnen Sätzen seiner Dritten Symphonie in seiner handschriftlichen Partitur solche Überschriften voranstellte, die widerspiegeln, was ihn zu seinen musikalischen ‚Beschreibungen‘ inspirierte.
Nur das erste Kapitel, Was meine Jugend erzählt, ist rein autobiographisch. In ihm versuche ich zunächst deutlich zu machen, wie sehr das Erleben zeitgenössischer historischer Ereignisse durch die eigenen Jugendeindrücke beeinflusst wird. So wird der Leser, der die wichtigsten Fakten meiner Kindheit zur Kenntis nimmt, dieses Buch, in dem ich klar profilierte Standpunkte zu kontroversen Themen einnehme, vielleicht besser verstehen. Für einen in Deutschland heranwachsenden jüdischen Jungen konnten die Ereignisse in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht dramatischer sein. Sie haben meine Persönlichkeit stark geprägt, und dies findet seinen Niederschlag in meinen Anschauungen.
Die Welt des deutschen Judentums vor der NS-Zeit – so verschieden von der in den Niederlanden – wird im zweiten Abschnitt dieses Kapitels kurz geschildert, wobei mein Elternhaus im Mittelpunkt steht. Den Schock, den Hitlers Machtergreifung in meiner Familie auslöste, könnte nur ein literarisch Begabterer als ich anschaulich vermitteln. Daher sei hier – neben vielen anderen – das Meisterwerk des deutsch-jüdischen Schriftstellers Lion Feuchtwanger empfohlen, Die Geschwister Oppermann.
Für mich persönlich wurde die Lage erst richtig kritisch, als ich nach der ‚Kristallnacht‘ nicht mehr zur Schule durfte. Tatsächlich habe ich dies als äußerst bedrohlich sowohl für meine Zukunft wie für mein ganzes weiteres Leben empfunden. Es war daher nur ein logischer Schritt, als ich mich entschloss, allein, als vierzehnjähriger Junge, in die Niederlande zu fliehen. Der vierte Abschnitt beschreibt meine schließlich erfolgreichen Bemühungen um eine weitere Ausbildung. Das Kapitel endet mit einem kurzen Bericht über die Zeit im Versteck und das bemerkenswerte Verhör beim deutschen Sicherheitsdienst in Den Haag nach meiner Verhaftung. Ganz bewusst habe ich in dieser autobiographischen Skizze meinen Erlebnissen in Auschwitz wenig Platz eingeräumt, zum einen, weil es bereits so viele Bücher darüber gibt, zum anderen, weil es mir unmöglich schien, etwas von dem zu vermitteln, was ich in dieser absurden Welt erlebt habe.
Der Rest des Stoffs folgt im großen und ganzen dem Verlauf meines Lebens, nicht im strikt autobiographischen Sinne, sondern dadurch, dass ich wichtige Ereignisse und Erlebnisse in chronologischer Reihenfolge auf objektivierbare Fragen projiziere, die mit den Hauptthemen dieses Buches zusammenhängen. Man muss dies aber nicht zu eng auffassen. Ich kam ja sehr jung nach Auschwitz, und das Kapitel, das ganz diesem Thema gewidmet ist, erscheint zwar an der, chronologisch gesehen, entsprechenden Stelle. Das Thema spielt jedoch eine dermaßen wichtige Rolle, das es in allen Kapiteln zur Sprache kommt.
Das zweite Kapitel, Déjà-vu, die Albträume eines in Deutschland geborenen Juden, steht an dieser Stelle, weil es direkt auf die Kindheitserlebnisse in Hitler-Deutschland zurückgreift. Es beschreibt eine Anzahl der restriktiven und erniedrigenden Maßnahmen, mit denen das NS-Regime die Juden zu Parias machte, um sie dann leichter aus Deutschland vertreiben zu können. Eine der Zielsetzungen dieses Buches ist es, deutlich zu machen, dass die Juden in den Jahren, bevor der Holocaust geplant und durchgeführt wurde, bereits unter vielfältigen Formen der Unterdrückung zu leiden hatten. Angesichts des übermächtigen Eindrucks, den der fabrikmäßig ausgeführte Völkermord hinterlassen hat, wird die vorausgegangene, etwa acht Jahre umfassende Periode sowohl im Denken wie in der Literatur häufig vernachlässigt. Das geht sogar so weit, dass bei der Erwähnung von Hitlers Diktatur sofort und ausschließlich an Gaskammern gedacht wird. Dass dem systematischen Mord Jahre vorausgingen, in denen das deutsche Volk durch Propaganda, fortschreitende diskriminierende Maßnahmen und antijüdische Gesetze mental darauf vorbereitet wurde, wird kaum noch erwähnt. Aber gerade dieses Vorstadium vor der schließlichen Katastrophe ist so bedeutsam. Denn bei ausreichender Wachsamkeit der demokratischen Länder hätten damals noch Maßnahmen ergriffen werden können, die Katastrophe wenn nicht zu verhindern, so doch zu beschränken. Denn man kann das Leben der Menschen auf vielfältige Weise zerstören. Etwa, indem man jungen Leuten den Zugang zur Bildung versperrt und sie daran hindert, ihre Talente zu entfalten und ihre Ambitionen zu verwirklichen. Ihr Leben bleibt dadurch unfertig und oft unerfüllt. Oder man entzieht Menschen, die sich eine Existenz aufgebaut haben, die Lebensgrundlage und treibt sie in die Verzweiflung und den Selbstmord.
Dies alles geschah in Deutschland zwischen 1933 und 1941. Bis zum Januar 1939 habe ich es am eigenen Leib erfahren. Das Intermezzo zwischen Anfang 1939 und der Besetzung der Niederlande im Mai 1940 war kaum mehr als eine Atempause. Das Leben als Paria hat mich ein für allemal gelehrt, wie unheilvoll Diskriminierung aufgrund von Herkunft oder Abstammung sein kann. Aus dieser Erkenntnis heraus halte ich es für meine Pflicht, die Behandlung der Palästinenser in den von Israel besetzten Gebieten äußerst kritisch zu beobachten. Und zu meinem Entsetzen stelle ich viele Übereinstimmungen fest. Hierauf gehe ich im zweiten Kapitel näher ein. Da dieser Vergleich unweigerlich auf starken Widerstand stoßen wird, habe ich versucht, sowohl die Gegenargumente als auch meine eigene Motivation zu analysieren.
Parallel zu den Ereignissen in meinem Leben ist das dritte Kapitel, Lehren aus Auschwitz, ganz dem Holocaust, der industriemäßigen Vernichtung von Millionen Juden, gewidmet, der letzten Phase meines Lebens unter der NS-Herrschaft. Im ersten Abschnitt wird die Entstehung der Todesmaschinerie skizziert. Es ist eines der Rätsel der modernen Geschichte, wie ein Volk, das einen so wertvollen Beitrag zur westlichen Kultur geleistet hat, sich einem Regime unterwerfen konnte, das sich innerhalb einer Zeitspanne von zwölf Jahren derartiger Verbrechen schuldig machte. Im zweiten Abschnitt gehe ich auf die Lehren ein, die vor allem wir Juden aus dem Holocaust ziehen sollten. Leider kommen die meisten Juden, die sich öffentlich hierzu äußern, nach meinem Dafürhalten zu falschen, beziehungsweise kontraproduktiven Schlussfolgerungen.
Im vierten Kapitel, Allgemeine Begriffsverwirrung, findet ein Teil meines Lebens nach dem Krieg seinen Niederschlag. Nach meiner Rückkehr in die Niederlande studierte ich theoretische Physik. Nebenbei belegte ich Vorlesungen über Philosophie, namentlich über den Neopositivismus des Wiener Kreises. Der betreffende Ordinarius, Professor Beth, sowie einer der Mathematik-Professoren, van Dantzig, waren beide Anhänger der niederländischen Entsprechung dieser Schule, die sich ‚Signifi-ca‘ nannte. Seitdem bin ich durchdrungen von der Wichtigkeit sprachlicher Klarheit. Ein erster Schritt besteht darin, sich möglichst eindeutig definierter Begriffe zu bedienen. Hierzu gehört natürlich auch die Wachsamkeit vor dem Gegenteil, vor oft unbewusst angewandten Scheinbegriffen, die zu Verwirrung und Missverständnissen führen, bis hin zur bewussten Manipulation zum Zweck der Täuschung und der Propaganda. Darauf gehe ich in fünf Abschnitten ein.
Auf kaum einem anderen Gebiet herrscht größere Begriffsverwirrung als auf dem des Antisemitismus. Das bekommen all diejenigen zu spüren, die es wagen, die israelische Politik zu kritisieren. Diesem sowohl für die Beschuldigten wie für alle Juden in der Welt gefährlichen Missbrauch einer Waffe, an der für immer das Gift von Auschwitz klebt, kommt in den letzten Jahren so oft vor, daß ich diesem ganzen Themenkomplex ein eigenes Kapitel, das fünfte, widme. Hiermit sind wir, was die Ordnung des Stoffs an Hand bestimmter Phasen meines Lebens betrifft, in der für mich äußerst befriedigenden Zeit als wissenschaftlicher Forscher und schließlich als Direktor eines großen industriellen Forschungslabors angelangt. Vierunddreißig Jahre Berufserfahrung in allen wichtigen Industriestaaten haben mir deutlich gemacht, was der wesentliche Unterschied zwischen Antisemitismus und Kritik an den politischen Taten Israels ist. Auch habe ich gelernt, dass jemandem unberechtigterweise antisemitische Sentimente vorzuwerfen eines der effektivsten Mittel ist, gerade diese Gefühle hervorzurufen.
Das vorletzte Synthese der vorherigen Kapitel, andererseits aber auch die Skizze meiner Auffassung vom Judentum und gleich zeitig ein Requiem auf das verlorengegangene, aufgeklärte Reform-Judentum Mitteleuropas, das in der Nachfolge des Rabbi Hillel die mitmenschliche Ethik wieder ins Zentrum des jüdischen Lebens rückte. Es stellt meiner Ansicht nach einen, wenn nicht den Höhepunkt der jüdischen Geschichte seit dem Mittelalter in Spanien dar.
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werfe ich einen Blick auf eine Zukunft, die weit außerhalb der mir gegebenen Zeit liegt. Dennoch schließt auch sie sich an das dramatischste Ereignis meiner Jugend an, den Holocaust, womit sich der Kreis sozusagen schließt. Diese unsägliche Tragödie wird vor allem unter dem Aspekt ihrer langfristigen Auswirkungen auf das jüdische Volk als Ganzem betrachtet. Ihr Einfluss auf den Verlauf der jüdischen Geschichte ist richtungweisend gewesen und wird dies bleiben. Die hierfür verantwortlichen soziopsychologischen Mechanismen werden in diesem Kapitel analysiert. Die Beschädigung des jüdischen Volkes, die einen moralischen Verfall nach sich zog, ist so ernsthaft, dass mir sein Fortbestehen auf Dauer nicht mehr gewährleistet erscheint. Verantwortlich ist natürlich neben der Schwere der Katastrophe im Zweiten Weltkrieg auch die eng mit unserer Kultur verbundene Tradition des Gedenkens aller Tragödien, die uns je in unserer langen Geschichte widerfahren sind. Es ist selbstverständlich ein heikles Unterfangen, Entwicklungen vorherzusagen. Aber die von Bernard Wasserstein1 vorgelegten, demographischen Fakten hinsichtlich der Juden in der Diaspora sprechen ein deutliche Sprache. Dass ethische Grundsätze beziehungsweise ihr Fehlen zum Überleben oder Untergang eines Volkes beitragen können, steht für mich außer Zweifel. Zweifelhaft ist jedoch meine immer wieder eher implizit als explizit vorgebrachte Annahme, es werde keinen Umbruch in der seit der Aufklärung feststellbaren, fortschreitenden Säkularisierung geben. Mit anderen Worten, die Zukunft des jüdischen Volkes könnte langfristig auch anders verlaufen, als im sechsten Kapitel prognostiziert. Dies könnte meiner Ansicht nach nur dann geschehen, wenn sich der in den Vereinigten Staaten, in Israel und in manchen islamischen Ländern zu beobachtende Trend hin zu religiösem Fundamentalismus nicht nur als ein vorübergehendes Phänomen erweist, sondern als eine wahrhafte, dauerhafte Rückkehr zu einer neuen Religiosität. Wie am Ende dieses Kapitels angedeutet, gibt es hierfür durchaus Anzeichen. Persönlich hänge ich, trotz aller gegenteiligen Erfahrung, zu sehr an den Ideen und Werten der Aufklärung, als dass ich eine solche Entwicklung für eine größere Katastrophe hielte als ein eventuelles Verschwinden des Judentums.
Das siebte und letzte Kapitel, „Gedanken über das Wesen des Bösen“, ist erst nach Veröffentlichung der niederländischen Ausgabe dieses Buches entstanden. Es kann im wörtlichsten Sinn als philosophischer Rückblick auf ein reiches, bewegtes Leben aufgefasst werden. Dass das Buch damit endet, dass ich mein philosophisches Fazit auf die heutigen Probleme zwischen der westlichen Welt und dem Islam anwende, hat zwei Gründe. Erstens können diese Probleme nie gelöst werden, solange der palästinensisch-israelische Konflikt nicht zu einem befriedigenden Ende gebracht ist. Schon darum sind meine philosophischen Schlussfolgerungen eng mit den Hauptthemen diese Buches verbunden. Der zweite Grund ist persönlicher Art. In meinen Betrachtungen über den Sinn oder die Sinnlosigkeit des Leidens im dritten Kapitel weise ich darauf hin, dass Leiden an sich keinerlei Sinn hat, dass man ihm aber einen Sinn geben kann, indem man es als Stimulans zu positiven Taten und Gedanken sieht. Lehren ziehen aus meinen Erfahrungen, um mitzuhelfen, die heutigen Probleme zu bewältigen, betrachte ich als eine solche Sinngebung.
Schließlich noch ein Wort an meine zukünftigen Kritiker. Ihre Reaktionen werden durch meine unverblümt kritische Haltung zur israelischen Politik nicht immer freundlich sein. Das ist ein Risiko, das ich bewusst eingehe, und zwar hauptsächlich aus den Gründen, die ich im zweiten Abschnitt des zweiten Kapitels nenne. Dort wird, im Zusammenhang mit der Lage im Nahen Osten, auch das Wort ‚beschämend‘ verwendet. Der niederländische Journalist Max van Weezel2 hat sich im August 2003 dagegen ausgesprochen, dass Juden in Bezug auf die von Israel begangenen Verbrechen Scham empfinden.3 Das begreife ich nicht. Gute, vernünftige und ihr Land liebende Niederländer haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg für den unsinnigen, anachronistischen und nur zu Elend und Unglück führenden Krieg in Indonesien geschämt. Das gleiche gilt für amerikanische Bürger im Hinblick auf den Vietnamkrieg. Wenn man sich einer Gemeinschaft zugehörig fühlt, und im Namen dieser Gemeinschaft werden Verbrechen begangen, dann ist Scham, die aus der Kombination von Verbundenheit mit der Gemeinschaft und mitmenschlicher Ethik hervorgeht, legitim, ja, sogar geboten. Sollten für Juden andere Regeln gelten? Wie dem auch sei, meine unverblümte Kritik hat ihren Ursprung in der Sorge um das Fortbestehen des Landes, von dem wir einmal hofften, es werde ein sicherer Zufluchtsort sein.
Diejenigen, die mir jüdischen Selbsthass vorwerfen, verweise ich auf den dritten Abschnitt des vierten Kapitels, der ganz diesem Phänomen gewidmet ist.
EINS
Autobiographischer HintergrundWas meine Jugend erzählt
1. Geschichtsschreibung und Trauma
Gehirnwäsche
Mit der Überschrift dieses ersten Abschnitts ist die folgende Anekdote verknüpft. In einer Rundfunksendung diskutierte ich mit dem Vorsitzenden von Likud Nederland, der niederländischen Abteilung der Partei des israelischen Ministerpräsidenten Scharon, über den Sinn der so genannten targeted killings, der gezielten Tötung bestimmter Palästinenser, die im Verdacht stehen, Terroristen zu sein oder Terrorakte vorzubereiten. Die Regierung Scharon beschließt solche Morde, ohne die Öffentlichkeit über die zugrunde liegenden Verdachtsmomente zu informieren. Von einem fairen Verfahren ist also keine Rede, auch nicht von irgendeinem Beweis, den die Öffentlichkeit zur Kenntnis nehmen kann. Ich halte solche Aktionen für kontraproduktiv, da sie wieder neue Selbstmordanschläge provozieren. Als ich dies vorbrachte, sagte mein Gegenüber plötzlich: Herr Meyer, Sie wurden einer Gehirnwäsche unterzogen. Worauf ich antwortete: Sie haben vollkommen Recht, und wissen Sie wodurch? Durch die Weltgeschichte, die über mich hinweggerollt ist. Diese Gehirnwäsche, die in meinem Fall durch Ort und Zeit meiner Geburt und durch meine ethnische Herkunft etwas intensiver war als bei den meisten Westeuropäern, hat meine Sicht der Welt für immer geprägtiv. Ich verwende bewusst nicht das Wort ‚verformt‘, denn so empfinde ich es nicht. Nach der Lektüre dieses Essaybandes oder zumindest eines Teils mag der Leser selbst beurteilen, welches der beiden Wörter er für das zutreffendere hält.
Über Geschichtsschreibung
Eines steht für mich fest: Die Beschreibung historischer Ereignisse gemäß dem berühmten Ideal des Historikers Leopold Ranke, dass der Historiker nicht richten und belehren, sondern nur darstellen solle, wie es eigentlich gewesen sei, ist nicht möglich. Aber eine andere Forderung, die Ranke und die Historisten an die Geschichtsschreibung stellten, hat meiner Ansicht nach immer noch Gültigkeit, dass man nämlich versuchen solle, sich in die vergangene Zeit, die man erforscht, hineinzuversetzen. Es ist unmöglich, die Vergangenheit zu begreifen, wenn man heutige moralische Maßstäbe anlegt. Ein bekanntes Beispiel aus der niederländischen Geschichte ist die Kolonialzeit und besonders der damit verbundene Sklavenhandel, bei dem die Niederländer eine nicht unerhebliche Rolle spielten. Unhistorisch wäre es, eine Zeit, in der die Gleichheit aller Rassen noch entdeckt werden musste, nach Erkenntnissen zu beurteilen, die erst hundert Jahre später in der Zeit der Aufklärung formuliert wurden und erst nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich universale Gültigkeit erlangten. Man muss mit anderen Worten bei der Beurteilung und vor allem bei der Verurteilung von Menschen der Vergangenheit auf Grund heutiger Normen sehr vorsichtig sein. A fortiori gilt dies natürlich für den Holocaust, der so unvorstellbar war, dass eigentlich niemand ihn vorhersehen konnte. Den ersten Berichten darüber hat denn auch fast niemand Glauben geschenkt. Menschen der damaligen Zeit den Vorwurf zu machen, sie hätten etwas nicht verhindert, was sie unmöglich vorhersehen konnten, also gewöhnlichen deutschen Bürgern eine Mitschuld an der Massenvernichtung in Auschwitz anzulasten, ist absurd. Dies trifft selbstverständlich nur auf diejenigen zu, die sich nicht persönlich welcher Verbrechen auch immer schuldig gemacht haben.
Geschichte als Modell für heutige Ereignisse
Während es also ungerecht ist, Verhältnisse und Menschen früherer Zeiten aus der Sicht der Gegenwart zu bewerten, ist es dagegen durchaus gerechtfertigt und manchmal sogar nützlich, heutige Verhältnisse und politische Ereignisse anhand historischer Erkenntnisse zu prüfen. Aber weil die Geschichte sich nie bis ins Detail wiederholt, ist Vorsicht geboten, wenn man zukünftige Entwicklungen mit Hilfe historischer Parallelen vorherzusehen versucht. Ein Vergleich zwischen aktuellen Ereignissen und solchen – um ein Beispiel zu nennen –, die zwischen 1933 und 1945 stattfanden, ist für jemanden mit meinem Hintergrund und meiner Geschichte eine Herausforderung. Es ist jedoch auch ein Risiko damit verbunden.
Die Herausforderung besteht darin, dass es zwar schwierig, aber notwendig ist, Menschen davon zu überzeugen, dass die automatische Assoziation von ‚Deutsche‘ und ‚Zweiter Weltkrieg‘ mit ‚Gaskammern‘ und ‚Holocaust‘ sehr unhistorisch ist. Denn dadurch werden nicht nur wichtige Abschnitte der Geschichte vernachlässigt, sondern auch die Art und Weise, wie die Menschen die Wirklichkeit damals erlebten. Ja, auf Grund sowohl meiner eigenen Erfahrung, als auch auf Grund historischer Tatsachen kann ich behaupten, dass die Tragödien, die sich in der Zeit vor der großen Vernichtung im Leben derer abspielten, die dem Hitler-Regime kritisch gegenüber standen – Demokraten, Kommunisten, Sozialisten und natürlich auch die Juden –, gewaltig unterschätzt werden. Sie werden von dem ab 1942 systematisch betriebenen Völkermord so sehr in den Hintergrund gedrängt, dass die schrecklichen Geschehnisse davor kaum Beachtung finden. Ich werde hierauf noch wiederholt zurückkommen.
Das Risiko nun, das mit jenem Vergleich verbunden ist, besteht darin, dass die dramatischen Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs mehrere Generationen ernsthaft und nachhaltig traumatisiert haben. Wie ich oben bereits sagte, waren sie für mich eine Art Gehirnwäsche, wodurch ich alles, was danach stattfand, also die ganze nach den traumatischen Erfahrungen erlebte Geschichte, durch diese Brille sehe und mit einer durch diese Erfahrungen verursachten Überempfindlichkeit erlebe, abwäge und interpretiere. Das gilt übrigens nicht nur für mich, sondern für alle, die durch Traumata geformt oder verformt wurden.
Um meine Ansichten über die Hauptthemen dieses Buches verständlich zu machen, muss ich daher etwas über die Schlüsselerlebnisse meines Lebens berichten, darüber, wie die Geschichte über mich hinweggerollt ist. Erst das ermöglicht dem Leser, die objektivierbaren Ereignisse aus der gleichen Perspektive zu betrachten. Aber der Leser behält auch immer seine eigene Brille auf. Es versteht sich von selbst, dass nicht nur traumatische Erfahrungen den Filter bestimmen, durch den man die Welt wahrnimmt. Auch soziologische und genetische Faktoren spielen eine Rolle.
2. Eine untergegangene Welt, das deutsche Judentum
Einleitung
Es hilft kein Jammern und kein Klagen, ich bin und bleibe, was man in Israel einen Jekken nennt. Das heißt, ich bin mir immer noch bewusst, dass ich ein in Deutschland geborener Jude bin, der durch die Werte geprägt wurde, die das deutsche Judentum ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bestimmten. Bei der Ausformung dieser Werte spielte der jüdische Philosoph der Aufklärung Moses Mendelssohn eine bedeutende Rolle, der auch weit über den jüdischen Kreis hinaus Berühmtheit erlangte.
Auf die Bedeutung Mendelssohns komme ich im vorletzten Essay dieses Buches, Das Ende des Judentums, noch ausführlicher zu sprechen. Hier beschränke ich mich auf einige Beobachtungen über die sozialen, religiösen und familiären Verhältnisse, unter denen ich bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr aufwuchs.
Soziale Umwelt
Im Gegensatz zu den Niederlanden gab es zwischen den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und der Machtergreifung Hitlers in Deutschland kein nennenswertes jüdisches Proletariat. Sowohl hinsichtlich des Einkommens wie der Bildung und Qualifikation lagen die deutschen Juden über dem Durchschnitt der Bevölkerung. Dies illustriert recht anschaulich die Tatsache, dass in meiner Geburtsstadt Bielefeld in Westfalen zwischen 1870 und 1933 zwei Prozent der Bevölkerung jüdischer Herkunft war, während die Zahl jüdischer Schüler auf dem Gymnasium, das ich besuchte, im gleichen Zeitraum zehn Prozent betrug. Auf den Missbrauch, den antisemitische Demagogen mit solchen Statistiken trieben, gehe ich im fünften Kapitel näher ein. Hier beschränke ich mich auf meine persönlichen Erfahrungen.
Großeltern, Eltern und Verwandtschaft
Der Ursprung meiner Familie lässt sich bis Ende des 17. Jahrhunderts zurückverfolgen. Sowohl die Familie mütterlicher- wie die väterlicherseits war seit jener Zeit in Westfalen ansässig. Als meine Mutter neun Jahre alt war – sie wurde in Dortmund geboren – siedelte ihr Vater Julius Melchior nach Berlin um, um dort die Leitung der Patzenhofer Brauerei zu übernehmen, deren Biermarke es bis heute gibt. Sein Wohnhaus, das er im schicksten Viertel Berlins bauen ließ, steht heute noch. Die vier Brüder meiner Mutter absolvierten alle ein Universitätsstudium. Einer wurde Professor der Chirurgie an der Universität von Breslau, ein anderer wurde nach seinem Maschinenbaustudium Abteilungsleiter bei der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), einer von dem jüdischen Großindustriellen Emil Rathenau gegründeten Firma. Dank seiner technischen Kenntnisse wurde dieser Onkel im Ersten Weltkrieg Pionier-Offizier im deutschen Heer. Dies war einer der Gründe, warum er in der Nazizeit trotz der Tatsache, dass er und seine nichtjüdische Frau keine Kinder hatten, in Berlin den Krieg überleben konnte. Zum Schluss hat man ihn, der den Judenstern trug, sogar zum Hausluftschutzwart* ernannt.
Meine Mutter hätte liebend gern Medizin studiert, aber meine äußerst viktorianische Großmutter erlaubte es nicht. Das sei kein Beruf für ein anständiges Mädchen aus gutem Hause. So empfand meine Großmutter es nun mal. Das Resultat war, dass meine Mutter im Alter von sechsundzwanzig Jahren von zu Hause weglief, eine kurze Ausbildung als Krankenschwester absolvierte und sich freiwillig in einem Krankenhaus an der Ost front meldete – einem Lazarett für ansteckende Krankheiten. Sie wäre beinahe an der Diphtherie gestorben, die sie sich dort zugezogen hatte.
Ein anderes Resultat ihres Aufenthalts an der Ostfront war, dass sie in jenem Krankenhaus meinen Vater kennenlernte, der in der Schlacht bei Tannenberg (1914) so schwer verwundet worden war, dass er, untauglich für den Frontdienst, nun als Unteroffizier die Verantwortung für die militärische Ordnung im Krankenhaus übernommen hatte. Ende 1916 heirateten sie. Ihre Mutter war darüber nicht sehr erfreut. Mein Vater, promovierter Jurist, Anwalt und zugleich Notar, kam gesellschaftlich gesehen, zumindest auf den ersten Blick, aus einem weniger arrivierten Milieu als meine Mutter. Sein Vater hatte den nicht gerade angesehenen Beruf eines Pferdehändlers, was man heute mit einem Gebrauchtwagen-Händler vergleichen könnte. In verschiedener Hinsicht wurde dieser gesellschaftliche ‚Makel‘ mehr als wettgemacht durch die Persönlichkeit und Kultur der Frau, die er vermutlich durch seinen großen Charme zu erobern gewusst hatte.
Diese Großmutter Theodora war ein besondere Frau, das Musterbeispiel jener jungen jüdischen Frauen, wie sie aus den so genannten Hof- und Schutzjuden hervorgegangen waren, in diesem Fall die des Hofes des kleinen Füstentums Lippe-Detmold. Wie im sechsten Kapitel ausführlicher dargelegt wird, waren diese jüdischen Töchter im Allgemeinen sehr gebildet. Sie kannten die deutschen und antiken Schriftsteller durch und durch, und die erfolgreichsten unter ihnen unterhielten die berühmten literarischen Salons in Berlin. Das tat meine Großmutter nicht, aber sie las „ihre“ griechischen und lateinischen Autoren im Orignal. Außerdem war sie im Unterschied zu meiner Großmutter Melchior eine warme, sensible Frau, die mit viel Liebe und mit bescheidenen Mitteln ihre Familie mit sieben Kindern versorgte. Mein Vater hat sie sein Leben lang angebetet, und dies mag mit zu seiner äußerst aufmerksamen und liebevollen Haltung meiner Mutter gegenüber beigetragen haben, deren Zeuge ich vierzehn Jahre lang war.
Ein Bruder meiner Großmutter, der Sanitätsrat Dr. Max Meyer, war Dorfarzt in Oerlinghausen, zwölf Kilometer von Bielefeld entfernt. Er besuchte uns oft und hat mir, ohne es zu wissen, später noch einen großen Dienst erwiesen. Hierauf komme ich am Ende dieses Kapitels noch zu sprechen.
Mein Vater hatte vier Brüder und zwei Schwestern. Im Unterschied zu den Gepflogenheiten in der Familie meiner Mutter durften alle Kinder der Großeltern Meyer studieren, allerdings unter der Bedingung, dass sie das Gymnasium absolvierten, ohne ein einziges Mal sitzen zu bleiben. Dieses strenge Kriterium erfüllten neben meinem Vater noch ein Bruder und die jüngste Schwester. In dieser Familie mit der gebildeten Mutter durfte also auch sie als Mädchen zur Universität. Da die Eltern aber das Studium dreier Kinder nicht finanzieren konnten, mussten diese selbst für die nötigen Mittel sorgen. Mein Vater lieh sich das Geld von einem wohlhabenden angeheirateten Verwandten, dem Pionier der plastischen Chirurgie Dr. Joseph. Leider habe ich die Mutter meines Vaters nicht gekannt. Sie starb relativ früh, wie es hieß, aus Kummer und Sorge um ihre fünf Söhne, die allesamt im Ersten Weltkrieg an der Front waren. Ihr jüngster Sohn, ihr Liebling, fiel bereits in den ersten Wochen. Das schloss aber nicht aus, dass die Familie meines Vaters, wie fast alle deutsch-jüdischen Familien, äußerst vaterlandsliebend war.
Was in nahezu allen deutsch-jüdischen Familien und gewiss auch in der meinigen und der meiner Großeltern mütterlicher- wie väterlicherseits in hohem Ansehen stand, war die so genannte allgemeine Bildung. Man hatte sich in der Antike, der deutschen Klassik, Musik, Theater und Oper auszukennen. „Weißt du das nicht? Das gehört doch zur allgemeinen Bildung!“ war ein bei uns zu Hause öft gehörter Ausspruch. Man musste viel wissen, viel lernen und sich um zwei Dinge im Leben kümmern: zum einen, dass man eine gute Position erreichte, sodass man einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten konnte, und zum anderen – und das galt als das Wichtigste überhaupt –, dass man danach strebte, ein anständiger Mensch zu werden und zu bleiben, ein Mensch mit moralischen Grundsätzen und einem wachen Gewissen. Hierauf komme ich im dritten und vierten Kapitel zurück.
Das Judentum in meiner Familie
Die Art und Weise, wie in meinem Elternhaus das Judentum gelebt wurde, unterschied sich sehr von der in einer niederländisch-jüdischen Familie vor dem Krieg. Schon beide Familien meiner Großeltern waren kaum noch traditionell, geschweige denn orthodox. Wir wussten zwar in etwa, welche Nahrung koscher oder treife (nicht koscher) war, aber ich kannte in meiner Kindheit buchstäblich niemanden, der sich an die jüdischen Speisegesetze hielt. Wobei darauf hingewiesen werden muss, dass Westfalen, in dem meine Geburtsstadt liegt, die Wiege des deutschen Reform-Judentums war, einer liberalen Richtung, die sich zum Ziel gesetzt hatte, den jüdischen Gottesdienst zu reformieren (siehe auch das sechste Kapitel). In der Synagoge von Bielefeld legte sich niemand einen Tallit, einen Gebetsschal, um. Nur der Rabbi trug ein stilisiertes Rudiment, so breit wie ein gewöhnlicher Wollschal. Wenn jemand einmal mit einem Tallit in der Synagoge erschien, was hin und wieder geschah, dann sagten wir zueinander: „Schau mal, der kommt aus Osteuropa.“ Ja, wir gingen tatsächlich noch ab und zu in die Synagoge – an wichtigen Festtagen, aber sonst nicht. Obwohl ich nie die Gelegenheit hatte, mit meinen Eltern darüber zu sprechen, hatte für uns der Besuch der Synagoge in erster Linie eine soziale Funktion. Mein Vater, ein bekannter Anwalt in einer mittelgroßen Stadt und Mitglied einer recht kleinen jüdischen Gemeinschaft von zwei- bis dreihundert Familien, konnte es sich nicht erlauben, nicht ab und zu mit seiner Familie zu erscheinen.
Nein, die Halachah, der jüdische Religionskodex, bedeutete uns nichts. Ethik, Leistung, Einsatz – das war das wichtigste. Hinzu kam der Stolz, dass wir, das jüdische Volk, seit der Antike überlebt hatten und dass wir als deutsche Juden, namentlich nach Moses Mendelssohn, so viel erreicht und geleistet hatten (siehe auch das sechste Kapitel).
Zufriedene, erfolgreiche jüdische Bürger
Meine Eltern hatten den Ersten Weltkrieg mit großer Intensität erlebt. Ein gefallener Bruder, Hungersnot, Verwundung und Krankheit, eine vor Kummer gestorbene Mutter, Verarmung durch die Inflation und, nicht zuletzt, die Schande und Schmach, Teil einer Nation von Verlierern zu sein – und ich meine die deutsche, nicht die jüdische Nation. Trotzdem glaube ich mich zu erinnern, dass ich bis 1933 in einer harmonischen, glücklichen Familie aufgewachsen bin. Meine Mutter war eine warme, intelligente und probate Frau, die fürsorgliche, alles lenkende Seele des Hauses.
Mein Vater stand uns viel ferner. Er arbeitete hart in seiner Anwaltspraxis und fühlte sich schnell durch den Lärm gestört, den meine beiden Brüder und ich machten – vor allem ich. Aber er war erfolgreich. Dass einer seiner Mandanten die Bielefelder Stadtverwaltung war, ein lukrativer und angesehener Klient, darüber empfand mein Vater große Genugtuung. All dies hatte zur Folge, dass meine Eltern mit ihren drei Söhnen in materieller Hinsicht wenig zu klagen hatten. Bis zur Machtergreifung Hitlers hatten wir zwei Dienstmädchen, die bei uns wohnten und meiner Mutter in der Küche, im Haushalt und mit den Kindern halfen. Von uns wurde als Gegenleistung für die elterlich Fürsorge erwartet, dass wir in der Schule unser Bestes gaben, mit guten Noten heimkamen und auch in unserem Betragen zu Klagen keinen Anlass gaben. In unserem Haus herrschte eine Atmosphäre von Wärme und Geborgenheit.
* Der Hausluftschutzwart leitete die unmittelbar vor Ort notwendigen Maßnahmen zur Schadensbekämpfung
3. Das Ende einer Welt – Hitler an der Macht
Einleitung
Wie Hitler, für die Juden das Böse schlechthin, innerhalb einer demokratischen Gesellschaftsordnung Mitglied der Regierung werden konnte, ist in unzähligen Büchern nachzulesen. Das Einzige, was ich hier erwähnen möchte, ist die Tatsache, dass die NSDAP bei den letzten demokratischen Wahlen, bei den Reichstagswahlen vom 6. November 1932, nicht mehr als 33,1 Prozent der Stimmen erreichte. Wie es Hitler, nachdem er einmal zum Reichskanzler ernannt worden war, im Handumdrehen gelang, die absolute Macht an sich zu reißen, ist ebenfalls ein Kapitel für die Geschichtsbücher*. Im Folgenden beschränke ich mich darauf, die Reaktion unserer Familie auf diese bedrohliche Entwicklung zu schildern.
Auswirkungen auf meine Familie
Die Grundeinstellung meiner Eltern war, dass sie sich – mit Recht – als gute Deutsche fühlten. Deutschland war ihre Heimat, für die sie alles eingesetzt hatten, was sie besaßen: ihre Gesundheit und ihr Leben. Daher war ihre Haltung gegenüber den politischen Ereignissen ambivalent. Einerseits waren sie optimistisch und hofften, dass dieser Scharlatan, Hitler, sehr bald entlarvt werden würde, andererseits gab die Erinnerung an die Zeiten, bevor die fast vollständige Emanzipation der Juden in der Weimarer Republik verwirklicht worden war, durchaus auch Anlass zur Sorge. Hinzu kam, dass schon am 1. April 1933 jüdischen Anwälten der Zugang zu den Gerichtsgebäuden verwehrt wurde5, eine Maßnahme, die später übrigens wieder aufgehoben wurde.
An einen anderen einschneidenden Vorfall erinnere ich mich noch gut, der meine Eltern und besonders meinen Vater tief traf. Er war mit Leib und Seele Jurist, er glaubte heilig an eine gewissenhafte Rechtsprechung. Einer seiner Brüder war 1934 von einem Kollegen, der es auf seine Stelle als Abteilungsleiter in einem Warenhaus abgesehen hatte, bei der Gestapo denunziert worden. Er hätte in einer Kneipe einen abfälligen Witz über Hitler erzählt. Es kam zu einem Prozess in Leipzig, den mein Vater von der Zuschauertribüne aus noch verfolgen konnte. Mein Onkel, ein hoch dekorierter Kriegsveteran, der vier Mal an der Westfront verwundet und mit dem Silberen Verwundeten Abzeichen und dem Eisernen Kreuz Erster Klasse ausgezeichnet worden war, wurde zu mehreren Jahren im Konzentrationslager Dachau verurteilt. Als mein Vater von diesem Prozess, der jedem Rechtsempfinden Hohn sprach, nach Hause kam, war er am Boden zerstört. Er hatte das Vertrauen in den Rechtstaat verloren, und ihm war die wahre Natur des Regimes – jedoch noch nicht dessen Dauerhaftigkeit – deutlich geworden.





























