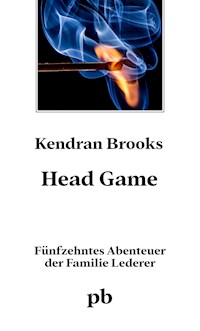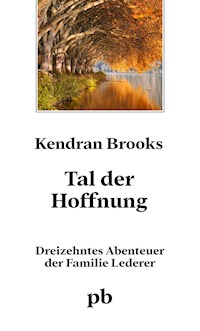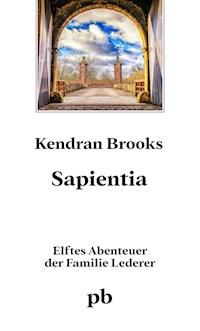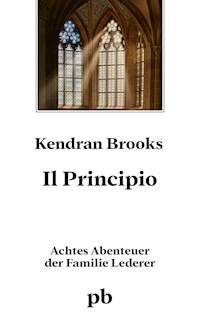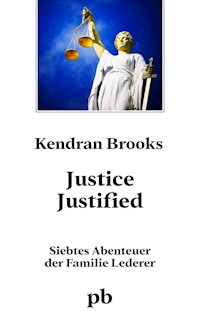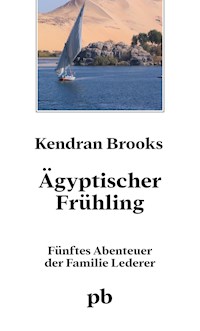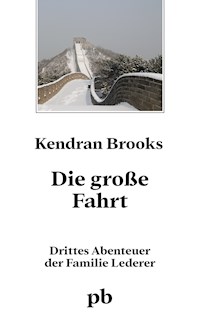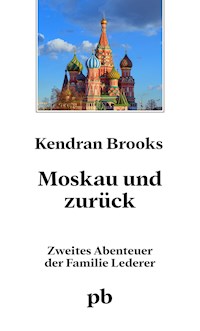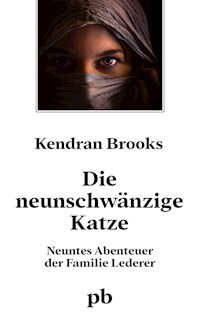Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Shamee Ling versucht sich in Kalifornien ein neues Leben aufzubauen. Doch reicht Ehrgeiz dazu aus? In Indien begeben sich Jules und Henry auf eine Safari. Löwen sollen fotografiert werden. Stattdessen wird ein Tiger entfesselt. Derweil plagt sich in Rio de Janeiro Zenweih Ling mit finanziellen Sorgen herum. Hochs und Tiefs eines Unternehmers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kendran Brooks
Das entzweite Herz
14. Abenteuer der Familie Lederer
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorgeschichte
Die Leichtigkeit des Seins
Wer will noch mal?
Nur nicht unterkriegen lassen
Trau, schau wem
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr
Der Krug geht zum Brunnen. Und wenn er nicht bricht?
Unten durch bedeutet keineswegs unten bleiben
Aufbruch. Doch wohin?
Impressum neobooks
Vorgeschichte
»Ich musste es tun«, sagte der Mann um die dreißig und wirkte auf den Sheriff des Santa Cruz County äußerst verwirrt, wie er mit sich selbst ringend vor ihm stand und von einem Fuß auf den anderen trat. Klatschnass klebten ihm die pechschwarzen Haare am Schädel, fast wie die Gummihaut eines Taucheranzugs. Er trug einen dunkelbraunen, völlig durchweichten Cord-Anzug, ein kariertes Hemd mit roter Krawatte. Kein Stadtmensch, eher ein zurechtgemachter Farmer. Seine Hosen waren hoch bis zu den Knien mit Dreck bespritzt, die Schuhe voller Lehmklumpen. Sie hatten eine Schlammspur von der Eingangstür bis vor den Schreibtisch des Sheriffs gezogen.
»Martha wird sich bestimmt wieder bei mir beschweren«, dachte Sheriff Oliver McFlinton missmutig an seine Reinigungskraft, mit der er sich seit vielen Jahren immer wieder zankte, über den vereinbarten Umfang der Putzarbeiten im Office und die angeblich viel zu geringe Bezahlung. Gleichzeitig mit dem Bild der griesgrämigen Martha vor Augen musterte McFlinton weiterhin den nervösen Besucher, mit ähnlicher Skepsis und Reserviertheit wie sein Deputy Steven Muller. Der stand am Aktenschrank und hatte gerade in einer der Schubladen nach den Unterlagen zu einem Einbruchdiebstahl von vergangener Woche im Drugstore gekramt, als der Mann ins Office gestolpert kam. Muller hatte seinen Kopf zum Besucher umgedreht. Seine Hände ruhten immer noch in der Schublade.
»Setzen Sie sich erst einmal hin«, begann Sheriff McFlinton umgänglich-freundlich und deutete auf den Stuhl vor seinem Pult. Doch der Dreißigjährige reagierte weder auf die Worte noch auf die Geste des Gesetzeshüters, starrte mit stechendem Blick durch den Sheriff hindurch und wiederholte murmelnd: »Ich musste es tun.«
»Bitte«, die Stimme von Oliver McFlinton hatte sich ein wenig erhoben und bereits den zwingenden Tonfall eines lang gedienten Gesetzeshüters angenommen, der wusste, wie man mit Menschen in Ausnahmesituationen umging. In der Regel war diese Art der Anrede für jeden, ob Beschuldigter oder Zeuge, ein ausgesprochen guter Grund, ohne jeden Widerspruch McFlinton zu gehorchen. Denn auch wenn der alte Sheriff längst die siebzig überschritten hatte, so galt er bei den Einwohnern im Land weiterhin als Eisenfresser und höchster Garant für Recht und Ordnung. Die meisten Menschen im Santa Cruz County liebten und verehrt ihn, die wenigen anderen fürchteten ihn zumindest.
Auf der Straße begrüßten die Leute den in die Jahre gekommenen McFlinton nur mit »Good morning, Olly« oder »How are you today, Olly?«, denn der Gesetzeshüter gehörte genauso zu ihnen und zu diesem Land wie jeder Hügel und jedes Haus. Die Jugendlichen allerdings, die sprachen meistens nur vom »ollen Olly«, zumindest wenn der Polizeibeamte außer Hörweite war. Dieses »olle« war aber keineswegs abwertend gemeint, ganz im Gegenteil. Sie sprachen es fast ehrfürchtig aus.
Richtiggehend berühmt wurde der Sheriff in den 1980ern, als er ganz auf sich allein gestellt hinter zwei gefährlichen Bankräubern herfuhr und sie nach einer wilden Verfolgungsjagd in der mexikanischen Wüste stellte. Den einen erschoss er in Notwehr und den anderen brachte er schwer verletzt aber lebend über die Grenze zurück in die Stadt. Die beiden Verbrecher hatten bei ihrem Raubzug auf die Credits & Loans Amado den Kassierer erschossen, für weniger als 20´000 Dollar Beute. Der überlebende Bankräuber wurde später wegen Mord ersten Grades zum Tod verurteilt und hingerichtet. Diese Geschichte lag nun zwar schon mehr als drei Jahrzehnte zurück, hatte dem alten Eisenfresser seitdem aber stets die Wiederwahl gesichert.
»Verbrechen müssen gesühnt werden...«, war einer seiner Standardsätze, die er sich seit seinem Antritt als junger Deputy zu Eigen gemacht hatte. Und jeder im Santa Cruz County konnte den zweiten Teil des Satzes fast im Schlaf hersagen, »...Aug um Auge, Zahn um Zahn, egal, wer es auch ist, das ist nur gerecht und darum richtig.«
Mit der strikten Auslegung des Gesetzes bekundete Sheriff McFlinton allerdings große Mühe. Jugendliche Straftäter setzte er beispielsweise lieber im kommunalen Straßenunterhalt ein oder schickte sie für ein paar Tage auf eine nahe Ranch als Hilfskraft, führte sie nur selten vor einen Richter. Denn ein weiterer seiner Sprüche lautete: »Wer faul im Käfig sitzt, wälzt keine guten Gedanken.«
Auch dafür liebten ihn die Bewohner.
Immer noch stand der etwa dreißigjährige, schwarzhaarige Besucher nervös angespannt vor dem Pult von McFlinton und starrte gedankenverloren durch den Sheriff hindurch. Der alte Gesetzeshüter erhob sich missmutig ächzend von seinem hölzernen Bürosessel, den er von seinem Vorgänger übernommen hatte und der wohl noch mehr Jahre als der Sheriff zählte. Olly McFlinton ging ruhig um den Schreibtisch herum, fasste den Mann kurzerhand an den Schultern, schob ihn hinüber vor den Besucherstuhl und drückte ihn dort sanft, aber bestimmt auf die Sitzfläche hinunter.
»Und nun erzählen Sie mir Ihre Geschichte ... am besten von Anfang an«, fuhr er in einem beruhigend-versöhnlichen Tonfall fort, »wie heißen Sie?«
Endlich erwachte der Mann aus seiner Starre.
»Henry, ... Henry Shuffle«, antwortete er mit klarer Stimme und schaute dem Sheriff zu, wie der wieder hinter seinem Pult Platz nahm.
»Und woher kommen Sie?«
»Tyler, ... in Texas.«
McFlinton beugte sich etwas vor, legte die Unterarme aufs Tischblatt und betrachtete sich das Gesicht des Mannes eingehend. Der Dreißigjährige war nicht schlank, aber auch noch nicht fett. Sein Kinn fiel auffallend zurück, zeugte von wenig Willenskraft und mangelhaftem Durchsetzungsvermögen. Seine Nase war viel klein geraten, passte nicht in das recht breitflächige Gesicht. Einzig bemerkenswert waren seine Augen. Die dunkelbraunen Pupillen glühten fiebrig, so als beutelte den Mann eine starke Grippe, gleichzeitig war das Weiß drum herum rot geädert und entzündet, so als hätte der Besucher schon seit Tagen kein Auge mehr zugetan. Doch es fehlten die dunklen Ringe unter den Augen, was gegen jede Schlaflosigkeit sprach.
»Vielleicht eine Reizung? Durch Pfefferspray?«, mutmaßte der Gesetzeshüter in Gedanken, wie es seinem Berufsstand entsprach, »oder doch bloß Heuschnupfen?«
Der Mann wartete sichtlich nervös auf die nächste Frage des Sheriffs.
»Was genau meinten Sie vorhin mit, ich musste es tun?«
»Sie war besessen«, behauptete der Dreißigjährige und seine Augen glühten vor Abscheu und halbem Irrsinn auf, »Luzifer hielt sie in seinen Klauen gefangen.«
Olly McFlinton ruckte unruhig auf der Sitzfläche seines hölzernen Bürosessels herum, blickte kurz hinüber zu seinem Deputy. Der hatte sich nun vollends dem seltsamen Besucher zugewandt, beobachtete ihn und seinen Vorgesetzten gleichermaßen aufmerksam. Der Gesichtsausdruck von Steven Muller hatte sich allerdings von zuerst skeptisch-interessiert auf angespannt-lauernd gewandelt. Und auch der alte Sheriff fühlte bereits die Kälte, die sich im Raum auszubreiten schien, so wie immer, wenn McFlinton von einem Gewaltverbrechen ausgehen musste.
»Von wem sprechen Sie?«
Der Mann reagierte zuerst nicht, starrte erneut durch den Gesetzeshüter hindurch, sah wohl wiederum irgendwelche Bilder auf der Wand hinter dem Sheriff, an der die Karte des Santa Cruz County hing. Erst mit Verspätung zuckte Henry Shuffle doch noch zusammen und richtete seinen Blick wieder klar auf das Gesicht des Gesetzeshüters.
»Ich weiß nicht ... eine Anhalterin.«
McFlinton nickte seinem Deputy zu.
»Bring ihm doch eine Tasse Kaffee, Steven«, befahl er mit rauer Stimme seinem Mitarbeiter, »der Mann friert in seinen nassen Kleidern.«
Danach blickte er wieder den Besucher an, diesmal fest und eindringlich.
»Wer genau sind Sie, Henry Shuffle aus Tyler in Texas? Und was machen Sie im Santa Cruz County?«
Sein Tonfall hatte wiederum jede Schärfe verloren, klang geduldig und beinahe väterlich. Und der Dreißigjährige begann tatsächlich ruhig zu erzählen, von seiner Ehefrau und den beiden Kindern, einem achtjährigen Jungen und einem sechsjährigen Mädchen, auch von seinem neuen Job als Handelsreisender für Pumpen aller Art und dass er all die Farmen und Ranches im Süden der USA seit Wochen abklapperte. Er sprach ausführlich von der unvergleichlichen Hochwertigkeit der Produkte seines Arbeitgebers, über ihre Langlebigkeit und die günstigen Service-Verträge. McFlinton ließ ihn ohne Zwischenfrage reden.
Doch plötzlich zuckte der Mann heftig zusammen und hielt inne, schien sich endlich wieder an den Grund zu erinnern, warum er auf der Polizeistation in Amado erschienen war. Er sammelte sich noch einmal kurz, fuhr dann eher stockend fort, so als müsste er einen Film kommentieren, der sich vor seinem geistigen Auge langsam abspulte.
»Sie stand plötzlich da ... im strömenden Regen ... ohne jeden Schirm oder Mantel«, meinte er gedankenverloren, »... nass bis auf die Haut ... so wartete sie am Straßenrand ... aber auf wen? ... keine Ahnung ... sie hatte sich zu meinem sich nähernden Wagen umgedreht ... ihren Daumen ins Scheinwerferlicht gehalten ... ich hab selbstverständlich angehalten ... in einer solchen Nacht ... hab sie einsteigen und mitfahren lassen ... weiß eigentlich gar nicht wieso ... denn sie war noch nicht einmal besonders hübsch.«
Die letzte Bemerkung sprach er aus, als wäre damit irgendetwas erklärt. Doch der alte Sheriff fragte nichts, hörte dem Mann weiterhin geduldig zu. Nur sein Nussknacker-Kinn hatte sich verkantet, als er den letzten Satz mit dem »war« vernehmen musste.
»Der Teufel steckte in ihr«, behauptete der Fünfzigjährige erneut und sah den Gesetzeshüter verbittert, freudlos und fast verzweifelt an, »Luzifer höchst persönlich.«
Steven Muller schob einen Pappbecher mit Kaffee vor den Mann hin, trat leise wieder zwei Schritte zurück und blieb abwartend stehen, zeigte wiederum ein Lauern im Gesicht, eine Sprungbereitschaft, ähnlich einem Schäferhund, der den Ball fixierte, den sein Herrchen gleich werfen würde und nach dem er schnappen wollte.
»Weiter«, befahl McFlinton nun leise und doch drängend und mit einer gewissen Schärfe. Henry Shuffle fuhr murmelnd fort, so dass der Deputy seine Ohren spitzen musste und der alte Sheriff rasch den Lautstärkeregler an seinem Hörgerät hochdrehte.
Der Handelsreisende aus Texas schilderte, wie die junge Frau ihn gleich nach dem Einsteigen zu reizen begann, zuerst mit schmeichelnden Worten, dann auch mit entsprechenden Blicken und obszönen Gesten, wie er irgendwann die Landstraße verlassen hatte und auf die Zufahrt zu einer Farm abgebogen war. Rasch waren sich die beiden einig geworden, denn Satan hatte nicht nur sie, sondern auch ihn längst in seinen Klauen gefangen. Die junge Frau öffnete ihm die Hose und begann ihn oral zu befriedigen.
»Da erschien Gabriel und befahl mir, das Mädchen vor dem Teufel zu retten. Deshalb habe ich es getan. In seinem Auftrag.«
»Welcher Gabriel?«, warf Steve Muller irritiert ein. Der junge Deputy hatte sich auch in den vergangenen drei Jahren nie durch besondere Hellsichtigkeit oder Geistesgegenwart ausgezeichnet. McFlinton warf ihm einen verärgert-warnenden Blick zu.
»Erzengel Gabriel, selbstverständlich«, bekannte der Mann jedoch freimütig, sich kurz zum Deputy umwendend, »der Sendbote Gottes.«
»Und wo ist die junge Frau jetzt?«, fragte der alte Sheriff knapp.
»Ich weiß nicht. Immer noch in meinem Wagen.«
»Tot?«, fragte Steven Muller überflüssigerweise, diesmal jedoch in einem scharfen, anklagenden Tonfall.
Der Handelsreisende zuckte entschuldigend mit den Schultern: »Ich hab sie gewürgt, bis sie sich nicht mehr gerührt hat. Doch der Teufel steckte weiterhin in ihr drin. Ist nicht aus ihr gewichen. Das hab ich deutlich gespürt. Deshalb bin ich auch aus meinem Wagen gesprungen und zu Fuß hierher geflohen.«
Olly McFlinton erhob sich erneut aus seinem Stuhl, diesmal jedoch ohne jedes Ächzen oder Stöhnen, als hätte er in einer Sekunde zwanzig Altersjahre abgeschüttelt. Er nahm seinen Hut vom Haken und setzte ihn auf den Kopf.
»Kommen Sie«, befahl er dem Dreißigjährigen. Der stand sogleich folgsam auf, froh darüber, dass jemand die Sache tatkräftig in seine erfahrenen Hände nahm. Der alte Gesetzeshüter ging dem Mann voraus und trat aus dem Office, ließ ihn draußen in den Streifenwagen steigen, auf den Beifahrersitz.
»Soll ich mitkommen?« fragte Steven unnötigerweise. Er stand noch unter der offenen Tür. McFlinton nickte nur mit dem Kopf stumm in Richtung des zweiten Streifenwagens, setzte sich hinters Steuer des ersten und fuhr los. Muller beeilte sich, ihm zu folgen.
Das Auto des Handelsreisenden fanden sie wenige Meilen außerhalb von Amado, ebenso die Leiche der zwanzigjährigen Ellie Carson auf dem Beifahrersitz.
Ellie hatte noch bei ihren Eltern auf der nahen Farm gelebt, wie McFlinton wusste. Doch schon mit sechzehn Jahren galt sie in ganz Amado als ein überdrehtes und ausgesprochen leichtsinniges Ding. Der alte Gesetzeshüter wusste, dass die junge Frau in den letzten vier Jahren mit unzähligen Jungs aus dem Santa Cruz County geschlafen hatte. Wahrscheinlich war sie nie richtig im Kopf gewesen, nicht einfach nur wild und ungestüm, sondern mental gestört, irgendwie krank. Denn sie schien kein einziges Mal eine längere oder gar feste Beziehung gesucht zu haben, sondern stets bloß das nächste Abenteuer, einen weiteren Kick, das besondere Kribbeln im Bauch vor dem noch Unbekannten. Nun war ihr diese Sucht zum tödlichen Verhängnis geworden. Armes, junges Ding.
Steven Muller sprach ins Funkgerät, forderte die Spurensicherung aus Tucson an. Währenddessen führte Sheriff McFlinton den apathisch wirkenden Henry Shuffle zurück zu seinem Streifenwagen und ließ ihn erneut auf der Beifahrerseite einsteigen. Dann verabschiedete er sich von seinem Deputy kurz und stumm, mit einem knappen Anheben seines Kinns. Muller würde diesmal wissen, was zu tun war, den Tatort absperren und auf das Eintreffen der Kollegen aus Tucson warten.
McFlinton fuhr mit dem Handelsreisenden direkt nach Nogales, zum Verwaltungssitz des Santa Cruz County. Dort würde man dem Mann seine Rechte vorlesen und ihn wegen Mordverdacht festnehmen, danach erkennungsdienstlich behandeln und Spuren sichern, ihm auch alle gefährlichen oder gefährdenden Dinge abnehmen und anschließend in eine Zelle sperren, wahrscheinlich auch psychologisch betreuen.
Verbittert saß der alte Sheriff hinter dem Steuer des Streifenwagens, zeigte sein hartes, unbewegliches Nussknackergesicht, dachte an den schweren Gang, der ihm in wenigen Stunden bevorstand, wenn er Sally und Mike von der Ermordung ihrer jüngsten Tochter Ellie berichten musste. Die beiden würden ihn bestimmt vor der Haustür zu ihrer Farm erwarten, sobald sie seinen Wagen sich nähern hörten, würden ihn mit bangen Augen anstarren, ihn mit im Hals stockenden Worten in die Wohnstube bitten und ihm einen Stuhl am Esstisch anbieten, sich zu ihm setzen, ihn dabei immer noch fragend und forschend anschauen und doch längst schon die allergrößte Furcht vor dem verspüren, was er ihnen gleich erzählen musste.
Sally würde laut und hysterisch aufschreien und gleich danach schluchzend und weinend am Tisch zusammenbrechen. Und Mike würde seine riesigen Hände zu kneten beginnen und ihn gleichzeitig ausfragen, jede Kleinigkeit über den Tathergang und den Mörder wissen wollen. Die Wut würde sich beim Farmer dabei immer weiter steigern und ihn irgendwann zornig aufspringen und laut fluchen lassen, dass man ihm diesen verdammten Mörder aus Tyler nur für eine einzige Minute überlassen sollte, damit er ihn in der Luft zerfetzen konnte. Und dann würde auch dieser Hüne von Mann schluchzend zusammenbrechen, zurück auf seinen Stuhl fallen und sein haltlos weinendes Gesicht voller Verzweiflung und Not und auch Scham hinter seinen Pranken verbergen.
Ja, die Fahrt hinaus zur Carson Farm am frühen Morgen würde dem alten Sheriff sehr schwerfallen. Aber er würde auch diese Pflicht getreu erfüllen, so wie er all die Jahre zuvor stets seine Pflicht tat, unerschütterlich und ohne zu wanken.
»Verbrechen müssen gesühnt werden, Aug um Auge, Zahn um Zahn, egal, wer es auch ist, das ist nur gerecht und darum richtig.«
Dieser dreizehnte Mord in seinem County während seiner langen Amtszeit war auch nicht schrecklicher, verwerflicher oder gar sinnloser als die anderen zwölf Bluttaten zuvor. Trotzdem konnte Olly McFlinton den neben ihm immer noch apathisch sitzenden Täter nicht mehr anblicken, vermochte auch kein Wort an ihn zu richten, spürte in seinem Innersten nur den ständig wachsenden Drang, nach rechts an den Straßenrand zu lenken, dort anzuhalten, den verrückten Mädchenmörder aus seinem Wagen zu zerren, ihn den Abhang hinunter zu stoßen und ihn dort wie einen tollwütigen Kojoten abzuknallen.
Nein, McFlinton blieb mit dem Fuß auf dem Gaspedal, lenkte auch nicht nach rechts, fuhr einfach immer weiter Richtung Nogales, sah dabei stur geradeaus und auf die Fahrbahn vor sich, dachte manchmal an den bevorstehenden schweren Gang zur Carson Farm und wie er Sally und Mike vom Tod ihrer leichtsinnigen und doch so lebenslustigen Ellie berichten musste.
Die Leichtigkeit des Seins
Großvater Mao Ling war vor mehr als sechzig Jahren nach Brasilien ausgewandert, hatte wie ein Sklave geschuftet, zuerst um die teure Passage und die illegale Einreise abzustottern, später, um sich den Traum vom eigenen Restaurant zu erfüllen. Sein Lokal lief von Beginn an sehr gut, mit der Zeit immer besser. Er eröffnete zwei weitere, genoss den langsam anwachsenden Wohlstand, war stolz auf sich und sein Lebenswerk.
Sein Sohn Zenweih baute später zusammen mit seiner Frau Sihena die immer noch eher bescheidenen Anfänge zu einer großen Kette von erstklassigen China-Restaurants aus. Die Lings wurden in der Folge richtiggehend reich, zumindest für brasilianische Verhältnisse. Ihre Kinder wuchsen im Luxus auf, mit Koch, Zimmermädchen, Gärtner und Chauffeur. Die Söhne und Töchter der Lings gehörten von Beginn weg zur lokalen Highsociety von Rio de Janeiro, kannten nur andere, wohlhabende Jugendliche, wuchsen abseits all des Drecks und der Gewalt der Millionenmetropole auf, hinter hohen Mauern und auf Privatschulen.
Die jüngste Tochter der Lings hieß Shamee und war gerade neunzehn geworden. Doch schon mit sechzehn Jahren hatte sie nicht mehr allzu viele Freundinnen gekannt. Denn Shamee war immer schon ziemlich eingebildet gewesen, fühlte sich als etwas ganz Besonderes. Sie machte es anderen Menschen nicht einfach, sie zu mögen.
Ohne Frage war sie hübsch, zumindest niedlich, selbst wenn sie als chinesisch-stämmige Brasilianerin doch eher klein geraten war, im Vergleich zu ihren Altersgenossinnen mit europäischer Abstammung. Auch ihr Gesicht konnte man als recht hübsch bezeichnen, war aber weit entfernt von schön oder gar edel. Sie war zwar schlank und auch recht sportlich, doch ihre Unterschenkelknochen wiesen eine etwas starke Biegung auf und verliehen ihr so die typischen leichten X-Beine einer Asiatin, entsprachen damit keineswegs dem Idealbild im Land. Doch mit einer entsprechenden Körperpflege, teuren Kleidern und Schuhen, etwas Schmuck und möglichst arrogantem Auftreten ließen sich solche geringen körperlichen Mängel problemlos überspielen. Ganz anders ihr arrogantes Wesen. Da half auch kein noch so teures oder dickes Make-Up.
Shamee war gerade sechzehn geworden, als sie einen ersten, großen Knacks in ihrem bis dahin so komfortablen Leben erfahren musste und einen richtigen Schock erlitt. Sie war allein in der Stadt unterwegs gewesen und probierte in einer Mode-Boutique gerade ein paar Kleider an, als sie von drei jungen Männern angegriffen wurde. Mit großer Wahrscheinlichkeit wollte man sie vergewaltigen, vielleicht auch entführen oder sogar ermorden. Nur knapp entkam Shamee damals ihren Verfolgern, rannte voller Panik den ganzen langen Weg zu Fuß zurück nach Hause, kam dort aufgelöst und tränenüberströmt an, wurde jedoch von ihrer Mutter derart kühl und lieblos empfangen, dass sich Shamee seither fragte, ob nicht Sihena hinter dem bösartigen Anschlag in der Boutique steckte. Denn an einen Zufall mochte die Sechzehnjährige nicht glauben. Zu zielstrebig waren die drei Männer vorgegangen, hatten auch nur sie als Opfer ausgesucht und ohne zu zögern angegangen. Das konnte kein böser Zufall gewesen sein. Das war ein klarer Auftrag. Die Frage für sie lautete nur, ob eine neidische Konkurrentin oder aber ihre eigene Mutter dahintersteckte.
Shamee fühlte sich nach diesem Erlebnis von allen im Stich gelassen, verfolgt, verraten und durch die eigene Familie bedroht. So riss sie von zu Hause aus, floh zu einem wohlhabenden Bekannten, den sie ein paar Wochen zuvor auf einer Party kennengelernt hatte. Doch der Mann war Porno-Produzent aus Florida. Das erfuhr Shamee in dessen Villa in Miami, verbrachte dort trotzdem mehrere Wochen, zusammen mit einem ganzen Stall voller ähnlich leichtlebiger Mädchen, die den Luxus liebten und nach irgendeiner Karriere gierten. Die chinesisch-stämmige Brasilianerin genoss das freie Leben unter Gleichgesinnten, freundete sich auch rasch mit den meisten Mädchen an, kehrte erst nach mehreren Monaten in die alte Heimat und in den Schoss ihrer Familie zurück.
Ihre Eltern machte ihr damals kaum Vorwürfe, zumindest keine direkten, waren froh, ihre Jüngste wieder zu haben. Doch Shamee Ling war nicht mehr das Nesthäkchen von einst, hatte ihre Unschuld endgültig verloren, fühlte sich deshalb auch von allen beobachtet und sogar kontrolliert. Denn die Sechzehnjährige erzählte nichts über ihre Zeit in Florida oder was sie wochenlang getrieben hatte. Ihre Geschwister und auch die Eltern vermuteten zuerst eine Drogensucht, beobachteten Shamee deshalb auf Schritt und Tritt, engten sie mit ihrem Misstrauen immer mehr ein. So jedenfalls empfand die Rückkehrerin zunehmend. Deshalb floh sie wenig später erneut aus Rio de Janeiro, kehrte zurück nach Florida und in die Villa des Porno-Produzenten, verdingte sich dort zuerst als Party-Girl und Edelhure, landete nach einigen Monaten in einem der schlimmsten Bordelle in Mexico City, war dorthin wie eine Stück Fleisch verkauft worden. Man hielt sie als Sex-Sklavin gefangen, fern der Heimat und über viele Monate hinweg ohne jede Kontaktmöglichkeit zu ihren Eltern. Doch irgendwann erfuhr die Familie vom Schicksal der jüngsten Tochter und man befreite sie aus den Fängen der Bordellbetreiber.
Geschändet und bar aller Illusionen kehrte Shamee nach Rio de Janeiro zurück. Sie wohnte wieder in ihrem alten Kinderzimmer, umgeben von Familie, wenigen Bekannten, einigen Dienstboten und sehr vielen Schuldgefühlen. Nicht so sehr gegenüber ihren Eltern oder Geschwistern, sondern nur gegenüber sich selbst.
Nein, sie wollte sich auch nach den schlimmen Erfahrungen in Mexiko nicht den elterlichen Zwängen fügen, traute zudem weiterhin ihrer Mutter Sihena das Allerschlimmste zu, spürte auch das ständige Misstrauen ihres Vaters Zenweih und ihrer Brüder und Schwestern.
Im Bordell in Mexico City hatte sie oft Selbstmordgedanken gehegt, machte gar den einen Versuch sich umzubringen. Doch nun, zurück in Brasilien, da spürte sie diese persönliche Niederlage immer seltener. Denn auch miese Erinnerungen verblassten, wenn auch oft nur langsam. Nein, sie würde nicht vor all den Schrecken dieser Welt kapitulieren. Denn sie war immer noch Shamee Ling, eine ziemlich hübsche, chinesisch-stämmige Brasilianerin, mit dem Feuer einer jungen Draufgängerin und den dreckigen Erfahrungen einer verdammten Hure, stark genug, um selbst dem Teufel ins Auge zu spucken.
Aber was sollte sie mit ihrem noch so jungen Leben anfangen?
Sie hatte bislang keine Ausbildung und kein Studium begonnen, ja noch nicht einmal die Schule auf höchstem Niveau abgeschlossen. Niemand brauchte sie. Niemand wollte sie.
Ihre Eltern, Zenweih und Sihena, schlugen ihrer jüngsten Tochter vor, doch ins Restaurant-Business einzusteigen. Shamee hatte es daraufhin auch wirklich versucht, war ein paar Tage lang mit ins Büro gefahren, hatte sich alles erklären lassen, tippte brav Bestellungen ein und hakte Lieferscheine ab. Die ganze Zeit über fühlte sie sich jedoch wie eingesperrt, nein, eher wie weggesperrt, so als hätte man sie bei lebendigem Leib begraben.
Sollte das tatsächlich alles sein? Dieser jämmerliche Bürokram? Lesen, Schreiben, Rechnen? Wie in der Schule? Das war doch kein Leben?
Wo blieben die Herausforderungen? Die Abenteuer? Wo zum Teufel lagen in diesem Alltagstrott die Bewährungsproben, die doch erst echte Würze in jedes Leben brachten?
Shamee hielt es keine zwei Wochen aus, setzte sich dann mit ihrem Vater Zenweih zusammen, schilderte ihm ihre negativen Gefühle, die er weder verstand noch akzeptieren wollte. Stattdessen sprach er von Durchsetzungsvermögen, vom Ausharren, vom inneren Schweinehund, den es zu überwinden galt.
Doch wozu?
Um einen noch günstigeren Lieferanten für Sojasprossen ausfindig zu machen? Sich eine neue Sorte Nudeln für die Suppen auszusuchen? Oder den Preis von einem Kilogramm Schweinefleisch, um einen weiteren Real zu drücken?
Ihr Vater freute sich tatsächlich über solch banale Dinge. Für Shamee waren sie hingegen nur Graus und Pein, eine Demütigung ihres Intellekts und Folter für ihre großen Ambitionen.
Denn sie wollte frei sein.
Endlich wieder frei sein.
Fast bedauerte sie, aus der Zwangsprostitution geholt worden zu sein, nur um in die Enge ihrer Familie zurückzukehren und in ein ödes Leben ohne Illusionen gestoßen zu sein. Gab es denn keinen anderen Weg für sie? Nur diese fortwährenden Zwänge?
Ihre Mutter Sihena wollte ebenfalls nichts von ihrer Abscheu für die Büroarbeit wissen, schrie sie stattdessen an, bezeichnete sie als ein unflätiges und unnützes und undankbares Ding, verabreichte ihr sogar im Zorn eine schallende Ohrfeige, diese dämliche, verrückte Ziege.
Wenn es nach Sihena gegangen wäre, Shamee hätte sich möglichst bald irgendeinen reichen Schnösel als Ehemann angeln müssen, ihn bezirzen und rasch heiraten sollen.
War das etwa ihr Lebenszweck?
Den Eltern nicht mehr auf der Tasche liegen?
Nein, sie würde sich unter keinen Umständen an irgendeinen blasierten Erben hängen, sich ihm unterordnen, nur um im Gegenzug ein bequemes Leben zu erhalten und finanziell versorgt zu sein. Sie mochte aber genauso wenig weiterhin unter der Fuchtel ihres Vaters stehen, für das bisschen Taschengeld, das der ihr im Austausch zu ihrem öden Job bezahlte. Oder erneut die Schulbank drücken? Danach studieren, so wie alle ihre älteren Geschwister? Nein. Unmöglich. Geradezu absurd, nach all den gesammelten Lebenserfahrungen in Miami und Mexico City.
Und anderswo arbeiten? Irgendwo in Rio de Janeiro? In einer Boutique oder einem Kosmetik-Institut? Wo sie im Job jederzeit mit früheren Freundinnen oder auch nur guten Bekannten zusammentreffen konnte? Nein danke. Nie im Leben. Sie hätte unweigerlich ihr Gesicht verloren, hätte vor Scham im Boden versinken müssen.
So formte sich der Plan in ihrem Kopf, ihre Heimat erneut zu verlassen, wiederum in Richtung USA. Denn nur dort glaubte sie, Freiheit und unbegrenzte Möglichkeiten für sich zu finden. Aber diesmal wollte Shamee nicht einfach der Familie entfliehen, sondern offen ihren Wunsch vortragen und mit dem Segen der Eltern abreisen, um so wenigstens etwas Geld mit auf den Weg zu bekommen. Denn ohne alle Mittel für einen Neustart musste man in jedem Land ganz unten beginnen, konnte sich auch nur sehr mühsam auf eigene Beine stellen. Und das wollte sich Shamee auf keinen Fall antun. Dafür war sie sich dann doch zu schade.
Ihr Vater Zenweih hörte ihr diesmal geduldiger zu, versuchte sie zwar erneut umzustimmen, lenkte dann aber überraschend schnell ein und gab ihren Plänen seinen Segen. Er hatte eingesehen, dass seine Jüngste hier in Brasilien, zumindest im Moment, nicht mehr glücklich werde konnte. Und so floh Shamee tatsächlich erneut und zum dritten Mal aus Rio de Janeiro, doch diesmal mit ein paar Tausend Dollar vom Vater in der Tasche und dem Segen zumindest der Hälfte ihrer Familie.
San Francisco war diesmal ihr Ziel. Sie kannte die Stadt am Pazifik zwar noch nicht, hatte aber von ihr gehört, über sie gelesen und in Fernsehberichten und im Internet viele Dinge erfahren. San Francisco war das Tor zum Silicon Valley und deshalb hip und modern, aufgeschlossen allem Fremden und Exotischen gegenüber, eine internationale Metropole, vielschichtig und multi-kulti, wie man sie in ganz Südamerika nirgendwo vergleichbar fand.
So dachte Shamee zumindest oder stellte sich die Stadt des Heiligen Franz von Assisi vor.
Als sie das Flugzeug auf dem Internationale Airport Galeão bestiegen hatte, als die Boeing wenig später die Andockstation verließ und in Richtung Startfeld rollte, da war es Shamee Ling dann doch ein klein wenig Bang im Herzen. Nicht wegen der Fremde, in die sie eintauchen sollte. Auch nicht wegen ihren Verwandten und den wenigen Freunden, die sie in Brasilien zurückließ. Doch die junge Frau spürte, dass diesmal die Trennung endgültig war. Sie würde nicht mehr nach Rio de Janeiro und in den Schoss ihrer Familie zurückkehren können und alle bisherigen Kapitel ihres noch jungen Lebens schlossen sich mit dem Abheben des Flugzeugs für immer. Ihre alte Heimat hörte auf für sie zu existieren. Sie musste sich eine neue erobern.
So entfloh Shamee nicht nur ihrer Kindheit und ihrer Rolle als Tochter einer wohlhabenden Familie, sondern ebenso aus ihren bisherigen Ansprüchen als Glamour-Girl der lokalen Highsociety. Sie wollte sich ehrlich beweisen, als Mensch, als Frau, als Persönlichkeit. Selbst wenn sie fast bei null beginnen musste, so fühlte sie sich in diesem Moment bereit dazu.
Doch was wollte sie in San Francisco überhaupt anstoßen und unternehmen?
Ihrem Vater hatte sie von einem bescheidenen Leben in der Fremde vorgeschwärmt. Nur so könnte sie zur Ruhe kommen und sich selbst finden. Irgendeine Chance würde sich bestimmt irgendwo für sie auftun, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Die große Skepsis des Vaters blieb selbstverständlich bestehen. Doch Zenweih tröstete sich mit dem Gedanken, seine Tochter würde schon nach wenigen Monaten in die alte Heimat zurückkehren, spätestens wenn ihr Reisegeld restlos aufgebraucht war. Denn dass seine Jüngste für ihren Lebensunterhalt arbeiten wollte, das traute er ihr weiterhin nicht zu.
Für Shamee war die Trennung vom Elternhaus aber endgültig. Das spürte sie nicht nur. Das verlangte sie auch von sich selbst. Doch nun, so ganz allein im Flugzeug sitzend, fragte sie sich das erste Mal ganz ehrlich, was sie denn in dieser ihr noch wenig bekannten Stadt mit sich anfangen sollte? Auf welche Weise ihren Unterhalt bestreiten? Erfolgreich werden?
Bislang war ihr noch nichts Konkretes in den Sinn gekommen, hatte sie noch keine Pläne zur Hand, was sie freimütig vor sich selbst zugab. Doch war sie nicht jung, hübsch und sprach neben Portugiesisch auch Spanisch und Englisch fließend? Konnte sich in einer entsprechenden Gesellschaft gewählt ausdrücken und sich vornehm geben? Und hatte sie nicht tausende von Einfällen, mit denen sie bestimmt irgendwie punkten konnte?
»Es wird schon«, sprach sie sich leise und auf Englisch guten Mut zu, räkelte sich im Sessel der Business Class zurecht und bestellte sich bei der Flugbegleiterin ein Glas Champagner.
»Das Leben ist schön«, sagte Shamee Ling wenig später als Trinkspruch zu sich selbst, in Anlehnung an einen italienischen Kinofilm, den sie vor Jahren gesehen hatte. Der hatte zwar kein gutes Ende gefunden, zumindest nicht für die Hauptfigur. Doch diesen Umstand verdrängte sie einfach, stellte sich ihre Zukunft stattdessen blendend vor, gab sich ganz diesem warmen, wohligen Gefühl hin.
Shamee nahm einen langen Schluck aus dem Glas, spürte das Prickeln in Mund und Rachen, fühlte, dass ihr Leben von nun an immer so sein würde. Prickelnd und aufregend, lustvoll und wunderbar.
»The Taste of Live«, sagte sie leise zu sich selbst und lächelte verträumt, ohne aber bestimmte Bilder vor ihrem geistigen Auge zu sehen, nur in unbestimmten Gedanken und warmen Gefühlen schwelgend, »The Taste of Live.«
Sie musste eingenickt sein, irgendwann während des langen Fluges, wurde erst von der Ansage aus dem Cockpit kurz vor der Landung geweckt, blickte sich verwirrt um, setzte sich dann zurecht, fuhr mit den Handflächen kurz durch ihr hübsches Gesicht, zog wenig damenhaft die Nase hoch. Niemand nahm von ihr Notiz.
Sie reiste als Touristin in die USA ein, so als hätte sie vor, schon in wenigen Wochen das Land wieder zu verlassen. Sie hatte nur genug Geld für zwei oder drei Monate dabei, führte auch nicht allzu viel Gepäck mit sich, um ja nicht aufzufallen und bei den Einwanderungsbeamten Misstrauen zu wecken. Grenzkontrolle und Zoll waren so rasch überwunden. Gutgelaunt zog sie den Rollkoffer hinter sich her, quer durch die Ankunftshalle und durch eine der automatischen Türen hinaus auf den Bordsteig. Warme, schwüle Luft schlug ihr entgegen. Shamee roch Benzin, Teer und fettiges Fast-Food.
Es schmeckte einfach köstlich aufregend.
Als sie sich vor dem Airport-Terminal in die Schlange vor dem Taxistand eingereiht hatte, da spürte sie das erste Mal eine innere, starke Regung, ein ausgesprochenes Glücksgefühl, so als wäre sie in diesem Moment bereits in ihrer neuen Heimat angekommen. Denn all die Leute rings um sie herum waren so ganz anders geartet als die Menschen in Brasilien, wie ihr nun schien, wirkten viel geschäftiger, gleichzeitig weitaus cooler und wesentlich zielorientierter und bestimmter.
»If I am making there, I make it everywhere«, sang sie sich unhörbar für andere vor und verspürte dabei ein unglaublich warmes Gefühl im Herzen und einen echten Adrenalinschub voller Glück im Gehirn.
Sie ließ sich zu einem günstigen Motel in Oakland fahren, in dem sie sich schon von zu Hause aus übers Internet ein Zimmer gebucht hatte, vor allem auch wegen der Migrationsbehörde, die bei der Grenzkontrolle nach der Wohnadresse in den USA fragte. Dort stieg die junge Brasilianerin chinesischer Herkunft tatsächlich für die ersten zwei Wochen auch ab. Danach wechselte sie in die Innenstadt, zu einem weitaus teureren Bed & Breakfast, wohnte dort fast wie eine weitere Tochter der taiwanesischen Vermieterin.
Shamee erkundete in dieser ersten Zeit ausführlich die Stadt, sprach mit hunderten von Leuten, forschte nach Chancen für sich selbst, nach interessanten Jobs, vielleicht sogar im aufregenden Silicon Valley? Doch was sollte sie dort überhaupt tun? Inmitten all der Computer-Nerds? Die meisten von ihnen waren doch zum Gähnen langweilig, hatten nur ihre kleinen Programme im Kopf. Nein, das war nichts für sie. Weder menschlich noch finanziell. Denn was hätte sie dort auch arbeiten und leisten können? Keine ihrer tausend Ideen passte dorthin. Aber auch sonst schien eigentlich keiner der Einfälle Hand und Fuß zu besitzen. So kam es ihr zumindest vor, nun, da sie ihre Einfälle mit der Wirklichkeit einer Großstadt in den USA abglich, wo bereits zehntausende junger Menschen nach ihren ganz persönlichen Chancen im Leben suchten.
Ihr Geld ging auch weitaus rascher zu Ende, als sie es sich vorgestellt hatte. Die Kleider-Boutiquen und Schuhgeschäfte hatten es ihr am Anfang zu sehr angetan. Und so landete sie bereits in der sechsten Woche nach ihrer Ankunft in einem billigen, winzigen Apartment in einem Industrie- und Gewerbegebiet und arbeitete in einer der zahllosen Sandwich-Buden, die nach den individuellen Wünschen ihrer Kundschaft Brote schmierten und XXL-Becher mit Softdrinks füllten. Doch ihre Arbeit am Tresen gefiel Shamee ganz gut. Man traf jeden Tag neue Leute. Manche von ihnen waren nett oder hübsch, andere sogar interessant, die meisten allerdings eher zum Würgen und Kotzen. Und doch war da ständig ein gewisser, wenn auch unbestimmter Drive zu spüren, eine Good Vibration, die von dieser Stadt und all ihren Bewohnern ausging.
Hing dieses Gefühl vielleicht mit dem Wetter zusammen, das hier an der Pazifikküste abwechslungsreicher als anderswo in den Staaten ausfiel? Oder an der ständig frischen Brise, die vom Ozean heran wehte? Auch die Millionen von Touristen mochten ihren Teil dazu beitragen, genauso wie die Internet-Milliardäre und Garagen-Millionäre aus dem Silicon Valley. Es war wohl die Mischung von all dem, die dafür sorgte, dass sich selbst eine kleine Sandwich-Schmiererin hinter der Theke eines Schnellimbiss-Restaurants in diesen Strudel hineingezogen fühlte und sich als Teil des Ganzen empfand und darum die Good Vibration in ihrem Innersten stark spürte.
Nur Mike war eine echte Plage, der Betreiber der Sandwich-Bude. Nicht, dass er sie direkt bedrängt hätte. Doch seine ständigen Anspielungen und Zoten konnten einem ziemlich auf den Geist gehen, all seine dümmlichen, meist sexistischen Sprüche und Witze sowieso.
»Na, letzte Nacht wieder feucht geträumt?«, war nur eine seiner unverschämten Begrüßungsformeln morgens um zehn Uhr, wenn ihre erste Halb-Schicht begann. Sie arbeitete bis zwei Uhr nachmittags durch, hatte danach vier Stunden Pause, begann wieder um sechs für weitere fünf. Um elf Uhr nachts, normalerweise eher gegen halb zwölf, konnte sie endlich aufräumen und gehen, hatte es von dort aus nicht allzu weit zu ihrer Ein-Zimmer-Behausung, konnte darum zu Fuß gehen und so Geld sparen. Zurück in ihren vier Wänden warf sie sich meistens todmüde auf die Matratze, fühlte sich ausgebrannt und abgegriffen, von den Blicken unangenehmer Gäste und den öden Sprüchen von Mike.
»Noch zwei, höchstens drei Monate«, sagte sie sich immer wieder, bevor sie einnickte, »dann finde ich bestimmt was Besseres«, murmelte sie bereits im Halbschlaf.
Doch so weit kam sie gar nicht. Das Schicksal hatte anderes mit ihr vor.
Es war an einem regnerischen, sehr kühlen Abend. Draußen auf dem Meer wütete ein Orkan, schickte immer wieder starke Böen mit heftigem Niederschlag hinüber zur Stadt, schüttelte und beutelte, was nicht festgebunden war, trieb die Menschen aus den Straßen und in ihre Häuser und Wohnungen. Das Leben erstarb regelrecht nach zwanzig Uhr. Die letzten Gäste waren vor einer Viertelstunde gegangen, neue konnten sie in dieser Nacht kaum mehr erwarten. Shamee war allein mit ihrem Boss Mike. Der schickte sie nach einer Weile in die Küche zum Aufräumen.
»Pack schon mal das Geschirr in die Maschine«, hatte er ihr befohlen. Normalerweise tat er das selbst, hielt so seiner Angestellten den Rücken an der Theke frei. Doch wenn vorne kaum was los war, hing Mike nur zu gerne den Boss raus.
Shamee ging gehorsam nach hinten, durch die Pendeltür, öffnete die Klappe des Geschirrspülers, zog das untere Rollgitter heraus, begann Teller und Platten einzuräumen, stieß es zurück in den Kasten, holte das obere hervor, stellte Tassen, Gläser und Besteck hinein, schob es ebenso in die Maschine zurück. Sie nahm zwei Tabletten aus dem Waschmittelpack und warf sie direkt zum dreckigen Geschirr, drückte die Tür zu und setzte die Maschine in Gang.
Als sie sich umdrehte, schrak sie heftig zusammen. Denn Mike stand unvermittelt hinter ihr, so dicht, dass sie seinen nun schnaufenden Atem im Gesicht spürte. Instinktiv wollte sie ihren Arbeitgeber von sich wegdrücken, mit den Handflächen vor dessen Brust. Doch der Hüne trat stattdessen noch dichter an sie heran, presste sie mit seiner Körpermaße an die Maschine, umfasste gleichzeitig mit seinen Pranken ihre Schultern und bog ihren Oberkörper weit zurück.
»Nun bist du endlich fällig, Kleine«, sagte er unnatürlich ruhig zu ihr und sie las in seinen Augen die Entschlossenheit, die sich wohl in den vergangenen Wochen immer weiter in ihm angestaut hatte.
»Nicht«, stieß sie keuchend hervor, »hör auf, Mike. Ich will nicht.«
Sie spürte seine tastenden Finger zwischen ihren Oberschenkeln und schrie erschrocken auf, wand sich unter ihm und stieß ihm ihre Fäuste vor die Brust. Doch genauso gut hätte sie versuchen können, einen Elefantenbullen mit bloßen Händen wegzudrücken. Mike grinste sie erregt-schnaufend an, presste ihr plötzlich seine wulstigen Lippen auf den Mund. Shamee geriet in Panik, öffnete ihren Kiefer wie zum Schrei, spürte auch schon die Zunge des Hünen eindringen und biss mit aller Kraft zu.
Mike schrie brüllend auf, trat einen Schritt zurück und versetzte ihr einen Faustschlag auf das Brustbein. Der Stoß warf die junge Frau zurück und über die Geschirrspülmaschine. Ihr Boss spuckte derweil Blut, drehte sich von ihr weg und verließ, undeutliche Flüche ausstoßend, die Küche. Shamee rappelte sich auf, massierte sich das schmerzende Brustbein, fluchte ihrerseits unterdrückt, soweit sie überhaupt Luft bekam.
Ihr Boss war wohl hinüber zu den Toilettenräumen gegangen, wollte sich dort am Waschbecken um die Bisswunde in seiner Zunge kümmern, sie im Spiegel begutachten. Shamee erhielt so die notwendige Zeit, um sich zu fassen.
Immer noch tobte wilde Panik in ihr. Doch ohne jeden Übergang konnte sie plötzliche wieder klare Gedanken fassen. Denn sie musste weg. So rasch als möglich.
Endlich stieß sie sich von der Maschine ab und ging mit langen Schritten hinüber in den Gastraum, zog dort die Schürze aus und warf sie auf die Theke, rannte zur Eingangstür, die Mike abgeschlossen hatte. Doch zum Glück steckte noch der Schlüssel. So trat Shamee drei Sekunden später aus der Sandwich-Bude, wurde von Sturmböen und heftigem Regen erwartet und innerhalb von Sekunden völlig durchweicht.
Sie rannte den Bordsteig entlang bis zu ihrem Apartment, kam dort heftig schnaufend und tropfnass an. Mike wusste, wo sie wohnte. Deshalb packte sie nur das Notwendigste zusammen, warf alles ungeordnet in ihren Rollkoffer, stürzte wenig später zurück auf die Straße.
Auf ein Taxi konnte sie nicht hoffen. Diese Gegend gehörte eh nicht zu den besten und in der nass-kalten Nacht waren mögliche Kunden reinste Mangelware. Niemand fuhr seinen Wagen hier spazieren, in der seltsamen Hoffnung auf einen Zufallstreffer. Und auf Uber warten, das konnte sie nicht. Denn sie dachte mit Grauen daran, wie ihr Boss sie hier suchen und aufspüren konnte. So lief Shamee immer weiter der Straße entlang, hatte die Richtung zum Busbahnhof eingeschlagen. Zwei Meilen waren es bestimmt bis dorthin, vielleicht sogar drei. Egal. Nur weg von Mike und in Sicherheit.
*
Jules Lederer war schweizerisch-amerikanischer Doppelbürger. Aufgewachsen in einem sehr wohlhabenden Elternhaus an der Zürcher Goldküste, mit einem kaum anwesenden Vater, der sich als Diplomat für die Schweiz verdingte, und einer wenig interessierten Mutter, die ihre Zeit lieber mit ihren Tennislehrern verbrachte, als sich ums eigene Kind zu kümmern. Das Knabeninternat wurde so für Jules zu einer eigentlichen Erlösung von der elterlichen Kaum-Anwesenheit. Und sein anschließendes Wirtschaftsstudium in St. Gallen machte ihn in Verbindung mit einem über viele Jahre sehr intensiven Training fernöstlicher Kampfsportarten zu einem bemerkenswerten Mann.
Nach seinem erfolgreichen Abschluss arbeitete Jules Lederer einige Jahre lang für eine angesehene, weltweit tätige Anwaltskanzlei in Zürich. Sie vertrat reiche Menschen und große Konzerne weltweit, fand für sie Steuerschlupflöcher, fädelte Fusionen und Übernahmen ein, kümmerte sich um alle rechtlichen, aber auch um viele andere Schwierigkeiten.
Jules Lederer begann schon bald, sich auf die wirklich heiklen Fälle zu konzentrieren. Oft befanden sich darunter richtig gefährliche Aufgaben. So wurde er mehr und mehr zu einem Abenteurer, der die Welt als das betrachtete, was sie tatsächlich war, nämlich ein Tummelfeld von einigen echten Kriminellen und einem riesigen Heer von Möchtegern-Gangstern. Er lernte sich darin zu behaupten. Und zu gewinnen.
Irgendwann machte sich Jules Lederer selbstständig. Denn der allmonatliche Aufwand für seine oft kaum durchschaubaren Spesenaufwendungen wurde ihm einfach zu lästig. So begann er als One-Man-Show für Weltkonzerne, Politiker und Wirtschaftsführer zu arbeiten, beseitigte für sie jene Schwierigkeiten, gegen die man nicht mit Verhandlungen, Anwälten oder Gerichten vorgehen konnte. Er wurde zu einem richtigen Problemlöser und verdiente sich dabei eine goldene Nase.
Seine Ehefrau Alabima lernte Jules Lederer vor fast zehn Jahren in Äthiopien kennen. Die wunderschöne Frau vom Stamme der Oromo schenkte ihm ein Jahr später eine Tochter, die sie auf den Namen Alina taufen ließen. Zudem adoptierten die beiden den philippinischen Waisenjungen Chufu. Der damals Fünfzehnjährige studierte später in Brasilien Psychologie, lebte nun schon seit einigen Jahren mit seiner Freundin Mei Ling in Rio de Janeiro. Auch die chinesisch-stämmige Brasilianerin hatte Psychologie studiert und beide arbeiteten seit ihrem Abschluss in der Kinder-Psychiatrie-Abteilung eines großen Krankenhauses. Und ja, Mei Ling war die ältere Schwester von Shamee Ling, die erst vor kurzem nach Kalifornien ausgewandert war.
Das Leben mit Jules fiel der gläubigen Alabima nicht gerade leicht. Denn der Selfmade-Millionär hatte seine noch junge Familie schon mehrere Male in höchste Lebensgefahr gebracht. Das lag an seinen übernommenen Aufträgen, aber vor allem auch daran, dass Jules weiterhin mit viel Hingabe irgendwelchen Geheimnissen nachjagte, für die er sich privat interessierte. Irgendwann bestand die Äthiopierin darauf, dass ihr Ehemann endlich kürzertrat und keine riskanten Aufträge mehr für Klienten übernahm. Das versprach ihr Jules damals aufrichtig und er hielt sich auch daran. Doch zu welchem Preis?
Jules veränderte sich. Erst schleichend, dann immer rascher. Zuerst wurde er griesgrämig, suchte anderweitige Zerstreuung, schien sogar auf dem besten Weg, schizophren zu werden, sah überall nur noch mögliche Feinde oder gefährliche Gegner, die sich an ihm und seiner Familie rächen wollten. Allerdings schoben Alabima und auch Jules diese böse Entwicklung später auf einen Gehirntumor, der beim Schweizer festgestellt wurde. Die Ärzte hatten damals alle Hoffnungen aufgegeben, rechneten mit dem Tod des Schweizers innerhalb von Wochen oder wenigen Monaten. Zu aggressiv und zu weit fortgeschritten schien der Krebs bereits, eine Operation unmöglich, die Chemotherapie mit Bestrahlungen nutzlos.
Jules schloss in diesen Wochen des Bangens und der Furcht mit seinem Leben ab. Er trennte sich bewusst von Ehefrau und Kindern, wollte ihre Besuche nicht mehr an seinem Krankenlager dulden, auch nicht ihr Mitleid spüren müssen oder ihre Tränen sehen. Doch dann gelang seine wunderbare Heilung, mit Hilfe eines experimentellen Medikaments, das Alabima für ihren Ehemann aufgespürt und illegal in den USA beschafft hatte. Die Äthiopierin machte sich dadurch zwar strafbar und wurde seitdem von den Behörden beobachtet und sogar verfolgt. Doch für die Rettung ihres Gatten schien ihr dieser Preis gering.
Für Jules Lederer war die so unerwartete Rückkehr aus dem Totenreich allerdings keine Erlösung. Im Gegenteil. Denn für welches Leben und für welchen Zweck sollte er weiterhin existieren, nachdem er sich doch längst mit dem Tod abgefunden hatte? Der Strich unter seinem Leben war von ihm bewusst und gefasst gezogen worden. Und nun wurde seine Rechnung ungefragt erneut aufgemacht?
Jules Lederer verlor nach seiner körperlichen Genesung den Boden unter den Füssen, wurde depressiv, dachte oft an Selbstmord, hielt mehr als einmal den Lauf eines Revolvers in seinen Mund, hätte nur noch abzudrücken brauchen. So schleppte er sich über viele Monate hinweg mehr schlecht als recht durch die Zeit, lebte zwar noch für seine Lebenspartnerin und für seine beiden Kinder, schien jedoch ansonsten alle Energie und sämtliche Interessen für immer verloren zu haben, konnte kaum noch Freude oder auch nur Empathie empfinden.
»Wie ein Zombie«, hatte sein Adoptivsohn Chufu einmal respektlos zu Alabima gesagt, während einer seiner eher seltenen Besuche in der Schweiz, »er lebt zwar noch, doch er ist innerlich tot.«
Die Äthiopierin hatte nichts darauf geantwortet, konnte es nicht, vor Schmerz über den verlorenen Ehemann und Lebenspartner. Auch hatte sie ihre eigenen Probleme, in diesem ihr immer noch weitgehend fremden Land, genannt Schweiz, das von außen betrachtet so ordentlich und gut organisiert daherkam, wo jedoch die Wärme zwischen den Menschen gänzlich zu fehlen schien. Nachbarn zerrten einander wegen Nichtigkeiten vor Gericht. Die Becher der Bettler vor den Warenhäusern blieben leer. Man ging in die Kirche, um zu beten und verfluchte außerhalb alle Migranten.
Nein, die Äthiopierin hatte sich nie so richtig in ihre neue Heimat einbringen und einleben können. Jules hatte dafür gesorgt. Denn kein Nachbar und kein Elternpaar aus der Schule ihrer Tochter Alina waren ihm gut genug gewesen, weder als Gesprächspartner noch als Kollegen und schon gar nicht als Freunde. So lebte die Äthiopierin in der Schweiz wie im Exil, dachte immer wieder mit Wehmut und Sehnsucht an ihre alte Heimat zurück, an ihre Familie mit der vielköpfigen Verwandtschaft, in der sie bis zur ihrer Abreise nach Europa eingebettet gewesen war. Sie hatte ihr altes Zuhause aus Liebe aufgegeben, fand jedoch wegen ihrer Liebe zu Jules keine neue. Ohne ihre bald zehnjährige Tochter Alina hätte Alabima kaum noch Sinn in ihrem Dasein verspürt. Doch auch der Zwang der Verantwortung für ihr leibliches Kind ersetzte nicht die Lust am eigenen Leben. Die immer noch wunderschöne, reife Frau von Ende dreißig schien langsam, aber sicher zu verwelken, wie eine Schnittblume, die trotz viel Licht und genügend Wasser unweigerlich einging, ganz einfach, weil ihr die Wurzeln abgeschnitten worden waren.
Jules Lederer hatte sich schon immer sehr schwer getan mit echten Freundschaften oder auch nur guten Bekannten. Da gab es zwar ein paar langjährige Auftraggeber, mit denen er sich immer noch gut verstand. Einer von ihnen, ein russischer Oligarch, hatte ihn und seine ganze Familie jedoch kurz nach der Geburt seiner Tochter Alina umzubringen versucht, als der Schweizer ihm versehentlich in die Quere kam. Denn das Leben veränderte alle Menschen über die Zeit, ihre Positionen und ihre Ideale genauso, wie ihre Dogmen und den übrigen Glauben. Wer konnte schon ins Innerste der Leute blicken? Ihre Veränderungen zielsicher aufspüren und nachvollziehen?
Doch immerhin waren zwei herausragende Männer über all die Jahre hinweg stets eng mit Jules Lederer verbunden geblieben. Einer von ihnen hieß Toni Scapia, war von Geburt aus Millionär und lebte die meiste Zeit des Jahres in Miami. Der andere hieß Henry Huxley, war Brite, wohnte schon immer in London.
Wer Henry Huxley war, wusste wohl nur er selbst. Jules hatte ihn zwar vor mehr als zwanzig Jahren und während eines Auftrags kennengelernt, wusste trotzdem recht wenig über ihn zu berichten. Die beiden so ungleichen Männer, Henry war mehr als zehn Jahre älter als Jules, fanden damals rasch Gefallen aneinander. Gemeinsam erlebten sie einige Abenteuer, retteten sich mehrmals gegenseitig das Leben. Ihre Freundschaft überdauerte die Zeit.
Genauso wie Jules Lederer war auch Henry Huxley beständig hinter irgendwelchen Geheimnissen her, hielt seinen Daumen am Puls der Millionen-Metropole London, unterhielt Beziehungen zu den miesesten Gangstern der Stadt bis hinauf zu den angesehensten Politikern. Henry hatte die sechzig längst überschritten, ging stramm auf die siebzig zu. Vor ein paar Jahren durfte er Holly Peterson kennenlernen. Die aparte Frau von Mitte vierzig hatte zuvor als selbstständiges Edel-Escort-Girl gearbeitet. Damals sollte sie für Henry Huxley in einem Fall tätig werden. Das funktionierte zwar nicht, doch dafür verliebten sich die beiden ineinander und blieben zusammen, heirateten einige Zeit später und adoptierten Sheliza bin-Elik, eine vor dem Bürgerkrieg in die Türkei geflohene Syrierin, die ihre gesamte Familie verloren hatte. Die damals 14-jährige Alawitin wurde im Flüchtlingslager von einem 16-jährigen Sunniten schwanger. Doch der junge Mann wollte von Frau und Kind nichts wissen. Und so erbarmte sich Henry Huxley der armen Waisen und brachte das Mädchen nach Großbritannien, bemühte sich mit Holly zusammen um die Adoption.
Die gläubige Muslimin Sheliza bekundete allerdings größte Mühe mit der für sie völlig neuen, westlichen Welt, in der Sex und Konsum alles zu beherrschen schienen. Dies hier sollte ihre neue Heimat werden? Ein Sündenpfuhl, in dem der Kommerz über jeder Menschlichkeit stand?
Noch vor der Geburt ihrer Tochter flüchtete das Mädchen zurück nach Syrien, suchte dort vergebens nach überlebenden Familienmitgliedern. Sie geriet in die Fänge des IS und wäre beinahe umgekommen, konnte schließlich dank dem beherzten Eingreifen von Jules Lederer und Henry Huxley mit ihrer in der Zwischenzeit geborenen Tochter Fadoua gerettet werden, gelangte zurück nach Großbritannien. Der zu einer liebenden Mutter verwandelte Teenager hatte auf ihrer Odyssee durch Syrien allerdings ihren Glauben an Allah gänzlich eingebüßt. Zu viel sinnlose Gewalt musste sie mit ansehen, zu brutal waren die selbsternannten Gotteskrieger gegen die Bevölkerung vorgegangen. Sheliza konvertierte zum Katholizismus, nicht weil sie das Christentum dem Islam vorgezogen hätte, sondern nur weil sie darauf spekulierte, dass ihre Tochter auf diese Weise im Westen weit besser behütet war und sich auch wesentlich leichter integrieren konnte.
Was konnte man sonst noch über Henry Huxley und sein Leben erzählen? Selbst Jules Lederer wusste nicht allzu viel mehr über den langjährigen Freund. Der Brite hatte mit großer Wahrscheinlichkeit eine militärische Vergangenheit hinter sich gelassen. Womöglich war er auch für den Geheimdienst tätig gewesen. Jedenfalls besaß Henry bis heute gute Kontakte in diese Organisationen. Auch schien er immer schon finanziell recht unabhängig gewesen zu sein.
Weder die Lederers noch die Huxleys, waren also gewöhnliche Patchwork-Familien. Chufu Lederer, der adoptierte Philippine, machte sich über viele Jahre hinweg einen Spaß daraus, von einem regelrechten Flickenteppich zu reden, wenn die Sprache auf seine Familie kam. Sie bestand aus dem schweizerisch-amerikanischen Doppelbürger Jules, der Äthiopierin Alabima, ihm als gebürtigen Philippinen und der in der Schweiz geborenen Alina. Eine bunte Mischung aus Weiß, Schwarz, Gelb und Braun.
Über die letzten paar Jahre hatten sich Jules Lederer und Henry Huxley immer seltener getroffen oder auch nur am Telefon gesprochen. Der Zahn der Zeit nagte auch an ihrer Freundschaft und die fortschreitende Persönlichkeitsstörung von Jules tat das Ihrige. Doch immerhin kamen die beiden Familien weiterhin ein oder zwei Mal im Jahr für ein paar Tage zusammen, versuchten so ihre früher so enge Beziehung zu pflegen und zu erneuern, auch wenn sie auf Sparflamme blieb. Doch jedes Mal sprachen sie davon, sich in Zukunft wieder öfters zu treffen, was aber bislang frommer Wunsch geblieben war.
Doch nicht in diesen Winter. Zumindest, was Henry und Jules betraf. Denn Shridar Kumani, ein indischer Geschäftsmann, hatte die beiden zu sich nach Mumbai eingeladen. Der frühere Rohstoffhändler war vor vielen Jahren Klient von Jules Lederer geworden. Als der Schweizer jedoch am Gehirntumor schwer erkrankt war, reiste Henry Huxley an seiner Stelle nach Indien. Der Brite löste die ihm gestellte Aufgabe, eine unglückliche Verquickung von Religion und Wirtschaftsinteressen, auf seine ganz persönliche und sehr spezielle Weise, jedoch zur vollsten Zufriedenheit von Shridar Kumani. Seitdem verband gerade diese beiden Männer eine nie ausgesprochene Freundschaft, die auf gegenseitiger Achtung beruhte.
Und so saßen die beiden langjährigen Gefährten Jules und Henry nur zwei Wochen später tatsächlich im selben Jet, hatten sich in London getroffen und flogen zusammen nach Mumbai, freuten sich auf das Wiedersehen mit ihrem früheren indischen Auftraggeber.
Die Erste Klasse der Air India bot ihnen jeden erdenklichen Komfort. Huxley und Lederer genossen den neunstündigen Flug, unterhielten sich angeregt über die alten, gemeinsamen Zeiten und Abenteuer, stellten auch Mutmaßungen über den eigentlichen Grund für die Einladung von Shridar Kumani und ganz generell über ihren Aufenthalt in Mumbai an, vermuteten weniger eine reine Nettigkeit des früheren Rohstoffhändlers als vielmehr eine neue und wichtige Aufgabe für die beiden in die Jahre gekommenen Problemlöser. Sie freuten sich auf eine neue Herausforderung.
Da neu anknüpfen ihrer früher so engen Beziehung gelang ihnen allerdings nur leidlich. Denn das Alter hatte nicht nur den Vorteil, die Menschen etwas ruhiger zu stellen. Im Gleichschritt ging auch eine zunehmende Starrköpfigkeit einher, zudem eine unspezifische Angst vor allen Veränderungen in der Welt draußen, die stetigen Einfluss auf das Umfeld nahmen, gegen die man nichts ausrichten konnte. Ja, das Alter war weder am Briten noch am Schweizer spurlos vorübergegangen. Vielleicht lag es aber auch an ihrer Verantwortung gegenüber ihren Familien? Diese Verpflichtung mahnte sie ständig zu größter Vorsicht, dämpfte ihren früher eher lockeren Umgang mit möglichen Risiken, hatte ihnen regelrechte Fesseln angelegt. Zwei einst stolze Adler, die nicht mehr auf die Jagd gehen durften, deren Federn deshalb beschnitten waren. Eine gewisse Melancholie hatte die beiden wohl ebenfalls befallen, denn ihr Leben konnte nie mehr so werden, wie es einst war.
Jules und Henry teilten sich die acht Plätze im vordersten Teil des Flugzeugs mit vier Männern und zwei Frauen, alle in den hohen Vierzigern bis Anfang sechzig. Mit Sicherheit befanden die sich allesamt auf Geschäftsreise, schienen erfolgreiche Unternehmer oder zumindest wichtige Manager zu sein. Obwohl längst sehr wohlhabend geworden, jagten sie weiterhin dem Geld nach, als könnten sie sich damit noch mehr vom Leben kaufen.
Jules und Henry hoben sich von den anderen sechs Passagieren in der ersten Klasse ab, wie zwei Flamingos in einem Schwarm von Krähen. Nicht nur sprachen die beiden weit kräftiger dem alkoholischen Angebot im Flugzeug zu. Sie plagten sich auch nicht mit Laptops oder IPads ab, stierten auf keine Bildschirme, diktierten keine Briefe oder murmelnden Berichte in Mikrophone. Selbstverständlich bemerkten die beiden alten Freunde immer wieder die abschätzenden und manchmal auch etwas giftigen Blicke der anderen Erste-Klasse-Passagiere, kümmerten sich jedoch herzlich wenig darum, gaben sich völlig zwanglos.