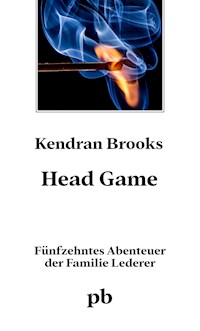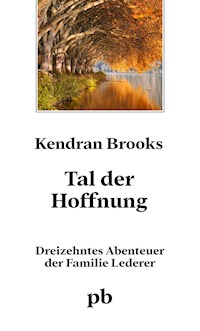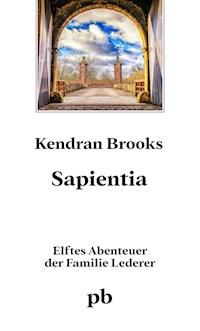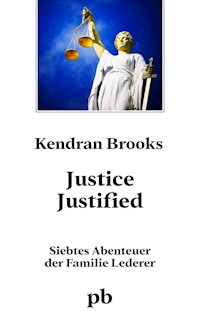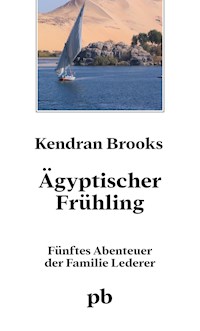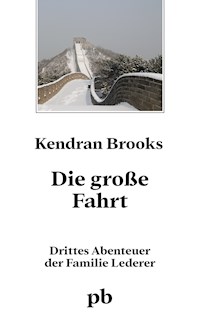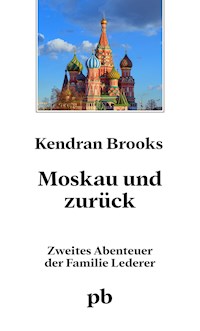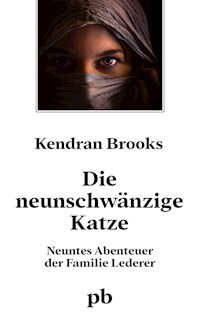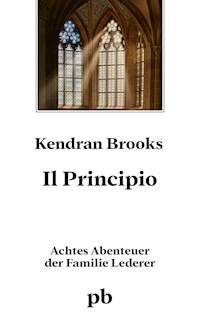
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Mord an einem ewigen Studenten in Lausanne wirft eigentlich keine hohen Wellen. Doch die Polizei findet Hinweise, die zu Alabima und zu Jules führen. Sind sie die Auftraggeber? Oder zumindest einer von ihnen? Ohne Wissen des anderen? Und während Jules sich vor einer Entscheidung drückt und mit Henry Huxley zusammen das Kloster Mor Gabriel im Süden der Türkei besucht, muss sich Alabima gegen einen Staatsanwalt wehren, der mit diesem Fall politische Karriere machen will. Der Mörder des Studenten ist längst wieder zurück in Hongkong und sucht dort nach Heimat, findet sie und versucht sie zu verteidigen. Doch kann sich ein ehemaliger Gangster gegen seine frühere Triade behaupten? Und wie steht die Nachbarin zu einem Verbrecher, der Blut an seinen Händen hat? Während Henry Huxley auf Mor Gabriel verzweifelt versucht, die alawitischen Flüchtlinge vor dem Zorn der Schiiten und Sunniten zu schützen, muss sich Jules in der Schweiz gegen Behördenwillkür durchsetzen und in Hongkong eine Sexarbeiterin aufspüren. Am Ende stellt sich jedoch eine Frage: Hat Alabima ihre Heimat endgültig verloren oder neu gefunden? Stolz und Ehre, aber auch Würde und Wissen/Können sind die vier Grundlagen unserer Persönlichkeit. Das "Lied über den Stolz und die Ehre" geht auf diese Charaktereigenschaften ein und interpretiert sie, stellt sie in einen Kontext zu unserem digitalisierten Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kendran Brooks
Il Principio
8. Abenteuer der Familie Lederer
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorgeschichte
Heimat
Stolz
Heimat?
Ehre
Feindschaft
Entscheidungen
Fortschritte
Ankunft
Impressum neobooks
Vorgeschichte
»... und darum müsste ihr, als gläubige Kinder Allahs, eure Haare und auch eure Gesichter vor den Blicken der Männer verbergen. So verlangt es der Prophet. Ich erwarte von euch, dass ihr von morgen an im Niqab zur Schule kommt.«
Mohammed al-Barani blickte sich selbstsicher und zufrieden in seinem Klassenzimmer um, schaute dabei keines der Vierzehnjährigen Mädchen direkt ins Gesicht, sondern überflog ihre Köpfe, sah die bunten Tücher mit viel Wohlwollen, störte sich an den wenigen, dunklen Haarschöpfen dazwischen.
In der Dorfschule von al-Busayrah, einem Provinznest im Osten von Syrien, war man sunnitisch, nicht schiitisch und schon gar nicht alawitisch oder christlich, lebte Gott gefällig und nicht lästerlich, wie die Machthaber in der sündigen Hauptstadt Damaskus. Mohammed al-Barani war nicht nur Lehrer, sondern auch Imam in der nahen Moschee, verband den Dienst an der Bildung mit dem Dienst für Allah, wusste um sämtliche Sünden und Verfehlungen der Menschen, kannte ihren Preis im Jenseits.
Unwirsch zogen sich seine Augenbrauen zusammen, als er ganz hinten, in der linken Ecke des Raumes und nahe der Türe zum Flur, seine Schülerin Sheliza zögerlich ihre Hand heben sah, diese kleine, hellbraune Hand, die dem gottesfürchtigen Mann schon immer zu wohlgeformt schien, zu gepflegt, mit zu langen Fingernägeln, eine Hand wie die Versuchung selbst.
»Ja…«, nickte er dem Zeigefinger auffordernd zu, der sich aus der kleinen Faust des Mädchens keck emporgereckt hatte, »…hast du dazu eine Frage, Sheliza?«
Die junge Alawitin lebte noch nicht lange in al-Busayrah, kam erst vor zwei Jahren mit ihren Eltern hierher. Eine Erbschaft war der Grund gewesen, ein großes Hofgut mit mehr als sechshundert Hektar fruchtbaren Bodens, das mehr als einem Dutzend Familien Lohn und Brot gab. Doch das schlanke, feingliedrige Mädchen war Mohammed al-Barani vom ersten Tag an nicht ganz geheuer gewesen. Denn als er sie das erste Mal und als Zwölfjährige auf dem Schulhof erblickt hatte, da war sie bei seinem Auftauchen genauso wie er abrupt stehen geblieben, hatte ihn stumm, aber offen angesehen, hatte ihn mit einem klugen, prüfenden Blick und ihren so unangenehm wissenden Augen angeschaut und ihn durchdrungen. Sie schien in seinem Innersten wie in einem aufgeschlagenen Buch lesen zu können und hatte darin bestimmt alles über seine alte Schuld erfahren, diese Sünde, die von niemandem jemals vergeben werden konnte, selbst nicht von Allah.
»Entschuldigen Sie, werter Herr Lehrer al-Barani, doch können Sie uns bitte erklären, welcher Vers des heiligen Buches die Verhüllung der Frauen fordert?«
Einige ihrer Klassenkameradinnen kicherten leise, wandten sich ihre Gesichter zu und grinsten einander verschmitzt an. Die Saat dieser Frevlerin Sheliza war längst am Keimen, nicht nur hier im Klassenzimmer, sondern in der gesamten Schule. Oder lachten diese einfältigen Mädchen etwa nicht ihn aus, den Lehrer, sondern die vorlaute Sheliza? Dieses alawitische Mädchen aus der Hauptstadt? Diese Vierzehnjährige, die so gar nicht zu ihnen und in diese ländliche Gegend passte?
Mohammed al-Barani atmete tief ein und langsam wieder aus, beobachtete sich dabei selbst und war höchst zufrieden mit seiner strahlenden Selbstsicherheit und der nach außen hin bestimmt gut sichtbar getragenen Ruhe.
»Nun, du findest in Sure 33 Vers 59 die Antwort, Sheliza. Lies den Vers zu Haus ruhig nach, dann wirst du verstehen.«
Seine Augen wanderten bereits wieder von der Zimmerecke weg, schwenkten hinüber zur Fensterfront nach rechts, wollte seine Schülerinnen schon im nächsten Moment verabschieden und sie in die zweistündige Mittagspause entlassen. Doch da war wieder diese kleine, hellbraune Hand und der keck daraus emporgestreckte, schlanken Zeigefinger mit dem viel zu langen Nagel, wie er aus den Augenwinkel heraus erkannte. Kalt blickte der Lehrer hinüber, fixierten das Mädchen und nickten ihm auffordernd aber stumm zu, diesmal vielleicht eine Spur weniger selbstsicher als zuvor, dafür mit einem grimmigen Zug um die Mundwinkel.
»Aber werter Herr Lehrer al-Barani«, begann diese freche Göre aus Damaskus ihre Gegenrede, »ich kenne diesen Vers längst auswendig. Darin spricht Mohammed doch von der Djilbab, einem Kleidungsstück, dessen Form wir heute gar nicht mehr kennen. Wie sollen wir also wissen, ob er damit tatsächlich das Verbergen der Haare und die Verschleierung des Gesichts gemeint hat? Und weshalb…«, wollte die aufmüpfige Schülerin ergänzen, wurde von ihrem Lehrer jedoch barsch unterbrochen.
»Die Form des Kleidungsstücks spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, denn der Prophet spricht eindeutig von der Verhüllung des Kopfes und des Gesichts. Oder ziehst du das etwa in Zweifel?«
Sheliza senkte einen Moment lang ihren Blick, demütig, wie es dem Propheten gefiel. Doch schon hob sich ihr Antlitz erneut, schaute den Lehrer und Imam aus dunkelbraunen Augen stürmisch zwingend an.
»Aber der Prophet verwendet doch das Verb udina, und das bedeutet doch gar nicht verhüllen oder über sich ziehen, sondern bloß nahebringen? Und Mohammed verspricht sich von der Djilbab vor allem, dass man die Frauen damit leichter erkennen kann, damit sie nicht belästigt werden. Vielleicht wollte der Prophet mit seiner Anweisung bloß erreichen, dass man die Frauen schon von Weitem an ihrer Figur, von ihrer Körperform her, erkennen kann?«
Die Augen des Lehrers hatten sich geweitet und er staunte das freche Mädchen einen Moment lang fassungslos und mit offenem Mund an.
»Wie kannst du es wagen, die Worte des Propheten nach deinem Gutdünken auszulegen? Und wie kannst du an der viele Jahrhunderte alten Auslegung der Verse zweifeln? Denn schon immer galt das Gebot der Verschleierung, schon zu Lebzeiten von Mohammed, dem Propheten Allahs.«
Die so zornig gesprochenen Worte von al-Barani verfehlten die von ihm erwartete Wirkung. Sie erzeugten bei der Empfängerin bloß ein Stirnrunzeln, das ihr auch noch ausgesprochen gut ins Gesicht stand, wie dem Lehrer bewusstwurde. Er würde sich für diesen unliebsamen Gedanken später hassen.
»Sie beziehen sich bestimmt auf die Auslegung des Verses durch Abd Allāh ibn ʿAbbās, Herr Lehrer. Doch der war doch Richter und gar kein Schriftgelehrter.«
»Jedoch ein Vetter des großen Propheten, du naseweises Kind. Und er trägt den Beinamen habr al-umma, Gelehrter der Umma. Auch hat Mohammed seiner Auslegung des Verses nie widersprochen. All das wüsstest du, wenn du die Schriften besser studiert hättest.«
»Aber Herr Lehrer, der Titel von Abd Allāh ibn ʿAbbās lautete nicht habr al-umma al-islāmīya. Und so war er nur ein weltlicher Richter, kein geistlicher…«, verteidigte sich die Vierzehnjährige gekonnt, schien nun ebenso aufgebracht wie ihr Lehrer.
»Willst du etwa den Zorn Allahs auf dich lenken, Unglückliche?«, herrschte der sie nun mit zornig funkelnden Augen an. Doch die Wut erlosch in ihnen ebenso rasch, wie sie darin hochgekocht war, »aber ich will mich nicht mit dir streiten, dummes Kind«, fuhr er sanfter fort, »denn du findest die erklärenden Anweisungen des Propheten auch in Sure 24 im Vers 31. Dort steht geschrieben, die Frau müsse ihre Augen vor dem Blick der Männer senken, um keusch zu bleiben. Und vergiss nicht Sure 33 Vers 53. Dort wird der Frau direkt befohlen, einen Gesichtsschleier zu tragen, wenn sie mit fremden Männern spricht.«
»Das stimmt doch alles gar nicht«, reklamierte die streitbare Sheliza erneut, »denn in Sure 24 Vers 30 wird den Männern ebenso befohlen, ihren Blick vor jeder Frau zu senken, um keusch zu bleiben. Der große Prophet hat also beide Geschlechter auf exakt dieselbe Weise ermahnt und nicht einseitig den Frauen die Bürde der Verhüllung auferlegt. Und Sure 33 Vers 53 bezieht sich ausschließlich auf den persönlichen Haushalt des Propheten Mohammed, denn er beginnt mit den Worten, betretet nicht die Häuser des Propheten. Außerdem gilt die Anweisung gar nicht seinen Frauen, sondern den männlichen Besuchern, denn er befiehlt ihnen, sich nur durch einem Hijab die Gattinnen anzusprechen. Und ein Hijab ist doch ein Vorhang und bestimmt kein Gesichtsschleier. Mohammed verlangt im Vers 53 ausdrücklich, dass die männlichen Besucher ihre Augen vor seinen Frauen zu verhüllen haben und nicht umgekehrt.«
Mohammed al-Barani stand wie betäubt einen Moment lang sprachlos da und stierte seine Widersacherin aus weit geöffneten, wieder zornig funkelnden Augen an. In seinem Kopf schwirrte jedoch die Gedanken wie Nebelfetzen. Sie summten wie die Bienen im Stock, ließen ihn keinen Ausweg erkennen. Doch dann erkannte der Lehrer die neugierigen Blicke all der anderen Schülerinnen seiner Klasse, wie sie ihn teilweise fragend, meist jedoch amüsiert oder gar spöttisch betrachteten. Sie sahen in ihm wohl bereits den Wurm am Haken der Angel dieser verdammten Vierzehnjährigen. Das machte ihn vollends wütend.
»Du vergisst den Rest der Sure 24, Vers 31, Sheliza, wo der Prophet uns erklärt: Und sag den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Augen niederschlagen, und ihre Keuschheit bewahren, den Schmuck, den sie tragen, nicht offen zeigen, soweit er nicht sichtbar ist, ihren Schal sich über den Ausschnitt ziehen und den Schmuck, den sie tragen, niemandem offen zeigen.«
Sein Redeschwall war wie die Befreiung aus dem Dunkel, wie das Sprengen von Ketten. Doch die verhasste Sheliza ergänzt nun den Rest des Verses, lächelte dazu spöttisch: »…außer ihrem Mann, ihrem Vater, ihrem Schwiegervater, ihren Söhnen, ihren Stiefsöhnen, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und ihrer Schwestern, ihren Frauen, ihren Sklavinnen, den männlichen Bediensteten, die keinen Geschlechtstrieb haben, und den Kindern, die noch nichts von weiblichen Geschlechtsteilen wissen.«
Einige der Mädchen kicherten wiederum los, sehr zum Missfallen des Lehrers, der sie darum mit strafenden Blicken bedachte, was die Klasse rasch verstummen ließ.
»Doch was hat der Prophet mit Ausschnitt gemeint, den man bedecken soll? Und was mit den weiblichen Geschlechtsteilen…?«, fuhr die Vierzehnjährige unerbittlich fort. Doch noch bevor Sheliza weitere Erklärungen abgeben konnte, schnitt ihr der Lehrer das Wort ab.
»Wage es ja nicht, noch weitere solch sündige Worte von dir zu geben, Unglückliche«, schrie er sie an, »verschone uns mit deinen frevlerischen Gedanken über die heiligen Worten Allahs. Sonst stürzen sie dich für alle Zeiten ins Unglück.«
Erschrocken hatte Sheliza innegehalten, starrte ihren Lehrer verblüfft und mit flackerndem Blick an, hatte al-Barani noch nie so aufgebracht und zornig erlebt. Die Vierzehnjährige begann sogar leicht zu zittern, konnte ihre Finger nicht mehr ruhig halten.
»Schweig jetzt, Mädchen, und ihr alle geht nun nach Hause. Es ist längst Mittagszeit. Dir jedoch, Sheliza, verbiete ich jede weitere Unterhaltung mit deinen Freundinnen auf dem Schulweg. Kehre schweigend in das Haus deines Vaters zurück und kündige ihm meinen Besuch für heute Nachmittag an. Ich komme gleich nach Schulschluss zu ihm, so gegen fünf Uhr. Denn ich muss ihn über dein respektloses Verhalten in der Klasse aufklären.«
Der Kopf der Vierzehnjährigen senkte sich zwischen ihre Schultern, schien darin Schutz zu suchen. Nicht vor Angst vor ihrem Vater, der sich stets die Zeit genommen hatte, um mit ihr zu diskutieren, der ihr immer das Gefühl gab, dass auch ihre Meinung für ihn wertvoll war und dass sie für ihre Rechte und ihre Überzeugungen eintreten und kämpfen sollte. Auch ihre Mutter war stets sanft zu ihr gewesen, hatte großes Verständnis für ihre Zweifel und ihr Unbehagen gegenüber ihrem Glauben aufgebracht, gerade in den letzten Monaten, als ihr Busen zu wachsen begonnen hatte und auch ihr Schamhaar dunkler und kräftiger sprießte und Sheliza ihr endlich entsprechende Fragen zu stellen begann.
Doch Mohammed al-Barani war ihr Lehrer und damit die wichtigste Person für ihr künftiges Leben, jedenfalls was ihre weitere Ausbildung betraf. Er besaß die Macht, sie mit seiner Unterschrift an die nächsthöhere Schule einzuweisen. Er konnte sie ihr aber auch verweigern. Sheliza war eine ausgesprochen gute Schülerin, wollte später auf jeden Fall an einer guten Universität studieren, vielleicht Medizin oder doch eher Rechtswissenschaften, sie wusste es noch nicht. Aleppo oder Homs waren ihr Ziel, nur möglichst weit weg von dieser furchtbar rückständigen Gemeinde in der Provinz Deir ez-Zor, wo manchmal noch Steine aus dunklen Gassen geflogen kamen, wenn eine Besucherin aus der Hauptstadt oder aus dem Westen ohne Kopftuch über den Marktplatz ging.
Keine ihrer Kameradinnen sprach sie auf dem Nachhauseweg an. Sie alle mieden ihre Nähe, verließen in kleinen, lebhaften Gruppen den Schulhof, blickten nur manchmal verstohlen zu ihr hinüber. Aber auch Sheliza versuchte nicht, sich jemandem anzuschließen, auch wenn sie sich in diesen Minuten sehr einsam fühlte, als hätte man sie in ein dunkles Verließ gestoßen, als hätte man sie aus dieser Welt entfernt.
Ihre Schritte wurden länger und immer rascher, getrieben von der Ungewissheit, was der Besuch des Lehrers in wenigen Stunden für ihr weiteres Leben bedeuten konnte. Sie hatte den Zorn in seinem Gesicht gesehen, die riesige Wut in seinem Bauch gespürt. Nein, Mohammed al-Barani würde ihren Vater heute Nachmittag wohl nicht als Lehrer besuchen, sondern als Imam seiner sunnitischen Gemeinde. Und er würde ihren Vater in die Pflicht nehmen. Darüber wurde sich Sheliza immer klarer.
Die letzten fünfzig Meter rannte die Vierzehnjährige auf das offene Tor zum Hof ihrer Eltern zu, passierte den steinernen Bogen, erkannte im selben Moment Onkel Jussuf, wie er mit einer Karre Mist aus dem Stall trat und im Licht der gleißenden Sonne zu ihr hinüber blinzelte und verharrte. Und so blieb auch sie stehen und spürte erst in diesem Moment, dass sie am ganzen Körper schlotterte, dass sie keuchend um Atem rang, dass ihre Unterlippe zuckte und vibrierte, ob vor Aufregung oder vor Anstrengung. Und sie sah immer noch atemlos zu, wie Onkel Jussuf aufmerksam zu ihr hinüber spähte, dann den Karren absetzte und nun auf sie zu eilte.
»Was ist denn passiert, Mädchen?«, fragte ihr Großonkel besorgt und blickte sie aus ernsten Augen forschend an, »war was in der Schule? Oder auf dem Heimweg? Warum bist du so gerannt? Sprich doch, Mädchen.«
Sheliza schluchzte auf, spürte die sorgenvolle Wärme aus der Stimme ihres alten Onkels, fühlte die Geborgenheit der Mauern des elterlichen Anwesens, sah die schwarze Katze, die wie so oft auf der Türschwelle zum Wohnhaus lang ausgestreckt lag und schlief, auch die fünf Ziegen unter dem Vordach, die an ihrer Futterkrippe Strohhalme zupften und kauten und nun neugierig geworden zu ihnen hinüber spähten, ohne dass sie Anstalten gemacht hätten, den kühlenden Schatten zu verlassen.
»Es ist nichts, Onkel Jussuf«, stammelte das Mädchen endlich los, »bloß ein Streit. Mit meinem Lehrer.«
»Ein Streit mit Mohammed al-Barani?«, die Stimme ihres Onkel klang überrascht und beruhigt zugleich, beinahe schon amüsiert, »worüber hast du denn mit dem alten Mohammed gestritten, Mädchen?«
»Unser Lehrer verlangt, dass wir ab morgen ganz verhüllt zur Schule kommen. Nicht nur mit Kopftuch, sondern auch mit Schleier. Sonst will er uns nicht länger unterrichten. Kannst du dir das vorstellen, Onkel Jussuf? Er verlangt, dass wir den Niqab anziehen und von nun an unsere Gesichter vor aller Welt verbergen.«
Der alte Jussuf schwieg, wiegte nur leicht seinen Kopf hin und her, strich dann der Vierzehnjährigen mit seiner schwieligen Hand tröstend über das Haar.
»Das ist nun mal so, hier auf dem Land. Das ist Tradition, verstehst du, Mädchen? Gegen die Tradition kannst du dich nicht auflehnen, Sheliza.«
Das Mädchen schüttelte stumm, jedoch ablehnend ihren Kopf.
»Sieh es doch als eine Prüfung an, als ein Zeichen von Allah, ihm wohlgefällig sein. Allah ist groß«
»Groß ist Allah und Mohammed sein Prophet«, ergänzte das Mädchen leise murmelnd und wie selbstverständlich, trat dann einen Schritt vom Großonkel zurück.
»Ich muss meinen Eltern mitteilen, dass mein Lehrer heute Nachmittag hierherkommt, um mit meinem Vater zu sprechen.«
Jussuf sah seine Nichte bitter an.
»War der Streit denn so schlimm?«
Sie zuckte mit ihren dünnen Schultern, seufzte erneut.
»Nimm es nicht allzu schwer, Sheliza. Jeder Sandsturm legt sich irgendwann einmal und die Sonne erobert sich den Himmel zurück. Allah ist groß…«
»…und Mohammed sein Prophet«, murmelte sie geistesabwesend.
Langsam ging die Vierzehnjährige hinüber zum Hauseingang, wo die Katze immer noch auf der Schwelle döste. Doch die schlurfenden Schritte des Mädchens ließen sie nun aufschrecken. Misstrauisch betrachtete das Tier die Hausbewohnerin, schien zum Sprung bereit, um sich jeder Annäherung zu entziehen. Jussuf starrte seiner Großnichte hinterher, nachdenklich und auch ein wenig traurig geworden. Er kannte die moderne Haltung seines Neffen in Glaubensfragen. Der hatte auch sein halbes Leben in Damaskus verbracht und sogar die weite Welt besucht. Selbst seine Ehefrau Irina war weit gereist, hatte China und Indien gesehen. Ja, das waren moderne, junge Menschen, nicht mehr im alten Geist gefangen, so wie er und die meisten seiner Nachbarn und Freunde in dem kleinen Provinznest nahe der Grenze zur Türkei. Die Zeit würde bestimmt auch hier für Veränderungen sorgen. Nur jetzt noch nicht.
Wenn man zur Dorfgemeinschaft dazugehören wollte, musste man sich der Tradition fügen und sie respektieren. Selbst der Kopftuchzwang war zwar in ganz Syrien offiziell längst aufgehoben, doch wen scherte das hier in al-Busayrah? Hier lebte man so, wie die Väter und Großväter und mit der stolzen islamischen Tradition. Jedes Mädchen im Dorf musste das einsehen und sich fügen, selbst Sheliza, sein kleiner Liebling. Alles andere störte bloß die dörfliche Ruhe und streute Unfrieden zwischen die Menschen. Auch wenn der alte Jussuf den Lehrer und Imam al-Barani nicht besonders gut mochte, letztendlich hatte dieser doch die guten Sitten und die Tradition auf seiner Seite stehen und seine Forderung nach Verhüllung der Gesichter geschlechtsreifer Mädchen war sinnvoll und friedensstiftend. Nur so war die Sünde aus den Köpfen der jungen Männer zu halten.
Jussuf ging wieder hinüber zum Karren mit der Ladung Mist. Sie schien schwerer geworden zu sein, als er sie anhob und seinen Oberkörper gleichzeitig nach vorne neigte, um dem Karren etwas Schwung zu verleihen. Doch die Arbeit war ihm stets etwas Wunderschönes gewesen, denn sie lähmte den Geist, brachte jedem Frieden. Allah ist groß.
Während dessen hatte sich Sheliza im Flur die Schuhe von den Füssen gestreift und war in ihre Haussandalen geschlüpft, hatte danach das modern eingerichtete Badezimmer aufgesucht, ihre Blase entleert, die auf einmal überquellen wollte, sich danach Hände und Gesicht gründlich gewaschen. Das kühle Wasser hatte sie erfrischt und ihr neuen Mut verliehen. Noch vor dem Abtrocknen sah sie sich im Spiegel an, blickte in ein tropfnasses Gesicht mit feuchten, klebrigen Haarsträhnen an Stirn und Schläfen, erkannte den bitteren Zug um ihre Mundwinkel und auch die Sorgen in ihren Augen. Tief atmete sie ein, die Vierzehnjährige, schaute sich ihr Spiegelbild unverwandt an, schien es zu studieren. Was brachten wohl die nächsten Stunden für sie und ihr weiteres Leben? Wie würde ihre Mutter reagieren, wenn sie vom Streit mit dem Lehrer erfuhr? Was würde ihr Vater sagen?
Ein schlechtes Gewissen begann sich in ihrer Brust zu melden, vielleicht aus Sorge um ihre Zukunft, vielleicht aus Angst, ihre Eltern stünden nicht mehr hinter ihr. Aber hätte sie etwa nachgeben sollen? Al-Barani nicht widersprechen, auch wenn er falsch lag? Entgegen ihrer Erziehung durch den verehrten Vater und die geliebte Mutter?
Trotz stieg erneut in ihr hoch, derselbe wilde Zorn, der sie auch im Klassenzimmer ergriffen und zusätzlich angestachelt hatte. Oft schon war sie von ihrer Mutter seinetwegen gescholten worden. Sei nur nicht zu stolz, Sheliza, hatte sie mehr als einmal zu ihr mahnend gesagt, aber auch, Arroganz zahlt sich niemals aus, mein Mädchen. Doch besaß sie etwa kein Recht auf die eigene Meinung? Sheliza spürte den Zorn noch stärker hoch kochen, eine Wut auf die ganze Welt der Erwachsenen und wie sie zu funktionieren schien, wo Kinder und Jugendliche nur zu gehorchen hatten, sich der Traditionen unterordnen mussten, keine Stimme besaßen, keinen eigenen Willen. Sie schluchzte und schniefte, wischt sich mit dem Handrücken über die Nase, bekämpfte ihren Zorn, rang ihn schließlich nieder und verdrückte die Tränen, die sich in ihre Augen schleichen wollten.
Sie musste kühl bleiben, ihren Eltern den Sachverhalt ehrlich und offen erklären. Sie würden sie bestimmt verstehen und zu ihr halten. So hoffte die Vierzehnjährige wenigstens.
Ihre Augen wurden erneut feucht, denn sie durchfuhr ein riesengroßer Schrecken. Was war, wenn sie die Schule ab morgen gar nicht mehr besuchen durfte? Wenn sie der Lehrer einfach ausschloss? Würde sie dann so enden wie Martha, die Frau eines ihrer Knechte?
Martha war ungebildet, hatte als Kind keine Schule besuchen dürfen, konnte weder Schreiben noch Lesen, plapperte bloß all das meist völlig falsch nach, was sie in der Moschee von den Imamen vernommen hatte, spielte sich damit vor anderen auf, machte sich wichtig. Das war bestimmt nicht im Sinne Allahs. Martha legte auch stets den Tschador an, wenn sie den Hof verließ und ins Dorf ging, hatte ihr auch schon mehrmals dasselbe angeraten, sich endlich züchtig und sittlich zu kleiden, manchmal mit süßer, lockender Zunge, meistens jedoch mit drohender Stimme. Sie würde als Hure enden, hatte Martha gesagt, als dreckige, kleine Hure, wenn sie weiterhin unschicklich herumliefe. Sie schaute sie dabei mit einem lodernden und alles durchdringenden Blick an, so richtig fanatisch, dass ihr angst und bange wurde. Später, als sie es der Mutter erzählte, war Martha heftig ausgescholten worden, dass sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern sollte und ihre Kinder in Ruhe lassen.
Ja, Mama würde bestimmt zu ihr halten.
Oder doch nicht?
Auch sie trug seit ein paar Monaten stets ein Kopftuch, wenn sie das Haus verließ.
»Man muss sich den Leuten und der Gemeinde anpassen«, hatte sie leichthin ihre Frage beantwortet, »und so ein buntes Tuch kleidet mich doch ausgesprochen gut?«
Das war nicht ehrlich gemeint gewesen, hatte ihr der traurige Blick ihrer Mutter verraten.
Hoffentlich war Mama auf ihrer Seite.
Und hoffentlich flog sie nicht von der Schule.
Verunsichert ging Sheliza den Flur entlang und auf die Türe zur Küche zu. Dahinter war die Mutter wohl mit den letzten Vorbereitungen fürs Mittagessen beschäftigt. Das hörte sie deutlich am Scheppern der Pfannen und Töpfe. Nur zaghaft drückte Sheliza die Falle herunter, stieß das Türblatt langsam auf. Was würde sie dahinter erwarten? Verständnis oder Bestrafung?
Das Herz klopfte ihr hoch bis zum Hals.
Heimat
Es war einer der letzten schönen Herbsttage am Lac Léman. Die Sonne hatte den Morgennebel vertrieben, glitzernd breitete sich das dunkelblaue Wasser unter ihren Strahlen aus, verschmolz in der Ferne mit dem Ufer und den schattigen Höhen der Alpenkette.
Jules Lederer spielte ausgelassen mit seiner Tochter Alina im Garten. Er war der Torwart, sie die Artistin im Penaltyschießen. Das Tor bestand aus der Gartenbank und der Schubkarre als Torpfosten, dazwischen lag ein Abstand von gut drei Metern. Und selbst die regelkonformen elf Meter waren zu mickrigen vier zusammengeschrumpft. Der noch feuchte Rasen hinderte die beiden allerdings am hohen, körperlichen Einsatz. Alina holte kaum Anlauf und Jules hütete sich, nach einem zu gut platzierten Plastikball zu hechten, ließ sich lieber das eine oder andere Mal von seiner Tochter schlagen. Höhere sportliche Ambitionen von Vater und Tochter wurden zudem auch noch von ihren anhaltenden Lachanfällen behindert. Alina wie Jules konnten hinterher kaum erklären, was eigentlich der Anlass für ihre ausgelassene Fröhlichkeit gewesen war. Gut, der eine Ball, hart getreten von Alina, spritzte von der Ecke der Gartenbank direkt an die Stirn von Jules, hinterließ auf ihr einen dreckigen Schmier und in seinem Gesicht einen äußerst verblüfften Ausdruck. Alina hatte losgeprustet und Jules stimmte wenig später ein.
»Du … wolltest dich … doch … nicht … im Schlamm … wälzen, ... Papa ...«, stieß die Kleine zwischen ihren Lachattacken hervor. Ihr Gelächter drang durch das offene Fenster in die Küche, wo Alabima Vorbereitungen fürs Mittagessen traf, die frischen Scampi vom Markt in Lausanne am Küchentisch sitzend ausnahm, sie dazu aufschnitt und den Darm umsichtig entfernte. Den Kohlrabi hatte sie zuvor schon geschält und in kleine Würfel geschnitten. Er köchelte munter in einer Pfanne auf dem Herd vor sich hin. Weich gekochter Kohlrabi an einer würzigen Frischkäse-Kräuter-Soße, dazu gegrillte Scampi, nur mit einer Prise Meersalz und ein wenig schwarzem Pfeffer abgeschmeckt. Einfach und schmackhaft, leicht und bekömmlich.
Alabima stand auf und warf einen Blick hinaus in den Garten, sah Jules direkt ins Gesicht und wie er gespielt grimmig den nächsten Torschuss seiner Tochter einforderte. Und sie betrachtete Alina von hinten, wie sie vor lauter Lachen neben den Ball in die Luft trat und vom Schwung getrieben ausglitt und auf ihrem Hosenboden landete, mitten in den Match hinein, den ihre Sportschuhe durch das Treten auf nassem Rasen zuvor angerichtet hatten.
»He, ihr beiden«, rief sie ihnen laut zu, »Laurel und Hardy sind wohl auferstanden? In einer halben Stunde gibt’s Mittagessen. Kommt rechtzeitig rein, ihr Schmutzfinken, und wascht euch gründlich.«
Beide winkten ihr fröhlich zu, Jules lächelnd, Alina sich immer noch vor Lachen kugelnd.
Alabima setzte sich wieder und nahm die letzten beiden Scampi aus, legte sie neben die anderen aufs Tablett, betrachtete ihre Hände mit den feingliedrigen Fingern und den nur halblangen Nägeln, die nach einer Maniküre verlangten. Die Äthiopierin sandte ein stilles Dankgebet gen Himmel. Wie hatte sich Jules doch in den letzten Wochen verändert, war aus seiner Erstarrung erwacht, erschien ihr wieder lockerer, gelöster, hatte auch seine über viele Monate anhaltenden nächtlichen Angstattacken abgelegt, lag meistens ruhig neben ihr im Bett, war auch so zärtlich zu ihr wie kaum je zuvor. Sie liebten sich fast jeden Tag, inniger und vertrauter als früher, sanfter und einfühlsamer. Ja, Alabima war eine überaus glückliche Ehefrau und Mutter. All die dunklen Wolken der letzten beiden Jahre schienen endgültig verflogen, hatten sich wie der Regenschauer von letzter Nacht gelegt, ließen die Zukunft in einem strahlenden Licht erscheinen. Vergessen war auch ihr Abenteuer in Hongkong und all die Gefahren, in der sie mit ihrer Tochter damals schwebte. Oder zumindest hatte sie die Gedanken daran erfolgreich verdrängen können.
Auch Dr. Grey, die Psychologin aus Lausanne, zu der Jules seit mehr als einem Jahr jede Woche für eine Stunde zum Gespräch hinging, hatte die Fortschritte ihres Klienten zufrieden festgestellt, hatte ihn darin bestärkt, auf dem eingeschlagenen Weg mutig weiter zu gehen und nicht zurückzublicken, sondern nur vorwärts zu schauen. Selbst Jules gestand sich ein, dass all das Böse in ihm, das ihn seit Mexiko verfolgt und beständig gequält hatte, seit seiner Aussprache mit Alabima verschwunden schien, ihn zumindest nicht mehr in der Nacht überfiel, ihn nicht länger drangsalierte und vom Leben abschnitt. Und so glaubte auch der Schweizer mittlerweile an eine vollständige Heilung seiner Seele.
Die Äthiopierin stand vom Küchentisch auf und trug das Tablett mit den Scampi hinüber zum Spülbecken, wusch sie gründlich aus und tupfte sie mit Küchenpapier trocken, ging mit ihnen zum Herd, zog eine Bratpfanne aus dem Schrank, stellte sie auf die Platte, drehte am Regler, worauf sich die Gasflamme mit einem »Plopp« entzündete und blaue Flammen nach dem Metallboden zu lechzen begannen. Sie holte die Flasche mit Rapsöl hervor und stellte sie neben dem Herd bereit.
Die Türklingel ging und Alabima warf einen kurzen, prüfenden Blick zur Pfanne mit dem köchelnden Kohlrabi, drehte die Gasflamme etwas niedriger, ging aus dem Küche und auf den Flur und hinüber zum Bildschirm der Überwachungskamera, drückte den Verbindungsknopf, schaute erwartungsvoll auf die Scheibe. Doch als die Aufnahme vom Torbereich an der Hauptstraße angezeigt wurde, stockte ihr das Herz für einen Moment und sie trat erschrocken einen Schritt zurück, hob ihre Arme, hatte ihre Hände zu Fäusten geballt, drückte sie gegen ihre Kehle, konnte kaum glauben, wen sie dort längst erkannt hatte. Ein chinesisches Vollmondgesicht starrte in die Kamera, versuchte ein Lächeln, lieferte jedoch nur ein schräges, verunsichertes Grinsen.
»Hallo?«, meldete sich die Stimme des Mannes klar über den Lautsprecher, »mein Name ist Fu Lingpo. Ist Misses Lederer zu Hause?«
*
Eine neue Flüchtlingsgruppe aus Syrien traf an diesem Nachmittag in Mor Gabriel ein. Das orthodoxe Kloster, im 3. Jahrhundert nach Christus gegründet, war um einige hundert Jahre älter als der heute hier alles beherrschende Islam. Das Kloster leitete aus diesem Umstand heraus auch besondere Rechte für sich ab, sehr zum Missfallen der örtlichen Behörden und der Mehrheit der Bevölkerung. Mor Gabriel gehörte zu den letzten Bastionen des Christentums im tiefsten Süden der Türkei, wurde noch von zwei Dutzend Nonnen und einer Handvoll Mönche bewohnt.
Timotheus, der Erzbischof und Metropolit, empfing die Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Nachbarland persönlich, blickte in viele erwartungsvolle, aber auch in verängstigte oder leere Gesichter, in glücklich angekommene und ratlose vertriebene. Er breitete seine Arme weit aus, empfing die Menschen mit einem warmen »as-salāmu ʿalaikum«, worauf mehrheitlich ein eher schüchtern ausgesprochenes » wa-ʿalaikum us-salām« oder auch nur ernstes Kopfnicken zurückkamen.
Menschen stiegen von den beiden Lastwagen herunter, trugen Bündel und Koffer mit sich, Taschen und auch zusammengeknüllte Plastiksäcke unter ihren Armen. Das war das Wenige, das ihnen der Bürgerkrieg gelassen hatte, ihre letzte Habe, den Rest ihrer Heimat und womöglich ihrer Würde.
Die riesige Klosteranlage beherbergte bereits mehr als einhundert syrische Flüchtlinge. Doch der Platz war längst noch nicht erschöpft, eher noch die Arme und Hände der wenigen Mönche und Nonnen, die hier noch lebten, beteten und arbeiteten, ihre Seele und ihre Jahre ihrem Gott weihten und dereinst glücklich, weil erfüllt, sterben durften. Selbstverständlich packten die geflüchteten Syrer auch mit an, halfen bei der Ernte auf den Gemüsefeldern, in der Küche oder bei der Wäsche. Doch alles musste erst organisiert und überwacht sein, angeleitet und entschieden. Und so übernahmen sich vor allem die älteren Brüder und Schwestern regelmäßig, kämpften bis zu ihrer völligen Erschöpfung, sanken mehr tot als lebendig und oft erst tief in der Nacht auf ihre Matratzen, schliefen den kurzen Schlaf der Gerechten, wurden viel zu früh wieder geweckt, wuschen sich behände und warfen sich die Kleider über, stürzten erneut in die Schlacht, in die sie ihr Gott von einem Tag auf den anderen geführt hatte.
Viele der ankommenden jüngeren Kinder wirkten sehr verschüchtert, ja ängstlich, hatten das Knallen der Schüsse, das Donnern der Bomben, das Schreien der Menschen immer noch in ihren Ohren, sahen Bilder der Zerstörung in ihrem Kopf, wurden vom Anblick toter Menschen auf den Straßen gequält. Sie bedurften der besonderen Fürsorge und viele der Klosterfrauen verbrachten die meisten Stunden mit den Allerjüngsten, trugen sie im Garten herum, zeigten ihnen die Schönheiten der Natur, lenkten sie mit kindlichem Spiel von der schrecklichen Welt der Erwachsenen ab.
Die syrischen Flüchtlinge waren größtenteils Schiiten, fast ebenso viele jedoch Sunniten. Die wenigen Alawiten unter ihnen fühlten sich von den beiden anderen Gruppen eher bedroht, hielten sich deshalb weitgehend zurück, mieden jeden unnötigen Kontakt zu ihnen und blieben meist unter sich. Timotheus ließ das alles zu. Denn die Zeit der Verständigung lag in weiter Ferne. Und die Zeit der Versöhnung noch sehr viel weiter.
Ein junges und hübsches Mädchen fiel dem Abt von Mor Gabriel besonders auf. Sie ging mit einem alten Mann, der vorsichtig von der Ladefläche des Lasters geklettert war und nun hinkend und aufgestützt auf das halbwüchsige Kind langsam näherkam. Viele der anderen Flüchtlinge warfen dem Paar recht böse Blicke zu, drängten sich an ihnen vorbei, schienen sogar böse Worte gegen sie auszustoßen, leise zwar, so dass sie nicht bis an die Ohren des Abtes drangen. Doch die hässlichen und bitteren Fratzen, die sie dabei zogen, waren ihm Beweis genug. So trat der Abt den beiden verfluchten Ankömmlingen ein paar Schritte entgegen. Diese hatten ihn längst zwischen den anderen Mönchen und dem Dutzend Nonnen als Hausherrn erahnt, wirkten unter seinem freundlichen Blick ein wenig verlegen.
»Salām«, begrüßte Timotheus die beiden freundlich und erhielt vom Mann ein kurzes, forschend fragendes »Salām« zurück, während das Mädchen ihn mit »wa-ʿalaikumu s-salām wa-rahmatu´ʾllāhi wa-barakātuhu« grüßte. (und auf euch sei Frieden und Gottes Erbarmen und sein Segen).
Doch ihre Worte erklangen nicht etwa stolz und frei, sondern flüsternd und darum recht unterwürfig. Das Mädchen hielt auch ihren Blick gesenkt, behielt die Augen auf den Boden gerichtet, vielleicht auch auf die staubigen Schuhe des Metropoliten von Mor Gabriel. Ihr alter Begleiter dagegen schaute den Erzbischof und Abt nun offen an, hatte erkannt, dass von ihm nichts Böses ausging, sondern Güte und Verständnis.
»Ihr seid Alawiten?«
Das war Frage und Antwort zugleich und so nickte der Alte bloß.
»Herzlich willkommen im Kloster Mor Gabriel. Ihr seid hier nicht allein. Gut zwei Dutzend eurer Glaubensbrüder und Schwestern leben bereits unter uns. Sie haben sich im Ostflügel niedergelassen. Kommt, ich bring euch zu ihnen.«
Timotheus wartete auf keine Frage oder eine Antwort der beiden, ging gemessenen Schrittes in Richtung des bezeichneten Gebäudeteiles davon, jedoch so gemächlich, dass der hinkende Alte mit dem ihn stützenden Mädchen aufzuschließen vermochte.
»Woher kommt ihr?«, fragte der Metropolit wie beiläufig.
Der Alte musste sich erst räuspern.
»Wir sind aus al-Busayrah. Das ist ein kleiner Provinzort…«
»Oh, ich kenne al-Busayrah. Liegt es nicht am Zusammenfluss des Chabur mit dem Euphrat? Nicht weit der Provinzhauptstadt Deir ez-Zor?«
»Ja, mein Herr«, antwortete der Alte und schien irgendwie erleichtert, vielleicht, weil hier ein Mensch zu ihm sprach, der nicht nur Anteil nahm, sondern sich auszukennen schien.
»Dann ist der Krieg schon bis dorthin gelangt?«
Der Alte nickte.
»Ja, Herr. Gestern Morgen überfielen Dschihadisten unsere Gemeinde. Sie waren wohl von den Sunniten herbeigerufen worden, weil sie sich davor fürchteten, die Schiiten und Alawiten könnten die libanesische Hisbollah um Unterstützung bitten.«
Der Abt war stehen geblieben, ebenso die beiden Flüchtlinge.
»Und dann?«
Der alte Mann schluckte leer und die Bitterkeit nahm von seinem Mund und seinen Augen Besitz.
»Diese Ungeheuer stürzten sich grundlos auf alle Alawiten und auch auf die Christen. Ich war mit Sheliza mit dem Jeep unterwegs gewesen. Wir hatten nach unserem Vieh außerhalb der Ortschaft gesehen und den Rindern ein wenig Kraftfutter gebracht. Doch als wir zurück kamen…«, die Worte des Alten stockten und erneut musste er trocken schlucken und seine Augen wurden ihm feucht, »…sie waren bereits in den Hof eingedrungen und wir hörten viele Schüsse. Und schreckliche Schreie. Dann kam einer der Soldaten durch das Tor gerannt, sah uns draußen verstört im Wagen sitzen und legte sein Gewehr auf uns an. Da habe ich Gas gegeben und bin davongebraust. Er hat noch ein paar Mal hinter uns her geschossen, doch wir entkamen unverletzt. Wir wagten uns nicht mehr zurück in die Stadt, sondern flohen nach Norden. Als der Tank leer war, gingen wir zu Fuß weiter, wurden von anderen Flüchtlingen eingeholt und mitgenommen. In Nusaybin gelangten wir glücklich über die Grenze in die Türkei. Die Soldaten dort befahlen uns dann auf die Lastwagen, die uns hierherbrachten.«
Timotheus sah auf das Mädchen hinunter, das bei den Erklärungen des Alten aufgeblickt hatte und unsicher aber neugierig den hoch gewachsenen Mann in der Kutte anstarrte, der sie vielleicht mit seinem mächtigen Kinnbart, in dem sich bereits zahlreiche Silberfäden zeigten, aber wohl vor allem durch seine freundliche und besonnene Art beeindruckte. Der Erzbischof blickte sie aus gütigen Augen und voller Verständnis an, worauf sie ihre Augen wieder zu Boden schlug.
»Hier seid ihr in Sicherheit«, erklärte ihnen der Abt von Mor Gabriel, »hier seid ihr außer Gefahr. Sucht euch ein Quartier aus. Einer meiner Brüder wird sich später um euch kümmern. Du bist der Vater des Mädchens?«
Der Alte schüttelte verneinend seinen Kopf.
»Nein, ihr Onkel. Ihr Großonkel.«
»Dann solltet ihr euch zwei getrennte Zellen nebeneinander aussuchen. Macht euch mit den anderen Bekannt. Wie heißt ihr eigentlich?«
»Ich bin Jussuf bin-Elik und sie heißt Sheliza bin-Elik.«
»Es ist gut.«
Der Metropolit legte seine flache Hand auf die Schulter des Alten, drückte sie sanft und ermutigend. Der packte sein Bündel und Onkel und Nichten gingen weiter auf die kleine Gruppe von Menschen zu, die sich vor dem Hauptzugang des Seitenflügels angesammelt hatte und zu den Neuankömmlingen starrte. Je näher sie kamen, umso deutlicher konnten sie die Mienen in den Gesichtern unterscheiden. Sheliza sah in ernst blickende, leere Augen, in denen keine Hoffnung lag, die immer noch das Entsetzen des Bürgerkriegs zeigten. Manche der Frauen trugen ein Kind auf ihren Armen. Sie pressten sie an sich, als ob die Kleinen sie beschützen müssten. Keiner der mehrheitlich älteren Männer schien zu ihnen zu gehören. Das hier war keine Gemeinschaft, denn es fehlte die Vertrautheit untereinander. In ihren Gemeinden in Syrien waren Nachbarn zu erbitterten Feinden geworden, der Staat zu einem menschenfressenden Ungeheuer, die Religion zur alles verschlingenden Python. Diese menschlichen Splitter des Bürgerkrieges waren auf Mor Gabriel zwar in Sicherheit vor den fallenden Bomben und den fliegenden Kugeln, vor dem Durst und dem Hunger. Doch ihr Leben, wie sie es gekannt hatten, war vor vielen Tagen oder gar Wochen endgültig zu Ende gegangen, würde nie mehr so sein, wie es einmal gewesen war.
Ja, Sheliza wurde sich, je näher sie diesen Menschen kamen, umso sicherer. Die hier Gestrandeten waren im Moment zwar in einem sicheren Hafen angelangt, jedoch noch lange nicht zurück in ihrem Leben. Die Vierzehnjährige schluckte trocken, unterdrückte einen Seufzer und wischte sich tapfer über die feucht gewordenen Augen.
Ihre Eltern waren mit Sicherheit erschossen worden. Auch ihre Brüder und Schwestern und die übrige Verwandtschaft, womöglich sogar sämtliche Menschen auf ihrem Hofgut. Doch warum war der Tod über sie alle gekommen?
Sie sah ihren Lehrer Mohammed al-Barani vor sich, wie er sie drohend anstarrte und von ihr Demut verlangte.
War all das tatsächlich das Werk Allahs? Hatte er die Alawiten endgültig verlassen? Trug vielleicht gar sie allein die Schuld am Untergang? Durch ihren Trotz, durch ihre Dickköpfigkeit?
Ihr Großonkel begrüßte die Männer vor dem Eingang, stellte sich und Sheliza vor. Das Mädchen blieb dabei stumm, schaute nur die Frauen und Kinder an, hielt ihren Blick vor den Augen der Männer gesenkt.
Sure 24, Vers 31 dachte die Vierzehnjährige in diesem Moment bitter, schämte sich auf einmal für ihre Demut, hob trotzig ihr Kinn, schaute die fremden Männer offen und direkt an. Sie alle waren Alawiten, wie dieser Abt ihnen erklärt hatte. Deshalb erwiderten sie ihren Stolz nicht etwa mit Ungeduld oder gar mit Ablehnung, sondern mit einem verständnisvollen Lächeln. Ja, dieses Lächeln steckte einen nach dem anderen von ihnen plötzlich an, so als würden sie sich gegenseitig die Hände reichen, sprang sogar auf die Frauen über, die einander prüfenden Blicke voller Erstaunen zuwarfen. Und Sheliza? Sie fühlte sich auf einmal inmitten von Freunden und Vertrauten, erkannte auch in den Gesichtern der anderen große Verwunderung über das, was soeben mit ihnen allen geschehen war.
Timotheus stand drei Dutzend Schritte entfernt, hatte innegehalten und abgewartet, hatte die Begrüßungsszene beobachtet, erkannte auch das Erstaunen und dann die Erkenntnis in den Gesichtern all der Flüchtlinge. Er drehte sich zufrieden von ihnen ab, ging langsam zurück zum Verwaltungsgebäude.
»Ein stolzes Mädchen«, murmelte der Erz-Bischof so leise, dass nur er es vernahm, »ein sehr stolzes Mädchen.«
*
Die Erinnerungen stürzten wie eine Lawine auf Alabima nieder. Die Tage der Angst während der Gefangenschaft in Hongkong. Die Ungewissheit vor der nächsten Stunde, ja der kommende Minute. Die Drohung ihrer Ermordung. Ihre grenzenlose Furcht vor dem weiteren Schicksal ihrer Tochter Alina. Der Äthiopierin schossen die Tränen in die Augen und sie blieb fassungslos vor dem Bildschirm neben der Eingangstüre stehen, starrte auf ihren Entführer, blickte in das Gesicht des Mannes, dem sie ihr Leben verdankte. Sie atmete so heftig ein und aus, dass sich ihre Brust hob und senkte, hob und senkte, spürte nicht ihre Aufregung, das Zittern ihrer Hände, konnte keinen klaren Gedanken fassen, denn alles stürmte zugleich in ihrem Kopf durcheinander, Gefühle und Gedanken, Bilder und Worte.
»Hallo?«, rief erneut die Stimme aus dem Lautsprecher, »hören Sie mich? Ist jemand zu Hause?«
Vielleicht waren es die Worte zu Hause, die Alabima aus ihrer Erstarrung lösten. Jedenfalls trat sie näher an den Bildschirm heran und drückte nach einem kurzen Zögern den Verbindungsknopf, versuchte zu sprechen, musste sich jedoch erst räuspern.
»Ja, hier ist Alabima Lederer.«
Ihre Stimme klang wie aus einer tiefen Gruft. Oder eher wie die einer Toten, die eben zu neuem Leben erweckt worden war, brüchig und ihr selbst fremd.
»Misses Lederer?«
Erneut versuchte sich der Chinese an einem Lächeln und auch diesmal misslang es ihm.
»Bitte verzeihen Sie meinen überraschenden Besuch…«, erklärte Fu Lingpo der immer noch fassungslosen Frau, »…aber ich muss dringend mit Ihnen sprechen.«
Die Worte schienen nicht in Alabima zu dringen. Doch nach ein paar weiteren Sekunden der Erstarrung meinte sie ebenso tot wie zuvor: »Und worüber wollen Sie mit mir reden?«
Alles Feuer schien aus der Äthiopierin gewichen, so monoton flüsterte sie die Worte, mehr zu sich selbst als zum Chinesen vor dem Eingangstor. Im Bildschirm sah sie, wie er sich kurz am Kopf kratzte und sich seine nächsten Worte zu Recht legte.
»Es ist möglich, dass Sie immer noch bedroht werden. Bitte, Misses Lederer. Können Sie mich hereinlassen? Nur für eine Minute.«
Das Vollmondgesicht versuchte es diesmal mit einer Vertrauen erweckenden Miene, die jedoch höchstens als treuherzig durchging. Ihr nächster Gedanke galt jedoch nicht ihm und seinem Wunsch, sondern ihrem Ehemann. Wenn Jules auf ihren Entführer traf, würde er versuchen, diesen umzubringen. Zu viel Hass hatte ihr Ehemann in den Wochen zuvor gegen die Gangster dieser Triade aus Hongkong ausgesprochen und zu oft von Vergeltung geredet.
»Nicht hier«, beeilte sie sich deshalb zu sagen, »und nicht jetzt.«
Der Chinese wartete geduldig auf ihre Entscheidung.
»Wir treffen uns im Café des Avenues in Lausanne, um vier Uhr, heute Nachmittag. Okay?«
»Ja, Misses Lederer, ich werde dort sein.«
Er nickte zum Abschied in die Kameralinse und wandte sich dann vom Tor ab, schlug die Richtung zur Bushaltestelle ein. Alabima stand immer noch vor der Eingangstüre, brachte ihre schwirrenden Gedanken in Ordnung. Das Zittern in ihren Fingern verschwand nach einer Weile. Sie hörte die Türe zum Garten, straffte sich und wischte zur Sicherheit noch einmal über ihre Augen, versuchte ein Lächeln. Alina stürzte aus dem Wohnzimmer in den Flur und gleich in Richtung Bad, rief ihrer Mutter ein fröhliches »ich hab gewonnen«, zu und verschwand auch schon hinter der Türe. Jules folgte der Kleinen, lächelte verschmitzt und um Verzeihung bittend.
»Sie ist nun mal ein Wildfang.«
»Wascht euch bitte«, meinte die Äthiopierin milde, »ich muss nur noch die Scampi anbraten. Dann können wir essen.«
»Ist was?«
Jules war stehen geblieben und schaute seine Frau fragend an.
»Nein, es ist nichts«, log Alabima.
»Hast du etwa geweint?«
Tapfer lächelte die Frau und meinte beruhigend: »Zwiebelschneiden.«
»Ach so.«
Endlich wandte sich Jules ab, ging seiner Tochter ins Bad nach, um sich zumindest Hände und Gesicht zu waschen. Alabima kehrte in die Küche zurück, sah nach dem Topf mit den Kohlrabi, streute eine Prise Salz über sie, schob den Deckel wieder darüber, schaltete die zweite Herdplatte mit der Bratpfanne etwas höher, ging zum Kühlschrank und holte dort den Frischkäse heraus, legte ihn neben dem köchelnden Topf hin, holte ein Brettchen und ein Messer, zupfte ein paar Blätter und Knospen von den Stängeln der Küchenkräuter im Topf am Fenster, schnitt sie auf dem Brett klein. Sie goss Öl in die Bratpfanne und es begann sogleich zu brutzeln und so schob sie die erste Ladung Scampi zischend hinein, zog eine der Holzkellen aus dem blechernen Milchtopf neben dem Herd, begann auch schon die Meerestiere zu wenden.
Die erste Portion landete auf einem frischen Teller, den sie in die Warmhaltebox unter dem Backofen stellte, etwas Öl in die Bratpfanne nachgoss und die zweiten acht Scampi hineinhob, die wenig später ebenfalls warm gestellt wurden. Sie löschte beide Herdplatten und hob den Deckel der Pfanne weg, schälte mit einem Suppenlöffel vom Frischkäse in den Topf, streifte die Kräuter vom Brettchen darüber, verband alles mit etwas Sahne und Butter aus dem Kühlschrank, würzte noch mit Muskat und weißem Pfeffer nach, schmeckte kurz ab, gab noch mehr Muskat hinzu, zupfte zuletzt noch von einem Stängel Kerbel ein paar der Astrispen ab und verteilte sie über den Kohlrabi.
Jules trat in die Küche und begann wortlos den Tisch zu decken, holte danach eine Flasche Mineralwasser aus dem Keller, füllte die Gläser.
»War jemand an der Tür?«
Seine Frage ließ Alabima zusammenzucken. Einen Moment lang blieb sie erstarrt und wie ertappt stehen, dann wandte sie sich lächelnd ihrem Ehemann zu.
»Wie kommst du darauf?«
»Der Überwachungsbildschirm war eingeschaltet.«
Die Äthiopierin versuchte, sich nichts anmerken zu lassen.
»Ach ja. Hab ich vergessen auszuschalten. Es war bloß ein Hausierer.«
»Ein Hausierer? Was wollte er den verkaufen?«
»Es war einer vom Blindenheim. Hatte alle möglichen Bürsten bei sich. Ich hab ihm gesagt, wir bräuchten keine und hätten dieses Jahr bereits gespendet.«
Jules nickte und gab sich zufrieden, begann in einer Zeitschrift mit mäßigem Interesse zu blättern. Beide hörten, wie Alina aus dem Bad kam, denn sie zog die Türe recht unsanft hinter sich ins Schloss.
»Kommst du zum Essen, Liebling?«, rief die Mutter hinaus auf den Flur.
»Eine Minute, Maman«, antwortete diese, »ich muss mich erst noch anziehen.«
Dann waren ihre patschenden Fußsohlen auf der Marmortreppe nach oben zu hören.
»Das kann dauern«, murmelte Jules über die Zeitschrift gebeugt, während Alabima das Gemüse in einer Schüssel anrichtete, noch eine Butterflocke auf die Kohlrabi legte und mit einem Deckel verschloss, sie auf den Tisch stellte, danach die warm gestellten Scampi hervorholte, sie mit etwas Meersalz und schwarzem Pfeffer aus der Mühle bestreute.
Alina kam überraschend schnell aus ihrem Zimmer herunter, setzte sich an den Tisch, zog sofort das Glas mit dem Mineralwasser zu sich hin und sog die Hälfte davon durstig und in langen Schlucken hinunter, kam dabei außer Atem.
»Das war großartig, Papa«, kommentierte sie danach den Vormittag, »wir sollten öfters Fußball spielen. Vielleicht wirst du dann auch noch etwas besser?«
Jules blickte von seiner Zeitschrift auf und legte sie dann zur Seite, schaute seine Tochter lächelnd an.
»Ich denke, wir sollten mit dem Boxunterricht beginnen«, scherzte er, »denn darin wirst du mich nicht so rasch übertrumpfen können, Alina.«
Es wurde ein richtig schönes, entspanntes Mittagessen, vor allem, weil Alina nun doch eine zunehmende Müdigkeit verspürte und auch Jules das Recken und Strecken nach den fliegenden Bällen schmerzhaft in seinen Gliedern fühlte. Vielleicht wäre ihm sonst eher aufgefallen, wie wortkarg Alabima während des gesamten Essens blieb, dass sie kaum an ihrem Gespräch teilnahm und eigentlich bloß auf Fragen antwortete.
*
Jussuf und Sheliza hatten sich auf Mor Gabriel nach wenigen Tagen eingelebt. Mit den anderen Alawiten verstanden sie sich ausgezeichnet, zu den Schiiten und Sunniten pflegten sie kaum Kontakt. Jede der moslemischen Kirchen blieb im Grunde genommen unter sich. Die christlichen Mönche und Nonnen sorgten für die notwendige Kommunikation zwischen ihnen, spielten Puffer und Schaltstelle zugleich. Sogar drei Gebetsräume waren für die Flüchtlinge eingerichtet worden. Die Sunniten hatten allerdings darauf bestanden, ihre Andachtsstätte außerhalb der geweihten Klostergebäude einzurichten, weshalb man ihnen die ehemalige Schreinerei zuwies, die etwas abseits lag. Dort hatten sie die Werkbänke und Maschinen entfernt und den Boden mit Teppichen und Matten ausgelegt. Nur auf einen Muezzin mussten die geflohenen Syrer verzichten. Denn der Ruf des Propheten zum Gebet auf dem Gelände eines christlichen Klosters wäre den Mönchen und Nonnen wohl doch unerträglich gewesen. Da halfen auch die lautstarken Proteste der Schiiten nichts. Erzbischof und Abt Timotheus blieb zumindest in diesem Punkt hart.
Sheliza war für Arbeiten in der Wäscherei und in der Klosterküche eingeteilt. Daneben konnte sie jeden Tag für wenigstens drei Stunden am Schulunterricht teilnehmen, den vor allem die Nonnen für alle Flüchtlingskinder organisiert hatten. Von den Sunniten nahm allerdings niemand daran teil. Denn dort hatte ein selbst ernannter Imam das Zepter an sich gerissen, lehrte die Kinder ausschließlich den Koran, verbat sich jede Einmischung in die Erziehung und Erbauung der moslemischen Jugendlichen durch Vertreter des Klosters, wiegelte auch die Eltern gegen den Schulunterricht der Christen auf, machte ihnen Angst vor falschen Lehren, mit denen ihre Kinder gefüttert würden.
Sheliza allerdings genoss die Schulstunden sehr. Denn Mohammed al-Barani hatte ihnen vor allem Lesen, Schreiben, Rechnen und den Koran vermittelt, später kam noch islamische Geschichte hinzu, jedoch kein einziges naturwissenschaftliches Fach. Hier auf Mor Gabriel dagegen gab es für sie Unterricht in Biologie und Physik, auch ein wenig Chemie und in Rhetorik. Eine neue, aufregende Welt tat sich für die Vierzehnjährige auf, eine Welt, für die sie noch zu jung war, als sie noch in Damaskus lebte und dort zur Schule ging und die im religiös geprägten Unterricht des Provinzortes nicht vorkam. Von der ersten Stunde an wunderte sich die junge Muslimin über die offenen Worte der Nonnen, vor allem wenn es um Biologie und damit auch um den Glauben ging, aber auch in Physik und den Glauben, ja in Rhetorik und den Glauben. Die Christen trennten diese Dinge voneinander, stellten zwar Abhängigkeiten her, zeigten gleichzeitig aber auch gerne die Grenzen der Wissenschaft auf und benannten die Vorteile des Glaubens und damit der Religionen, blieben jedoch ohne jeden Fanatismus, beharrten nicht auf ihre heilige Schrift als einzig gültige Antwort auf sämtliche Fragen des Lebens. Nein, sie abstrahierten die Worte ihres Gottes und damit im Grunde genommen die Worte aller Gottheiten, versuchten sie in einen Kontext zu den Beobachtungen und Forschungsergebnissen in der Wissenschaft zu bringen. Sie interpretierten auch die Aussagen in ihrer Bibel für sich persönlich und für sie als Schulklasse. Die Kernaussagen der christlichen Religion schienen sich allerdings nicht großartig von den zentralen Forderungen im Koran zu unterscheiden, was Sheliza anfangs sehr erstaunte.
Vor allem wenn ihnen die noch recht junge Schwester Helene, eine hagere, blauäugige, blonde und recht groß gewachsene Nonne, in Biologie ein weiteres Wunder der Erde mit klaren Worten und ohne jede religiöse Anspielung erklärte, vermisste Sheliza ihren Vater ganz besonders. Denn auch der hatte sie stets aufgefordert, selbst zu denken und so hinter die Fassade von Tradition, Geschichte und Religion zu blicken. Immer wieder mal musste sie darum Tränen der Sehnsucht nach ihren Eltern unterdrücken. Ihr Großonkel Jussuf sprach sehr einfühlsam mit ihr darüber, sagte auch ganz klar, dass sie sich keine Hoffnung machen durfte, dass ihre Eltern und ihre Geschwister ohne jeden Zweifel Opfer des unsäglichen Bürgerkriegs geworden waren. Das machte Sheliza zwar traurig. Doch hinterher hatte sie sich auch stets gestärkt gefühlt, so als würde ihr Klarheit auch Kraft verleihen. Vielleicht war es aber auch nur ihr Trotz.
In der Küche machte sich die Vierzehnjährige ebenso rasch beliebt, wie in der Wäscherei. Unermüdlich schnitt sie Kartoffeln, wrang Kleidungsstücke durch die Mangel, zerpflückte Salat und bügelte Hemden und Hosen. Die Nonnen bewunderten ihren Einsatz, lobten sie immer wieder dafür. Doch Sheliza winkte stets bescheiden ab, sprach von einer Selbstverständlichkeit, wusste längst, dass nur ein müder Körper in einen erholsamen Schlaf finden konnte und plagende Albträume abhielt. Auch Onkel Jussuf hatte ihr am dritten Tag nach ihrer Ankunft auf Mor Gabriel geraten, sich mit aller Kraft überall einzusetzen, nachdem sie in den beiden Nächten zuvor mehrmals laut schreiend aufgewacht war.
Ihre freien Stunden verbrachte Sheliza oft auf der niedrigen Mauer vor dem Torbogen, unter dem die Zufahrtsstraße zum Kloster hindurchführte. Vor dort aus hatte sie einen weiten Blick über das Land, bis fast zur Grenze nach Syrien, wie sie sich zumindest vorstellte. Die Hügel und Senken, Berge und Täler luden zum Träumen ein, weckten Sehnsüchte, nach Freiheit und nach Weite, aber auch nach der Fremde. Was band sie noch an die Stätten ihrer Heimat? Wenn sie an Damaskus dachte, erinnerte sie sich noch an ihre Wohnung und an verschiedene Nachbarn, auch an Klassenkameradinnen und einige Lehrer. Doch all das lag bereits zu weit in ihrer Kindheit zurück, als dass sie sich noch mit ihnen verbunden fühlte. Und al-Busayrah? In dieser Stadt starben ihre Eltern, ihre Brüder und Schwestern und weitere Verwandte und Freunde. Nichts konnte sie jemals zurück zu diesen Barbaren bringen, zu diesen Fanatikern, wo die Schiiten wohl zuerst nach der Hisbollah riefen und die Sunniten darum die Dschihadisten und damit den Tod in ihre Gemeinschaft brachten. So jedenfalls hatte es Onkel Jussuf ihr erklärt.
Die Vierzehnjährige spürte, dass nicht nur das erlebte Schreckliche, sondern auch die Umgebung des christlichen Klosters, die Offenheit der Nonnen und Mönche, ihr großes Wissen um die Welt und ihr tiefer Glaube ohne jeden Fanatismus, einen immer stärkeren Einfluss auf sie ausübte. Das spürte sie vor allem in ihren Gesprächen mit ihrem Großonkel, denn der sah sie immer öfters überrascht und auch ein wenig misstrauisch an, fühlte wohl auch die starke Wandlung in seiner Großnichte, wusste wohl noch nicht, wie er darauf reagieren sollte.
»Ziemlich schräg, was die alte Schachtel uns heute vorgeschwindelt hat.«
Die Stimme ließ Sheliza erschrocken herumwirbeln. Sherif stand hinter ihr, kaum vier Schritte entfernt, musste sich leise an sie herangeschlichen haben. Sie blickte in ein grinsendes, hübsches Jungengesicht, das ein wenig wild auf sie wirkte. Sherif war zwei Jahre älter als sie, besuchte trotzdem dieselben Schulstunden, kam mit dem Stoff nicht wirklich zurecht. Der junge Sunnit kümmerte sich jedoch kaum um Fortschritte, machte selten die Hausaufgaben mit der notwendigen Ernsthaftigkeit, glaubte wohl, sich durch sein weiteres Leben schummeln zu können. Gestern hatte er damit geprahlt, dass sein Vater ein reicher Kaufmann aus Aleppo wäre, keiner dieser armen Seifenkocher, sondern ein Großhändler, der mit Europa und den USA Geschäfte machte, im ganz großen Stil. Er erzählte auch von ihrer Villa, von dem halben Dutzend Bediensteten, vom Luxus, den er gewohnt wäre. Was davon Wahrheit und was Lüge war, wusste Sheliza nicht zu sagen. Doch dieser Sherif hatte von Anfang an einen seltsam neuen Reiz auf die Vierzehnjährige ausgeübt. Vielleicht lag es an seinem selbstsicheren, ja prahlerischen Auftreten? Oder doch an seinem überaus hübschen Gesicht mit den dunklen Locken und den beinahe schwarzen, tiefgründigen Augen? Er war einen ganzen Kopf größer als sie, überragte auch alle anderen Schüler in ihrer Klasse, war schlank und wirkte drahtig, war bestimmt ein guter Sportler.
Sheliza senkte ihre Augen nicht, blickte Sherif direkt in die seinen, als müsste sie sich mit ihm messen, als wollte sie seiner Willenskraft entgegentreten und standhalten.
»Was schaust du mich so deppert an?«, maulte der sunnitische Junge, »und warum beantwortest du meine Frage nicht?«
Ungeduld war aus seiner Stimme zu vernehmen, Ungeduld und eine gewisse Herablassung. Doch Sherif war zu ihr gekommen, hatte sie wohl auf der Mauer sitzen sehen, hatte sich herangeschlichen, um sich mit ihr zu unterhalten. Er war der Suchende, nicht sie. Sheliza fühlte, wie ihre Selbstsicherheit anwuchs, trotz des Jungen, trotz dem vielen Geld seiner Eltern.
»Ich finde, Bruder Cornelius hat uns das mit den schiefen Ebenen sehr klar und verständlich erklärt.«
Das Grinsen von Sherif wurde impertinent.
»Du hast die Pointe wohl nicht mitbekommen? Schiefe Ebene und ziemlich schräg. Kapiert?«
»Ach so«, antwortete ihm Sheliza gleichgültig, »das hast du gemeint.«
Beide schwiegen, sahen einander an, der sunnitische Junge mit zunehmendem Unbehagen, das er keinesfalls nach außen zeigen wollte, das alawitische Mädchen mit der Gewissheit, die Fäden ihrer Unterhaltung fest in ihren Händen zu halten. Darum drehte sie sich auch recht gleichgültig von ihm ab, blickte wieder in die Ferne, zum Horizont hinüber, in dessen Nähe die Sonne an diesem späten Nachmittag immer rascher hin kroch.
»Ich hab dich in der Küche gesehen. Du bist ziemlich geschickt«, nahm Sherif ihre Unterhaltung erneut auf. Sheliza schaute weiterhin geradeaus, hob bloß stumm ihre schmalen Schultern an, ließ sie wieder sinken.
»Ich mein mit dem Messer«, ergänzte der Junge ein wenig unbeholfen.
Sie schwiegen beide, sahen hinüber zum blendenden Ball der Sonne, der das Land in ein zunehmend warmes Licht tauchte und die Abenddämmerung einläutete.
»Darf ich mich zu dir hinsetzen?«
Das Herz von Sheliza machte einen Hüpfer, ob vor Freude oder bloß vor Aufregung, konnte die Vierzehnjährige auch hinterher nicht sagen. Doch sie nickte stumm und der Junge setzte sich neben sie hin, schwang dann seine Beine über die niedrige Mauer, stieß dabei mit seinem Rücken unsanft an ihre linke Schulter.
»’tschuldigung«, murmelte er, aber sie winkte ab, »is’ nix.«
Beide starrten auf den Hügelzug vor ihnen, hinter dem sich dunkle Berghänge erhoben, deren Flanken bereits im Schatten der untergehenden Sonne standen. Was Sherif dabei fühlte, konnte Sheliza nicht wissen. Ihr Herz dagegen pochte hart und laut und sie hatte Angst, dass dieser Junge das wilde Klopfen womöglich hören konnte. Sie wollte sich zur Ruhe zwingen, doch das funktionierte nicht, ganz im Gegenteil. Die Hände wurden ihr feucht und sie wischte sie rasch an ihrem Rock ab.
»Schon Scheiße, das mit dem Krieg«, warf Sherif ein neues Thema auf.
»Ja, große Scheiße«, meinte Sheliza und blickte kurz zu ihm hinüber, sah in sein Gesicht, lächelte ein wenig verschämt und drehte ihren Kopf rasch wieder weg.
»Du bist mit deinem Vater hier?«
»Mein Großonkel.«
»Und deine Eltern?«
Die Vierzehnjährige antwortete nicht, fühlte, wie sich ihre Augen mit Tränen füllen wollten, schniefte kurz, kniff die Augen zusammen, unterdrückte die Regung.
»Wahrscheinlich sind sie tot.«
Ihre Worte klangen so schlicht, so klar und ohne Emotionen. Sie sollten den wahren Sturm ihrer Gefühle verbergen, ihrem Drang nicht nachgeben, laut aufzuschreien und diese Welt mit all ihrer Bösartigkeit zu verurteilen, ja, den Tod selbst anzuklagen und die Ungerechtigkeit des Lebens zu verfluchen.
»Das tut mir leid.«
Ihr aufgewühlter Trotz verflog mit seinen Worten, machte ihren Tränen nun endgültig Platz. Sie schluchzte laut auf und schlug die Hände vor das Gesicht, bedeckte ihre Augen, drehte sich auch von ihm weg und beugte ihren Kopf, spürte das Zittern am ganzen Körper, durfte endlich ganz Kind und verzweifelt sein.
Erst mit Verspätung fühlte sie seine Hand auf ihrem Rücken, wie sie zu trösten versuchte. Sie schüttelte sie sofort ab, bedauerte das gleich darauf auch schon.
»Ich wollte dich nicht…«
Seine unbeholfen ausgesprochene Entschuldigung ließ sie wieder Kontrolle über ihre Gefühle erlangen. Rasch wischte sie mit den Ärmeln die feuchten Augen trocken und sie schniefte auch zweimal. Dann drehte sie sich ihm zu.
»Ist schon gut…«
Sie schluckte noch einmal, hart und tapfer, sah dann wieder weg, hinaus auf die Ebene und in die untergehende Sonne.
»Das Leben ist nicht gerecht.«
»Nein«, pflichtete sie ihm traurig zu, »das ist es nicht.«
Sein Name ertönte laut vom Kloster her. Er drehte sich zur Stimme um, winkte ihr kurz und beruhigend zu.
»Ich muss gehen…«
Sie schwieg und er blieb unschlüssig neben ihr sitzen.
»Wenn ich etwas…?«
»Nein.«
Er schwang seine Beine wieder über die Mauer, diesmal darauf bedacht, sie nicht zu berühren. Dann hüpfte er herunter, blieb jedoch noch stehen.
»Ich mag dich. Du bist hübsch.«
Sie blickte ihn nicht an, starrte weiterhin zum Horizont hinüber und in das zunehmend orange Licht, nahm ihn vielleicht gar nicht mehr wahr oder tat wenigstens so.
»Du bist so anders…«, fügte er hinzu und musste wohl erst noch darüber nachdenken, was denn so Besonderes an diesem Mädchen war. Doch dann sah und wusste er es auf einmal und so ergänzte er leise, »…so stolz.«
Er sah nicht die wiederkehrenden Tränen in ihren Augen, sah nur, wie sich ihr Rücken und Nacken versteifte und wie sie zu zittern anfing. Sherif trat einen Schritt zur Seite, betrachtete ihre kecke Nase mit dem leichten Schwung nach oben, ihr schmales Kinn mit dem seidigen Flaum, ihr fast schwarzes, linkes Augen, dessen Pupille im Licht des Abendrotes Orange flimmerte.
Ein weiteres Mal wurde er vom Kloster gerufen, drängend und zornig.
»Also … ich muss.«
Sie reagierte nicht, sah weiterhin stur geradeaus.
Sherif wandte sich endgültig ab, verließ sie und ging mit eiligen Schritten zurück zu den Gebäuden, die in flammenden Farben standen. Er überlegte, wie alt dieses stolze, alawitische Mädchen wohl sein mochte. War sie in seinem Alter? Nein, dafür sah sie noch zu kindlich aus. Sie konnte höchstens fünfzehn sein. Oder sogar noch ein Jahr jünger. Sheliza war ihr Name, das hatte er längst erfahren.
»Sherif und Sheliza.«
Die beiden von ihm geflüsterten Namen klangen fast wie ein Versprechen.
*
Als Alabima zum Café des Avenues kam, sah sie durch die Schaufensterscheibe Fu Lingpo an einem der Tische und vor einer Tasse sitzen. Auch er hatte sie längst entdeckt, versuchte ein Lächeln, sah wenig glücklich und eher verlegen aus. Die Äthiopierin zog einen den Flügel der Glastür auf und trat ein, zog sie rasch hinter sich zu, um nicht zu viel Kälte hinein zu lassen. Während sie dem Tisch mit dem Chinesen zustrebte, öffnete sie ihren Wollmantel, streifte ihn von den Schultern, legte ihn über die Rückenlehne von einem der freien Stühle und setzte sich auf den daneben. Dabei starrte sie ihren Entführer die ganze Zeit lang an, abwartend und angriffslustig, zornig und unsicher zugleich. Als er keine Anstalten machte, irgendetwas zu sagen, ergriff sie das Wort.
»Was wollen Sie von mir? Warum sind Sie mir hierher gefolgt?«, herrschte sie ihn auf Englisch an.
Die Bedienung kam und Alabima musste sich einen Moment lang von Fu Lingpo abwenden, bestellte sich einen Pfeffermünztee.
»Im Glas oder eine Portion in der Kanne?«
Die Äthiopierin hatte längst wieder den Chinesen fixiert, wurde durch die Frage der Angestellten aufgeschreckt.
»Äh, im Glas. Nur ein Glas, bitte.«
Lingpo lächelte. Er sprach zwar kein Französisch, doch das Mienenspiel der dunkelhäutigen Frau hatte ihm wohl ihre Verunsicherung verraten.
»Ich bin hier, um sie zu beschützen, Madame.«
»Beschützen? Ich brauche keinen Schutz.«
Sie zischte diese Worte leise über den Tisch hinweg, damit niemand sonst im Lokal sie mitbekam.
»Aber, Madame, Sie und Ihre Tochter sind immer noch in Gefahr.«
Alabima schüttelte ablehnend den Kopf.
»Sie vergessen, dass ich wieder zu Hause bin. Und Sie haben wohl verdrängt, wie mein Ehemann mit Ihren Gangsterkollegen in Hongkong umgesprungen ist?«