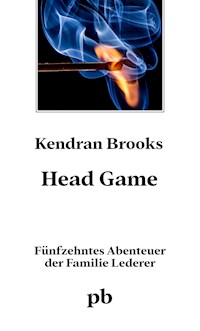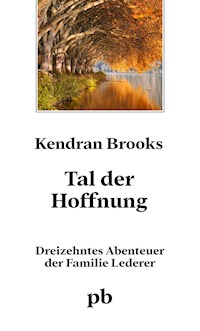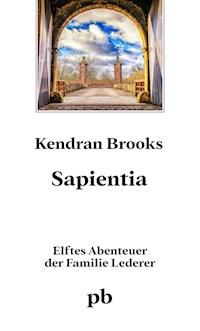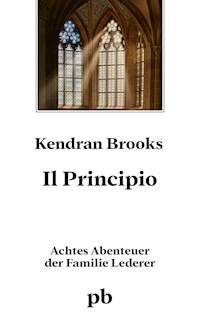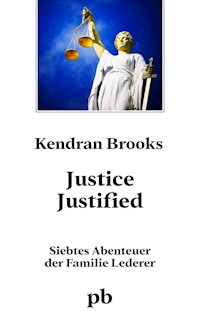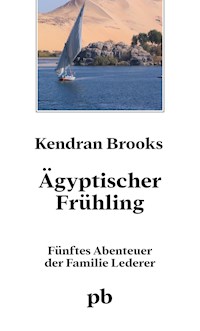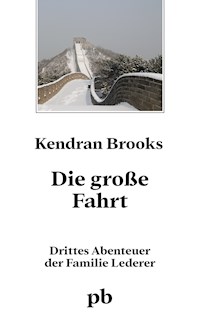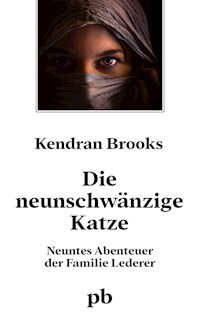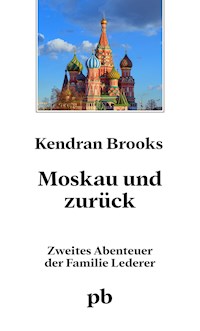
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neu aufflammender, russischer Nationalismus, Inselbegabungen und Vogelgrippe-Viren treffen 2007 auf die Subprime-Krise. Eine Großbank gerät in die Fänge der IRS, während die Lederers in Moskau um ihr Leben fürchten müssen. Kann die junge Patchwork-Familie diesem Druck standhalten und eine Lösung aus ihrer Krise finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kendran Brooks
Moskau und zurück
2. Abenteuer der Familie Lederer
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
London, Frühjahr 2005
Montag, 23. Juni 2008
Drei Monate danach: Montag, 29. Sept. 2008
2005, Sommer
Montag, 23. Juni 2008
Freitag, 26. Sept. 2008
2005, im Winter
Dienstag, 24. Juni 2008
Samstag, 6. Sept. 2008
2006, im Frühling
Mittwoch, 25. Juni 2008
Freitag, 29. August 2008
2007, Sommer
Donnerstag, 26. Juni 2008
Samstag, 13. August 2008
2007, Herbst/Winter
Donnerstag, 26. Juni 2008
Sonntag, 10. August 2008
2007, Winter
Donnerstag, 26. Juni 2008
Donnerstag, 31. Juli 2008
2008, Sommer
Freitag, 27. Juni 2008
2008, Sommer
Donnerstag, 16. Oktober 2008
Impressum neobooks
London, Frühjahr 2005
Kendran Brooks
Moskau und zurück
Zweites Abenteuer der Familie Lederer
pb
Erstausgabe (in Deutsch) als eBook 2009
Überarbeitete Version 2021
Copyright © Kendran Brooks
Umschlagbild: Fotolia, New York, USA
Umschlaggestaltung: Kendran Brooks
»Und was wollen Sie dafür haben?«
»Vierzigtausend Pfund.«
»Vierzigtausend? Na gut. Ich werde sehen, ob sich das machen lässt. Rufen Sie mich in zwei Tagen bitte an. Auf diese Nummer.«
Der elegant gekleidete, vielleicht fünfzigjährige Mann mit dem dünnen Schnauzer und dem immer noch vollem, dunkelblond-grauen Haar schob ein Kärtchen über die grauschwarz gesprenkelte Tischplatte. Ihm gegenüber saß ein etwas grobschlächtig wirkender Mann mit verbitterten, müden Gesichtszügen. Jede seiner bestimmt zahlreichen Sorgen hatten ihre Spuren darin hinterlassen. Er nahm die Karte, warf einen flüchtigen Blick darauf und steckte sie in die Brusttasche seiner speckig wirkenden Kunstlederjacke. Dann erhob er sich vom Stuhl am kleinen, runden Tisch im McDonald‘s am Piccadilly Circus. Er ächzte leise und man sah seinen steifen Bewegungen an, dass er zwar erst sechzig oder etwas älter sein mochte, seinen langsamen, aber unaufhaltsamen körperlichen Zerfall jedoch seit Jahren schmerzhaft spürte. Der zottelig wirkende, graugelbe Haarkranz um seine Glatze herum verlieh dem bloß mittelgroßen, aber korpulenten Mann das ungepflegte Aussehen eines Clochards Sein dunkelbrauner, fleckiger Regenmantel tat sein Bestes, um diesen Eindruck zu verstärken. Der Mann wirkte durch und durch durchschnittlich. In einer Gruppe von Menschen hätte man ihn kaum bewusst wahrgenommen. Und selbst wer in seiner Nähe stünde und ihm direkt in die Augen sähe, vergäße ihn nach wenigen Minuten.
Vor der Eingangstüre schob der Mann den Kragen seines Mantels hoch. Es war kühl geworden an diesem März Abend und die feuchte Luft umso unangenehmer. Er wandte sich nach rechts, ging mit langsamen, müden Schritten in Richtung Leicester Square davon. Nach wenigen Sekunden entschwand er zwischen den hunderten Touristen und Freitagabend-Partygängern.
Im McDonald‘s blieb ein nachdenklicher Henry Huxley zurück, Meister einer Freimaurerloge und guter Freund von Jules Lederer. Ja, er würde dem Schweizer noch heute Abend wegen dieser Angelegenheit anrufen. Doyle Muller war ihm bislang ein zuverlässiger Verkäufer von Informationen gewesen, auch ein geschickter Händler, der den Marktwert seiner Ware recht genau abschätzen konnte und nie übertriebene Preise verlangte. Warum sollte sich ein alternder Beamter des MI6 nicht auch ein wenig Extrageld für die Jahre nach seiner Pensionierung hinzuverdienen? So üppig fielen die staatlichen Renten nicht aus.
*
»Hallo Jules, lange nicht gesehen.«
Die Freude von Henry war nicht gespielt, denn Jules hatte sich tatsächlich einige Wochen lang nicht mehr in London blicken lassen. Die beiden hatten sich vor acht Jahren kennengelernt, als sie ein Komplott gegen den britischen Verteidigungsminister aufdeckten. Seit diesen Tagen wussten Henry und Jules, dass sie sich in jeder Situation vollkommen aufeinander verlassen konnten und eine tiefe Freundschaft verband sie.
Ständig auf der Suche nach Geheimnissen, die es aufzulösen galt, haftete den körperlich recht unterschiedlichen Männern ein und derselbe Forschergeist an. Sie waren in Grunde ihrer Herzen wahre Entdecker und Abenteurer, die durchaus auch kalkulierbare Risiken eingingen, wenn sie sich als unvermeidlich für die Aufklärung einer Frage herausstellten.
Henry Huxley war der typische, stets ein wenig distinguiert wirkende Brite, höflich aber zurückhaltend, freundlich aber selten herzlich. Man hätte ihn auf fünfzig Jahre geschätzt, wobei ihn aber sein dichtes Haar und die jugendlich blitzenden Augen eher jünger erscheinen ließen. Nur der feine Fächer an Fältchen um seine Augenwinkel herum, die tiefe, senkrechte Furche mitten auf seinem Kinn und die etwas schlaff wirkende Haut am Halsansatz deuteten auf sein wahres Alter, das gut zehn Jahre höher sein mochte. Er war schlank und groß gewachsen, gegen eins neunzig, wirkte jedoch keineswegs schlaksig, sondern drahtig wie ein englischer Offizier in Hindustan des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts. Ja, man konnte sich diesen Mann sehr gut als den Kommandanten eines Bataillons von Aufklärern vorstellen, das erfolgreich hinter den feindlichen Linien operierte. Denn wer in Henrys blaugrüne Augen blickte, erkannte darin sein Wissen über viele erprobte Fähigkeiten und einen wachen, beweglichen Geist, der jede Situation rasch erkennen, analysieren und für seine Zwecke nutzen konnte.
Jules Lederer war dunkelhaarig und besaß braune Augen, Teddybär Augen, wie mehr als eine seiner wechselnden Freundinnen übereinstimmend meinte. Sein Gesicht wirkte auf Anhieb anziehend, auch wenn seine Nase eher zu breit für sein Gesicht schien und sein Mund darum was zu schmal. Seine Lippen waren voll und hatten jenen Schwung, der gleichermaßen Sinnlichkeit und Lebenslust zeigt. Die straffe Haut um Kinn und Hals, die sich über den Wangenknochen zu spannen schien, verlieh ihm ein markant männliches, fast schon asketisches, auf jeden Fall aber sehr sportliches Aussehen. Selbst unter der gut geschnittenen Anzugjacke erkannte nicht nur ein geschultes Auge ein reiches Spiel der Oberarm- und Schultermuskulatur, wenn er sich bewegte. Man hätte den bloß mittelgroßen, jugendlich wirkenden Mann auf Mitte bis Ende dreißig geschätzt. Wahrscheinlich war er aber einige Jahre älter.
»Hallo Henry, die Freude ist ganz meinerseits. Du hast etwas für mich, hast du am Telefon gestern Abend erzählt?«
»Ja, vielleicht sogar etwas Großes. Ein MI6 Mitarbeiter namens Doyle Muller, der mir schon mehrere Male nützliche Informationen zukommen ließ, hat mir eine Bandaufnahme angeboten. Es soll der Mitschnitt eines Telefongesprächs zwischen einem Agenten der CIA und einem Banker aus Zürich sein. Das Gespräch soll bereits vor drei Jahren stattgefunden haben und sein Inhalt sei höchst interessant, wie mir Muller versicherte. Ich dachte, das könnte dich interessieren.«
»Hast du es dir schon angehört?«
»Nein. Muller meinte, der Gesprächsinhalt sei so brisant, dass er zuerst vierzigtausend Pfund sehen will. Das ist sein Preis fürs einmalige Anhören. Das Band selbst will er nicht hergeben.«
»Vierzigtausend? Und das nur fürs Anhören? Klingt interessant. Ist dieser Muller vertrauenswürdig?«
Henry kratzte sich am Kinn, wobei der Daumennagel seiner rechten Hand der senkrechten Spalte entlang schrabbte, so als wenn er die Kerbe noch vertiefen wollte.
»Ja, ich denke, die Informationen auf dem Band sind das verlangte Geld wert. Er hat mich bisher noch nie geblufft oder übers Ohr zu hauen versucht.«
»Und um welchen Bankier handelt es sich?«
»Das hat mir Muller nicht verraten. Doch er versicherte mir, es sei einer der Top Shot in der Schweiz.«
Jules zögerte nur kurz.
»Also gut, Henry. Stell bitte den Kontakt zu diesem Muller her. Wir treffen uns mit ihm so bald als möglich.«
Henrys Gesicht verzog sich zu einem breiten Lächeln und seine Augen begannen zu funkeln. Jules und er würden wieder einmal gemeinsam auf Jagd gehen.
*
Jules war auch bei diesem Besuch in London im traditionsreichen The Montague abgestiegen, nicht aufgrund der Nähe zum Russel Square Gardens, sondern wegen den Kellerräumen des Hotels. Über sie konnte man in ein Nebengebäude gelangen. Dort führte eine Luke in das Abwassersystem der Stadt. In den Tagen der Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg hatte man einige Häuser in der Gegend mit dieser bequemen Fluchtmöglichkeit ausgestattet. Jules benutzte das unterirdische Kanalsystem, um zwei Blocks weiter in ein Wohnhaus zu gelangen. Dort hatte er vor einem Jahr und unter falschem Namen eine Wohnung im Untergeschoss gemietet, die er seitdem für seine Zwecke benutzte.
Seitdem er in der Jenny-Affäre rund um den Verteidigungsminister Brown vor ein paar Jahren der Polizei die notwendigen Hinweise zur Aufklärung des Falles zugespielt hatte, ließ ihn Scotland Yard bei all seinen späteren Besuchen in der Hauptstadt rund um die Uhr beschatten. So wollte man wahrscheinlich erreichen, dass er nicht noch einmal in eine für die englische Krone politisch brisante Sache hinein stolpern konnte. Doch an diesem Morgen wollte Jules seinen Bewachern im Wagen vor dem Hotel für ein paar Stunden entwischen. Er hatte eine wichtige Verabredung.
Seine Souterrain-Wohnung enthielt ein paar unansehnliche Second-hand Möbel, wie Passanten von draußen trotz der recht blinden Fensterscheiben erkennen konnten. Doch im Badezimmer stand ein neuer, höchst professioneller Schminktisch mit hellen Strahlern und einer ganzen Reihe von kleinen Schubladen.
Aus einem der Fächer klaubte sich Jules eine falsche Nase, die er bei Charles Fox in Covent Garden passgenau für sein Gesicht hatte anfertigen lassen. Sie saß perfekt auf seiner eigenen und nachdem er die Ränder mit etwas Schminke kaschiert hatte, wirkte sie mit ihren kleinen, feinen, rot-bläulichen Äderchen überaus echt. Sie verlieh ihm eine gewisse Grobschlächtigkeit, trotz seines sonst schmalen und feingeschnittenen Gesichts. Jules klebte sich einen falschen, bauschigen Lippenbart mit ungleich lang geschnittenen, dunklen Haaren unter die Nase. Dieser machte ihn zu einer wenig gepflegten Erscheinung von Ende vierzig. In seine Haare schmierte er zudem etwas Gel, was sie fettig und klebrig erscheinen ließ. Seinen Jogginganzug und die Trainingsschuhe aus dem Hotel tauschte er in zu große, verwaschene und abgestoßene Jeans um, ausgetretene Sneakers um. Ein schlotteriger, schwarzer Wollpullover vervollständigte seine Kleidung. Zusammen mit dem fleckigen Chelsea-Schal verwandelte er sich in einen körperlich verbrauchten, miesepetrig dreinblickenden Fabrikarbeiter und Fußballfan aus dem Eastend von London. Die tausenden von Überwachungskameras der britischen Hauptstadt würden ihn auch diesmal zwar auf Schritt und Tritt begleiten, ihn jedoch kaum als Jules Lederer identifizieren.
Das mitgebrachte Geld packte der Schweizer in eine alte Plastiktüte von Tesco und machte sich dann auf den kurzen Weg zur Holborn U-Bahn-Station. Es hatte an diesem Morgen genieselt und die Straßen waren noch feucht. Nur langsam bevölkerten sich die Gehsteige mit Menschen und der Himmel über ihnen schien bloß darauf zu warten, bis sich genügend Opfer für einen neuerlichen Regenguss angesammelt hatten.
Er überholte zwei alte Frauen, die vorsichtig auf dem manchmal etwas glitschigen Gehsteig vor ihm hergegangen waren. Die eine sagte eben zur anderen »es ist doch eine Schande, wie unser Prinz Charles mit Camilla umgeht, findest du nicht auch?«, worauf die andere meinte »warum sollte er sie besser behandeln als Diana? Charles ist auf seine Art eben durch und durch ein Gentleman. Dem sind seine Hunde und die Pferde wichtiger als die Familie«.
Die beiden Frauen gackerten in einem misstönigen Kanon los.
Kurz vor dem Eingang zur Station passierte Jules zwei Bobbys, deren Blicke ihn kurz streiften, bevor sie sich an einen Obdachlosen hefteten, der auf einer trockenen Stelle am Boden unter einem Vordach saß und sich mit dem Rücken an die Hauswand gelehnt hatte. Er schien verwirrt zu sein oder betrunken oder beides zugleich.
Um halb zehn erreichte Jules die Liverpool Station und steuerte wie verabredet direkt auf den Meeting-Point zu.
»Hi, Jules«, sprach ihn Henrys Stimme von der Seite her an. Sein Freund hatte sich hinter einer aufgeklappten Zeitung aufgebaut und überwachte diskret die Bahnhofshalle, »irgendwelche Verfolger, die du noch abschütteln musst?«
»Hi, Henry. Nein, alles okay.«
»Dann geh bitte zu den Toiletten. Muller sitzt in der dritten Kabine von rechts. Zur Erkennung pfeifst du The Rain in Spain aus My Fair Lady.«
Jules setzte sich in die vierte Kabine von rechts, schloss die Tür und pfiff leise die ersten Takte von Es grünt so grün. Dann schob er die Plastiktüte mit den vierzigtausend Pfund unter der Wand hindurch in die Nebenkabine.
Er hörte, wie das Geld auf der anderen Seite aufgehoben und im Sack kurz gewühlt wurde. Dann schob eine grobschlächtige Hand mit breiten, behaarten Fingern und ungepflegten Nägeln einen Kopfhörer unter der Wand hindurch. Jules ergriff ihn und setzte ihn auf. Ein Knacken verriet ihm das Einschalten eines Kassettengeräts auf der anderen Seite.
»Guten Tag Herr Waffel, ich bin’s«, hörte Jules eine Stimme, die breites, amerikanisches Englisch sprach, wahrscheinlich ein Texaner, »hat Ihnen unsere kleine Demonstration mit Ihrer Tochter gefallen? Konnten wir Sie endlich davon überzeugt, dass Sie unser Anliegen mit ganzer Kraft unterstützen sollten?«
Auf der anderen Seite war erst schweres Atmen und dann ein mühsam unterdrücktes Fluchen zu hören. Dann polterte jedoch eine aufgebrachte Stimme los, deren nervöses, fast schon hysterisches Stakkato die Unsicherheit ihres Besitzers verriet.
»Sie verdammter Schweinehund. Was habe ich Ihnen bloß angetan, dass Sie meine Familie bedrohen?«
»Aber Herr Waffel. Es geht nicht darum, was Sie bis jetzt getan haben, sondern um das, was Sie in Zukunft für uns noch tun sollen. Mein erstes, durchaus freundlich gemeintes Angebot haben Sie ja leichtsinnigerweise abgelehnt, so dass wir uns gezwungen sahen, bei Ihnen etwas mehr Überzeugungsarbeit zu leisten. Und? Wie steht’s nun? Hat Ihnen die Entführung der Kleinen endlich klar gemacht, dass Sie keine Chance gegen uns haben? Diesmal durften Sie ihre Tochter bereits nach drei Stunden wieder gesund und wohlbehalten in die Arme schließen. Das nächste Mal wird ein Mitglied Ihrer Familie sterben, wenn Sie nicht endlich das tun, was wir von Ihnen verlangen. Ich hoffe, wir verstehen uns, Herr Waffel. Unseren Deal habe ich Ihnen vor einer Woche ausführlich erklärt. Beginnen Sie endlich mit der Umsetzung. Oder wollen Sie erst einen Ihrer Lieben tot sehen, bevor Sie vernünftig werden?«
Die Stimme des Amerikaners klang bei seinen letzten Worten fast gelangweilt, was seine Drohung noch schrecklicher machte. Ihm schien es im Grunde genommen egal zu sein, für was sich Waffel entschied.
Der Banker am anderen Ende der Leitung rang hörbar um Fassung. Dann war seine zerknirschte Stimme leise zu vernehmen: »Ja, Sie verdammtes Schwein, ja, ich mache, was Sie von mir verlangen. Doch das wird nicht so einfach sein. Die Anlagestrategie meiner Bank bestimme nicht ich allein. Da gibt es Ausschüsse und natürlich den Vorstand als oberste Instanz. Ohne die Einwilligung all dieser Organe kann ich Ihren Plan gar nicht umsetzen und ob ich meine Kollegen überzeugen kann, möchte ich doch stark bezweifeln.«
»Machen Sie sich deswegen keine Sorgen, Herr Waffel. Sie stehen nicht allein da, denn wir haben selbstverständlich weitere Entscheidungsträger Ihrer Bank in unserer Hand, ebenso wie zwei der Vorstandsmitglieder. Die von uns ausgearbeitete, risikoreichere Anlagestrategie wird man ohne große Gegenstimmen durch die Gremien winken. Vertrauen Sie uns.«
»Und wozu das alles? Warum wollen Sie meinen Arbeitgeber schädigen? Arbeiten Sie im Auftrag eines amerikanischen Hedge Funds? Geht es um eine Spekulation gegen meine Bank?«
»Aber Herr Waffel. Sie denken viel zu kurz. Aber unsere Beweggründe sollten Sie nicht weiter interessieren. Nur eines noch zum Abschied. Wir überwachen Sie und jeden Ihrer Schritte selbstverständlich auf das Genaueste. Solange Sie unseren Plan umsetzen, passiert Ihnen und Ihrer Familie nichts. Sollten Sie jedoch in irgendeiner Weise ausscheren, dann schlagen wir ohne weitere Warnung zu. Ist Ihnen das bewusst?«
Einen Moment lang war es still auf der anderen Seite.
»Ja, das ist mir in den vergangenen Tagen klar geworden«, kam dann leise die Antwort.
Das neuerliche Knacken verriet das Ende des Bandes. Jules zog den Hörer vom Kopf und schob ihn unter der Wand durch. Dann zupfte er etwas Papier von der Rolle, betätigte die Spülung und verließ nachdenklich die Kabine.
Montag, 23. Juni 2008
Die Einladung von Wladimir Sokolow war letzten Herbst eingetroffen, als Alabima hochschwanger war und sie unmöglich reisen konnten. Die Geburt ihrer Tochter Alina verlief drei Wochen später ohne Probleme und das kleine Mädchen wuchs seitdem prächtig heran. So sprach diesen Sommer eigentlich nichts mehr gegen einen Besuch des früheren Auftraggebers von Jules. Deshalb machte sich Familie Lederer aus La Tour-de-Peilz am schönen Genfersee gelegen an diesem Morgen ans Packen der Koffer.
»Hast du mein Waschzeug schon verstaut?«, rief Chufu aus seinem Zimmer im ersten Stock in die Wohnhalle hinunter. Jules stand zwischen einem losen Haufen von Koffern und blickte sich verzweifelt um.
»Ja, ich glaub schon. Du hast es doch zu deinem Sportzeug gelegt, oder?«
»Zum Sportzeug? Nein. Meine Sportsachen liegen immer noch hier oben auf dem Bett. Doch das Waschzeug ist bereits weg. Aber mal eine andere Frage: Hast du noch einen leeren Koffer für mich übrig?«
»Noch einen Koffer, Chufu?«, Jules Stimme verriet eine rasch anschwellende Verzweiflung, »wofür brauchst du denn den? Ich glaube, du hast uns falsch verstanden. Wir ziehen nicht um, sondern machen bloß vierzehn Tage Urlaub in Moskau«, und Jules fügte mit einem bissigen Ton hinzu, »du kannst deine Wintersachen und die Skischuhe also ruhig hierlassen.«
Wie die meisten Menschen, die in ihrer Kindheit wenig besessen haben, neigte auch ihr siebzehnjähriger Adoptivsohn dazu, alles und jedes was ihm in die Hände fiel zu horten. Es hatte Monate gedauert, ihm das Anlegen von Vorräten an Esswaren in seinem Zimmer abzugewöhnen. Immer wieder klaubte er aus den Schränken in der Küche Schokolade und andere Süßigkeiten zusammen und versteckte sie in der Kommode unter seiner Unterwäsche oder im Schrank zwischen den Schuhen. Für schlechte Zeiten, hatte er immer wieder achselzuckend und mit einem unschuldigen Lächeln auf den Lippen gemeint.
Jetzt hätte er wohl am liebsten auch noch seine Mini-Stereoanlage und die Playstation in den Urlaub mitgenommen, wahrscheinlich zusammen mit seiner Sammlung an alten Herman Comics. Jules wollte gerade eine diesbezüglich bissige Bemerkung hoch rufen, als seine Frau Alabima mit der kleinen Alina auf dem Arm aus dem Wohnzimmer zu ihm in den Flur trat.
»Mein Gott, Jules. Ihr Männer seid aber auch Chaoten. Ihr sollt doch einfach euer Zeug reisefertig machen. Ist das denn so schwer? Da frag ich mich doch, wie du früher als Junggeselle deine Koffer ganz allein packen konntest?«
»Das ist bloß alles Chufus schuld«, versuchte Jules abzuwiegeln, »der würde doch noch die Schmutzwäsche aus dem Wäschekorb einpacken, wenn ich ihn nur ließe«
»Gar nicht wahr«, tönte es aus dem ersten Stock herunter. Der Sohnemann hatte die Antwort seines Adoptivvaters dummerweise gehört, »Jules spielt hier den großen Organisator, bringt aber selbst nichts auf die Reihe und lässt mir in den Koffern kaum Platz für das Notwendigste. Ich werde in Moskau nackt herumlaufen müssen.«
Jules zuckte ergeben mit den Schultern und flüsterte seiner Frau zu »Schlimmer als jede Diva«, worauf ihm Alabima über zwei große Hartschalenkoffer hinweg die Tochter entgegenstreckte.
»Gib deinem gestressten Vater mal einen dicken Kuss, Prinzessin.«
Die kleine Alina lächelte ihn strahlend an, ja, schien sogar über beide Wangen frech zu grinsen, so als wenn sie ganz genau begriffen hatte, wie sehr sich Jules mit den Reisevorbereitungen überfordert fühlte.
Der Schweizer musste laut auflachen, als er den listigen Ausdruck im süßen Gesichtchen seiner Tochter erkannte. Dann beugte er sich rasch zu ihr hinüber und drückte erst Alina einen schmatzenden Kuss auf die Wange, umfasste dann aber mit dem Arm die Schulter seiner Frau und zog sie etwas näher zu sich heran. Sie küssten sich lange und leidenschaftlich, während ihre Tochter ihnen mit einem Staunen im Gesicht zuschaute.
»Wenn ich euch zwei nicht hätte«, schnaufte er glücklich.
»Und was ist mit mir?«
Chufu stand oben auf dem Treppenabsatz, beide Arme vollgepackt mit T-Shirts, Trainingshosen und einem Paar Sneakers obendrauf und grinste zu ihnen hinunter.
»Dann komm halt her und hol dir deinen Kuss«, rief Jules gespielt ärgerlich hoch, worauf sein Adoptivsohn nur verächtlich die Lippen schürzte, zum Geländer trat, seine Arme öffnete und dabei schrie: »Achtung eine HG.«
Irgendwoher hatte der Kerl diesen blöden Satz aus dem Schweizer Militär aufgeschnappt, den man ausrufen muss, wenn man eine Übungsgranate abzieht und ins Gelände schmeißt. Seine Sportsachen fielen allerdings recht kompakt herunter und landeten zielgenau auf dem blauen Stoffkoffer, der bereits gut gefüllt am Boden lag.
Jules wurde wütend.
»Aha. Du willst sie wohl da drin verstaut haben, deine Sachen, in diesem Koffer hier?«, rief er aufgebracht hoch, »na schön, mein Junge, kein Problem. Ich stopf deine Sachen gerne auch noch mit rein«, und schon riss Jules den Reißverschluss ein Stück weit auf und begann, die Trainingsschuhe durch den engen Schlitz hineinzupressen.
Alabima sah ihm kopfschüttelnd zu und meinte mitleidig lächelnd: »weißt du eigentlich, dass du gerade deine eigene Wäsche hoffnungslos zerwühlst?«
Jules hielt erschrocken inne, öffnete den Kofferdeckel ganz, schaute genauer hin und direkt auf seine ehemals glatt gebügelten Unterhemden und T-Shirts, die jetzt zusammengewuselt drin lagen.
»Sch......ade«, meinte er kleinlaut, »tut mir leid, Schatz.«
»Reißt euch endlich zusammen, ihr Kindsköpfe«, rief Alabima streng aus, »arbeitet gefälligst planmäßig zusammen und vergesst eure ewigen Sticheleien. Das Taxi holt uns in einer halben Stunde ab. Der Countdown läuft also für euch.«
Oha, dachte sich Jules, so war das also. Seine Frau strebte bereits das Oberkommando über die erste vierköpfige Auslandsexpedition der Familie Lederer an. Na, vielleicht war das auch das Beste.
»Zu Befehl, oh mein General«, antwortete Jules laut, stand gespielt stramm und salutierte zackig, lachte Alabima belustigt an.
»Stehen Sie bequem, Soldat Lederer, und arbeiten Sie zügig weiter. Gefreiter Chufu wird Sie sicher tatkräftig unterstützen, wenn Sie ihn nett darum bitten.«
Dabei lächelte sie ihn süffisant an und Jules dachte in diesem Moment unweigerlich du kleines Biest.
»Das habe ich gehört, Soldat«, war ihre Antwort auf seinen Gesichtsausdruck.
»Und warum machst du Chufu zum Gefreiten und ich bin bloß einfacher Soldat?«
Bevor Alabima antworten konnte, schallte es bereits von oben herunter: »Gefreiter muss man sich verdienen, Soldat Lederer, durch harten, zielstrebigen Einsatz und beispiellosem Kadavergehorsam. Wenn Sie sich weiterhin bemühen, wird aus ihnen in ein paar Jahren vielleicht doch noch ein nützliches Mitglied in unserem Verband. Strengen Sie sich also weiterhin an und geben Sie Ihr Bestes.«
Jules zerknirschte den Fluch auf seinen Lippen, während Alabima mit ihrer Tochter leise lachend wieder im Wohnzimmer verschwand.
Natürlich wurden sie mit Packen rechtzeitig fertig. Als dann aber der Mercedes Kleinbus des Taxiunternehmens auf den Vorplatz zu ihrer Villa einbog, schaute Jules seine Frau völlig entgeistert an.
»Größer ging wohl nicht, mein Schatz?«
»Na, drei Hartschalenkoffer, den blauen Stoffkoffer, drei Taschen und dazu der Kinderwagen. Hätte ich etwa einen Smart bestellen sollen, mein Schätzchen?«, meinte sie spöttisch, »die kluge Frau baut eben vor, wenn sie mit zwei männlichen Chaoten wie euch verreisen muss.«
*
Am Flughafen angekommen packten sie ihre Sachen auf zwei Rollwagen. Chufu übernahm den einen, Jules den anderen. Sein Stiefsohn und er verstanden sich wie die meiste Zeit über, ohne ein Wort zu wechseln. Wie auf Kommando rannten sie plötzlich los und in Richtung der Check-In Schalter der Swiss. Es war der ewige Wettkampf der beiden. Wer würde das Ziel als erster erreichen und über den anderen triumphieren? Chufu gewann diesmal knapp, weil Jules einer älteren Frau mit ihrem verdammten Kofferwagen ausweichen musste. Die Frau kam von links und nahm ihm eindeutig die Vorfahrt, was sein Sohn kaltschnäuzig ausnutzte, elegant dem Beinahe-Zusammenstoß auswich und zuerst den Schalter erreichte.
Natürlich plärrte Chufu seinen Sieg ungebührlich laut heraus und klopfte sich zufrieden auf die Schenkel. Und Jules erntete zum Gelächter seines Adoptivsohns auch noch den mitleidigen Blick der Frau hinter dem Check-In Schalter der ersten Klasse.
Vater und Sohn mussten dann aber noch eine geraume Zeit auf Alabima warten. Sie kam gemächlich, mit Alina auf dem Arm und den Tickets und Pässen in ihrer Handtasche näher. Zwanzig Sekunden waren verdammt lang, wenn man untätig vor einer Schalterperson herumstand und ihren Blicken ausgesetzt war.
Als das Gepäck endlich aufgegeben, die Zollkontrolle abgewickelt, die Shoppingmeile abgeklappert und ihr Flug aufgerufen war, atmete Jules das erste Mal an diesem Morgen auf. Ihr Urlaub konnte beginnen.
*
»Du hast mir bisher nur wenig über die Sokolows erzählt. Wie immer machst du wieder ein Riesengeheimnis um deine Vergangenheit. Du kennst die beiden von früher her, hast du gesagt?«
Alabima hatte sich über die breite Lehne ihres Sitzes in der ersten Klasse des Airbus 320 zu Jules und Alina hinübergebeugt und schob ihrer Tochter den eben verlorenen Schnuller routinemäßig wieder zwischen die schmatzenden Lippen. Chufu saß hinter den drei und vergnügte sich mit dem elektronischen Unterhaltungsprogramm an Bord des modernen Flugzeugs. Neben ihm saß eine attraktive Frau von Mitte zwanzig mit langen, blonden Haaren. Chufu musterte sie immer wieder verstohlen von der Seite her. Mit seinen siebzehn Jahren war er für weibliche Reize längst empfänglich, selbst wenn ihm die Frau doch eher als zu alt für sich erschien. Immerhin zeigten sich bei ihr schon die ersten, feinen Fältchen um die Mundwinkel herum. Doch ihr Parfum betörte ihn mit seinem dezenten Moschusduft, der von starken Zitrusfrüchten überlagert wurde. Er lenkte seine Augen immer wieder von seinem elektronischen Spiel ab und zu ihr hin.
Ihr leichtes Make-Up war makellos, wie er bewundernd feststellte. Die glutroten Lippen schienen wie mit dem Meißel herausgearbeitet, so scharfkantig waren die Ränder. Chufu seufzte unbewusst leicht auf, worauf die junge Frau ihm ihr spitzbübisches Gesicht kurz zudrehte und ihn spöttisch anlächelte.
Sie kannte ihre Wirkung auf jüngere und ältere männliche Semester sehr genau. Chufu lief auch prompt rot an und vertiefte sich wieder in die Schachpartie, die er gegen den Computer längst verloren hatte. Hoffentlich erkannte das die Blondine neben ihm nicht. Rasch beendete er das Spiel und startete ein neues.
»Ja. Ich habe vor neun Jahren für Wladimir Sokolow einen Auftrag erledigt«, meinte Jules leise zu Alabima gewandt. Sie sah in seinen Augen den tiefen Ernst und die Bilder, die ihm die Erinnerung an den Fall zurückbrachten.
»Um was ging es denn?«
»Du weißt, dass ich nicht gern über meine Arbeit von früher rede und dich nicht damit belasten will. Doch ich denke, du hast in diesem Fall ein Recht darauf mehr zu erfahren. Wladimir Sokolow hatte damals Probleme mit einer lokalen Verbrecherorganisation. Diese versuchten, Schutzgeld von einigen seiner Unternehmen zu erpressen. Er hatte mich beauftragt, das zu beenden.«
»Eine Verbrecherorganisation? Etwa die russische Mafia?«
Alabimas Stimme klang besorgt.
»Nicht die Mafia, bloß ein paar unbesonnene, aber äußerst brutal vorgehende Jungs, die sich überschätzten und glaubten, sich in Moskau selbständig machen zu können.«
»Und du hast dieses Problem für Sokolow gelöst?«
»Ja, das habe ich. Genau genommen hat die Armee die Arbeit für uns erledigt. Ich kenne aus meiner ersten Zeit in Russland noch ein paar der Generäle, du weißt, als sich damals Jelzin nach Beendigung des Augustputsches an die Macht schwingen konnte und Gorbatschow ablöste. Ich sprach mit einem dieser Generäle über die Banditen und er ordnete wenig später eine Anti-Terrorübung im Gebäude an, in dem das Hauptquartier der Gangster lag. In deren Verlauf stießen die Soldaten auf das umfangreiche Waffenarsenal und im anschließenden heftigen Feuergefecht wurden alle Mitglieder der Bande erschossen. Auch drei Soldaten kamen dabei ums Leben.«
Alabima sah ihren Ehemann entsetzt an.
»Das ist ja schrecklich.«
Jules schaute sie schuldbewusst an.
»Glaub mir, ich bin wirklich nicht stolz auf diese Lösung, ganz bestimmt nicht. Doch es war eine üble Bande, die mit aller Härte ein Stück des Erpresser-Kuchens abzubeißen versuchte. Mit zwei Bombenanschlägen gegen Einrichtungen von Sokolow wollten sie ihn gefügig machen. Dabei starben mehr als ein halbes Dutzend Unschuldiger. Jemand musste diesen Irrsinn einfach beenden.«
»Und die Polizei konnte gegen diese Gangster nicht vorgehen?«
»So einfach war das im damaligen Russland leider nicht und ist es wohl auch heute noch nicht. Da gibt es unterschiedliche Interessengruppen, die sich von der Politik, über die Wirtschaft, über den Geheimdienst, die Armee und die Polizei bis hin zur Mafia und anderen Verbrechersyndikaten ausstrecken. Nach der Perestroika war in ganz Russland auf allen Ebenen der Gesellschaft ein Verteilungskampf um die Wirtschaftsgüter entbrannt, ein Kampf, der sich seit dem Explodieren der Energiepreise vor zwei Jahren sogar noch verstärkt hat. Denk an die Verhaftung des früheren russischen Milliardärs Michail Chodorkowski. Er wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt, zwangsenteignet und verbüßt nun eine achtjährige Haftstrafe, bloß weil er pro-westliche Parteien in Russland unterstützt hat und es wagte, gegen Putin zu opponieren und die grassierende Korruption anzuklagen.«
»Und in ein solch gefährliches Land nimmst du uns mit?«
Aus Alabimas Stimme schwang ernste Besorgnis mit.
»Ach, wir sind doch bloß vier Touristen aus dem Westen, so wie viele Millionen andere, die sich jedes Jahr in Moskau tummeln. Mein Einsatz für Sokolow liegt auch fast zehn Jahre zurück. Niemand erinnert sich dort noch an mich.«
»Zumindest die Sokolows tun es noch, wie ihre Einladung an uns beweist«, meinte seine Frau skeptisch, »und vielleicht tun es auch noch andere? Was ist dieser Wladimir Sokolow eigentlich für ein Mensch?«
»Er ist ein Oligarch der ersten Stunde, einer, der sich seine ersten Milliarden bereits Anfang der neunziger Jahre verdient hat.«
»Seine ersten Milliarden? Ich dachte, Russland war damals noch ein kommunistischer Staat? Wie kann da jemand Milliarden zusammenraffen?«
»Sokolow hat es mir einmal ausführlich erzählt. Damals muss es für einen entschlossenen Mann lächerlich einfach gewesen sein, ein großes Vermögen zu verdienen. Über seine guten Verbindungen zur Parteizentrale konnte er einige Verwaltungsbeamte bestechen. So erhielt er Importlizenzen für verschiedene technische Geräte aus dem Westen. Anfang der 1980er Jahre begann er zum Beispiel im großen Stil Faxgeräte in Europa und den USA aufzukaufen. Du musst wissen, damals waren Faxgeräte etwas recht Neues. Sie revolutionierten die Kommunikation zwischen den Unternehmen, vielleicht nicht so stark, wie das Internet mit seinen Emails ein paar Jahre später, aber immer noch gewaltig. Denn plötzlich konnte man innerhalb von Minuten detaillierte Informationen austauschen oder Verträge abschließen, wofür man zuvor viele Tage benötigt hatte. In Russland waren Faxgeräte damals Mangelware und heiß begehrt. Die meisten Unternehmen besaßen aber nicht die notwendigen Importbewilligungen, verfügten auch nicht über westliche Devisen. Dies wusste Sokolow selbstverständlich und hat darum als Bezahlung für die Geräte Naturalien akzeptiert, vor allem Schrott.«
»Schrott? Wie kann man mit Schrott Milliarden verdienen?«
»Es kommt bloß auf die Menge an. Ein Faxgerät kostete ihn damals im Einkauf rund tausend amerikanische Dollar. Verkauft hat er die Geräte dann für beispielsweise sechzig Tonnen erstklassigen Stahlschrott oder zwanzig Tonnen Aluminiumschrott. Du weißt sicher, dass die mangelhafte wirtschaftliche Koordination im zentral geführten Sowjetreich zu ruinösen Fehlleistungen führte. Doch in diesem gewaltigen Land gab und gibt es so viele natürliche Ressourcen, dass man sich nie um Verschwendung scheren musste. Der anfallende Schrott wurde deshalb gar nicht wiederverwertet wie im Westen. Jahrzehntelang stellte man nur neuen Stahl und neues Aluminium her, während sich die ausrangierten Fahrzeuge und Maschinen auf riesigen Schrottplätzen anhäuften. Sechzig Tonnen Stahlschrott oder zwanzig Tonnen Aluminium besaßen damals im Westen einen Gegenwert von etwa fünftausend Dollar. So kaufte Sokolow also ein Faxgerät für tausend ein und verkaufte es für fünftausend. Kein schlechtes Geschäft, wenn du daran denkst, dass die Sowjetunion in wenigen Jahren hunderttausende von diesen Geräten benötigte. Und wenig später folgten dem Fax viele Millionen Personal Computer. Sokolow verdiente über all die Jahre hinweg sein Geld wie Heu und ohne das geringste wirtschaftliche Risiko.«
Alabima sah ihren Ehemann ungläubig an.
»Millionen von Computern?«
»Vergiss nicht, die Wirtschaft der Sowjetunion war damals in zehntausende von Kolchosen mit Millionen einzelner Unternehmen aufgeteilt. Der Bedarf nach modernen Bürogeräten und später, nach der Öffnung der Grenzen zum Westen, auch nach hochwertigem Büromobiliar, war einfach gigantisch. Ich habe selbst erlebt, wie Mitte der neunziger Jahre in Europa die Lieferfristen für Büromöbel von vier auf zwölf Wochen anstiegen, weil der größte Teil der Produktion zu Fantasiepreisen in den Ostblock verscherbelt wurde. Der Schrotthandel der Sowjetunion mit dem Westen erreichte in diesen Jahren solch enorme Ausmaße, dass die Preise weltweit auf die Hälfte zusammenbrachen. Eisenerzminen und Stahlhütten in ganz Europa wurden für Jahre unter starken finanziellen Druck gesetzt, mussten ihre Produktion verringern oder gar geschlossen werden. Dass die Stahlpreise weltweit in den letzten zehn Jahren wieder angestiegen sind, liegt weniger an der ungebrochenen Nachfrage als an den aufgelösten Schrottlagern der Sowjetunion, die heute leer stehen. So fehlt der billige Nachschub und die Preise können endlich wieder steigen. Doch Sokolow und andere Oligarchen hatten ihre Milliarden längst im Trockenen.«
Jules sah Alabimas Stirn an, dass sie sich dies alles vorzustellen versuchte, wie Russland durch einige entschlossene Männer in wenigen Jahren ausgeplündert wurde, wie der während der Sowjet-Zeit angesammelte viele Millionen Tonnen wiegende Schrott nach und nach zu Dumpingpreisen in den Westen gelangte, wie die Stahlindustrie weltweit von diesem Segen aus dem Osten bedrängt wurde. Und so ergänzte Jules: »So etwas passiert eben überall dort, wo der Staat seine Märkte vor dringend benötigten Importen künstlich abschottet, gleichzeitig gewisse Hintertürchen offenstehen lässt. Es treten dann immer Profiteure auf, die in wenigen Jahre riesige Vermögen anhäufen. Eine Variante davon findest du beispielsweise im Verkauf von Medikamenten in Afrika. Viele Staaten kennen dort eine strickte Devisenbewirtschaftung. Für die meisten Güter bestehen wertmäßige Beschränkungen für den Import, so auch für die teuren Medikamente aus dem Westen. Der Bedarf im Land übersteigt jedoch die vorgesehenen Import-Mengen. Doch weil der Staat nicht über genügend viele Devisen verfügt, muss er auf eine flächendeckende Versorgung seiner Bevölkerung verzichten. Sobald jedoch eine Regierung abgewählt wird, schmieren die Pharmakonzerne noch rasch die alten Minister und erhalten im Gegenzug eine Sonderbewilligung für zusätzliche Importe. Später muss dann die neue Regierung einen Weg finden, wie sie den massiven Abfluss an Devisen anderweitig stoppen kann, um ihre eigene Währung stabil zu halten.«
»Ist das etwa auch in meinem Heimatland so?«
Alabima blickt Jules sichtlich besorgt an.
»Ja, es wäre wahrscheinlich auch bei deinen Leuten so, wenn die Regierung jemals wechseln würde. Aber dank des Wahlbetrugs von 2000 und 2005 steht die EPRDF ja weiterhin an der Spitze deines Landes. Und so spart sich Äthiopien wenigstens diese teuren politischen Ablösekosten«, meinte Jules sarkastisch.
»Und was ist dieser Sokolow für ein Mensch?«
»Du wirst ihn mögen, denk ich. Er ist sehr gebildet, wie viele Russen. Er kennt sich in der Literatur aus und umgibt sich gerne mit ausgesuchten Kunstwerken. Mittlerweile ist er weit über sechzig Jahre alt und sicher etwas ruhiger geworden. Manchen Menschen erscheint er wohl ein wenig überheblich, was aber bei einem Selfmade-Milliardär nichts Besonderes ist.«
»Und seine Geschäfte laufen heute immer noch problemlos?«
»Er hatte damals eine Vereinbarung mit Jelzin getroffen. Der ließ ihn in Ruhe. Bestimmt hat er später auch mit Putin einen Weg gefunden. Er wird wohl der Partei einen angemessenen Anteil an seinen Gewinnen überlassen und zusätzlich viel Geld für soziale Belange spenden. Soviel ich weiß, hat er sein Vermögen heute vor allem im Erdgassektor und in russischen Banken angelegt. Forbes schätzt ihn zurzeit auf acht bis zehn Milliarden Dollar.«
»Und so ein Mann lädt uns einfach so zu sich nach Hause ein?«
»Sokolow ist zwar einiges älter als ich. Doch wir verstanden uns auf Anhieb ausgezeichnet. Er war damals noch ein echter Pirat, oder vielleicht besser ausgedrückt ein Freibeuter, der die Umstände seines Landes genau kannte und danach handelte. Er ist immer noch mit seiner ersten Frau Irina verheiratet, eine Seltenheit im modernen Russland, wo die Reichen ihre Frauen öfters wechseln, als wir unsere Autos. Sie haben einen Sohn, der Nikolai heißt, und zwei Töchter, die etwa in deinem Alter sind, Jelena und Natascha.«
»Und wo leben die Sokolows? Direkt in Moskau oder außerhalb?«
»Wo sie wohnen? Sie werden bestimmt ein paar Häuser oder Wohnungen in der Stadt besitzen. Doch ich denke, sie leben immer noch die meiste Zeit über auf ihrer Datscha, etwa dreißig Kilometer außerhalb von Moskau.«
»Eine Datscha? Ist das nicht ein russisches Wochenendhaus?«
»Als Wochenendhaus würde ich es in diesem Fall nicht bezeichnen, Liebling. Aber du wirst es ja selbst in ein paar Stunden sehen. Lass dich überraschen.«
Drei Monate danach: Montag, 29. Sept. 2008
Jules saß bestimmt seit einer Stunde regungslos im Zimmer der kleinen Alina, hatte sich einen Stuhl neben das leere Kinderbett gestellt, sich gesetzt und starrte seitdem gedankenverloren auf das schneeweiße Laken, das nur leichte Knitter aufwies. Er spürte, dass ihm sein rechtes Bein eingeschlafen war, denn er konnte es nicht mehr bewegen, hing wie tot an seinem Körper, gefühllos und abgestorben.
Sollte er aufstehen und damit die Ameisen in seinen Blutbahnen aufwecken? Doch aus welchem Grund sollte er sich noch einmal von diesem Stuhl erheben?
Draußen brach die Abenddämmerung an. Trübes Herbstlicht drang durch die Fensterscheibe, lullte alles im Zimmer ein. Es war, als wenn der Himmel selbst den Schmerz in der Brust von Jules barmherzig dämpfen wollte. Doch die Trübheit hatte sich längst in sein Herz hineingefressen, hatte sich dort ausgebreitet, vergiftete seine Seele.
Wie konnte es bloß soweit kommen?
Unbewusst schüttelte Jules seinen Kopf.
Zugegeben. Er hatte als Lebenspartner von Alabima und als Vater von Chufu und Alina auf der ganzen Linie versagt. Und er war dafür vom Schicksal hart bestraft worden. Doch durfte eine Strafe so vernichtend ausfallen? War das gerecht?
Sein Hausarzt, Robert, ein wirklich guter Freund, hatte ihm irgendwelche Tabletten verschrieben. Er sollte sie ein paar Wochen lang einnehmen, hatte ihm Robert eindringlich nahegelegt, dann würde er sich rasch wieder besser fühlen.
Doch was wusste sein Arzt schon von seiner Trauer?
Ja, Jules wollte trauern, schämte sich keineswegs dieses tiefen Gefühls der Hoffnungslosigkeit, das von Woche zu Woche immer stärker Besitz von ihm ergriff und ihm seinen Lebenswillen entzog. Ja, es verlangte ihn nach dieser selbstzerstörerischen Stimmung in seinem Herzen, nach der Düsternis, die sein Leben von innen heraus auffraß
Was war der Sinn des Lebens?
Was war der Sinn seines Lebens?
Jules erinnerte sich an einen guten Freund von früher. Der hatte doch eine Kurzgeschichte über den Sinn des Lebens geschrieben. Ja, das Buch müsste immer noch im Regal in seinem Büroraum unten stehen. Sollte er es holen gehen?
Er entschloss sich dazu. Ächzend stand er auf, unfähig, sein gefühlloses rechtes Bein zu belasten, ohne einzuknicken. Er verharrte schnaufend, ertrug stoisch den heftigen Schmerz, als sich das Blut den Weg durch die Adern und Venen bahnte. Immer noch hinkend ging er in die Eingangshalle hinunter, in sein Büro. Ja, dort stand es, so leuchtend orange, dass man es auf den ersten Blick zwischen all den anderen Büchern entdecken musste. Er zog den schmalen Band hervor, ging wieder hoch ins Zimmer von Alina, setzte sich wieder auf den Stuhl neben dem Bettchen, suchte sich die Geschichte heraus.
*
Der Sinn des Lebens
Vor ein paar Wochen war ich am Gymnasium in Tübingen. Eine Lehrerin hatte mich zum Schriftstellerkurs ihrer Abschlussklasse eingeladen. Ich vermutete insgeheim, ich sollte dort als abschreckendes Beispiel eines Nichtskönners präsentiert werden. Doch ich verfügte gerade über die notwendige Zeit und die Lust und wagte deshalb den Auftritt.
Die Lehrerin stellte sich wenig später als eine glühende Bewunderin meiner Bücher heraus und ich ließ sie deshalb drei oder vier Kurzgeschichten auswählen, die ich den Schülern anschließend vorlas. Nach dem eher höflichen, als begeisterten Klatschen der Schüler begann die allgemein übliche Fragestunde. Bereits die Nummer drei war ein echter Hammer: Eine hübsche Blondine mit kessem Blick und spitzer Nase fragte mich, was denn, meiner Meinung nach, der wahre Sinn des Lebens sei.
Bevor ich ihr salopp antworten konnte mit Selbstverständlich Sex, Drugs and Rock’n’Roll, rief ich mich zur Ordnung und meinte stattdessen: »Der Sinn des Lebens? Keine einfach zu beantwortende Frage. Lassen Sie uns doch gemeinsam diesem ewigen Rätsel der Menschheit nachspüren.
Unser Weg zur Findung der Antwort soll dabei möglichst rational und objektiv sein. Lassen wir jede Gefühlsduselei und vor allem die Philosophie beiseite. Denn Gefühle verschleiern die wirklichen Zusammenhänge und mit der Philosophie lässt sich alles und nichts begründen. Halten wir uns stattdessen strikte an die bekannten Tatsachen.
Pflanzen und Tiere sind Teile der Natur. Natur heißt ständige Veränderung der Umweltbedingungen. Um mit diesem Wechsel zurechtzukommen, hat die Natur das Konzept der Evolution entwickelt: Eine Generation folgt der vorherigen und mit jeder von ihnen werden kleine Veränderungen in den Genen als mögliche Antwort auf sich wandelnde Lebensbedingungen eingebaut.
Pflanzen und Tiere sind bei der Vermehrung stark von ihren Instinkten geleitet und weniger von Erfahrung. Zwar geben bei einzelnen Tierarten die Mütter den Kindern etwas an Wissen mit auf den Lebensweg, doch beschränkt sich diese Weitergabe von Informationen mangels Aufzeichnungsmöglichkeiten auf die direkte, persönliche Anleitung. Das schränkt die Menge und die Qualität der Informationen stark ein.
Aus diesem Grund müssen sich Pflanzen und Tiere auch in Zukunft fast ausschließlich auf die Evolution verlassen. Um das Aussterben der eigenen Art zu verhindern, liegt der Sinn des Lebens von Pflanzen und Tieren darum einzig in der Reproduktion der eigenen Art.
Bei uns Menschen liegt die Sache etwas anders gelagert. Wir haben die Sprache, später Bilder und Schrift entwickelt, um Erfahrungen direkter und umfangreicher weitergeben zu können. So steht uns nicht nur das Wissen unserer Eltern, sondern die Erfahrungen und Erkenntnisse von Jahrtausenden zur Verfügung. Ich glaube, es war Terry Pratchett, der Autor der Scheibenwelt Romane, der den Menschen als einen Geschichten-erzählenden-Affen beschrieb hat, was uns wohl sehr treffend karikiert.
Dank dem Reservoir an bestehendem und weiter gegebenem Wissen können wir uns rascher als die übrige Natur auf Veränderungen einstellen. Ein gutes Beispiel dafür sind die Grippe-Viren. Kaum sind sie von der Natur erschaffen, wird ihre Wirksamkeit durch die moderne Medizin zunichte gemacht.
Diese Überlegenheit gegenüber der Natur besteht bereits seit längerer Zeit. Vor einigen hunderttausend Jahren hat der Mensch das Feuer für die Zubereitung von Speisen entdeckt und so seine Ernährungsmöglichkeiten stark erweitert. Mindestens seit dieser Zeit ist er deshalb auf der Suche nach einem zweiten Sinn in seinem Leben, neben der Reproduktion.
Leider bringt uns das Streben nach mehr Sinn laufend in neue Schwierigkeiten. Denken Sie an die Religionen, die uns Dinge erklären, welche uns die Wissenschaft nicht zweifelsfrei beweisen kann. Die Religionen befriedigen unser metaphysisches Bedürfnis. Doch wer einzig in der Religion seinen zweiten Lebenssinn findet, ruft leicht Kriege gegen andersgläubige aus, gegen die Feinde seines zweiten Lebenssinns. Oder denken wir an die großen Eroberer, an Könige und Wirtschaftskapitäne. Sie schaffen sich ohne Rücksicht und mit allen Mitteln ihre Reiche, über die sie herrschen können. Dabei spielt für sie das Schicksal ihrer Untertanen nur eine geringe Rolle. Beide, der religiöse Fanatiker, wie der nach Macht strebende Mensch, haben allerdings zumindest zeitweise ihren Götzen gefunden, dem sie huldigen können und der sie glücklich macht.
Auch Künstler haben Momente voller Glück, wenn sie etwas Einmaliges geschaffen haben. Oder nehmen Sie die Sieger im Sport oder Spiel. Sie fühlen sich allesamt großartig und sind überglücklich. Ja selbst der Unterlegene spürt ein Glücksgefühl, wenn er nur gut genug gekämpft hat. Und genau dies dürfte der zweite und eigentliche Sinn unseres Lebens sein, nämlich Glück zu verspüren.
Vielleicht fragen Sie sich nun, wie man sein Glück finden kann? Das ist einfacher, als man gemeinhin annimmt. Kehren wir für die Beantwortung dieser Frage zum ersten Sinn des Lebens zurück.
Der Sinn der ständigen Reproduktion beruht auf dem Konzept der Evolution: Was sich ständig erneuert, kann sich anpassen. Den zweiten Sinn des Lebens, Glück zu verspüren, können wir erfüllen, in dem wir nach dem Konzept Freude haben und Freude geben leben. Denn wer sich Freude verschafft und im selben Masse Freude verschenkt, verspürt nicht nur Glück allein, er lässt auch andere am Glück teilhaben. Suchen Sie sich also möglichst viele Freuden und verteilen Sie so viel Freude wie Sie nur können. Wägen Sie dabei aber immer ab, welche Freude Ihnen hier und jetzt am meisten Glück beschert und beschränken Sie sich darauf. Denn alle Freuden der Erde kann niemand ausleben. An einer Party mit Freunden müssen sie sich zum Beispiel zwischen den anregenden Gesprächen und dem Alkoholrausch entscheiden. Beides zusammen geht nicht. Wägen Sie daher immer klug ab.
Der griechische Philosoph Epikur hat bereits vor über zweitausend Jahren das Glück zum einzigen wirklichen Sinn des Lebens erhoben. Dabei schränkte er dieses Glück aber allzu sehr auf die eigene Person ein und schürte so auch den Egoismus. Die Epikureer waren darum lange als genusssüchtige Egoisten verschrien. Soweit sollten Sie es also nicht kommen lassen. Nein. Um glücklich zu sein gehört nicht nur das Erleben der eigenen Freude, sondern genauso das Erleben der Freude bei anderen Menschen.
Und wenn Sie gleichzeitig auch noch der Natur Genüge tun und den ersten Sinn des Lebens dabei erfüllen, umso besser für die Menschheit.«
Ich war höchst zufrieden mit meinen Ausführungen. Im Klassenraum blieb es jedoch erst noch ein paar Sekunden lang still, bevor ein paar der Schüler mit den Fingerknöcheln auf ihr Pult zu klopfen begannen, was ich als allgemeine Zustimmung zu meiner Antwort wertete. Mein Kopf war in diesem Moment wohltuend leer, so als wenn sein gesamter Inhalt ausgeschüttet wäre. Ich war eins mit dem Universum. Die Anschlussfrage derselben Blondine holte mich allerdings wieder in die Realität zurück, denn sie wollte wissen, ob ich Pizza mag.
*
Jules klappte das Buch zu. Ja, wir Menschen verlangten nach mehr Sinn in unserem Leben. Unser Fortpflanzungstrieb genügte zwar, um zu heiraten, Kinder zu zeugen und sie aufzuziehen. Doch die vielen Trennungen und Scheidungen bewiesen, dass dieser Zweck allein auf Dauer nicht genügte. Manche Menschen wandten sich darum mit Inbrunst einer Sache zu. Ob es sich dabei um eine Religion, ein Vorbild oder ein Hobby handelte, spielte kaum eine Rolle. Andere wiederum vergruben sich in ein hektisches Treiben, vielleicht, um nicht wirklich über ihre verbleibenden Jahre auf Erden nachdenken zu müssen. Wie schrieb Goethe in seinem Die Leiden des jungen Werther? Es ist ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Teil der Zeit, um zu leben, und das bisschen, das ihnen von Freiheit übrigbleibt, ängstigt sie so, dass sie alle Mittel aufsuchen, um es loszuwerden.
Und die Lehre von Epikur kann man in einem einzigen Satz zusammenfassen: Meide den Schmerz und die Pein und füge auch anderen keine Schmerzen oder Pein zu und du findest das wahre Glück auf Erden.
Doch wie sollte er jemals wieder Glück empfinden, nachdem er das Wertvollste in seinem Leben verloren hatte? Und falls Glück der eigentliche Sinn des menschlichen Lebens ist, unter welchen Umständen konnte er dann noch weiterleben?
Jules erhob sich wieder vom Stuhl, trat zum Fenster, blickte durch die Gardine hinaus auf den dunkel unter ihm liegenden See. Nicht mehr lange und die Nacht würde alles verstecken, erst die Bergkette in der Ferne, später den See und sogar den Garten. Es waren nur wenige Schritte hinunter zum Wasser. Es würde sehr kühl sein, kaum zehn Grad Celsius. Die Kälte würde rasch in seinen Körper dringen, ihn erst unempfindlich machen, dann vollkommen lähmen. Die Gleichgültigkeit würde ihn überkommen, ihn herzlich empfangen.
Er ging zurück zum Stuhl, setzte sich, starrte auf das Laken mit den feinen Fältchen. Sein Blick war leer.
2005, Sommer
»Für die Installation der Wanzen berechnen wir Ihnen eine Pauschale von fünfzigtausend Franken. Darin enthalten ist auch die spätere Entfernung der Geräte. Für die 24/7 Überwachung der Mikrophone und die Fallen Sonderarbeiten an, so beträgt unser Stundenlohn dreihundert Franken. Die Mehrwertsteuer ist in diesen Beträgen noch nicht enthalten.«
Der Mann im unauffälligen, braun-grauen, sportlich geschnittenen Anzug hatte sich ganz vorne auf die Kante des Stuhles gesetzt, den er von Jules angeboten erhalten hatte. Es sah fast danach aus, als wenn er befürchtete, das Möbelstück allzu stark abzuwetzen. Sie hatten sich in Jules Büro in seinem Haus am Genfersee gesetzt und besprachen den geplanten Einsatz des Privatdetektiven und seiner Mitarbeiter im Fall des Bankiers Waffel.
Der vielleicht Fünfunddreißigjährige blickte äußerst freundlich drein, sah auch proper und überaus korrekt aus, hatte ein fein geschnittenes Gesicht und recht feminine Hände, wie Jules bei der Begrüßung aufgefallen war. Seine schmale Nase und die dünnen Lippen, die wie Striche in seinem Gesicht wirkten, zeigten einen Menschen, der niemals mehr verspricht, als er halten wird. Sein Händedruck war angenehm trocken, warm und fest zugleich. Vor Jules Lederer saß kein Blender, sondern ein Fachmann, der auf sein Können, sein Wissen und seine Erfahrung baute.
»Dann sind wir uns einig, Monsieur Glasson«, beantwortete Jules den fragenden Gesichtsausdruck seines Besuchers, stand auf und reichte dem Privatdetektiv über die Pultplatte hinweg seine Hand.
»Sie geben mir Bescheid, sobald die Wanzen installiert sind?«
»Selbstverständlich. Und von da an erhalten Sie jeden Tag eine Liste aller Telefonate im Haus von Herrn Waffel, sowie eine schriftliche Zusammenfassung der wichtigsten Informationen aus den Gesprächen. Bei Bedarf liefern wir Ihnen selbstverständlich auch die Originalaufzeichnungen nach. Die Rechnung über die Installation der Geräte und eine Vorauszahlung für die Betriebskosten im ersten Quartal erhalten Sie noch diese Woche. Es freut mich, dass wir miteinander ins Geschäft kommen, Herr Lederer.«
Der Mann verabschiedete sich und ging zielstrebig zur Tür, öffnete sie, trat in den Flur und schloss sie gleich wieder leise hinter sich. Als Jules aufgestanden war und den Flur erreicht hatte, fiel die Eingangstüre bereits sanft und mit einem Klicken ins Schloss. Jules blickte dem Mann durch den Türspion nach, doch der war bereits aus dem Sichtfeld verschwunden.
Zurück in seinem Büro legte sich Jules auf den Soft Pad Chaise, den er vor wenigen Wochen erstanden hatte. Dieser Liegestuhl war 1968 von Charles und Ray Eames entwickelt worden. Die Idee dazu hatte allerdings Billy Wilder gehabt. Der amerikanische Regisseur war lange Zeit auf der Suche nach einer Liege für kurze Pausen zu seiner Entspannung gewesen. Das Möbelstück musste auf alle Fälle verhindern, dass Wilder für Stunden einschlief. Der Regisseur wollte nicht wertvolle Arbeitszeit durch unerwünscht lange Nickerchen verlieren. Die beiden Designer entwickelten daraufhin mit ihm zusammen eine ausgesprochen bequeme Liege, die allerdings so schmal ausfiel, dass man seine Arme nirgendwo seitlich am Körper ablegen konnte. Man musste sie auf dem Bauch verschränkt halten. Sobald man jedoch drohte einzuschlafen und sich die Muskeln der Gliedmaßen zu entspannen begannen, rutschten die Arme durch die Schwerkraft seitlich hinunter und man wachte auf.
Eine genial einfache Lösung für ein schwieriges Problem und ein eindrucksvolles Beispiel für wirklich gutes Design, das stets die technisch einfachste Lösung für den angestrebten Zweck fand.
Hatte auch er an alles gedacht? War es ethisch vertretbar, dem Bankier Waffel eine Detektei auf den Hals zu hetzen und ihn bei sich zu Hause abzuhören? Aber was konnte Jules sonst tun? Der Schweizer war sich zu sicher, dass dieses vom MI6 abgehörte Telefongespräch echt war und genauso stattgefunden hatte. Nun musste Jules sich einfach Gewissheit darüber verschaffen, inwieweit Waffel die Pläne der CIA tatsächlich umgesetzt hatte oder womöglich immer noch tat.
Das Büro von Waffel an der Bahnhofstrasse in Zürich konnte kaum erfolgreich verwanzt werden. Die Chefetagen der großen Banken wurden alle drei, vier Wochen von internen Sicherheitsleuten durchsucht und elektronisch vermessen. Jules hatte selbst vor Jahren für eine internationale Bank gearbeitet und kannte daher die gängigen Sicherheitsprotokolle. Doch in Waffels eigenen vier Wänden war nicht mit dieser zwinglianischen Gründlichkeit zu rechnen. So hofften zumindest die Detektei und Jules.
Über seine Gedankengänge war er wohl doch kurz eingenickt, denn er zuckte auf seiner Liege erschrocken zusammen und merkte, dass seine Arme rechts und links vom Körper herunterhingen. Rasch setzte er sich auf und versuchte, die letzten Gedanken während des Halbschlafs noch einmal zu fassen. Ein Name stach hervor, Roger Spälti. Roger war sein Mentor bei der großen Anwaltskanzlei gewesen, in die Jules direkt nach Abschluss des Wirtschaftsstudiums eingetreten war. Später wurden sie Freunde. Roger war damals bereits Mitte bis Ende vierzig und einer der sechs Partner der Kanzlei. Und er war ein begeisterter Kenner der asiatischen Kampfsportarten. Jules hatte ihn bei einer Taekwondo Exhibition im Hallenstadium in Zürich kennengelernt. Der Veranstalter wollte damals auch einen Showkampf mit Nunchakus zeigen, diese mit einer kurzen Kette verbundenen Holzstöcke, für deren perfekte Handhabung Bruce Lee berühmt wurde. Neben Jules war Heinz Keller in ihrem Asian Fight Club der Geschickteste mit der schwer zu kontrollierenden Waffe und so schlugen sich die beiden an der Exhibition prächtig, ernteten viel Beifall der Zuschauer. Später kam dann Roger Spälti in den Umkleideraum, fragte sie ein wenig aus und bot ihnen dann einen Job in seiner Kanzlei an. Was sie dort tun sollten, war ihnen nach dem ersten Gespräch noch nicht wirklich klar. Doch die hervorragenden Anstellungsbedingungen und die in Aussicht gestellte, ausgedehnte Reisetätigkeit um den gesamten Erdball herum waren für sie beide einfach zu verlockend, um abzulehnen. Roger lernten sie in den darauffolgenden Wochen und Monaten immer besser kennen. Seinen Freund Keller schickte die Kanzlei schon bald zu betuchten Klienten, für die er wohl kleinere und größere Probleme zu lösen hatte, wie Heinz im Vertrauen ihm gegenüber erwähnte. Was Heinz allerdings genau tat, fand Jules erst einige Monate später heraus. Denn das Motto der Kanzlei lautete: »Je weniger Leute wissen, was du tust und wie du es tust, desto weniger Probleme bekommst du hinterher.«
Nach einem seiner Einsätze kam Heinz Keller allerdings nicht mehr zurück. Auf Jules Frage hin zog ihn Roger Spälti ins Vertrauen.
»Heinz wurde letzte Woche auf Haiti ermordet.«
»Ermordet? Wie? Und von wem?«
»Man hat ihn im Lift seines Hotels überfallen und erdrosselt. Er ist einer Bande von Erpressern in die Quere gekommen. Weißt du, Jules, wir versuchen dort unten schon seit ein paar Monaten drei Ferienhotels für einen unserer Klienten aus den USA zu erwerben. Er braucht sie zwar bloß als Steuerabschreibungsobjekte, doch er hat sich nun Mal in den Kopf gesetzt, dass es unbedingt Haiti und exakt diese Hotels sein müssen. Die lokale Schutzgeldmafia ist jedoch allzu gierig und verlangt für ihr Stillhalten dreißig Prozent des Kaufpreises. Das wären mehrere Millionen Dollar und entschieden zu viel für unseren Kunden. Denn unter dieser Voraussetzung würde sich seine Investition steuerlich nicht mehr rechnen. Heinz war dort unten, um mit den Kerlen zu verhandeln und ihren Preis zu drücken. Wahrscheinlich hat man ihn umgebracht, um uns vor Augen zu führen, wie wenig wir in ihrem Machtbereich ausrichten können.«
»Und du schickst nun mich hinunter?«
»Wie kommst du darauf?«
»Na, du hättest mir die Umstände um den Tod von Heinz bestimmt nicht erzählt, wenn du das nicht vorhättest.«
Roger schaute Jules einen Moment lang forschend an.
»Nur wenn du willst, Jules, nur wenn du wirklich willst.«
»Lass für mich bitte einen Sitzplatz im nächsten Flugzeug buchen und gib mir alle Informationen und Berichte, die wir über den Fall besitzen.«
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Jules für die Kanzlei und ihre Klienten in erster Linie Probleme mit den Steuerbehörden gelöst, dabei Akten ein wenig zurechtgebogen oder als Vertreter der Kanzlei vor diversen Richtern als Zeuge ausgesagt. Wahrscheinlich dachte sich Roger Spälti damals, Jules sei noch nicht soweit, um auch die wirklich heiklen und vor allem gefährlichen und damit oft auch gewalttätigen Aufgaben zu übernehmen. Er sollte sich aber getäuscht haben. Denn damals begann Jules Karriere als zuverlässiger Beseitiger handfester Schwierigkeiten.
Doch warum war ihm im Halbschlaf der Name von Roger Spälti überhaupt eingefallen? Hatte das etwas zu bedeuten? Was hätte wohl der erfahrene Frontmann der Kanzlei in seiner derzeitigen Situation unternommen? Vielleicht direkt Waffel angegangen und versucht, Gegendruck aufzubauen und ihn so zum Reden zu bringen? Nein. Mit dem Machtapparat der CIA konnte Jules nicht in Konkurrenz treten. Ein solcher Gedanke war einfach lächerlich. Falls Waffel die Forderungen der Amerikaner tatsächlich erfüllt hatte und die Bank in Gefahr geriet, musste Jules einen wesentlich subtileren Weg wählen, um Gegensteuer zu geben.
Vielleicht sollte er Roger einmal anrufen oder sich am besten gleich mit ihm zusammensetzen. Sein ehemaliger Mentor war zwar schon seit Jahren pensioniert und lebte mit seiner malaysischen Frau Yolida auf einer kleinen Insel vor Sumatra, die er sich nach dem Verkauf seiner Anteile an der Anwaltskanzlei gekauft hatte. Ein Besuch bei den Spältis konnte kaum schaden.
*
In den nächsten Wochen und Monaten erhielt Jules Bericht um Bericht aus der Detektei. Als die Gesamtkosten die dreihunderttausend Franken Marke erreicht hatten, wusste er genug, um die nächsten Schritte anzugehen. Waffel hatte mehr als einmal geschäftliche Sitzungen am Sonntagnachmittag in seinem Haus abgehalten und so war Jules klar geworden, dass die Großbank, für die Waffel als Chief Executive Officer tätig war, ihre bislang vorsichtige Anlagepolitik längst aufgegeben hatte. Seit gut zwei Jahren wanderte immer mehr Geld in den amerikanischen Häusermarkt und in Verbriefungen von Krediten an Universitäten und an Studenten. Waffel hatte dem Vorstand zudem einen unglaublich hohen Hebel von über sechzehn verkaufen können. Das bedeutete, es wurde das Sechzehnfache des Eigenkapitals der Bank auf eigene Rechnung in Wertpapiere und andere Anlagen gesteckt, finanziert durch zinsgünstige, kurzfristige Kredite anderer Banken. Der Sinn eines so hohen Leverages lag selbstverständlich darin, dass man sechzehn Mal eine Zinsdifferenz von wenigen Basispunkten erzielte, die durch diesen Hebel aber auf viele Prozent des Eigenkapitals anwuchs. Zusammen mit dem traditionellen Bankgeschäft, der Vermögensverwaltung, dem Asset Management und dem Investment Banking für Kunden konnte so eine Rendite von weit über zwanzig Prozent auf dem Firmenkapital erzielt werden.
Doch langfristige Investitionen in Immobilienpapiere und in Schuldverschreibungen mit Hilfe von kurzfristigen Krediten zu finanzieren, war seit Menschengedenken eine meist tödliche Strategie. Sobald irgendeine Krise eintrat und die langfristigen Papiere nicht mehr rasch und kostendeckend über den Markt abgestoßen werden konnten, rissen einen die kurzfristig wegfallenden Kredite der Geldgeber unweigerlich in den Konkurs.
Hatte der Vorstand der Bank den Verstand verloren? Oder waren sie alle so sehr von ihren mathematischen Modellen zur Berechnung der angeblichen Risiken überzeugt? Vertrauten sie tatsächlich nur noch auf Computerauswertungen, Formeln und Analysen und nicht mehr dem gesunden Menschenverstand, der sich in den letzten dreihundert Jahren im Bankwesen doch längst heraus geformt hatte? Oder wurden neben Waffel tatsächlich weitere führende Köpfe der Bank bedroht und erpresst?
Besonders erschreckend fand Jules den hohen Anteil der Investitionen in den amerikanischen Häusermarkt über sogenannte strukturierte Produkte auf den Subprime Krediten. Er erinnerte sich noch gut an den Immobiliencrash in Japan, zu Beginn der 1990er Jahre. Selbst heute, nach fünfzehn Jahren, war der finanzielle Schock noch nicht überwunden. Nach dem Börsencrash 1987 war auch in der Schweiz das zinsgünstige Geld zu lange von der Nationalbank angeboten worden, so dass die Häuserpreise erst stark anstiegen, um anschließend noch stärker nach unten zu korrigieren. 1992 waren die Immobilien in der Schweiz wieder so viel Wert wie sechs Jahre zuvor. Und die Banken mussten in der Folge fünfzig Milliarden an Hypothekarkrediten abschreiben.
Im damaligen Amerika sanken die Häuserpreise flächendeckend um mindestens zwanzig Prozent und tausende von Sparkassen meldeten Konkurs an. Etwas Ähnliches bahnte sich nach Meinung von Jules seit 2003 wiederum an. Die jährlichen Wertsteigerungen im US-Häusermarkt hatten Rekordwerte erreicht und im Gegensatz zur konservativen Finanzierung in den meisten europäischen Ländern, wo die Häuser in der Regel höchstens zu achtzig oder neunzig Prozent des Kaufpreises belehnt wurden, waren im US-Immobilienmarkt längst Finanzierungen von hundertzehn oder gar hundertzwanzig Prozent üblich. Der neue Hausbesitzer sollte sich neben der viel zu hohen Hypothek auch gleich noch mit einem Neuwagen beglücken. Oder er bezahlte in den ersten drei Jahren die Hypothekarzinsen bequem mit dem Geld aus dem viel zu hohen Kredit. Nach ein paar Jahren war die Immobilie eh stark im Wert gestiegen und konnte bei Bedarf mit einem satten Gewinn verkauft werden. So jedenfalls die Theorie der ewigen Verlierer.
Was für eine irrsinnige Idee auch, anzunehmen, die Immobilienpreise würden ewig im Preis steigen, ungeachtet den Konjunkturzyklen, die jede Wirtschaft seit Menschengedenken durchlebte. Irgendwann kam jede Spirale aus Wirtschaftswachstum, steigenden Einkommen, höheren Preisen, weiteren Unternehmensgewinnen und vermehrten Investitionen zum Stillstand. Dann fiel das geschäftige Treiben plötzlich in sich zusammen und Katzenjammer kehrte für ein Jahr oder auch länger ein.
Konjunkturdellen ließen stets auch den Wert von Investitionsgütern stark sinken. Denn eine neue Maschine, die nicht ausgelastet wurde, war plötzlich nur noch einen Bruchteil des Kaufpreises wert. Und wenn Käufer ausblieben, so korrigieren Immobilienpreise sofort und stark nach unten. Wenn zum Beispiel steigende Zinssätze auf den Hypotheken die Besitzer übermäßig drückten, konnten sie in der Masse ihre viel zu hoch bezahlten Häuser nicht mehr kostendeckend abstoßen Sie wurden obdachlos und verloren all ihr Erspartes.
Schon während der Depression in den 1930er Jahren gab es in den USA die gefürchteten Jingle Mails. Damit waren Briefumschläge gemeint, in denen die bisherigen Eigentümer die Schlüssel zu ihren überschuldeten Häusern einfach ihrer Bank zusandten, während sie still und heimlich die Habseligkeiten zusammenpackten und den Staat verließen, um sich anderswo schuldenfrei eine neue Existenz aufzubauen.
Früher oder später würde auch der aktuelle Konjunkturzyklus zu Ende gehen. Doch allein in den letzten drei Jahren waren die Immobilienpreise in den USA um satte fünfundzwanzig Prozent angestiegen. Und die Spirale noch oben schien sich immer schneller zu drehen. Bei dieser Entwicklung war ein Absturz der Häuserpreise in den USA um mindestens dreißig Prozent vorprogrammiert. Wer in diesem Moment in amerikanische Immobilien investiert war, musste mit empfindlichen Verlusten rechnen.
Jules erinnerte sich gerne an das Jahr 2000 zurück. Damals hatte sich ein völlig unrealistisches Verhältnis zwischen den erzielten Gewinnen in der Internet Branche und den an den Börsen erreichten Aktienkursen etabliert. Beim Suchmaschinen-Unternehmen Yahoo beispielsweise lag der Aktienkurs zeitweise fünfhundert Mal höher als der erzielte Jahresgewinn. Normal wäre bei einem stark wachsenden Unternehmen jedoch ein Verhältnis von fünfundzwanzig bis dreißig gewesen. Die an der Börse bezahlten Preise für Yahoo Aktien waren also mindestens fünfzehnmal zu hoch. Das war für Jules eine wunderbare Gelegenheit, Geld in rauen Mengen und ohne wirkliches Risiko zu scheffeln. Durch den Kauf von Put Optionen auf die Yahoo Aktie konnte er sein Vermögen innerhalb weniger Monate verdreifachen. Denn Yahoo stürzten damals von ihrem Höchst von hundertzwanzig Dollar auf ein Tiefst von fünf Dollar. Die unglücklichen Anleger verloren damals also sechsundneunzig Prozent ihres Einsatzes, während der Schweizer im Gegenzug mehrere Millionen an Gewinnen einstrich.