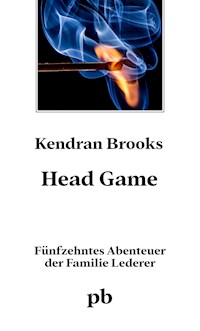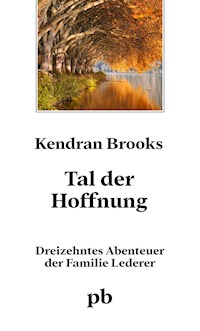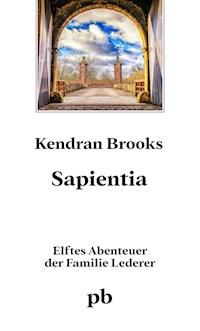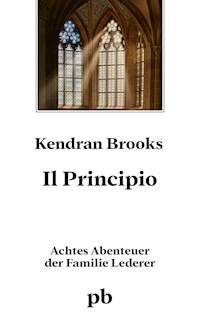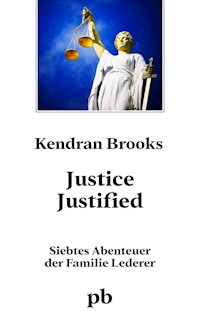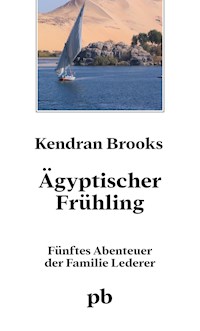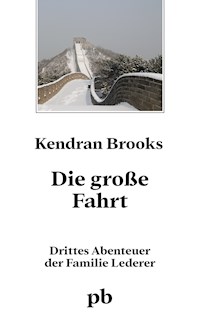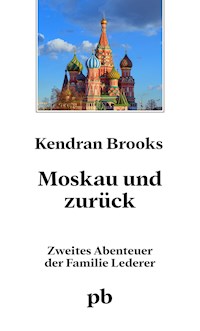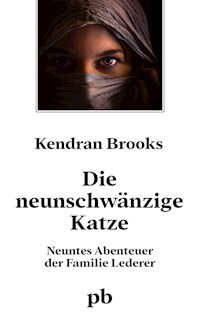Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein klassischer Abenteuerroman über einen modernen Problemlöser, der im Auftrag seiner internationalen Kundschaft gefährliche Aufgaben übernimmt. Zudem der Beginn einer Familiensaga, die sich über die nächsten Romane hinweg weiter entwickelt. Sach-Thema in diesem Roman ist das Erdöl. Der Roman spielt in London und im Persischen Golf, in Eritrea und in Äthiopien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kendran Brooks
Nur ein Auftrag
1. Abenteuer der Familie Lederer
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1964 - 1980
Vorgeschichte
Dienstag, 15. August 2006, 07:30 Uhr / City of London
Sonntag, 3. September 2006 / Kuwait - künstliche Insel von Mina Al Ahmadi
Dienstag, 15. August 2006, 11:15 Uhr / City of London
Donnerstag, 7. September 2006, abends / Rotes Meer
Donnerstag, 7. September 2006, abends / City of London
Freitag, 8. September 2006, 07:00 Uhr / Rotes Meer
Dienstag, 3. Oktober 2006, 21:00 Uhr / City of London
Montag, 11. September 2006, irgendwann / Hara
Samstag, 7. Oktober 2006, 01:00 Uhr / City of London
Sonntag, 8. Oktober 2006 bis Dienstag, 10. Oktober 2006 / Hara
Samstag, 7. Oktober 2006, 11:00 Uhr / City of London
Freitag, 13. Oktober 2006, 07:00 Uhr / Danakil Senke
Freitag, 20. Oktober 2006, 11:00 Uhr / City of London
Impressum neobooks
1964 - 1980
Auf die Welt kam Jules in Boston, Massachusetts. Seine Eltern waren zur Entbindung nach Amerika geflogen, damit ihr kleiner Junge gleich von Anfang an als Doppelbürger der USA und der Schweiz aufwachsen konnte. Kluge Leute sorgten schon damals für ihre Kinder vor. Und so wurde seine Geburt zum Startpunkt eines Lebens als Weltbürger. Oder sollte man es eher ein Leben ohne Wurzeln und ohne echtes Heimatgefühl nennen? Ein Leben als Ruheloser?
Sein Vater, Jean Lederer war ein ranghoher Diplomat in den Diensten der schweizerischen Eidgenossenschaft, war beruflich oft im Ausland unterwegs und entsprechend wenig zu Hause. Seine Mutter stammte aus einer wohlhabenden Industriellen-Familie mit altem Geld. So genoss der kleine Jules das großartige Privileg, in einem wohl behüteten Zuhause an der Zürcher Goldküste aufzuwachsen.
Seinen Vater sah er also selten, seine Mutter etwas häufiger. In der übrigen Zeit kümmerte sich im Babyalter eine Krankenschwester liebevoll um ihn, später und gemäß ihren Anstellungsbedingungen das Verwalterehepaar des Anwesens. Maria war aber nicht nur sein Kindermädchen, sondern vor allem die Köchin, Waschfrau und Reinigungskraft, während Urs sich um den großen Park kümmerte, der die Villa umgab, und gelegentlich Chauffeurdienste leistete, aber auch alle technischen Anlagen in und ums Haus herum in Schuss hielt. Das Ehepaar aus Nidwalden wohnte im Pförtnerhaus gleich neben dem schmiedeeisernen Eingangstor, das von wuchtigen Steinpfeilern umrahmt war und aller Welt die große Bedeutung der Eigentümerfamilie Kund tat. Ein früherer Besitzer des Anwesens hatte das recht beengte fünf Zimmer Häuschen für sein damals wohl umfangreicheres Dienstpersonal bauen lassen. Das mochte hundert Jahre her sein. Jetzt lag es im Schatten hoher Tannen und der Ort kam Jules immer auch ein klein wenig unheimlich vor. Doch es roch dort stets aufregend, nach Sauberkeit und nach Arbeit, nicht so unangenehm schwer parfümiert, wie im großen Haupthaus. Jules erinnerte sich gerne an die Nachmittage bei den beiden gemütlichen Innerschweizern. Denn im Pförtnerhaus durfte er das, was seine Mutter im Haupthaus strikt verboten hatte, nämlich mit anpacken und mithelfen, etwas, das andernorts ehrliche Arbeit und nicht das stupide Leben der Unterklasse genannt wurde.
Seine Maman, sie sprach meistens Französisch mit ihm, hatte als junge Frau Rechtswissenschaften studiert. Nicht für ihren Broterwerb, sondern zu ihrer Zerstreuung. Nach der Geburt von Jules mittels Kaiserschnittes und der damit verbundenen baldigen Wiedererlangung ihrer sehr schlanken, fast knabenhaften Figur widmete sie sich wiederum mit Hingabe ihren beiden Steckenpferden, dem Einkaufen und dem Tennissport. Dabei ergänzten sich die beruflich bedingten, oft langen Abwesenheiten ihres Ehegatten in idealer Weise mit ihrem Freiheitsdrang. Sie hatte nämlich die wichtige und höchst löbliche Aufgabe übernommen, junge Tennistalente zu entdecken und zu fördern.
Zu Anfang verstand Jules nicht, warum ihn seine Mutter jedes Mal für zwei Stunden auf sein Zimmer hochschickte, wenn einer dieser sportlichen Männer in ihren knappsitzenden, kurzen Hosen und dem meist strahlenden, manchmal auch ein wenig verlegenen Lächeln bei ihnen eintraf. Sie ging mit ihrem wechselnden Besuch jeweils in Richtung Poolhaus davon, hinter dem der Tennisplatz des Anwesens lag. Das zumindest konnte Jules aus seinem Fenster heraus beobachten.
Mit neun Jahren verschaffte er sich jedoch Gewissheit, schlich nach einer Viertelstunde braven Wartens in seinem Zimmer die Treppe hinunter, entdeckte niemanden im Flur, ging vorsichtig weiter und durch eines der beiden Wohnzimmer hinaus auf die Terrasse, sah sich auch dort gründlich um, konnte wiederum keine Menschenseele im weitläufigen Park ausmachen und wurde mutiger. Die vielen Bäume und Büsche gaben ihm Deckung und so schlich sich Jules wie ein Indianer auf dem Kriegspfad in Richtung Tennisplatz. Diesen konnte er wegen der hohen Hecke nicht einsehen. Doch er wunderte sich, kein typisches Aufklatschen der Bälle zu hören.
Als er jedoch in die Nähe des Poolhauses kam, vernahm er ein recht lautes Stöhnen und heftiges Keuchen. Er erkannte die Stimme seiner Mutter, als sie plötzlich spitz aber unterdrückt aufschrie und danach ausstieß: »Ja, gib’s mir, gib’s mir so richtig, du geiler Bastard.«
Jules war aufs Äußerste besorgt um seine Maman. Rasch glitt er am kurzen Ende des Schwimmbeckens entlang und zum breiten Fenster des in Weiß und Gelb hübsch angemalten Poolhauses. Vorsichtig und neugierig blickte er durch die Scheibe und schrak zurück. Denn seine Mutter lag nackt auf dem Teakholztisch, den sie sonst für ihre Gartengrillfeste benutzten. Ihre Beine umklammerten die nackten Po-Backen des jungen Tennisspielers von heute Morgen. Der Mann stieß mit seiner Hüfte immer wieder vor, krachte mit seinem Becken heftig gegen das der Mutter. Doch ihr schien diese Misshandlung zu gefallen, denn sie feuerte ihn mit den Worten »mehr, mehr, mehr« an.
Ihre kleinen, flachen Brüste mit den steil aufragenden Nippeln wabbelten vor und zurück, im Rhythmus der Stöße des jungen Mannes. Der Mund seiner Mutter war verzerrt, der rechte Mundwinkel nach unten gezogen als spürte sie Schmerzen, ja, ihr ganzes Gesicht glich einer der schrecklich verunstaltenden Fratzen, die Jules vom Karneval her kannte, war schweißbedeckt und vor Hitze gerötet. Ihre verdrehten Augen, unbestimmt nach oben und zur Decke gerichtet, mit einem verschwommenen Blick, der bis in den Himmel zu reichen schien, erinnerte Jules an die tot gefahrene Katze, die er vor wenigen Wochen im Straßengraben vor dem großen Eingangstor liegen sah. Ihr Schielen glich auffällig demjenigen seiner Mutter, wie er erschrocken feststellte.
In diesem Moment hob der Tennisspieler seinen Kopf und blickte direkt in Jules Augen, erkannte den Jungen hinter der Scheibe und schrie erschrocken auf. Jules warf sich sogleich herum und stob zurück zum Haus, rannte durch das Wohnzimmer und den Flur die Treppe hoch und schnurstracks in sein Zimmer, warf sich bäuchlings aufs Bett, vergrub sein Gesicht im Kopfkissen und brach in Schluchzen und Weinen aus.
Doch schon nach wenigen Sekunden verstummte er, drehte sich auf den Rücken und wischte sich die Tränen fort. Nach dem ersten, heftigen Gefühlsausbruch war ihm bewusst geworden, dass es für ihn gar keinen Grund zum Weinen gab. Denn der junge Mann hatte ihn mit seinem Ausruf zwar erschreckt, doch mehr war bislang nicht passiert.
Durch die offene Schlafzimmertür hörte er wenig später im Flur unten die drängende Stimme seiner Mutter, ohne dass er ihre Worte hätte verstehen können. Die Eingangstüre öffnete sich und fiel wieder ins Schloss. Kurz darauf waren leichte Schritte auf der Treppe zum Obergeschoss zu hören und wenig später trat Maman in sein Zimmer und setzte sich neben ihm aufs Bett. Sie war wieder angezogen, ganz in weiß, in ihrem gewohnt engen Tennisdress mit dem kurzen Rock, aus dem ihre schlanken, braungebrannten Beine so gesund herauswuchsen. Ihr Gesicht war noch immer ein wenig erhitzt und gerötet und ihre Augen zeigten im Hintergrund ein zufriedenes Glühen. Sie beließ sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht, wie sie es oft tat, schaute ihren Sohn dabei lächelnd an und legte ihm ihre Hand sanft auf die Schulter.
Jules blickte sie ernst an, wusste nicht, was kommen würde. Eigentlich erwartete er laute Schelte, weil er nicht auf seinem Zimmer geblieben war. Vielleicht würde es sogar eine Strafe für den Ungehorsam absetzen? Aber Maman packte bloß sein Kinn zwischen Daumen und Zeigefinger und rüttelte ein wenig daran herum. Das tat sie immer dann, wenn er etwas ausgeheckt oder jemandem einen Streich gespielt hatte oder über seinem Spiel die Uhrzeit vergaß und nicht pünktlich zum Essen erschienen war. Jules atmete innerlich auf. So schlimm konnte das, was er getan und gesehen hatte, also gar nicht sein.
»Du solltest doch auf deinem Zimmer bleiben, mein kleiner Pirat«, säuselte Maman und er entspannte sich noch ein wenig mehr. Aus ihren Worten hatte keinerlei Vorwurf geklungen.
»Tut mir leid, Maman«, antwortete er trotzdem schluchzend und fühlte auch ein schlechtes Gewissen.
»Nicht schlimm, Jules«, meinte seine Mutter versöhnlich, »weißt du, das was du gesehen hast, das gehört zu den Übungen, die man als Sportler machen muss, um fit zu bleiben. Da ist gar nichts weiter dabei. Am besten vergisst du schnell wieder, was du gesehen hast, ja?«
»Ist gut, Maman«, antwortete Jules und nahm sich vor, die Bilder in seinem Kopf niemals zu verlieren.
Nach diesem Morgen kam kein junger Tennisspieler mehr auf ihr Anwesen. Dafür verbrachte seine Mutter noch mehr Zeit außer Haus, verließ Jules oft schon am frühen Vormittag, kam erst spät abends und lange nach dem Abendbrot zurück. Und so waren ihm Maria und Urs Amstutz bald einmal mehr vertraut als die eigene Mutter und erst recht als der immer seltenere und oft nur noch für ein kurzes Wochenende auftauchende Vater.
Jules Lebenssituation verschärfte sich ein knappes halbes Jahr später. Sein Vater hatte nach einem Streit mit seiner Mutter die Koffer gepackt und das Haus verlassen, wollte sich mit einer billigen Schlampe aus Genf eine Wohnung teilen. So jedenfalls lauteten die bitteren Worte von Maman am Telefon, als sie mit Grand-mère Julia darüber sprach.
Die Scheidung verlief, soweit er sich später erinnern konnte, in gegenseitigem Einverständnis. Maman schleppte ihn ein paar Mal zu ihrem Rechtsanwalt. Dort sollte Jules erzählen, wie sehr er von seinem Vater all die Jahre vernachlässigt worden war. Doch woher sollte Jules wissen, was Vernachlässigung durch einen Elternteil bedeutet, wenn man die andere Hälfte fast ebenso selten gespürt hatte?
Er war damals zehn Jahre alt und bildete sich ein, bereits alles über die Welt und die Schlechtigkeit der Menschen zu wissen, über ihre Falschheit und Verlogenheit, den zwanghaft hoch gehaltenen Fassaden und den dahinter lauernden Geheimnissen. Ohne Maria und Urs hätte er wohl damals, noch als Kind, den Glauben an das Gute in den Menschen verloren. Doch das Verwalterehepaar lebte in einer anderen Welt als seine Eltern. Diese war voller Achtung und Rücksichtnahme dem Partner und auch anderen Menschen gegenüber. Und so wurde Jules doch nicht zu einem der vielen selbstgefälligen Zyniker, lernte stattdessen zu erkennen, zu vergleichen, abzuwägen und zu verstehen.
*
Sein weiterer Lebensweg wäre wahrscheinlich ähnlich unaufgeregt wie der seiner Eltern verlaufen. Doch für einen Dreizehnjährigen war er nicht nur zu klein, sondern auch sehr schmächtig. Bis zu diesem Alter war er zu Hause und von verschiedenen Privatlehrern unterrichtet worden. Doch nun schickte ihn seine Mutter auf ein Internat in Montreux. Sie wollte sich endlich selbst verwirklichen, wie sie es nannte, und dabei schien ein Teenager im selben Haus ungemein zu stören.
Das Internat lag wunderschön über dem Genfersee. Als er von Urs Amstutz dorthin gefahren und abgeliefert worden war, das erste Mal auf die weite Rasenfläche trat und auf die tiefblauen Berge und den glitzernden See hinaus und hinunter starrte, da fühlte sich Jules auf einmal so frei wie ein Vogel, als hätte er die Enge eines Käfigs überwunden. Eine neue, aufregende Welt sollte sich für ihn auftun, mit Klassenkameraden, echten Freundschaften, weit weg von zu Hause. Doch sein Hochgefühl erlosch bereits während der ersten Turnstunde. Sie sollten ein dickes Tau hoch klettern, etwas, das Jules aufgrund seiner schmächtigen Arme völlig misslang. Er versuchte sich hochzuziehen und irgendwie mit seinen Füssen Halt zu finden, klammerte sich mit aller Kraft an den speckigen Hanf, den tausende von Jungenhänden mit ihrem Schweiß immer und immer wieder durchtränkt hatten, kam keinen Zentimeter hoch, wollte trotzdem nicht aufgeben, sah dabei in das mitleidig dreinblickende Gesicht seines Lehrers, schämte sich vor allen Kameraden, wie er hilflos fünfzig Zentimeter über dem Boden hing. Als einer von ihnen dann verächtlich ausrief »Schwuchtel-Jules«, setzten einige andere sofort laut lachend ein und so blieb ihm dieser hässliche Übername für Jahre anhaften, so als wäre er auf seine Stirn gebrannt.
Auch die meisten Lehrer lachten über die fortwährende Hetze der anderen Knaben. Die Ausnahme war Peter Maischberger, ihr Sportlehrer aus München. Der hatte den Erfinder seiner Schmach gleich nach dem Ausruf gemaßregelt, ihn direkt aus der Stunde und auf sein Zimmer geschickt, ihm weitere Strafen angedroht.
Peter Maischberger war nur mittelgroß, doch sein Brustkorb mächtig breit und seine Oberarme dick wie Baumstämme. Er wurde von allen Jungs bloß ehrfürchtig bestaunt und geachtet, war der angesehenste Lehrer unter den Schülern.
An einem der freien Nachmittage, Jules war wohl seit einem halben Jahr im Internat, lud ihn Maischberger ein, ihn nach dem Unterricht in seiner Wohnung zu besuchen. Die lag wie alle Appartements der Lehrkräfte in einem freistehenden Haus abseits der Schulgebäude, am anderen Ende des weitläufigen Parks. Jules ging ohne Argwohn hin, dachte nicht im Traum daran, dass sich dieser nette Mann an ihm vergehen könnte.
Peter hatte für sie beide Kakao gekocht. Zusammen setzten sie sich auf das schmale, mit rotem Samtstoff bespannte Sofa. Sie prosteten sich mit den Tassen zu, als wären sie alte Kameraden. Dann schlürften sie das heiße Getränk vom Rand, sahen sich dabei in die Gesichter.
Peter begann zu erzählen, wie ungerecht doch die anderen Knaben zu Jules wären und wie sehr er doch darunter zu leiden hatte. Das tat dem Jungen in der Seele wohl. Denn endlich verstand ihn jemand, zeigte sein Mitgefühl. Wenig später begann Peter ihn zu streicheln, erst an Nacken und Hals, dann mit dem Rücken seiner beharrten Finger über die Wangen. Seine Lippen kamen plötzlich näher, drückten sich sanft, aber bestimmt auf die seinen. Eine Zungenspitze tastete sich vor, drängte sich zwischen seinen Zahnreihen hindurch, drang in seine Mundhöhle vor, begann sanft mit seiner Zunge zu spielen.
Jules wehrte sich keineswegs gegen die Zudringlichkeit seines Lehrers. Seine Überraschung war dafür viel zu groß. Gleichzeitig kannte er intime Zärtlichkeit weder von seinen Eltern noch von Maria oder Urs. Einen anderen Menschen zu streicheln, zu küssen, ja ihn bloß zu spüren, zu riechen und zu schmecken, das war eine ganz neue, aufregende Erfahrung für den Dreizehnjährigen. Und so ließ er seinen netten Sportlehrer gewähren, entspannte sich mehr und mehr unter den kundigen Händen und Lippen, fand alles äußerst aufregend.
Minutenlang genoss Jules die körperlichen Aufmerksamkeiten seines Lieblingslehrers. Doch bald regte sich auch in ihm ein bisher unbekanntes Gefühl, ein seltsames Verlangen nach einem ihm fremden Körper. Er schlang seine Arme um den Nacken von Peter und drängte seine schmale Brust an die mächtige des Lehrers. Und so wurden sie an diesem Nachmittag ein Liebespaar, schenkten sich, auf was sie beide wohl so lange verzichten mussten, trafen sich von da an mindestens zweimal pro Woche heimlich nach dem Unterricht und in der Wohnung von Peter, gaben einander, wonach es sie am meisten verlangte.
Doch Zärtlichkeit auszutauschen war nicht das Einzige, was ihm sein Sportlehrer damals beibrachte. Fünfmal die Woche, nach dem Abendbrot, trainierte er mit Jules ganz allein in der Sporthalle. Maischberger zeigte ihn die richtigen Atemtechniken, lehrte ihn ausdauerndes Rennen und sogar hartes Kämpfen. Jules Kondition wuchs im selben Masse wie seine Muskeln. Er bekam ein neues Körpergefühl und seine bisherige Scham vor jedem Spiegel verblasste zusehends, wich einem neu erstarkten Selbstbewusstsein.
Nach einem halben Jahr hatte Jules gut zehn Kilogramm an Gewicht zugelegt und seine Reflexe waren ausgezeichnet und seine Kraft entsprach derjenigen eines jungen Erwachsenen. Peter hatte ihm auch beigebracht, wie man sich mit bloßen Fäusten und Handkanten gegen noch stärkere und größere Gegner wehren konnte. So zahlte Jules seinen Schulkameraden bald einmal die monatelangen Hänseleien Stück für Stück zurück. Und ein gutes Jahr später war selbst für Peter Maischberger die Zeit der Abrechnung gekommen.
*
Es war ein wunderschöner Samstagmorgen, der erste Tag der großen Sommerferien. Alle anderen Schüler waren noch am Freitagabend nach Hause gefahren, so wie die allermeisten Lehrer. Nur Jules und Peter waren wie üblich zurückgeblieben, dazu nur noch der stets griesgrämige Hauswart des Internats. Wohin sollte Jules auch fahren? In das Haus seiner Mutter, wo ihn nur das Verwalterehepaar erwartete? Oder gar nach Genf zu einem ihm völlig fremd gewordenen Vater? Nein, Jules blieb von Anfang an wann immer erlaubt auch während den Ferien im Internat und kehrte höchstens über Weihnachten, Neujahr und Ostern in eines der beiden ungeliebten Zuhause für ein paar Tage zurück.
Jules hatte auch diese Nacht mit Peter zusammen in der Wohnung verbracht. Sie hatten etwas Wein zum Essen getrunken und sich danach geliebt. Später waren sie im aufgewühlten Bett eingeschlafen. Gegen sieben Uhr morgens weckte ihn Peter mit einem zärtlichen Kuss. Jules glaubte heute noch die etwas ausgetrockneten Lippen seines Sportlehrers auf den eigenen zu spüren, wie sie sanft und schmeichelnd nach mehr verlangten.
Warum ihn damals dieser heftige Impuls plötzlich überkam, konnte er später nicht erklären. Doch Jules stieß seinen Freund und Mentor mit aller Kraft von sich herunter, wühlte sich unter der Decke hervor und blickte seinen doppelt so alten Liebhaber wütend und voller Abscheu an. Peter zeigte erst ein großes Erstaunen in den Augen. Dann aber hatte er wohl begriffen und seine sexuelle Verfehlung an einem seiner Schüler wurde ihm schamvoll bewusst.
Und Jules? Der sprang aus dem Bett und ging nackt, wie er war und ohne ein Wort zu sagen auf seinen Liebhaber los. Ein unbändiger Zorn hatte ihn beim Anblick des traurig dastehenden Peter erfasst, eine grenzenlose Wut, wie er sie nie zuvor verspürt hatte, ergriff ihn. Sie nahm seinen Körper völlig in Gewalt und schaltete seinen Verstand aus. Peter wehrte sich kaum gegen die Fäuste von Jules, wie sie ihn immer wieder hart trafen, ja, er schien die Schläge wie eine auferlegte Busse entgegen zu nehmen. Der Sportlehrer war zwar im eigentlichen Sinne nicht religiös, wie Jules vermutete. Sie hatten zwar nie direkt darüber gesprochen, doch Peter besuchte keinen der Gottesdienste, die das Internat jede Woche anbot. Doch an diesem Samstagmorgen zu Beginn der großen Sommerferien wollte sein Sportlehrer für die Versündigung am mittlerweile fünfzehnjährigen Schüler bestraft werden.
Längst hatte ihm Jules Nase und Mund blutig geschlagen. Die Haut an seinen Knöcheln war aufgerissen und brannte wie Feuer. Trotzdem schlug der Junge weiter auf den Lehrer ein, auf die zur Deckung erhobenen Arme, seitlich auf die ungeschützten Ohren, dann wieder auf den Bauch oder die Brust.
Wie lange der Wutausbruch ihn gefangen hielt, wusste Jules hinterher nicht zu sagen. Irgendwann hörte er einfach damit auf und ließ schnaufend seine Fäuste sinken. Peter stand schwankend vor ihm. Blut tropfte aus Nase und Mund, fiel auf die schwer atmende, rasierte und nackte Brust herunter, lief von dort über den Bauch hinweg tiefer, wurde dort von der Pyjamahose aufgesogen. Aus zugeschwollenen Augen blickte er Jules traurig und bittend zugleich an, wie ein weidwundes Tier, das sich von seinem Jäger Gnade erhoffte. Wollte er tatsächlich um Verzeihung heischen oder doch eher noch mehr Strafe empfangen? Jules wusste es nicht. Und es war ihm auch egal. Voller Abscheu wandte er sich von seinem bisherigen Liebhaber ab und verschwand im kleinen Badezimmer neben dem Schlafraum.
Der Fünfzehnjährige stieg in die Duschkabine, drehte den Kaltwasserhahn voll auf und blieb lange unter dem harten Strahl stehen. Seine Gedanken jagten sich, ohne dass er einen davon hätte festhalten können. Nach einer Weile begann er sich mechanisch von oben bis unten einzuseifen, immer und immer wieder, so als müsste er sämtlichen Dreck dieser Welt von seinem Körper waschen. Seine angeschwollenen Handgelenke konnte er nach kurzer Zeit kaum noch bewegen. Zu hart hatten seine Fäuste Peters Körper getroffen. Die Knöchel seiner Finger waren voller Abschürfungen und Risse. Die Haut über dem ersten Knöchel seines Ringfingers der rechten Hand wies eine gut drei Zentimeter lange, tiefe Furche auf, die heftig blutete. Sie rührte bestimmt von Peters Schneidezahn oder Eckzahn her, als seine Faust die Oberlippe seines Liebhabers spaltete und dahinter auf das scharfe Hindernis stieß.
Jules trocknete sich gründlich ab und versorgte dann die tiefe Wunde aus dem Arzneikästchen neben dem Spiegel, streute etwas Puder darüber und klebte ein Pflaster darauf. Die dünne Narbe würde ihn sein Leben lang an diesen wichtigen Schritt zum Erwachsenwerden erinnern.
Er verließ die Wohnung von Peter Maischberger, nachdem er sich, ohne ein Wort zu verlieren, im Schlafzimmer angezogen hatte. Sein Sportlehrer stand immer noch mit hängenden Armen da, starrte dumpf sinnend zu Boden, wagte kaum zu ihm aufzublicken. An diesem Morgen war seine Welt wohl zusammengebrochen. Doch für Jules sollte eine neue beginnen.
Zurück in seinem Zimmer kramte der Junge ein paar Sachen zusammen und holte sein Geld aus dem kleinen Tresor im Kleiderschrank. Er war fest entschlossen, diesem Ort den Rücken für immer zu kehren. Zu Fuß, mit seinem kleinen Koffer in der rechten Hand, verließ er das Internat, ging die Straße zum Bahnhof hinunter, suchte sich dort den nächsten Zug nach Lausanne heraus und kaufte sich ein entsprechendes Ticket am Schalter. Warum Lausanne sein erstes Ziel war, wusste er nicht. Er kannte die Stadt kaum, war bloß drei Mal dort gewesen. Sie war aber die nächste größere Stadt, ein Ort, der Anonymität versprach. Und das war, was Jules nun brauchte, Abstand von Peter und Abstand von seinem bisherigen Leben. Er fühlte, dass er allein sein wollte, nein, sein musste. Und dies ging am besten inmitten vieler Menschen.
Vom Bahnhof in Lausanne aus folgte er den gewundenen Straßen, die ihn den Hügel hinab bis an das Seeufer führten. Es war früher Nachmittag, die Sonne brannte heiß und Jules setzte sich auf eine Parkbank im Schatten einiger Bäume eines kleinen Parks. Junge Leute tummelten sich auf den Rasenflächen, spielten Ball oder Frisbee oder gingen in kleinen Gruppen der Uferpromenade entlang spazieren. Ihr Stimmengewirr traf seine Ohren wie durch Watte. Er fühlte sich immer noch aufgewühlt vom Bruch mit Peter und dem Internat, wusste zwar, dass dieser Schritt der richtige war, spürte gleichzeitig aber auch eine seltsame Leere in sich, eine Verlorenheit. Was sollte er tun? Wohin sollte er gehen?
Verliebte Pärchen spazierten Arm in Arm, Gruppen von Mädchen und Jungen redeten beim Vorübergehen aufgeregt miteinander, Familien mit und ohne Kinderwagen kreuzten sein Blickfeld. Er sah das wirkliche Leben vor sich, zum Greifen nahe. Und doch fühlte er sich so weit davon entfernt, als läge ein undurchdringlicher Nebel zwischen diesen Menschen und ihm, dem Außenseiter, dem Homo, diesem Schwuchtel-Jules.
Plötzlich erhob sich ein starker Wunsch in ihm. Er wollte dazugehören, zu dieser Welt voller Liebe und Aufmerksamkeit, zu diesen Menschen, die einander etwas bedeuteten. Auf seiner Parkbank hatte jemand eine Tageszeitung leicht zerfleddert liegen lassen. Er nahm sie zur Hand und begann darin zu blättern, war auf der Suche nach dem wahren Leben. Und er fand es, im hintersten Teil, bei den Kleinanzeigen, in Form eines Inserates einer gewissen Lulu. Warum zogen ihn diese paar lächerlichen Zeilen an? Sie versprachen doch bloß eine Scheinwelt voller Lügen und Betrug. Oder war das vielleicht das wirkliche, das einzig wahre Leben? Jules stand mit einem Ruck auf, entschlossen, es herauszufinden.
Bald fand er eine Telefonkabine, öffnete mit zittrigen Fingern seine Brieftasche, zog ein paar Münzen hervor und fütterte den Apparat. Sein Magen krampfte sich vor gespannter Erwartung zusammen und sein rechter Arm schlotterte richtiggehend, als er die letzten Ziffern der Nummer aus der Zeitung wählte. Es klingelte einmal, zweimal, noch hatte er Zeit, um aufzulegen, doch dann wurde auch schon abgehoben. Eine dunkle, etwas heiser klingende Frauenstimme meldete sich mit einem zärtlichen »Hier ist Lulu, und wer bist du?«
Stockend gab Jules Antwort, worauf ihre nächste Frage mit strenger Stimme auf sein Ohr traf: »Wie alt bist du?«
»Zwanzig«, log er.
»Zwanzig? Bist du sicher? Du hörst dich sehr jung an?«
Die Stimmte hatte den Tonfall einer strengen Lehrerin angenommen.
»Ja, ich bin heute zwanzig geworden!«, log Jules. Eine gehörige Portion Trotz hatte sich in seine Stimme gemengt und er hoffte, diese Lulu bemerkte sie nicht.
»Okay. Schon gut. Wann willst du zu mir kommen, Liebling?«
Ihre Stimmte schnurrte bei ihrer Frage.
»So.…sofort, wenn das möglich ist.«
»Du hast wohl Druck auf der Leitung?«, lachte ihre dunkle Stimme aus dem Hörer, »na gut, dann komm zu mir. Wie lange hast du bis zur Rue de Bourg? Du findest mich in der Nummer 12, im dritten Stock. Du musst bei Praxis klingeln.«
Jules hatte keine Ahnung, wo die Rue de Bourg lag, doch durch die Scheibe der Telefonkabine sah er eine große Tafel mit dem Stadtplan von Lausanne an der Uferpromenade stehen.
»In zehn Minuten kann ich da sein«, hörte er sich flüstern.
»Also bis in zehn Minuten. Ich mach mich in der Zwischenzeit schön für dich, mein Starker.«
Wie in Trance hängte Jules den Hörer auf und verließ die Kabine. Was hatte er bloß getan? Sich mit einer Liebesdienerin verabredet? Jules wusste noch heute ganz genau, dass er damals das Wort Hure selbst in seinen Gedanken vermied.
Auf dem Stadtplan erkannte er rasch, wie weit die Rue de Bourg entfernt lag. Er packte seinen kleinen Koffer und rannte los. Eine knappe Viertelstunde später kam er völlig verschwitzt bei der Nummer 12 an, stieg heftig schnaufend das Treppenhaus hoch und verharrte dann einen Moment lang unschlüssig vor der alten, hässlichen Holztür mit der abblätternden grauen Farbe. Ein billiges Messingschild zeigte die Aufschrift Praxis. Zögernd tippte er auf den Klingelknopf.
Rrrring.
Scharf und schrill meldete sich drinnen eine Glocke. Doch die Länge des Tons schien ihm plötzlich viel zu kurz geraten, als wenn sich ein kleiner, verschreckter Junge schämen müsste. Rasch drückte er den Kopf deshalb noch einmal, länger und fordernder.
Rrrrrrrrrriiiiiing.
*
Erst hörte er schlurfende Schritte näherkommen, dann öffnete sich die Türe und eine füllige, dunkelhäutige Frau stand in einem viel zu knappen, scheußlich violetten Bikini vor ihm. Ihre Brüste waren riesig und hingen tief herunter, reichten ihr trotz stützendem Oberteil fast bis zum schlaffen Bauch. Doch ihr etwas feistes Gesicht mit den dunkelrot geschminkten, wulstigen Lippen sah ihn strahlend lächelnd an, so als wenn er ein lieber Freund wäre, den sie lange Zeit vermisst hatte. Sie bat ihn herein, rückte dazu etwas zur Seite, damit er sich im schmalen Flur an ihrem Busen und dem Bauch vorbeiquetschen konnte. Wie betäubt trat er ein, wurde sanft an der Schulter gefasst und durch eine schmale Türe in das erste Zimmer rechts vom Eingang dirigiert.
Ein breites Bett mit golden glänzenden Kugeln auf den vier Pfosten nahm den halben Raum ein. Darauf lag eine dicke Matratze mit beigem, fleckigem Überzug. Auch einige Löcher entdeckte Jules darin, wahrscheinlich Brandflecken vergessener Zigaretten. Ein großes, gelbes Badetuch war in der Mitte der Matratze ausgebreitet. Hier sollte es also stattfinden, was immer es sein würde. Jules blickte auf die alte, längst stumpf gewordene Tapete an den Wänden. Darauf waren lauter Papageien gedruckt. Sie starrten ihn tadelnd an.
»Ich koste hundert die Stunde, ist das okay für dich?«, hörte er ihre Stimme wie durch Watte. Er nickte benommen. Lulu hieß ihn, seinen Koffer abzustellen. Dann führte sie ihn über den Flur in ein winziges Bad und meinte, er wäre zu verschwitzt und sollte deshalb erst einmal duschen, was er auch gehorsam tat.
Das billige Shampoo roch nach Fichtennadeln und ließ seine Haut leicht Kribbeln. Gründlich spülte er den Schaum ab. Nachdem er das Wasser abgedreht hatte und sich suchend umblickte, entdeckte er den hohen Stapel mit Handtüchern auf einem Stuhl rechts neben der Duschkabine liegen. Er nahm das oberste weg und trocknete sich überaus sorgfältig ab. Vor allem seine nassen Schamhaare störten ihn ungemein, zerzaust wie sie waren. Immer und immer wieder fuhr er mit dem Tuch darüber hinweg, wollte sie so ein wenig glätten. Am liebsten hätte er sie trockengeföhnt, denn feucht erschienen sie ihm gleichermaßen sündig wie verboten. Der Mut vor dem, was auf der anderen Seite des Flurs und im Zimmer von Lulu auf ihn warten mochte, hatte ihn längst verlassen. Fast war er entschlossen, wieder in seine Kleidung zu schlüpfen und unter irgendeinem Vorwand aus der Wohnung zu flüchten. Doch da hörte er aus dem Schlafzimmer die lockende Stimme der Frau.
»Kommst du endlich zu mir, mein Großer?«
Jules fing wieder an zu zittern und sein Magen krampfte sich erneut zusammen. Er fühlte sich kraftlos und ausgeliefert. Doch dann fasste er sich und trat durch die Badezimmertür in den Flur und mit einem weiteren Schritt in den Schlafraum. Lulu rekelte sich auf dem gelben Badetuch auf dem Bett, trug immer noch diesen scheußlich violetten Bikini. Ihre Brüste lagen nun flachgedrückt auf ihrer Brust, erschien ihm viel kleiner als zuvor an der Türe. Dafür wölbte sich das Rund ihres Bauches umso mehr darunter. Obschon die dunkelhäutige, mollige Frau alles andere als wirklich vorteilhaft aussah, versteifte sich sein Penis beim Anblick ihrer fleischigen, nackten Schenkel mit den dicken Knien, richtete sich steil auf.
»Oh, du freust dich wohl sehr auf mich? Es ist doch nicht etwa dein erstes Mal? Oder doch?«
Er nickte verschämt, dafür überaus ehrlich.
»Na, dann komm doch zu mir, mein Junge, ich beiße dich schon nicht«, und nach einem kurzen Zögern fügte sie lüstern hinzu, »jedenfalls noch nicht.«
Lulu führte Jules an diesem Nachmittag in die Liebe zwischen Frau und Mann ein. Peter hatte den Jungen dazu abgerichtet, vollkommen auf seine Bedürfnisse einzugehen. Und so versuchte Jules auch bei dieser ihm fremden Frau herauszufinden, was sie wohl besonders gerne mochte und wie er ihr am besten gefallen konnte. Immer wieder lachte sie laut und kehlig auf, wenn er sich ungeschickt oder grob anstellte und einmal, als er sie mühsam auf den Bauch gedreht hatte und das erste Mal mit seinem Glied in sie eindrang, sagte sie mit etwas gepresster Stimme »Anal kostet aber fünfzig extra, mein kleiner Stecher.«
Die Frau roch wunderbar nach Veilchen und einem anderen, schweren und betörenden Duft. Es war Moschus Öl, wie Jules später herausfand. Es legte sich bleiern auf seine Schleimhäute, stachelte aber gleichzeitig seine Lust an.
Lulu zeigte ihm an diesem Nachmittag ohne Scheu, was eine Frau mochte und was die meisten von ihnen ablehnten, obwohl es beiden Beteiligten großen Spaß machen konnte. Bestimmt war ihr von Anfang an klar gewesen, dass Jules noch ein Junge und keineswegs erwachsen war. Doch die Liebesdienerin verfügte gleichermaßen über einen gesunden Geschäftssinn wie über ein großes Herz, war voller Erbarmen für einen Menschen in sichtlicher Not.
Jules lernte schnell von ihr und würde Lulu für ihre kundige Anleitung ein Leben lang dankbar sein. Diese vielleicht vierzigjährige, schon ziemlich verbrauchte Mulattin machte an diesem Samstagnachmittag aus einem fast sechzehnjährigen Jungen einen Mann, der vor keiner Sache mehr davonlaufen musste.
Vorgeschichte
Juni 2006 / Indischer Ozean, vor dem Horn von Afrika
Edward Hunter, von allen nur Eddie gerufen, hetzte die eisernen Treppenstufen hoch. Er war nur mittelgroß, aber sehr schlank, hatte dunkelbraunes, kurzes Haar und ein hübsches Gesicht. Der Dritter Offizier des Supertankers Daisy verspürte den starken Harndrang schon seit über einer Stunde. Bis zuletzt hatte er ihn unterdrückt, während er die Mannschaft beim Auswechseln der Temperaturfühler im Heizungsraum und bei den Unterhaltsarbeiten an der Liftanlage anwies und überwachte. Doch nun wurde es höchste Zeit für ihn und sein drängendes Bedürfnis.
»Das Bier vom Abendessen, verdammt«, knurrte er durch seine zusammengepressten Lippen. Ein Krampf im Unterleib ließ ihn mit schmerzverzerrtem Gesicht verharren. Sein Oberkörper krümmte sich, gleichzeitig wippte er auf seinem linken Bein, überstand so den stechenden Schmerz. Erst als auch der Drang seiner Blase sich sogleich zu entleeren abgeklungen war, stieg Eddie weiter die Stufen hoch.
»Warum hat der Kapitän bloß diese verdammte Nachtarbeit befohlen? Morgen früh hätte auch noch völlig ausgereicht. Die alten Fühler zeigten bisher noch keinen Aussetzer und auch der Lift hat immer funktioniert. Der Alte spinnt doch.«
Der Heizungsraum lag zwei Stockwerke unter dem Deck und die Wohnräume der Mannschaft zwei darüber. So musste Eddie vier Treppen hochsteigen, solange der Lift außer Betrieb war. Erst dort würde er die nächstgelegene Toilette finden. Doch als er auf Höhe des Decks angelangt war, erblickte er Scheinwerferlicht von draußen durch die Bullaugen einfallen und verharrte.
»Seltsam. Heut Nacht sind doch keine Arbeiten auf dem Vorschiff geplant? Welcher Trottel hat denn die Flutlichtanlage eingeschaltet?«
Trotz seiner körperlichen Not ging er zur Außentür, stieß sie auf, trat hinaus und blieb nach zwei Schritten überrascht stehen. Vor ihm wimmelte es von dunkelhäutigen Afrikanern, die mit langen, dicken Schläuchen beschäftigt waren, die sie mit vereinten Kräften über die Bordwand auf das Deck des Tankschiffs heraufzogen.
»He!«, rief Eddie halb erschrocken, halb ärgerlich aus, »was zum Teufel...?«
Dann traf es ihn von hinten so hart am Kopf, dass der Dritte Offizier des Supertankers Daisy augenblicklich zusammenbrach und wie ein nasser Sack zu Boden fiel. Endlich durfte sich sein gequälter Blasenverschluss entspannen. Der Urin nässte den Stoff seiner hellblauen Jeans dunkel und der Fleck wuchs rasch zwischen seinen Beinen an. Aus seinem eingeschlagenen Schädel sickerte derweilen unaufhörlich sein Blut, bildete eine dickflüssige Lache auf dem stählernen Boden des Decks. Seine Augen starrten jedoch gebrochen hinauf in den dunklen Nachthimmel und zu den unerreichbaren, kalt funkelnden Sternen.
Ein hochgewachsener Schwarzer beugte sich über ihn, begutachtete die hässliche Kopfwunde mit einem zufriedenen Lächeln. Dann rief er ein paar bellende Befehle zu den anderen Afrikanern hinüber. Sogleich setzten sich drei von ihnen in seine Richtung in Bewegung. Zwei packten wortlos den Toten an den Armgelenken und schleiften ihn zur Reling hinüber, wo sie ihn achtlos mit ihren Füssen über die Bordwand schoben. Der dritte Mann war bereits dabei, mit einem Eimer Wasser und einem Schwamm die Blutspuren zu beseitigen. Nichts würde am nächsten Morgen von diesem Mord berichten.
In Rotterdam aber würde Sally, die Freundin von Edward Hunter, in zwei Wochen vergebens auf ihren Liebsten warten.
Dienstag, 15. August 2006, 07:30 Uhr / City of London
»Jules Lederer, 1964 in Washington D.C. geboren, Doppelbürger der Schweiz und der USA, mit Wohnsitz in New York und in La Tour-de-Peilz in der Schweiz«, las Chefinspektor Gregory Tremmand seinen beiden Mitarbeitern laut aus einer Akte vor und fügte nach einer kurzen Pause hinzu »...von Beruf Unternehmensberater«, wobei er das letzte Worte mehr knurrte als aussprach, so als wenn er sich darüber ärgern müsste.
John Leason, eins achtzig groß, dunkelhaarig und mit den funkelnden Augen und dem unverwechselbaren Teint eines Inders und sein Kollege Hence Faulkner, fast eins neunzig, blond und braungebrannt wie ein Skilehrer in St. Moritz, schauten einander fragend an.
»War das als Witz gemeint, das mit dem Unternehmensberater?«, fragte John seinen Vorgesetzten unsicher, »falls ja, so haben wir ihn nicht wirklich verstanden.«
Hence Faulkner und John Leason saßen vor dem Pult ihres Chefs auf zwei Holzstühlen, die recht unbequem aussahen und auch waren. Leason hatte sich trotzdem hingeflegelt, lag mehr als dass er saß auf dem hässlichen Möbelstück und balancierte seinen rechten Fußknöchel zudem auf seinem linken Oberschenkel, wippte mit der Fußspitze einen Takt, wirkte in diesem Moment wie ein ungeduldiger Terrier, dessen Flanken vor Aufregung zittern, weil er sich auf die kommende Jagd auf Ratten freute. Sein Kollege John Faulkner saß dagegen stocksteif auf seinem Stuhl, hatte die Schultern zurückgezogen und die Brust rausgedrückt. Mit seinen ruhigen, grauen Augen ließ er das Gesicht seines Vorgesetzten Tremmand keinen Moment aus den Augen, als könnte er daraus weitere wichtige Informationen ablesen.
Gregory Tremmand, ein Mann von Ende fünfzig, mit dem Gesicht einer gereizten Bulldogge, in das sich jedes seiner vielen Dienstjahre bei Scotland Yard als eine zusätzliche Furche tief eingegraben hatte, angelte sich die nächste Zigarette aus einem zerknautschten Päckchen, steckte sie zwischen seine Lippen und sah seine beiden Mitarbeiter etwas gequält an.
»Nein, das mit dem Unternehmensberater war kein Witz. So steht es zumindest im Telefonbuch.«
John und Hence sahen sich wieder fragend an. Ihr Chef hatte sie vom Mordfall in der Trevor Street abgezogen, um ihnen etwas über einen Unternehmensberater aus der Schweiz zu erzählen? Synchron zuckten sie fragend mit den Schultern und wirkten in diesem Augenblick das erste Mal wie ein eingespieltes Team.
Chefinspektor Tremmand hatte die hilflose Geste seiner Mitarbeiter nicht beachtet, las weiter aus der Akte vor, während seine rechte Hand auf der Suche nach seinem Feuerzeug über die Pultplatte tastete.
»Erstmals wurde er 1986 bei uns aktenkundig. War in die Irangate-Affaire verwickelt. Jedenfalls wird er in einem Untersuchungsbericht als Zeuge aufgeführt. Genaue Schlüsse über seine Rolle sind jedoch nicht möglich. Dann, 1991, tauchte er in Russland auf. Das war damals, als Gorbatschow gestürzt wurde und sich später Jelzin an die Macht schwingen konnte. Gemäß einem Bericht der MI6 hat Lederer ein Jahr später zwei Tonnen Beluga Kaviar für vierzig US-Dollar das Pfund von den Russen gekauft und nach Westeuropa verschiffen lassen. Schon damals lag der Weltmarktpreis für ein Pfund bei über tausend Dollar. Warum ihm die Russen den Kaviar so billig nachgeschmissen haben, konnten weder die Deutschen noch wir in Erfahrung bringen. Es dürfte sich um eine Gefälligkeit von Jelzin gehandelt haben. Wir wissen jedoch nicht, aus welchem Grund oder zu welchem Zweck.«
Hence Faulkner stieß einen leisen Pfiff zwischen den Zähnen hervor. Er hatte sich den Gewinn dieses Unternehmensberaters bei dem Kaviar-Geschäft ausgerechnet und kam auf fast vier Millionen Dollar.
Tremmands Finger hatten endlich das Feuerzeug ertastet und die Zigarettenspitze glühte hell auf, als er sie in Brand setzte. Er nahm einen ersten und tiefen Zug, hielt einen Augenblick lang inne, um den Rauch in seiner Lunge wirken zu lassen, dann erst atmete er befreit aus.
John und Hence beobachteten ihren Vorgesetzten verstohlen, aber höchst aufmerksam, zeigten dabei ein möglichst unbeteiligtes Gesicht. Der Zigarettenrauch war in den Tiefen der Lungen ihres Chefs vollständig aufgesogen worden, denn bei seinem Ausatmen war kaum ein Wölkchen zu sehen gewesen. Tremmand rauchte immer auf diese ungesunde Weise und bei Scotland Yard liefen seit zwei Jahren Wetten über den Kalendertag, an dem ein Arzt bei Tremmand Lungenkrebs feststellen würde. Jeder Tipp kostete zwei Pfund und jeder Mitarbeitende durfte so viele davon abgeben, wie er bezahlen wollte. Das gesamte Geld sollte demjenigen Glücklichen gehören, der den Zeitpunkt am Genauesten erraten hatte. Der Jackpot war mittlerweile auf den Gegenwert eines Mittelklassewagens geklettert und die regelmäßig wiederkehrenden, oft Minuten lang dauernden Hustenanfälle von Tremmand heizten die Wettfreudigkeit seiner Mitarbeitenden immer wieder von Neuem an. Doch dieses Mal räusperte sich Tremmand nur kurz und fuhr sichtlich ruhiger als zuvor mit seinen Ausführungen fort.
»Vor ein paar Jahren war er in die Jenny-Affäre verwickelt. Ihr habt bestimmt von der Geschichte mit Verteidigungsminister Brown, dem Callgirl Jenny und der IRA gehört? Müsste mittlerweile zum Ausbildungsstoff gehören. Es war dieser Lederer, der uns damals den Tipp mit dem Tabakshop in Soho zuspielte. Er muss in diese Spionagegeschichte hineingestolpert sein, hatte die richtigen Schlüsse gezogen und uns danach informiert. Seit diesem Tag behalten wir den Kerl auf unserem Radarschirm.«
Seine beiden Mitarbeiter blickten ihren Chef erstaunt an.
»Wie kann ein Unternehmensberater in eine solch große Sache einfach hineinstolpern?«, meinte John Leason ungläubig seinen Kopf schüttelnd.
Tremmand überging auch diese Bemerkung, ohne eine Regung zu zeigen, sah aber von den Aktennotizen auf und seinen beiden Mitarbeitern direkt und zwingend in die Gesichter.
»Lederer trifft in fünfundvierzig Minuten mit der British Airways Maschine aus Genf in Heathrow ein. Schnappt euch einen Wagen und beschattet ihn. Ich will wissen, was er tut und mit wem er sich trifft. Aber schaut zu, dass er euch auf jeden Fall bemerkt. Er soll ruhig wissen, dass wir ihm hier in London auf die Finger schauen und er nirgendwohin gehen kann, ohne dass wir es erfahren. Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass der Kerl hier bei uns noch einmal in irgendwelche Dinge verwickelt wird. Kapiert?«
John und Hence nickten wortlos.
»Und wie sieht er aus?«
Tremmand zupfte ein Foto aus dem Aktendeckel und schob das Bild über die Pultplatte. Faulkner beugte sich vor, nahm es auf und steckte es wortlos ein. Dann erhoben sich die beiden jungen Agenten und wandten sich zur Tür. Tremmands nächste Bemerkung ließ sie noch einmal innehalten.
»Lasst euch von dem Kerl aber nicht verarschen, Jungs. Er ist uns hier in London in den letzten Monaten schon zweimal entwischt. Nicht für lange Zeit zwar, doch wir wussten beide Male nicht, wo er sich herumtrieb und mit wem er sich traf. Ich will keine weiteren Pannen mehr erleben. Ist das klar?«
»Klaro, Boss«, quittierte Hence lässig die Frage.
»Yes, Sir«, meinte John und stand grinsend stramm, wie beim Militär, worauf ihn sein Boss bloß gequält ansah und mit der Hand eine müde, wegwischende Bewegung machte.
Die beiden Agenten verließen das Büro ihres Chefs, zogen die Tür hinter sich leise zu. Tremmand hatte sich wieder an sein breites Pult gesetzt und die Akte von Lederer noch einmal aufgenommen, blätterte nachdenklich darin herum und meinte leise zu sich selbst: »Was willst du diesmal in meiner Stadt?«
*
»Mr. Lederer ist eingetroffen« säuselte die vielleicht fünfundzwanzig Jahre alte, äußerst aparte Sekretärin ins Mikrofon ihres Telefons. Nachdem sich Jules bei ihr vorgestellt hatte, sah sie ihm erst prüfend in die Augen, danach in ihre Agenda nach, hob den Hörer ab und drückte eine Taste.
»Ja, Mr. Ashawii«, quittierte sie etwas, dass Jules nicht mithören konnte und schob den Hörer zurück auf den Apparat. Sie lächelte ihn mit blendend weißen Zähnen an, die gleichmäßig wie kleine Perlen zwischen ihren blutrot gefärbten Lippen hervor blinkten.
»Bitte setzen Sie sich noch für einen Augenblick, Mr. Lederer. Mr. Ashawii wird in wenigen Minuten Zeit für Sie haben.«
Jules fläzte sich bewusst jugendlich auf das breite Sofa in dem recht großen Vorzimmer zum Büro des Rohstoffhändlers, blickte die Sekretärin offen und unverhohlen, ja fast schon anzüglich an. Er hatte gleich beim Eintreten das kurze Aufblitzen in ihren mandelförmigen Augen bemerkt. Ihre orientalisch-asiatischen Gesichtszüge, eine Mischung aus Inderin und Afghane vermutete der Schweizer, kombiniert mit dem schulterlangen, dichten, schwarzen Haar, den großen, dunklen Augen und einem samten aussehenden Teint, elektrisierten mit Sicherheit jeden männlichen Besucher.
»Wie heißen Sie«, fragte er geradeheraus, als sie ihn ebenfalls offen betrachtete.
»Sonja Leason«, war ihre Antwort und sie blickte ihn dabei recht keck, aber auch irgendwie abschätzend oder gar lauernd an, wie eine Wildkatze kurz vor dem Sprung auf ihre Beute.
»Ich hab Sie hier noch nie gesehen. Arbeiten Sie schon lange für Ashram Ashawii?«
»Erst seit zwei Monaten«, meinte sie knapp angebunden, wenn auch nicht direkt unhöflich. Irgendetwas an seiner Frage oder eher noch an ihrer Antwort schien sie zu stören. Denn danach blickte sie von ihm weg und tat so, als suchte sie etwas auf ihrem Pult, öffnete eine Schublade und kramte darin herum, schloss sie, erhob sich und ging betont langsam zum Aktenschrank, der an einer der Wände stand. Dabei kam sie dicht am Sofa vorbei und der Schweizer nahm ihren Duft wahr, sog ihn hörbar und genießerisch ein.
»Mmmm. Prada Tendre«, stellte er fest.
Verblüfft blieb sie stehen und sah ihn an.
»Ja, stimmt. Sind Sie in der Parfümbranche tätig, Mr. Lederer?«
»Nein, das gerade nicht. Doch ich mag diesen Duft ganz besonders, vor allem der Zitrusanteil durch die Bergamotte und auch den würzigen Kardamom. Es ist ein Parfüm, das genügend Raum für den herrlich natürlichen Duft der Frau lässt, die es trägt.«
Sie sah ihn erst etwas zweifelnd und ein wenig verwirrt an, konnte in seinen Augen jedoch nur Aufrichtigkeit erkennen. So lächelte sie ihn spitzbübisch an, hob ihr Näschen ein wenig in die Luft und schnüffelte übertrieben deutlich in seine Richtung.
»Auch nicht schlecht«, urteilte sie, »sehr männlich. Was ist es?«
»Alaun.«
»Alaun? Noch nie davon gehört.«
Sie schnüffelte erneut.
»Aber es gefällt mir.«
Sie ging zu einem Schrank an der Wand, öffnete die unterste Schublade und pickte sich eine Akte heraus. Dazu bog sie ihren Oberkörper bei durchgedrückten Knien weit nach vorne und nach unten, streckte ihm so ihren süßen kleinen Po entgegen, der den dünnen Stoff ihres kurzen Jupes stark spannte und fast zu sprengen drohte. Jules erkannte, dass sie kein Höschen darunter trug, denn nicht mal ein Tange-String zeichnete sich ab. Da richtete sie sich auch schon wieder auf, drehte sich geschmeidig auf einem Fuß herum und ging lässig zu ihrem Pult zurück.
Jules bewunderte ihre zierlichen Füße mit den schlanken Fesseln. Trotz der hohen Stilos bewegte sie sich sicher, das Resultat von ein paar Jahren Ballettunterricht, vermutete er, oder der Ausbildung als Laufstegmodell, obwohl sie dafür wohl an die fünf Zentimeter zu klein geraten war.
Als sie sich wieder gesetzt hatte, drehte sie ihm ihr hübsches Gesicht wieder zu und schaute ihn herausfordernd an, so als wollte sie sagen: Na, gefällt dir, was du siehst? Sicher gefalle ich dir. Ich gefalle allen echten Männern. Doch traust du dich auch?
Danach senkte sie ihr Gesicht auf die Akte.
»Hübsch.«
Mit einem Ruck hob sie ihren Kopf und sah ihn aus schmalen, abschätzenden Augenschlitzen an, zeigte gleichzeitig ein bezauberndes, spitzbübisches Lächeln.
»Wie meinen Sie?«, tat sie gekünstelt verwirrt.
»Ich meine Ihr Kleid. Ein Yves Saint-Laurents, wenn ich mich nicht irre?«
Nun war sie tatsächlich verblüfft, wie ihm ihr offener Mund verriet, der ihr Gesicht keineswegs verunstaltete, sondern sie noch ein paar Jahre jünger machte.
»Stimmt! Woher wissen Sie das?«
»Ich habe es gesehen. Auf dem Laufsteg in Paris, letztes Frühjahr.«
»Sie waren in Paris? Sind Sie denn im Modebusiness tätig?«
Er schüttelte lächelnd den Kopf.
»Nein, ich war bloß zufällig dort. Auf Einladung eines Geschäftsfreundes.«
»Aha.«
Sie schenkte ihm ein strahlendes Lächeln, zeigte ihm erneut ihr wunderschön gearbeitetes Gebiss. Denn dass diese nicht natürlich sein konnten, bewies ihre makellose Regelmäßigkeit und der symmetrische Aufbau. Genauso wie ihre etwas zu üppige Oberweite, gemessen an ihrem schmalen, mädchenhaften Becken, waren auch ihre Zähne eine Spur zu perfekt geraten. Ganz im Gegenteil zu ihrer Handtasche, wie er nun feststellte und die hinter ihrem Stuhl auf einem Büroschrank stand, als gehörte sie zur Einrichtung. Die große, goldene Schnalle wies sie als eine eher mittelprächtige Gucci aus. Doch zum bewusst schlicht gehaltenen Kleid von Saint-Laurents passte das auffällige und etwas plump wirkende Anhängsel nicht wirklich, sah dazu beinahe billig aus. Besser hätte ihr eine klassische Tasche gestanden, eine Kelly Bag von Hermes vielleicht oder angesichts der Jugendlichkeit ihrer Trägerin vielleicht noch eher eine Birkin?
Jules wollte schon in die nächste Flirtstufe einsteigen, als seine Gedanken doch noch zu Ashram Ashawii schweiften. Jules kannte die Vorliebe des Libanesen für Assistentinnen mit Können und Aussehen. Und er wusste von Ashrams eifersüchtigem Wachen über die Tugend seiner Sekretärinnen. Doch in Wirklichkeit zwang der Rohstoffhändler alle seine persönlichen Mitarbeiterinnen regelmäßig zum Beischlaf. Das war ein wesentlicher Teil seiner Anstellungsbedingungen und der eigentliche Grund, warum er ihnen den dreifachen Lohn bezahlte. Er genoss seine Assistentinnen eine Zeit lang, bis er ihrer Müde wurde. Dann tauschte er sie durch eine frische Kraft aus. Doch wehe, wenn ihm in dieser Zeit ein anderer Mann in die Quere kam. Nebenbuhler konnte der Libanese nicht ausstehen.
Diese Gedanken mussten sich wohl bis in seine Gesichtszüge geschlichen haben, vielleicht sogar zusammen mit einem unbewussten, aber bedauernden Schulterzucken. Jedenfalls warf ihm die Schöne hinter dem Pult nun einen giftigen Blick zu, drehte sich von ihm weg und beachtete ihn nicht weiter. Sie hatte in seinen Augen wohl erkannt, was sie selbst war, nämlich bloß die unterbeschäftigte, überbezahlte Sekretärin und Sexgespielin eines erfolgreichen Londoner Geschäftsmanns.
Das große Vorzimmer war mit geschmackvollen Möbeln ausgestattet, wenn auch in einer orientalisch anmutenden, überladenen Weise. Zum viel zu wuchtigen Pult der Assistentin aus dunklem Mahagoni mit dem ebenso dunklen Schrank dahinter, gesellte sich ein weiß lackierter, um Aufmerksam heischender Aktenschrank an der einen Wand und ihm gegenüber ein elfenbeinfarbener, moderner Bartresen.
Das wuchtige Sofa von Parker+Farr, auf dem sich Jules herum lümmelte, war ein viktorianisches Monster mit Blumendekor, Fransen und Troddeln. Seine weichen Kissen gefüllt mit Gänsefedern ließen einen richtiggehend einsinken. Ashram hatte ihm mal erzählt, das Sofa stammte aus dem Requisitenfundus der Miss Marple Filmstudios. Zum Beweis hing ein kleines schwarz-weiß Foto in einem Bilderrahmen an der Wand hinter dem Sofa. Es zeigte die Amateurdetektivin in ihrem Filmstudio-Haus und hinter dem Sofa stehend. Araber liebten es nun mal, mit Statussymbolen zu protzen.
Vor dem breiten Polstermöbel stand ein schön gearbeiteter, aber unpassend kleiner Tiffany Tisch. Und an den Wänden hingen klassische Gemälde mit allzu protzigen Goldrahmen. Ein Segelschiff in rauer See, Ernte einbringende Bauern und eine Fuchsjagdszene.
Jedes Möbelstück, jedes Bild war für sich allein betrachtet voller Charakter, wertvoll und stilsicher ausgesucht. Doch in ihrer Kombination wirkte die Einrichtung eher wie der zusammengewürfelte Ramsch, den man für einen Garagenverkauf vom Speicher geräumt und auf dem Rasenplatz vor seinem Haus ausbreitet hatte, damit ihn die neugierigen Nachbarn begaffen konnten und kaufen sollten. Wieder ein Beweis dafür, dass Geldbesitz nichts mit ästhetischem Empfinden zu tun hatte. Innenarchitekten und Stil-Berater würden sich auch in Zukunft die Butter auf ihre Brötchen verdienen können, wenn sich reiche, aber unsensible Menschen vorteilhaft präsentieren wollten.
In diesem Moment sprang die Tür zum Büro des Direktors der O&G Limited auf. Ashram Ashawii trat schwungvoll auf seinen stämmigen Beinen in der ihm eigenen, leicht schwankenden, beinahe watschelnden Art heraus, streckte breit lachend seine kurzen, dicht mit schwarzen Haaren übersäten Arme aus den nach hinten gerutschten, zu engen Jackenärmeln entgegen und rief: »Jules, endlich. Wie lange ist es her?«
*
Nach der überschwänglichen Begrüßung bat ihn Ashram in sein Büro, hieß ihn dort auf einem der beiden Fleming & Howland Chesterfield Ledersessel vor seinem Schreibtisch Platz nehmen, während er selbst von einem schmalen, hohen Tisch an der Wand zwei Gläser umdrehte und sie aus einer dickbauchigen Karaffe großzügig füllte. Er reichte Jules eines der Gläser und trat mit dem anderen hinter sein Pult. Dann prostete er ihm wortlos lächelnd und im Stehen zu, nahm einem langen Schluck, schnalzte zufrieden mit der Zunge und setzte sich erst dann und leise ächzend.
War Ashram völlig außer Form? Hatte er so sehr an Gewicht zugelegt, dass ihn schon das Herumlaufen im Büro und das Setzen außer Atem brachten? Richtig sportlich hatte der kompakte Libanese noch nie auf andere Menschen gewirkt. Doch wer mit ihm einmal Squash oder Tennis gespielt hatte und sich dabei übers Feld hatte hetzen lassen müssen, der wusste nur zu genau, wie wendig und ausdauernd der Libanese trotz seiner Leibesfülle war. Seine kurzen Arme und der dicke Hals mit dem ewig offen stehenden, obersten Hemdknopf täuschten. Die stämmigen Knochen seines Körpers waren dick mit Muskeln bepackt, die unter einer eher dünnen Fettschicht ruhten. Und Ashram wusste mit seiner Kraft durchaus umzugehen, trainierte früher mehrmals pro Woche und besaß die explosive Kraft eines Gewichthebers: äußerlich kaum zu erkennen, doch wuchtig und unwiderstehlich, wenn sie eingesetzt wurde.
Nein. Das Ächzen hatte sicher nichts mit seinem körperlichen Befinden zu tun, eher mit einer seelischen Belastung. Besorgnis schlich sich in die Überlegungen von Jules. Denn auch wenn sie vor allem reine Geschäftsfreunde waren, so verband ihn mit Ashram Ashawii eigentlich vom ersten Augenblick ihres Kennenlernens an auch eine gewisse kameradschaftliche Verbundenheit, die wohl aus der Lebensfreude und der Energie des Libanesen entspross.
Sie hatten sich nach dem Schluck ein paar Sekunden lang schweigend betrachtet.
»Wie geht es Hélène und den Kindern?«, begann der Rohstoffhändler das Gespräch so wie eigentlich jedes Mal, wenn sie sich trafen, wobei er den Namen von Jules Ehefrau in seinem arabisch gefärbten Französisch aussprach.
Seine Standardfrage war jedoch keineswegs als Floskel gedacht, wie Jules wusste, ganz im Gegenteil. Als Familienmensch war es Ashram ein echtes Anliegen, auch über die Befindlichkeiten der engsten Angehörigen seiner Bekannten auf dem Laufenden zu sein. Einem Menschen aus dem Westen mochte dies ein wenig seltsam erscheinen, angesichts der regelmäßigen, außerehelichen Eskapaden des Rohstoffhändlers. Doch als echter Orientale konnte der Libanese seine überschwänglichen Gefühle einfach nicht nur auf eine einzige Frau konzentrieren.
»Alles bestens«, beantwortete Jules die Frage knapp und ohne eine entsprechende Gegenfrage nach der Familie von Ashram zu stellen. Das war sehr unhöflich, machte dem Rohstoffhändler aber unmissverständlich klar, dass der Schweizer diesmal ohne weitere Umwege zum Grund der Einladung kommen wollte. Immerhin hatte ihn der Libanese erst gestern Abend angerufen und ihn dringlich nach London gebeten, weg von seinem Haus am Genfersee, wo Jules ein paar Tage Urlaub hatte verbringen wollen.
»Na gut«, meinte der Rohstoffhändler nach kurzem Zögern, als der Schweizer keine Anstalten machte, noch etwas an seine kurze Antwort anzufügen.
»Was wissen Sie über die Tankerrouten vom Golf von Arabien nach Westeuropa und den USA?«
»Nicht sehr viel, Ashram. Jeden Tag verlassen vier oder fünf VLCC oder ULCC und rund ein Dutzend kleinere Tanker die dortigen Häfen in Richtung Westen. Die kleinen Schiffe fahren meistens durch den Suezkanal nach Europa oder in die USA. Von den großen Pötten wählt die Hälfte die Route ums Kap herum, die etwa dreißig Tage dauert. Die anderen großen Tanker fahren über das Rote Meer bis zum Suezkanal und lassen dort einen Teil der Ladung durch die Pipelines zum Mittelmeer pumpen, bevor sie dank des nun geringeren Tiefgangs den Kanal benutzen können und laden das Öl nach der Passage wieder. Oder sie löschen ihre Fracht vollständig und ganz andere Schiffe nehmen ihre Ladung im Mittelmeer auf und transportieren sie weiter. Doch warum fragen Sie mich das?«
Der Libanese blickte ihn prüfend an. Irgendwie schien er während den Ausführungen von Jules auf irgendetwas zu lauern, auf ein Stichwort oder einen besonderen Hinweis. Der Schweizer erkannte in den Augen des Libanesen, wie enttäuscht er von der nur allgemein gehaltenen Antwort war. Doch dieser Gesichtsausdruck wich rasch einem fest entschlossenen und für den Orientalen außergewöhnlich ernsten.
»Es gibt da eine Sache, die wir gerne geklärt hätten. Und ich denke, Sie sind der richtige Mann für diese Aufgabe.«
Das WIR im ersten Satz elektrisierte Jules. Wer war WIR? Soweit er wusste, gehörte die O&G Limited mit Sitz in London immer noch zu hundert Prozent Ashram Ashawii. Nie zuvor hatte der Rohstoffhändler im Zusammenhang mit seinem Unternehmen das Wort WIR verwendet. Hatte der fünfzigjährige Libanese neuerdings Partner? Oder war er nur der Vermittler zwischen einer Gruppe von Interessenten und ihm?
Ashram wartete nach seinen Worten auf eine Reaktion des Schweizers, auf eine Bemerkung oder eine Frage. Der tat ihm diesen Gefallen jedoch nicht, saß weiterhin ruhig da und nahm einen weiteren Schluck des vorzüglichen schottischen Whiskeys.
Das ausgeprägte Aroma nach Kräutern und Trockenblumen, mit dem Hauch von Minze, zusammen mit dem etwas salzigen Geschmack und dem weichen, sehr buttrigen Abgang weckten in ihm Erinnerungen. Es musste ein Ben Wyvis sein, wahrscheinlich aus dem Jahr 1972, da war sich der Schweizer ziemlich sicher. Ashram zeigte nicht nur bei Frauen, sondern auch beim Essen und Trinken einen auserlesenen Geschmack und konnte sich diesen wirklich teuren Tropfen auch problemlos leisten. Und als orthodoxer Christ war ihm Alkohol keineswegs durch seine Religion verboten. So saß Jules fast ein wenig verträumt da und genoss es ganz einfach, bei jedem Nippen so an die zehn Pfund seine Kehle hinab rinnen zu lassen. Der Whiskey wärmte den Magen, gleichzeitig verströmte der lange Nachgang einen sanft umhüllenden Duft.
Es verstrich eine volle Minute, während der ihn Ashram unverhohlen musterte und während Jules ihm freundlich zulächelte, zwischendurch immer wieder an seinem Glas schnüffelte oder nippte. Endlich gab Ashram sein Geduldspiel auf und räusperte sich.
»Äh, na gut. Also, Jules, es geht um folgende Sache.«
Noch einmal stockte der Rohstoffhändler, so als müsste er sich vergewissern, dass ihm sein Besucher auch wirklich mit voller Aufmerksamkeit zuhörte. Dabei flackerte sein linkes Augenlid kurz und seine innere Anspannung war ihm auch aufgrund der etwas verkniffenen Mundwinkel leicht abzulesen.
»Seit rund achtzehn Monaten treten in unregelmäßigen Abständen gewisse Schwierigkeiten auf den Tankerrouten vom Golf nach Europa und in die USA auf, Probleme, die Sie für uns aufklären sollen. Doch bevor ich mehr darüber verraten kann, muss ich von Ihnen erst wissen, ob Sie unseren Auftrag auch annehmen.«
Schon wieder sprach er in der Mehrzahl. Die Neugierde von Jules war nun endgültig geweckt. Doch so leicht ließ er sich vom Libanesen nicht einwickeln.
»Etwas mehr müssen Sie mir schon verraten, mein alter Freund, bevor ich meine Seele an Sie verkaufe«, entgegnete er scherzhaft und breit lächelnd, »sagen Sie mir bitte klipp und klar, was Sie von mir erwarten. Dann kann ich Ihnen auch sagen, ob ich in der Lage und bereit bin, es Ihnen zu geben.«
»Es ist eigentlich eine Kleinigkeit«, begann der Rohstoffhändler abwiegelnd. Doch bei seinen Worten verlagerte er sein Gewicht im Sessel von links nach rechts, so als wenn ihm das teure Stück plötzlich unbequem geworden wäre. Dem Libanesen war sichtlich unwohl in seiner Haut. Vielleicht, weil Jules ihn in die Rolle des Bittstellers zwang? Oder steckte mehr dahinter, als seine Gestik und Körperhaltung bislang verrieten?
»Sie sollen bloß zwei oder drei Tankerfahrten von Kuwait nach Europa mitmachen. Nicht als Passagier selbstverständlich, sondern als Besatzungsmitglied. Dabei sollen Sie in ihren Berichten alles Außergewöhnliche festhalten, das Ihnen während den Fahrten, aber auch beim Laden und Löschen der Schiffe auffällt. Das ist auch schon alles.«
»Alter Freund«, entgegnete Jules immer noch lächelnd, »so schnell kriegen Sie mich nicht um den Finger gewickelt. Sie wissen, wie teuer ich bin. Für die Erledigung von Spazierfahrten würden Sie mich kaum engagieren. Ich stelle Ihnen deshalb drei einfache Fragen. Wenn Sie mir diese zu meiner Zufriedenheit beantworten, bin ich Ihr Mann.«
Ashram schaute ihn verunsichert an, nickte zögernd.
»Okay. Was wollen Sie wissen, Jules?«
»Es wird erzählt, dass in den letzten zwölf Monaten zwei Tankschiffe auf ihrer Fahrt nach Europa spurlos verschwunden sind. Die See soll ruhig gewesen sein und man konnte später keine Ölteppiche entdecken, die auf eine Explosion und ein Sinken der Schiffe hingewiesen hätten. Weiter erzählt man sich, dass beim Entladen in den Zielhäfen, seit mehr als einem Jahr immer wieder geringe Mengen an Erdöl fehlen, so, als wenn ein Teil der Ladung auf offener See gelöscht worden wäre. Doch in den elektronischen Pumpaufzeichnungen der Schiffe konnte man nichts dergleichen feststellen. Und Leck geschlagen waren die Tanker mit Sicherheit auch nicht. Wie also sollte Öl von den Schiffen während des Transports verschwinden? Die Befragung der Besatzungen ergab, soweit ich informiert bin, nie etwas Handfestes. Doch es sollen von den betroffenen Tankern manchmal Besatzungsmitglieder oder gar Offiziere auf offener See verschwunden sein. Man nimmt an, dass diese Männer mit den Diebstählen des Erdöls zu tun hatten, auch wenn man sich das Wie bislang nicht erklären kann. Denn weder beim Ladevorgang noch beim Löschen konnten Unregelmäßigkeiten nachgewiesen werden. Darum meine erste Frage an Sie, Ashram. Hat Ihr Auftrag mit dem verschwundenen Erdöl zu tun?«
»Ja.«
»Na gut. Kommen wir zur zweiten Frage. Wäre ich in Ihrem Auftrag unterwegs oder im Auftrag anderer?«
»Im Auftrag von mir und anderen.«
Unruhe breitete sich nun in den Augen von Ashawii aus, während er beinahe lauernd auf die dritte Frage seines Besuchers wartete. Jules ließ ihn noch etwas zappeln und kippte erst noch voller Genuss den letzten Schluck aus dem Glas in seine Mundhöhle, schluckte ihn bedächtig. Erst danach hob er seinen Blick vom Rand des Glases, richtete ihn direkt auf den Libanesen und fragte unschuldig lächelnd: »Und wie geht es Melina und deinen beiden Jungs?«
Eine kurze Verblüffung flog über die wulstigen Lippen des Libanesen. Dann zogen sich seine Mundwinkel zu einem ungemein breiten, entspannten Lächeln auseinander.
»Gut«, meinte er zweideutig, »sehr gut.«
Ob er damit den Gesundheitszustand seiner Familie meinte oder eher Jules harmlose dritte Frage, war aus den Worten nicht heraus zu hören.
»Sie kennen meine Bedingungen, Ashram. Eine Überfahrt dauert mit der Anreise etwa fünfzig Tage, wenn es ums Kap herum geht. Ich berechne Ihnen pro Fahrt also eine Million Dollar, zahlbar vor jeder Fahrt auf mein Konto bei der Bank of Dubai hier in London. Die Nummer finden Sie sicher noch in Ihren Akten. Sobald das Geld für die erste Reise eingetroffen ist und Sie mir ein Plätzchen auf einem der Tanker organisiert haben, kann es von mir aus losgehen. Als was werde ich reisen?«
Ashram zögert nur kurz.
»Können Sie kochen?«
»Wenn’s sein muss«, gab der Schweizer lachend zurück, »Seemänner sollen ja hart im Nehmen sein.«
Auch Ashram entspannte sich zusehends. Er wusste, er bekam, was er wollte, ohne dass er Jules allzu viel an Informationen hatte preisgeben müssen und ohne, dass dieser von ihm verlangt hatte, die Leute im Hintergrund zu benennen.
Und Jules?
Nach dem gestrigen Anruf des Libanesen mit seiner dringlichen Bitte hatte der Schweizer gleich vermutet, die Einladung des Rohstoffhändlers müsste mit den vor der Öffentlichkeit bislang geheim gehaltenen Erdölverlusten zu tun haben. Shridar Kumani hatte ihm bereits vor einigen Wochen davon erzählt. Der Inder war ebenso im Ölgeschäft und als Makler tätig, so wie Ashram Ashawii. Doch im Gegensatz zum Libanesen hatte Shridar seine Zelte direkt in Kuwait City aufgeschlagen und seinen Daumen so noch näher am Puls der Erdölverladestationen. Jules kannte den ewig freundlichen, stets lächelnden Inder seit vielen Jahren und sie tauschten sich regelmäßig aus.