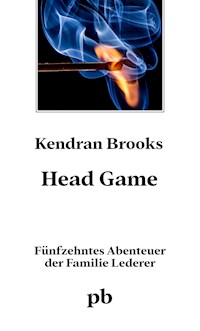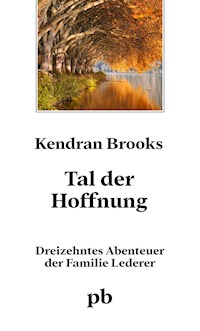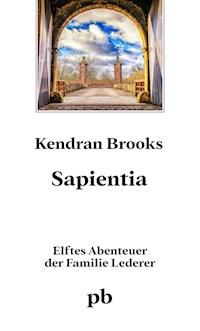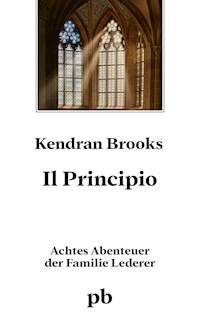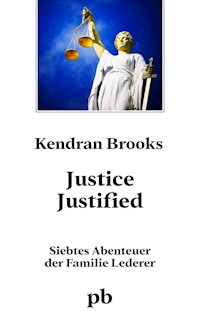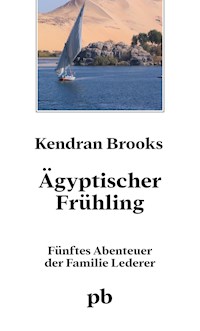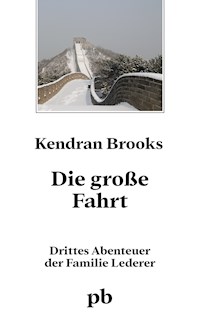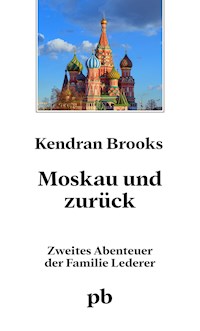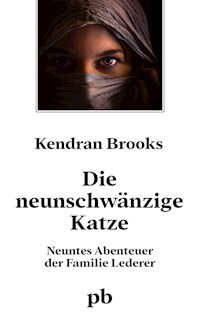Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Drei voneinander unabhängige Handlungsstränge erzählen Geschichten in Grossbritanien, in Brasilien und in Kenia. Wir begleiten Sophie Shi und Fu Lingpo ein Stück weit. Die beiden bauen sich im Nordosten des Landes ein neues Leben auf. Doch die al-Shabaab Milizen und alte Bekannte aus Hongkong hängen wie Damoklesschwerter über ihrem zukünftigen Glück. In Brasilien erfahren wir endlich, warum und wohin Shamee Ling zweimal spurlos verschwand. Und wir begleiten die chinesstämmige Brasilianerin ein Stück auf ihren steinigen Wegen. In London ist Sheliza bin-Elik mit ihrer neugeborenen Tochter nur scheinbar sicher und dem Terror-Regime der ISIS entkommen. Denn Verblendete gibt es überall. Wer schützt die junge Mutter und ihr Kind vor den radikalen Islamisten in Grossbritannien? Die drei Erzählungen werden vom Besuch einer katholischen Messen in Lausanne umrahmt. Jules begleitet Alabima und Alina an diesem Sonntagmorgen und macht sich seine ganz eigenen Gedanken zu dem, was er dort sieht und hört und fühlt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kendran Brooks
Im Fegefeuer
10. Abenteuer der Familie Lederer
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorgeschichten
Einzug
Schuldbekenntnis
Gloria
Lesung
Evangelium
Predigt
Glaubensbekenntnis
Gabenbereitung
Wandlung
Kommunion
Stille
Segen
Impressum neobooks
Vorgeschichten
»Du hast was?«
Jules Lederer stand mit einem irritierten Gesicht unter der Tür zur Küche, hielt einen eingeschriebenen Brief des Tribunal d‘Arrondissement de Lausanne in seiner Hand und blickte auf Alabima, die am Tisch saß und Gemüse kleinschnitt.
»Ich habe ein rassistisches Arschloch K.O. geschlagen«, antwortete seine Gattin geduldig und gelassen, als spräche sie zu einem Kleinkind, sah nicht zu ihm auf.
»Und wann soll das gewesen sein?«
Der Schweizer schien ratlos, während seine äthiopische Ehefrau unbekümmert mit den Vorbereitungen fürs Mittagessen weiterfuhr und mit Messer, Schnittbrett und Gemüse hantierte.
»Das war bei der Einschulung von Alina. Sie hatte sich neben einen hübschen Blondschopf gesetzt. Als deren Vater das sah, verlangte er von seiner Tochter, sich woanders hinzusetzen.«
»Und deswegen hast du den Mann verprügelt? Womit denn?«
Jules Lederer, um die fünfzig Jahre alt, war ein Selfmade-Millionär. Sein Vermögen hatte er sich mit der Erledigung von delikaten, aber auch gefährlichen Aufträgen für eine wohlhabende Klientel verdient. Seine Ehefrau Alabima lernte er vor acht Jahren kennen, als er sich geschäftlich in Äthiopien aufhielt. Die beiden heirateten und adoptierten wenig später Chufu, einen damals 15-jährigen philippinischen Waisenjungen, der mittlerweile in Brasilien Psychologie studierte und kurz vor dem Abschluss stand. Zudem bekamen Jules und Alabima Lederer nach einem Jahr Ehe eine Tochter, die sie auf den Namen Alina taufen ließen.
Der Schweizer hatte schon als Jugendlicher asiatischen Kampfsport betrieben und war auch mit fünfzig noch recht fit. Dass allerdings auch seine Ehefrau kräftig zuschlagen konnte, davon hatte er bislang nichts gewusst.
»Ich hab ihm zuerst in seine Eier getreten und ihn anschließend mit einem Palkup Chigi mattgesetzt«, verkündete die aparte 40-jährige immer noch äußerlich gelassen, wenn auch diesmal mit leichtem Triumph in ihrer Stimme.
»Palkup Chigi? Mit dem Ellbogen?«, fragte Jules verdutzt nach. Er hatte seine Ehefrau noch nie über Taekwondo-Begriffe reden hören, geschweige denn sie anwenden sehen, »aber…?«
»Ich gehe seit fast einem Jahr regelmäßig ins Training«, gab sie endlich zu, ließ ihre Arbeit kurz ruhen und blickte ihren Ehemann schelmisch lächelnd an, »in ein Kampfsportzentrum in Lausanne.«
Jules Lederer schüttelte verblüfft seinen Kopf und schaute seine Lebenspartnerin immer noch irritiert an, verlangte ganz offensichtlich nach weiteren Erklärungen.
»Ich wollte dich irgendwann damit überraschen«, bot sie ihm einen Grund für ihre bisherige Geheimniskrämerei an, »leider hat mir nun die Anklage wegen Körperverletzung alles verdorben.«
»Und wer ist dein Trainer?«
»Mein Sahbum-Nim ist Song Dae-Sun. Er war Mitglied der Olympiamannschaft Südkoreas 1992 in Barcelona«, ihr Ehemann schien immer noch verwirrt, weshalb sie rasch anfügte, »weißt du, ich hatte einfach das Bedürfnis, mich sportlich etwas mehr zu fordern.«
»Und dann nimmst du Taekwondo-Unterricht? Statt Gymnastik oder Yoga?«
Sie nickte, diesmal ohne aufzublicken, und schnitt weiter das Gemüse klein.
»Und wie gut bist du?«
»Für den verdammten Rassisten hat’s auf jeden Fall locker gereicht.«
Jules las noch einmal das Schreiben des Gerichtshofs durch.
»Wirst du von Pierre verteidigt?«
»Oui, mais sûre mon chéri. Pierre und einer seiner Kollegen, der sich auf Körperverletzung spezialisiert hat.«
»Wie groß war denn der Kerl?«
»Eins-neunzig, schätze ich«, mutmaßte sie, »und bestimmt über hundert Kilogramm schwer.«
»Und du hast ihn tatsächlich K.O. geschlagen?«
Sie antwortete mit einem stummen Nicken.
»Wann wolltest du mir eigentlich davon erzählen?«
Die Stimme des Schweizers klang nicht länger verblüfft und schon gar nicht ärgerlich, sondern amüsiert und Alabima hob als Antwort nur kurz ihre Schultern, ließ sie wieder sinken.
»Ich dachte mir, der Kerl ziehe seine Anklage zurück, noch bevor es zum Prozess kommt. Ich hab ihm dafür zehntausend Franken angeboten. Leider lehnte er ab.«
»Und deine frühere Bewährungsstrafe?«
Die Äthiopierin hatte vor einigen Jahren versucht, ein experimentelles, nicht zugelassenes Medikament gegen Krebs in die Schweiz zu importieren, um den todkranken Jules damit behandeln zu lassen, war aber erwischt und zu einer bedingten Gefängnisstrafe verurteilt worden.
»Pierre meint, selbst bei einer Verurteilung wegen Körperverletzung wird der Richter sie kaum vollziehen lassen.«
»Kaum?«
»Kaum.«
»Wir könnten eigentlich mal gemeinsam trainieren?«, lockte Jules nun seine Ehefrau, war weiterhin gutgelaunt, wirkte richtiggehend aufgeräumt.
»Ohne mich«, quittierte Alabima jedoch umgehend seinen Wunsch, »mit dir lass ich mich vorerst noch nicht ein, mon petit chou.«
Die Lederers hatten viele gute, aber auch einige äußerst schlechte Tage in ihrer mittlerweile acht Jahre andauernden Beziehung erlebt. Denn die Aufträge von Jules hatten seine Familie einige Male in höchste Gefahr gebracht. Einmal sah sich Alabima sogar aus lauter Angst gezwungen, sich von Jules zu trennen. Sie reiste mit der noch nicht jährigen Alina zurück nach Äthiopien und lebte einige Wochen lang bei ihren Eltern in Addis Abeba. Doch die Eheleute fanden schließlich wieder zusammen, liebten einander immer noch, wussten und spürten ganz einfach, dass sie keinen besseren Lebenspartner für sich finden konnten, egal, wie oft ihre Beziehung durch Drohungen und Gewalttaten auch belastet wurde.
Alabima verzieh Jules sogar sein über einige Monate anhaltendes Fremdgehen in einem Sado-Maso-Club in Vevey, während er einsehen musste, dass auch die kurze Leidenschaft seiner Ehefrau zu einem Studenten in Lausanne unbedeutend für ihre Beziehung war. Zwar hatte sich der Schweizer beim Gedanken an die Untreue seiner Partnerin monatelang herumgequält, dachte selbstverständlich auch an Trennung oder gar Scheidung, auch an irgendeine Form von Revanche oder Rache. Doch dann war ihm endlich bewusst geworden, dass Alabimas Persönlichkeit perfekt mit seiner eigenen harmonierte und sie vervollständigte, was sie beide zu eigentlichen Seelenverwandten machte.
Jules war ganz Können und Wissen, maß weder dem Stolz noch der Ehre echte Bedeutung zu, besaß nach eigener Einschätzung auch nur wenig innere Würde, konnte durchaus fies oder gar niederträchtig handeln. Der Schweizer empfand sich selbst als eine Art von Nerd, allerdings als einen höchst gewaltbereiten. Seine Ehefrau hingegen besaß eine große, angeborene Würde und ihr Stolz war völlig natürlich, entsprach dem Wesen des äthiopischen Volkes der Oromo, das sich als einziges von ganz Afrika über all die Jahrhunderte hinweg nie einer fremden Macht beugen musste. Selbst der Versuch der Unterwerfung durch die europäischen Kolonialmächte England, Frankreich und Italien scheiterten am unbeugsamen Freiheitswillen der Oromo. Auch die Ehre der Familie ging Alabima über alles. Sie war unverzichtbarer Bestandteil eines erfüllten und glücklichen Lebens.
Die Stärke ihrer Partnerschaft beruhte auf der Verschiedenheit ihrer beiden Persönlichkeiten, deren Eigenschaften sich ideal ergänzten. Deshalb hatte ihre Lebensgemeinschaft bislang alle Tiefen, den Schmerz und das Leid überwinden können.
Jede gute Partnerschaft beruhte auf einer Gleichberechtigung. Diese erreichte man jedoch nur durch gegenseitige Wertschätzung. Waren sich die beiden Menschen in ihrem Wesen jedoch sehr ähnlich, standen sie in ständiger Konkurrenz zueinander. Aus einem Wettbewerb heraus ergab sich jedoch nie ein Gleichgewicht, kam es immer zu einem Sieger und einem Verlierer, was unweigerlich zu Spannungen in der Beziehung führte. So jedenfalls empfand Jules seit einiger Zeit, nachdem ihm diese Zusammenhänge richtig bewusstwurden. Computer-Dating-Plattformen mochten stets das Gleichartige und Verbindende zweier Menschen suchen. Doch der wahre Kitt in der Beziehung zweier Individuen bestand in den Unterschieden ihrer Persönlichkeit, handelte es sich um Liebe oder um Freundschaft. Gleichartige Vorlieben vermochten das Interesse am anderen zwar zu wecken und auch zwei Menschen kurzzeitig aneinanderbinden. Doch nur unterschiedliche, sich gleichzeitig ergänzende Wesenszüge führten zu langfristig stabilen und damit erfolgreichen Partnerschaften. Hatte man aber sein perfektes Gegenstück im Leben mit sehr viel Glück gefunden, so hielt man es selbst über turbulenteste Zeiten hinweg fest.
»Ich könnte bestimmt dafür sorgen, dass der Kerl seine Strafanzeige noch vor der Verhandlung zurückzieht«, bot der Schweizer seine Unterstützung an, ohne Näheres zu verraten. Aber Alabima wusste auch so, was Jules damit meinte.
»Lieber nicht. Denn ich habe in der Zwischenzeit erkennen müssen, dass uns die Staatsanwaltschaft überwachen lässt.«
»Immer noch?«
Der Schweizer schien weder überrascht, noch beunruhigt.
»Ja. Denn im Gegensatz zu dir wusste die Polizei von meinem Taekwondo-Training.«
Die Lederers waren den Behörden in der Vergangenheit schon mehr als einmal aufgefallen. Vor Jahresfrist sah sich Alabima sogar mit einer Anklage wegen Anstiftung zum Mord an ihrem früheren Liebhaber konfrontiert, saß mehrere Wochen in Untersuchungshaft, bis sich das Verfahren als Justizirrtum herausstellte. Deshalb wunderte sich Jules auch nicht über die weitergehende Beschattung durch den Staatsapparat, sondern nickte gleichgültig.
»Trotzdem könnte ein wenig Druck auf den Kerl nicht schaden?«
Alabima schüttelte nun jedoch sehr heftig und klar ablehnend den Kopf, blickte ihren Gatten zwingend an und sagte knapp, aber befehlend: »Nein, Jules!«
Er nickte zustimmend und gab nach. In einer knappen Viertelstunde musste er Alina von der Schule abholen, während Alabima das Mittagessen fertigkochen wollte. Es war ein fast normaler Dienstagvormittag bei den Lederers.
*
»Und wie wollt ihr mich bestrafen?«
Sheliza bin-Elik blickte ernst, aber auch auffordernd Henry Huxley und seine Lebenspartnerin Holly Peterson an. Die 15-jährige, syrische Alawitin hatte ihre Eltern verloren, floh vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat in die Türkei. Im Flüchtlingslager lernte sie den zwei Jahre älteren Sherif Nimraui kennen. Die beiden verliebten sich ineinander und Sheliza erwartete wenig später ein Kind. Doch der junge Vater verstieß die angehende Mutter, wollte von ihr und ihrem gemeinsamen Kind nichts wissen. Henry Huxley nahm die verzweifelte 15-jährige Waise mit nach London, betreute die werdende Mutter seitdem zusammen mit seiner Lebenspartnerin Holly Peterson. Die beiden Briten dachten sogar schon an Adoption.
Doch die gläubige Muslimin hatte sich sehr schwer getan im freiheitlichen und freizügigen Westen mit seiner allgegenwärtigen Sittenlosigkeit. Mit dem Fortschreiten ihrer Schwangerschaft fühlte sie sich immer unwohler, dachte auch oft an ihre Familienangehörigen, die womöglich doch noch irgendwo und irgendwie in Syrien überlebt hatten. Noch vor der Geburt ihrer Fadoua verließ Sheliza heimlich London, reiste mit Unterstützung eines salafistischen Imams zurück in ihr Heimatland, gab sich dort als Sunnitin aus, die zu ihrem kämpfenden Ehemann unterwegs war. Doch die Suche nach Überlebenden ihrer Familie blieb erfolglos und als ihr Schwindel schließlich aufflog, geriet sie in die Fänge der ISIS-Terroristen. Henry Huxley musste zusammen mit seinem guten Freund Jules Lederer viele Hebel in Bewegung setzen, um die junge Mutter und ihr Neugeborenes in Syrien aufzuspüren und heraus zu holen. Bei der Rettung von Mutter und Tochter erhielt der Brite eine Schussverletzung am Unterschenkel, zwar nicht wirklich schlimm und doch äußerst schmerzhaft und hinderlich. Darum humpelte der Brite derzeit noch mit Krücken oder zumindest einem Stock herum.
Erst am Tag zuvor waren Henry Huxley mit Sheliza bin-Elik und ihrer wenige Wochen alten Tochter Fadoua von Bagdad aus nach London zurückgekehrt, waren von Holly Peterson in Heathrow abgeholt worden. Die drei hatten bislang noch nicht über die vergangenen Monate gesprochen, über das heimliche Verschwinden der werdenden Mutter aus London, über den Vertrauensbruch von Sheliza gegenüber ihren Pflegeeltern, auch nicht über die großen Gefahren, denen sich der Teenager mit seiner Tochter ausgesetzt hatte und in die sich Henry Huxley und Jules Lederer begeben mussten, um die beiden aus dem Bürgerkriegsland zu retten. Nein, diese Aussprache fand noch nicht statt, weil Holly und Henry am Vortag darauf bestanden hatten, als erstes bei Harrods die Ausstattung für das Kinderzimmer von Fadoua auszusuchen und gleich in ihr Appartement liefern zu lassen und anschließend bei Harvey Nichols alles Notwendige an Wäsche und Kleidung für die Kleine zu besorgen. Der gestrige Nachmittag und der Abend waren darum mit Besorgungen und dem Einrichten des Zimmers ausgefüllt gewesen und Mutter und Tochter gingen wenig später todmüde zu Bett.
Doch an diesem frühen, nächsten Morgen war Sheliza bin-Elik in die Wohnküche des großen Appartements getreten und verlangte von ihren Pflegeeltern ein Urteil.
»Wie kommst du darauf, dass wir dich bestrafen wollen?«
Henry Huxley und Holly Peterson schienen nicht wirklich überrascht oder irritiert, hatten etwas Ähnliches erwartet. Trotzdem fragte Holly nach.
»Na, ich war sehr undankbar euch gegenüber, habe euch angelogen und mich heimlich aus dem Staub gemacht. Trotzdem suchtet ihr wochenlang nach mir. Henry und Jules mussten mich und Fadoua aus höchster Gefahr retten und Henry wurde dabei sogar verletzt. Nicht auszudenken, wenn ihm…«, sie stockte und sprach erst nach einer Weile weiter, »… ich mache mir riesige Vorwürfe.«
Henry und auch Holly lächelten der jungen Mutter aufmunternd zu.
»Das brauchst du nicht, Sheliza«, stellte der Brite entschieden klar, »es irrt der Mensch, solang er strebt«, zitierte er einen von ihm hoch geschätzten Deutschen Dichter, den er auch der jungen Muslimin schon ans Herz gelegt hatte, »du bist noch so jung und darum für dein Ungestüm nicht vollends verantwortlich.«
»Ich fühle mich aber schuldig. Und ich erwarte eure Bestrafung.«
Die beiden Engländer konnten in das Herz der Syrierin blicken, erkannten die muslimische Erziehung, wonach Vater und Mutter unter allen Umständen geehrt werden mussten. Und Henry und Holly waren in den vergangenen Monaten irgendwie zu ihren Ersatzeltern geworden. Darum nickten die beiden Briten nun, was aber nicht nach Einverständnis aussah. »Wir sind wirklich der Auffassung«, begann Holly, »dass eine Bestrafung falsch wäre. Denn du, Sheliza, warst noch ein unbedarftes Mädchen, als du uns wegliefst. Zurückgekehrt bist du jedoch als Frau und Mutter, die in Zukunft Verantwortung tragen wird, für sich selbst, aber auch für ihr Kind. Die frühere Sheliza hätten wir bestrafen können und auch bestrafen müssen. Doch dich? Eine junge Erwachsene? Nein, dich zu bestrafen wäre falsch und unnütz.«
Sheliza blickte die immer noch so schöne, fünfundvierzig Jahre alte Britin offen, aber auch nachdenklich an, begann dann zu nicken.
»Ich verstehe euch zwar, denn auch ich fühle, wie sehr ich mich in den letzten drei Monaten verändert habe, wie ich heute ganz anders denke als noch vor einem halben Jahr. Doch ich schäme mich so sehr, euer Vertrauen missbraucht zu haben…?«
Ihre Stimme versagte ihr und sie senkte ihr Gesicht vor Scham, blickte hinunter auf ihre Tochter Fadoua, die sie sogleich anstrahlte und unvermittelt versuchte, mit der winzigen Hand die Nase ihrer Mutter zu erwischen. Doch die Kleine verschätzte sich gehörig in der Entfernung, wischte nur durch die Luft und schaute deshalb verwundert auf ihre immer noch leere Hand.
»Das ist ein Teil des Erwachsenwerdens«, begann Henry und als Sheliza aufblickte, fügte er sanft hinzu, »ich meine, Fehler zu begehen. Wir alle lernen aus ihnen und das sollte auch dir genügen.«
In der Wohnung stützte sich Henry nur auf einen Laufstock, wollte den durchschossenen Unterschenkel nicht länger mit Hilfe zweier Krücken schonen, glaubte mit Bewegung und Belastung eine raschere Heilung zu bewirken.
»Aber irgendeine Strafe müsst ihr mir auferlegen«, verlangte die junge Syrierin.
Wiederum sahen sich die beiden Briten einverständlich an, so als hätten sie die Forderung von Sheliza in dieser Art erwartet und alles Weitere längst miteinander besprochen und festgelegt.
»Na gut«, entschied Holly, »zur Strafe wirst du den Antrag fürs Gericht unterzeichnen, mit dem du deine Eltern und Geschwister für tot erklärst. Anschließend lässt du dich von uns beiden adoptieren.«
Sheliza bin-Elik war zwar noch sehr jung und wirkte öfters naiv wie ein Kind, schien diesmal jedoch hinter der Forderung der Britin sogleich auch die List zu erkennen.
»Ihr wollt doch bloß, dass Fadoua und ich finanziell abgesichert sind. Ist es nicht so?«
Sie sah Henry und Holly triumphierend an. Doch die beiden Briten zeigten nicht das von der Muslimin erwartete Lächeln, sondern blickten ihre Pflegetochter ernst und sogar voller Teilnahme an.
»Das ist auch gar keine Strafe«, meinte die 15-jährige entschieden und auch ein wenig bekümmert, »denn in Al-Sukhna haben mir unsere früheren Nachbarn glaubhaft versichert, dass alle meine Angehörigen durch die Dschihadisten umgebracht wurden.«
Henry schüttelte trotzdem langsam und verneinend den Kopf.
»Du irrst dich, Sheliza. Es ist ein sehr großes Opfer, das wir von dir erwarten. Wenn du beim Notar vor dem Schriftstück sitzt und es dir noch einmal in Ruhe durchliest, wird dir die Konsequenz deiner Unterschrift bewusstwerden, nämlich dass du mit deinem Namen den Tod deiner Eltern und deiner Geschwister bezeugst. Spätestens dort wirst du spüren, wie hoch die Strafe ist, die wir dir heute auferlegen.«
Die Syrierin blickte den Briten erst erstaunt und dann nachdenklich geworden an. Und sie forschte in sich nach der Antwort auf seine Behauptung. Plötzlich begann ihre Unterlippe zu zittern. Sie nahm sie zwischen ihre Schneidezähne, klemmte sie fest und schluckte dann trocken, nickte langsam und verstehend, während Holly und Henry mit ansehen mussten, wie die 15-jährige mit den Tränen kämpfte.
*
Die Strafanzeige gegen Alabima wurde bis zur Verhandlung nicht zurückgezogen. Auch auf den Vorschlag der Staatsanwaltschaft, ein abgekürztes Verfahren durchzuführen mit bedingter Busse und einer finanziellen Genugtuung für das Opfer, willigte der Kläger mit seinem Anwalt nicht ein. So fand sich Alabima Lederer als Angeklagte vor dem Einzelrichter wieder. Der nahm die Anträge der Staatsanwaltschaft, der Verteidigung und des Anwalts des Privatklägers entgegen und verurteilte die Äthiopierin nach kurzer Befragung zum Hergang und den exakten Verletzungen des Opfers zu einer Busse über fünfzigtausend Schweizer Franken auf zwei Jahre bedingt. Zudem verlangte er eine Therapie der Angeklagten zur Verminderung ihrer Gewaltbereitschaft durch einen vom Gericht anerkannten Psychologen. Und er sprach dem Opfer ein Schmerzensgeld über fünftausend Franken zu. Alabima sollte neben den Gerichtskosten von dreizehntausend Franken auch noch das Anwaltshonorar des Privatklägers über sechstausend übernehmen.
So geheuer schien dem Richter die Anklage gegen die Äthiopierin allerdings nicht zu sein. Denn wie sollte diese mittelgroße, schlanke, kaum sechzig Kilogramm leichte Frau einen Brocken von über hundert Kilogramm K.O. schlagen können? Aber die diversen schriftlich vorliegenden Aussagen von Augenzeugen ließen kaum Zweifel am Tathergang zu. Selbst die Verteidigung widersprach nicht und führte noch nicht einmal Gründe für eine Strafminderung an. Auch sprach die Angeklagte bloß von einer stark empfundenen Provokation durch den Mann, die bei ihr einen bedauernswerten Kurzschluss ausgelöst hatte, den sie heute sehr bedauerte.
Der rassistische Vater war mit der Höhe des Schmerzensgelds bestimmt nicht einverstanden, sah immer wieder begehrlich zur aparten, dunkelhäutigen Frau und ihrem wohlhabenden Ehemann hinüber, die ihn jedoch beide nicht beachteten. Er würde das Urteil mit seinem Anwalt besprechen müssen, ob vielleicht vor der nächsthöheren Gerichtsinstanz ein paar Scheine mehr als Schmerzensgeld für ihn drin lagen.
Auf dem kurzen Heimweg nach La Tour-de-Peilz sprachen die beiden Eheleute kein Wort miteinander. Doch als sie die Haustüre hinter sich geschlossen hatten, umarmten sie einander und küssten sich stürmisch. Jules nahm Alabima auf seine Arme und trug sie hinauf ins Obergeschoss und direkt in ihr Schlafzimmer, ließ sie fröhlich ausgelassen und mit viel Schwung aufs Bett plumpsen und legte sich neben sie. Sie küssten und streichelten einander, fühlten rasch die beginnende Erregung.
»Meine Schwerverbrecherin«, lockte der Schweizer und strahlte über sein ganzes Gesicht, »was stell ich bloß mit einem solch bösen Mädchen an?«
*
Shamee Ling war monatelang verschwunden. Zuerst vermuteten ihre Angehörigen eine Entführung der 17-jährigen, wie sie in Rio de Janeiro bei wohlhabenden Familien immer wieder vorkamen. Doch Lösegeldforderungen blieben aus und alle Suche nach dem Verbleib der jungen Frau verlief im Sand. Doch dann war sie von heute auf morgen erneut aufgetaucht und in die elterliche Villa zurückgekehrt, hatte keinerlei Erklärung über ihren Aufenthaltsort und den Grund ihrer Abwesenheit abgegeben, sich weder ihren Eltern noch ihren Geschwistern anvertraut. Wenige Tage später jedoch stritt sich Shamee heftig mit ihrer Mutter Sihena und verließ daraufhin erzürnt das Elternhaus, tauchte erneut ab. Wohin sie diesmal ging, auch das wusste niemand, auch nicht ihre ältere Schwester Mei Ling, deren Freund und Lebenspartner Chufu Lederer war, der philippinische Adoptivsohn von Jules und Alabima.
Die Aufregung in der Familie Ling hielt sich beim zweiten Verschwinden der jüngsten Tochter verständlicherweise in Grenzen. Shamee war schon immer ein eigenwilliges und schwieriges Kind gewesen. Als Teenager kam ein unheilvoller Stolz hinzu, der die junge Frau unnahbar und überheblich gegenüber fast allen Menschen machte. Schon mit vierzehn ließ sie sich von niemandem mehr etwas sagen und mit siebzehn bestimmte sie weitgehend selbst über ihr Leben, das aus etwas Schule und viel Müßiggang bestand. Ihre chinesisch-stämmigen Eltern hatten zwar versucht, alle ihre Kinder traditionell und innerhalb all der Zwänge und Regeln einer asiatischen Familie zu erziehen. Doch was bei den älteren Geschwistern von Shamee durchaus gefruchtet hatte, blieb bei der jüngsten ohne Erfolg. Das Nesthäkchen der Familie war wohl zu lange von allen vergöttert und verwöhnt worden.
Großvater Ling war vor einigen Jahrzehnten als junger Mann nach Brasilien ausgewandert, hatte nach harten Arbeitsjahren einen Imbiss eröffnet und ihn zu einem bescheidenen Speiselokal ausgebaut. Sein Sohn Zenweih, der Vater von Shamee und Mei, hatte aus diesen Anfängen gemeinsam mit seiner Ehefrau Sihena eine Kette mit über zwanzig gut gehenden China-Restaurants aufgebaut. Die Lings galten in Rio de Janeiro als reich und waren tatsächlich sehr wohlhabend geworden. Und selbst wenn sich Zenweih und Sihena über all die Jahre hinweg als Ehepaar auseinandergelebt hatten, so funktionierte ihr gemeinsam geführtes Unternehmen weiterhin ausgezeichnet.
Chufu Lederer studierte zusammen mit Mei Ling im dritten Jahr an der Universidade Federal do Rio de Janeiro Psychologie. Seit gut zwei Jahren lebten die beiden in einem gemeinsamen Apartment nahe der Universität und bereiteten sich derzeit auf den Abschluss ihres Studiums vor. Pläne für die Zeit danach hatten die zwei allerdings noch keine gefasst. Eine akademische Laufbahn an der Universität als Doktoranden erschien ihnen alles andere als prickelnd. Für eine eigene Praxis waren sie jedoch eindeutig zu jung und zu unerfahren. Und vor einem Leben als Angestellte einer größeren Nervenklinik grauste es beiden.
Nach dem ersten Verschwinden von Shamee vor gut einem halben Jahr hatten Chufu und Mei alles unternommen, um die jüngste Ling Tochter aufzuspüren, ließen sogar die anderen Familienmitglieder und deren Hausangestellten von Privatdetektiven über viele Wochen hinweg überwachen, um mögliche Verstrickungen zum organisierten Verbrechen in Brasilien aufzudecken. So fanden sie unter anderem eine Verbindung der Ling Eltern zu einem Menschenhändlerring heraus, aber auch, wie schlecht es mittlerweile um die Ehe von Zenweih und Sihena stand. Alle Nachforschungen bezüglich Shamee brachten jedoch nichts ein und sie rechneten bis zum überraschenden Auftauchen der jüngeren Schwester von Mei mit dem Schlimmsten. Als Shamee dann unversehrt zurückkehrte, keine Fragen beantwortete und Eltern wie Geschwister ohne jede Erklärung zu ihrem Verschwinden und dem Ort ihres Aufenthalts ließ, da spürte die ältere Mei trotzdem, dass der jüngeren Schwester etwas äußerst Bewegendes oder gar Schreckliches zugestoßen sein musste. Denn Shamee zog sich vor ihnen allen zurück, wirkte noch abweisender als früher, oft sogar geistig abwesend, auch sehr verunsichert und irgendwie seelisch verletzt. Zuerst vermuteten Chufu und Mei eine Drogensucht. Doch bevor sie weitere Nachforschungen in diese Richtung hatten anstellen können, war Shamee nach dem Streit mit ihrer Mutter erneut abgetaucht. Den Grund für die heftige Auseinandersetzung hatte ihnen Sihena allerdings nicht verraten, weigerte sich darüber zu sprechen. Und so lagen erneut bloß Vermutungen zu den Hintergründen vor, ließen eine höchst unruhige und schlechte Stimmung zwischen der Mutter auf der einen Seite und dem Vater mit den anderen Kindern auf der anderen zurück.
Einzug
Alabima und Alina waren an diesem Sonntagmorgen nach Lausanne gefahren, wollten der katholischen Messe in der L’église Notre-Dame du Valentin beiwohnen. Jules begleitete die beiden, wenn auch ohne jede Begeisterung und aus reinem Pflichtgefühl heraus. Alabima war zwar äthiopisch-orthodoxe Christin. Sie erzog Alina jedoch katholisch, obwohl die Afrikanerin die strickte Ausrichtung der Papsttreuen auf die Erbsünde ablehnte. Doch dafür mochte sie umso mehr deren starke Gewichtung der Bergpredigt von Jesus Christus als die grundsätzliche Auslegung der gesamten Bibel, also auch des Alten Testaments.
Die Kirche Notre-Dame du Valentin war erst 1832 erbaut worden und durfte viele Jahrzehnte lang keine Glocken in ihrem Turm läuten lassen. Denn nach der Eroberung der Waadt durch die reformierten Berner im Jahre 1536 wurde der katholische Glaube über Jahrhunderte hinweg zuerst verboten und später diskriminiert. So waren den Katholiken lange Zeit Gotteshäuser gänzlich verboten und die stolze Kathedrale, fertig gestellt und geweiht 1275 in Anwesenheit von Papst Gregor X. und König Rudolf von Habsburg, hatte man den Katholiken damals weggenommen und den Protestanten übergeben. Selbst heute noch sorgte der Staat für den teuren Unterhalt des konfiszierten Gotteshauses. In ihm fand auch weiterhin nur eine einzige katholische Messe im Jahr statt.
Im September 2013 machte die Kathedrale schweizweit Schlagzeilen, weil einer Gruppe ehemaliger Papstgardisten der Zugang zur Kirche verweigert wurde, obwohl doch in der Waadt mittlerweile wieder weit mehr Katholiken als Protestanten lebten. Der Glaube konnte Berge versetzen. So jedenfalls interpretierte man in der Bibel Hiob 9,5 und Matthäus 17,20. Doch bestimmt passierten derlei Dinge nicht in Lausanne, wo sich die 27% Protestanten in der Bevölkerung weiterhin nicht um die Befindlichkeiten der 38% Katholiken scherten.
Jules kannte alle diese Geschichten, mochte als nicht-gläubiger und nicht-praktizierender Protestant generell keine Gotteshäuser. Ganz besonders verabscheute er jedoch diese katholische Notre-Dame du Valentin, in der er an diesem Sonntagmorgen zusammen mit Alabima und Alina saß. Denn mit ihrer völlig überdimensionierten Zugangstreppe und dem übermächtigen Eingangsportal quetschte sie sich brutal zwischen die Häuser des Quartiers, ähnlich einem Walrossbullen, der sich rücksichtslos zwischen seine Weibchen drängte. Hinzu kam der achtunddreißig Meter hohe Glockenturm, der die gesamte Umgebung dominieren wollte. Papst Johannes Paul II. verlieh der Notre-Dame du Valentin 1992 gar den Rang einer Basilica minor. Der Ehrentitel drückte die starke Verbindung dieses Gotteshauses zum Vatikan aus und sollte gleichzeitig ihre alles überragende Stellung in der Romandie zementieren.
Und nun saß also Jules mit seinen Lieben und vielen Gläubigen an diesem Sonntagmorgen in dieser ungeliebten Kirche und harrte der kommenden, von ihm so verabscheuten Dinge.
Die Orgel setzte plötzlich ein, vehement, zwingend, den gesamten Raum dröhnend füllend und alle bislang noch vorhandenen guten Gefühle vertreibend. Ein Rudel Ministranten drängte sich aus einer Seitenpforte, wurde von drei Priestern verfolgt. Die blickten mit harten Augen auf ihre vorangehenden, jungen Helfer, zeigten offenen Missmut oder gar Anzeichen von Zorn. Hatte es kurz zuvor in der Sakristei etwa Zwist oder gar heftigen Streit gegeben? Waren die sechs jungen Burschen etwa beim verbotenen Naschen des köstlichen Messweins erwischt worden? Oder hatten sie schlimme Zoten gerissen, während sie sich in ihre gelb-stichigen Gewänder hüllten, um sich so in gläubige Lämmer Gottes zu verwandeln?
Alle Kirchenbesucher hatten sich von den Stühlen erhoben, selbst Jules mit seiner Skepsis, und schauten dem Einzug der heute stattfindenden Konzelebration zu, der Liturgie mit mehreren Priestern und mit dem entsprechenden Pomp. Die Geistlichen verzichteten allerdings auf den qualmenden Weihrauch, wie Jules erleichtert feststellte. Dieser alles verpestende Kübel hatte seit der Einführung von Deodorants den Nutzen zur Gänze verloren, zauberte heutzutage höchstens noch Ekel in die Gesichter der Kirchenbesucher. Wenigstens der Kelch ging an diesem Sonntagmorgen an ihm und allen anderen vorüber.
Jules blickte kurz zu Alina hinüber, die regungslos dastand und dem Einzug von Ministranten und Priestern mit großen Augen folgte, fasziniert vom Prunk der Gewänder, dem feierlichen Schreiten und der damit ausgestrahlten Würde, wohl ebenso gefangen vom Dröhnen der Orgel und den ernsten Gesichtern der meisten anderen Kirchenbesucher.
Wo war bloß Gott, wenn man ihn mal brauchte?, dachte sich Jules und sah das Bild eines zornigen Zeus vor sich, wie er seine Blitze zur Erde schleuderte, mitten hinein in diese verlogene Rotte, die sich Christen nannte und Demut heuchelte, gleichzeitig aber Flüchtlinge herzlos abwies. Er musste über seinen Gedanken einer Gottesstrafe unwillkürlich schmunzeln und erhielt prompt einen recht derben Ellbogenstoß von Alabima in die Seite. Hatte sie etwa auf seinem Gesicht mitgelesen?
Der Einzug umrundete vollständig das Geviert der Besucher und schritt danach vor den Altar, begrüßte auch diesen. Dem Kreuzzeichen des ersten Priesters folgten alle Anwesenden mit Ausnahme von Jules, der sich in diesem Moment an das Lied Habemus Papam von Konstantin Wecker erinnerte, in dem der bayrische Liedermacher den Prunk und die Verlogenheit des Vatikans anprangerte und gegen Ende sang: »... und strahlend betreten am nächsten Morgen die Ehrwürdens die Bühne, behängt und beringt und geschmückt wie die Christbäume, und sprechen das Agnus Dei. Und wenn sie ihre Hände zum Segen erheben, mach ich mich ganz klein, um auch ja nichts abzukriegen davon.«
Jules hatte seine Schultern hochgezogen, so als ginge er in Deckung.
*
Womit Henry Huxley früher sein Geld verdient hatte, war nur ihm bekannt. Denn nicht einmal sein langjähriger Freund Jules Lederer wusste viel über die Vergangenheit des Briten. Der 62-jährige wirkte auf einen Betrachter wie der kühne Major einer Spezialeinheit, der es gewohnt war, mit seinen Männern hinter feindlichen Linien gefahrvolle Aufträge zu erledigen. Hoch aufgeschossen, ausgesprochen schlank, beinahe hager, wirkte er trotz seines Alters immer noch drahtig und durchaus fit und leistungsfähig. Seine Lebenspartnerin Holly Peterson lernte er erst vor knapp zwei Jahren kennen. Die Mitte-Vierzigerin hatte bis dahin als selbstständiges Escort-Girl gearbeitet, sah immer noch blendend aus und wäre wohl von den meisten Männern auf höchstens fünfunddreißig geschätzt worden. Auch sie hatte in ihrem Beruf sehr erfolgreich agiert und war zudem umsichtig mit dem verdienten Geld umgegangen. So war sie heute finanziell ebenso unabhängig wie Henry Huxley. Die Engländerin und der Engländer lebten allerdings nicht in Saus und Braus, hätten ihr gemeinsames Leben eher als bescheidenen Wohlstand beschrieben. Denn Understatement war für die beiden Briten eine Selbstverständlichkeit.
Henry kannte das Vorleben von Holly, hatte sich keinen Moment daran gestört. Ihre frühere Tätigkeit als Tages-, Freizeit- und Ferienbegleitung, Sex inklusive, hatte sie für ihren Henry selbstverständlich aufgegeben. Im Gegenzug fühlte sie sich als Hausfrau jedoch zu wenig ausgelastet, auch wenn sie in den ersten Wochen und Monaten die Ruhe und Beständigkeit ihres neuen Zusammenlebens durchaus genossen hatte. Irgendwann jedoch kam der Punkt, an dem es sie wieder nach mehr Aufregung im Leben verlangte. Doch der Brite mochte seine neue Lebenspartnerin unter keinen Umständen in seine weiterhin laufenden Geschäfte einbeziehen, wollte sie aus jeder Gefahr heraushalten. Denn Henry Huxley liebte immer noch das Nachspüren und Auflösen von Geheimnissen, besaß in London und Umgebung ein riesiges Beziehungsnetz, kannte in der Hauptstadt Gott und die Welt und hielt ständige seine Fühler ausgestreckt, zur Unterwelt der acht Millionen Einwohner zählenden Stadt ebenso, wie zu deren Oberschicht.
»Viel zu gefährlich«, lautete sein wichtigstes Argument gegenüber den Forderungen von Holly nach mehr Einbezug in seine Tätigkeiten, »aber meistens auch sterbenslangweilig«, gestand er ihr oft, wenn er spät abends von seinen meist ergebnislosen Treffen zurückkehrte, mit denen er seine Kontakte aufrecht hielt.
Gemeinsam mit Jules Lederer erlebte Henry Huxley in den vergangenen Jahren einige aufregende, aber auch aufreibende Abenteuer. In seiner Stadt London allerdings und ganz allein auf sich gestellt, ging der Brite eher wenig Risiko ein, spürte lieber irgendwelchen Gerüchten nach, die sich manchmal dank seinem Netzwerk in Informationen und später in Beweise verwandelten, die er verkaufen konnte oder noch öfters verschenkte, um neue und in Zukunft nützliche Bekanntschaften zu knüpfen. Denn das war das Angenehme an seiner finanziellen Unabhängigkeit. Er konnte sich auch in dieser Hinsicht großzügig zeigen.
Für Holly Peterson war das syrische Flüchtlings-Mädchen Sheliza bin-Elik eine willkommene Ergänzung in ihrem Leben gewesen. Eigene Kinder besaß Holly genauso wenig wie Henry. Und so hatte die 45-jährige noch so gerne die Rolle einer älteren Freundin für die damals 14-jährige, angehende Mutter übernommen und nur sehr selten den strengen Pflegeelternteil heraushängen lassen. Mit der kleinen Fadoua aber schien sich für die Engländerin ein weiteres, aufregendes und hoffentlich auch glückliches Kapitel geöffnet zu haben.
Sheliza bin-Elik hatte erst nach der Geburt ihrer Tochter erkannte, wie sinnlos ein Leben in Syrien war. Der damals 14-jährigen wurde angesichts des Bürgerkriegs und all der Not der Menschen bewusst, dass sie ihre Fadoua unmöglich in einem Land großziehen durfte, indem andauernde Unterdrückung und hässlichste Brutalität herrschten. Als sie und ihre Tochter von Henry Huxley und Jules Lederer aus den Fängen der ISIS gerettet wurden, hatte die junge Frau innerlich bereits den Entschluss gefasst, ihre Tochter nicht nur in den Westen und damit in Sicherheit vor Willkür und Tod zu bringen, sondern auch den christlichen Glauben anzunehmen und Fadoua gewissenhaft darin zu erziehen. Denn ihre Tochter sollte aus all den Zwängen des Islams befreit aufwachsen dürfen und unter ihresgleichen in London unbeschwert und von allen Menschen akzeptiert leben können.
Die heute 15-jährige stürzte sich nach ihrer Rückkehr mit viel Elan in die selbst gestellte Aufgabe, durchforstete das Internet nach passenden Angeboten und entschloss sich nach reiflicher Überlegung für die römisch-katholische Kirche St Mary of the Angels in Bayswater als Ort ihrer Konvertierung zum Christentum. Holly und Henry waren mit ihrem Vorhaben zwar grundsätzlich einverstanden gewesen, hatten die junge Syrierin trotzdem gefragt, warum sie denn ausgerechnet zur römisch-katholischen Glaubensrichtung und nicht etwa zu ihrer eignen, der anglikanischen, konvertieren wollte.
»Ich weiß nicht«, begann die 15-jährige und schien einen Moment lang verunsichert, »ihr habt zwar den Erzbischof von Canterbury als höchste geistliche Instanz. Doch ich denke, der Papst in Rom hat weit mehr Gewicht in der Welt, ist er doch das Oberhaupt von mehr als einer Milliarde Gläubigen, während die Anglikaner bloß achtzig Millionen zählen.«
»Ich sehe, du denkst recht praktisch«, meinte Holly etwas anzüglich und neckend, » ob aber die schiere Menge in Glaubensfragen wirklich alles ist, was zählt?«
»Ich will ganz einfach sicher gehen, dass Fadoua nicht nur innerhalb einer möglichst großen Glaubensgemeinschaft aufwächst, sondern diese Kirche auch von einer obersten Instanz geleitet wird. Denn ich denke, das ist das wahre Problem des Islams. Bei ihm gibt es keine Instanz, die Terroristen und Dschihadisten aus der muslimischen Kirche werfen könnte, egal, welch schreckliche Verbrechen diese Ungeheuer auch begehen und wie viele Menschen sie umbringen oder versklaven. Dieser oberste, religiöse Führer fehlt uns ganz einfach. Alle Muslime dürfen sich gleichermaßen auf Allah und Mohammed berufen und niemand kann sie in ihrem Irrglauben stoppen, weil niemand das dafür notwendige, übergeordnete Recht besitzt. Doch bei den Katholiken ist das ganz anders. Hat der neue Papst nicht erst vor kurzer Zeit alle Mitglieder der italienischen Mafia ex-kommuniziert und seine Priester angewiesen, diese Leute in Zukunft nicht mehr als gläubige Christen zu betrachten? Ihnen die heiligen Sakramente vorzuenthalten? Das ist doch ein überaus starkes Signal gegen das Unrecht?«
Henry, Holly und Sheliza wandten sich also an die Kirche St Mary of the Angels und wurden an Monsignore Keith Barltrop verwiesen, einen Mann von wohl Mitte fünfzig, der sehr ruhig und abgeklärt auf sie wirkte und gleichzeitig einen gewissen Schalk in seinen Augen zeigte und diesen keineswegs vor ihnen zu verbergen suchte. Er versprach, die junge Muslimin in den nächsten Monaten persönlich in die römisch-katholische Lehre einzuführen und sie bis zu ihrer Taufe anzuleiten und zu begleiten. Irgendwie schien der Geistliche begeistert von der Vorstellung, eine syrische Muslimin mit ihrer Tochter zusammen in den Schoss seiner Kirche zu führen. Allerdings verschwieg die 15-jährige dem Monsignore gegenüber ihr Kalkül bezüglich der Größe der katholischen Kirche mit ihrem Papst an der Spitze, also die eigentlichen Gründe für ihren Religionswechsel. Sie gab sich ihm gegenüber als aufgeschlossen und äußerst wissbegierig aus, sparte auch nicht mit Komplimenten zu verschiedenen Aussagen in der Bibel, die sie sich im Vorfeld herausgesucht hatte. Allerdings empfand sie viele der Passagen der Heiligen Schrift als eher naiv oder zumindest weltfremd, andere als viel zu lasch. Ständig wurde an das Gute im Menschen appelliert, während im Islam doch weit klarere Forderungen und harte Bedingungen gestellt wurden, die ein schwacher Erdenbürger zu erfüllen hatte, um Ewiges Leben erlangen zu können.
Ihre Scheinheiligkeit gegenüber dem Monsignore erschien der jungen Alawitin als eine geringe Verfehlung, gemessen an all den Demütigungen, die sie immer noch täglich als Muslimin empfand, wenn sie mit Fadoua im Kinderwagen der nahen Oxford Street entlang spazierte oder durch Covent Garden schlenderte. Sex, Sex, Sex, schrie es von überall her auf sie ein, zeigte sich sogar in den Gesichtern der Passanten. Es schien nichts Wichtigeres im heutigen London zu geben, nichts Anderes zu gelten. Aus den Schaufenstern und von den Plakatwänden herunter lächelten leicht bekleidete Models, so als bestünde das Leben nur aus lauter Spaß und sexuellen Ausschweifungen. Junge Frauen zogen sich wie Huren an, boten sich den Blicken der Männer wie eine käufliche Ware an, staksten auf hochhackigen Schuhen, Miniröcken und knappen Blusen oder Shirts über die Gehsteige, freuten sich sogar über die lästerlichen Pfiffe oder zotigen Sprüche der männlichen Fleischbeschauer.
An einem Freitagabend ging Holly Peterson mit der jungen, muslimischen Mutter aus, wollte mit ihr eine der angesagten Diskotheken der Stadt besuchen. Zuvor hatte sich die Syrierin in einer Boutique mit dem entsprechenden Outfit ausstatten lassen müssen, mit engen, weißen Jeans und einer Bluse mit Ausschnitt, dazu passenden Sandalen, die ihren schlanken Fuß so wunderbar betonten, wie die Boutique-Betreiberin ihr weismachen wollte, während sich die junge Alawitin vor dem Spiegel stehend innerlich für ihr durchaus hübsches Aussehen vor Allah schämte.
Bevor die beiden jedoch am späteren Abend das Appartement verließen, musste sich Sheliza von Holly erst noch stark schminken lassen.
»Du musst wie achtzehn oder älter aussehen, sonst lassen sie uns gar nicht erst rein«, hatte die aparte Britin lächelnd gemeint und das Gesicht der jungen Muslimin anschließend um Jahre altern lassen. Als Henry Huxley die beiden wenig später verabschiedete, hatte der Engländer ein besonderes Funkeln in den Augen, aber nicht etwa ein amüsiertes, sondern eher ein angespanntes. Und er hatte Sheliza auffordernd und wohlwollend zugenickt. Denn der feinfühlige Brite wusste wohl nur zu gut, welch heftigen Kulturschock die 15-jährige Muslimin in dieser Nacht erleben würde.
Sie hatten sich noch gar nicht in die lange Schlange vor dem Tanzlokal eingereiht, als sie bereits die ersten Sprüche über sich ergehen lassen mussten, von wegen Dreier-mit-Mutter-und-Tochter und ähnlichen obszönen Einladungen, ausgesprochen von schmierigen, angetrunkenen Typen in knappen T-Shirts und hängenden Jeanshosen, oft Maurerdekolleté zeigend, wie Holly Peterson schmunzelnd Sheliza erklärte. Zum Glück wurden sie wenig später vom Türsteher entdeckt und zu sich nach vorne gewunken und auch gleich eingelassen. Holly sah aber auch entzückend aus, wie Sheliza selbst fand, trug eine enge, dunkelblaue Jeans, die ihre langen, schlanken Beine mit den schmalen Knöcheln hervorragend betonte, einen recht weiten, rosafarbenen Pullover, der mehr von ihren üppigen Brüsten erahnen als klar erkennen ließ. Die Engländerin trug nur mittelhohe Sandalen an ihren Füssen, weil sie nicht größer als die meisten der möglichen Tanzpartner sein wollte, wie sie der Muslimin erklärt hatte.
Als die Türe zum Kellerlokal aufschwang, wummerten Basstöne und schrillte Gitarrengeplärr wie ein Schwall hoch zu ihnen. Sheliza blieb unwillkürlich stehen, als wäre sie gegen eine Wand geprallt, musste von Holly mit sanftem Druck die schmutzige Betontreppe hinuntergeführt werden. Der Lärm schwoll weiter an, je tiefer sie gelangten, und Sheliza hielt sich längst ihre Ohren zu, worauf Holly in ihrer winzigen Umhängetasche kramte und zwei Pfropfen herauszog, ihrer Pflegetochter irgendetwas zuschrie und danach die gummiartigen Stöpsel in deren Gehörgänge stopfte. Dankbar nickte Sheliza der Britin zu, denn der Lärm in ihrem Kopf war endlich auf Zimmerlautstärke verringert.
Unten mussten sie an einem winzigen, aus ein paar Brettern gezimmerten Tickethäuschen zwei Eintritte lösen, bekamen einen Stempel auf ihren linken Handrücken gedrückt und einen Getränkegutschein ausgehändigt, stürzten sich daraufhin in das Getümmel des erstaunlich großen Kellergewölbes, das mit seinen Nebenräumen bestimmt mehreren hundert Besuchern Platz bot und auf dessen Bühne drei Musiker ihre Instrumente malträtierten und in Mikrophone kreischten. Holly schrie Sheliza irgendetwas zu und deutete mit dem Zeigefinger in Richtung der langen Bar. Gemeinsam kämpften sie sich durch die Masse an Menschen. Die allermeisten Besucher waren Männer, nur ein Viertel von ihnen Frauen. Dementsprechend oft wurde Sheliza von Händen und Armen und Beinen gestreift, meistens absichtlich, nur manchmal versehentlich. Strahlende Gesichter schwangen sich vor ihre Augen, grinsten und lachten, versprühten ihren Scharm und den Willen zum Sex. Abstoßend, widerlich, geradezu unmenschlich. Beinahe sehnte sich die 15-jährige in diesem Moment zurück in den Bürgerkrieg nach Syrien und in eines der Gefängnisse der ISIS, wo man sie zumindest in Ruhe gelassen hatte, sie nicht berührte, sich ihr nicht aufdrängte, sie keinen Moment lang als Sexobjekt entwürdigte, sie nur mit dem Tode bedroht hatte.
Die junge Mutter riss sich jedoch zusammen, lächelte zurück, stieß den einen oder anderen mit der flachen Hand sanft aus dem Weg, zwängte sich zwischen anderen hindurch, gelangte endlich zur Bar und stellte sich neben Holly an die Theke. Die Britin bestellte für sie beide und wenig später wurden zwei große Kelchgläser vor sie hingestellt, gefüllt mit irgendwelchen farbenfrohen Flüssigkeiten, garniert mit einem Spieß, an dem ein paar Fetzen Früchte recht dekorativ hingen.
»Alkoholfrei«, glaubte Sheliza durch die Ohrpfropfen zu vernehmen und nickte dankbar, hob ihr Glas und prostete Holly zu, die ihrerseits mit einem strahlenden Lächeln und ein paar freundlichen Handbewegungen etwas mehr Platz für sie beide an der Bar schaffte. Zwei junge Männer in schwarzen Lederjacken erhoben sich wenig später von ihren Hockern und boten sie ihnen mit den Händen fuchtelnd an. Holly nickte dankbar und führte Sheliza hinüber und sie setzten sich. Die beiden Kerle bauten sich sogleich links und rechts von ihnen auf, als wären sie nun ihre persönliche Beute, begannen schreiend mit ihnen zu quatschen. Sheliza verstand kaum ein Wort, spürte nur den Atem des einen unangenehm auf ihrem Hals und auf der Wange, roch die säuerliche Bierfahne, konnte kaum von den gelben Zähnen wegsehen, bog sich immer weiter vom ständig Nachdrängenden weg, stieß unsanft mit Holly zusammen, die sie aufmunternd und forschend ansah, ihren Oberarm mit der Hand sanft umfasste und ihr »Toilette« ins Ohr schrie. Sie nickte dankbar und wie erlöst. Holly sagte etwas zum Kerl neben ihr, bahnte anschließend für sie beiden den Weg hinüber zum mit Washroom bezeichneten Ausgang. Der Flur dahinter machte einen Knick und verzweigte danach in zwei Räume für Männer und Frauen, deren Türen mit automatischen Schließern für einigermaßen Ruhe dahinter sorgten. Zwei junge Frauen standen vor einem der vier Waschbecken, kontrollierten ihr Make-Up, trugen beide weiße, halb-durchsichtige Blusen und darunter rote BHs, hatten schwarz und dick umrandete Augen und knallgrüne Lippen, sahen verbraucht aus wie vierzig, waren wohl doch eher erst zwanzig, blickten Holly und Sheliza zuerst abschätzend und dann neidisch an, als sie den Waschraum verließen.
Eine der Kabinen war noch besetzt und das Mädchen oder die Frau hinter der Blechtür kotzte sich gerade die Seele aus dem Leib, fluchte zwischen dem heftigen Aufstoßen immer wieder laut vernehmlich. Sheliza zog endlich die Stöpsel aus ihren Gehörgängen und verstand nun, dass der Ärger der Frau in der Kabine weit weniger mit ihrem Unwohlsein zusammenhing als vielmehr mit dem vielen guten Geld, das diese bislang in ihren Freitagabend-Rausch investiert hatte und das unwiederbringlich verloren war.
»Mit Freiheiten muss man umzugehen lernen«, meinte Holly lächelnd und legte ihre rechte Hand auf Shelizas linke Schulter, »das Treiben hier muss dir wie die Hölle vorkommen, ich weiß. Doch das, was du hier siehst, hat nicht wirklich viel mit dem echten Leben zu tun. Denn spätestens am Montagmorgen sitzen alle diese jungen Leute wieder ordentlich hinter ihren Schreibtischen oder stehen an der Theke der Läden und Imbiss-Buden und gehen ihrer Arbeit nach. Das, was du hier siehst, ist nichts anderes als ein Ventil. Doch die meisten von diesen jungen Menschen arbeiten unter der Woche hart, strengen sich im Studium oder als Angestellte richtig an, verdienen sich ihren Lebensunterhalt und hoffen auf ein bisschen persönliches Glück. Bitte sei ihnen nicht böse, wenn sie den richtigen Weg für sich selbst noch nicht entdeckt haben. Denn jeder Mensch muss ihn eigenständig für sich aufspüren und kann ihm erst danach folgen. Viele dieser jungen Männer und Frauen werden in wenigen Jahren bereits Eltern sein, so wie du. Sie werden ihre Kinder großziehen, sich ein Häuschen in einem Vorort mieten und alle Wildheit von früher abgestreift und rasch vergessen haben. Denn sie sind allesamt bloß auf der Suche, genauso wie du, Sheliza.«
Die junge Syrierin nickte.
»Ich verstehe schon, was du mir mit dem Besuch hier klar zu machen versuchst. Doch ich kann es noch nicht wirklich begreifen und schon gar nicht akzeptieren oder in Ordnung finden.«
»Das kommt alles noch. Lass dir dafür Zeit. Du bist wie ein Tiger, der in einem ihm fremden Dschungel unterwegs ist. Er muss vorsichtig bleiben, spürt vielleicht sogar Angst, kennt nichts, sieht überall nur mögliche Gefahren und unbekanntes Gebiet, ist deshalb höchst misstrauisch gegen alles und erwartet jederzeit einen Überraschungsangriff. Doch so fühlen sich in einer Großstadt wie London sehr viele Menschen. Wie einsame Tiger in einem dichten Dschungel, den niemand durchschaut. Die Wildnis kommt auch ihnen jeden Tag von Neuem fremd und manchmal gefährlich vor, selbst wenn sie schon Jahre darin leben. Und trotz all der Probleme und möglichen Gefahren bleiben sie hier wohnen, stellen sich den wiederkehrenden Herausforderungen und wachsen an ihnen. So wird es auch dir ergehen. Hab nur ein wenig Geduld.«
Wiederum nickte die Syrierin tapfer.
Die Verriegelung der Kabine drehte sich und die Tür schwang auf. Eine junge Frau torkelte auf hohen Stilos heraus. Sie trug langes, gewelltes, dunkelbraunes Haar, das ihr bis zur Brust herunterhing. Sie war nur mäßig hübsch, hatte eine zu kleine Stupsnase und einen zu schmalen Mund, die ihrem Gesicht etwas Verschlagenes gaben. Leicht schwankend ging sie hinüber zu einem der Waschbecken, ohne Holly oder Sheliza auch nur anzusehen, blickte mit ihren entzündeten Augen in den Spiegel, entdeckte die hängengebliebene Kotze an einigen ihrer Haarsträhnen, fluchte erneut, aber leiser, und beugte sich tief hinunter, um sie unter dem Wasserstrahl recht unbeholfen auszuwaschen, schaute wieder hoch und betrachtete sich den verschmierten Mascara im Spiegelbild, kramte in ihrer winzigen Umhängetasche nach dem Stift, versuchte eine Korrektur, die jedoch gänzlich misslang, weil ihre fahrige Hand unkontrollierbar blieb. Sie fluchte erneut, diesmal wieder lauter, und stopfte die Mascara zurück in die Tasche, reckte sich noch einmal vor dem Spiegel zurecht und schwankte dann an Holly und Sheliza vorbei zur Türe.
»Guter Spruch«, meinte sie dann doch noch und drehte sich zu den beiden um, »ich mein, das mit dem Tiger.«
Die Tür schlug hinter ihr zu.
Holly und Sheliza blickten sich an und lächelten einander zu.
»Musst du auch?«, fragte die Britin die Syrierin und wie zwei gleichaltrige Kolleginnen setzten sie sich in zwei nebeneinanderliegende Kabinen, das heißt, sie hockten sich stehend über die schmutzigen Schüsseln ohne Deckel oder Toilettensitz. Wenig später und wieder vor den Waschbecken und den fleckigen Spiegeln, schauten sie einander stumm lächelnd an, während andere Frauen und Mädchen hereinkamen oder wieder gingen.
»Lektion gelernt«, meinte Sheliza nach einer Weile, »ich beiß mich schon durch, keine Sorge, Holly.«
»Du musst die Tigerin sein, vergiss das nie. Die Tigerin, nicht das Reh.«
*