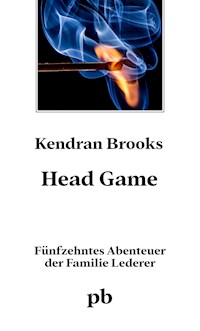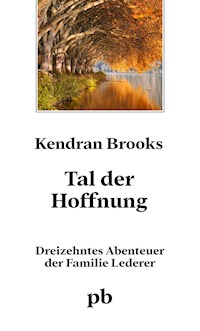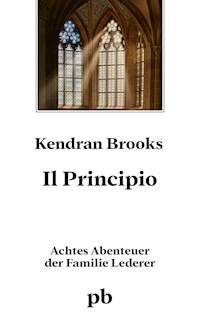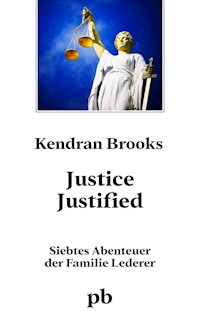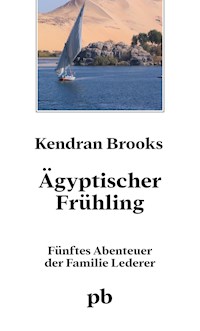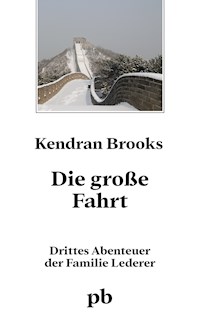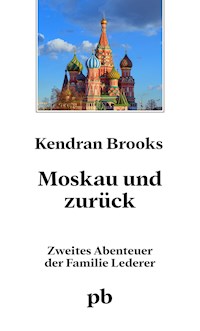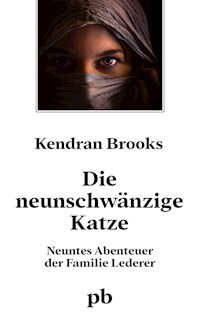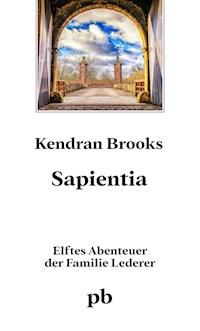
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jules Lederers Leben wird durch eine Kindheit mit einem kaum anwesenden Vater und einer Zärtlichkeiten ablehnenden Mutter geprägt, durch eine Pubertät im Knabeninternat, während der er von seinem Sportlehrer verführt und missbraucht wird, durch die einsame Zeit als Student und durch den turbulenten Eintritt in ein abenteuerliches Arbeitsleben. Beherrschung zwingt er sich auf, spielt ebenso mit ihrer Schwester, der Unvernunft. Trost und Ziel erhält er durch sein Sapientia, einem nicht fassbaren Land voller Klarheit und Vernunft, deren Pforten ihm aber oft verschlossen bleiben. Wer ist dieser Jules, dem wir uns in bisher zehn Romanen genähert haben? Was treibt ihn an? Wie kommt er mit sich selber zurecht?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kendran Brooks
Sapientia
11. Abenteuer der Familie Lederer
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorgeschichte
1988 – für Heinz
1991 – für Aleksandra
1997 - für die Queen
1999 – für Sergej
2003 – für alle Peter dieser Welt
2005 - für nichts
2006 – für Gott?
2007 – alles für Alina
2008 – alles umsonst
2009 – für Zheng He
2010 – für Chufu und Mei
2011 – für das Kind
2012 – für wen?
2013 – für Jules
2014 – für das Leben
Impressum neobooks
Vorgeschichte
Sapientia war schon vor langer Zeit zu seinem bevorzugten Rückzuggebiet geworden, zu einem Ort, der ihn umgab wie eine warme, weiche Wolke des Wissens, des Könnens, der Vernunft und nicht zuletzt der Beherrschung. Überhaupt. Beherrschung. War das nicht eine der wichtigsten Eigenschaften für jeden Menschen? Zu jeder Zeit?
Jules Lederer hatte sich jahrelang in asiatischen Kampfsportarten geschult, war darin ein wahrer Meister geworden, konnte seinen Körper als höchst effiziente Waffe einsetzen, seine Finger wie Dolche, seine Arme wie Schwerter, seine Beine wie Lanzen, seinen Körper als Rammbock. Er war gefährlich. Das wusste er. Aufgrund seines täglichen Trainings und einigen handfesten Auseinandersetzungen. Doch er spürte diese Kraft auch im Alltag beständig, selbst wenn er ruhig an der Hochschule St. Gallen im Vortragssaal saß und irgendeinem Professor gelangweilt oder interessiert zuhörte. Oder wenn er durch die Straßen und Gassen der Stadt streifte oder sich mit Kollegen zu einem Bier oder Essen traf. Denn das Wissen um seine Gefährlichkeit verlieh ihm ein hohes Selbstbewusstsein. Und das Selbstbewusstsein sorgte für zusätzliche Gewissheit und damit Gefährlichkeit. Denn Körper und Geist waren in eine perfekte Symbiose getreten, befruchteten sich gegenseitig, trieben sich ständig weiter an und hoch.
Zumindest bis zu diesem einen Tag, als er die Beherrschung gegenüber Boris verlor. Der ekelhafte Russe hatte ihn zuvor aufgezogen und verhöhnt, nannte ihn ein Weichei und eine Bonsai-Spargel. Jules durchschlug daraufhin mit einem Jumok Jirugi die Deckung des 30-jährigen aus Jaroslawl problemlos. Der Schlag kam für den Russen zu ansatzlos und viel zu schnell. Seine Nase wurde ihm dabei zertrümmert, die Oberlippe gespalten. Noch vier Wochen später waren die Blutergüsse an der Stirn, an den Wangen und um die Augen herum auszumachen. Jules Lederer wurde von allen Seiten mit Vorwürfen übergossen und Meister Hiro Kashi verbannte ihn sogleich und auf Lebzeiten aus dem Dojang.
Später am selben Abend und zurück in seiner recht tristen 1-Zimmer-Wohnung im dritten Stockwerk einer verlotterten Mietskaserne an der Waldaustraße, nachdem er sich auf der einzigen Herdplatte die Ramen vom Vortag aufgewärmt und sich am winzigen Tisch niedergesetzt hatte, ohne Appetit die Nudelsuppe aus dem kleinen Topf löffelte, da tauchten seine Gedanken das erste Mal ein, entschwanden ihm nach Sapientia, von einem Augenblick zum nächsten, ohne Vorzeichen, ohne Vorwarnung, auch ohne Übergang. Kurz vorher spürte er noch, wie sich seine Dura mater, dann die Arachnoidea und unmittelbar danach die Pia mater zu verflüssigen schienen und sein Gehirn zwischen den Knochen seines Schädels sanft zu schaukeln begonnen hatte. Gleichzeitig umhüllte ihn ein strahlendes Licht, so plötzlich, so grell, dass er die Tischplatte mit dem Suppentopf und seine Hand mit dem Löffel nicht mehr erblicken konnte und geblendet seine Augenlider zusammenkniff, gleichzeitig aber eine ungeheure Ruhe und den vollkommenen Frieden in sich spürte, in diesem unbestimmbaren, neblig-warmen Weiß. Jules entspannte sich vollends, konnte loslassen, vergaß jeden Gedanken, an den Ausschluss aus dem Dojang, an die unangenehme Aussprache mit Meister Hiro Kashi und selbst an seinen Gewaltausbruch gegen den unerträglichen Boris. Nein, Jules blieb in diesen Sekunden (oder vergingen gar Minuten?), ohne jedes Bild oder Sprache, befand sich einfach nur dort, in diesem Land der Erkenntnis, des Wissens, der völligen Klarheit, fühlte sich darin geborgen und sicher aufgehoben.
In den folgenden Wochen und Monaten fragte er sich immer wieder, ob er womöglich einen Blick in den Himmel werfen durfte und für Momente die Gnade irgendeiner Gottheit erfahren hatte. Doch Jules war alles andere als religiös, lehnte auch jede Form kirchlicher Autorität ab, verabscheute sämtliche ihrer Riten, hatte nur Hohn und Spott für gläubige Menschen übrig. Und doch. Dieses Erlebnis begann ihn immer stärker zu beschäftigen, ließ ihn nicht mehr los. Denn er sehnte sich zurück in sein neues Sapientia, in dieses friedvolle Land, das keine Grenzen zu kennen schien und voller Klarheit, Wissen und Möglichkeiten steckte.
Immer krampfhafter versuchte Jules dorthin zurück zu gelangen, kochte gar den Ramen exakt so nach, wie ein paar Tage zuvor, wärmte ihn zur selben Stunde auf, setzte sich mit demselben Topf an seinen Tisch, brachte sich mit Hilfe von Zazen zur Ruhe, versenkte sich in Satori, hatte trotzdem keinen Erfolg. Unerreichbar erschien ihm dieses so unvermittelt neu entdeckte Land und gleichzeitig als der einzige Ort, der für ihn noch erstrebenswert war.
Wochen später, an einem Samstagabend, nachdem er mit Kollegen viel zu lange in einer Bar herumgehangen und gebechert hatte, kam in seinem benebelten Gehirn diese blödsinnige Idee auf, wurde rasch zu einer Manie. Ja, ein Faustkampf musste her, würde wohl endlich die Voraussetzung schaffen, um nach Sapientia zurückkehren zu können. Jules wusste hinterher nur noch unklar, wie er einen bulligen Kerl zuerst verbal und danach auch noch handgreiflich anpöbelte, wie der ihn an den Jackenaufschlägen mit beiden Händen packte und hinaus auf die Straße zerrte, wie ihn Fäuste trafen, ins Gesicht und in den Leib, wie das Adrenalin trotz Alkoholpegel in ihm hochkochte und er sich mit ein paar Tritten und Schlägen rasch Luft verschaffte, den Mann dann mit einem gewaltigen Mureupchagi direkt auf den Solarplexus traf und den Kerl so zu Boden fällte, wie ihn gleich danach seine Kollegen umringten, auf ihn einredeten oder schrien, ihn packten und rasch wegführten von diesem Ort der Gewalt, noch bevor die Polizei eintraf und ihn festnehmen konnte.
Die Staatsgewalt fand ihn trotzdem, holte ihn schon am nächsten Morgen in seiner Wohnung ab, verkatert und desorientiert wie er war, führte ihn in Handschellen die Treppen nach unten, stieß ihn in den Streifenwagen, fuhr ihn auf ein Revier. Ein uniformierter Beamter befragte ihn nur kurz und Jules gab bereitwillig Auskunft, gab auch alles zu, an das er sich noch erinnern konnte oder was ihm zumindest plausibel erschien, seine Provokationen, seinen Gewaltausbruch. Er wurde ein paar Stunden später einem Richter vorgeführt. Der bot einen Wald-und-Wiesen-Hausarzt auf, der die von der Justiz erwartete oder verlangte Diagnose abgab. Er bezeichnete Jules als unkontrolliert und selbstmordgefährdet und so ließ ihn das Gericht zur weiteren Abklärung in eine psychiatrische Einrichtung einweisen.
Drei Wochen verbrachte Jules dort mit unsinnigen Gesprächen, meistens vollgepumpt mit irgendwelchen Drogen, vor allem Beta-Blockern, die ihm den Lebensmut nehmen sollten. Doch auch die Medikamente führten ihn kein einziges Mal zurück nach Sapientia, schienen ihn bloß immer weiter aus der realen Welt zu reißen, in eine neblig-trübe Suppe von Leben.
Überhaupt. Der Name. Sapientia. Damals kannte er ihn noch gar nicht, hatte keine Bezeichnung für diesen für ihn so erstrebenswerten Ort. Vielleicht gelang ihm deshalb der Sprung dorthin nicht mehr?
Sein Anwalt befreite ihn aus dem künstlichen Gedankengefängnis der Irrenanstalt. Vielleicht hatten seine Eltern Druck auf die Behörden ausgeübt? Ein Lederer in der Psychiatrie? Das durfte nicht sein. Jules hatte allerdings keinen Kontakt mehr zum längst geschiedenen Elternpaar, suchte ihn auch nicht nach seiner Entlassung aus der Nervenheilanstalt. Wichtig war bloß, dass er frei gekommen war und ein halbes Jahr später wegen leichter Körperverletzung zu einer bedingten Gefängnisstrafe von sechs Monaten verurteilt wurde, aber nicht etwa wegen der Gewalt, die er tatsächlich gegen diesen Kerl in dieser Bar in dieser Nacht eingesetzt hatte, nicht wegen dem kurzen Krankenhausaufenthalt, den er ihm bescherte, sondern vor allem wegen der tödlichen Gewalt, die er aufgrund seiner Ausbildung, seines unermüdlichen Trainings und des Alkohols in seinem Blut hätte einsetzen können.
Doch Sapientia blieb für Jules auch in den nächsten Monaten unerreichbar. Hatte ihm vielleicht doch irgendein Gott ein einmaliges Zeichen gesandt? Als eine Art von Gnade und letzter Chance? Doch Jules verweigerte sich standhaft gegen jeden religiösen Gedanken. Denn kein Gott war in seinen Augen gerecht und kein Gott wollte ehrlichen Frieden. Das lehrte einem die Geschichte, die Erfahrung und das Hier und Heute. Und so blieb dem Schweizer nichts anderes als die Sehnsucht nach diesem einen Ort, wo sich seine Gedanken völlig frei bewegten und er sich gleichzeitig geborgen und beschützt fühlte.
In dieser Zeit wählte er auch den Namen für sein neues Land.
Sapientia.
Lateinisch stand das Wort für Klugheit, Weisheit, Vernunft und Besonnenheit. Nicht das Jules die römische Sprache besonders geliebt hätte. In der Schule hatte er sich an ihr gelangweilt und sie war wohl auch der Grund gewesen, warum er seine pubertären Ideen rasch begrub, dereinst als Archäologe die Welt zu bereisen, um neue Fundstätten zu entdecken und alte Fragen der Menschheit zu beantworten. Das Abenteuer hatte ihn wohl schon damals gelockt. Doch Latein und später Altgriechisch wären zwei Grundvoraussetzungen für eine Karriere als Grabungsleiter gewesen, viel zu hohe Hürden für einen wenig disziplinierten Schüler, der gerade begann, seine körperlichen Fähigkeiten durch viel Sport zu entwickeln.
Er musste lange den Zugang zu seinem Sapientia suchen, fand ihn irgendwann, betrat das Land seiner Verheißung immer gezielter und so oft ihm danach war, benutzte dessen unerschöpflichen Möglichkeiten. Und wenn er auch in späteren Jahren den Weg dorthin ab und zu aus seinen Augen verlor, sich selbst das Tor in sein Reich versperrte, so fand er den Schlüssel doch stets wieder, zumindest, wenn er ihn wirklich dringend brauchte.
1988 – für Heinz
Seine Abschlussarbeiten hatte Jules termingerecht eingereicht und alle Anspannung, aller Ärger, alle Mühsal war in diesem Moment von ihm abgefallen. Er hatte auch noch nicht für seine Zukunft geplant, wollte die nächsten Monate ohne jede Verpflichtung verbringen, vielleicht die Welt bereisen, das Leben genießen. Zwar nur mittelgroß, schlank und mit einem Allerweltsgesicht gesegnet, zog der Schweizer trotzdem viele Frauen jeden Alters an, sobald er sich lässig an einem Sandstrand in der Badehose oder an einer Bar mit weit geöffnetem Hemd und eng geschnittener Hose zeigte und so seinen gestählten Körper mit den deutlichen, wenn auch nicht protzigen Muskeln präsentierte.
Finanziell war Jules Lederer bereits damals weitgehend unabhängig. Seine geschiedenen Eltern hatten ihn stets reichlich mit Geld versorgt. Zudem beerbte er eine verstorbene Tante, die er gar nicht kannte, die ihn wahrscheinlich als Säugling zum ersten und letzten Mal gesehen und in ihren bestimmt schon damals faltigen und fleckigen Armen gewiegt hatte. Doch achthunderttausend Franken blieben achthunderttausend, selbst wenn sie vom Teufel selbst ausbezahlt worden wären.
Immer noch lebte Jules in der 1-Zimmer-Wohnung an der Waldaustraße in St. Gallen, immer noch trainierte er täglich seinen Kampfsport, wenn auch nicht mehr unter einem Meister und in einem Dojang, sondern in einem gewöhnlichen Karateklub, dessen Mitglieder allesamt weit weniger an asiatischen Weisheiten als an durchschlagenden Argumenten interessiert waren.
Jules hielt sich meist abseits von ihnen, hatte in einer Ecke der großen Trainingshalle auf eigene Kosten einen Wing Chung Holzdummy installieren lassen, um seinen Körper weiter abzuhärten. Heinz Keller war ihm hierher gefolgt, hatte das frühere Dojang von Meister Hiro Kashi ebenfalls verlassen, blieb sein guter Kollege und beinahe Freund. Nur beinahe, denn Jules mochte die Nähe eines anderen Mannes nicht aushalten und ohne die war echte Freundschaft unmöglich. Vielleicht lag das an Jules Kindheit mit einem Vater, der nie für ihn da war und einer Mutter, die jede Körperlichkeit ablehnte. Womöglich auch an seinem früheren Sportlehrer Peter Maischberger, der die Verletzlichkeit von Jules damals im Knabeninternat in Montreux gespürte hatte, ihn verführte und missbrauchte.
Nein, mit Männern sich im Kampf messen, das mochte Jules Lederer, war für ihn zu einem wichtigen Lebensinhalt geworden. Doch mehr und echte Nähe? Über Gedanken und Gefühle sprechen? Vertrautheit aufbauen? Das alles kam für ihn nicht mehr in Frage. Und so blieb seine Beziehung zu Heinz Keller eine rein kollegiale, mit lockeren Gesprächen und stets ausweichendem Tiefgang. Und Heinz spürte die mangelnde Bereitschaft von Jules, nahm darauf Rücksicht, vielleicht, weil er in ihm längst den Anführer ihres Zweiergespanns sah, dessen Launen er sich unterzuordnen hatte, vielleicht auch, weil er damals schon die innerliche Verlorenheit von Jules fühlte und kein Mittel fand, sie aufzubrechen.
Doch dann trat Roger Spälti in ihr Leben, tauchte an einem Abend in der Karateschule auf, beobachtete die Kämpfer auf den Kwon-Matten, gesellte sich wenig später zu Jules und Heinz, die an der Wing Chung Holzpuppe Ausdauer übten und ihre Schmerzempfindlichkeit senkten. Und irgendwann stellte sich Roger den beiden vor, lud sie zu einem isotonischen Getränk an der Bar ein, fragte sie aus, nach ihren Kampfkünsten, der Einschätzung ihrer Fähigkeiten. Jules war ehrlich überrascht, dass Heinz ihn als sein Vorbild beschrieb und von seinem Können schwärmte, tat dasselbe für seinen Kollegen, wenn auch wenig überzeugend.
Später ließ sich Roger Spälti von ihnen beiden einen Showkampf mit Nunchakus zeigen. Sie gehörten für Jules und Heinz zu den bevorzugten asiatischen Waffen, waren doch die beiden durch kurze Ketten verbundenen und mit Blei ausgegossenen Holzenden nur schwer beherrschbar, verlangten gleichermaßen nach körperlichem, wie nach geistigem Geschick, mussten geradezu mit dem Kämpfer verschmelzen, um wirksam eingesetzt zu werden.
Roger Spälti zeigte sich von der Vorführung begeistert, lud Heinz und Jules spontan zu einer asiatischen Kampfsport-Show ein, die sein Arbeitgeber Lenz & Karrer, eine große Anwaltskanzlei in Zürich, sponserte. Die beiden nicht-mehr-lange Wirtschaftsstudenten nahmen freudig an und zeigten ein paar Wochen später dem Publikum einen ebenso wilden, wie erklärenden Schaukampf. Zufrieden saßen die beiden hinterher in der Umkleide zusammen, hatten längst geduscht und die Haare gewaschen und schlüpften gerade in ihre Straßenschuhe, als Roger Spälti zu ihnen hineinkam und sie zu einem Bier oder Wasser in einer nahen Kneipe einlud. Zu dritt saßen sie wenig später in der Gräbli Bar an einem Tisch zusammen, Heinz und Jules innerlich in gespannter Erwartung, Roger locker und doch bestimmt.
»Ich hab das Okay bekommen«, vermeldete er, nachdem sie sich zugeprostet hatten, »von meinen Vorgesetzten«, ergänzte Roger erklärend, »die saßen nämlich auch im Publikum. Auf meine Bitte hin.«
Irgendwie seltsam geheimnisvoll klangen diese Sätze in den Ohren der beiden Wirtschafts-Studenten, beinahe schon verschwörerisch.
»Wir möchten euch beiden deshalb ein Angebot machen.«
Heinz und Jules sahen einander an, lächelten überrascht und erfreut.
»Wir sind ständig auf der Suche nach jungen Talenten, die unsere Teams verstärken«, führte Spälti weiter aus, flocht immer noch an seinem Netz, um die Beute sicher einzufangen, »und ihr beide könntet zu den Besten gehören«, was immer er mit Besten meinen mochte. Heinz und auch Jules sagten nichts darauf, warteten auf weitere Erklärungen.
»Lenz & Karrer sind weltweit als Wirtschaftskanzlei tätig. Wir besitzen Niederlassungen in Washington, Tokio und Singapur, werden bald eine weitere Filiale in Doha eröffnen. Ihr seht, wir expandieren kräftig«, und er blickte seine Beute ein wenig gönnerhaft, aber keineswegs überheblich an.
»Unsere Mandanten sind die größten Konzerne der Erde und die wohlhabendsten Familien und Privatpersonen«, köderte er seine beiden Opfer weltmännisch verführerisch.
»Und mit was verdient ihr euer Geld?«, fragte Heinz neugierig dazwischen, längst angesteckt durch die süßen Düfte fremder Länder und Kulturen, die sich bei Lenz & Karrer wohl mit Beruf und Einkommen verbinden ließen.
»Wir sind Wirtschaftsanwälte«, stellte Roger Spälti unnötigerweise klar, als müsste er Heinz und Jules aus Wolkenkuckucksheim zurück auf die Erde holen, »internationale Steuersachen, Unternehmenszusammenschlüsse, Nachfolgeregelungen, Family-Offices«, ließ er gleich wieder eine breite Palette an möglichst exotischen Tätigkeitsfeldern aufblitzen.
»Und wir wären…?«, meinte nun auch Jules und wirkte weitaus skeptischer und vorsichtiger als Heinz.
»Anfänger, selbstverständlich«, meinte Roger laut auflachend, »oder was dachtet ihr denn, so direkt nach eurem Studium?«
Heinz schien ernüchtert, Jules dagegen eher interessierter als zuvor. Doch beide sagten nichts, warteten auf das konkrete Angebot.
»Ihr arbeitet vorerst in Zürich, werdet einem Team zugeteilt, erhaltet einen Patenonkel, der euch in den nächsten zwei oder drei Jahren betreuen wird, lernt zuerst unseren Betrieb und danach schrittweise unsere Klienten kennen. Keine Sorge, ihr werdet auf jede eurer Aufgaben sorgfältig vorbereitet. Lenz & Karrer können es sich nicht erlauben, einen Mandanten zu verärgern oder zu enttäuschen.«
»Und du glaubst, wir beide gehören zu den Richtigen?«, fragte Jules weit skeptischer zurück, als er sich tatsächlich fühlte, so als müsste er mit dem Angebot spielen.
Roger lächelte, nachsichtig, aber auch wissend. Vielleicht waren die drei aus demselben Holz geschnitzt, auch wenn Spälti bestimmt fünfzehn Jahre älter war als die beiden Noch-Studenten. Doch er schien in ihnen vielleicht eine Art von jüngerer Ausgabe zu sehen, hoffte es zumindest.
Heinz bewegte sich als erster, streckte Spälti seine Hand entgegen. Der nahm sie ohne Zögern an, schüttelte sie, nickte seinem neuen Mitarbeiter lächelnd und zufrieden zu, meinte trotzdem: »Und keinerlei Fragen? Zur Höhe des Einkommens? Unseren Sozialleistungen? Den Spesen?«
»Nein«, meinte Heinz strahlend lachend und fügte an, »ich bin mir sicher, dass Jules und ich bei Lenz & Karrer alles finden werden, was wir uns nur wünschen.«
Spälti antwortete nicht darauf, sah stattdessen Jules auffordernd an. Doch der zögerte noch, so als spürte er bereits all die Probleme und Schwierigkeiten, auch all den Zorn und die Wut, die Gewalt und die Menschenverachtung, die stets an den großen Vermögen der Welt klebten.
»Wie steht es mit dir?«, fragte Roger deshalb nach und allen dreien war in diesem Moment bewusst, dass Spälti unbedingt Jules mit in sein Boot der Wirtschaftsanwälte holen wollte und Heinz eher als eine Dreingabe betrachtete.
»Wir wissen doch noch nicht einmal, ob unsere Abschlussarbeiten fürs Diplom reichen«, wandte Jules Lederer ein und sah dann etwas staunend in das breite Grinsen von Roger Spälti.
»Ihr vielleicht nicht. Wir jedoch schon.«
Jules schlug in die angebotene Hand ein.
*
Heinz Keller und Jules Lederer verloren sich in den nächsten Wochen aus den Augen. Denn Jules blieb in der Zentrale der Anwaltskanzlei in Zürich hängen, während Heinz bereits zehn Tage nach ihrem gemeinsamen Antritt nach Washington übersiedelte. Ein amerikanischer Kollege war durch einen Unfall ausgefallen und schneller Ersatz gefragt. Heinz fühlte sich auserwählt, foppte Jules gehörig, was sich der gerne gefallen ließ und seinem Kollegen alles Gute wünschte. Doch irgendwie fühlte sich Jules doch zurückgesetzt und er sprach Roger Spälti darauf an, beschwerte sich indirekt bei ihm. Doch der nickte ihm bloß aufmunternd zu und klopfte ihm auf die Schultern: »Deine Zeit kommt schon noch, Jules, keine Sorge.«
»Aber warum habt ihr Heinz vorgezogen?«
»Die Entscheidung fiel aufgrund der Resultate des Assessments nach eurem Eintritt.«
»Und Heinz schnitt darin besser ab als ich?«, zweifelte Jules den Test sogleich an.
Roger lachte auf.
»Nein, Jules, ganz und gar nicht.«
»Aber warum …?«
»Der frei gewordene Posten in Washington war der Richtige für Heinz Keller. Er ist ein Heißsporn, wie du sicher weißt, und an diesem Ort bestimmt gut aufgehoben. Denn in den USA geht’s weit hemdsärmeliger zu und her als hier bei uns in der gemütlichen Schweiz. Zudem haben wir mit dir weit mehr vor«, ließ Spälti gewisse Erwartungen in Jules zurück.
Doch die immer selteneren Telefongespräche mit seinem Kollegen Heinz verhießen für Jules wenig Gutes. Während er in Zürich fast ausschließlich an seinem Arbeitsplatz im Großraumbüro saß und dort Bilanzen und Kapitalflussrechnungen von irgendwelchen Unternehmen analysieren und auf besonders Gewinn versprechende Investitionen abtasten musste, berichtet ihm Heinz von unwahrscheinlich betuchten Klienten, die er als Junior-Berater zusammen mit seinem direkten Vorgesetzten besuchte, von riesigen Villen, teuren Sportwagen und den schönsten Frauen des Erdballs. Und auch wenn Jules die Schilderungen durchwegs als übertrieben und prahlerisch abtat, sie versetzten ihm trotzdem Stiche. Mehr als einmal ermahnte er seinen Kollegen auch, doch auf dem Teppich zu bleiben, doch Heinz ließ sich nicht mehr beirren, sprach von ungeahnten Möglichkeiten und wenig später von seinem ersten Alleineinsatz im nahen Ausland. Mehr verriet er Jules nicht, tat geheimnisvoll, als wäre er plötzlich der Bruder von James Bond und kein kleiner Anwaltsgehilfe. Sie verabschiedeten sich wie üblich, mit lockeren Sprüchen und guten Wünschen. Missmutig legte Jules den Hörer auf die Gabel zurück, fragte sich, ob sein Eintritt bei Lenz & Karrer nicht ein riesiger Fehler gewesen war. Roger Spälti sprach er jedoch nicht mehr an. Der war eh immer häufiger abwesend, besuchte wohl die anderen Standorte im Ausland, stellte den Kontakt mit der Zentrale sicher.
Ein Gefühl der Vereinsamung oder der Verlassenheit stellte sich bei Jules ein. Denn nach seinem Umzug von St. Gallen in ein 2-Zimmer-Appartment an der Mühlegasse in Zürich hatte er sich noch keinen neuen Bekanntenkreis aufgebaut. In der Kanzlei waren fast alle Angestellten und auch die Partner verheiratet, pflegten außerhalb der Büroräume keine Kontakte untereinander, schienen sich richtiggehend abzuschotten und sich abends und übers Wochenende in ihre selbst geschaffenen Schneckenhäuser zurückzuziehen.
Nur einmal hatte ihn Roger Spälti zu sich nach Hause eingeladen, kurz nach der Abreise von Heinz. Es gab Otak-otak, in Bananenblätter eingewickelte Kugeln aus Makrelenfleisch, danach Satay mit Erdnusssauce und etwas gedünstetes Gemüse, eine Curry Laksa mit Nudeln und als Hauptgang ein Rendang aus Rindfleisch, scharf gewürzt und mit Ingwer, Zitronengras und Galgant verfeinert, wie Jules verwundert und fragend zugleich feststellte.
»Meine Familie versorgt uns regelmäßig mit allem Notwendigen«, meinte Yolida und lächelte dazu, als müsste sie sich entschuldigen, »doch woher kennst du Galgant? Kaum jemand in der Schweiz kennt dieses Gewürz?«
Die malaysische Ehefrau von Spälti sprach ein derart britisch klingendes Englisch, dass sich Jules sogleich an einen Austauschstudenten aus England erinnert fühlte, den er ein Jahr zuvor in St. Gallen kennengelernt hatte. Tatsächlich hatte Yolida am Girton College englische Geschichte und englische Literatur studiert und in Cambridge auch ihren Heinz kennengelernt, der am Jesus College Philosophie und Theologie belegte. Das Ehepaar war kinderlos geblieben. Jedenfalls wurden keine erwähnt und Jules fragte aus Gründen der Pietät nicht weiter nach.
»Meine Mutter hatte eine Phase, in der sie mit asiatischen Heilkräutern und Gewürzen experimentierte und eine Reihe von Hausmittelchen herstellte. Sie verlor zwar rasch das Interesse daran. Doch ich kann mich an eine rotbraune Flüssigkeit erinnern, die sie mir gegen Bauchschmerzen verabreichte. Sie war scharf und roch nach Ingwer, den ich damals aber noch gar nicht kannte. Und als ich sie fragte, was ich da schluckte, sprach sie von Galgant, was für mich so ähnlich wie Galgen tönte. Ich hab später in der Schulbibliothek nachgeschlagen und darüber gelesen. Seinen besonderen Geschmack habe ich jedoch nie mehr vergessen.«
So und ähnlich verliefen die drei Stunden Plauderei mit Essen, das mit einem Bubur cha-cha endete. Erst Monate später und nach Jules Einsatz in Haiti erzählte ihm Roger Spälti, was Yolida nach diesem Abend zu ihm sagte.
»Er ist ein sehr angenehmer junger Mann. Er wirkt aufrichtig und abgeklärt, sehr vernünftig und ruhig. Doch tief in ihm drin brennt ein Feuer. Ich konnte nicht spüren, ob es gut oder schlecht ist. Aber es ist vorhanden und wirkt ähnlich wie Heimweh, eine Art von Sehnsucht. Vielleicht nach einem bestimmten Menschen? Oder nach einem Ort? Vielleicht auch nur nach Ansehen, Geld oder Macht. Er scheint mir hungrig, dieser Jules. Doch nach was?«
Jules hatte laut aufgelacht und lausbübisch gegrinst, als ihm Spälti dies erzählte, hatte seinem Mentor aufmunternd auf das linke Schulterblatt geklopft und gemeint: »Deine Frau ist so klug. Grüß sie bitte nett von mir.«
*
Jules hatte sich entschieden. Er wollte noch in dieser Woche bei Lenz & Karrer kündigen und die Anwaltskanzlei verlassen. Von Heinz Keller hatte er seit zwei Wochen nichts mehr gehört und auch Roger Spälti schien sich nicht mehr um ihn zu kümmern.
»Ich versauere hier noch«, hatte er seinem Vorgesetzten am gestrigen Abend an den Kopf geworfen, »immer nur Zahlen analysieren und Berichte schreiben und nie erhält man ein Feedback, weiß nicht, wer was auf der Basis meiner Arbeit entschieden hat oder ob ich hier bloß für den Papierkorb lese und tippe.«
Sein Vorgesetzter sah ihn nur mitleidig an, setzte seinen dunkelgrauen Filzhut mit dem dunkelbraunen Seidenschweißband auf und verließ das Großraumbüro, ging wie jeden Abend exakt um Viertel nach Fünf, ließ diesmal bloß sein sonst obligates Kopfnicken zur Verabschiedung weg, als deutliche Missbilligung des Ausbruchs seines Untergebenen. Jules blieb ratlos in seinem zwei mal zwei Meter kleinen, von hohen Schallschluckwänden umschlossenen Einzelarbeitsplatz zurück, fühlte sich wie ein überdimensionierter Hamster im Käfig, fürchtete sich gleichzeitig vor der allabendlichen Rückkehr in seine Wohnung, vor der nächsten einsamen Nacht. Er erhob sich von seinem Bürostuhl, blickte über die Kante der eins sechzig hohen Wände und sah sich um. Da und dort leuchteten noch Arbeitsplatzlampen, vielleicht vergessen von längst gegangenen Kollegen, vielleicht auch die Markierungen von anderen noch emsigen Hamstern im Rad. Er setzte sich wieder hin, starrte auf die Tastatur, hob seine rechte Hand und wuchtete seine Faust mit aller Kraft auf die Buchstaben, so dass einzelne der Kunststoffkappen zerbrachen, nahm das Keyboard danach hoch und zerlegte es krachend über seinem Oberschenkel, faltete es zusammen wie einen Karton und warf es in den Papierkorb neben seinem Pult, starrte feindselig darauf nieder, schalt sich gleichzeitig einen verdammten Narren. Wie sollte er nun seine Kündigung tippen?
Erschlagen fühlte er sich, als er sich in sein Apartment mehr schleppte als ging. Im Kühlschrank fand er noch eine Block billigen Gouda-Käse und eine fast volle Tube Mayonnaise, setzte sich mit den beiden in den Händen aufs Sofa und tippte mit dem kleinen Finger auf die Fernbedienung, schaltete den Fernseher ein, blickte auf die Mattscheibe, sah nicht wirklich die Bilder, hörte auch nicht zu, drückte mechanisch die Paste aus der Tube auf den Käse und biss vom großen Stück ab, kaute flüchtig und schluckte zornig.
Zehn Minuten später war er wieder auf der Straße unten, spürte Käse und Mayonnaise wie einen harten Brocken schwer im Magen liegen, so als hätten sich die Bissen dort wieder zusammengefügt, bekam auch einen unangenehm beißenden Geschmack im Mund, peilte die nächstgelegene Bar an, in der er ab und zu einen der Abende verbrachte. Diesmal war sie kaum besucht und so konnte er sich auf seinen Lieblingshocker am Tresen setzen, ganz hinten in der Ecke, von dem aus er den Eingang beobachten konnte. Er bestellte sich einen Dry Martini, musste sich den längst schalen Bond-Spruch bezüglich geschüttelt oder gerührt vom grinsenden Barkeeper anhören, der sich im Übrigen auf einen Wodka-Martini bezog, ärgerte sich beim Kauen der Olive einmal mehr darüber, dass sie, wie fast überall in der Stadt, zuvor in Öl eingelegt war und nicht in der obligaten Lake, dachte über sein Leben nach, rief sich in Erinnerung, dass er am nächsten Morgen zuerst im Computerfachgeschäft vorbeigehen musste und eine neue Tastatur erwerben.
Ein zweiter Dry Martini folgte dem ersten und Jules dachte kurz an die US-amerikanische Schriftstellerin Dorothy Parker, die einmal gesagt haben soll: »Ich trinke gerne Martini, doch zwei sind genug, denn nach dreien liege ich unter dem Tisch und nach dem vierten unter dem Wirt.«
Jules war nicht nach Lachen oder auch nur nach Grinsen zumute. Denn was sollte er nach dem Austritt aus der Kanzlei tun? Wo sich bewerben? Welche Richtung einschlagen?
Sein Vater war ein hoher Diplomat, reiste für die Schweizer Regierung in der Welt herum und machte sich wichtig. Seine Mutter war vereinsamt, seit ihr Ehemann ausgezogen und ihre Jugend verblüht war. Sie widmete sich ausschließlich dem Alkohol und manchmal noch jungen, gekauften Liebhabern. Als einziges Kind würde er dereinst von beiden genug Geld erben, um nicht arbeiten zu müssen. Machte Arbeit Sinn, wenn man auf den Verdienst nicht angewiesen war?
Jules bestellte sich einen weiteren Martini, diesmal jedoch aus halb-halb Gin und Wodka. Der Barkeeper schüttelte ihn, ohne zuvor zu fragen, servierte ihn in einer Schaumweinschale und legte eine Zitronenzeste hinein. Nun musste Jules doch ungewollt grinsen, murmelte sogar ein: »Close but no cigar.«
»Wie bitte?«, fragte der Barkeeper zurück, hatte wohl ein Lob von Jules erwartet.
»Schon gut«, und er trank das Glas in einem Zug leer, »ich möchte zahlen.«
Als er zum Apartmenthaus kam, wartete Roger Spälti vor der Eingangstüre auf ihn, hatte wohl zuvor erfolglos bei ihm geklingelt. Jules erkannte eine ungewohnte Unruhe in den Augen seines Mentors. Spälti schien höchst verunsichert oder gar erschüttert. Die beiden Männer begrüßten sich wortkarg, denn Jules glaubte selbstverständlich, seine verbale Auseinandersetzung mit seinem Vorgesetzten hätte Roger auf den Plan gerufen und er war zu ihm geeilt, um ihm eine gehörige Standpauke zu halten. Darum fragte Jules auch gar nicht nach den Gründen für den unerwarteten Besuch. Aber auch sein Mentor erklärte nichts, während sie schweigend in der Liftkabine ins fünfte Obergeschoss fuhren und wenig später die Wohnung von Jules betraten. Spälti steuerte direkt das schmale Sofa an und setzte sich hinein.
»Hast du einen Whiskey?«, fragte ihn sein Mentor und Jules schüttelte verneinend den Kopf: »Ich kann nur mit Tequila dienen.«
»Dann her damit. Und nimm dir auch einen.«
Während Jules den Agavenschnaps aus dem Schrank holte und mit zwei Wassergläsern zurückkam, sie hinstellte und zur Hälfte mit Tequila Silver füllte, sah er Spälti fragend an, konnte sich auf das Verhalten seines Mentors keinen Reim machen.
Wollte man ihn fristlos entlassen? Oder ihm gar noch zusätzlichen Ärger bereiten? Vielleicht eine Klage wegen Zerstörung von Firmeneigentum? Anwälten war einfach Alles zuzutrauen.
Spältis offensichtliche Unsicherheit begann sich auf Jules zu übertragen. Sie prosteten sich mit ernstem Blick zu, als ginge es um einen Abschied, hoben die Gläser an, ohne etwas zu sagen, tranken jeder einen großen Schluck.
»Heinz wurde letzte Woche auf Haiti ermordet.«
Jules war einen Moment lang sprachlos. Er fühlte, wie ihm die knappe Information über den Tod seines Kollegen heiß zu Kopf stieg, wo sein bisheriger Alkoholkonsum in der Bar längst für Enthemmung und für besten Nährboden gesorgt hatte.
»Ermordet? Wie? Und von wem?«
»Man hat ihn im Lift seines Hotels überfallen und erdrosselt. Er ist wahrscheinlich einer Bande von Erpressern in die Quere geraten. Weißt du, Jules, wir versuchen dort unten schon seit ein paar Monaten drei Ferienhotels für einen unserer Klienten aus den USA zu erwerben. Er braucht sie zwar bloß als Abschreibungsobjekte für seine Steuern, doch er hat sich nun Mal in den Kopf gesetzt, dass es unbedingt Haiti und exakt diese drei Hotels sein müssen. Die lokale Schutzgeldmafia ist jedoch allzu gierig und verlangt für ihr Stillhalten dreißig Prozent des Kaufpreises. Das wären mehrere Millionen Dollar und entschieden zu viel für unseren Kunden und seine Steueroptimierung. Das würde sich für ihn nicht mehr rechnen. Heinz war für uns dort unten, um mit den Kerlen zu verhandeln und ihren Preis zu drücken. Wahrscheinlich hat man ihn bloß umgebracht, um uns vor Augen zu führen, wie wenig wir in ihrem Machtbereich auszurichten vermögen.«
Der Redeschwall von Spälti sollte von so viel ablenken, von seiner Verunsicherung über den Tod eines jungen Mitarbeiters, vom Gefühl der Verantwortung und des eigenen Versagens.
»Und du schickst nun mich hinunter?«
Erst nachdem er es ausgesprochen hatte, wurden Jules seine eigenen Worte bewusst. Spälti sah ihn auch erstaunt an, ob gespielt oder echt: »Wie kommst du denn darauf?«
»Na, du hättest mir die Umstände um den Tod von Heinz bestimmt nicht erzählt, wenn du das nicht vorhättest.«
Roger schaute Jules einen Moment lang forschend an.
»Nur wenn du willst, Jules, nur wenn du wirklich willst.«
Der Alkohol und seine plötzliche Wut ließen Jules keine Wahl.
»Lass für mich bitte einen Sitzplatz im nächsten Flugzeug buchen und gib mir alle Informationen und Berichte, die wir über den Auftrag besitzen.«
»Dein Flug geht morgen, nein, heute früh um halb neun ab Kloten. Ticket und alle Informationen findest du an deinem Arbeitsplatz.«
Spälti nahm erneut das Glas zur Hand und stürzte den Rest Tequila hinunter, erhob sich und reichte Jules seine Hand, aber nicht zum Abschied.
»Für Heinz«, meinte sein Mentor feierlich, beinahe salbungsvoll, so als wollte er Jules für den mit Sicherheit sehr gefährlichen Auftrag in Haiti segnen, ähnlich einem Priester vor der Schlacht die Soldaten. Der grinste schief zurück.
»Für Heinz.«
*
Die Air France brachte Jules über Paris und New York in die Karibik und nach Port-au-Prince. Die von der Anwaltskanzlei zusammengestellten Informationen waren in einem gut gefüllten Bundesordner untergebracht, der auf dreihundert Seiten nicht nur den Auftrag des US-amerikanischen Kunden exakt beschrieb, selbstverständlich ohne Namensnennung, sondern auch alle Umstände, wie Heinz in Haiti vorgehen sollte und welche Kontakte er dort besaß. Daneben war umfangreiches Material zur bewegten Geschichte dieses Landes und zu den Besonderheiten der aktuellen Politik und der Wirtschaft vorhanden. Bereits 1791 kam es zu Sklavenaufständen, gefolgt von französischer Besatzung und Bürgerkrieg. 1804 wurde in Haiti die erste freie Nation Lateinamerikas ausgerufen. Doch der Kampf um die Macht zwischen den fünf Prozent Mulatten, die sich als eigentliche Herrschaftsklasse sahen, und den über neunzig Prozent Schwarzen, dauerte über viele Jahrzehnte an, schien sogar bis in die Neuzeit das Zusammenleben zu stören. Nach der über dreißig Jahre andauernden Diktatur der Duvaliers ernannte sich vor zwei Jahren General Namphy zum Präsidenten und ließ eine neue Verfassung mit Präsidialsystem, einem Abgeordnetenhaus und einem Senat ausarbeiten. Doch die Wahlen 1987 mussten abgebrochen werden, weil die immer noch zahlreichen Duvalier-Anhänger alle wahlwilligen Bürger bedrohten und manche sogar ermordeten. Der dann im Januar 1988 gewählte Präsident Manigat war eher eine Marionette der Armeeführung und stand von Beginn an auf wackligen, politischen Füssen. Jederzeit konnte das Militär erneut die Macht an sich reißen und so war Haiti derzeit ein wahrer Hexenkessel, in dem die Armeeführung, Duvalier-Anhänger und viele andere Parteien und Politiker kräftig rührten und sich darum niemand um das organisierte Verbrechen kümmerte oder sich gar mit ihm wirtschaftlich verband.
Jules las auf dem langen Flug die Informationen mehrmals durch, dachte nach, strich in Gedanken auf der Liste seiner möglichen Kontakte in Port-au-Prince alle Namen bis auf einen. Nelson Sloanne Larue hatte für Lenz & Karrer in Washington gearbeitet, war vor zwei Jahren in die Heimat zurückgekehrt und hatte eine Bar direkt am Hafen eröffnet. Ihn wollte Jules als einzigen aufsuchen, versprach sich von ihm nicht nur Informationen über die Stadt, sondern vor allem auch Verschwiegenheit und damit Sicherheit vor der Polizei und anderen Interessengruppen.
Die Kanzlei hatte für ihn ein Zimmer im Hotel Oloffson reserviert, wo bereits Heinz Keller untergebracht war und ermordet wurde. Jules dachte jedoch keinen Moment lang daran, dort auch tatsächlich abzusteigen. Stattdessen hatte er sich auf JFK einen Reiseführer gekauft und sich selbst kundig gemacht.
Nachdem er seinen Koffer vom Transportband genommen und auf das Wägelchen gestellt, dieses an anderen Passagieren und am Zoll vorbei dirigiert hatte, übersah er bewusst den dunkelhäutigen Mann im schwarzen Billig-Anzug und der Chauffeur-Mütze, der mit einem Kartonschild in der Hand auf ihn wartete und alle ankommenden Fluggäste kurz musterte. Jules warf einen gelangweilten Blick auf seinen Namen, ließ seine Augen gleich weiterwandern, wurde vom Anzug-Mann nicht mehr beachtet. Draußen stieg er ins nächste freie Taxi und nannte die Adresse. Der Mann sprach nur ein paar Brocken Französisch oder war an einer Unterhaltung nicht interessiert. Jedenfalls kam auf der kurzen Fahrt hinauf in die Hügel kein Gespräch auf. Wie gewünscht hielt der Wagen vor der Casa Emanuela Grandis, einem einfachen Bed & Breakfast und Jules bekam wenig später ein spartanisch eingerichtetes, kleines, aber sehr sauber gehaltenes Zimmer, hatte beim Einchecken zudem eine Broschüre mit Stadtplan überreicht erhalten. Der Weg hinunter zum Hafen war recht weit und Jules benötigte für ihn zu Fuß eine gute halbe Stunde, stand dann aber vor der Miracles Bar und schüttelte seinen Kopf, denn sie lag nicht am Hafen, wie in den Unterlagen von Lenz & Karrer vermerkt, sondern mehrere hundert Meter entfernt in der Innenstadt.
Was stimmte wohl noch alles nicht an all den zusammengetragenen Informationen im Dossier der Kanzlei?, fragte sich Jules unweigerlich, als er mit den Händen die Perlenketten vor dem Eingang teilte und ins Halbdunkel eintrat. Viel los war nicht an diesem späten Nachmittag. Zwei sehr dunkelhäutige junge Männer saßen an einem der Tischchen so nahe beisammen, dass sie sich flüsternd unterhalten konnten. Eine immer noch hübsche Frau von vielleicht Mitte dreißig stand hinter dem Tresen und taxierte ihn, den braungebrannten und trotzdem weißhäutigen Europäer, der sich wahrscheinlich hierher verlaufen hatte. Jules nickte ihr wie entschuldigend zu und setzte sich auf einen der Hocker, stellte seine Ellbogen auf die Platte, lächelte die Barkeeperin gewinnend an.
»Hi, einen Daiquiri, please?«
Jules hatte sich für Englisch entschieden. Zwar sprach er Französisch wie eine zweite Muttersprache. Doch eines hatte ihm Roger Spälti noch am Abend zuvor eingebläut: »Lass dich deine Feinde und auch deine Freunde stets so lange wie nur möglich unterschätzen. Mit offenen Karten spielen bloß Idioten, Bluffer und Verlierer.«
»War das eine Frage oder eine Bestellung?«, kam es in erstaunlich gutem Englisch zurück. Die Frau hinter dem Tresen lächelte nicht dazu, blickte ihren neuen Gast sogar recht abweisend oder missbilligend an.
»Eine Bestellung«, meinte Jules immer noch lächelnd, »doch ich hätte tatsächlich eine Frage«, wobei er seine Stimme senkte, um die Frau näher zu sich zu locken und vertraulicher mit ihr reden zu können. Doch sie blieb stehen, wo sie war, machte auch keine Anstalten, seinen Cocktail zu mischen, verschränkte ihre Arme vor der Brust.
»Ist Nelson Larue zu sprechen?«, fragte Jules deshalb lauter, als er es gerne getan hätte.
»Nelson Sloanne Larue«, berichtigte ihn die Barkeeperin und er nickte zustimmend.
»Um was geht es?«, kam die Gegenfrage nun scharf zurück.
»Das möchte ich nur mit Nelson direkt besprechen.«
Die Augen der Frau schweiften kurz hinüber zum Tisch mit den beiden jungen Männern, dann schwenkte ihr Kopf kurz in Richtung Ausgang. Die zwei erhoben sich sogleich und gingen hinaus, stellten sich jedoch links und rechts neben dem Eingang auf, so als müssten sie ihn bewachen. Jules schluckte trocken, fühlte ein mulmiges Gefühl im Magen, auch wenn er keine Gefahr oder Feindseligkeit spürte.
»Was wollen Sie von mir?«, fragte die Frau.
»Von Ihnen?«, meinte Jules erstaunt.
»Ja, Sie suchen nach mir?«
Der Schweizer starrte die Frau dämlich an, worauf sie das erste Mal lächelte, wenn auch spöttisch: »Nelson JOANNE Larue. Kapiert?«
Jules nickte.
»Also?«
Ohne seine Antwort abzuwarten, begann sie nun doch seinen Daiquiri zu mischen.
»Ich komme von Lenz & Karrer.«
»Sie sind wegen Heinz Keller hier?«
»Ja und nein«, wich der Schweizer aus, worauf ihn die Frau forschend musterte.
»Ich will zwar die Schwierigkeiten beseitigen, wegen denen Heinz sterben musste, aber auch seinen Mörder finden. War Heinz denn öfters hier bei Ihnen Gast?«
Nelson Joanne nickte: »Ja, das letzte Mal an dem Abend als er ermordet wurde.«
Die Frau schien bedrückt. Machte sie sich Vorwürfe? Hatte sie seinen Kollegen womöglich falsch beraten? Hatte sich an seinem Tod schuldig gemacht? Oder steckte sie weit tiefer in der Sache drin, als Lenz & Karrer vermuteten? War sie weniger Informantin als vielmehr Mitglied der lokalen Erpresser-Mafia? Eine Mittäterin?
Auch wenn Jules die Erfahrung fehlte. Von dieser Frau ging keine Falschheit aus. Er fühlte nur Anteilnahme und ein gewisses Interesse.
»Können Sie mir denn weiterhelfen? Wissen Sie, wer hinter der Ermordung steckt? Kennen Sie vielleicht sogar die Täter? Man hat mir gesagt, Heinz wurde im Aufzug im Hotel Oloffson erdrosselt. Sind seine Mörder dort zu suchen? Unter den Angestellten?«
Nun blickte ihn Nelson Joanne mitleidig an, nahm ihre Unterlippe zwischen die Zahnreihen, fragte sich wahrscheinlich, ob sie diesem so naiv wirkenden Europäer etwas erzählen sollte. Jedenfalls spürte Jules eine gewisse Abneigung, aber nicht unbedingt gegen seine Person, sondern eher gegen seine Frage.
»Das Oloffson besitzt gar keinen Aufzug«, gab sie ihm dann doch eine Information, auf die er bei einem Besuch des Hotels von selbst gestoßen wäre. Jules schaute irritiert.
»Wussten Lenz & Karrer wirklich nichts Besseres, als einen weiteren Welpen nach Port-au-Prince zu schicken und zu verheizen?«, fügte sie etwas boshaft oder womöglich auch frustriert hinzu. Der Schweizer fühlte sich gekränkt und gleichzeitig herausgefordert, warf sich in die Brust.
»Sie unterschätzen mich vielleicht.«
Nelson Joanne taxierte ihn noch einmal, sah ihm für Sekunden tief in die Augen, schien seine Seele zu erkunden oder auch nur seine Entschlossenheit.
»Ja, das ist möglich«, schloss sie ihre Untersuchung ohne konkretes Ergebnis ab. Doch zumindest war leichter Zweifel herauszuhören. Sie stellte den fertigen Daiquiri vor ihm hin, nahm sich selbst ein Wasserglas und füllte zwei fingerbreit Havanna Club ein, prostete ihm zu.
In der folgenden halben Stunde erfuhr Jules alles, was Nelson Joanne über den Verkäufer der drei Hotelanlagen wusste, über die örtliche Immobilien-Mafia und deren Verbindungen in die höchsten Kreise des Militärs. Auch über drei mächtige Straßengangs, bei denen man fast beliebig Auftragsmorde bestellen konnte, wurde er eingehend informiert.
»Ich weiß nicht, warum die Zentrale in Washington einen so unerfahrenen Mann wie Heinz Keller hierhergeschickt hat. Er war der Aufgabe schlichtweg nicht gewachsen. Mit seinem Auftreten verunmöglichte er von Anfang an jede vernünftige Lösung.«
»Mein Mentor bei Lenz & Karrer hat gemeint, Heinz wurde möglicherweise nur als eine Art Warnung ermordet«, stocherte Jules nach.
»Und wer ist ihr Mentor?«
»Roger Spälti. Kennen Sie ihn vielleicht?«
»Ich lernte ihn vor Jahren kennen, als ich noch in Washington arbeitete. Hätte ich gewusst, dass Spälti Ihr Mentor ist, ich hätte Sie wohl etwas freundlicher empfangen.«
Jules registrierte, dass sie seinen Mentor beim Nachnamen nannte. Wahrscheinlich hatten die beiden also nie ein Verhältnis miteinander, noch nicht einmal besonders engen Kontakt.
»Meiner Meinung nach wurde Heinz Keller ermordet, um den US-Investor zu einem raschen Nachgeben zu zwingen.«
»Und warum die Eile?«
Nelson Joanne lachte trocken, beinahe gehässig auf: »Unser neuer Präsident, Leslie Manigat, hat bereits damit begonnen, den Einfluss des Militärs zurückzudrängen. Falls ihm dies gelingen sollte, werden die örtlichen Mafia-Gruppierungen bald einmal nicht mehr an die Generäle zahlen…«
»…sondern an die neuen politisch Mächtigen?«, schloss Jules die Erklärung von Nelson Joanne gleich selbst ab. Sie nickte zustimmend.
»Der arme Heinz. Er kam zwischen Hammer und Amboss, geriet zwischen die Interessen der Armee und der Politiker. Zwei Tage vor seiner Ermordung schlug er sich mit einer Straßengang herum und verprügelte drei oder vier der Kerle. Er dachte wohl, damit hätte er sich erst einmal Respekt verschafft.«
»Hatten Sie und Heinz etwas miteinander?«, rutschte Jules ungewollt eine peinliche Frage heraus. Nelson Joanne war ihm aber nicht böse, lächelte sogar nachsichtig: »Heinz war ein feiner Kerl, aber nicht mein Typ.«
Fast hätte Jules sie nun gefragt, ob vielleicht eher er ihrer Vorstellung entsprach, konnte sich diesmal aber zurückhalten. Doch das amüsierte Lächeln von Nelson Joanne bewies ihm, dass sie den mit ihrer Antwort wohl bewusst provozierten Gedanken in seinem Gehirn von seinem Gesicht abgelesen hatte.
»Dann steckt Ihrer Meinung nach also das Militär hinter der Ermordung meines Kollegen?«
Jules erwähnte den Namen bewusst nicht mehr, versuchte so Distanz zwischen Nelson Joanne, Heinz Keller und sich selbst aufzubauen.
»Mit Sicherheit. Denn nur die Armee und der Geheimdienst verfügen über genügend Macht, um den Mord an einem Ausländer derart zu verfälschen. Und der Geheimdienst dürfte längst für Präsident Manigat arbeiten.«
»Und wer hätte beim Militär genügend Macht für eine Verfälschung? Können Sie mir einen Namen nennen?«
Nelson Joanne lächelte erneut mitleidig.
»Von wem wird denn die Armee befehligt?«, fragte sie anzüglich zurück.
»Namphy?«, vergewisserte sich Jules und die Frau nickte leicht.
Die Schultern des jungen Schweizers sanken etwas ein. Wie sollte er den Oberbefehlshaber der Armee zur Rechenschaft ziehen? An ihn heran kam er mit Sicherheit nicht. Falls aber General Namphy tatsächlich die Ermordung von Heinz Keller zu verantworten hatte, machte es kaum Sinn, an seiner Stelle irgendwelche untergeordneten, ausführenden Schergen aufzuspüren und zu bestrafen.
»Wollen Sie immer noch Rache nehmen?«
Nelson Joanne meinte ihre Frage zumindest diesmal nicht etwa sarkastisch, sondern schien durchaus an der Antwort interessiert.
»Haben Sie etwa Beweise für eine Beteiligung von General Namphy?«
Sie lachte kurz und laut auf.
»Wer in Haiti lebt, braucht keine Beweise, erfährt die Macht und die Gewalt der Militärs jeden Tag, kennt ihre engen Verbindungen zur Mafia, ihre Beteiligung an Schutzgelderpressungen, ihre Förderung der Korruption.«
»Das ist mir zu wenig.«
Erneut lachte Nelson Joanne auf, diesmal hell und anzüglich: »Ja, Mister, Sie haben sich Ihren Auftrag bestimmt simpler vorgestellt.«
»Genauso wie Heinz Keller?«, fügte Jules an und die Frau hinter dem Tresen nickte.
»Sie sollten wieder abreisen. Richten Sie Spälti aus, dass der US-Bonze die geforderte Summe einfach bezahlen soll und gut ist. Oder er soll seine Idee einfach vergessen.«
Jules zögerte mit einer Antwort, worauf Nelson Joanne weiterfuhr: »So laufen die Geschäfte nun mal hier in Haiti. Wer sich damit nicht abfinden kann, soll wegbleiben oder er muss sich eine eigene Armee mitbringen.«
Nachdenklich erhob sich Jules, dankte der Frau und wollte gehen.
»Zwei US-Dollar«, rief sie ihn zurück und er blieb irritiert stehen, sah auf das fast leere Glas mit dem Rest vom Daiquiri, kam zurück und legte eine 5-Dollar-Note auf den Tresen.
»Darf ich wiederkommen?«, fragte er sie dann doch noch und schaute die Frau aufmerksam an.
»Dies ist zwar kein freies Land, aber zumindest ein öffentliches Lokal«, gab sie vage und auch schnippisch zurück.
Das Oloffson stellte sich wenig später als imposanter, aber ziemlich heruntergekommener Bau heraus. Auch im Innern stieß man überall auf Erneuerungsbedarf. Verschlissener, fleckiger Teppichboden, zerkratztes Parkett, schmutzige Wände und herab rieselnder Putz. Die Mitarbeitenden allerdings waren ausgesprochen freundlich und zuvorkommend. Sie zeigten auch den seltsamen Stolz von Menschen, die sich selbst als unbedeutend einstuften, jedoch ihrer Meinung nach für etwas Bedeutendes arbeiteten, auch wenn dessen ehemaliger Glanz längst verloren gegangen war und nur noch aus Erinnerungen bestand. Jules gab sich als Tourist aus, der im Reiseführer vom historischen Hotel gelesen hatte. Eifrig wurde er von einem livrierten Kellner im Erdgeschoss herumgeführt, bekam Erklärungen zu den Räumen und der Geschichte des Hauses. Er bedankte sich mit einer 5-Dollar-Note und verließ das Hotel, schlenderte die Straßen hinauf und zurück zum Bed & Breakfast, kaufte sich unterwegs an einem Straßenstand zwei Hot Dogs, schlenderte nachdenklich weiter, kaute geistesabwesend, ließ die Informationen von Nelson Joanne und seine bisherigen, persönlichen Eindrücke von Land und den Leuten ineinanderfließen, versuchte sich an einem Gesamtbild. Die Dämmerung setzte ein, die Leute gingen nach Hause, Passanten und Fahrzeugverkehr nahmen in den Straßen rasch ab. Nur unbewusst hörte der Schweizer ein Motorrad hinter sich aufheulen, registrierte beinahe zu spät den geplanten Überfall, drehte seinen Kopf fast im letzten Moment herum, erkannte den geschwungenen Baseballschläger in der Hand des Beifahrers, ließ sich instinktiv rückwärts zu Boden fallen, sah den Keulenkopf undeutlich an seinem Gesicht vorbei wischen, rappelte sich rasch wieder auf, sah das Motorrad stoppen und die beiden Männer absteigen und drohend auf ihn zukommen.
»Money … Money«, befahl ihm der eine Kerl mit schauderhaftem, französischem Akzent, schwang dazu drohend die Keule, während der andere bloß fordernd seine Hand ausstreckte. Jules ließ die beiden noch etwas näher herankommen, versuchte sich an einem ängstlich wirkenden Gesichtsausdruck, kramte nervös in seinen Jackentaschen, so als suchte er nach Geld. Doch dann tauchte er unvermittelt unter den erhobenen Armen mit dem Baseballschläger durch und knallte dem Kerl seinen rechten Unterarm gegen die Kehle, packte ihn beim Herumwirbeln mit der anderen Hand am Hals und brachte ihn so aus dem Gleichgewicht, zerrte ihn zu Boden, stellte seinen linken Fuß auf dessen Gurgel und sah den Motorradfahrer wild an, rief ihm ein Verächtliches »Allez, balourd!« zu.
Der blickte noch einmal kurz zu seinem Kumpanen am Boden, der verzweifelt versuchte, den Fuß von Jules wegzustoßen, sah dem vermeintlichen Opfer die Selbstsicherheit an und dass dieser bestimmt noch weitere Tricks kannte. Zögernd und umsichtig wich er zurück, bis er sich auf den Sitz schwingen und das Motorrad starten konnte. Er drehte um und brauste an Jules und seinem Kumpanen vorbei die Straße hinunter, ließ eine langgezogene, blaue Abgaswolke zurück.
Der Schweizer ließ den anderen Kerl nun endlich los, ging hinüber zur fallengelassenen Keule, hob sie auf und zerbrach sie über seinem Oberschenkel, warf die beiden Teile im weiten Bogen die Straße hinunter. Danach ging er seelenruhig weiter, kümmerte sich nicht weiter um den Angreifer, der sich aufgesetzt hatte und sich immer noch keuchend den Hals rieb.
Nein, keinen Moment lang dachte Jules an einen geplanten Angriff irgendeines Widersachers. Er hatte sich bloß dämlich wie ein Tourist angestellt, war bei einbrechender Dunkelheit immer noch zu Fuß unterwegs gewesen, von jedermann sogleich als Ausländer erkennbar, hatte zudem seine Gedanken ganz woanders gehabt, war zu offensichtlich als ein wehrloses Opfer erschienen.
Der Schweizer hatte allerdings den jungen Mann übersehen, der immer noch im Schatten der Häuser verharrte und zuvor dem Überfall unbeweglich, aber interessiert zugeschaut hatte. Erst als Jules weit genug entfernt war, trat er zurück auf den Gehsteig und schlenderte nachdenklich in Richtung Hafen davon.
*
Auch am nächsten Morgen beim Frühstück hatte sich Jules noch nicht entschieden. Wie unvernünftig doch sein Zorn über den Tod von Heinz war, die dumm sein Anspruch, hierher in dieses ihm völlig fremde Land zu reisen, um den Mord an einem Kollegen zu rächen und die Probleme der Kanzlei zu lösen.
Stolz war in den meisten Situationen ein schlechter und gefährlicher Ratgeber, vor allem wenn man die jeweilige Kultur des Stolzes gar nicht kannte. Denn Stolz verspürten alle Völker der Erde und die allermeisten Menschen. Doch worauf sich dieser Stolz bezog, war sehr unterschiedlich. Im Westen bildeten oft Geld und Macht, aber auch bloße Überheblichkeit die Grundlagen. In arabischen Ländern waren Herkunft und persönliche Ehre entscheidend, während in afrikanischen und asiatischen Regionen die Familie das wichtigste Statussymbol nach außen hin blieb. Doch hier in der Karibik? Aufgrund ihrer Geschichte hatten die Einheimischen bestimmt einen natürlichen Stolz gegenüber allen Ausländern entwickelt, trotz jahrzehntelanger Diktatur, trotz anhaltender Ausbeutung und trotz fehlenden oder zumindest höchst mangelhaften staatlichen Institutionen und sozialen Netzen. Denn ähnlich wie die kleine Schweiz, hatten sich auch die Haitianer von den Fesseln ausländischer Mächte mit Gewalt befreit, hatten sich den Respekt der Welt verdient und sich ihren eigenen, wenn auch steinigeren Weg gesucht.
Jules dachte an die Verkaufsstände an den Straßen, an denen für wenige haitianische Cent Lehmkuchen verkauft wurden. Auch das Rezept dieser Hungerunterdrücker fand er in den Unterlagen der Kanzlei, diesmal ihm als dringende Warnung dienend. Unter ein Kilogramm Lehm wurden fünf Gramm Salz und hundert Gramm billigste Margarine mit etwas Wasser gemischt und der so entstandene Brei an der Luft getrocknet. Giftig waren die Dinger in der Regel zwar nicht und sie erfüllten durchaus ihren Zweck, gaukelten dem Magen ein Völlegefühl vor, das über Stunden anhielt, während der Körper trotzdem weiter hungerte. Auch das Fleisch in den Würstchen der beiden verzehrten Hot Dogs am gestrigen Abend war nicht über jeden Zweifel erhaben gewesen. Doch sie schwammen zuvor in sauber aussehendem und vor allem dampfend heißem Wasser. Ab 70 Grad Celsius wurden fast alle Bakterien abgetötet, wie Jules wusste, und nur noch wenige giftige Pilzsporen konnten sich bei diesen Temperaturen vermehren. Das Brot allerdings war matschig gewesen, obwohl bestimmt am selben Tag gebacken. Doch in der Schwüle des Tages verdarben Mehlprodukte rasch. Einen US-Dollar hatte man ihm für die beiden eher missglückten Sattmacher abgeknöpft, ein Wucherpreis verglichen mit dem, was die Einheimischen bezahlten, ein Bettelgeld jedoch für jeden Touristen und trotzdem eher ein Magenbetrug und bestimmt keine Gaumenfreude.
Seine Gastgeberin, Emanuela Grandis, eine füllige Mulattin mit gewaltigen Hängebrüsten und einem runden, gemütlichen Gesicht mit warmherzigen Augen, setzte sich zu ihm, als Jules am nächsten Morgen als letzter Frühstücksgast noch am Tisch bei seiner zweiten Tasse Tee saß.
»Haben Sie für heute besondere Pläne, Monsieur?«, fragte sie in einem leidlichen Englisch mit dem weichen Akzent vieler Französisch-Muttersprachlichen und der Betonung der letzten Silbe in fast allen Wörtern.
»Nein, Madame Grandis, das heißt, ich habe mich noch nicht entschieden.«
»Sie sollten ein paar unserer Museen besuchen. Und selbstverständlich auch die Kathedrale«, wollte sie weitere Informationen über den Grund des Aufenthalts ihres seltsamen Gastes herausfinden, der sich gestern ohne jede Reservierung von einem Taxi direkt hierherfahren ließ und dem die Höhe des Zimmerpreises völlig egal schien.
Jules musste lächeln.
»Vielleicht könnten Sie mir ein wenig von Ihrem schönen Land und den Menschen erzählen?«
Die Mulattin sah ihn prüfend an. Die Flügel ihrer breiten Nase blähten sich für einen Moment auf. Sie ahnte wohl ein Geheimnis, zumindest etwas Ungewöhnliches und einige Aufregung Versprechendes.
»Was möchten Sie denn gerne erfahren?«
»Was wissen Sie über General Namphy? Oder Präsident Manigat?«
Emanuela Grandis sog scharf die Luft durch ihre Nase ein und ihr Gesichtsausdruck wechselte von fröhlich zu vorsichtig.
»General Namphy hat uns den Frieden gebracht. Er wurde zum Vater aller Haitianer. Und Präsident Manigat? Er ist ein Unruhestifter. Ich habe ihn nicht gewählt. Wussten Sie, dass er vor Jahren in Venezuela lebte und von dort aus Pläne schmiedete, um die Macht in Haiti mittels Staatsstreich an sich zu reißen? Ich traue keinem Menschen, der nicht einmal vor dem Einsatz von Gewalt zurückschreckt.«
»Und General Namphy ist nicht gewalttätig?«