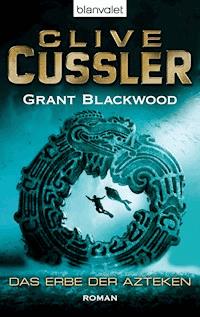
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Fargo-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Die Schatzjäger Sam und Remi Fargo entdecken bei einem Tauchgang Teile eines aztekischen Artefakts – und befinden sich plötzlich im Visier der ultranationalistischen und skrupellosen mexikanischen Partei Mexica Tenochca. Denn hinter dem Fund verbirgt sich ein Geheimnis, das diese völlig ruinieren würde. Eine gnadenlose Hetzjagd rund um die Welt beginnt. Sam und Remi Fargo wissen, dass nur einer das Rennen gewinnen kann – und dass ihr Versagen nichts als den Tod bringen würde!
Archäologie, Action und Humor für Indiana-Jones-Fans! Verpassen Sie kein Abenteuer des Schatzjäger-Ehepaars Sam und Remi Fargo. Alle Romane sind einzeln lesbar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
& Grant Blackwood
Das Erbe
der Azteken
Ein Fargo-Roman
Aus dem Englischen von Michael Kubiak
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Lost Empire« bei Putnam, New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen
der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © 2010 by Sandecker RLLLP
By arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176 – 0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Blanvalet Verlag,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Rich Carey/Shutterstock.com
und Maximilian Meinzold
Redaktion: Jörn Rauser
HK · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-15180-5
www.blanvalet.de
Prolog
London, England, 1864
Der Mann, den alle nur als Jotun kannten, schritt zielstrebig durch den morgendlichen Nebel, den Kragen seiner Kapitänsjacke hochgeschlagen und einen Schal locker um Hals und Mund geschlungen. Sein Atem bildete eine weiße Wolke in der kalten Luft.
Plötzlich blieb er stehen und lauschte. Hatte er Schritte gehört? Er drehte den Kopf erst nach links, dann nach rechts. Irgendwo vor ihm erklang ein gedämpftes Klicken. Ein Stiefel auf dem Kopfsteinpflaster. Obwohl schwer und hochgewachsen, zog sich Jotun schnell und leichtfüßig in den Schatten eines gewölbten Toreingangs zurück. In der Tasche seiner Jacke schloss sich seine Faust um den Griff eines mit Bleischrot gefüllten Totschlägers aus Leder. Die Seitenstraßen und Gassen von Tilbury waren niemals ein freundlicher Ort und erst recht nicht zwischen Sonnenuntergang und -aufgang.
»Verdammte Stadt«, knurrte Jotun. »Dunkel, feucht, kalt. Lieber Gott, hilf.«
Ihm fehlte seine Frau, ihm fehlte sein Land. Aber hier wurde er gebraucht, jedenfalls meinten das jene, die ganz oben saßen. Er vertraute natürlich ihrem Urteil, doch es gab Zeiten, da hätte er seinen augenblicklichen Dienst bereitwillig gegen ein offenes Schlachtfeld eingetauscht. Dort würde er seinen Gegner wenigstens sehen und kennen – und wüsste, was er mit ihm zu tun hätte: Er würde ihn töten oder selbst getötet werden. Ganz einfach. Andererseits gefiel seiner Frau, obgleich weit entfernt von ihr, sein augenblicklicher Einsatzort viel besser als seine früheren. »Lieber in der Ferne und am Leben als in der Nähe und tot«, hatte sie zu ihm gesagt, nachdem er seine Befehle erhalten hatte.
Jotun wartete einige Minuten, hörte jedoch keine weiteren Geräusche. Er sah auf seine Uhr: halb vier. In einer Stunde würde es auf den Straßen lebendig werden. Wenn sich sein Jagdwild aus dem Staub machen wollte, dann müsste es vorher geschehen.
Er kehrte auf die Straße zurück und ging weiter nach Norden, bis er zur Malta Road kam und die Richtung nach Süden zu den Docks einschlug. In der Ferne konnte er das einsame Scheppern einer Boje hören, außerdem drang ihm der Gestank der Themse in die Nase. Ein Stück voraus, im Nebel, konnte er eine einsame Gestalt erkennen. Sie stand am südöstlichen Ende der Dock Road und rauchte eine Zigarette. Auf Katzenpfoten überquerte Jotun die Straße und ging weiter, bis er die Straßenecke deutlicher ausmachen konnte. Der Mann war tatsächlich allein. Jotun zog sich in die Gasse zurück, dann stieß er einen einzigen leisen Pfiff aus. Der Mann wandte sich um. Jotun zündete mit dem Daumennagel ein Streichholz an, ließ es kurz auflodern und löschte die Flamme sofort wieder mit Daumen und Zeigefinger. Der Mann kam auf Jotun zu.
»Guten Morgen, Sir.«
»Darüber lässt sich streiten, Fancy.«
»Das stimmt, Sir.« Fancy ließ den Blick über die Straße schweifen.
»Nervös?«, fragte Jotun.
»Was, ich? Weshalb sollte ich nervös sein? Ein kleiner Mann wie ich, der bei Nacht durch diese Gassen schleicht? Was könnte daran nicht in Ordnung sein?«
»Dann lass mal hören.«
»Es ist dort, Sir. Vertäut am Pier, und das schon seit vier Tagen. Allerdings nur noch mit je einer Leine an Heck und Bug. Ich habe mit einem Kumpel gesprochen, der unten im Hafen gelegentlich Handlangerdienste übernimmt. Es heißt, das Schiff werde flussaufwärts fahren.«
»Wohin?«
»Zu den Millwall Docks.«
»Die Millwall Docks sind noch nicht fertig, Fancy. Warum belügst du mich?«
»Nein, Sir, das ist das, was ich gehört habe. Millwall. Am späten Morgen.«
»Ich hab schon jemanden in Millwall, Fancy. Er sagt, der Hafen sei für mindestens eine weitere Woche geschlossen.«
»Tut mir leid, Sir.«
Jotun hörte das typische Scharren von Leder auf Stein hinter sich in der Gasse und begriff sofort, dass Fancy etwas ganz anderes leidtat. Jotun tröstete sich ein wenig mit dem Wissen, dass ihn dieses kleine Wiesel von einem Mann wahrscheinlich nicht aus Tücke, sondern eher aus Habgier verraten hatte.
»Nimm die Beine in die Hand, Fancy. Renn weit weg. Ganz aus London raus. Wenn ich dich noch einmal sehe, schlitz ich dir den Bauch auf und stopf dir deine eigenen Eingeweide ins Maul.«
»Sie werden mich nie wiedersehen, Sir.«
»Das wäre auch besser, wenn dir dein Leben lieb ist.«
»Noch einmal, es tut mir leid. Ich habe Sie immer …«
»Noch ein Wort, und es wird dein letztes sein. Geh.«
Fancy rannte los und verschwand im Nebel. Jotun ging seine Möglichkeiten schnell durch. Dass Fancy ihn mit den Millwall Docks belogen hatte, bedeutete, dass er auch beim Schiff gelogen hatte, was wiederum bedeutete, dass es flussabwärts fuhr und nicht flussaufwärts. Das konnte er unmöglich zulassen. Daraus ergab sich die Frage: War es klüger, vor den Männern zu fliehen, die hinter ihm her waren, oder sich auf einen Kampf mit ihnen einzulassen? Wenn er flüchtete, würden sie ihn jagen, und das Letzte, was er jetzt brauchte, war ein Krawall so nahe am Hafen. Die Schiffsmannschaft war sicherlich längst nervös geworden und entsprechend wachsam – dabei brauchte er sie vollkommen ruhig und ahnungslos, um sie unvorbereitet zu überrumpeln.
Jotun wandte sich zur Gasse um.
Sie waren zu dritt, einer ein wenig kleiner als er, zwei sehr viel kleiner, aber alle hatten breite, runde Schultern und darauf kantige, bullige Köpfe. Straßenräuber. Halsabschneider. Hätte das Licht ausgereicht, um ihre Gesichter deutlicher zu erkennen, nahm Jotun an, dass sie nur noch wenige Zähne, zahlreiche Narben und kleine, bösartige Augen gehabt hätten.
»Guten Morgen, Gentlemen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?«
»Mach das Ganze nicht schlimmer, als es sein muss«, erwiderte der Größere des Trios.
»Messer oder Fäuste oder beides?«, fragte Jotun.
»Was?«
»Egal. Es ist eure Wahl. Nun kommt schon, fangen wir endlich an.«
Jotun zog die Hände aus den Taschen.
Der Große stürmte los. Jotun sah das Messer an der Hüfte des Mannes hochschnellen, ein präzise berechneter Stoß, um eine Arterie im Oberschenkel zu durchtrennen oder den Unterleib aufzuschlitzen. Jotun war jedoch nicht nur fünf Zentimeter größer als der Mann, sondern hatte auch zehn Zentimeter mehr Armeslänge, und die benutzte er, indem er mit einem Uppercut reagierte. In der letzten Sekunde öffnete er die Hand und ließ den Totschläger herausschießen. Das in Leder eingenähte Bleischrot traf den Mann genau unterm Kinn. Sein Kopf wurde hochgerissen, er stolperte rückwärts gegen seine Partner und landete dann hart auf dem Hintern. Das Messer rutschte klirrend über das Pflaster. Jotun machte einen langen Schritt vorwärts, zog ein Knie bis zur Hüfte hoch und rammte den Absatz seines Stiefels auf den Knöchel des großen Mannes und zertrümmerte den Knochen. Der Mann schrie vor Schmerzen auf.
Die beiden anderen zögerten zwar, aber nur für einen kurzen Augenblick. In Situationen wie diesen zerstreut sich ein solches Wolfsrudel gewöhnlich, sobald der Leitwolf ausgeschaltet wurde, aber diese Männer waren daran gewöhnt, leichtes Spiel zu haben.
Der auf der rechten Seite wich seinem gefallenen Partner aus, duckte sich und stampfte los wie ein Stier. Der Angriff war natürlich eine Finte. In einer der Hände hielt er ein Messer versteckt; in dem Moment, in dem Jotun den Mann packte, würde das Messer hochkommen. Jotun machte mit dem linken Bein einen Schritt rückwärts, beugte es und vollführte dann einen Satz vorwärts, während er gleichzeitig mit dem rechten Fuß ausholte und ihn nach vorn schwang. Der Tritt erwischte den Mann mitten im Gesicht. Jotun hörte das gedämpfte Knirschen brechender Knochen. Der Mann sackte auf die Knie, schwankte für einen kurzen Moment hin und her und stürzte dann mit dem Gesicht zuerst auf die Straße.
Der letzte Mann dachte nicht daran zu zögern, und Jotun erkannte, auf was er wartete: auf jenen entscheidenden Moment, in dem jemand erkennt, dass er sterben wird, wenn er nicht die richtige Entscheidung trifft.
»Die beiden leben noch«, sagte Jotun. »Wenn du nicht kehrtmachst und abhaust, töte ich dich.«
Der Mann stand wie festgewurzelt da, das Messer stoßbereit in der Hand.
»Nun komm schon, mein Sohn, haben sie dir wirklich genug dafür gezahlt?«
Der Mann ließ das Messer sinken. Er schluckte krampfhaft, schüttelte dann ruckartig den Kopf, machte kehrt und rannte los.
Jotun rannte ebenfalls. Und zwar so schnell er konnte die Straße hinunter, in die Dock Road, dann quer durch einige Zierhecken und an der St. Andrews Church vorbei. Durch eine kurze Gasse erreichte er ein Paar Lagerhäuser. Er eilte zwischen ihnen hindurch, setzte über einen Zaun hinweg, landete hart und rollte sich über die Schulter ab, kam wieder auf die Füße und rannte weiter, bis unter seinen Stiefeln das dumpfe Dröhnen von Holz erklang. Der Hafenkai. Er blickte nach links, dann nach rechts, sah jedoch nichts als Nebel.
Wohin?
Er drehte sich um, las die Hausnummer über seinem Kopf, dann machte er auf dem Absatz kehrt und spurtete fünfzig Meter weiter nach Süden. Zu seiner Rechten hörte er Wasser plätschern, steuerte darauf zu. Ein dunkler Schatten ragte vor ihm auf. Er bremste, prallte gegen einen Kistenstapel, stolperte zur Seite und gewann sein Gleichgewicht zurück. Dann sprang er auf die kleinste Kiste und kletterte schließlich eine Etage höher. Etwa zwanzig Meter unter seinem Standplatz konnte er eine Wasserfläche erkennen. Er schaute flussaufwärts, erkannte dort aber nichts. Dann blickte er den Fluss hinab.
In zwanzig Metern Entfernung gewahrte er den matten Schein eines gelben Lichts hinter einem zweiflügeligen Fenster; darüber, hinter der Deckreling, befand sich das Ruderhaus eines Schiffes.
»Verdammt!«, schimpfte Jotun lauthals. »Gottverdammter Mist!«
Das Schiff verschmolz gerade mit dem Nebel und verschwand.
1
Chumbe Island, SansibarTansania
Die Haie schossen am Rand ihres Gesichtsfeldes hin und her, schlanke graue Schatten, die Sam und Remi immer nur kurze Blicke auf messerscharfe Finnen und zuckende Schwanzflossen erlaubten, ehe sie hinter dem Vorhang wirbelnder Sandkörner verschwanden. Wie üblich hatte sich Remi diese Gelegenheit zum Fotografieren nicht entgehen lassen, und wie üblich hatte sie Sam gebeten, als Größenmaßstab herzuhalten, während sie ihre Hochgeschwindigkeits-Unterwasserkamera an ihm vorbei auf das Fressgelage richtete. Was Sam betraf, so machte er sich weniger Sorgen wegen der Haie als wegen des Abgrunds, der sich hinter ihm befand, einem fünfzig Meter tiefen Steilabfall der Sandbank, der sich in den unergründlichen Tiefen des Sansibar-Kanals verlor.
Remi ließ die Kamera sinken, lächelte mit den Augen hinter ihrer Tauchermaske und machte mit der Hand das Okay-Zeichen. Erleichtert schwebte Sam mit einem Flossenschlag zu ihr hinüber. Zusammen knieten sie im Sand und verfolgten das Schauspiel. Es war Juli, also Monsun-Zeit. Der warme Ostafrikanische Küstenstrom aus Südosten traf auf die südlichste Spitze von Sansibar und teilte sich in einen landwärts gerichteten und einen ablandigen Strom. Die Haie erhielten auf diese Weise einen Nahrungstrichter in der rund fünfunddreißig Kilometer breiten Lücke zwischen Sansibar und dem afrikanischen Festland, speziell der Küste Tansanias, da dort Schwärme von Beutefischen nach Norden wanderten. Remi nannte es ein unwiderstehliches Lebendbüfett.
Sam und Remi achteten darauf, innerhalb dessen zu bleiben, was sie die Sicherheitszone nannten. Es war der etwa fünfzig Meter breite Streifen glasklaren Wassers vor Chumbe Island. Dahinter brach der Festlandsockel ab und bildete eine Wand des Sansibar-Kanals. Die Grenze der Zone war nicht zu übersehen. Die Strömung, nirgendwo schwächer als sechs Knoten, schrammte an der Sandbank der Insel entlang und wirbelte einen dichten Sandvorhang auf. Diesen Bereich bezeichneten Sam und Remi als Goodbye-Zone; ein Schritt in diese reißende Strömung ohne Sicherheitsleine, und man begab sich unfreiwillig auf einen Trip ohne Wiederkehr an der afrikanischen Ostküste entlang.
Trotz der Gefahr – oder vielleicht sogar gerade wegen ihr – war dieser alljährliche Ausflug nach Sansibar einer ihrer liebsten. Neben Haien, Beutefischen, reißenden Strömungen und Unterwassersandstürmen, die häufig monatelang andauerten, hielt der Ostafrikanische Küstenstrom stets Schätze bereit. Allerdings waren es gewöhnlich nur kleine und unbedeutende Fundstücke, die abgesehen von ihrer Seltenheit und ihrem Fundort nichts weiter auszeichnete. Aber das reichte Sam und Remi völlig. Im Laufe der Jahrhunderte hatten ganze Schiffsflotten die afrikanische Ostküste von Mombasa bis Daressalam befahren, viele beladen mit Gold, Edelsteinen und Elfenbein für die Städte der Kolonialreiche. Unzählige Schiffe waren im Sansibar-Kanal und seiner Umgebung gesunken, wobei sich der Inhalt ihrer Frachträume auf dem Meeresboden verteilt hatte, wo er darauf wartete, von der richtigen Strömung freigelegt oder in Reichweite von neugierigen Tauchern wie den Fargos transportiert zu werden. Während ihrer alljährlichen Reisen hatten sie Gold- und Silbermünzen römischen wie spanischen Ursprungs gefunden, außerdem chinesisches Porzellan, Jade aus Sri Lanka, Tafelsilber … Ob faszinierend oder alltäglich, sie hatten es immer sorgfältig geborgen. Auf dieser Reise hatten sie bisher nur ein einziges bemerkenswertes Stück entdeckt: eine rautenförmige Goldmünze, die derart mit Muschelkalk verkrustet war, dass sie keine Einzelheiten darauf erkennen konnten.
Sam und Remi sahen den Haien noch für ein paar weitere Minuten bei ihrer Mahlzeit zu, dann, nachdem sie sich durch ein Kopfnicken miteinander verständigt hatten, kehrten sie um und glitten dicht über dem Meeresgrund nach Süden. Dabei hielten sie gelegentlich an und fächerten mit einem Pingpongschläger Sand beiseite, nämlich in der Hoffnung, dass sich der jeweilige Klumpen, der ihnen aufgefallen war, als bedeutendes Zeugnis der Geschichte entpuppte.
Chumbe Island, etwa neun Kilometer lang und drei Kilometer breit, besitzt in etwa die Form eines Damenstiefels, wobei Schienbein, Knöchel und Vorderfuß dem Kanal zugewandt sind und Wade, Bleistiftabsatz und Sohle der Insel Sansibar selbst. Dicht oberhalb des Knöchels klaffte in der Sandbank eine Lücke. Es war ein Einlass, der zu der Lagune führte, die durch den Pfennigabsatz gebildet wurde.
Nachdem sie eine Viertelstunde lang über den Sandboden gepaddelt waren, erreichten Sam und Remi diese Lücke, wandten sich nach Westen, bis sie nur noch zehn Meter vom Strand entfernt waren, und gingen dann auf nördlichen Kurs, um ihre Suche fortzusetzen. Nun wurden sie ein wenig wachsamer. An diesem Teil der Sandbank schob sich der Hauptkanal gefährlich dicht an den Strand herab. Es war eine blasenförmige Ausbuchtung, die ihre Sicherheitszone auf wenig mehr als zehn Meter schrumpfen ließ. Remi schwamm in Richtung Land und befand sich dabei ein kurzes Stück vor Sam, während sich beide immer wieder vergewisserten, dass der andere nicht zu nahe an den Abgrund geriet.
Aus dem Augenwinkel gewahrte Sams rechtes Auge ein Glitzern. Es war nicht mehr als ein flüchtiges goldenes Aufblitzen. Er stoppte seine Schwimmbewegungen, ließ sich mit den Knien zuerst auf den Sand sinken und klopfte dann mit dem Tauchermesser gegen seine Luftflasche, um Remi auf sich aufmerksam zu machen. Sie hielt ebenfalls an, drehte sich und kam mit einigen Flossenschlägen zu ihm zurück. Er deutete auf den Punkt. Sie nickte und folgte Sam zum Ufer, bis die Sandbänke in Sicht kamen. Als Sandmauer von fast vier Metern Höhe bildeten diese Sandbänke eine Art Abhang, wo die Wassertiefe schlagartig von Brusthöhe auf sechs bis sieben Meter absackte. Sie hielten vor dem Sandwall an und sahen sich um.
Remi deutete mit den Händen die Frage Wo? an.
Sam zuckte die Achseln und ließ den Blick an der Sandbank entlang wandern. Dort. Gut fünf Meter rechts von sich gewahrte er es abermals, ein goldenes Blinken. Sie schwammen darauf zu und hielten erneut an. Hier war die Goodbye-Zone noch näher gerückt und begann keine drei Meter hinter ihnen. Selbst in dieser Entfernung konnten sie die Strömung spüren. Sie war wie ein Strudel, der sie in die Tiefe ziehen wollte.
In Taillenhöhe ragte etwas aus dem Sandwall, das wie das fünfzehn bis zwanzig Zentimeter große Stück eines Fassreifens aussah. Obgleich angelaufen, blind und mit Seepocken besetzt, war der Ring von der Meeresströmung regelrecht sandgestrahlt worden, so dass glänzendes Metall zutage trat.
Sam streckte die Hand aus und wedelte den Bereich um den Reifen mit dem Pingpongschläger frei. Der freigelegte Abschnitt vergrößerte sich auf zwanzig Zentimeter, dann auf fünfundzwanzig, ehe die Krümmung wieder in die Sandbank eintauchte. Sam bewegte den Schläger nach oben und hoffte, einige der Fassdauben freizulegen, falls das Holz nicht völlig verrottet war.
Dann unterbrach er seine Bemühungen und sah zu Remi hinüber. Die Augen hinter ihrer Maske waren vor Staunen geweitet. Über dem Ring erschien kein verfaultes Holz, sondern eine metallene Wölbung, stellenweise mit grüner Patina bedeckt. Sam ließ sich auf die Knie sinken und rutschte vorwärts, bis seine Brust beinahe den Sandwall berührte. Dann legte er den Kopf in den Nacken und wedelte mit dem Schläger unter dem Ring hin und her. Nach etwa einer halben Minute erschien eine Höhle. Behutsam schob er eine Hand in die dunkle Öffnung und erforschte sie mit gespreizten Fingern.
Er zog den Arm heraus, entfernte sich von dem Objekt und kam zu Remi zurück. Sie schaute ihn erwartungsvoll an. Er nickte als Antwort auf ihre stumme Frage. Ein Zweifel war ausgeschlossen. Ihr Fass war kein Fass, sondern eine Schiffsglocke.
»Also, das kam unerwartet«, stellte Remi ein paar Minuten später fest, nachdem sie aufgetaucht waren.
»Du sagst es«, erwiderte Sam, nachdem er das Mundstück des Atemschlauchs herausgenommen hatte. Bisher war das größte Artefakt, das sie je gefunden hatten, ein Silberteller von einem torpedierten Libertyschiff aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen.
Sie streifte die Schwimmflossen ab und warf sie über das Dillbord aufs Achterdeck ihres Mietbootes, einer auch vielfach als Wassertaxi eingesetzten Andreyale-Joubert-Nivelt-Express-Motoryacht, komplett mit lackierter Teakholztäfelung und antiken Eisenbahnfenstern. Dann kletterte sie die Leiter hinauf. Sam folgte ihr. Sobald sie die restliche Taucherausrüstung abgelegt und in der Kajüte der Andreyale-Yacht verstaut hatten, angelte Remi zwei Flaschen Mineralwasser aus der Kühlbox und warf Sam eine davon zu. Nun machten sie es sich in den Deckstühlen gemütlich.
»Was meinst du, seit wann liegt sie schon da unten?«, fragte Remi.
»Schwer zu sagen. Es dauert meist nicht allzu lange, bis die erste Patina entsteht. Wir müssten uns ansehen, wie dick die Schicht auf dem restlichen Teil ist. Das Innere fühlte sich ziemlich glatt an.«
»Und der Klöppel?«
»Den habe ich nicht gefunden.«
»Sieht so aus, als müssten wir eine Entscheidung treffen.«
»Das werden wir auch.«
Die Regierung von Tansania hatte nicht nur einige sehr unorthodoxe Gesetze, was die Bergung von Meeresfunden betraf, sondern Chumbe Island trug die offizielle Bezeichnung Chumbe Island Coral Park. Darüber hinaus waren große Teile als Riff-Schutzzone und als Waldreservat abgetrennt und für die Öffentlichkeit gesperrt worden. Ehe Sam und Remi überhaupt etwas unternehmen konnten, mussten sie zuerst feststellen, ob die Glocke innerhalb eines dieser geschützten Bereiche lag. Wenn sie diese Hürde überwanden, dann konnten sie auch guten Gewissens den nächsten Schritt in Angriff nehmen: die Herkunft und die Geschichte der Glocke bestimmen, was eine Vorbedingung war, wenn sie einen gesetzlichen Anspruch auf ihren Fund anmelden wollten, ehe einheimische Amtsträger auf seine Existenz aufmerksam würden. Sie bewegten sich auf einem schmalen Grat. Wenn sie ihn überwanden, konnten sie sich vielleicht über einen bedeutenden historischen Fund freuen, aber auf beiden Seiten des Grates lauerten Gesetze, auf Grund derer ihnen bestenfalls ihre Beute weggenommen wurde oder sie schlimmstenfalls mit einem Gerichtsverfahren rechnen mussten. Laut Gesetz durften sie sämtliche gefundenen, von Menschenhand hergestellten Objekte, deren Bergung »keine umfangreichen Ausgrabungsarbeiten« erforderte, als ihr Eigentum betrachten. Gegenstände wie Remis rautenförmige Münze waren unproblematisch; eine Schiffsglocke wäre jedoch etwas völlig anderes.
Das alles war den Fargos nicht neu. Gemeinsam und jeder für sich, privat wie professionell, hatten Sam und Remi beinahe von Kindesbeinen an Schätze, Artefakte und verborgene historische Zeugnisse gesucht.
Dem Beispiel ihres Vaters folgend, hatte Remi das Boston College besucht und dort Master-Grade in Anthropologie und Geschichte erworben. Dabei hatte sie sich vor allem auf die Handelsrouten des Altertums spezialisiert.
Sams Vater, der vor einigen Jahren gestorben war, hatte als Ingenieur zum Leitungsstab der NASA-Raumfahrtprogramme gehört, und Sams Mutter, eine temperamentvolle Lady, betrieb ein Tauchboot, das für ausgedehnte Ausflüge gemietet werden konnte.
Sam erwarb ein Ingenieursdiplom am California Institute of Technology und heimste beim Lacrosse und beim Fußball eine Handvoll Trophäen ein.
Während seiner letzten Monate am Caltech war Sam von einem Mann angesprochen worden, der, wie sich später herausstellte, von der DARPA – der Defense Advanced Research Projects Agency – kam, jener Regierungsbehörde, die Forschungsprojekte für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten durchführen ließ. Die Verlockung, an der Entwicklung technischer Neuerungen mitzuarbeiten und gleichzeitig seinem Vaterland einen Dienst zu erweisen, machte Sam die Entscheidung leicht.
Nach sieben Jahren bei der DARPA kehrte er nach Kalifornien zurück, wo Sam und Remi sich im Lighthouse Café, einem Jazzclub in Hermosa Beach, kennenlernten. Sam hatte den Club aufgesucht, um sich ein kühles Bier zu genehmigen, und Remi feierte dort gerade den erfolgreichen Abschluss eines Forschungsprojekts, in dessen Verlauf sie den Gerüchten über ein vor Abalone Cove gesunkenes spanisches Schiff auf den Grund gegangen war.
Auch wenn keiner von ihnen ihr erstes Treffen als Liebe auf den ersten Blick bezeichnen würde, waren sie sich doch darin einig, dass sie sich »vom ersten Moment an verdammt sicher« gewesen seien. Sechs Monate später heirateten sie im Rahmen einer bescheidenen Zeremonie im Lighthouse Café, da sie sich dort zum ersten Mal begegnet waren.
Auf Remis Anregung hin stürzte sich Sam kopfüber in sein eigenes Unternehmen, und nach einem Jahr stießen sie auf eine Goldader, indem sie einen Argonlaser-Scanner entwickelten, der auf größere Entfernung edelmetallhaltige Vorkommen und Verbindungen von Gold über Silber und Platin bis hin zu Palladium aufspüren und identifizieren konnte. Schatzsucher, Universitäten, Staatsbetriebe und Bergbaufirmen bewarben sich um Lizenzen für Sams Erfindung, und innerhalb von zwei Jahren konnte die Fargo Group einen jährlichen Reingewinn von drei Millionen Dollar verbuchen. Schon nach vier Jahren traten multinationale Konzerne an sie heran. Sam und Remi entschieden sich für das höchste Gebot, verkauften die Firma für genug Geld, um den Rest ihres Lebens komfortabel abzusichern, und frönten von da ab nur noch ihrer wahren Leidenschaft: der Schatzsuche.
Für Sam und Remi war das Geld nicht der Motor ihres Lebens, sondern das Abenteuer und die Genugtuung, beobachten zu können, wie die Fargo Foundation aufblühte. Die Stiftung, die ihre Spenden unter unterprivilegierten und missbrauchten Kindern sowie dem Tier- und Naturschutz aufteilte, war während des vorangegangenen Jahrzehnts sprunghaft gewachsen und hatte im vorangegangenen Jahr verschiedenen Organisationen fast zwanzig Millionen Dollar an Unterstützung zukommen lassen. Ein wesentlicher Teil stammte aus Sams und Remis Privatvermögen, der Rest aus privaten Spenden. Wohl oder übel erregten ihre Aktivitäten die Aufmerksamkeit der Medien, wodurch wiederum weitere reiche Spender angelockt wurden.
Die Frage, die sich ihnen jetzt stellte, war, ob diese Schiffsglocke vielleicht etwas war, das der Finanzierung weiterer wohltätiger Bemühungen dienen konnte, oder ob es sich nur um ein historisches Kuriosum handelte. Nicht dass dies von großer Bedeutung war. Historische Geheimnisse zu enthüllen, hatte einen ganz besonderen Reiz für sie. Ganz gleich wie oder was, sie wussten genau, wo sie anfangen mussten.
»Es ist Zeit, Selma anzurufen«, entschied Remi.
»Ja, jetzt ist Selma gefragt«, pflichtete Sam ihr bei.
Eine Stunde später befanden sie sich wieder in ihrem im Plantagenstil erbauten Mietbungalow in Kendwa Beach an der Nordspitze Sansibars. Während Remi einen frischen Obstsalat zu Schinken und Mozzarella zubereitete und Eistee in Gläser einschenkte, wählte Sam Selmas Nummer. Über ihren Köpfen brachte ein anderthalb Meter großer Deckenventilator die Luft in Wallung, und eine kühle Brise bauschte die Gazevorhänge vor den Fenstern.
Obgleich es in San Diego erst vier Uhr morgens war, nahm Selma Wondrash den Hörer schon nach dem ersten Klingeln ab. Sam und Remi überraschte das nicht, nachdem sie zu der Überzeugung gelangt waren, dass Selma pro Nacht nur vier Stunden lang schlief, außer sonntags, wenn sie sich eine fünfte Stunde Schlaf gönnte.
»Sie rufen mich aus dem Urlaub immer nur dann an, wenn Sie in Schwierigkeiten oder im Begriff sind, in Schwierigkeiten zu geraten«, drang Selmas Stimme ohne Einleitung aus dem Telefonlautsprecher.
»Das stimmt nicht«, protestierte Sam. »Als wir vergangenes Jahr von den Seychellen aus anriefen …«
»War eine Pavianherde in Ihr Strandhaus eingefallen, hatte die Inneneinrichtung zerlegt und sich mit Ihrem gesamten weltlichen Besitz aus dem Staub gemacht. Und die Polizei hat Sie für Einbrecher und Diebe gehalten.«
Sie hat recht, bestätigte Remi mit einer stummen Geste über die Kücheninsel hinweg. Mit der Messerspitze warf sie Sam ein Stück frischer Ananas hinüber. Er fing es mit dem Mund auf, und sie applaudierte ihm lautlos.
»Okay, das ist wahr«, gab sich Sam geschlagen.
Selma Wondrash stammte aus Ungarn, was man ihrem Akzent immer noch anhören konnte, und war die strenge, aber auch durchaus weichherzige Chefin von Sams und Remis dreiköpfigem Recherche-Team hinter der Fargo Foundation. Selma war Witwe, seit sie ihren Mann, zu Lebzeiten Testpilot der Air Force, bei einem Flugzeugabsturz zehn Jahre zuvor verloren hatte.
Nachdem sie ihr Studium der Bibliothekswissenschaften in Georgetown mit einem Diplom abgeschlossen hatte, leitete Selma die Spezial-Sammlung der Kongress-Bibliothek, bis Sam und Remi sie von dort weglockten. Außer als hervorragende Rechercheurin hatte sich Selma schon bald als begnadete Reiseagentin und Logistik-Spezialistin erwiesen, indem sie mit geradezu militärischer Effizienz Sams und Remis Transport an ihre jeweiligen Zielorte organisierte. Selmas einzige Leidenschaft schien die Recherche zu sein, für die sie aß, trank und lebte. Sie fand ihre Glücksmomente darin, Geheimnissen, die sich standhaft jeder Aufklärung verweigerten, und Legenden mit einem winzigen Funken Wahrheit auf den Grund zu gehen.
»Was ist es diesmal?«, fragte Selma.
»Eine Schiffsglocke«, rief Remi.
Sie konnte das Rascheln von Papier hören, als Selma sich einen Notizblock angelte. »Lassen Sie hören«, sagte sie.
»Die Westküste von Chumbe Island«, sagte Sam und nannte dann die Koordinaten, die er in seinem GPS-Gerät gespeichert hatte, ehe er zum Boot zurückgeschwommen war. »Sie müssen zuerst …«
»Den Grenzverlauf und die Ausdehnung des Reservats und der Naturschutzzonen überprüfen, ich weiß«, sagte Selma, wobei ihr Bleistift über das Papier flog. »Wendy wird sich mal die tansanischen Seerechtsbestimmungen vornehmen. Sonst noch etwas?«
»Eine Münze. Rautenförmig, etwa so groß wie eine amerikanische Halbdollarmünze. Wir haben sie etwa einhundertzwanzig Meter nördlich der Glocke gefunden …« Sam schaute fragend zu Remi, die seine Aussage mit einem Kopfnicken bestätigte. »Wir werden versuchen, sie zu säubern, aber zurzeit ist nichts darauf zu erkennen.«
»Hab’s notiert. Was als Nächstes?«
»Es gibt nichts mehr. Das war’s. So schnell wie möglich, Selma. Je eher wir diese Glocke an den Haken nehmen können, desto besser. Die Sandbank sah nicht sehr stabil aus.«
»Ich melde mich«, erwiderte Selma und unterbrach die Verbindung.
2
Mexico City, Mexiko
Quauhtli Garza, der Präsident der Vereinigten mexikanischen Staaten und Vorsitzender der Mexica (traditionell Meh-SCHII-kah ausgesprochen) Tenochca Party, blickte durch die deckenhohen Fenster auf die Plaza de la Constitución hinunter, wo einst der Große Tempel gestanden hatte. Jetzt war er nicht mehr als eine wunderschöne Ruine und eine touristische Attraktion für all jene, die die traurigen Überreste der prachtvollen aztekischen Stadt Tenochtitlán und den großen Sonnenstein mit seinen über dreieinhalb Metern Durchmesser begaffen wollten.
»Das ist der blanke Hohn«, murmelte Quauhtli Garza, während er das Gedränge der Schaulustigen betrachtete.
Ein Hohn, den er nur mit geringem Erfolg hatte korrigieren können. Sicher, seit seinem Wahlsieg zeigte das mexikanische Volk zunehmend Interesse an seiner eigenen Herkunft – es verstand mittlerweile, dass die wahre Geschichte seines Landes durch den spanischen Imperialismus so gut wie ausgelöscht worden war. Sogar der Name, Azteken-Partei, den viele Reporter und Journalisten in ihren Berichten über die Partido Mexica Tenochca benutzten, stellte eine Beleidigung und fortgesetzte Irreführung dar. Hernán Cortés und seine blutrünstigen spanischen Konquistadoren hatten das mexikanische Volk Azteken genannt, abgeleitet von Aztlán, dem Namen der legendären Heimat der Mexikaner. Es war jedoch ein notwendiger Kunstgriff. Einstweilen war der Begriff Azteken ein Wort, welches das mexikanische Volk verstand und in seinem kollektiven Herzen tragen konnte. Mit der Zeit würde Garza dem Volk die Augen öffnen und ihm die eigene Vergangenheit nahebringen.
Tatsächlich war es eine Grundströmung nationalistischer Rückbesinnung auf die Zeit vor der spanischen Eroberung gewesen, die Garza und die Partido Mexica Tenochca an die Macht gebracht hatte, aber Garzas Hoffnung auf eine landesweit zunehmende Bereitschaft Mexikos, sich die eigene Geschichte bewusst zu machen und sich mit ihr auseinanderzusetzen, verflüchtigte sich zusehends. Er war im Laufe der Zeit zu der Überzeugung gelangt, dass sie die Wahl teils wegen der Inkompetenz der vorangegangenen Regierung und teils wegen ihrer geschickten Azteken-Show, wie ein politischer Experte es nannte, gewonnen hatte.
Von wegen Azteken-Show! Dieser Vorwurf war absurd.
Hatte Garza nicht schon vor Jahren seinen spanischen Vornamen gegen einen aus dem Nahuatl ausgetauscht? Hatte sein gesamtes Kabinett nicht das Gleiche getan? Hatte Garza seinen eigenen Kindern nicht ebenfalls Nahuatl-Namen gegeben? Und mehr noch: Texte und Bilder über die spanische Eroberung Mexikos wurden nach und nach aus den Lehrplänen der Schulen getilgt; Straßen und Plätze trugen zunehmend Namen aus dem Nahuatl; Schulen boten Kurse in Nahuatl und mexikanischer Geschichte an; religiöse Feiertage und traditionelle mexikanische Feste wurden mehrmals im Jahr gefeiert. Dennoch, sämtliche Umfragen zeigten, dass das mexikanische Volk sie als geschenkte Freizeit betrachteten – als Vorwand, um der Arbeit fernzubleiben oder sich zu betrinken oder in der Öffentlichkeit danebenzubenehmen. Gleichzeitig ging jedoch aus den Umfragen hervor, dass eine grundlegende Veränderung herbeizuführen wäre, wenn sie genug Zeit hätten, um daran zu arbeiten. Garza und die Partido Mexica Tenochca brauchten eine weitere Legislaturperiode, und um das zu erreichen, musste Garza den Senat, die Abgeordnetenkammer und den Obersten nationalen Gerichtshof unter seine Kontrolle bringen. Zurzeit beschränkte sich die Präsidentschaft auf eine einzige Amtszeit von sechs Jahren. Nicht lang genug, um zu erreichen, was Garza plante, und auch nicht lange genug, um zu erreichen, was Mexiko brauchte: ein Bewusstsein für seine eigene Geschichte, frei von Lügen, die Eroberung durch die Spanier und die blutigen Auseinandersetzungen betreffend.
Garza verließ den Platz am Fenster, kehrte zu seinem Schreibtisch zurück und drückte auf einen Knopf der Fernbedienung. Rollläden senkten sich vor den Fenstern herab und dämpften den grellen Schein der Mittagssonne. An der Decke flammten Einbauleuchten auf und illuminierten den dunkelroten Teppichboden und die wuchtigen Holzmöbel. Wie alles andere in seinem Leben spiegelte sein Büro seine Herkunft als Mexica wider. Wandteppiche und Gemälde, auf denen die Geschichte der Azteken dargestellt wurden, bedeckten die Zimmerwände. Dort hing ein vier Meter langer handgemalter Kodex, der die Gründung von Tenochtitlán auf einer sumpfigen Insel im Texcoco-See schilderte; an anderer Stelle zeigte ein Gemälde die aztekische Mondgöttin, Coyolxauhqui; über dem offenen Kamin waren auf einem deckenhohen Wandteppich Huitzilopochtli, der Kolibri des Südens, und Tezcatlipoca, der Rauchende Spiegel, zu sehen, wie sie gemeinsam über ihr Volk wachten. An der Wand über seinem Schreibtisch hing ein Ölgemälde von Chicomoztoc – dem Ort der Sieben Höhlen – jene legendäre Urheimat aller Nahuatl sprechenden Menschen.
Von diesen raubte ihm jedoch nichts seinen nächtlichen Schlaf. Diese Ehre gebührte einem Artefakt, das in einer Ecke des Raumes stand. In einem Würfel aus anderthalb Zentimeter dickem Glas, der auf einem Kristallsockel stand, befand sich Quetzalcoatl, der gefiederte Schlangengott der Azteken. Natürlich war Quetzalcoatl überall zu betrachten – auf Töpfereien und Wandteppichen und in zahlreichen Kodizes – , aber diese Darstellung war einzigartig. Es war eine kleine Statue. Die einzige ihrer Art. Sie war zehn Zentimeter hoch und etwa siebzehn Zentimeter lang. Die Hände eines unbekannten Künstlers hatten dieses Meisterwerk vor einem Jahrtausend aus einem soliden Stück nahezu glasklarer Jade geschaffen.
Garza ging um seinen Schreibtisch herum und ließ sich in einem Sessel vor dem Podest nieder. Angestrahlt von einer in der Decke versenkten Halogenlampe entstanden auf der polierten Oberfläche Quetzalcoatls hypnotisierende Farbwirbel, die in schnellem Wechsel die verschiedensten Formen bildeten. Garzas Blick wanderte über Quetzalcoatls Gefieder und Schuppen und verharrte auf dem restlichen Schwanz – genauer gesagt dort, wo der Schwanz eigentlich hätte sein müssen, korrigierte er sich. Anstatt, wie bei einer Schlange üblich, in einem spitzen Ende auszulaufen, verbreiterte sich die kleine Statue an dieser Stelle nämlich und endete mit einer schartigen vertikalen Kante, als wäre die kleine Figur von einem größeren Artefakt abgeschlagen worden. Zumindest war das die Theorie, auf die sich Garzas Historiker und Archäologen geeinigt hatten. Es war eine Theorie, die er um jeden Preis unterdrücken wollte.
Diese Darstellung Quetzalcoatls, dieses Symbol der Partido Mexica Tenochca, war unvollständig. Garza wusste, was fehlte – mehr noch, er wusste, dass das fehlende Stück nicht im aztekischen Pantheon beheimatet war. Als Symbol der Mexica-Tenochca-Bewegung seit dem Tag, als Garza sie ins Leben gerufen hatte, war diese kleine Statue das Symbol für die Welle des Nationalismus, die ihn in sein Amt getragen hatte. Sollten Zweifel an seiner Echtheit aufkommen … Dies war eine Frage, über deren Beantwortung Garza nicht nachzudenken wagte. Die Vorstellung, dass ein im neunzehnten Jahrhundert verschollenes Kriegsschiff alles zerstören konnte, was er aufgebaut hatte, war unerträglich. Alle Bemühungen völlig umsonst und verpufft, nur weil ein Tauchtourist ein scheinbar wertloses Schmuckstück oder ein Artefakt gefunden hatte und es jemandem zeigen könnte, der sich am Rande für Geschichte interessierte und sich bei einem Experten über das Fundstück erkundigte. Es wäre der sprichwörtliche umkippende Dominostein, der dem aufkeimenden Nationalstolz den Todesstoß versetzen würde.
Das Summen der Sprechanlage auf dem Schreibtisch riss Garza aus seinen Grübeleien. Er knipste die Halogenbeleuchtung der Vitrine aus und kehrte hinter seinen Schreibtisch zurück.
»Ja?«, fragte er.
»Er ist hier, Mr President.«
»Schicken Sie ihn herein«, sagte Garza, dann nahm er hinter dem Schreibtisch Platz.
Einen Moment später wurden die Doppeltüren geöffnet, und Itzli Rivera kam hereingeschlendert. Mit einem Meter achtzig Körpergröße und einhundertfünfzig Pfund Gewicht machte Itzli Rivera von Weitem betrachtet einen eher unscheinbaren Eindruck – extrem hager, das schmale, mit scharfen Linien gezeichnete Gesicht wurde von einer ausgeprägten Hakennase beherrscht. Doch als er näher kam, wurde Garza daran erinnert, wie trügerisch Riveras äußere Erscheinung war. Es zeigte sich im harten Ausdruck seiner Augen und seines Mundes, in seinem festen, zielstrebigen Schritt und in den straffen Muskeln seiner entblößten sehnigen Unterarme. Selbst wenn er den Mann nicht kannte, ahnte der aufmerksame Beobachter doch sofort, dass Itzli Rivera die harten Seiten des Lebens nicht fremd waren. Natürlich wusste Garza, dass dies zutraf. Sein wichtigster Helfer hatte schon zahlreichen armen Seelen das Leben zur Hölle gemacht, bislang vorwiegend politischen Gegnern, die sich mit Garzas Ansichten über Mexiko nicht anfreunden konnten. Glücklicherweise konnte man aber eher eine Jungfrau in einem Bordell finden als ein für Korruption unempfängliches Mitglied des Senats oder der Abgeordnetenkammer. Und Rivera hatte ein Gespür für die Schwächen eines Menschen und setzte genau dort stets seinen Hebel an. Rivera selbst war ein überzeugter Anhänger und hatte seinen spanischen Namen Fernando gegen Itzli eingetauscht, was im Nahuatl soviel wie Obsidian bedeutete. Ein Name, der ausgezeichnet passte, dachte Garza.
Rivera war Major in der Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, kurz GAFE, und in der Abteilung 2 des Geheimdienstes des ehemaligen Secretaria de la Defensa Nacional gewesen und hatte die Armee verlassen, um Garza als Leibwächter zur Seite zu stehen. Garza hatte jedoch sehr schnell Riveras besondere Fähigkeiten erkannt und ihn zu seinem persönlichen Geheimdienstleiter und Operationschef befördert.
»Guten Morgen, Mr. President«, sagte Rivera steif.
»Ebenfalls, ebenfalls. Setzen Sie sich. Darf ich Ihnen etwas anbieten?« Rivera schüttelte den Kopf, während Garza fragte: »Welchem Umstand verdanke ich diesen Besuch?«
»Wir sind auf etwas gestoßen, das Sie sich vielleicht ansehen wollen – ein Video. Ich habe Ihre Sekretärin gebeten, es zum Abspielen einzulegen.«
Rivera nahm die Fernbedienung vom Tisch, richtete sie auf den fünfzig Zoll großen LCD-Bildschirm an der Wand und drückte auf die Einschalttaste. Garza setzte sich. Nach einigen Sekunden Stille erschienen ein Mann und eine Frau Mitte dreißig, die nebeneinander vor einem Meerespanorama im Hintergrund saßen. Außerhalb des Bildes stellte ein Reporter Fragen. Obwohl Garza die englische Sprache fließend beherrschte, hatten Riveras Techniker spanische Untertitel eingefügt.
Das Interview war nur kurz, kaum länger als drei Minuten. Als es beendet war, sah Garza seinen Geheimdienstchef fragend an. »Und was soll ich damit anfangen?«
»Das sind die Fargos – Sam und Remi Fargo.«
»Sollte das für mich von irgendeiner Bedeutung sein?«
»Erinnern Sie sich noch an vergangenes Jahr, an diese Geschichte mit Napoleon Bonapartes Weinkeller … an die verschollenen Spartaner?«
Garza überlegte und nickte langsam. »Ja, ja …«
»Dahinter steckten die Fargos. Sie sind auf ihrem Gebiet sehr gut.«
Interessiert lehnte sich Garza in seinem Sessel vor. »Wo wurde dieses Interview aufgezeichnet?«
»Auf Sansibar. Von einem BBC-Korrespondenten. Natürlich könnte der Zeitpunkt ein reiner Zufall sein.«
Garza machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich glaube nicht an Zufälle. Und Sie auch nicht, mein Freund, sonst wären Sie damit nicht zu mir gekommen.«
Zum ersten Mal seit dem Betreten des Büros zeigte sich bei Rivera der Anflug einer Gefühlsregung – ein haifischartiges Lächeln, das jedoch nicht einmal bis zu seinen Augen reichte. »Richtig.«
»Wie sind Sie darauf gestoßen?«
»Nach der … Enthüllung … ließ ich von meinen Technikern ein spezielles Programm entwickeln. Es durchsucht das Internet nach Schlüsselwörtern. In diesem Fall nach ›Sansibar‹, ›Tansania‹, ›Chumbe‹, ›Schiffswracks‹ und ›Schatz‹. Die letzten beiden bilden das Spezialgebiet der Fargos. In dem Interview bestanden sie darauf, dass sie sich auf einem Tauchurlaub befänden, aber …«
»So nahe beim Schauplatz des letzten Zwischenfalls … mit der Engländerin …«
»Sylvia Radford.«
Radford, dachte Garza. Glücklicherweise hatte diese Idiotin keine Ahnung von der Bedeutung dessen, was sie gefunden hatte. Für sie war es lediglich ein eher wertloses Kinkerlitzchen, das sie auf Sansibar und Bagamoyo herumzeigte, um von den Eingeborenen zu erfahren, welche Bedeutung es haben könnte. Ihr Tod war eine unglücklicherweise unvermeidbare Notwendigkeit gewesen, aber Rivera hatte es mit der üblichen Sorgfalt erledigt – ein Straßenraub, der mit einem Mord geendet hatte, wie die Polizei ermittelte.
Was Miss Radford gefunden hatte, war eine winzige Spur, die mit größter Sorgfalt hätte untersucht und weiterverfolgt werden müssen, damit sie nicht im Sand verlief. Aber die Fargos … Nun ja, sie kannten sich mit dem Verfolgen zufällig gefundener Spuren und Hinweise aus, vermutete er. Die Fargos wussten, wie man aus nichtssagenden Hinweisen wichtige Erkenntnisse gewinnen konnte.
»Könnte sie jemandem erzählt haben, was sie gefunden hatte?«, fragte Garza. »Die Fargos haben ihr eigenes Informantennetz, stelle ich mir vor. Könnten sie irgendetwas erfahren haben?« Garza kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen und musterte Rivera prüfend. »Reden Sie schon, Itzli, ist Ihnen irgendwas entgangen?«
Der Blick, der schon so manchen Minister und politischen Gegner hatte erzittern lassen, verfehlte jedoch bei Rivera, der lediglich die Achseln zuckte, seine Wirkung völlig.
»Das bezweifle ich zwar, aber es ist immerhin möglich«, meinte er ungerührt.
Garza nickte. Obgleich die Möglichkeit, dass Miss Radford einem Dritten von ihrem Fund erzählt hatte, einen beunruhigenden Aspekt darstellte, war Garza froh, dass Rivera keine Probleme hatte zuzugeben, dass ihm möglicherweise ein Fehler unterlaufen war. Als Präsident war Garza ständig von Speichelleckern und Jasagern umgeben. Darum vertraute er darauf, dass Rivera ihm stets die unverblümte Wahrheit sagte und das Unlösbare löste – und er hatte ihn in beiden Punkten niemals enttäuscht.
»Finden Sie es heraus«, befahl Garza. »Gehen Sie nach Sansibar, und bringen Sie in Erfahrung, was die Fargos vorhaben.«
»Und wenn ihre Anwesenheit nicht auf einem Zufall beruht? Sie werden sich nicht so einfach aus dem Weg räumen lassen wie die Engländerin.«
»Ich bin sicher, dass Sie einen Weg finden werden«, sagte Garza. »Ein Blick in die Geschichte zeigt uns, dass Sansibar ein gefährlicher Ort sein kann.«
3
Sansibar
Nach dem Gespräch mit Selma gönnten sich Sam und Remi ein Nickerchen, dann duschten sie, wechselten die Kleidung und fuhren mit ihren Motorrollern über die Küstenstraße nach Stone Town zu ihrem Lieblingsrestaurant mit tansanischer Küche, dem Ekundu Kifaru, was auf Swahili Rotes Rhinozeros hieß. Das Rote Rhinozeros stand direkt am Hafenkai zwischen dem alten Zollgebäude und dem Big Tree, einem mächtigen alten Feigenbaum, in dessen Schatten jeden Tag Bootsbauer und Charterkapitäne herumlungerten, die Tagesausflüge nach Prison Island oder Bawe Island anboten.
Für Sam und Remi personifizierte Sansibar – Unguja in Swahili – das altweltliche Afrika. Die Insel war im Laufe der Jahrhunderte abwechselnd von selbsternannten Machthabern und Sultanen, von Sklavenhändlern und Piraten beherrscht worden. Sie hatte als zentraler Stützpunkt für Handelsgesellschaften gedient und Tausende von europäischen Missionaren, Forschern und Großwildjägern angelockt. Sir Richard Burton und John Hanning Speke hatten Sansibar als Ausgangspunkt für ihre Suche nach der Nilquelle ausgewählt; Henry Morton Stanley hatte seine berühmte Jagd nach dem berüchtigt launischen David Livingstone in den labyrinthartig verwinkelten Gassen von Stone Town begonnen; und Kapitän William Kidd hatte sich in den Gewässern um Sansibar angeblich sowohl als Pirat wie auch als Piratenjäger betätigt.
Hier, so stellten Sam und Remi fest, rankte sich um jede Straße und jeden Platz eine Legende, und jedes Bauwerk hatte eine geheime Geschichte. Wenn sie Sansibar verließen, nahmen sie jedes Mal Dutzende schöner Erinnerungen mit.
Als sie auf den Parkplatz einbogen, sank die Sonne zügig dem Horizont entgegen und zauberte goldene und rote Schatten aufs Meer. Der Duft gegrillter Austern lag in der Luft.
»Willkommen daheim, Mr und Mrs Fargo«, rief der Portier und winkte dann zwei weiß gekleideten Angestellten, die sogleich herbeieilten und die Motorroller wegbrachten.
»Guten Abend, Abasi«, erwiderte Sam und schüttelte dem Portier die Hand. Remi wurde mit einer herzlichen Umarmung begrüßt. Sie hatten Abasi Sibale bei ihrem ersten Besuch auf Sansibar sechs Jahre zuvor kennengelernt und sich schnell mit ihm angefreundet. Gewöhnlich luden sie ihn und seine Familie während ihrer alljährlichen Besuche mindestens einmal zum Essen ein. Abasi hatte stets ein Lächeln für sie bereit.
»Wie geht es Faraja und den Kindern?«, fragte Sam.
»Sie sind wohlauf, danke. Werden Sie während Ihres Aufenthaltes hier zu Abend essen?«
Remi lächelte. »Ganz sicher sogar.«
»Ich glaube, drinnen ist schon alles für Sie vorbereitet«, sagte Abasi.
Elimu, der Oberkellner, erwartete sie bereits am Eingang. Auch er kannte die Fargos seit Jahren. »Schön, Sie wiederzusehen. Ihr Lieblingstisch mit Blick auf den Hafen ist bereits gedeckt.«
»Vielen Dank«, sagte Sam.
Elimu geleitete sie zu einem Tisch in einer Nische, der von einer roten Sturmlaterne beleuchtet wurde und auf zwei Seiten von offenen Fenstern umgeben war. Unter ihnen flammten die Straßenlaternen von Stone Town soeben flackernd auf.
»Wein?«, fragte Elimu. »Soll ich Ihnen die Karte bringen?«
»Haben Sie noch diesen Pinot Noir – den Chamonix?«
»Ja, einen 98er oder einen 2000er.«
Sam sah Remi fragend an, und sie meinte: »An den 98er kann ich mich noch gut erinnern.«
»Wie die Dame wünscht, Elimu.«
»Sehr wohl, Sir.«
Elimu verschwand.
»Es ist wunderschön«, murmelte Remi und blickte aufs Meer hinaus.
»Da kann ich dir nur beipflichten.«
Sie wandte sich vom Fenster ab, lächelte ihn an und drückte seine Hand. »Du hast ein wenig zu viel Sonne abbekommen«, stellte sie fest. Unerklärlicherweise holte sich Sam an den seltsamsten Stellen einen Sonnenbrand – diesmal waren nur sein Nasenrücken und seine Ohrläppchen gerötet. Schon am nächsten Tag wären die Stellen gebräunt. »Später wird es dich dort jucken.«
»Es juckt jetzt schon.«
»Und hast du irgendwelche Ideen?«, fragte Remi und hielt die rautenförmige Münze hoch, die den Nachmittag in einer Schüssel mit zehnprozentiger Salpetersäure verbracht hatte. Und danach hatte sie in Sams geheimer Lösung aus Weißweinessig, Salz und destilliertem Wasser gelegen. Anschließend war sie mit einer weichen Zahnbürste behutsam abgeschrubbt worden. Während viele Stellen blind und unkenntlich blieben, konnten sie ein Frauenprofil und die beiden Worte Marie und Reunion erkennen. Diese Details hatten sie Selma übermittelt, ehe sie ihren Bungalow verließen.
»Keine einzige«, antwortete Sam. »Allerdings ist das eine höchst seltsame Münzenform.«
»Stammt sie vielleicht aus einer privaten Münzanstalt?«
»Schon möglich. Und wenn, dann ist sie ein kleines Kunstwerk. Glatte Kanten, gleichmäßig geformt, ausreichend schwer …«
Elimu kam mit dem Wein, dekantierte ihn, schenkte beiden eine Probe ein, wartete ihr zustimmendes Kopfnicken ab und füllte dann die Gläser. Dieser spezielle Pinot Noir stammte aus Südafrika. Es war ein vollmundiger Rotwein mit einem Aroma aus Gewürznelken, Zimt, Muskat und etwas, das Sam nicht identifizieren konnte.
Remi trank einen zweiten Schluck und sagte: »Zichorie.«
Sams Telefon klingelte. Er schaute auf das Display, formte mit den Lippen den Namen Selma und meldete sich. »Guten Abend, Selma.« Remi beugte sich vor, um mitzuhören.
»Für mich heißt es guten Morgen. Pete und Wendy sind eben eingetrudelt. Sie vertiefen sich sofort in die tansanischen Gesetze und Ausgrabungsbestimmungen.«
»Prima.«
»Lassen Sie mich mal raten: Sie sitzen gerade im Ekundu Kifaru und bewundern den Sonnenuntergang.«
»Wir sind nun mal Gewohnheitstiere«, verteidigte sich Remi.
»Haben Sie Neuigkeiten?«, wollte Sam wissen.
»Über Ihre Münze. Es gibt da noch ein Rätsel, das Sie lösen müssen.«
Sam sah, wie der Kellner auf ihren Tisch zukam, und sagte: »Warten Sie einen Moment.« Sie bestellten Samakai wa kusonga mit wali – Fischkroketten und Wildreis mit Chapati-Brot – und zum Nachtisch N’dizi no kastad, eine auf Sansibar beliebte Bananencreme. Der Kellner entfernte sich, und Sam erteilte Selma wieder das Wort.
»Schießen Sie los, Selma. Wir sind ganz Ohr«, sagte er.
»Die Münze wurde irgendwann um 1690 geprägt. Insgesamt wurden nur fünfzig Stück hergestellt und niemals offiziell in Umlauf gebracht. Sie waren im Grunde nichts anderes als Symbole für besondere Wertschätzung oder Zuneigung, wenn man es so nennen kann. Das Wort Marie auf der Münze gehört zu Sainte Marie, dem Namen eines französischen Dorfs an der Nordküste von Reunion.«
»Nie gehört«, sagte Remi.
»Kein Wunder. Es ist eine winzige Insel etwa vierhundert Meilen östlich von Madagaskar.«
»Wer ist die Frau?«, fragte Sam.
»Adelise Molyneux. Die Ehefrau von Demont Molyneux, der von 1685 bis 1701 Verwalter von Sainte Marie war. Anlässlich ihres zehnten Hochzeitstages soll Demont alles Gold, das er besaß, eingeschmolzen und daraus diese Adelise-Münzen geprägt haben.«
»Eine wirklich nette Geste«, sagte Remi.
»Die Anzahl der Münzen sollte den Jahren entsprechen, die Demont mit seiner Frau vor ihrer beider Tod noch zu verbringen hoffte. Sie kamen dem ziemlich nahe. Beide starben nämlich innerhalb eines Jahres kurz vor ihrem vierzigsten Hochzeitstag.«
»Wie ist denn nun diese Münze nach Sansibar gelangt?«, fragte Sam.
»An diesem Punkt vermischt sich Wahrheit mit Legende«, antwortete Selma. »Ich nehme an, Sie haben schon mal von George Booth gehört?«
»Er war englischer Pirat«, sagte Sam.
»Richtig. Er trieb sich vorwiegend im Indischen Ozean und im Roten Meer herum. Um 1696 fing er als Kanonier auf der Pelican an und ging dann auf die Dolphin. Um 1699 wurde die Dolphin von einer britischen Flotte in der Nähe von Reunion in die Enge getrieben. Einige Mannschaftsangehörige ergaben sich; andere, darunter auch Booth, flohen nach Madagaskar, wo sich Booth und ein anderer Piratenkapitän, John Bowen, zusammentaten und die Speaker, ein vierhundertfünfzig Tonnen großes und mit fünfzig Kanonen bewaffnetes Sklavenschiff, eroberten. Booth wurde zum Kapitän gewählt und kam um 1700 mit der Speaker nach Sansibar. Beim Landgang, um ihre Proviantvorräte aufzufüllen, wurde der Landungstrupp von arabischen Soldaten angegriffen. Booth fand den Tod, und Bowen überlebte. Bowen kehrte mit der Speaker in die Gewässer um Madagaskar zurück und starb ein paar Jahre später auf Mauritius.«
»Sie sagten, die Dolphin sei bei Reunion in die Enge getrieben worden«, wiederholte Sam. »Wie nahe bei dem Dorf Sainte Marie?«
»Nur wenige Meilen von der Küste entfernt«, erwiderte Selma. »Die Legende berichtet, dass Booth und seine Bande kurz zuvor das Dorf überfallen hatten.«
»Und wahrscheinlich die Adelise-Münzen mitgenommen haben«, erklärte Remi.
»So berichtet es die Legende. Und so schilderte Demont Molyneux das Geschehen in einem offiziellen Beschwerdebrief an Ludwig XIV., den König von Frankreich.«
»Fantasieren wir ein wenig«, sagte Sam. »Booth und die anderen Flüchtlinge von der Dolphin nehmen die Adelise-Münzen mit und treffen mit Bowen zusammen. Sie bringen die Speaker unter ihr Kommando und nehmen Kurs auf Sansibar, wo sie … was tun? Ihre Beute auf Chumbe Island vergraben? Sie in seichtem Wasser versenken, um sie später wieder aus dem Meer zu holen?«
»Vielleicht ist die Speaker auch gar nicht von dort weggekommen«, wandte Remi ein. »Vielleicht entsprechen die Geschichten ja gar nicht der Wahrheit, und die Speaker ist im Kanal gesunken.«
»Das ist dasselbe in Grün«, sagte Selma. »Ganz gleich, was geschehen ist, die Münze, die Sie gefunden haben, gehört zu dem Adelise-Schatz.«
»Die Frage ist doch«, sagte Sam, »stammt unsere Glocke demnach von der Speaker?«
4
Sansibar
Das Gewitter, das sich in den frühen Morgenstunden über der Insel entladen hatte, war bei Tagesanbruch weitergezogen, hatte die Luft gereinigt und dafür gesorgt, dass Tautropfen auf dem Laub der Bäume und Büsche rund um den Bungalow funkelten. Sam und Remi saßen auf der hinteren Veranda mit Blick auf den Strand und begannen den Tag mit einem Frühstück aus Obst, Brot, Käse und starkem Kaffee. Die Bäume ringsum waren vom Gesang unsichtbarer Vögel erfüllt.
Plötzlich flitzte ein fingergroßer Gecko an dem einen Bein von Remis Sessel hinauf und huschte über ihren Schoß und weiter auf den Tisch, wo er sich einen Weg zwischen den Tellern und Schüsseln suchte, bevor er die Armlehne von Sams Sessel als Fluchtweg benutzte.
»Er hat wahrscheinlich die falsche Abzweigung genommen, denke ich«, bemerkte Sam.
»Ich übe auf Reptilien offenbar eine besondere Anziehungskraft aus«, sagte Remi.
Sie tranken noch eine weitere Tasse Kaffee, dann räumten sie auf, packten ihre Rucksäcke und spazierten zum Strand hinunter, wo sie den Kabinenkreuzer auf Grund gesetzt hatten. Sam warf ihre Rucksäcke über die Reling, dann half er Remi, ins Boot zu steigen.
»Anker?«, rief sie.
»Sofort.«
Sam hockte sich vor den korkenzieherförmigen Strandanker, rüttelte ihn frei, zog ihn aus dem Sand und reichte ihn zu Remi hinauf. Sie verschwand, und schon konnte er hören, wie sie über das Deck ging, und dann, ein paar Sekunden später, sprang der Motor blubbernd an.
»Langsam rückwärts«, rief Sam.
»Langsam rückwärts, aye«, antwortete Remi.
Als Sam hörte, wie sich die Schraube zu drehen begann, stemmte er sich mit der Schulter gegen den Rumpf, grub die Füße in den nassen Sand, spannte die Beine und schob. Das Boot rutschte einen knappen halben Meter zurück, dann einen weiteren und schwamm schließlich. Sam streckte sich, bekam die unterste Stange der Reling zu fassen, schwang die Beine hoch, hakte die Fersen hinter das Dollbord und kletterte an Bord.
»Chumbe Island?«, rief Remi durch das offene Fenster des Steuerhauses.
»Chumbe Island«, bestätigte Sam. »Dort wartet ein Rätsel auf seine Auflösung.«
Sie befanden sich ein paar Meilen nordwestlich von Prison Island, als Sams Satellitentelefon trällerte. Er saß gerade auf dem Achterdeck und sortierte ihre Ausrüstung, griff nach dem Telefon und drückte auf die Sprechtaste. Selma meldete sich. »Gute Nachrichten und nicht so gute Nachrichten«, sagte sie.
»Die guten zuerst«, bat Sam.
»Laut den Bestimmungen des tansanischen Ministeriums für Naturschutz befindet sich die Stelle, an der Sie die Glocke gefunden haben, außerhalb sämtlicher Reservats- und Schutzzonengrenzen. Es gibt dort kein Korallenriff, daher muss das Gebiet auch nicht geschützt werden.«
»Und die nicht so guten Neuigkeiten?«
»Die tansanischen maritimen Bergungsvorschriften gelten auch dort – ›Keine aufwendigen Ausgrabungs- und Bergungsmaßnahmen‹. Das ist zwar ziemlich vage ausgedrückt und nicht genau zu definieren, aber es klingt so, als bräuchten Sie mehr als nur ein paar Pingpongschläger, um diese Glocke freizulegen. Ich habe Pete und Wendy angewiesen, sich das Verfahren zur Erlangung einer Genehmigung mal anzusehen – unauffällig und diskret, natürlich.«
Pete Jeffcoat und seine Freundin Wendy Corden – braungebrannte und sportlich durchtrainierte blonde Kalifornier mit abgeschlossenem Studium in Archäologie respektive Gesellschaftswissenschaften – waren Selmas Assistenten.
»Gut«, sagte Sam. »Halten Sie uns auf dem Laufenden.«
Nach einem kurzen Zwischenstopp am Kai von Stone Town, um zu tanken und Verpflegung für den Tag einzuladen, brauchten sie weitere gemütliche anderthalb Stunden, um sich an der Küste entlang durch die Kanäle zwischen den äußeren Inseln Sansibars einen Weg zu suchen und zu den GPS-Koordinaten der Glocke zu gelangen. Sam ging zum Bug und warf den Anker ins Wasser. Die Luft war totenstill, der Himmel blau und wolkenlos. Da Sansibar knapp unterhalb des Äquators lag, fiel der Juli eher in den Winter als in den Sommer. Die Temperaturen lagen kaum über fünfundzwanzig Grad Celsius. Also ein idealer Tag, um zu tauchen. Erst zog er am Fahnenmast die Flagge mit weißen Streifen auf rotem Grund hoch, dann kam er zu Remi aufs Achterdeck.
»Flaschen oder Schnorchel?«, fragte sie.
»Lass uns mit den Schnorcheln anfangen.« Die Glocke lag in drei Meter tiefem Wasser. »Sehen wir uns erst einmal an, was uns erwartet, danach können wir weiter überlegen.«
Wie schon am Tag zuvor und während neunzig Prozent der gesamten Zeit in Sansibar war das Wasser atemberaubend klar und rangierte farblich zwischen Türkis und Indigo. Sam rollte sich rückwärts über das Dollbord, wenige Sekunden später gefolgt von Remi. Zusammen trieben sie ein paar Sekunden lang reglos auf der Oberfläche und warteten ab, bis sich die Wolke aus Luftbläschen und Schaum aufgelöst hatte, dann drehten sie sich um und tauchten. Sobald sie den weißen Sandboden erreicht hatten, wandten sie sich nach rechts und gelangten schnell zum Rand der Sandbank, wo sie ein weiteres Mal kopfüber abknickten und dem beinahe senkrechten Absturz bis auf den Grund folgten. Sie stoppten, knieten sich auf den Sand und rammten ihre Tauchermesser in den Untergrund, um sie als Handgriffe benutzen zu können.
Ein Stück voraus konnten sie den Rand der Goodbye-Zone erkennen. Der Gewittersturm der vorangegangenen Nacht hatte nicht nur die Strömung im Hauptkanal beschleunigt, sondern auch eine Menge Geröll aufgewühlt, so dass das Wasser wie eine solide graubraune Wand aus Sand aussah. Wenigstens würden auf diese Art und Weise Haifische von Abstechern ins seichte Wasser abgehalten. Der Nachteil war, dass sie die Strömung sogar dort spüren konnten, wo sie gerade schwebend verharrten.
Sam tippte gegen seinen Schnorchel und hielt den Daumen nach oben. Remi nickte.
Mit kräftigen Flossenschlägen stiegen sie wieder auf und brachen durch die Wasseroberfläche.
»Spürst du es?«, fragte Sam.
Remi nickte. »Es fühlte sich wie eine unsichtbare Hand an, die uns mitreißen will.«
»Halte dich dicht an der Sandbank.«
»Alles klar.«
Sie tauchten abermals. Auf dem Grund schaute Sam auf die Anzeige seines GPS-Geräts, deutete nach Süden an der Sandbank entlang und gab Remi mit den Fingern ein Zeichen: zehn Meter. Sie tauchten auf und schwammen hintereinander in diese Richtung. Sam schwamm voraus und hatte ständig ein Auge auf der GPS-Anzeige und eins auf ihrer Position. Schließlich stoppte er und deutete mit dem Zeigefinger nach unten.
Dort, wo die Glocke aus der Sandbank geragt hatte, war außer einem runden Krater nichts mehr. Besorgt blickten sie nach rechts und links. Remi entdeckte es zuerst: eine kleine Mulde im Boden, etwa drei Meter rechts von ihrer Position, die mit einer weiteren Mulde durch eine gekrümmte Linie verbunden war, ähnlich der Spur einer Schlange. Das Muster wiederholte sich. Sie folgte ihm mit den Blicken, bis sie, rund sechs Meter weiter entfernt, etwas Dunkles aus dem Sand ragen sah. Die Glocke.
Sie brauchten ein wenig Fantasie, um sich zusammenzureimen, was geschehen war: Während der Nacht hatten die vom Sturm aufgepeitschten Wellen an der Sandbank genagt und langsam, aber stetig den Sand um die Glocke weggespült, bis sie sich aus ihrem Ruhebett löste. Von dort hatte die Strömung die Glocke weitergerollt, und Physik, Erosion und Zeit hatten auf sie eingewirkt, bis der Sturm weitergezogen war.
Sam und Remi sahen einander an und nickten aufgeregt. Wo tansanische Gesetze ihnen verboten, »intensive Ausgrabungs- und Bergungstechniken« anzuwenden, hatte Mutter Natur zu ihrer Rettung eingegriffen.
Sie schwammen zu der Glocke hinüber und hatten erst die Hälfte der Distanz überwunden, als Sam nach Remis Arm griff, um sie zu bremsen. Sie hatte jedoch bereits angehalten. Sie brauchte ihre Augen nicht anzustrengen, um zu erkennen, was auch er gesehen hatte.
Die Glocke war am Rand des Abgrunds liegen geblieben. Mantel und Krone waren noch im Sand eingesunken, während Schlagring und Glockenmund schon ins Leere hinausragten.
Wieder an der Oberfläche, atmeten sie tief durch. Remi sagte: »Sie ist zu groß.«
»Zu groß für was? Um sie zu bewegen?«
»Nein, um von der Speaker zu stammen.«
Sam ließ sich das durch den Kopf gehen. »Du hast recht. Ist mir gar nicht aufgefallen.«
Die Verdrängung der Speaker wurde mit vierhundertfünfzig Tonnen angegeben. Laut den üblichen Größenverhältnissen der fraglichen Zeit dürfte ihre Glocke nicht mehr als sechzig Pfund gewogen haben. Diese Glocke hier war hingegen erheblich größer.
»Das wird immer seltsamer«, stellte Sam fest. »Zurück zum Boot. Wir brauchen einen Plan.«
Sie waren nur noch drei Meter vom Boot entfernt, als sie hinter sich das Dröhnen von Dieselmotoren hörten, die sich näherten. Sie erreichten die Leiter, wandten sich um und gewahrten in einhundert Metern Entfernung ein Kanonenboot der tansanischen Küstenwache. Sam und Remi kletterten auf das Achterdeck der Andreyale-Yacht und befreiten sich von ihrer Taucherausrüstung.
»Lächle und winke«, riet Sam murmelnd.
»Sind wir in Schwierigkeiten?«, fragte Remi im Flüsterton, während sie das Gesicht zu einem fröhlichen Grinsen verzog.
»Keine Ahnung. Das werden wir sicherlich bald erfahren.« Sam winkte.
»Wie ich gehört habe, sind tansanische Gefängnisse ziemlich ungemütlich.«
»Jedes Gefängnis ist ungemütlich. Aber alles ist relativ.«
Als es sich bis auf zehn Meter genähert hatte, drehte das Kanonenboot bei und legte sich, Bug an Heck, parallel neben sie. Sam erkannte jetzt, dass sie es mit einem modernisierten chinesischen Patrouillenboot der Yulin-Klasse aus den 1960ern zu tun hatten. Sie trafen auf ihren Reisen immer wieder auf Schiffe der Yulin-Klasse, und Sam, stets voller Interesse, hatte seine Hausaufgaben gemacht: vierzig Fuß lang, zehn Tonnen; Dreiwellen-Getriebe, zwei Dieselmotoren mit 600 PS Leistung und ein Paar 12,7-Millimeter-Zwillingsgeschütze am Bug und achtern.
Zwei Mannschaftsmitglieder in Dschungeltarnkleidung standen auf dem Achterdeck und zwei weitere auf dem Vorschiff. Alle hatten Kalaschnikows über den Schultern. Ein hochgewachsener Schwarzer in strahlend weißer Uniform, offensichtlich der Kapitän, trat aus der Kabine und kam zur Reling.
»Ahoi«, rief er. Anders als bei Sams und Remis früheren Begegnungen mit der Küstenwache machte dieser Kapitän ein grimmiges Gesicht. Es gab kein Lächeln und keine freundliche Begrüßung.
»Ahoi«, erwiderte Sam.
»Routinemäßige Sicherheitsüberprüfung. Wir kommen jetzt zu Ihnen an Bord.«
»Niemand hindert Sie daran.«
Die Maschinen des Kanonenboots orgelten dumpf, während sich das Yulin-Boot näher heranschob, bis sein Bug nur noch drei Meter entfernt war. Die Maschinen gingen blubbernd in den Leerlauf, und das Yulin-Boot trieb noch ein kleines Stück weiter und stoppte dann. Die Matrosen auf dem Achterdeck warfen Fender aus alten Autoreifen über die Reling, dann bückten sie sich, packten die Reling der Andreyale-Yacht und zogen die Boote aufeinander zu. Der Kapitän machte einen Satz über die Reling und landete mit katzenhafter Geschmeidigkeit neben Sam und Remi auf dem Achterdeck.
»Sie haben die Tauchflagge gehisst, wie ich sehe«, sagte er.
»Wir schnorcheln hier ein wenig herum«, klärte Sam ihn auf.
»Ist das Ihr Boot?«
»Nein, gemietet.«
»Ihre Papiere, bitte.«
»Für das Boot?«
»Und die Tauchgenehmigungen.«
Remi sagte: »Ich hole alles«, und trottete dann über die Treppe in die Kajüte hinunter.
Der Kapitän wandte sich an Sam. »Aus welchem Grund sind Sie hier?«
»Auf Sansibar oder jetzt an diesem Ort.«
»Beides, Sir.«
»Wir machen Urlaub. Uns hat es an dieser Stelle besonders gefallen. Wir waren schon gestern hier.«
Remi erschien mit den Dokumenten und reichte sie dem Kapitän, der zuerst den Mietvertrag inspizierte und danach ihre Tauchgenehmigung. Er blickte hoch und studierte ihre Gesichter. »Sie sind Sam und Remi Fargo.«
Sam nickte.
»Die Schatzsucher.«
Remi zuckte die Achseln. »Offenbar gibt es keine bessere Bezeichnung dafür.«
»Suchen Sie auf Sansibar nach irgendwelchen Schätzen?«
Sam lächelte. »Wir sind zwar nicht deswegen hergekommen, aber wir versuchen schon, die Augen immer offen zu halten.« Als er über die Schulter des Kapitäns hinwegblickte, konnte Sam hinter den getönten Kabinenfenstern des Yulin-Bootes eine schattenhafte Gestalt erkennen. Aufmerksam schien sie zu ihnen herüberzuschauen.
»Haben Ihre Augen schon irgendetwas entdeckt?«
»Eine Münze.«
»Sind Sie sich darüber im Klaren, was die tansanischen Gesetze in einem solchen Fall vorschreiben?«
Remi nickte. »Das sind wir.«
Auf dem Yulin-Boot wurde einmal gegen das Fenster geklopft.
Der Kapitän sah über die Schulter und sagte zu Sam und Remi: »Warten Sie hier«, dann kletterte er über die Reling und verschwand in der Kabine seines Schiffes. Eine Minute später erschien er wieder und kam abermals an Bord.
»Diese Münze, die Sie gefunden haben – beschreiben Sie sie.«
Ohne zu zögern, erwiderte Remi: »Rund, Kupfer, etwa so groß wie eine Fünfzig-Shilling-Münze. Sie ist ziemlich ramponiert. Bislang haben wir uns keinen Reim darauf machen können.«
»Haben Sie die Münze bei sich?«
»Nein«, sagte Sam.
»Und Sie behaupten, dass Sie nicht nach irgendwelchen Schiffswracks oder einem ganz besonders wertvollen Gegenstand suchen?«
»Das ist richtig.«
»Wo wohnen Sie auf Sansibar?«
Sam sah keinen Sinn darin zu lügen. Sie würden die Antworten sowieso genauestens überprüfen. »In einem Bungalow am Kendwa Beach.«
Der Kapitän gab ihnen ihre Papiere zurück, dann tippte er mit einem Finger gegen seinen Mützenschirm. »Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.«





























