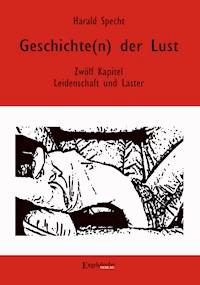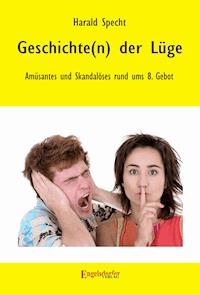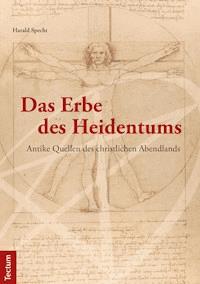
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das "Abendland" hat sich aus uralten, längst vergessenen Quellen entwickelt. Der Sieg des Christentums über heidnische Kulte, Mysterienbünde und gnostische Religionsgemeinschaften, aber vor allem die unheilige Liaison von Staat und Religion führten zu einem jähen Bruch mit vielen dieser antiken Traditionen. Was okkulte Bruderschaften oder mysteriöse Orden wie Alchimisten, Rosenkreuzer und Freimaurer als "Arcanum" hüteten oder man als Geheimnis der Tempelritter vermutete, wurde aber seit der Antike unauffällig auch in den Werken der Wissenschaft, Literatur und Kunst als heidnisches Erbe tradiert. Künstler und Gelehrte der Renaissance und Vordenker der Aufklärung wurden so zu den wahren Hütern dieses Vermächtnisses. Die verborgene Symbol-Sprache ihrer Werke enthält unerwartete Hinweise auf einen lang gehüteten Wissensstrom, der die Entwicklung des Abendlands begleitete und unterschwellig die heidnischen Weltbilder und deren kosmologische, philosophische, naturwissenschaftliche und kulturelle Traditionen weiterführte. Doch welche Geheimnisse wurden über die Jahrhunderte bewahrt, um diese uralten Weisheiten und Erkenntnisse vor Vergessen und Vernichtung zu retten? - Was hat antike Himmelskunde mit Religion und biblischen Figuren wie Jesus, Johannes oder Maria zu tun? - Welche heidnischen Wurzeln verbergen sich hinter unserem abendländischen Gedankengut bis hin zu den christlichen Feiertagen? - Was verraten uns versteckte Botschaften in alten Kunstwerken, wie etwa im scheinbar harmlosen Schäferidyll "Et in Arcadia ego" des genialen Malers Nicolas Poussin? Eine Fülle ähnlicher Fragen führt Harald Specht auf eine spannende Reise von der Antike bis hin zum aufgeklärten Europa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1414
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Harald Specht
Das Erbe des Heidentums
Harald Specht
Das Erbe des Heidentums
Antike Quellen des christlichen Abendlands
Tectum Verlag
Der Autor
Harald Specht, Dr. rer. nat. et Dr.-Ing. habil., Jahrgang 1951, ist Naturwissenschaftler. Neben mehr als 70 Fachpublikationen veröffentlichte er seit 1978 auch zahlreiche Drehbücher und Filmkommentare sowie Sachbücher und Romane.
Unter anderem
– „Von Isis zu Jesus - 5000 Jahre Mythos und Macht“ (2003)
Die „Trilogie des Allzumenschlichen“ mit den Bänden:
– „Geschichte(n) der Dummheit – Die sieben Sünden des menschlichen Schwachsinns“ (2004)
– „Geschichte(n) der Lust – Zwölf Kapitel Leidenschaft und Laster“ (2005)
– „Geschichte(n) der Lüge – Amüsantes und Skandalöses rund ums 8. Gebot“ (2006)
– „Der Tempel der Weisheit und die zweiundsiebzig Namen Gottes“ (2007)
– „Das Buch der Weisheit und die Spuren des Lichts“ (2008)
– „Jesus? – Tatsachen und Erfindungen“ (2010)
– „Der Jahwe-Code – Auf den Spuren der heiligen Zahl 72“ (2011)
– „Liebe, Laster, Leidenschaft – Geheimnisse großer Gemälde“ (2014)
Weitere Informationen zu Autor und Werk: de.wikipedia.org/wiki/Harald_Specht
Harald Specht
Das Erbe des Heidentums. Antike Quellen des christlichen Abendlands
© Tectum Verlag Marburg
ISBN: 978-3-8288-6235-7
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-3561-0 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung: Leonardo da Vinci, Vitruvianischer Mensch, circa 1492: Fotografie: Luc Viatour; http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg (bearbeitet). Pentragramm : shutterstock.com © konstantinks (bearbeitet)
Umschlaggestaltung: Mareike Gill | Tectum Verlag
Satz und Layout: Mareike Gill | Tectum Verlag
Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
„Mundum et hoc quodcumque nomine alio caelum appellare libuit, cuius circumflexu degunt cuncta, numen esse credi par est, aeternum, inmensum, neque genitum neque interiturum umquam.”
– C. Plini Secundi – Naturalis historia –
„Das Weltall und dasjenige,
das wir mit einem anderen Namen ‚Himmel‘ nennen,
unter dessen Wölbung alles sein Leben lebt,
hält man zu recht für ein göttliches Wesen.
Es ist ewig, unermesslich, weder gezeugt noch jemals vergänglich.“
Plinius der Ältere – (1. Jhd. u. Z.) – Naturgeschichte –
Meiner Familie
DANKSAGUNG
Ohne die freundliche Unterstützung zahlreicher Freunde und Kollegen bei der Recherche wäre das Buch nicht in dieser Form zustande gekommen. Besonderer Dank gilt daher:
–Dem Kunsthistoriker und Poussin-Fachmann Herrn Prof. Dr. Henry Keazor (Universität Heidelberg) für seine Hinweise zu den Poussin-Gemälden „Et in Arcadia ego II“ und „The Assumtion oft the Virgin I“,
–meinem Freund, Prof. Jean-Michel Genevrier (Frankreich / Belgien) für den Kontakt zum Louvre und seine Bemühungen zur Klärung des exakten Gemälde-Formates für das Gemälde „Et in Arcadia ego II“,
–der Buddhistin Yamuna Yogini, die mir über das Brauchtum in Nepal, China und Indien und den Zyklus der Menschenalter bis zum 72. Lebensjahr berichtete,
–meinem langjährigen Korrespondenzpartner, dem Schriftsteller und Experten für Salomons Tempel Herrn Peter Aleff (New Jersey, USA), für die Angaben zur astronomischen Ausrichtung dieses Bauwerks, für die Hinweise zur Zahl 72 bei Homer und zur sumerischen Sonnenrosette,
–dem Theologen und Experten für die Frühgeschichte des Christentums, Herrn Dr. Detering für seine fachkundige Unterstützung bei der Auswertung altgriechischer Texte,
–der Sprach- und Literaturwissenschaftlerin sowie Sachbuch-Autorin Sabina Marineo (Venedig / München) für zahlreiche Hinweise zur „Arkadien-Strömung“,
–Frau Katrin Tevdorashvili (Georgien) für ihre Fotoarbeit in Georgiens Kirchen
–und nicht zuletzt meinen Korrespondenzpartnern Raphael Lataster (Sidney / Australien) und Pier Tulip (Neapel / Italien) für ihre anregenden Hinweise in ihren Arbeiten und Büchern.
–Mein Dank gilt darüber hinaus den Mitarbeitern des Verlages mit Herrn Dr. Heinz-Werner Kubitza an der Spitze für ihre konstruktive Zusammenarbeit bei der Erstellung des druckfähigen Manuskriptes. Dies gilt insbesondere für Frau Mareike Gill, die sich mit Sachkenntnis und viel Liebe zum Detail dem Manuskript gewidmet hat.
Wie immer möchte ich meiner Frau Christine ein ganz besonderes Dankeschön sagen. Ohne ihr Zutun und ihre Geduld wäre meine Arbeit nicht möglich gewesen.
Köthen / Anhalt, 21. Oktober 2014
INHALT
Vorwort – Ein Grabmal und viele Fragen
KAPITEL 1 – Das erste Eckstück des Puzzles
– Ein genialer Maler und seine rätselhaften Bilder –
Zwei Fassungen und ein Gedanke?
Et in Arcadia ego & Memento mori
Landschaftsidyll oder Sternenkarte?
Arcadia, arcus oder arcas?
Die Jungfrau – Wie im Himmel so auf Erden
Eine Lösung, viele Fragen
KAPITEL 2 – Das zweite Eckstück des Puzzles
– Auf den Spuren der heiligen Geometrie –
Das große Entsetzen
Alles begann im babylonischen Chaldäa
Die 72 Teile des Himmels
Eine uralte ägyptische Legende
Die heilige „Fünf“ und das Sinnbild des Göttlichen
Ein unvergleichliches Himmelssymbol
Das Tetragramm Gottes und die Pythagoräer
Die 72 geheimen Namen Gottes
KAPITEL 3 – Das dritte Eckstück des Puzzles
– Die Erfindung Gottes als Naturprinzip –
Aus Vielen wurde Einer – Woher kam Jahwe?
Weg von den Sternen – hin zu Jahwe
Ich bin, der ich bin
Die Septuaginta – Das große Werk der 72 Weisen
Isis und Serapis – auf dem Weg nach Hellas und Rom
Hin zu den Sternen – Baal erobert das Imperium
„Das sei, was wir Gott nennen.“
KAPITEL 4 – Das vierte Eckstück des Puzzles
– Die Prophezeiung einer neuen Welt –
Arkadien und Pan
Die Dichter und die Weltzeitalter
Des Himmels Zufall ist des Menschen Wunder
Großer Wirrwarr um große Zahlen
Die Zahl des Himmels und des Horizonts – Die 72 überall
Astraea, die Zeitalter und wieder der Maler Poussin?
KAPITEL 5 – Zwischenstation Mailand
Resümee und neue Anhaltspunkte
KAPITEL 6– Neue Götter für das alte Rom
Alte Weisheit, neue Kulte
Sonne, Mond und Sterne – Mithras erobert das Imperium
Wirrwarr um den rechten Glauben
Von Daniel bis Vergil – Hoffnung auf das neue Zeitalter
Das Zeitalter der Fische(r)
Vom Märchen bis zur frommen Phantasie – Das tradierte Bild der Urchristen
Von Christos zu Jesus – Die frühe Christenheit
Nur Mythen- und Metaphern-Mix? – Die verwirrende Welt der Gnostiker
KAPITEL 7 – Als aus Hirten Herren wurden
– Vom geheimen Elitezirkel zur Staatsreligion –
Mithras versus Christus
Der Sieg der Nächstenliebe
Jedem Alles – Die Resultate von Synkretismus und Macht
Solarer Pantheismus – die letzte Form römischen Heidentums
Von der Verfolgung bis zum Sieg – An der Tafel des Kaisers
KAPITEL 8 – Der unterirdische Wissensstrom
– Die letzten Spuren des heidnischen Christentums –
„Die Wißbegierde weiche dem Glauben …“
Verfälscht, vernichtet und vergessen
„Zum Schweigen bringen, verbrennen und zerstören“
Halb Heide, halb Christ
KAPITEL 9 –Wie aus Alt-Heidnischem Neu-Christliches wird
– Beispiele für das Überleben –
Das fast fertige Puzzle: eine Bestandsaufnahme
Der große Glaubenstrick – Die göttliche Mutter wird Gottesmutter
Christus wird Gott, Maria überlebt
Aus Isis wird Maria – Von heidnischen Kulten bis zum christlichen Festkalender
Heidnische Heiligtümer und Kultstätten
Die Sache mit dem Apfel – Zur Rolle der Frau und Bedeutung der Sexualität
Marienfeste und ihre heidnischen Wurzeln
Wintersonnenwende und Frühlings-Äquinoktium – heidnische Traditionen zu Weihnachten und Ostern
KAPITEL 10 – Rebellion in Kirche, Kultur und Kunst
„Tötet sie alle, Gott wird die Seinigen schon erkennen“ – Von den Gnostikern bis zum Ketzerkuss
„In der Mitte von allen aber hat die Sonne ihren Sitz.“
KAPITEL 11 – Heidnische Geheimsymbole und Metaphern
„Ex oriente lux“
Drei Religionen und ein Gott?
Rätselsprache überall – Zahlen, Winkel, Zeigefinger
Okkultes und Magisches – Heidnische Symbolik im Mittelalter
Und immer wieder: Das Pentagramm
KAPITEL 12 – Das fertige Puzzle und ein neues Bild der Welt
Und noch einmal: Der Maler Nicolas Poussin
Gespreizte Finger – Hinweis auf Arkadien?
„SAPERE AUDE !“
„Ich habe dieser Hypothese nicht bedurft.“ – Warum Gott nicht mehr nötig war
NACHWORT– „Imagine“ by John Lennon
Anhang
Literatur- und Quellenverzeichnis
Abbildungen
VORWORT
Ein Grabmal und viele Fragen
Die ganze Sache ließ mir keine Ruhe. Seit Wochen schwirrten Ideen durch meinen Kopf, die sich immer wieder aufdrängten, ohne ein klares Bild zu ergeben. Intuitiv spürte ich jedoch, dass diese Gedankensplitter zusammengehörten; so wie farbige Blütentupfer auf einem riesigen Feld oder die Schnipsel eines großen Puzzles, die sich erst gemeinsam zu einem erkennbaren Ganzen fügen.
Im Ergebnis entstand dieses Buch, das kaum in eines der üblichen Genres einzuordnen ist; das weder ein rein historisches Sachbuch noch eine theologische Abhandlung ist, nicht allein als philosophische Betrachtung und auch nicht als kunsthistorischer Abriss gelten kann. All diese Aspekte flossen aber in die Recherche ein, die vor etwa zehn Jahren aus reiner Forscherlust und Neugier begann. Das Buch ist deshalb auch bewusst mit persönlichen Anmerkungen versehen, die dem Leser die Überlegungen des Verfassers verdeutlichen und ihn die einzelnen Schritte und Motive der Recherche miterleben lassen. Aus gleichem Grund wurden auch alle Quellen bis hin zu lexikalischen Hinweisen angegeben oder weiterführende Fakten in zahlreichen Fußnoten wiedergegeben. Der Leser kann somit die Gedankengänge und Recherchestränge dieser individuellen Spurensuche wohl am besten nachvollziehen.
Diese Suche auf den Spuren des Heidnischen im abendländischen Christentum hatte mit einem geheimnisvollen Gemälde von Nicolas Poussin begonnen, auf dem eine rätselhafte Begräbnisstätte abgebildet war. Das Bild zeigte darüber hinaus drei Hirten und eine auffällig gewandete Frau, die jenes Grabmal offenbar zufällig auf einer Anhöhe entdeckt hatten und sich über die mysteriöse Inschrift des Monuments zu wundern schienen. „Et in Arcadia ego“ („Auch ich in Arkadien“) war da zu lesen. Kryptische Worte, die scheinbar für die Ewigkeit in den steinernen Sockel gemeißelt worden waren; ein merkwürdiger Totenspruch, der wie ein Orakel Raum für Deutungen bot und mich beim ersten Betrachten des Bildes ratlos zurückließ.
Während der Arbeit an einem früheren Buch hatte ich dieses Meisterwerk des französischen Barockmalers schon einmal untersucht, wobei mir eine geheime Geometrie aufgefallen war, die der Maler geschickt in diesem Bildnis verborgen hatte. So war der gesamte Bildaufbau des Kunstwerkes offenbar einem exakten geometrischen Plan unterworfen, der auf das uralte Geheimsymbol des Fünfsterns, des Pentagramms mit seinen Winkeln zu 72° hinauslief. Selbst der Stab des knienden Hirten war exakt im Winkel von 72° zur Bildhorizontalen angeordnet worden. Vermutlich sollte Poussins Gemälde mit dem unverfänglichen Titel „Die Hirten von Arkadien“ dem wissenden Betrachter mehr verraten, als die harmlose Szene dem Unkundigen offenbaren konnte.
Zu meiner Überraschung fand ich wenige Tage später in meinen eigenen Aufzeichnungen, die ich schon vor Jahren bei Nachforschungen zur ägyptischen Göttin Isis abgeheftet hatte, einen weiteren interessanten Hinweis dazu. In einer selbst verfassten Fußnote zu diesem Text war vermerkt, dass die Zahl „Zweiundsiebzig“ wohl in der ägyptischen Mythologie eine hohe Symbolbedeutung hätte und darüber hinaus mit der Zahl „Fünf“ in Verbindung stünde. Einige dazu aufgeführte Randbemerkungen ließen jedoch damals mehr Fragen aufkommen als Antworten parat gewesen wären. Auffallend war, dass auch der Isis-Bruder und ägyptische Gott Seth laut mythologischer Überlieferung „72 Spießgesellen“ gehabt haben soll und dieser an sich unwichtige Fakt in antiken Schriften immer wieder betont wurde. /1/ Ferner erinnerte mich der Verweis auf die „Fünf“ nun deutlich an die fünfzackige Sternstruktur des Pentagramms und die Bildkompositionen Poussins. Welcher Zusammenhang aber hier bestand, war mir damals nicht klar.
Nun brannte ich darauf, näheres über den geheimnisumwitterten Maler und seine Kunst in Erfahrung zu bringen. Zu meiner großen Verblüffung zeigte sich, dass der Künstler in vielen seiner Bilder noch weit interessantere Details versteckt hatte, die ich bisher stets übersehen hatte. Was aber die Vorliebe Poussins für pentagonale Bildstrukturen mit Arkadien zu tun haben könnte, blieb dennoch im Dunkeln. Folgerichtig beschäftigte ich mich nun verstärkt mit derartigen Geheimnissen berühmter Gemälde. Die Resultate waren so unerwartet, dass sie nicht nur Anlass zu einem weiteren Sachbuch gaben, sondern darüber hinaus überraschenderweise auch das Arkadien-Puzzle vervollständigen konnten.
Eines der dazu notwendigen Puzzleteilchen lieferte wiederum ein Gemälde Poussins, sein um 1626 gemaltes Ölbild „Himmelfahrt der Jungfrau“. Dieses Kunstwerk verbarg nicht nur die erwartete geometrische Pentagramm-Struktur, sondern es enthielt auch versteckte Hinweise auf einen völlig anderen Inhalt des Bildes. Vermutlich hatte Poussin hier gar nicht die christliche Jungfrau Maria, sondern eine ganz und gar heidnische Göttin dargestellt! Was auf den ersten Blick also als Meisterwerk christlicher Bildkunst zu verstehen war, entpuppte sich bei genauerer Analyse als Darstellung eines durch und durch anderen Themas. In einer Zeit, in der jedwedes Abweichen vom christlichen Glauben für einen Künstler oder Wissenschaftler härteste Anklagen und sogar den Tod auf dem Scheiterhaufen bedeuten konnte, hatte es Nicolas Poussin gewagt, nur scheinbar die Jungfrau Maria zu malen. Nur auf den ersten Blick war also hier die Mutter Gottes dargestellt, wie sie laut römisch-katholischer Lehre am Ende ihres irdischen Daseins in den Himmel erhoben wird. In Wirklichkeit verwies das Gemälde jedoch auf die heidnische Göttin Astraea. Sie galt in der Antike als Symbol für eine ganz andere Himmelfahrt und versinnbildlichte einst eine paradiesisch anmutende Welt. Am Ende dieses goldenen Zeitalters, so las ich in einem Lexikon zur Mythologie, /2/ verließ Astraea aus Enttäuschung über das Menschengeschlecht die Erde, um als Sternbild „Jungfrau“ in den Himmel zu kehren. Noch verblüffender war, dass man Astraea auch mit Isis gleichsetzte, auf die ich wiederum bei meinem Suchen zur Zahl 72 gestoßen war. Gelang es dem Bildbetrachter, diese Gestalt in Poussins Kunstwerk richtig zu deuten, wurde uns vom Maler also offenbar eine ganz und gar andere, nicht christliche, sondern heidnische Geschichte erzählt. War der geniale Poussin hier gar als Ketzer am Werk gewesen?
Antworten auf diese Frage fand ich in den gängigen Büchern der Kunstgeschichte nicht. Es bedurfte ganz eindeutig weiterer Puzzleteilchen, um die immer spannender werdende „Sache Arkadien“ aufzuhellen.
Eines dieser Teilchen entdeckte ich ganz zufällig in einem sehr bekannten Porträt des Dichterfürsten Goethe. Schon in unseren Schulbüchern wurde uns dieses berühmte Gemälde des Malers Tischbein als „das Goethebild“ präsentiert, wenn im Literaturunterricht über die Italienreise des Dichters gesprochen wurde. Das großformatige Werk entstand 1786 in Rom und zeigt „Goethe in der Campagna“, wie er „auf denen Ruinen sitzet und über das Schicksal der menschlichen Werke nachdenket“ /3/. Von den Kunstwissenschaftlern wurde das Gemälde häufig als wenig gelungen oder zumindest unvollendet getadelt. Von einem „merkwürdig entleerten Bildhintergrund“ /3/ und „anatomischen Mängeln“ wurde geredet, ja sogar ein unnatürlich langes Bein und „zwei linke Füße“ des Körperporträts kritisierte man. Dass der wahre Grund dieser Darstellung aber mit einer versteckten Bildaussage zusammenhängen konnte, war bisher scheinbar niemandem aufgefallen. Lag ich mit meiner Bildanalyse richtig, dann hatte auch der Maler Tischbein mehr in sein Porträt „hineingemalt“, als man auf den ersten Blick vermuten konnte. Auch hier war die ominöse pentagonale Geometrie ganz unverkennbar bildbestimmend, spiegelten bestimmte Bilddetails einzelne Phasen der zivilisatorischen Entwicklung wieder. Ging es auch hier irgendwie um mein Stichwort „Arkadien“?
Schon ein erster Blick in die mehrbändige Goetheausgabe brachte das erhoffte Indiz. Es war mehr Entdeckerfreude als Verwunderung, als ich hier in Goethes Aufzeichnungen einen ernstzunehmenden Beleg meiner Vermutungen fand. Der Dichter hatte seine autobiografisch-literarische Darstellung der „Italienischen Reise“ auch mit einem Motto überschrieben, das ganz und gar nicht zu Italien gehörte, sondern auf Griechenland zu deuten schien. Erstaunlicherweise war dieses Motto dasselbe wie auf dem Grabmonument Poussins. Es lautete: „Et in Arcadia ego“!
Ein erster Verdacht drängte sich auf, der die Richtung für das Zusammenfügen meines Puzzles vorgab: War dieses „Arkadien“ etwa ein Synonym für etwas anderes, für etwas Unausgesprochenes, das in den zeitgenössischen Kunstwerken nicht direkt benannt oder dargestellt werden sollte? War dieses „Arkadien“ ein Schlüsselbegriff und die Pentagramm-Strukturen ein heimlicher Code für etwas, was Poussin und andere Künstler des Mittelalters nicht offen zeigen wollten oder durften?
Wie aber konnten der geheimnisumwitterte Barockmaler Poussin, der Feingeist und Freidenker Goethe, die uralte 72°-Symbolik des Pentagramms oder die heidnischen Göttinnen Astraea und Isis in Einklang mit Arkadien gebracht werden? Welche Rolle spielte die Gottesmutter Maria, die genau wie die antiken Göttinnen ewige Jungfrau war? Warum nutzte man überhaupt derartige Bildsymbole und Metaphern und was bedeuteten sie wirklich?
Welche Geheimnisse sich hinter all dem verbargen, schien angesichts der verworrenen Einzelhinweise schier unergründlich. Wollte ich meine wachsende Neugier stillen, blieb nur eins: Die genaue Untersuchung aller Einzelteilchen, die Klärung vieler Detailfragen und das Auffinden von passenden Fugen zwischen den unzähligen Puzzlestückchen. Das buntgewürfelte Kaleidoskop der vielen Hinweise musste so in Ordnung gebracht werden, dass daraus ein erkennbares Gesamtbild entstehen konnte. Wie bei einem wirklichen Puzzle war es sicherlich sinnvoll, zuerst die markanten Eckpunkte und Teile des äußeren Rahmens zu finden. Erst dann konnte ich darauf hoffen, nach und nach den inneren Teil dieses Labyrinths zu entdecken und das Knäuel der vielen Fragen zu entwirren.
Bei meinen Recherchen hatte ich mir angewöhnt, wichtige Artikel zu kopieren und interessante Stellen in einschlägigen Büchern mit farbigen Post-it-Haftmarkern zu kennzeichnen. Schon nach wenigen Monaten lagen 11 dicke Aktenordner vor mir. Angefüllt mit Notizen, Kopien und PC-Ausdrucken warteten sie auf ihre Durchsicht. Auch die beiseitegelegten Nachschlagewerke und Sachbücher zum Thema „Arkadien“ stapelten sich bergeweise und die meisten Bücher waren vor lauter Notizzettelchen kaum noch zu handhaben. Vor mir breitete sich ein Brachland Tausender Fakten aus, das es nun zu beackern galt. Was sich später als Unkraut oder im Gegenteil als Frucht erweisen sollte, war abzuwarten. Doch die Mühe sollte sich lohnen. Was sich anfangs wie ein dünn sprießendes Ährenfeld auftat, versprach mehr und mehr eine satte Ernte. Viele der Puzzleteilchen am rechten Fleck ergaben nun ein eindrucksvolles Bild, interessanter als ich es erwartet hatte.
Dass mein langes Suchen letztlich zu ganz existenziellen Fragen und erstaunlichen Antworten führte, konnte ich anfangs nicht erwarten. Dass meine Puzzlearbeit aber gar eine spannende Reise von der barocken Kunst über interessante Geschichten aus der Antike und dem Mittelalter wieder zurück zu unserer aufgeklärten Zeit bedeuten würde, machte die Sache nur noch spannender.
Den interessierten Leser lade ich gern auf diese Reise durch viele Jahrtausende ein.
Köthen, im Januar 2013
KAPITEL 1
Das erste Eckstück des Puzzles – Ein genialer Maler und seine rätselhaften Bilder –
Zwei Fassungen und ein Gedanke?
Immer wieder starrte ich auf die großflächigen Reproduktionen, die ich mir von Poussins Gemälden besorgt hatte. Interessanterweise hatte Nicolas Poussin (1594 – 1665) das Thema „Arkadien“ zweimal in Szene gesetzt. Zum einen malte er zwischen 1638 und 1640 sein berühmtestes Gemälde „Les bergers d’Arcadie“ (oder „Et in Arcadia ego – II“)1 und zum anderen hatte er etwa zehn Jahre davor ein gleichbenanntes Bild geschaffen, das häufig auch als „Et in Arcadia – I“ betitelt wird.2 Niemals aber gestaltete der Künstler seine Bilder zum gleichen Thema in derselben Weise. Das galt nicht nur für den Aufbau und die dargestellten Figuren, sondern auch in Bezug auf die Farbgebung. In allen diesen Aspekten unterschieden sich beide Arbeiten erheblich. Beide Gemälde geben jedoch etwa die gleiche Szene wieder: In idyllischer Landschaft stoßen Schäfer unvermittelt auf ein Grabmonument, in das die Worte „Et in Arcadia ego“ eingemeißelt sind. Sich der eigenen Vergänglichkeit bewusst werdend, sind die Schäfer darüber erstaunt und erschrocken.
Während die erste Fassung im Hochformat neben zwei Hirten und einer ganz in weiß gewandeten Schäferin einen älteren Mann zeigt, stellt uns Poussin in der berühmten zweiten Fassung drei Hirten und eine in Gelb und Blau gekleidete Frau dar. In einschlägigen Kommentaren der Kunsthistoriker war der Alte stets als Sinnbild des „Flussgottes Alpheus“ beschrieben worden. Die weibliche Figur ließ sich offenbar schwerer deuten. Sie sei, so konnte man lesen, eine „Allegorie der Pittura“ oder der „Daphne-Laura“, eine Verkörperung und Huldigung der Malerei oder doch eher ein Ausdruck der tröstenden Kunst./8//71/ – /73/
Andere vermuteten in ihr Athene,/34/sahen in ihr eine „Muse der Geschichte“ oder die „Arcadia, eine Personifizierung der Gegend von Arkadien“./6/ Wieder andere sprachen sich eher für „Sophia“, die personifizierte „Weisheit“ aus./7/
Über die verschiedenen Figuren hinaus waren auch deren Reaktionen über das aufgefundene Grabmal offenbar nicht die gleichen. Im ersten Fall überwiegen Überraschung und Erschrecken, in der zweiten Fassung eher das Interesse und die fragenden Blicke der Hirten. Ferner setzt der Maler die Szene seines zweiten Bildes ins Breitformat, wird das barocke Grabmonument der früheren Fassung hier zum schlichten Block mit abgeschrägten Kanten und gleichzeitig zum Mittelpunkt des Gemäldes. Darüber hinaus fällt das jüngere Gemälde auch durch eine bewusste Symmetrie auf, die nicht nur jeweils zwei Figuren gleichmäßig ins Bild setzt, sondern auch den Blick des Betrachters aktiver ins Zentrum des Geschehens führt. Verstärkt wird dieser Effekt durch eindeutige Gesten der Figuren, die das Augenmerk des Betrachters genau auf die Mitte des Grabsockels und dessen Inschrift „Et in Arcadia ego“ lenken. Während die Schäferin der ersten Fassung wie ihre zwei Kollegen erstaunt das Monument untersucht und nur der ältere Mann am Fuße des Sockels unbeteiligt scheint, blicken die drei Hirten der zweiten Fassung nicht nur interessiert auf die Inschrift, sondern fragenden Blickes auch auf die offenbar unbeeindruckte und erhabene Frau an ihrer Seite. Gerade die Frauen unterscheiden sich auf beiden Gemälden deutlich. In der älteren Fassung sehen wir eine leicht bekleidete Schäferin mit fast entblößter Brust in einem schlichten, die Schenkel nur knapp bedeckenden weißen Kleid. Sie erinnert eher an ein ungezwungenes junges Mädchen und ähnelt einer unbändigen antiken Nymphe. Im Gegensatz dazu strahlt die sittsam in Gelborange und Blau gewandete reifere Frau der zweiten Fassung eine besondere Sicherheit und Würde aus. Sie scheint zu wissen, wie die Inschrift des Grabes zu deuten ist. Wie zum Trost legt sie ihre Rechte auf die Schulter des fragenden Hirten, der offenbar eine Erklärung von der Wissenden erhofft. Nicht zu Unrecht wurde diese Figur daher auch als Personifikation der „Weisheit“ gedeutet.
Hatte Poussin auf der ersten Fassung noch drohend einen Totenschädel auf dem Grabmal platziert, fehlt dieser sonst übliche Blickfang in der jüngeren Arbeit. Erst auf den zweiten Blick ist hier der Tod im Bild, zart angedeutet durch einen Schatten, den der rechte Arm des knienden Hirten in Form einer Sense auf das Monument wirft.
Insgesamt strahlt die jüngere Fassung eine weit weniger düstere Stimmung aus als das Arkadiengemälde Nummer I. Durch insgesamt hellere Farben, die eher fragenden statt traurigen Gesichter der Hirten und vor allem durch das Weglassen des eindeutig auf den Tod weisenden Schädels will die Botschaft des Künstlers nicht so wie beim früheren Gemälde zu einer eindeutigen Aussage über Sterben und Vergänglichkeit passen. Der Kunsthistoriker und Poussin-Kenner Henry Keazor sah deshalb sogar eine „heitere Gelassenheit“ in dieser Szene./6/Zugleich glaubt Keazor auch im Hinblick auf das Arkadienmotto an eine inhaltliche Umdeutung, die der Maler gegenüber der klaren Todesaussage der Frühfassung hier zugunsten einer ruhigen „Besinnlichkeit“ verändert zu haben schien.Ähnlich sieht dies der Publizist Udo Leuschner. Er merkt an, dass im Gegensatz zur ersten Bildfassung nun die „Hirten und ihre Begleiterin … keineswegs aufgewühlt und bestürzt“ wirken, „sondern elegisch und kontemplativ. Die Szene ist von einer fast heiteren Ruhe. Aus dem Sarkophag ist ein Grabmal geworden, und der Totenkopf … ist gänzlich aus dem Bild verschwunden. Das ‚memento mori‘ hat sich in eine sanfte Elegie verwandelt. Die zweite Fassung signalisiert den endgültigen Triumph des barocken Lebensgefühls.“
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!