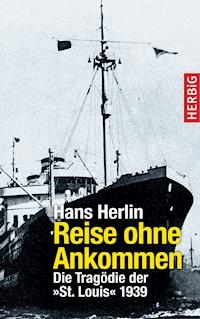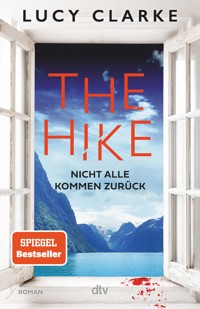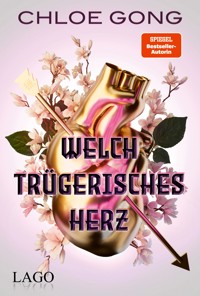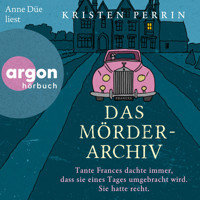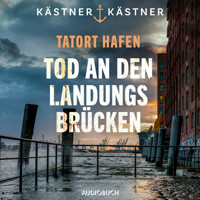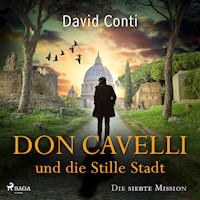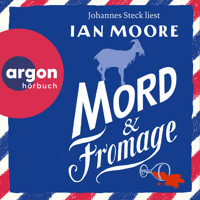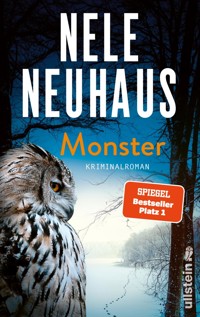4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Deutschland im Herbst 1993: Als die Leichen des pensionierten Verfassungsrichters Harrach und der Journalistin Anne Roeder (seiner Geliebten?) in der einsam gelegenen Villa Wallstein nahe der kleinen Stadt Liebenburg gefunden werden, lautet das Untersuchungsergebnis: Doppelselbstmord. Der Fall scheint klar; schnell werden die Akten geschlossen. Doch Harrachs Sohn Robert, Beamter des BKA, gibt sich mit dieser Erklärung nicht zufrieden. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Ähnliche
Hans Herlin
Das Erbe
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
Für Georg und Kathalina, meine treuesten Leser
Die Personen in dieser Geschichte sind nur in der Vorstellung des Autors vorhanden, sie haben keinerlei Ähnlichkeit mit Lebenden oder Verstorbenen – obwohl Kenner unserer jüngsten Geschichte den Eindruck gewinnen könnten, das hier Geschilderte enthalte einen Kern Wahrheit.
Die wichtigsten Personen
HARRACH, Hans Otto Friedrich: Bundesverfassungsrichter i.
HARRACH, Robert: sein Sohn, Beamter des BKA
SJIGETTI, Doris von: seine Tochter, Immobilienmaklerin
PEREIRA, Josef: Harrachs Diener
PEREIRA, Helena: dessen Frau
ROEDER, Victoria: ehemaliger Schlagerstar
ROEDER, Anne: deren Enkelin
HOLLE, Max: Vertreter der Thorbecke Pharma i.R.
HOLLE, Eleonore: dessen Frau
HOLLE, Julia: dessen Tochter, Krankenschwester
ZACHARIAS, »Nikita«: dessen Cousin
MEIXNER: Präsident des BKA
DAHLBERG: Vizepräsident des BKA
GAUSS, Eugen: Leiter des Kriminaltechnischen Instituts des BKA
MATUSCHEK:BKA-Beamter
LOHMANN, Karl: Polizeipräsident von Liebenburg
WEBER: Beamter der Kriminalpolizei
BERBALK: Polizeiarzt
MOSCHKAU, Otto: Kriminalrat, Chef des Sittendezernats von Liebenburg
DR. ZEITLER, Jürgen: Staatssekretär
ESSER, Julius: Oberbürgermeister von Liebenburg
DR. THORBECKE, Hans: Besitzer des Konzerns Thorbecke Pharma
NAGENGAST, Rolf: Rechtsanwalt
DR. WÖLFL: Rechtsanwalt
DR. QUACKENBUSCH, W.: Leichenbeschauer
SUCHAU, Alfred: Rechtspfleger beim Bundesverfassungsgericht
DR. HÜHNFELD: Landarzt
DR. KORRODI-CLAUSEN, Elisabeth: Leiterin der »Residenz Franconia«
WENDLAND: Druckereibesitzer
BILEK: ehemaliger Kaligrubenarbeiter
BERGHOF, Holger: Skinhead
LATZWELL, Leo: Pförtner am Institut für Sozialforschung der Universität Liebenburg
HÜBNER, Ellie: dessen Freundin
1
Um 18 Uhr an jenem Mittwoch – einen Tag vor dem Herbstanfang – fühlte sich Richter Harrach alles andere als moribund. Er machte einen jener langen Spaziergänge, von denen ihn auch das schlechteste Wetter nicht abhielt und denen er wahrscheinlich seine gesunde Bräune verdankte. Er war 71, klein, dünn und drahtig und hatte immer noch diesen steifen, aufrechten Gang (um größer zu erscheinen?) und jenen Ausdruck auf dem Gesicht, den die einen als Selbstsicherheit deuteten, die anderen als Arroganz.
Er trug einen abgetragenen Lodenmantel, einen Schlapphut, schwarze Schnürstiefel. Der Hund an seiner Seite war ein Riesenschnauzer, auf den Mann dressiert, zu seinem persönlichen Schutz. Jemand hatte ausgerechnet, der Richter habe in seiner Laufbahn in über dreißig Jahren an die 30000 Urteile gefällt, habe also 30000 potentielle Feinde. Er führte seine Prozesse ruhig, ohne laute Worte. Aber er ließ nie Rührseligkeit aufkommen. Anwälte, die Haupttäter vertraten, setzten Himmel und Hölle in Bewegung, daß ihr Mandant nicht vor seine Kammer kam. »Maximum-Harrach« – den Titel hatte er sich am Bayerischen Obersten Landesgericht erworben. Seine letzten zwölf Jahre in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht waren ruhiger verlaufen. Aber bei seiner Pensionierung vor nunmehr drei Jahren hatte er immer noch zu der Kategorie der höchst gefährdeten Personen gehört.
Das Bundeskriminalamt, Abteilung Personenschutz, hatte den Richter mit einem gepanzerten Mercedes, Fahrer Naujocks und ebenjenem dressierten Riesenschnauzer ausgestattet. Zuerst hatte es Harrach geschmeichelt, so wichtig genommen zu werden. Aber das hatte sich abgenützt. Naujocks – schon in Karlsruhe sein Leibwächter und ihm treu ergeben – hatte unter dem Umzug gelitten: Der ungemütliche Klotz von Villa, abgelegen, am Rande düsterer Wälder; lange, kalte Winter und Frühlingsstürme, die einem durch Mark und Bein gingen – er hatte in seiner peniblen Art notiert, daß es im ersten Jahr 135 Nebeltage gegeben hatte. Das nächste Dorf, Hardt, früher Grenzübergang zur DDR, bestand aus fünfzig tristen Häusern. Es hatte nichts aufzuweisen als seine beiden fragwürdigen Wahrzeichen: einen baufälligen Wasserturm und ein Grenzmuseum. Und die Freuden, die Liebenburg – dreißig Kilometer entfernt – einem Junggesellen zu bieten hatte, konnten Naujocks, ein Kind von St. Pauli, nicht reizen.
Er hatte nicht protestiert, als Naujocks abgezogen wurde. Das nächste war der Mercedes – Sparmaßnahme einer Regierung, die sich mit der Wiedervereinigung übernommen hatte. Blieb der Hund, der Harrach auf seinen Wanderungen Gesellschaft leistete; vielleicht hatte der schon immer die falschen Gene gehabt; von seiner Aggressivität war nichts geblieben, wie auch, wenn man ihn überfütterte, ihn nicht mehr im Zwinger hielt.
Harrach brauchte nicht auf seine Uhr zu blicken, als er die Seitentür des großen Tores durchschritt; er wußte, es war kurz vor 18 Uhr. In zwei Stunden erwartete er seinen Gast.
Besuchern, an denen Harrach gelegen war, beschrieb er die Lage der Villa als »das letzte Haus von Hardt«. Denen, die er widerwillig empfing, sagte er »das erste Haus im Grauen Land«, wie der Landstrich hieß. Im Park, die untergehende Sonne in den Augen, ging er den langen, gewundenen Weg entlang. Das Gras stand zu hoch. Die Buchsbaumeinfassungen wiesen Löcher auf, verdorrte Pflanzen. Die Treibhäuser – ein Hobby des früheren Besitzers – waren in einem beklagenswerten Zustand, das Glas vom Hagel zerschlagen, die Träger verrostet. Nur das Gartenhaus, in dem das portugiesische Ehepaar wohnte, hatte einen neuen Anstrich und eine neue Heizung bekommen. Die Portugiesen standen schon in Karlsruhe in seinen Diensten: Helena kochte, kümmerte sich um die Wäsche, Josef war eine Art Butler, ein Mann für alles.
Die Villa Wallstein war in den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts erbaut worden. Der Eigentümer war ein durch Spielzeug zu Reichtum gekommener Drechsler, der »Spielzeug-Baron«. So sah das Haus auch aus, mit seiner Kalksteinfassade, seinen Säulen, Türmen, das Ganze gekrönt von einer Sternwarte; als hätte dem Architekten einer der Sandsteinbaukästen, die eine Spezialität der Firma waren, als Vorlage gedient.
Josef öffnete die mit Buntglas versehene Tür. Er war Mitte Vierzig, dürr und drahtig, dunkelhaarig, mit einem dunklen Schatten auf den Wangen. Er trug bereits seine weiße, gestärkte Leinenjacke, in der er servierte. Er nahm Harrach Mantel und Hut ab, schweigend. Der begann die Treppe mit dem roten, verschossenen Läufer hinaufzusteigen. Der Hund zögerte am Fuß der Treppe. Dann trottete er durch die Halle auf die gegenüberliegende Doppeltür zu. Er stieß sie auf in der Hoffnung, bereits ein offenes Feuer in dem Kamin vorzufinden.
Harrachs Schlafzimmer im ersten Stockwerk hatte zwei Fenster nach Westen, zwei nach Süden, aber die Vorhänge blieben meist geschlossen, wegen der Handschriften, die er hier aufhob. Das breite Bett aus Mahagoni stand mit dem Kopfende nach Norden, was sein Arzt wegen schlechter Einflüsse auf den Schlaf beanstandete; aber Harrach war nicht der Mann, sich von so etwas beeindrucken zu lassen.
Josef war ihm gefolgt. Er ließ das Bad einlaufen. Es bedurfte schon lange keiner Worte mehr zwischen ihnen. Ihr Verhältnis war immer gleich geblieben, formell, berufsmäßig. Helena bedauerte es manchmal, auch fand sie das Haus, zwanzig Zimmer, zu groß, zu abgelegen. Andererseits war der Richter ein angenehmer Brotgeber. Er zahlte großzügig, gewährte ihnen zweimal drei Wochen Urlaub. Und es änderte sich nie etwas an seinem Tagesablauf. Er verlangte das Frühstück um 8 Uhr, arbeitete dann in der Bibliothek. 13 Uhr ein leichtes, kaltes Essen. Zwei Stunden Siesta. Der lange Spaziergang. Das Bad. Um 20 Uhr das Abendessen. Dreimal in der Woche kamen Gäste zum Kartenspiel, unterbrochen von einem Diner. Die Männer waren immer dieselben, sein Arzt und sein Anwalt. Die Damen wechselten, meist ältere Jahrgänge, Witwen – aber nicht die trauernden, noch vom Schmerz niedergedrückten, sondern die aufgeblühten, die im Mercedes-Kabriolett vorfuhren und in deren Taschenkalender die Bridgeturniere auf Malta, den Azoren, in Nizza und Deauville vorgemerkt waren. War dem Richter klar, mit welchen Augen sie ihn betrachteten, sein Haus, die Möbel, die gedeckte Tafel, den servierenden Josef; welche Hintergedanken sie dabei hatten, wenn sie ihren Partner selbst dann für die Ausführung eines Kontraktes lobten, den er bei etwas mehr Aufmerksamkeit leicht hätte gewinnen können? Jede hatte ihre Methode, jede glaubte, damit zum Ziel zu kommen – aber, wie Josef seine Frau beruhigte, lag nicht die Qualität eines Richters darin, die Motive zu durchschauen, das Verborgene ans Tageslicht zu bringen?
Um 18.30 Uhr hatte Harrach sein Bad genommen, sich rasiert (mit dem Messer), mit der Pinzette ein paar schwarze Haare auf dem Ohrläppchen ausgerissen. Josef hatte die Kleider für den Abend herausgelegt. Harrach verschwendete normalerweise keine Gedanken daran. Was ein Richter unter seiner Robe trägt, sieht man sowieso nicht, das einzige, worauf man zu achten hatte, war, daß man keine weißen Socken trug.
Seine Garderobe bestand aus alten, abgetragenen, grauen Anzügen. Die Hemden waren weiß. Die Krawatten unaufdringlich, alle zu schmal, aus der Mode. Er hatte sicher fünfzehn Jahre kein Kleidergeschäft mehr betreten. Für seine Schuhe – eine Untergröße, die schwer zu finden war – genügte ein Anruf bei dem Schuhmacher in Liebenburg, der seinen Leisten aufbewahrte.
Aber heute stand Harrach unzufrieden vor den auf dem Bett ausgebreiteten Sachen, den schwarzen, glänzend gewichsten Schuhen auf dem Boden. Er ging hinüber in den Nebenraum mit seinen Wandschränken. Er schob die grauen, dunklen Ein- und Zweireiher beiseite. Die Geste hatte etwas Ärgerliches, so, als mache er eine Bestandsaufnahme und das Ergebnis enttäusche ihn.
Er suchte weiter. Er fand ein Paar hellere Flanellhosen. Ein altes Sportjackett in Braun mit einem Glencheckmuster. Wo waren nur die Hemden? Er fand sie schließlich. Ein einziges blaues, verschossen, der Kragen mit angeknöpften Enden. Er entdeckte einen gelben, ärmellosen Kaschmirpullover mit V-Ausschnitt. Das Problem blieben die Schuhe – aber er fand ein Paar alte Mokassins mit schiefen Absätzen, Relikt einer Affäre, die viele Jahre zurücklag.
War er, hinterher vor dem Spiegel, mit dem Ergebnis zufrieden? Das Hemd war am Hals zu weit und zeigte seine Falten. Zu spät. Er lachte, machte jedenfalls den Versuch, aber Lachen stand seinem Gesicht nicht. Es gab Frauen in seinem Leben, jüngere, obwohl der Altersunterschied nie so groß gewesen war wie bei Anne. Er hatte keinerlei Illusionen. Warum dann diese Maskerade?
Er hatte ein genaues Bild von Anne vor Augen: Die Jeans, die ihre Rundungen zeigte; schwere Brüste unter den Hemden, die sie trug, die Ärmel meist aufgekrempelt, der helle Flaum der Härchen auf ihren Oberarmen …
Sie war sich der Wirkung bewußt, die das auf ihn hatte. Sie setzte es ein, um zu ihrem Ziel zu kommen. Wie weit würde sie gehen? Nein, er bildete sich nicht eine Sekunde ein, daß sie mehr für ihn empfinden könnte. Eine gewisse Neugier vielleicht, vor allem aber seine Beherrschung der Materie …
Das Telefon in seinem Schlafzimmer klingelte. Er hatte so intensiv an sie gedacht, daß er überzeugt war, sie sei am Apparat. (Um abzusagen?) Aber er hatte sie davor gewarnt, hier anzurufen, selbst wenn dies ein separater Anschluß war; er wußte, sie würde es respektieren.
Er blickte auf die Uhr auf dem Kaminsims. 18.58 Uhr. Es war der Anruf, den er erwartete. Es würde ein kurzes Gespräch sein, die Worte verschlüsselt, wie es geboten war. Er trat zu dem Apparat, schaltete das Aufzeichnungsgerät ein.
Er nahm den Hörer ab, hielt ihn an sein linkes Ohr, auf dem er besser hörte. »Ja.« Er meldete sich nicht mit Namen, aber das war nicht nötig und zwischen ihnen auch nicht üblich.
»Steht das Lot noch zum Verkauf?«
Harrach antwortete: »Ich kann mich nicht davon trennen …«
»Der Bieter ist bis an die Grenze gegangen.«
Harrach betrachtete das sich drehende Band, während der Anrufer seine Argumente vorbrachte. Er hörte sie sich an, ohne sich dazu zu äußern. Schließlich sagte er: »Es ist sinnlos. Sie können meine Motive nicht begreifen.«
Der andere wollte ihm anscheinend nicht das letzte Wort lassen. »Sie erzählt ihnen Lügen, fälscht Beweise … Sie waren immer so sehr auf ihren Ruf bedacht. Wenn sie fällt, fallen Sie mit ihr …«
Harrach schnitt ihm das Wort ab, indem er den Hörer einfach auflegte. Das Band stoppte.
»Scheißkerl.« Er sagte es laut, bissig, erleichtert, daß man ihm die Entscheidung abgenommen hatte.
2
Sieben Stunden später war Harrach tot. Das Opfer an seiner Seite war 37 Jahre jünger als der Richter. Eine Frau. Ihr Tod gab den Beamten der Liebenburger Kriminalpolizei keinerlei Rätsel auf. Sie schloß ihre Untersuchung in Rekordeile ab. Und neben der am Tatort sichergestellten Waffe und den Spuren lieferte Weber dem Untersuchungsrichter gleich das Motiv mit.
Allerweltsgeschichte: Frau findet die meisten jungen Männer unattraktiv, leer. Haben keine Lebenserfahrung, besitzen nicht jene Qualitäten, die ihr wichtig sind. Beweis: ihre gescheiterte Ehe. Fühlt sich dagegen angezogen von älteren Männern, findet Verständnis bei ihnen. Neugier, Faszination. Schock, als sie schließlich entdeckt, daß der Richter einfach ein alter Mann ist, mit Grenzwerten im Liebesvollzug. Katastrophe. Kiss Kiss Bäng Bäng.
Victoria Roeder (»Vicky«), die Anne am nächsten stand, würde später nicht gegen diese Version des Todes ihrer Enkelin protestieren. Vergessen ist Vergessen. Tod ist Tod. Sinnlos, sich Gedanken zu machen, wie über einen geurteilt wird, nachdem man unter der Erde ist. Die einzige Möglichkeit, mit der Vergangenheit fertig zu werden, mit dem Zerstörungswerk, das sie anrichtet, ist, tapfer zu leugnen und fest daran zu glauben, daß man immer noch so sexy ist und eine solche Ausstrahlungskraft hat wie in der Blüte seiner Jahre.
Und – was sie wirklich glaubte, aber wohlüberlegt für sich behielt: Es zahlte sich nicht aus, gegen Tabus zu verstoßen, gegen das, was man in ihrer Jugend »gesundes Volksempfinden« genannt hatte. War sie, Vicky, nicht das beste Beispiel dafür? Eine alte Frau, mehr oder weniger an ihren Stuhl gefesselt, eine Decke über dem Schoß, einen Seidenschal um den Hals, das Tischchen mit den Medikamenten in Reichweite – und der Fernbedienung für den Fernseher. Ah, der Bildschirm, auf dem sich ihre Vergangenheit abrufen ließ!
Sag mir, quando, sag mir, wann,
sag mir, quando, quando, quando
Es war einer ihrer letzten Auftritte gewesen, einer ihrer letzten Triumphe vor dem abrupten Ende. Gab es noch eine andere Existenz für sie als auf dem Video? Aber ihre Enkelin schien nichts daraus gelernt zu haben. Es wurde Vicky plötzlich unerträglich. Sie schaltete das Gerät aus, die Bilder, von denen sie sich sonst ernährte wie ein auf den Tod Kranker, der am Tropf hing. Außerdem konnte sie so besser hören, was oben in der Mansarde vorging, was Anne trieb.
Das Haus – eine Sommerwohnung richtiger – war so dünnhäutig und gebrechlich wie sie selbst, und es gab daran ebensoviel zu reparieren wie an ihr. Die Decke über ihrem Schoß war nötig, weil die Heizung mangelhaft war. Ihr Hausarzt behauptete, er brauche nicht einmal ein Stethoskop, um ihr Herz abzuhören – das Rasseln der Herzklappen sei mit bloßem Ohr zu vernehmen.
Sie lauschte nach oben …
Um 18 Uhr an jenem Mittwoch – einen Tag vor dem Herbstanfang –, während Richter Harrach von seinem Spaziergang zurückkehrte, saß Anne Roeder auf dem Rand des Bettes mit dem geblümten Überzug, den Computer auf dem Tisch vor sich. Die Bedienung machte ihr Schwierigkeiten. Darüber hinaus beschlich sie ein Gefühl von Unsicherheit, ja Panik, als könne sie sich nicht klarwerden, ob das Gerät ihr Freund oder ihr Feind war. Ihr Finger zögerte über der Taste »Print«, bis sie sich überwand, sie niederzudrücken.
Der Drucker war ein altes Modell, secondhand gekauft wie der Computer; er würde eine halbe Stunde brauchen für die dreißig Seiten des Dossiers.
Sie erhob sich. Sie trat zu dem Fenster. Als Vicky das Sommerhaus kaufte, hatte es in einer völlig unberührten Landschaft gelegen. Jetzt war es wie ein unnützer Wurmfortsatz am Rande einer Vorstadtsiedlung, hochaufgeschossene Wohnblocks, die die Stadtplaner hier in den Boden gerammt hatten. Gegenüber gab es noch eine freie Fläche, abgeteilte Schrebergärten, winzig wie Gästehandtücher. Dahinter begann gleich der Wald von Fichten, knorrig, gelichtet, das Grün zerfressen. Sie tastete sich zum Lichtschalter, nachdem sie die Vorhänge zugezogen hatte. Der Mansardenraum sah noch genauso aus, wie sie ihn vor zwanzig Jahren verlassen hatte, um zu studieren. Sie war hierher zurückgekehrt – geflüchtet –, nachdem sie ihre Stellung verloren hatte und nach der Scheidung. Sie hatte den Raum nicht wiedererkannt. Dieses Rosa an den Wänden und der Tür! Diese gerüschten Vorhänge. Diese Ansammlung von Plüschtieren, die »Vicky-Puppe«, die in den Kissen lauerte.
Die Plattenhüllen und Fotografien der Stars ihrer Mädchenjahre. Sie hatte sich nicht die Mühe gemacht, etwas daran zu ändern. Dies war eine Übergangsstation, obwohl Vicky es natürlich nicht wahrhaben wollte. Der PC war das einzig Neue in dem Raum, und er nahm sich nicht einmal fremd aus, ein Spielzeug eben. Sie warf einen Blick auf den Drucker, der seine Seiten ausrollte.
Sie war barfuß, trug verschossene Jeans, ein weißes T-Shirt, das aus der Hose hing. Ihre nipples – Anne hatte einen amerikanischen Besatzungsoffizier zum Vater, und bei Geschlechtsmerkmalen fiel ihr automatisch das englische Wort zuerst ein – waren deutlich unter dem Stoff zu sehen.
Sie öffnete den vorderen Knopf ihrer Jeans, rollte sie über die Hüften, wand sich heraus. Sie zog das T-Shirt über den Kopf.
Sie trug keinen BH. Sie trat vor den Spiegel, betrachtete ihre vollen Brüste. Natürlich war sie nicht mehr zwanzig. Sie hob beide Arme über den Kopf – besser. Sie zog eine Schublade auf, gefüllt mit Slips und Büstenhaltern. Die gewaschenen, täglich gebrauchten sahen zerknittert aus, unattraktiv. Es gab einen neuen mit dem dazu passenden Slip in einem Beigeton, mit Spitzen, sündhaft teuer übrigens.
Sie wechselte den Slip. Sie zog den BH an. Die Körbchen waren tief ausgeschnitten, so daß die Brüste darüber hinausstanden; die Fachleute nannten ihn »fifteen-second bra« – die Zeit, die er brauchte, damit er seine Wirkung tat.
Die Wahl des Kleides war einfach. Sie besaß zwei Straßenkostüme aus ihrer Zeit in der Anwaltskanzlei, und sie waren mit bösen Erinnerungen behaftet. Daneben hatte sie nur zwei andere Kleider. Eines für den Abend, schwarz, für Bayreuth gekauft. Das andere war eine lange Hose mit Kasack, beides in Seiden-Georgette, beige, durchscheinend, in vier Stunden von einem Schneider gefertigt, der in Bangkok in ihr Hotel gekommen war. Es war zu dünn für den kühlen Abend, zu auffallend, und sie hatte nur ein Paar leichte Sandalen, die sie dazu tragen konnte. Sie hatte nur die Wahl zwischen Jeans und dieser Kombination. Sie entschied sich für letztere.
Sie hatte noch die Zeit, etwas Make-up aufzulegen, ihre blonden Haare durchzukämmen. Der Drucker stoppte, in der Stille hörte sie Vicky nach ihr rufen. Irgendwann mußte sie mit Vicky sprechen. Oder ahnte sie mehr, als sie zugab? Natürlich wußte sie von den Drohungen, den anonymen Briefen, den Telefonanrufen, oft mitten in der Nacht. Vicky hatte das schließlich alles am eigenen Leib erlebt – »Sowjet-Hure; wir werden dich an der Mauer aufhängen« –, als daß sie nicht wüßte, wie ernst es zu nehmen war.
Anne sammelte die Blätter auf. Sie trennte sie an den perforierten Stellen, bündelte sie. Sie hatte nicht die Zeit, sie ein zweites Mal auszudrucken. Sie steckte das Konvolut in eines der beiden vorbereiteten, versteiften Kuverts, zu den Originaldokumenten. Sie nahm die Diskette an sich, stellte den Strom ab. Sie zog den Mantel über das Kleid, um Vickys Fragen aus dem Weg zu gehen.
Von ihrer Zeit auf der Bühne hatte Vicky eine Vorliebe für auffällige Kleider und starke Farben zurückbehalten. Sie trug eine Wollweste in einem kräftigen Pink, unter der Wolldecke steckten die Beine in silberglänzenden Strümpfen, und an den – geschwollenen – Füßen trug sie Slipper mit Straßbesatz. Ihr Gesicht war hell gepudert, so hell wie ihr Haar. Das Gesicht zeigte ihr Alter, bis auf den Mund; aber sagte man nicht, daß keine Sängerin je einen häßlichen Mund haben könne?
Es gab Tage, an denen Vicky ihr wie eine Stumme nur in einer Zeichensprache ihre Wünsche mitteilte, sie dirigierte, kritisierte – zu pathetisch, als daß man ihr böse sein konnte –, und Anne hoffte, dies sei einer dieser Tage. Vergeblich.
Vicky blickte von ihrem Sessel auf. »Das heißt, ich muß mich allein ausziehen!?«
Anne füllte das Glas auf dem Tischchen mit Wasser, rückte es näher heran, die Medikamente ebenfalls.
»Wann kommst du zurück?«
»Soll ich dir eine Filmkassette einlegen?«
»Wer ist der Neue?«
Anne wählte eine Kassette aus dem Regal, dort, wo auch ihre Fotoalben und die Mappen mit den Presseausschnitten lagen. Vicky liebte nur eine Art von Filmen, alte Katharine-Hepburn-Streifen zum Beispiel, Geschichten, in denen die Frauen zu stolz und zu intelligent waren, um das Opfer von Männern zu werden.
Anne nahm das Video aus dem Apparat und führte die Kassette mit dem Film ein. Vicky sagte in ihrem Rücken: »Natürlich hast du das Recht, glücklich zu sein.«
Anne trat zu ihr, beugte sich herab, küßte sie auf beide Wangen. »Halt mir die Daumen.«
»Ist es ein junger Mann?«
Anne lachte. »Er könnte mein Vater sein.«
»Wie ist seine …«
Anne unterbrach sie. »Ende des Verhörs.« Sie verließ den Raum, ging durch den schmalen Korridor mit den Fotografien hinter Glas an den Wänden – Vicky in ihren glorreichen Jahren.
Sie öffnete die Haustür, trat ins Freie. Es war kälter, als sie gedacht hatte. Die Siedlung lag in einem Tal zwischen zwei Waldzügen, eine Rennstrecke, auf der der Wind sich austoben konnte. Die Stadt, Liebenburg, war durch einen weiteren Höhenzug der Sicht entzogen. Aber der starke Widerschein ihrer Lichter verriet ihre Lage. Und da war das Hochhaus der Hauptverwaltung des Pharmakonzerns mit der Leuchtreklame auf dem Dach, eine auf der Spitze stehende Raute mit dem »T« in der Mitte, die sich langsam drehte.
Das Haus besaß keine Garage; ihr Wagen stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite, unter dem Mast einer Straßenbeleuchtung. Nach der Veröffentlichung ihres Buches hatte sie mehrmals Drohbriefe unter den Scheibenwischern des Saab gefunden. Manchmal ließ man sich noch mehr einfallen: Die Tür wurde aufgebrochen und ein Geschoß auf dem Fahrersitz plaziert; Fotomontagen, auf denen man ihren Kopf dem einer Leiche aufgesetzt hatte. Sie hatte jedesmal alles der Polizei ausgehändigt, aber natürlich hatten sie nie eine Spur von den Absendern gefunden.
Die Drohungen hörten auf, als der Verlag das Buch zurückzog. Man dachte wohl, sie habe ihre Lektion gelernt. Ein Jahr hatte sie ihre Ruhe gehabt. Erst in den letzten Wochen hatten die Drohungen wieder eingesetzt. Das war es, was sie irritierte: Sie hatte ihre Recherchen in aller Stille und mit größter Vorsicht betrieben – wie hatte sie Verdacht erregt? Sie hatte sich niemandem anvertraut; erst als sie alle Beweise zusammengetragen hatte, hatte sie mit Richter Harrach gesprochen; sie wußte, sie brauchte jemanden auf ihrer Seite, dessen Wort schwerer wog als das ihre …
Der Saab hatte keinen Karton unter der Windschutzscheibe. Das Türschloß war nicht aufgebrochen. Sie legte ihre Tasche und die beiden Kuverts auf den Beifahrersitz. Sie startete den Wagen.
Nach wenigen Metern merkte sie, daß etwas nicht stimmte. Der Wagen zog nach links, schleifte mit den Rädern am Bordstein entlang, obwohl sie ihn auf die Straßenmitte zu steuerte. Sie nahm das Gas weg, ließ ihn ausrollen, stieg aus.
Als sie um den Wagen herumging, entdeckte sie, daß alle vier Reifen zerstochen waren.
An jenem Mittwochabend stand Thorbecke an dem Erkerfenster mit dem Blick auf den südlichen Innenhof der Rudelsburg. Vor vielen Stunden war die Jagdgesellschaft von dort aufgebrochen. Jetzt hatten die Treiber die Strecke ausgelegt. Im Schein der Pechfackeln, die man ringsherum in den Boden gesteckt hatte, wirkte die Szene auf ihn noch barbarischer.
Er selbst nahm nie an den Jagden teil. Sein Jagdaufseher organisierte das blutige Gemetzel zur Unterhaltung seiner Gäste; sie behaupteten, es entspanne sie, bringe sie auf andere Gedanken, lasse sie den Streß des Geldverdienens und Machtausübens vergessen.
Später würde es im Wappensaal ein Diner geben, zum Abschluß der Restaurierungsarbeiten. Daran würde er teilnehmen müssen, aber sein persönlicher Diener würde das wenige, was er ihm diskret servierte, ungegessen wegtragen. Und er konnte darauf bauen, daß seine Frau, die die Tischordnung gemacht hatte, rechts und links von ihm Leute plaziert hatte, die es übersahen.
Prof. Dr. Dr. Hans Thorbecke galt als scheu, schüchtern, als ein Mann, der es ablehnte, Interviews zu geben, geschweige denn vor eine Kamera zu treten. Gewiß, er war auch Industrieller, der größte Arbeitgeber Liebenburgs. Von den beiden Doktortiteln, die er trug – der Professor war »honoris causa« –, war einer für Chemie, der andere für Philosophie – und er zog es vor, daß man den zweiten erwähnte.
Er war 52 Jahre, wirkte aber älter wegen seiner schneeweißen Haare. Man erzählte sich, sie seien über Nacht weiß geworden, als man ihn gekidnappt hatte und er vierzehn Tage in einem Erdloch verbrachte, gefesselt, in der Hocke, ehe die Firma das Lösegeld bezahlte. Er ließ noch immer nicht seinen Blick von den Jägern, in ihren Lodenmänteln, Hüten, Stiefeln, die Waffen im Arm. Selbst die Frauen unter ihnen – überraschend viele – sahen plump, massig aus. Es war ein leichtes, aus der Menge seinen Anwalt herauszufinden – Nagengast überragte alle Männer um einen Kopf.
Er stand mit einem Kollegen zusammen, in tiefer Diskussion; als ob es genügte, daß Thorbecke sich auf ihn konzentrierte, unterbrach Nagengast das Gespräch und schaute zu ihm hoch. Er verabschiedete sich, verschwand aus seinem Blick.
Minuten später tauchte er an der Tür zu der Galerie auf. Er ließ sich von einem Diener die Flinte und den Mantel abnehmen.
Thorbecke überwand sich, fragte: »Wie war die Jagd?«
»Danke. Die Wildschweine haben eine wahre Todessehnsucht …«
Thorbecke entgegnete nichts. Er ging voraus. Vor einer hohen Doppeltür deutete er auf den Kokosläufer. Nagengasts Gesicht, noch animiert von der Jagd, verschloß sich. Aber er streifte widerspruchslos seine Stiefel ab.
Der museumsartige Saal dahinter enthielt eine Glassammlung, die aus den USA zurückgekehrt war. Die Rudelsburg hatte einem Adligen der Meininger Nebenlinie gehört, bis man den letzten Prinzen nach dem Attentat auf Hitler an einem Fleischerhaken aufhing. Der erste Bewohner nach dem Zusammenbruch war ein Leutnant der US-Army, der sich die Glassammlung unter den Nagel riß. Dann kamen Russen, die hier über dreißig Jahre lang ihre Agenten geschult hatten.
Nach ihrem Abzug, nach dem Fall der Mauer, suchte die Landesregierung Thüringen einen Käufer. Nagengast handelte den Vertrag aus. Gegen den symbolischen Preis von 1 D-Mark erwarb Thorbecke den Besitz, mit der Verpflichtung, ihn zu restaurieren, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und dort »Kultur« zu veranstalten. Es hatte zwei Jahre gedauert, den Park wieder anzulegen, zu bepflanzen, das Innere nach den ursprünglichen Plänen wieder herzustellen. Für sich privat beanspruchte Thorbecke nur ein paar Räume.
Sie waren jetzt dort angelangt. Thorbecke öffnete die Tür, ließ Nagengast eintreten. Die Decken waren hier niedrig gehängt, die Heizung war unter den Boden verlegt. Constanze hatte als Dekorateurin für Laura Ashley gearbeitet, ehe sie die zweite Frau Thorbecke wurde, und der Raum zeugte von ihrem Geschmack.
»Etwas zum Aufwärmen?«
Nagengast winkte ab. »Ich hab gesehen, daß man zum Essen einen Château L’Evangile serviert.« Er ließ Thorbecke die Zeit, Fragen zu stellen. Natürlich kamen sie nicht. Er fuhr fort: »Er ließ sich nicht überzeugen.«
»Haben Sie selbst mit ihm gesprochen?«
»Natürlich nicht.«
»Was tut er nur mit all dem Geld?«
So eine Frage konnte nur ein Mann wie Thorbecke stellen, der sicher nicht einmal wußte, wie reich er nun wirklich war. »Er sammelt. Kinkerlitzchen.«
Wieder wartete er, daß Thorbecke fragte. Wieder vergeblich. Manchmal brachte es Nagengast auf, wie er behandelt und benutzt wurde. Thorbecke schien zu denken, er habe nicht nur einen Hausanwalt rekrutiert, sondern auch dessen Seele. Erlaubte Nagengast sich deshalb, mehr zu sagen, als er es üblicherweise tat? »Die Frau ist ein Leichtgewicht, aber den Richter müssen wir ernst nehmen.«
Thorbecke war an der Bar stehengeblieben. Er lächelte scheu, als überfordere ihn dies alles. »Was soll ich dazu sagen?«
Nagengast bemerkte, daß er einen der Hirschhornknöpfe an seinem Trachtenjanker abgerissen hatte. Er hing nur noch an einem Faden. Um ihn nicht zu verlieren, riß er ihn ab und steckte ihn in die Tasche. Er sagte: »Er verdient eine Lektion. Wir werden ihm einen ordentlichen Schrecken einjagen …«
Er suchte seinen Blick, und diesmal wich Thorbecke ihm nicht aus. Die Pupillen waren überraschend hell, fast farblos, wie eine Eisfläche. Der Blick aus ihnen wies ihn an seinen Platz, den des gedungenen Anwalts; nur so funktionierte das System, das es Männern wie Thorbecke erlaubte, im Hintergrund zu bleiben.
Thorbecke sagte salbungsvoll: »Ich habe volles Vertrauen zu Ihnen, Rolf.«
»Kann ich Ihr Telefon benutzen?«
Thorbecke deutete auf einen Apparat, der auf einem Tisch zwischen zwei Fenstern stand. »Sie wollen sicher ungestört sein …«
Nagengast blickte ihm nach, bis er die Tür geöffnet hatte und dadurch verschwunden war. Er kämpfte mit seinen Gefühlen. Er erlaubte sich einen Augenblick den Gedanken: Laß ihn seine eigene Scheiße fressen! Er wußte, es war ein Scheingefecht.
Thorbecke war Chemiker. Er bestand zu 90 Prozent aus Wasser und zu 10 Prozent aus Leidenschaften. Bei ihm, Nagengast, war das Verhältnis genau umgekehrt. Viele dachten, was ihn motiviere, sei Geld. Irrtum. Seine wahre Leidenschaft war die Manipulation, pur und rein, um ihrer selbst willen. Wendland war das letzte Beispiel …
Er hatte ihn vorgewarnt. Nagengast glaubte, ihn vor sich zu sehen, wie er auf diesen Anruf wartete, hager, mit den dünner werdenden, auffallend blonden Haaren. Und den Augen. Augen, von denen jedes verschieden war, als paßten sie nicht ganz zusammen.
Nagengast hatte einmal einen Auerhahn geschossen. Der Taxidermist machte beim Ausstopfen einen Fehler: Eines der künstlichen Augen war von dem richtigen Braun, aber das andere ging fast ins Rötliche. Es störte Nagengast jedesmal, wenn er den Raum betrat, in dem das Tier hing. Und so war es mit Wendland. Bei jeder Begegnung mit ihm, wenn ihn ein Blick aus diesem kuriosen Augenpaar traf, beschlich den Anwalt ein Gefühl des Unbehagens.
War es das, warum in diesem Augenblick sein Gedächtnis die Nummer nicht sofort herausgab? Aber seine Finger fanden sie automatisch.
Wendland war nach dem ersten Klingeln am Apparat, die Stimme rauh und voller Ungeduld. »Was also?«
Nagengast sagte: »Es ist das zweite Szenario.« Dem war nichts hinzuzufügen. Selbst wenn er es gewollt hätte, er kam nicht dazu, der andere hatte bereits aufgehängt.
Nagengast legte den Hörer zurück. Er ging zu der Bar und schenkte sich ein Glas von dem Cognac ein, den er vorher abgelehnt hatte.
3
Liebenburg – das waren siamesische Zwillinge, jedes mit seinem eigenen Charakter, eines der Geschwister betete, das andere arbeitete. Liebenburg, das betete, mit seinen Kirchen, dem Dom, dem Sitz des Erzbischofs und Patern, die Wein anbauten, lag auf dem rechten Mainufer, Liebenburg, das arbeitete, auf dem linken. Es war dieser Teil der Stadt, zu dem der Mann mit den schütteren blonden Haaren und den eigenartig verschiedenen Augen seinen Wagen steuerte.
Sein BMW bog von der Sedanstraße ab und fuhr langsam auf den großen Parkplatz am Fuße des Hügels zu. Die Eröffnung der Leder- und Rauchwarenmesse war in 24 Stunden; wie er erwartet hatte, erstrahlten die Hallen in hellem Scheinwerferlicht. Überall wurde noch gehämmert, gezimmert, um die Kojen der Aussteller fertigzumachen.
Bevor die Thorbeckes nach Liebenburg gekommen waren, lebte die Stadt von ihrem Holz- und Wildreichtum. Es gab Hunderte von Kleinbetrieben, Holzschnitzer, Spielzeughersteller, Kürschner. Eine Hochblüte erreichte die Stadt in der Mitte des 19. Jahrhunderts: Einer ihrer Bürger entwickelte ein Verfahren zur Herstellung von Fettleder, das die Produktion von besonders festem Schuhwerk ermöglichte. Lokale Historiker gingen so weit, den Sieg bei Sedan der Tatsache zuzuschreiben, daß die beiden bayerischen Corps mit Liebenburger Schuhwerk ausgerüstet gewesen waren. Daher die Sedanstraße und der Sedanhügel …
Der Parkplatz am Fuße des Hügels lag im Halbdunkel. Wendland – er hatte sich an den Namen nie gewöhnt, obwohl er ihn amtlich nun schon 17 Jahre trug – fuhr langsam die Reihe der abgestellten Fahrzeuge entlang.
Seit dem Telefonanruf befand er sich in einem erregten Zustand. Alles war vorbereitet gewesen, er hatte nur den Rucksack gegriffen, in dem er sonst seine Bergsteigerausrüstung aufbewahrte. Er hatte die Wohnung verschlossen, war zu dem im Hof geparkten BMW gerannt. Aber diese Euphorie würde abklingen. Bleiben würde seine wahre Natur.
Er war ein Beobachter. Die anderen haßten den Wachdienst an der Grenze, die Langeweile, er nicht. Später, als er für das Amt in Wiesbaden als V-Mann arbeitete, übertrug man ihm jene Aufgaben, bei denen es vor allem darauf ankam, nichts zu unternehmen, abzuwarten, sich in das Vertrauen der anderen einzuschleichen. Und nicht umsonst waren sein einziges Hobby die Berge: Wer in einer Steilwand hing, allein auf sich gestellt, der achtete auf jeden Haken, den er einschlug, darauf, wo er den Fuß hinsetzte, auf jeden Handgriff.
Er fuhr den BMW in eine Parklücke, stellte den Motor ab. In der Nähe luden Handwerker ihr Material und ihre Werkzeuge aus. Die einzigen anderen Personen waren zwei junge Frauen, die Zettel unter die Scheibenwischer der Autos steckten, Traktate gegen das Tragen von Pelzen.
Er wartete, bis sie sich entfernt hatten. Er stieg aus seinem Wagen. Er trug über seiner Hose und dem Pullover einen grauen Arbeitskittel, an den Füßen leichte Wanderschuhe. Er bewegte sich geschmeidig, ohne Eile, mittelgroß, alles in allem ein wenig auffallender Mann, bis auf die Augen. Er trug deswegen gewöhnlich eine Sonnenbrille, aber sie würde am Abend zu sehr auffallen. Und wegen seiner Haare trug er eine Wollmütze.
Er blieb stehen, wenn es ihm schien, ein Wagen sei für seine Zwecke geeignet. Die meisten Handwerker würden auf der Messe die Nacht durcharbeiten; wenn er Glück hatte, geriet er an ein solches Fahrzeug. Der Faktor Glück gehörte nun einmal dazu; im Zweifelsfall konnte er das Auto später einfach irgendwo stehenlassen, und jeder würde glauben, ein paar Rowdies hätten es für eine Spritztour gestohlen.
Er setzte seinen zwanglosen Bummel fort, die Hände in den Taschen seines Kittels. Der Abend war kühl, mit einem plötzlich aufkommenden heftigen Wind. Einen Augenblick wurde seine Konzentration abgelenkt von dem Papier, das der Wind über den Boden vor seinen Füßen hertrieb: Reklamezettel für eine Disko, Werbung für ein neu eröffnetes Geschäft mit türkischen Spezialitäten, Flugschriften gegen die weitere Ausbaggerung des Mains. Wenn er durch die Straßen ging, ein Kino besuchte, eine Veranstaltung, kam er beständig in Berührung mit dieser weggeworfenen Materie – sich sehr wohl der Ironie bewußt, daß er einen großen Teil davon selbst erzeugte …
Er hatte seine Wahl inzwischen auf zwei Fahrzeuge reduziert, beides kleine Lieferwagen. Er entschied sich für den R5 mit dem aufgebauten Kasten. Er gehörte einem Reinigungsunternehmen. Die Aufschrift an den Seiten lautete: »Probleme? Rufen Sie« – und dann die Telefonnummer.
Er zog die Hände aus den Taschen. Er trug dünne Lederhandschuhe. Er zwängte den Draht mit der Schlaufe durch den oberen Rand der Scheibe. In Sekunden hatte er den Knopf hochgezogen und die Tür geöffnet.
Er ging zu seinem BMW. Den Rucksack in der Hand kehrte er zu dem R5 zurück. Er legte den Rucksack auf den Beifahrersitz, beugte sich unter das Armaturenbrett, hantierte. Der Motor sprang an. Er setzte sich. Der Sitz war etwas zu eng, er stellte ihn zurück, legte den Gang ein.
Er fuhr im Schrittempo zwischen den Wagenreihen entlang. Als er vom Parkplatz herunterfuhr, auf die Straße einbiegen wollte, grüßte ihn jemand. Er hatte das Fenster heruntergedreht, weil die Heizung noch nicht arbeitete und die Scheiben beschlagen waren. Er grüßte zurück, nicht wirklich beunruhigt.
Bis Hardt waren es 31 Kilometer und dann noch einmal 2,5 Kilometer bis zu der Villa des Richters. Er brauchte keine Karte. Er hätte jederzeit blind dorthin gefunden.
Die Uhr am Armaturenbrett zeigte 20.15 Uhr, als er die Brücke über den Alten Main überquerte. Am Ufer ankerten zwei alte Flußdampfer, die früher dem Ausflugsverkehr gedient hatten. Er bemerkte die beiden Fahrzeuge der Polizei oben am Uferweg.
Seitdem die Baracken auf dem ehemaligen US-Fliegerstützpunkt mit Flüchtlingen überfüllt waren, hatte die Stadt einen weiteren Schub von zweihundert auf den Schiffen untergebracht. Polizei bewachte sie, während die Juristen sich darüber zu einigen suchten, ob sie abzuschieben seien oder nicht. Es waren Albaner aus dem Kosovo, oder Bosnier oder Rumänen – oder wer weiß was. Wendland hatte es gelesen, aber vergessen.
Er war längst in diesem Staat eingebürgert. Er lebte hier, wählte – aber etwas war geblieben, etwas, was ihn absonderte, und sei es nur, daß sein Dialekt noch immer durchkam. Er hätte sich also mit Flüchtlingen solidarisch fühlen sollen, aber er fragte sich, wie die meisten Liebenburger, ob es sich in der Stadt nicht besser leben ließe, wenn man sie nach Hause schickte oder gar nicht erst aufnehme …
Er durchfuhr die östliche Vorstadt, die ruhigen Straßen mit Villen in großen Gärten. Hier wohnten die Thorbeckes und Nagengasts, der Oberbürgermeister und andere Prominente, und die Polizeifahrzeuge standen auch hier, nur diskreter, in von Bäumen beschatteten Nebenstraßen.
Auf der nach Osten führenden B 303, schnurgerade, fuhr er schneller, ohne je die Geschwindigkeitsgrenze zu überschreiten. Ein leichter Nieselregen fiel, nicht genug, um die Scheibenwischer anzustellen, zuviel, um ohne sie auszukommen.
Er kam durch die letzte Gemeinde, die zu Liebenburg gehörte; ein alter Dorfkern, ausgestorben, ein paar Kleinbetriebe, die sich hierher verirrt hatten und irgend etwas Banales herstellten. Dann Reihen von gleichförmigen Bungalows, die meisten noch im Rohbau – seit neuestem schwer zu verkaufen.
Hinter der letzten Bushaltestelle bog er in die Nebenstraße ein. Sie stieg leicht an, wurde kurvig. Die Wälder links und rechts rückten näher, schnell wachsende Fichten. Er hatte gehört, Fichten fräßen den Sauerstoff. Er wußte nicht, ob etwas Wahres daran war. Jedenfalls hatte er nur Verachtung für diese Art von Forstwirtschaft. Wahrscheinlich taugte das Holz allenfalls dazu, um es zu Papier zu zerquetschen, das dann die Straßen verunreinigte.
Er erreichte Hardt. Der Ort saß auf der alten Zonengrenze. Der Übergang hatte jahrelang Bedeutung gehabt, weil die Behörden sich darauf geeinigt hatten, hier den Austausch von Särgen mit den Toten aus Ost und West zuzulassen. Ein Liebenburger Bestattungsunternehmen besaß das Monopol.
Er schlug die Straße ein, auf der jahrelang die Jeeps entlanggefahren waren, die auf dieser Seite die Grenze kontrollierten. Sie war schmal. Manchmal kam er durch Wälder, manchmal durch offenes Land mit dem Blick auf die Höhen des Thüringer Waldes. Hinter dem schmalen Brückchen über die Iste war der Wegweiser, der die Stelle anzeigte, wo eine Abzweigung zur Villa Wallstein führte. Er bog jedoch nicht dort ein, sondern fuhr im Rückwärtsgang den Pfad entlang, den die Forstarbeiter zum Abtransport von Holz benutzten. Nach zwanzig Metern hielt er an, schaltete die Lichter aus und löste den Kontakt.
Er befand sich in einem Wäldchen, das auf der topographischen Karte Wolfsleiten hieß, im Volksmund aber Agenten-Holz, weil viele Jahre hindurch die west- und ostdeutschen Geheimdienste hier ihre Spione ausgetauscht hatten.
Er zog die Wollmütze vom Kopf, schüttelte die blonden Haare, aber er behielt die Handschuhe an. Er drehte das Fenster herunter. Es war dunkel, wenige Tage nach Neumond. Der Regen hatte aufgehört. Irgendwo flog ein Vogel auf, erschreckt von dem Fahrzeug. Er hatte das Ende eines langen Weges erreicht. Von jetzt an hieß es warten.
Ehe er in den Forstweg eingebogen war, hatte er auf der Anhöhe die Umrisse der Villa Wallstein gesehen, das Haus, scharf gegen den Nachthimmel abgehoben, die erleuchteten Fenster. Er versuchte, sich jetzt den Mann in dem Haus vorzustellen, alles in Einklang zu bringen mit den Informationen, die er gesammelt hatte.
Solange der Richter Harrach sein Amt innehatte und in den Medien präsent war, hatte Wendland jeden Artikel, die kleinste Notiz über ihn ausgeschnitten und in Mappen gesammelt. Danach war es still geworden um ihn. Aber er hatte ihn nicht aus den Augen gelassen.
Der Dorfgasthof in Hardt hatte aufgegeben. Aber es gab ein Museum, und die Frau dort langweilte sich und hatte ihm bereitwillig mitgeteilt, was sie wußte: wer für den Richter kochte, wer sich um das Haus kümmerte, wer den Garten pflegte, welche Frauen aus dem Dorf dem portugiesischen Ehepaar halfen.
Im übrigen bedauerte sie den Richter: ein alter, reicher Mann, der sicher schrecklich einsam war. Er hatte einen Sohn. Eine Tochter. Aber sie besuchten ihn nie. Schrieben nicht einmal zu Weihnachten; dem Postboten jedenfalls waren keine Karten untergekommen. Und seine Frau? Niemand wußte wirklich, was mit ihr geschehen war – eine Ambulanz hatte sie vor vielen Jahren abtransportiert, und sie war nie mehr zurückgekehrt. Sie sagte, daß ein Arzt ihn regelmäßig aufsuchte. Irgend etwas mit dem Herzen. Dorfklatsch, hatte ihr Mann, der sie ablösen kam, gemeint: Der Richter sei vollkommen fit, man brauche ihn nur bei seinen täglichen Spaziergängen zu beobachten.
Wendland glaubte letzterem. Denn all die Jahre, die vergangen waren, hatten nichts daran geändert: Er sah immer nur den einen Mann, für ihn war es immer noch der Tag, als der Gerichtshof über seinen Fall zu entscheiden hatte.
Harrach sitzt in der Mitte zwischen zwei anderen Berufsrichtern und zwei Laienrichtern – aber sein Feind, das ist er. Der Stuhl mit der hohen Lehne überragt seinen Kopf. Keine drei oder vier Meter trennen sie.
Wendland folgt schon lange nicht mehr der Verhandlung, den Aussagen der Zeugen, den Argumenten seines Verteidigers. Vielleicht hat er den Fall schon verloren gegeben, in dem Moment, als feststand, daß Harrach der Vorsitzende sei.
Wendland ist von ihnen allen abgeschnitten, konzentriert nur auf den Mann dort oben, hinter dem Podium aus polierter Eiche. Er sitzt steif auf seinem Stuhl. Aus den Gesten ist nichts abzulesen, seine Stimme hat immer den gleichen Tonfall.
Wendland möchte schreien – sieh mich an!
Er tut es schließlich, und das ist der schlimmste Augenblick. Der Richter beugt sich vor, blickt ihn an, nur einmal, Sekunden, bevor er das Urteil spricht – leidenschaftslos, kühl, ein Fall wie jeder andere, der nächste wartet bereits.
Blackout.
Nur dieser Blick bleibt, der nichts hergibt, nichts beantwortet. Als freier Mann hat Wendland den Gerichtssaal betreten. Er verläßt ihn, links und rechts von ihm ein Beamter, als ein Verurteilter, und draußen wartet die Meute von Fotografen …
Der Mann in seinem Wagen rechnet nach: 17 Jahre, 5 Monate, 24 Tage. Er hätte es vorgezogen, es wäre ein rundes Datum gewesen – aber man konnte nicht alles haben, oder?
4
In Berlin herrschte ein Hundewetter, und die Maschine des Bundespräsidenten hatte Verspätung. Sein Mercedes parkte auf der Betonpiste, auf dem für ihn reservierten Platz. Der Fahrer saß hinter dem Steuer, im Trockenen. Robert Harrach stand draußen, neben dem Wagen, ohne Mantel, den Schirm ungeöffnet in der Hand. Er trug den dünnen, unauffälligen Anzug, der zu seinem Job gehörte.
Er war größer als sein Vater, kräftiger gebaut, aber die Ähnlichkeit der beiden Männer war nicht abzuleugnen: das langgezogene Gesicht, die zu groß geratene Nase, gewisse Gesten, wie der Griff mit zwei Fingern unter das Kinn, an die Stelle, wo die Narbe saß, auf der der Bart nicht wuchs.
Zu Harrachs Entsetzen war die Ähnlichkeit in den letzten Jahren eher größer geworden, und er haßte es, wenn man ihn darauf ansprach. Alles, was ihn an seinen Vater erinnerte, kostete ihn Überwindung.
Neben ihm senkte sich die gepanzerte Scheibe. Das Gesicht des Fahrers erschien. »Sie kommen.« Die Scheibe hob sich.
Harrach bewegte sich über die regennasse Betonpiste mit langsamen, steifen Bewegungen. War es das Wetter? Oder Berlin? Jeder fühlte sich verpflichtet, Berlin zu lieben. Er hatte nur schlechte Erinnerungen an die Stadt; ein abgebrochenes Jurastudium und die Frau, die er Hals über Kopf geheiratet hatte …
Die Scheinwerfer stachen aus den tiefhängenden Wolken. Die Bundeswehrmaschine landete, rollte aus. Harrach wartete, jetzt mit aufgespanntem Schirm, am Fuß der Treppe.
Der Bundespräsident erschien in der Kabinentür, weißhaarig, ohne Mantel. Ein Mann vom Protokoll wollte ihm einen Trenchcoat aufdrängen. Er nahm ihn über den Arm und kam die Stufen herunter. Als er sah, daß es Harrach war, sagte er: »Können Sie mir sagen, warum immer Hundewetter sein muß, wenn ich nach Berlin komme?«
Harrach fühlte, wie die Anspannung von ihm abfiel. »Es muß mit dem Berliner Humor zusammenhängen. Man bietet ihnen das Beste, was man hat.« Er hielt den Schirm über ihn und begleitete ihn zu dem wartenden Mercedes.
Sie würden zu spät zu der Vorstellung kommen, aber der Fahrer beeilte sich nicht. Es war der normale, starke Abendverkehr. Ein Fahrzeug des Personenschutzes fuhr voraus, ein zweites folgte ihnen. Keine Polizeieskorte auf Motorrädern mit Sirenen und Blaulicht. Der Präsident bestand darauf, Sicherheitsmaßnahmen auf ein absolutes Minimum zu beschränken.
Natürlich wußte er, was alles zu seiner Sicherheit aufgeboten wurde, wenn er seinen Amtssitz verließ, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Harrach hatte den ganzen Nachmittag mit seinen Männern im Schillertheater verbracht. Der Senat hatte die Subventionen für den Spielbetrieb gestrichen; der Präsident hatte der Bitte der Direktion und der Schauspieler entsprochen, eine der letzten Vorstellungen zu besuchen.
Hunderte von Demonstranten gegen die Schließung hatten sich vor dem Theater versammelt, als Harrach die Pläne studierte, den Weg festlegte, seinen Leuten für den Abend ihre Posten anwies; ein Dutzend draußen, die Hälfte für die Eingangshalle und Treppenaufgänge; und sie hatten sich einen der Hunde von der Berliner Polizei ausgeliehen, der darauf trainiert war, Sprengstoffe auszuschnüffeln.
Die drei Fahrzeuge näherten sich ihrem Ziel. Auf der angestrahlten Rasenfläche vor dem Bau waren Plakate aufgepflanzt. Demonstranten umlagerten den Eingang. Harrach schätzte sie auf nicht mehr als fünfzig. Sie würden friedlich sein – Regen hatte immer diese Wirkung.
Der Fahrer des Mercedes hielt so nahe wie möglich vor dem Eingang. Harrach verließ zuerst den Wagen. Der Rest war Routine, der sich auch der Präsident unterwarf. Sie nahmen ihn in die Mitte und bahnten ihm den Weg durch die Menge, das Foyer, die Treppen hinauf zu seiner Loge.
Harrach ließ zwei Beamte davor zurück. Er stieg hinunter ins Foyer. Im Hintergrund baute man das Buffet für die Pause auf. Er dachte bereits daran, daß sie den Präsidenten herunterbegleiten mußten. Es war nicht so sehr ein Sicherheitsproblem, es waren die Fragen, die man ihm stellen würde, über das Stück, die Schauspieler – das Pathos-Zeug, wie Harrach es nannte und in dem seine Frau eine solche Meisterin war, daß er seither nie mehr eine Oper oder ein Theater hatte aufsuchen können.
Harrach war seit dem frühen Morgen unterwegs. Er ging in die Kantine, bestellte einen Kaffee, nippte, ließ ihn dann stehen. Er zog ein Taschenbuch aus der Jackentasche, schlug es auf, wo die Seite umgeknickt war. Er gab vor, zu lesen, aber er dachte nach.
Auf dem Flughafen hatte er neben dem Präsidenten im Fond des Mercedes Platz genommen. Später, sie mußten vor einem Rotlicht anhalten, wandte der Staatsrepräsentant den Kopf und blickte ihn an.
»Sagen Sie, Harrach, wie geht es Ihrem Vater? Man hört so gar nichts mehr von ihm.«
Er konnte nicht sofort antworten. Der Präsident mußte spüren, wie ihn die einfache Frage aus der Fassung brachte. Er legte kurz seine Hand auf Harrachs Arm, wie um ihn zu beschwichtigen.
»Wir haben nie darüber gesprochen«, sagte er, »wissen Sie, daß wir derselbe Jahrgang sind und daß wir zusammen studiert haben?«
Harrach konnte plötzlich frei sprechen.
»Ich konnte mir nie vorstellen, daß er studiert hat. Für mich ist er schon in der Richterrobe geboren worden.« Dann fügte er hinzu: »Er hat kein Publikum mehr, aber ich weiß nicht, ob es ihm fehlt …«
Der Präsident glättete den Mantel auf seinem Schoß. Er blickte auf seine Hände, als er sagte: »Ich weiß, wie das ist – ich bin auch der Sohn eines berühmten Vaters.«
Die Ampel war längst auf Grün geschaltet, der Mercedes glitt durch den Verkehr, ruhig, ohne Sirene, ohne Blaulicht, mit den beiden Männern im Fond, von denen jeder seinen Gedanken nachhing.
5
Die Pereiras stammten aus dem Minho, dem Norden Portugals. Der Ort an der Küste lebt vom Fischfang – schlecht. Wer kein Boot besitzt, arbeitet in der Sardinenfabrik. Sie verpestet die Luft, und sie bezahlen dort Hungerlöhne.
Josef verließ mit 14 Jahren den Ort; eine erste Stelle als Küchenjunge in Braga. Nächste Stationen: Kellner in Porto, Souschef in Lissabon, Saalchef im Hotel Reid’s auf Madeira. Von dort, inzwischen verheiratet, war das Ehepaar dem Richter – der dort an einem Juristenkongreß teilgenommen hatte – nach Deutschland gefolgt.
Nach zwölf Jahren in seinen Diensten konnten die Pereira sich ein Grundstück kaufen, im Süden, in der Baixo Alentejo, nahe am Meer. In einem Jahr wurde der Rohbau erstellt, im nächsten das Dach vollendet, der Garten angelegt, Bäume gepflanzt.
Und dann, im letzten Jahr, als sie zum ersten Mal ihre Ferien im eigenen Haus verbringen wollten, hatten sie entdecken müssen, daß auf dem Nachbargrundstück eine stinkende Sardinenfabrik errichtet worden war. Soviel über Gerechtigkeit.
Josef befand sich in der Küche, um seiner Frau bei den letzten Vorbereitungen für das Abendessen zu helfen, als der Richter nach ihm verlangte. Er zog seine weiße Weste an, um sich in den ersten Stock zu begeben.
Harrach kam ihm bereits auf der Treppe entgegen, in Kleidern, in denen Josef ihn nie gesehen hatte. Er hielt eine Krawattenschleife in der Hand, die er in einer der Schubladen gefunden haben mußte.
»Sagen Sie, können Sie das binden?«
»Ich glaube schon.«
Der Richter blieb auf der untersten Stufe stehen; beide waren jetzt gleich groß; Josef stellte den Hemdkragen hoch, legte die Fliege um, band sie und brachte den Kragen wieder in Ordnung.
Der Richter blickte sich in der Halle um, deutete auf den Lüster in der Mitte. »Was ist mit dem Licht hier?«
Er hatte acht Arme mit acht Glühbirnen, aber nur jede zweite brannte. Josef war nicht jemand, der seinen Brotgeber ins Unrecht setzte, und so sagte er nur: »Ich werde die restlichen einschrauben.«
Sie traten zusammen in den großen Salon. Harrach interessierte sich nie für Details; kamen Gäste, überließ er alles dem Ehepaar Pereira, heute ging er zu der Doppeltür, die den Speiseraum abtrennte. Er schob sie auseinander, ging vor bis an den bereits gedeckten Tisch.
Er war oval, aus Mahagoni, ohne Tischtuch. Das Porzellan stand auf silbernen Platztellern, die Gläser auf Spitzendeckchen; in der Mitte befand sich der Tafelaufsatz des Grafen Galen, den Harrach erst kürzlich ersteigert hatte. Irgend etwas schien ihm zu mißfallen. Er deutete auf die beiden Gedecke, beide am äußersten Ende des Ovals.
»Setz sie an meine Seite«, sagte er. Er fügte hinzu: »An meine linke.«
Josef beeilte sich, seinem Wunsch nachzukommen. Aber der Richter entdeckte noch etwas, was seinen Widerspruch erregte. An seinem Platz stand eine Silberdose mit Deckel, in der sich die Pillen befanden, die er mit dem Essen einzunehmen hatte. Er zeigte darauf. »Schließ sie weg!« Vielleicht hatte Josef nicht schnell genug reagiert, denn Harrach fuhr ihn heftig an: »Sag mir nicht, was ich zu tun habe!«
Er wandte sich ab, ging in den Salon zurück. Er jagte den Hund vom Sofa. Der Raum war mit antiken Möbeln eingerichtet, zwei Gobelins hingen rechts und links von dem offenen Kamin, eine Wand enthielt die juristische Bibliothek. In einer Ecke stand der Kartentisch mit vier Stühlen.
Josef legte Holz im Kamin nach. Er begab sich durch die zweite Doppeltür in den Arbeitsraum des Richters und mixte ihm seinen Drink: einen Fingerbreit Whisky, vier Finger Wasser, ohne Eis. Er stellte das Glas auf ein silbernes Tablett und trug es in den Salon.
Der Richter nahm das Glas, stellte es neben sich auf einem Tischchen ab. »Du weißt, daß sie kein Fleisch und keinen Fisch ißt.«
»Meine Frau hat einen Gemüseauflauf gemacht.«
»Mein Gast wird sich um eine halbe Stunde verspäten. Und noch etwas – keine weißen Handschuhe beim Servieren, Josef.«
»Wie Sie wünschen. Servier ich nachher Tee und Kaffee?«
»Kaffee.«
»Auch für Sie?«
»Ich schlafe sowieso schlecht, also, was soll’s. Wir haben zu arbeiten.«
»Stell ich die Heizung auf Nachtbetrieb?«
»Nein. Und nehmen Sie den Hund mit zu sich. Sie fürchtet sich vor Hunden.«
Josef wollte gehen, aber der Richter hielt ihn zurück.
»Haben Sie mit Ihrer Frau gesprochen?«
»Ich fürchte, ich bin nicht viel weiter gekommen.«
»Ich werde mich also für den Rest meines Lebens von Suppen aus Dosen ernähren …«
»Noch nicht im nächsten Jahr. Ich würde es Ihnen rechtzeitig sagen.«
Der Richter nahm einen Schluck aus dem Glas, stellte es zurück. »Und wenn ich mir ein Haus in Portugal kaufe?«
Es brachte Josef aus der Fassung. Schließlich sagte er: »Sie würden sich nicht wohl fühlen dort. Viel zu heiß für Sie. Denken Sie daran, wie Sie im Sommer leiden.«