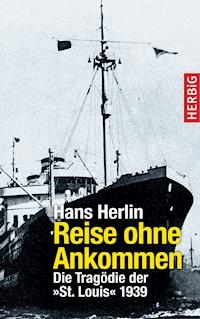3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
»Paßt auf!«, prophezeite Udet einen Tag vor seinem Tode, »sie werden sagen, ich sei an einem Herzschlag gestorben. Sie werden mir ein Staatsbegräbnis geben. Dann bin ich noch einmal der feine Max!« Wer war dieser Mann – Nationalheld, Widerstandskämpfer oder des »Teufels General«? Er war zunächst ein Mensch wie andere auch, mit Vorzügen und Schwächen, darüber hinaus aber war er ein Flieger, dem Fliegen einziger Daseinszweck und Glückseligkeit bedeutete. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Ähnliche
Hans Herlin
Ernst Udet
Der Flieger
FISCHER Digital
Inhalt
ZWEI MINUTEN vor den Nachrichten schob man dem Sprecher im Studio des Reichssenders Berlin einen schmalen Papierstreifen zu.
„Als erste Meldung!“ war am Rand vermerkt.
Der Sprecher legte den Streifen über den Wehrmachtsbericht vom 17. November 1941. Seine Hände strichen das dünne graue Papier glatt, ehe er den Text überflog. Dann las er ihn noch einmal, während der blaue Stift in seiner Hand einzelne Wortgruppen unterstrich.
Generaloberst Ernst Udet … bei Erprobung einer neuen Waffe … auf tragische Weise … in Erfüllung seiner Pflicht … Der Führer hat ein Staatsbegräbnis angeordnet.
Die Studio-Uhr zeigte eine Minute vor vierzehn Uhr. Der Sender strahlte noch das Mittagskonzert aus.
Die Einzelzimmer der Privatklinik des Luftwaffenarztes Professor Kempkes in der Augsburger Straße in Berlin hatten Radio. Auch Zimmer siebzehn. Dort hörte der Oberstleutnant Walter Angermund die Nachricht. Eben noch hatte Angermund vor sich hingedöst. Eben noch kam die Musik aus dem schwarzen Gehäuse des Volksempfängers am Kopfende seines Bettes und dann, unvermittelt, die feierlich getragene Stimme des Sprechers. –
Angermunds erster und einziger Gedanke war: „Das kann doch gar nicht sein …“ Er schaltete das Radio ab. Die Stille des Raumes machte alles noch unwirklicher. Er schob sich im Bett hoch und nahm das Telefon vom Nachttisch. Er stellte es auf seine Brust und wählte die Nummer des Reichsluftfahrtministeriums.
Die Nummer war besetzt. Er legte auf, wählte. Wieder besetzt. Er hämmerte auf die Gabel. Er versuchte es noch dreimal, aber es antwortete ihm immer nur das abweisende Zeichen. Dann wählte er eine andere Nummer. Als er die ruhige Stimme seiner Frau hörte, ließ er sich auf das Kissen zurückfallen.
„Hast du die Nachrichten gehört?“ fragte er. „Eben …“
„Nein.“
„Die letzten Nachrichten“, sagte er, „vor ein paar Minuten.“ Angermund blickte unwillkürlich zur Tür.
„Der Udet ist tot“, sagte er dann. „Der Ernst Udet. Tot. Ich denke, das kann gar nicht wahr sein … Mich hat keiner informiert. Ich liege hier, und Erni …“
Sie antwortete lange nicht, und er sah in diesem Augenblick ihr Gesicht vor sich. Es versuchte, wie immer in solchen Augenblicken, die beiden Jahre Krieg, die beiden Jahre Angst zu verleugnen.
„Kann ich etwas tun?“ hörte er ihre Stimme.
„Vielleicht könntest du dich um die Frauen kümmern. Sie werden seine Mutter und seine Schwester nach Berlin holen. Aber daß sie mich nicht benachrichtigt haben, verstehst du das?“
„Sie werden es schon noch tun“, sagte sie.
Später versuchte er wieder, das Reichsluftfahrtministerium anzurufen. Endlich bekam er eine Verbindung. Sabine von der Groeben war am Apparat, Udets Sekretärin.
„Sagen Sie, was ist denn los?“ fragte er. „Im Radio hieß es …“
„Ja, Herr Oberstleutnant …“, war alles, was sie sagte.
„Nun reden Sie schon!“
„Ach, wissen Sie, Herr Oberstleutnant, hier ist eine Mordsaufregung, ich weiß nicht, was ich sagen soll … und die Vorbereitungen für das Staatsbegräbnis … ich werde Herrn Oberst Pendele sagen, daß Sie angerufen haben. Er wird sich dann sicher mit Ihnen in Verbindung setzen …“
„Aber sagen Sie wenigstens, was stimmt denn an der Sache … daß er bei der Erprobung einer neuen Waffe …“ Angermund erschrak. Er hörte die Worte, als hätte ein anderer sie gesprochen. Sabine von der Groeben schien sie nicht gehört zu haben, sie legte auf.
Bei einer Erprobung einer neuen Waffe? – Was für eine Waffe das bloß sein mochte? Sie probierten ja an allerlei herum, da war von Geheimwaffen die Rede, die den Krieg entscheiden sollten … aber daß sie dem Generalluftzeugmeister, dem sie sogar das Kunstfliegen verboten hatten, erlaubten, sich in so ein Ding zu setzen?
Am Freitag also würde das Staatsbegräbnis sein. Nicht das erste. Und bestimmt nicht das letzte. Und der Oberstleutnant Walter Angermund würde zu seinen Produktionstafeln zurückkehren, zu den mit Buntstiften sauber gezogenen Kurven … Einen Augenblick lang saß ihm das alles wieder im Nacken. Die im Kampf gegen England verlorenen Maschinen, die im Nordmeer und Mittelmeer fehlenden schweren Kampfverbände, die immer stärker werdenden Einflüge englischer Bomber im Westen, die Schulverbände, die man seit dem Sommer in Rußland geopfert hatte … Die Truppen lagen vor Moskau, aber die schneidende Kälte hatte die Front erstarren lassen. Und während er hier hinter Doppeltür und Doppelfenster in dem überhitzten Zimmer lag, sammelte in der Stadt die Winterhilfe warme Sachen für die Soldaten, die nur für einen Sommerfeldzug ausgerüstet waren …
Als der Oberstleutnant Angermund aus der Klinik entlassen wurde, führte ihn sein erster Weg in die Stallupöner Allee. In der bedrückenden Stille dieses trüben Morgens ging der Oberstleutnant auf die einstöckige Villa zu.
Er hörte die Klingel im Hause anschlagen, ein lautes Schnarren, das wie ein Echo aus leeren, unbewohnten Räumen klang. Das Haushälterehepaar Peters mußte doch zu Hause sein? Aber niemand kam. Angermund schellte noch einmal. Dann ging er um das Haus herum. Die hohe Tür, die in die Halle führte, stand offen. Er trat ein, blickte sich suchend um, durchquerte die Halle und stieg die Treppe hinauf. Er öffnete die Tür zum „Fliegerzimmer“. Er starrte auf die Wände, an denen Erinnerungsstücke hingen. Wieder hatte er das Gefühl einer ungewohnten Leere. In diesem Augenblick hörte er, wie jemand seinen Namen rief. Er ließ den Türrahmen los und drehte sich um. Unten am Treppenabsatz stand Peters.
„Herr Oberstleutnant“, sagte Peters, „können wir einen Moment miteinander sprechen?“
Angermund ging hinunter. „Ja“, sagte er, „mit Ihnen hätte ich sowieso noch gesprochen.“
„Ich habe im Garten gearbeitet“, erklärte der Hausmeister. „Ich sah Sie hineingehen …“
Sie verließen das Haus. Sie gingen über den Rasen und dann den schmalen Weg zwischen den Stämmen der Fichten entlang.
„Ja, Herr Oberstleutnant“, sagte Peters dann, „ahnen Sie denn gar nichts? Wenn Sie wüßten, was sich hier getan hat am Montag …“ Er war stehengeblieben. „Sehen Sie“, begann er dann, „ich weiß, wie Sie mit Udet gestanden haben. Sie kennen ihn so lange und so gut … da kann ich nicht den Mund halten. Wo Sie doch im Krankenhaus waren und nichts weiter davon hörten.“ Er fuhr sich mit der Hand, an der noch Erde klebte, durch das Haar. „Wenn Sie wüßten, was wir hier erlebt haben!“ sagte er. „Aber ich darf ja gar nicht reden – denn wenn Sie Gebrauch davon machen – dann hänge ich.“
„Ja, Peters, ich werde Sie hängen lassen … das können Sie sich vorstellen.“ Angermunds Hand suchte Halt an einem der Baumstämme.
„Von mir erfährt niemand etwas“, sagte er.
„Das war in der Frühe“, berichtete Peters, „am siebzehnten, montags. – Der Schuß, das war unser Alarm … Das Telefon im Schlafzimmer des Herrn Generaloberst war ausgehängt – aber das sah ich erst später. Es war so um neun, kurz vor neun. Wir rauf. An der Tür gerüttelt. Nichts rührte sich. Wir klopften, aber er hatte sich eingeschlossen. Was nun? – Öffnen! Öffnen! Wir sind gewaltsam rein, und dann lag er da … er hatte sich mit dem mexikanischen Colt … Sie kennen doch den Riesencolt – erschossen. Die Waffe lag auf dem Boden neben seinem Bett …“
„Das wußte ich nicht … daß er Munition dazu hatte“, sagte Angermund. Er stand immer noch an den Baum gelehnt, die Hand gegen den Stamm gestützt. Die rauhe, kalte Rinde fühlte sich gut an. Ein Stück Leben.
„Es sah schlimm aus.“ Peters sprach ganz ruhig, aber so, wie einer spricht, der mit dem, was ihn quält, noch nicht fertig geworden ist. „So lag er da. Meine Frau war gegangen, um den Oberst Pendele anzurufen. Ich hab nachgefühlt. Vielleicht lebt er noch … und dann seh ich, der hat was angeschrieben! Am Kopf seiner Bettlade. Mit einem roten Fettstift.“
„Was hat er geschrieben?“
„Wir haben alle schwören müssen …“ Peters ließ den Kopf sinken.
„Ich werde schon noch dahinterkommen“, sagte Angermund. „Irgend jemand wird es wohl wissen.“
„Das ja! Seine … die Frau Bleier war da. Der Herr Winter ist gekommen. Der Herr Körner ist gekommen. Oberst Pendele und ein Arzt – nicht sein Arzt, nicht Dr. Brühl, der kam erst später. – Aber die werden auch nicht reden …“
„Sehen Sie mal, Peters“, sagte Angermund. „Meine Kameraden, sie haben mich nach dem Staatsbegräbnis in der Klinik besucht, und sie versichern mir, der Udet sei am Herzschlag gestorben.“
Peters lachte bitter. „Der Staatssekretär Körner hat mit Karinhall telefoniert. Und dann hieß es: Keiner verläßt das Haus! Nach ein paar Stunden hatte man sich die glorreiche Lüge erdacht.“
„Ja, Peters“, sagte Angermund, „ich habe so etwas geahnt. Mit dieser neuen Waffe da, in der wir nun eine ganz alte erkennen … Und auch die Motive … Können Sie sich vorstellen, warum er es getan hat?“
„Wissen Sie, Herr Oberstleutnant, was bei Ihnen im Amt los war – das wissen Sie ja besser als ich.“
„Jetzt brauchen sie keinen Schuldigen mehr zu suchen“, sagte Angermund. „Jetzt haben sie ihn. Ein Toter schweigt. Und die Lebenden, Peters, die werden sich schon rechtfertigen – das ist ein altes Lied, Peters. Die Methode kennen wir schon.“
Peters begleitete ihn bis zum Tor. Sie hatten sich schon die Hand gereicht, als Peters sagte: „Herr Oberstleutnant, da kommen jetzt eine Menge Leute angelaufen, auch solche, die für den General gar nichts übrig gehabt haben. Die wollen hier alles mögliche mitnehmen.“
„Wer kommt?“
„Ministeriumsleute. Wildfremde, die sich als seine Freunde ausgeben … Das darf hier doch nicht wie ein Ausverkauf losgehen.“ Peters hatte plötzlich Tränen in den Augen. Und dann sagte er: „So, nun habe ich’s Ihnen erzählt.“
Eine Viertelstunde später hielt Angermunds Wagen vor dem Hauptportal des Invalidenfriedhofs. Aber als er dann vor dem Hügel aus Kränzen stand, fragte er sich, weshalb es ihm so wichtig erschienen war, hierher an Udets Grab zu kommen.
Er starrte auf die Kranzschleifen. Er las die Namen, aber sie schienen bedeutungslos. Er blickte starr vor sich hin, als er die Schritte hörte, das Knirschen von Kies und dann die rauhe Stimme an seiner Seite:
„Viele Kränze, was?“ Der Mann zeigte mit dem Stiel seines Rechens auf das Grab. „Haben Sie ihn auch gekannt?“ fragte er neugierig. „Ich hab ihn mal gesehen. Oh, das ist lange her. In Staaken draußen, bei einem Volksflugtag. Der konnte fliegen! – Das war doch so ein Kleiner, nicht?“
„Ich hätte doch nicht hierher kommen sollen“, dachte Angermund.
„Aber so ein Kleiner war’s“, sagte der andere. „Ich frag mich nur, warum sie dann so’n großen Sarg nehmen. Sie machen da keinen Unterschied, sie stecken alle in die gleichen Särge … Na, ich will Sie man nicht stören.“
Angermund wußte nicht, wie lange er dort stand. Vom Hauptweg kam das ferne Geräusch eines Rechens, der über den harten Kies fuhr. Das Geräusch begleitete die ganze Zeit seine Gedanken.
„Wenn du nur ein Wort gesagt hättest, Erni“, dachte er, „ich hätte schon eine Maschine klar gekriegt und ein paar Zusatztanks dran … Das hätte uns ganz schön weit gebracht …
Weißt du noch, damals, als du mit der Curtiss aus Amerika zurückkamst – dreiunddreißig war das –, damals, da hätten wir wirklich wieder auf Tournee gehen sollen. Mit der schweren Curtiss stürzen und mit dem Flamingo Kunstflug – du hättest dich in die Luft gehängt, und ich hätte unten kassiert, wie in alten Zeiten. Wir hätten es wirklich tun sollen. Aber es lag wohl an mir, ich meinte damals – ach, das sagt er nur so …
Würdest du noch einmal alles erleben wollen? … Ich meine, wir haben auch unsere großen Zeiten gehabt, alles in allem.“
„Aber wirklich, alles noch einmal erleben …“ dachte der Mann vor dem Grab, ehe er sich abwandte und mit müden Schritten zurückging.
„Von Anfang an …“ dachte er.
Erster Teil As der Asse
Es war ein heißer August. Der heißeste August seit langem. Damals hatte es begonnen. Es hatte alles seine Ursachen und Gründe, aber für sie, die Achtzehnjährigen des Jahres 1914, hatte es an jenem heißen August begonnen, als in Berlin der Kaiser vom Balkon seines Schlosses herab einer begeisterten Menge verkündet hatte: „Sie haben mir das Schwert in die Hand gezwungen.“
In München zog eine jubelnde Menge unter den ruhmreichen Fahnen von 70/71 zum Odeonsplatz. „Es braust ein Ruf wie Donnerhall …“, sangen sie, „… zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein.“
Die Klassenräume der höheren Schulen leerten sich. Vor den Annahmestellen standen Schlangen.
Vom Münchner Hauptbahnhof fuhren die mit Blumen geschmückten Züge ins Feld. Mit Kreide hatten die Soldaten an die Waggons geschrieben: „Hier werden noch Kriegserklärungen angenommen.“
Für den achtzehnjährigen Ernst Udet, der am Abend des 2. August am Bahnhof stand, hatte der Tag mit einer Enttäuschung begonnen. Er hatte sich freiwillig gemeldet, aber er war abgewiesen worden.
Am 7. August besetzten deutsche Truppen Lüttich. Fast jeden Tag liefen jetzt die Verkäufer mit neuen Extrablättern durch die Straßen Münchens. Und täglich sprach in der Münchner Geschäftsstelle des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs ein schmächtiger Junge vor. Ernst Udet hatte sich dort gemeldet. Er besaß ein eigenes Motorrad, und der ADAC hatte die Vermittlung von Herrenfahrern an das Heer übernommen. Ihre Aufgabe war: Nachrichtenübermittlung und Transporte hinter der Front. Seither fuhr Ernst Udet nur noch in dreiviertellanger Lederjacke und großen Stulpenhandschuhen durch die Straßen Münchens und wartete auf seinen großen Tag.
Am 21. August, zwanzig Tage nach Kriegsbeginn, saß der „Kriegsmutwillige“ Udet in einem Zimmer des Hotels Pfeifer in Straßburg und schrieb seinen ersten Brief nach Hause.
Wie aus Blei gegossen hob sich die Silhouette des Münsters gegen die wolkenlose Bläue des Himmels ab. Wenn es still war, konnte Udet in seinem Zimmer das Schießen von der Front hören. Sie sollte nur fünfzehn Kilometer weit weg sein. Auf dem Tisch, an dem der Achtzehnjährige schrieb, lag eine Pistole. Heute morgen erst hatte er sie in Empfang genommen. Pistole, Uniformstücke und die weiße Binde, die er jetzt am linken Arm trug. Seit heute morgen war er „Verkehrsoffizier“ bei der 26. Württembergischen Reservedivision.
Am Abend dieses Tages schrieb er nach Hause, was sicher Tausende anderer Achtzehnjähriger in jenen Augusttagen an ihre Väter geschrieben haben:
„Mein lieber alter Herr! Du hattest mich oft als feige bezeichnet. Ich glaube, daß Du Dich darin doch getäuscht haben magst. Es geht morgen weg an die Front, und ich hoffe, daß es mit dem ,Eisernen‘ dann nicht mehr allzu lange dauert. Sollte mir nun wirklich etwas zustoßen … nun, dann hat mein leichtsinniges Leben doch einen würdigen Abschluß gefunden. Dein Kleiner.“
Drei Wochen später sah alles ganz anders aus. Drei Wochen später war Ernst Udet wieder in Straßburg. In einem Lazarett.
Am 22. August hatte seine Division Straßburg verlassen. Uber staubige Straßen drangen sie bis St. Dié vor. Am 6. September waren sie in den stark zerschossenen Ort eingezogen. Und dann, von heute auf morgen, hatte der überstürzte Rückzug begonnen.
Udet hatte den Tag über hinter der Front Post gefahren. Als er abends nach St. Dié zurückkam, war der Ort von den Deutschen geräumt worden. Der Achtzehnjährige wußte nichts von den zurückfliehenden Truppen, nichts von dem, was man später das „Marne-Drama“ nennen würde – für ihn war alles in den Augen der Frau zu lesen, die unter der Tür seines Quartiers stand.
„Heute kann ich Sie leider nicht mehr aufnehmen“, sagte sie. „Heute nacht kommen die Franzosen zurück … Ihr Stab ist schon fort …“
Es war dunkel, als Udet mit seinem Motorrad den Ort verließ. An den Straßen lagen noch die Gefallenen vom Vormarsch. Udet schloß die Augen, wenn das Scheinwerferlicht seines Motorrades die verkrampften Gestalten erfaßte. Er fuhr kreuz und quer, um dem Geschützfeuer auszuweichen. Aber die zirpenden Kugeln der Gewehre und die tackenden Maschinengewehre schienen ihn immer enger einzukreisen.
Er sah den Granattrichter erst im letzten Augenblick. Er riß den Lenker herum. Die Räder rutschten über die Straßenböschung, mahlten durch den Schlamm. Dann spürte er nur noch die Leere in seinem Magen, als das Vorderrad unter ihm wegsackte und er aus dem Sitz geschleudert wurde. Er wußte nicht, wie lange es gedauert hatte, bis er wieder zu sich kam. Er spürte den brennenden Schmerz in der Schulter. Fünfzehn Kilometer schob er sein Motorrad durch den Regen und die Nacht. Oft war er nahe daran, aufzugeben. Dann fand er einen Karren, ein herrenloses, verängstigtes Zugpferd davor. Er schob das Motorrad auf den Karren. So kam er am nächsten Tag wieder nach Straßburg … Ein paar Soldaten sahen das seltsame Gefährt, das von einem müden Gaul durch die Straßen gezogen wurde. Sie hoben den Ohnmächtigen aus dem Karren und trugen ihn ins Lazarett.
Als Ernst Udet nach zehn Tagen entlassen wurde, erfuhr er, daß seine Division nach Belgien verladen worden sei. Er fuhr ihr nach. Sein Motorrad war wieder zusammengeflickt worden. In Namur wußte man nichts von der Division. In Namur nicht, in St. Quentin nicht. Auch in Lüttich fand er sie nicht. Niemand schien ihren Standort zu wissen. In Lüttich meldete er sich beim Kraftwagenpark. Dort konnte er Post ausfahren.
Er wohnte im Hôtel de Dinant. Nach 20 Uhr, nach der Sperrstunde, saß er Monsieur Fernand in der Halle des Hotels in einem der weinroten Plüschsessel gegenüber. Sie sprachen selten miteinander. Immer wieder fühlte sich der junge Deutsche von Monsieur Fernand beobachtet, aber wenn er ihn ansah, wandte sich der Mann ab.
Im Hôtel de Dinant hatte Ernst Udet den Leutnant von Waxheim kennengelernt. Leutnant von Waxheim war Flieger. An dem Abend, an dem er im Hotel übernachtete, lud er den „Kleinen“ zum Abendessen ein.
Die Feldfliegerabteilung des Leutnants von Waxheim lag bei St. Quentin. Davon erzählte er beim Essen. Nachher – sie tranken Wein – rückte Udet mit seiner Bitte heraus. Das Lächeln des Leutnants machte ihn nicht irre.
Udet erzählte von München, von den Jungen, die mit ihm dort den Aero-Club gegründet hatten. Von den Modellen, die sie gebaut hatten, von den Flugversuchen.
Leutnant von Waxheim lehnte sich zurück. Sein Gesicht lag im Schatten, als er sagte: „Ich weiß, was Sie denken. Flieger halten sich Reitpferde und Hunde. Die gehen jeden Tag auf die Jagd und schlafen in Schlössern auf seidenen Betten. Ja, wir leben wie die Götter – und sollen jeden Tag sterben. Flieger sind einsam, nicht nur dann, wenn sie fliegen. Aber wenn Sie fliegen wollen, wenn Sie es mehr wollen als alles andere, dann ist es sinnlos, Ihnen dies zu sagen.“
Später, in seinem Zimmer, dachte Udet nur noch an das Versprechen, das der Leutnant ihm zum Schluß gegeben hatte: „Ich nehme Sie gern als meinen Beobachter. Ich werde Sie anrufen, sobald ich die Zustimmung habe.“
Zehn Tage später kam sein Anruf, es sei alles in Ordnung. Morgen solle er sich in St. Quentin melden. Das war morgens um 10 Uhr.
Monsieur Fernand stand in der Halle am Fenster, als er seinen jungen deutschen Gast vier Stunden später vor dem Hotel vorfahren sah. Er rührte sich nicht, als Udet die Tür mit dem Fuß aufstieß und in die Halle trat, einen schweren Blechkoffer in beiden Händen.
Udet stellte den Koffer auf den Boden. Er schlug den Deckel zurück. Er hob einen schweren ledernen Fliegerhelm heraus und hielt ihn triumphierend hoch.
„Wollen Sie ihn nicht wenigstens ansehen?“ sagte er enttäuscht. „Es ist ein erbeuteter französischer Fliegerhelm. Aus einer Maschine, die hier notlanden mußte.“
Fernand hatte sich umgewandt. Er starrte auf den Helm. Dann blickte er für Sekunden den Jungen an. Seine Augen waren traurig und rotumrändert. Er schüttelte den Kopf. Dann ging er schleppend hinüber zu seinem Stuhl hinter der Theke.
In seinem Zimmer lag ein Brief von seinem Vater. Erst nachdem er gepackt hatte, riß er ihn auf. Der alte Herr nannte ihm die Adresse eines alten Geschäftsfreundes aus Lüttich. Kerkhoue war der Name. „Vergiß nicht“, schrieb sein Vater, „der Familie Kerkhoue meine Grüße auszurichten.“
Es war kurz nach sechs, als Udet das Haus gefunden hatte. Es lag in der Stadt, ganz in der Nähe der Brücke über die Maas. In der Straße war heftig gekämpft worden. Als er mit dem Motorrad vor dem Haus hielt, sah er die Einschüsse in der Fassade. Seine Hand tastete nach der Fliegerbrille, die halb aus der Seitentasche seines Rockes heraushing, als er das breite Portal hinaufstieg. Die weiß gestrichenen Läden waren vor die Fenster geschlagen. Er ließ den Messingklopfer gegen die schwere Tür fallen. Das Mädchen öffnete die Tür nur eine Handbreit. „Bitte?“ fragte das Mädchen.
Er stieß die Tür auf und trat ein. Als sich seine Augen an das Dämmerlicht der großen Halle gewöhnt hatten, sah er sie in der Mitte des Raumes stehen. Er nannte seinen Namen, aber sie blickte ihn nur groß und erschrocken an.
Erst jetzt bemerkte er die aufgerollten Teppiche, die gardinenlosen Fenster und die weißen Schonüberzüge auf den Sesseln. „Sie sind Mademoiselle Kerkhoue?“ fragte er.
Sie stutzte einen Augenblick. Dann lachte sie. Ihr Lachen schien den verlassenen Raum wieder zu beleben. „Das war schön.“ Sie hatte eine ganz helle Stimme. Der starke Akzent, mit dem sie sprach, machte ihre Stimme noch schwebender. „Mademoiselle Kerkhoue! Mademoiselle Kerkhoue!“ Sie sang es vor sich hin. Sie tanzte dabei durch die Halle. Tanzte an der Haustür vorbei, sie stieß sie zu und stand dann plötzlich vor ihm.
„Mademoiselle und ihre Eltern sind weg“, sagte sie. „Sie sind vor euch weggelaufen. Nach Antwerpen.“
„Und Sie?“ fragte er.
„Ich laufe nicht weg“, antwortete sie. „Ich habe keine Angst.“ Sie zeigte auf die Fliegerbrille, die aus seiner Seitentasche heraushing. „Sie sind …“ sie hob beide Arme und imitierte die schwebenden Flächen zweier Flügel … „Sie sind Flieger?“
Im ersten Augenblick schämte er sich zu lügen. Aber dann sagte er: „Ja, in St. Quentin. In einem Schloß.“
„In einem Schloß?“ fragte sie. „Mit seidenen Betten?“
Er nickte.
„Wie Mademoiselle Kerkhoue“, sagte sie. „Wollen Sie es sehen?“ Sie griff nach seiner Hand. Sie zog ihn mit sich, die breite Treppe ins Obergeschoß hinauf. Sie hasteten einen Gang entlang, und dann warf sie die Tür zu einem Zimmer auf. „Hier schläft Mademoiselle“, sagte das Mädchen atemlos.
Die Läden vor den Fenstern zerteilten das Licht in kleine helle Flächen. Eine Handbreit Helligkeit lag auf ihrem Haar, und einen Augenblick dachte er: „Sie trägt ja noch Zöpfe.“ Aber als dann das Licht auf ihr Gesicht fiel und er ihre Augen sah, war das nur noch ein ferner, flüchtiger Gedanke.
Sie hielt noch immer seine Hand. Sie hob sie ganz schnell zu ihrer Wange empor. Dann trat sie an das breite Bett. Es war, wie die Sessel in der Halle unten, mit einem weißen Schonüberzug überdeckt. Sie lachte leise vor sich hin, als sie das Leinen wegzog. Ihre Hand fuhr leicht über die vom Sonnenlicht zu einem Perlmutt-Ton verblichene Seide. „Fühl doch!“ sagte sie.
Er kam erst eine halbe Stunde nach der Sperrstunde wieder ins Hotel.
Monsieur Fernand stand von seinem Stuhl auf, als die Eingangstür zufiel.
Udet erkannte den sonst abweisenden Mann nicht wieder. Monsieur Fernand ging auf den Deutschen zu und faßte ihn an beiden Armen.
„Viens“, sagte er, „Komm!“ Er zog ihn mit sich zur Theke. Er zeigte auf ein Kuvert, das dort lag, und drückte es Udet lächelnd in die Hand.
„La guerre“, sagte er, „la guerre, für dich finie!“
„Was heißt das?“
„Morgen“, sagte der Mann, „fährst du nach Hause.“
Udet riß das Kuvert auf, zog die Papiere heraus. Er las: Seine Versetzung nach St. Quentin war rückgängig gemacht worden. Die Verträge mit den freiwilligen Motorradfahrern waren aufgelöst worden. Und bei den Papieren lag ein Fahrausweis. Lüttich – München … Monsieur Fernand zog eine alte zerfranste Brieftasche aus seinem Rock. Seine Hände zitterten, als er die Fotografie aus einem der Seitenfächer herausnahm. „Für dich“, sagte er. „Zum …“ Er suchte nach dem Wort, „… zum Abschied.“
Es war ein Fliegerbild. In der Maschine mit der französischen Kokarde saß ein junger Mann. Udet kannte ihn nicht. Aber was er sofort erkannte, war der schwere französische Fliegerhelm, der das schmale Gesicht eng umschloß. Es war ein Helm wie der, der oben in seinem Zimmer im Blechkoffer lag. Und dann sah er die Augen des jungen Fliegers; es waren die gleichen traurigen, rotumränderten Augen, wie Monsieur Fernand sie hatte. „Das ist Ihr – Sohn?“
Monsieur Fernand nickte. „Er ist tot. Er ist gleich am ersten Kriegstag fortgegangen. Er war so wie Sie. Er hat mir einmal geschrieben, daß die Franzosen ihn als Flieger genommen haben … Dann kam nur noch dieses Bild. Ein Freund hatte es gemacht, kurz bevor mein Sohn abstürzte.“
„Und was soll ich …?“ fragte Ernst stockend.
„Es soll Sie erinnern“, sagte Monsieur Fernand. „Ihr habt ein Kreuz auf euren Maschinen. Die anderen Kokarden. Aber in beiden sitzen unsere Söhne.“
Ein halbes Jahr später war auch Leutnant von Waxheim tot.
Ernst Udet saß im Zug nach Darmstadt, als er den Namen des Leutnants in einer Nummer des „Flugsports“ in der Flugzeugführer-Verlustliste entdeckte.
Udet hatte sich sofort wieder freiwillig gemeldet, als er nach München zurückkam. Diesmal in Schleißheim bei der Fliegerersatzabteilung. Monsieur Fernands Mahnung und seines Vaters Widerspruch hatten ihn nicht daran hindern können. Man hatte ihn abgewiesen. Es entmutigte ihn nicht. Er ließ sich auf eigene Kosten als Pilot ausbilden und schickte seine Bewerbung nach Darmstadt und Döberitz. Schon nach wenigen Tagen war von Darmstadt der telegrafische Gestellungsbefehl gekommen. Jetzt war er auf dem Wege dorthin.
Er lehnte in einer Ecke des Abteils, als er den Namen des Leutnant von Waxheim las. Der trübe Widerschein der Petroleumlampe an der Decke färbte die Seite tiefblau. Er senkte seine Hände, die das Heft hielten, und blickte ins Leere. Leutnant von Waxheim tot! – Was der junge angehende Flieger Ernst Udet in dieser Stunde nicht wußte, war, daß der Tod des Leutnant von Waxheim auch sein Fliegerleben bestimmen würde.
Der Tod war aus heiterem Himmel gekommen. Es war der zweite Flug, den vier deutsche Aufklärer an jenem Tag machten. Sie flogen in dreitausend Meter Höhe über den Schützengräben, die die Erde wie Adern durchzogen.
Leutnant von Waxheim flog die erste Maschine. Der Beobachter im Sitz vor ihm hatte schon das Zeichen zum Rückflug gegeben, als in der Ferne der winzige Punkt auftauchte. Er wurde schnell größer, und dann erkannten sie den kleinen französischen Eindecker.
Er flog auf sie zu.
Der Beobachter hatte sich erstaunt in seinem Sitz umgewandt. Auch Leutnant von Waxheim schüttelte den Kopf. Er beobachtete die Maschine voller Neugier, aber ohne jede Unruhe. Die Sonne stand in ihrem Rücken, und solange der Franzose so auf sie zuflog, bestand keine Gefahr. Die Deutschen hatten Pistolen und Mausergewehre an Bord, aber die waren für den Fall einer Notlandung hinter feindlichen Linien gedacht. Flugzeuge waren im Frühjahr 1915 keine Kampfmaschinen. Flugzeuge dienten der Beobachtung. Nur von Zeit zu Zeit schoß man sich mit verrückten Engländern, die zielten, wenn sie eine deutsche Maschine überflogen.
Der französische Einsitzer hielt noch immer auf sie zu.
Waxheim starrte auf den Kreis seines Propellers. Seine Augen weiteten sich vor Erstaunen … Mit diesem verständnislosen Ausdruck in seinem Gesicht starb er.
Trudelnd stürzte die brennende Maschine des Leutnant von Waxheim der Erde zu.
Die drei anderen deutschen Maschinen ergriffen die Flucht. Die Piloten hatten gesehen, was vor ihnen noch kein anderer Flieger gesehen hatte: den Tod, der direkt durch den Propeller kam.
Sie hatten das automatische Gewehr gesehen, das vor dem Sitz des Piloten fest montiert war und die Feuerstöße durch den Propeller sandte.
Die Erschütterung stand noch auf den schneeweißen Gesichtern der deutschen Piloten, als sie landeten. Aber als sie dann im Kasino ihr Erlebnis erzählten, glaubte ihnen niemand.
Bis es wieder geschah. Einmal, und dann noch einmal, und immer wieder. Es war stets die gleiche französische Maschine. Der Feind schien nur diese eine in der Luft zu haben. Die Nachricht eilte von Flugplatz zu Flugplatz. Und wenn jetzt ein kleiner französischer Eindecker auftauchte, ergriffen die Deutschen die Flucht.
Wie alles geschehen war, erfuhr Ernst Udet erst in Heiligkreuz bei Colmar. Dorthin war er kommandiert worden, nachdem er in Darmstadt die Flugzeugmeisterprüfung abgelegt hatte.
Sie flogen bei gutem Wetter jeden Tag, der Beobachter Leutnant Bruno Justinus und er. Dem französischen Eindecker waren sie nie begegnet. Drei Wochen später sahen sie ihn. Sie waren an diesem Tag weit in das feindliche Gebiet über Beifort hineingeflogen. Sie waren schon wieder nahe den deutschen Linien, als Leutnant Justinus den Franzosen entdeckte. Es war der Eindecker. Der Pilot hatte einen Angriff auf eine Bahnstation geflogen und dabei Fliegerpfeile abgeworfen. Er flog jetzt etwa tausend Meter unter ihnen.
„Höher!“ gab Leutnant Justinus das Zeichen, aber dann wandte er sich jäh in seinem Sitz um. Seine ausgestreckte Hand deutete aufgeregt nach unten:
Der Propeller der französischen Maschine stand still. Motorlos glitt sie dahin. Sie verlor schnell an Höhe. Sie mußte bei dem Angriff einen Treffer abbekommen haben.
Sie stießen dem Eindecker nach, bis sie so nahe waren, daß sie das hinter dem Propeller montierte automatische Gewehr erkannten.
Justinus schrie etwas. Im Lärm des Motors blieben seine Worte unverständlich. Udet blieb dicht hinter der anderen Maschine. Justinus hatte sich in seinem Beobachtersitz hochgezogen.
Es war kurz nach drei Uhr, als der französische Eindecker auf einer Viehweide in der Nähe des Dorfes Hülste aufsetzte.
Ganz dicht huschten sie über ihn hinweg. Sie sahen die deutschen Kavalleristen auf die Maschine zureiten, als sie über dem Franzosen kreisten.
Vergeblich hatte der französische Pilot versucht, seine Maschine in Brand zu stecken. Der Franzose wurde gefangengenommen. Er hockte auf der Erde und starrte vor sich hin. Seine Hände umklammerten den dicken Fliegerschal. Sein Gesicht verzog sich zu einem schmerzlichen Lächeln, als die Deutschen vor ihm standen. Er machte die Andeutung einer Verbeugung und nannte seinen Namen: „Roland Garros.“ Dann setzte er sich wieder auf die Erde und grub seinen Kopf noch tiefer in die Arme. Er antwortete auf keine Frage.
„Haben Sie viele von diesen Maschinen in der Luft?“ fragte der deutsche Offizier.
Der Franzose blickte auf. Sein kleines schwarzes Bärtchen auf der Oberlippe verzog sich. „Solche Fragen sollten Sie einem Kriegsgefangenen nicht stellen“, sagte er.
In einem Sanitätsauto wurde Garros nach dem ersten Verhör nach Lendelede gebracht. Ehrliche Bewunderung stand auf den Gesichtern der deutschen Offiziere, als sie den französischen Gegner in ihr Auto baten.
Am nächsten Tag würde Roland Garros in ein Elite-Gefangenenlager gebracht werden. Später gelang es ihm, von dort zu fliehen. Er flog weiter, den ganzen Krieg. Im Oktober 1918 kehrte er von einem Flug nicht zurück. Aber an diesem Abend feierten die deutschen Offiziere den Franzosen im Kasino der Kommandantur von Lendelede wie einen Helden.
Das Flugzeug des Franzosen aber sollte den Krieg in der Luft entscheidend verändern.
Tiefe Gewitterwolken trieben über dem kleinen Erprobungsflugplatz in Berlin. Es dunkelte schon. Vor einem Hangar parkten ein Dutzend Wagen. Gelangweilt schritten die Fahrer auf und ab. Sobald sie sich dem Hangar näherten, wurden sie von den Posten zurückgeschickt. Die Offiziere, die im Hangar neben den Resten des kleinen französischen Eindeckers standen, unterhielten sich leise.
Am Tag zuvor waren das demontierte Maschinengewehr, der Motor und der Propeller der Maschine des Franzosen Roland Garros von der Front nach Berlin gebracht worden. Die Gesichter der Offiziere waren ernst, denn was sie sahen, war so simpel, daß sie es zuerst nicht glauben wollten: Die hölzernen Propeller des Eindeckers waren im Schußkreis des automatischen Gewehrs mit Stahlmanschetten versehen. Sie sollten die Kugeln ablenken. Man hatte einfach darauf vertraut, daß höchstens jede zehnte Kugel den Propeller treffen würde – und für die mußte das Schutzblech ein ausreichender Schutz sein. Das war das ganze Geheimnis.
Der französische Pilot, der mit dieser Maschine den deutschen Fliegern den Tod brachte, hatte jedesmal sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. „Wenn der Feind hundert Maschinen mit diesem Gewehr in der Luft hat“, sagte einer, „gewinnt ihm das unter Umständen den Krieg.“
„Sie werden keine hundert Piloten wie diesen Garros finden“, antwortete Feldflugchef Oberst Thomsen. „Die Gefahr liegt woanders. Wenn es dem Feind gelingt, diese Methode zu verbessern …“, er wandte sich an seinen Adjutanten, „… was ist denn? Warum kommt Fokker nicht?“
„Ich habe mit Schwerin gesprochen“, meldete der Adjutant. Er salutierte erschrocken.
„Rufen Sie noch einmal an!“
Der Adjutant ging zur Tür des Hangars, schlüpfte nach draußen.
Ein Offizier flüsterte Thomsen zu: „Vertrauen Herr Oberst dem Herrn Fokker nicht zu sehr? Er hat seine Verbindungen zu England, zu den Russen. – Wenn er auch kein feindlicher Ausländer ist, als Holländer ist er immerhin doch ein Neutraler …“
„Unser ,Fliegender Holländer‘?“ antwortete Thomsen. „Nein, mein Lieber, da sehen Sie Gespenster, wo keine sind. Fokker baut schließlich seit dem Jahre dreizehn für uns. Wir können glücklich sein, daß seine Landsleute ihn für einen Phantasten hielten. Und daß die Engländer, Franzosen und Russen den jungen Tulpenzüchtersohn nicht ganz ernst nahmen, als er ihnen ausgerechnet Flugapparate verkaufen wollte …“ Draußen hielt ein Wagen. Der kleine Holländer, der dann den Hangar betrat, war in diesem Kreis eine seltsame Erscheinung. Er trug schwarzweiß karierte, ungebügelte Breeches, Wickelgamaschen, einen abgetragenen halblangen Tweed-Mantel. Oberst Thomsen ging auf den jungen Mann zu. Fokker lächelte. Es war ein jungenhaftes Grinsen.
„Das ist sie also, die Wundermaschine“, sagte er. Er hatte die karierte Sportmütze sofort wieder aufgesetzt. Er schob sie aus der Stirn, als er die Teile der Maschine eingehend untersuchte.
„Nehmen Sie mit, was Sie brauchen“, sagte Thomsen. „Erproben Sie alles in Schwerin. Ich erwarte Ihren Bericht …“
„In achtundvierzig Stunden“, sagte Fokker. „Ich kenne Ihre Termine.“ Ein Abteil des Zuges, der in dieser Nacht vom Bahnhof Friedrichstraße nach Schwerin fuhr, bewachte ein Posten. Hinter den zugezogenen Vorhängen stand der fünfundzwanzigjährige Anton Fokker am Fenster des Abteils. Auf den Bänken lagen das ausgebaute automatische Gewehr und der Propeller aus dem Eindecker des Piloten Roland Garros. Die Sportmütze weit in den Nacken geschoben, die Stirn gegen das Glas der Scheibe gepreßt, so stand der Holländer da. Er überlegte: Garros hatte die Kugeln einfach zwischen den rotierenden Propellern hindurchgeschossen und auf sein Glück vertraut. – Aber war es wirklich Glück? Es war Roulette. Ein Roulette, auf dem es zu viele Todesfelder gab.
Wie wäre es – dachte der junge Mann –, wenn man den Propeller das Gewehr abdrücken ließe … Das war es! Das war die ganze Hexerei. Die Nacht vor dem Fenster war tief und schwarz. Der Zug schien plötzlich still zu stehen. Gedankenverloren zeichnete der Holländer einen Propeller auf das beschlagene Glas der Scheibe. Mit keinem Gedanken dachte er an die Menschen, die durch seine Waffe getötet würden.
Achtundvierzig Stunden später führte Anton Fokker den Offizieren des Generalstabs in Berlin seine Konstruktion vor. Etwas fassungslos besichtigten die Herren die Maschine. Die Propellerblätter hatten keine Stahlbeschläge. Fokker überhörte ihre Fragen. Er kletterte in den Führersitz der Maschine. Er winkte, sie sollten beiseite treten. Dann startete er den Motor. Die Räder der Maschine stemmten sich gegen die Bremsklötze, als die Salven durch den sich drehenden Propeller jagten. Eine Serie von hundert Schüssen peitschte über den Platz. Als der Motor erstarb, rannten die Offiziere über das Feld. Der Propeller war unbeschädigt. Aber die Gesichter der Generalstäbler blieben skeptisch. Daran änderte sich auch nichts, als Fokker ihnen seine Konstruktion erklärte. Ein metallener Knopf am Propeller schlug bei jeder Umdrehung an eine Nocke, die mit dem Abzug des Gewehrs verhakt war.
Das war alles? Keiner der Zeugen schien richtig zu erfassen, daß sie die Geburtsstunde einer neuen Waffe miterlebt hatten, des synchronisierten Maschinengewehrs. Es war die erste neue Waffe dieses Krieges.
Während die Offiziere zusammenstanden und sich erregt berieten, hielt sich Fokker abseits. Schließlich waren es Feldflugchef Oberst Thomsen und sein Berater Hauptmann Wilhelm Siegert, die über den Platz auf den Holländer zukamen.
„Wir müssen sicher gehen“, sagte Thomsen, „ehe wir unseren Piloten solche Maschinen geben. Es gibt dafür nur einen Weg, Fokker. Bringen Sie Ihre Maschine an die Front. Erklären Sie einem Piloten, wie sie zu fliegen ist. Dann lassen Sie ihn aufsteigen und eine feindliche Maschine abschießen. Nur so wird sich herausstellen, wie kampffähig Ihr Maschinengewehr ist.“
Im Hauptquartier des Kronprinzen in Stenay, zwischen Sedan und Verdun, erwartete man Anton Fokker auf dem Feldflugplatz der Fliegerabteilung 25. Seine Maschine stand streng bewacht in einem Zelt. Sie war mit der Bahn vorausgeschickt worden.
Alles war bereit, als der kleine Holländer in seinem Peugeot vorfuhr. Der Kronprinz begrüßte Fokker herzlich. Dann übermittelte er dem jungen Flugzeugbauer lächelnd den Befehl, der heute morgen im Hauptquartier eingegangen war. „Es wird gewünscht, daß Sie Ihre Maschine hier selbst vorfliegen.“
„Was denn, ich selbst? …“ Ungläubig starrte Fokker in die Gesichter der Umstehenden. Hauptmann Hähnelt, Stabsoffizier der Flieger beim Armeeoberkommando 5, war neben Fokker getreten. Ebenso der Führer der Abteilung 25, Hauptmann Blum, der Aufklärungsflieger Leutnant Loerzer und ein Beobachter namens Hermann Göring. „Aber in Berlin hieß es doch, ein deutscher Pilot …“
Aber dann ging er zu seinem Wagen. Er nahm die Fliegerbrille und die wollene Fliegerhaube aus dem Rücksitz des Wagens und schritt hinüber zum Flugzeugzelt. Die Maschine war schon aus dem Zelt gezogen worden, und Fokker startete. Uber dem Hauptquartier zog er eine Schleife. Dann stieß er mit der Nase nach unten. Plötzlich tackte das Maschinengewehr. Die Garben peitschten in abmontierte Tragflächen, die neben einem der Flugzeugzelte lagen. Die Stoffbespannung um das aufgemalte Eiserne Kreuz zerfetzte. Dann zog der Pilot die Maschine kurz noch einmal hoch und schwebte zur Landung ein.
Die Offiziere umringten den kleinen Holländer. Sie bestürmten ihn mit Fragen. Fokker hob abwehrend die Hände.
„Sie haben gesehen, das Maschinengewehr funktioniert“, sagte er dann. Er wies hinüber zu den zerschossenen Tragflächen. „Es funktioniert auch in der Luft. Das andere müssen eure Piloten machen. Ich kann es nicht. Ich will nur bauen, schnellere, sichere, wendigere Maschinen. Aber den Krieg müßt ihr allein gewinnen. Ihr oder die andern.“
Der Holländer war schon wieder in Berlin, als dort die Nachricht eintraf, daß der Leutnant Oswald Boelcke mit dem eingebauten Maschinengewehr ein feindliches Flugzeug abgeschossen hatte. Wenige Tage später startete ein anderer Pilot mit der Fokker und schoß gleich zwei Maschinen ab. Sein Name: Max Immelmann. Beide, Immelmann und Boelcke, waren erst auf dem Weg zu ihrem späteren Ruhm.
Und Fokker baute. Am Anfang gab es noch kleine Fehler an der MG-Steuerung, aber sie waren bald behoben, und jede Frontstaffel verlangte jetzt die Maschine mit dem synchronisierten Maschinengewehr. Fast über Nacht beherrschten deutsche Flieger die Luft über den Frontlinien. Ein fünfundzwanzigjähriger Holländer schien den Deutschen den Krieg zu gewinnen …
Aber schon fünf Wochen, nachdem der Leutnant Boelcke mit der neuen Waffe das erste feindliche Flugzeug abgeschossen hatte, fiel das Geheimnis dem Feind in die Hände. Allen deutschen Piloten, die Fokkers Maschine flogen, war es verboten worden, feindliches Gebiet zu überfliegen. Aber im Nebel hatte sich ein Pilot verflogen, und bevor er seine Maschine in Brand setzen konnte, wurde er gefangengenommen. Die Geschichte wiederholte sich. Nur daß diesmal ein französischer Pilot die erbeutete deutsche Maschine nach Paris überführte. Wochen arbeiteten die Franzosen fieberhaft. Dann hatte auch der Feind seine Waffe bereit. Der Krieg in der Luft wurde wieder zu einem Duell mit gleichen Waffen. Aber das Spiel war tödlich geworden. Das alles geschah im Jahre 1915.
Seit dem 29. November 1915 war Ernst Udet Unteroffizier der Feldfliegerabteilung 68 in Habsheim bei Mülhausen im Elsaß. Ihr Flugfeld lag zwei Kilometer von der Villa entfernt, in der sie wohnten. Udet und seine drei Kameraden bewohnten das Parterre und den ersten Stock der Villa eines bei Kriegsbeginn geflüchteten Amerikaners. Sie lebten wie die Götter in Frankreich. Wenn die Piloten morgens mit dem Auto zum Flugfeld fuhren, waren sie frisch und ausgeruht. Sie hatten gut gefrühstückt und ihr Bad genommen. Wenn sie von ihrem Einsatz zurückkehrten, kümmerten sich die Mechaniker um ihre Maschinen. Sie brauchten nur in ihr fürstliches Quartier zurückzukehren, zu ihren Hunden, Grammophonplatten und Büchern. Am Sonntag sausten sie im Auto nach Mülhausen zum Konzert im Zoo. Und vor der Heimfahrt besuchten sie schnell noch den „Intendanten“, der die gute Seife, die Lindt-Schokolade, die Gänseleber und den requirierten Alkohol verwaltete.
Ein- oder zweimal am Tage starteten die vier deutschen Piloten. Sie flogen mit ihren Maschinen Sperre über den deutschen Stellungen in den Vogesen. Aber der frostige Dezemberhimmel war wie leergefegt vom Feind.
Es war ein Tag vor Weihnachten, als das Feldtelefon in der Baracke der Monteure auf dem Flugfeld Habsheim schnarrte. Am Nachmittag, kurz nach 3 Uhr.
Die anderen Piloten waren nach Mülhausen gefahren. Ernst Udet saß mit dem Meteorologen in dessen Baracke, als einer der Monteure die Tür aufstieß. „Ein Caudron“, schrie er atemlos, „er hat die deutschen Linien überflogen.“
Eine Viertelstunde später kletterte der Unteroffizier Udet in seine Maschine, eingemummt in seine dicke Pelzweste. Der Monteur hatte ihm das Gesicht gegen die schneidende Kälte mit Butter eingerieben. Udet zog die wollene Fliegerhaube über den Kopf, rückte die Fliegerbrille vor die Augen, ließ den Propeller durchdrehen und startete den Motor. Dann glitt die eisig glitzernde Wiese unter den Rädern hinweg. Udet flog in zweitausend Meter Höhe, als er den Caudron erblickte.
Die Maschine schien ihre Aufnahmen gemacht zu haben; sie zog in einer weiten Kehre nach Westen. Die deutsche Maschine schnitt ihr den Weg ab. Uber den verschneiten Wäldern der Vogesen flogen sie dann aufeinander zu. Dem jungen deutschen Piloten schien es eine Ewigkeit zu dauern, bis sie sich näher kamen. Er starrte über das Maschinengewehr hinweg auf die Kanzel des Caudron. Wie ein dicker, schwerer Insektenleib hing sie zwischen den Schwingen.
Die Kanzel war sein Ziel. Er brauchte nur mit der Schnauze darauf zu stoßen – und zu schießen. Es war nur eine leichte Bewegung der Hand. Die Finger mußten die paar Zentimeter hinübergreifen auf den Knopf des Maschinengewehrs in der Mitte des Steuerknüppels.
Du mußt schießen, dachte er. Aber die Hände verweigerten den Befehl. Wie abgestorben lagen sie auf den Griffen. Er war jetzt so nahe am Gegner, daß er die Fliegerhaube und die Brille des Beobachters sah. Als der andere schoß, kam Leben in Udets Hände; hastig drückten sie den Knüppel hinunter. Der schwere Rumpf der feindlichen Maschine jagte so dicht über ihn hinweg, daß er glaubte, er hätte sie gestreift. Aber es waren wohl nur die harten Böen des Propellerwindes, die seine Maschine wie mit Fäusten schüttelten.
Jetzt erst spürte Udet den leichten Schmerz am Auge. Er zog mit den Zähnen einen Handschuh von den Fingern, tastete nach der Brille. Ein Schuß hatte den Bügel gestreift, das linke Glas war zersplittert, kleine Splitter waren in das Fleisch gedrungen. Heiß schlug sein Atem gegen die Wolle der Haube, die sein Gesicht halb bedeckte. Eine Sekunde schloß er die Augen.
Ein Flieger, der bei seinem ersten Kampf die Nerven verliert, lebt selten lange. Hatten sie das nicht alle erzählt? – Wie benommen flog er weiter. Der Caudron war längst in der Dämmerung verschwunden.
Du brauchst gar nicht mehr zu landen, dachte der junge deutsche Pilot.
Auf die weiten schneebedeckten Wälder senkten sich breite dunkle Schatten. Im Rückspiegel der deutschen Maschine fing sich ein letzter fahler Flecken Licht aus dem Westen. Dann war plötzlich die Dunkelheit da. Udet tauchte in sie hinein.
Er fand den Platz nur, weil die Monteure Pechfackeln angezündet hatten. Sechs Fackeln, drei auf jeder Seite. Er setzte die Maschine zwischen den rötlich flackernden Feuern auf. Er wartete, bis die Männer mit den Fackeln in der Hand über das Feld gelaufen kamen. Er fürchtete sich vor dem Augenblick; er würde ihnen nicht ins Gesicht sehen können.
Aber die Monteure strahlten, als sie ihm aus dem Sitz halfen. Sie stürmten in die Baracke, in der der Sanitäter sein Auge verband. Plötzlich waren auch zwei der Piloten da. Einer drückte Udet ein Glas in die Hand. Ihre lauten Stimmen hallten Udet in den Ohren. „Gratuliere!“ sagte einer.
„Was ist denn?“ fragte Udet verständnislos. Er sah den Meteorologen unter der Tür stehen; aber plötzlich war er wieder verschwunden.
„Na, nun tu mal nicht so bescheiden“, sagte einer der Kameraden „Sie werden dir den Abschuß schon anerkennen, auch wenn die Maschine drüben heruntergefallen ist …“ Wieder hoben sie die Gläser.
Ein Infanterieposten hatte in der Villa angerufen, daß der Caudron, nachdem ein deutscher Flieger ihn attackiert hatte, abgetrudelt und dann jenseits der französischen Linie aufgeschlagen sei.
Udet konnte ihnen nicht ins Gesicht sehen, als er trank. Plötzlich hielt er es nicht mehr aus. Er stürmte aus der Baracke. – Schlafen, dachte er, als er zur Villa zurückfuhr.
Er hatte eine halbe Stunde in seinem Zimmer am Fenster gestanden, als es klopfte. Draußen schneite es jetzt.
Als Udet sich vom Fenster abwandte, starrte er in das Gesicht Glinkermanns. Der Flieger murmelte eine Entschuldigung. Er zeigte auf den Stuhl. Udet nickte. Glinkermann setzte sich. Stumm saß er da.
Glinkermann war immer schweigsam. Aber man verstand sich mit ihm auch ohne Worte. Plötzlich war Udet sicher, daß der andere ahnte, was geschehen war.
„Es war ein Caudron“, sagte Udet hastig, „aber ich bin vor ihm ausgerückt. Jetzt weißt du es! Kein Grund zum Feiern. Ich kann ihn vielleicht gestreift haben, als ich unter ihm durchflog.“
Glinkermann war aufgestanden und neben Udet ans Fenster getreten. Er schob die Vorhänge etwas zur Seite.
„Der Schnee wird nicht liegenbleiben“, sagte er.
Udet griff nach dem Arm des Fliegers. „Es war nicht einmal die Angst“, sagte er, „es war einfach, daß niemand da war, der mir den Befehl gab, zu schießen … Du bist allein, dachte ich … Vielleicht war es doch nur Angst.“
„Du wirst sehen“, sagte Glinkermann nur, „der Schnee wird nicht liegenbleiben.“ Dann verließ er ohne ein weiteres Wort das Zimmer. Udet war plötzlich froh, daß er nichts anderes gesagt hatte. Es war wie ein Versprechen, daß die Worte, die gesprochen worden waren, ihr Geheimnis bleiben würden.
Sooft Udet in den nächsten Wochen flog, sah er in Gedanken die strahlenden Gesichter, die erhobenen Gläser … Er flog seit jenem Tag mit einer Verbissenheit, die selbst die anderen Piloten beunruhigte. Fast zwei Monate sahen sie in ihrem Abschnitt keinen Gegner. Dann kam der 18. März, ein Sonntag. Zwei Piloten waren in Urlaub, und als am späten Nachmittag die Nachricht von den anfliegenden Maschinen kam, starteten nur der Vizefeldwebel Udet und der Unteroffizier Glinkermann.
Sie flogen in zweitausend Meter Höhe. Sie blieben ganz nah beieinander. Durch ein Handzeichen konnten sie sich verständigen.
Udet sah sie zuerst. Noch waren sie nicht zu zählen. Sie zeichneten sich auf der blauen Zeltplane des Himmels wie ein paar schwarze Ölspritzer ab. Auch Glinkermann mußte sie gesehen haben. Er begann schnell höher zu steigen.
Udet folgte ihm nur zögernd. Er wollte allein sein – wie damals. Er beugte sich über die Seitenwand hinaus und blickte nach unten. Er riß sich vor Erstaunen die Brille von den Augen. Er zählte die Maschinen dreimal, bis er sicher war. Es waren zweiundzwanzig. Sie flogen ganz dicht, in vier Wellen hintereinander gestaffelt. Es waren Bomber, Caudrons und Farmans.
Von oben sahen sie aus wie schwere, grob zugehauene Kreuze. Es war ein unheimliches Bild. Es schien, als bewegten sich die zweiundzwanzig Maschinen wie ein einziges Riesenflugzeug langsam nach Osten. Sie hielten ihren Kurs unbeirrt.
Es war der erste geschlossene Bombenangriff auf deutsches Gebiet. Mülhausen-Riedisheim im Elsaß war das Ziel.
Udet hatte nur eine Sekunde gezögert. Er spürte auch jetzt die Angst, wie damals in den Vogesen, nur härter und brennender. Es war wie ein Feuer. Ein Feuer, durch das er hindurch mußte. Es hatte nichts mit den Männern in den anderen Maschinen zu tun. Er wußte nicht, weshalb. Er war nur sicher, daß es ihm nicht erspart blieb.
Sein Gesicht war starr, als er nach unten tauchte. Es glättete sich erst, als das Hämmern eines Maschinengewehres an sein Ohr schlug, die Stichflamme vor seinen Augen aufschoß.
Am Vormittag des 19. März 1916 tippte ein Gefreiter den Tagesbefehl der Armee-Abteilung Gaede. Eine Stunde später gingen die hektographierten Seiten an die Feldeinheiten.
Zum erstenmal nannte ein Tagesbefehl den Namen Ernst Udet.
Deutsche Piloten hatten den Pulk der feindlichen Maschinen zersprengt, ehe er großen Schaden anrichten konnte. Der Vizefeldwebel Ernst Udet hatte an diesem Tag seinen ersten Gegner abgeschossen.
Deutsche, Russen, Franzosen und Engländer – alle waren im Jahre 1914 im Glauben an ihre gute Sache in den Krieg gezogen. Nun dauerte die gute Sache schon fast zwei Jahre. Der Glaube an einen schnellen Sieg war längst dem bedrückenden Gefühl gewichen, daß dieser Krieg sein wahres Gesicht noch nicht gezeigt hatte.
Seit dem Juni 1916 waren in der Heimat Brot- und Fleischmarken eingeführt worden. Grieß, Graupen und Teigwaren waren von den Ladentischen ganz verschwunden. Butter gab es nur fünfundzwanzig Gramm in der Woche – wenn man sie bekam. Die Menschen tranken Tee von Brombeerblättern, Kaffee von Kohlrüben. Sie trugen Kleider, die aus Ginster, Hopfen oder Papier gemacht waren. Die Jagd auf Automobilreifen, jedes Stückchen Gummi und Metall begann. Aus den Küchen verschwand das kupferne Geschirr. Türklinken, Firmenschilder aus Messing, die Beschläge der Eisenbahnen wurden eingeschmolzen. Und die Kirchen hatten bald nur noch ihre kleinen Glocken, um Sieg und Trauer über das Land zu leuten.
Mit Furcht sah das Volk dem dritten Kriegswinter entgegen.
Seinen 21. Geburtstag feierte der Leutnant Ernst Udet im Schloß Boncourt in Nordfrankreich. Seit dem März 1917 lagen sie an dieser Front. Ihnen gegenüber flog die Elite der französischen Fliegerei. Die deutschen Piloten der Jagdstaffel 15 flogen den neuen Albatros mit zwei synchronisierten Maschinengewehren in der Kanzel. Ihr Staffelführer war Oberleutnant Gontermann. Zum erstenmal hatten die jungen Flieger einen wirklichen Lehrer. Noch nie hatte Udet einen Flieger so nah an den Gegner herangehen sehen. Im Mai hatte die Staffel ihren großen Tag. Gontermann bekam den Pour le mérite. Bis spät in die Nacht hinein feierten sie in den Prunkgemächern des alten französischen Schlosses. Am anderen Tag fuhr Oberleutnant Gontermann in Urlaub. Als er nach vier Wochen zurückkam, lebte von seiner ganzen Staffel nur noch der Leutnant Ernst Udet.
Gontermann wartete auf dem Flugfeld, als Udet mit seiner Albatros in den Platz einschwebte. Der glatte, haifischähnliche Rumpf war von Einschüssen durchsiebt.
Gontermann starrte in das abgespannte Gesicht mit den tiefen Falten um den Mund und zwischen den Augenbrauen. Udet versuchte zu lächeln, als er aus dem Sitz kletterte. Er griff hastig nach der angebrannten Zigarette, die Gontermann ihm hinhielt. Udets Hände zitterten, als er die Zigarette zu den Lippen hob.
„Schon gut“, sagte Gontermann. „Sie brauchen mir nichts mehr zu sagen, Udet, ich habe es drüben schon von den Monteuren erfahren.“ Die Grasnarbe des Platzes war grau vom Staub der brennenden Sonne. Langsam schritten die beiden Männer zu dem Auto hinüber. Sie wollten schon abfahren, als einer der Monteure über das Feld gelaufen kam. Er hielt eine kleine gerahmte Fotografie mit dem Bild eines zehnjährigen Mädchens in der Hand.
Udet starrte auf den zerschossenen Rahmen. Auf jeden Flug nahm er das Bild seiner kleinen Schwester mit. Es hing hinter seinem Rücken im Sitz der Maschine.
„Einundzwanzig Treffer habe ich gezählt“, sagte der Monteur. In seiner Stimme klang Stolz.
Eine Viertelstunde später schritten die beiden Offiziere durch den Park des Schlosses. Die Kieswege waren geharkt und an den Seiten scharf abgestochen. In einer Laube standen weißgestrichene Gartenstühle.
„Es begann gleich, nachdem Sie weg waren“, sagte Udet. „Der erste war Puz – wir flogen Sperre. Es war ein ruhiger Tag, kein Gegner zu sehen. Puz flog rechts von mir, mehr als zwanzig Meter waren es nicht. Dann passierte es … Der Franzose kam von oben, aus der Sonne heraus … Als wir in der Nacht darauf Puz’ Leiche bargen, fanden wir keine Schußverletzungen … Er war in seiner Maschine verbrannt. – Ich konnte es seinen Eltern nicht schreiben. Ich weiß nicht, wie viele Briefe ich in jener Nacht geschrieben habe.
Dann wurde Müller abgeschossen. Über Mortiers. Ich bin hinübergefahren. Sie hatten ihn in einer Scheune aufgebahrt. Als ich zum Flugfeld zurückkam, waren die anderen schon wieder gestartet. Auch Glinkermann. Seinen Stock hatte er in die Erde gerammt, die Mütze darübergestülpt – er nahm sie immer wieder auf, wenn er landete … Wir hörten bis spät in die Nacht nichts mehr von Glinkermann. Sein Schäferhund war bei mir im Zimmer, als ich auf Nachricht wartete … Gegen vier Uhr rief ein Infanterieposten an … Sie hatten Glinkermann gefunden … Er war tot …“