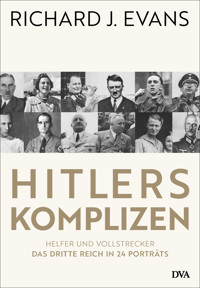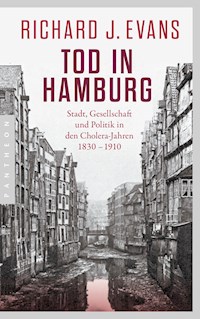19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das große Panorama des 19. Jahrhunderts
»Das europäische Jahrhundert« entwirft ein außergewöhnlich facettenreiches, überraschendes und unterhaltsames Panorama des 19. Jahrhunderts in Europa. Der Kontinent durchlief zwischen 1815 und 1914 eine drastische Transformation mit grundstürzenden Veränderungen in Kultur, Politik und Technik. Was in einer Dekade als modern empfunden wurde, war in der nächsten bereits veraltet. Großstädte schossen innerhalb einer Generation aus dem Boden, und neue europäische Länder gründeten sich. In der Zeit zwischen der Schlacht von Waterloo und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs beherrschte Europa den Rest der Welt wie niemals zuvor oder je wieder danach.
Richard J. Evans taucht tief ein in die Revolutionen und Kriege des 19. Jahrhunderts, schreibt aber auch über gesellschaftliche Verwerfungen, über Religion und Philosophie. »Das europäische Jahrhundert« ist ein in jeder Hinsicht epochales Werk und erklärt uns auf einzigartige Weise das vergangene und das heutige Europa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1674
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über das Buch:
»Das europäische Jahrhundert« entwirft ein außergewöhnlich facettenreiches, überraschendes und unterhaltsames Panorama des 19. Jahrhunderts in Europa. Der Kontinent durchlief zwischen 1815 und 1914 eine drastische Transformation mit grundstürzenden Veränderungen in Kultur, Politik und Technik. Was in einer Dekade als modern empfunden wurde, war in der nächsten bereits veraltet. Großstädte schossen innerhalb einer Generation aus dem Boden, und neue europäische Länder gründeten sich.
In der Zeit zwischen der Schlacht von Waterloo und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs beherrschte Europa den Rest der Welt wie niemals zuvor oder je wieder danach.
Richard J. Evans taucht tief ein in die Revolutionen und Kriege des 19. Jahrhunderts, schreibt aber auch über gesellschaftliche Verwerfungen, über Religion und Philosophie. »Das europäische Jahrhundert« ist ein in jeder Hinsicht epochales Werk und erklärt uns auf einzigartige Weise das vergangene und das heutige Europa.
Über den Autor:
Richard J. Evans, geboren 1947, war von 1998 bis 2017 Professor für Neuere Geschichte an der Cambridge University, 2008 wurde er zum Regius Professor ernannt. Er ist mit bahnbrechenden Publikationen zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und zum Nationalsozialismus hervorgetreten. Zwischen 2003 und 2008 veröffentlichte Evans eine dreibändige Geschichte des »Dritten Reiches«, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde und bei der DVA auf Deutsch erschienen ist. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Wolfson Literary Award for History und die Medaille für Kunst und Wissenschaft der Hansestadt Hamburg. 2012 wurde Evans von Queen Elizabeth II. zum Ritter ernannt. Zuletzt ist von ihm erschienen »Veränderte Vergangenheiten. Über kontrafaktisches Erzählen in der Geschichte« (DVA, 2014).
Richard J. Evans
Das
europäische
Jahrhundert
Ein Kontinent im Umbruch1815 – 1914
Aus dem Englischen von Richard Barth
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe ist 2016 unter dem Titel The Pursuit of Power. Europe 1815 – 1914 bei Allen Lane, Penguin Random House UK erschienen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © Richard J. Evans, 2016
Copyright © 2018 Deutsche Verlags-Anstalt, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: © akg-images, Bild-Nr. AKG71404 Revolution 1848/49: Straßenkämpfe in Berlin am 18. / 19. März 1848
Karten: Andras Bereznay
Lektorat: Jonas Wegerer
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Gesetzt aus der Berling Nova Text Pro
ISBN 978-3-641-18871-9V004
www.dva.de
In memoriam
Eric Hobsbawm
(1917 – 2012)
Vorwort
Dieses Buch ist eine Geschichte Europas von 1815 bis 1914 und schließt in der Reihe »Penguin History of Europe« an den Band The Pursuit of Glory (»Das Streben nach Ruhm«) an, der die Zeit zwischen 1648 und 1815 behandelt. Wie der Autor dieses Buches, mein Kollege hier in Cambridge Tim Blanning, richtig anmerkt, setzt jede Darstellung eines Abschnitts der europäischen Geschichte zwangsläufig mit einem willkürlich gewählten Zeitpunkt ein, aber manche sind willkürlicher als andere. Wir sprechen gewohnheitsmäßig vom »19. Jahrhundert« oder vom »20. Jahrhundert«, doch jedem Historiker ist klar, dass der Zeitabschnitt von 1801 bis 1900 oder von 1901 bis 2000 jenseits der rein chronologischen keine historische Bedeutung hat. Die Geschichte ist voller unabgeschlossener Entwicklungen, und selbst bei Ausbruch oder am Ende großer Kriege, die so häufig als Endpunkt geschichtlicher Werke über einen bestimmten Abschnitt der europäischen Vergangenheit herangezogen werden (so auch hier), bleiben viele Fragen offen. Die verschiedenen Aspekte der Geschichte folgen ihrer je eigenen Chronologie, so dass eine Jahreszahl, die in der Politik-, Militär- oder Diplomatiegeschichte bedeutsam ist, in der Sozial-, Wirtschafts- oder Kulturgeschichte möglicherweise kaum eine Rolle spielt. Französische Historiker der Annales-Schule haben sich angewöhnt, von einer »unbeweglichen Geschichte« (histoire immobile) zu sprechen, die in vielen Teilen Europas bis weit in die Neuzeit hinein fortgedauert hat: Obwohl das Ancien Régime politisch betrachtet Ende des 18. Jahrhunderts am Ende war, hatte das wirtschaftliche und gesellschaftliche Ancien Régime bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein Bestand. Bis dahin dauerte es beispielsweise, ehe die Leibeigenschaft fast überall in Europa von der Bildfläche verschwunden war. Und das demographische Muster von hohen Geburtenraten und Sterbeziffern begann, sich (abgesehen von Frankreich) erst während des sogenannten »demographischen Übergangs« der Jahrzehnte nach 1850 zu wandeln. Umgekehrt blieb die Industrialisierung bis in jene Zeit hinein ein auf kleine Bereiche der europäischen Wirtschaft beschränktes Randphänomen. Ja, einige Historiker – insbesondere Arno Mayer in seinem Buch Adelsmacht und Bürgertum. Die Krise der europäischen Gesellschaft, 1848 – 1914 (1981) – haben argumentiert, die traditionelle Adelselite habe ihre vorherrschende Stellung bis hin zum Ersten Weltkrieg verteidigt, so dass sich trotz aller oberflächlichen Turbulenzen auch auf politischer Ebene wenig geändert habe. Doch Mayers Sichtweise hat sich unter Historikern nicht durchgesetzt: Im Europa des 19. Jahrhunderts gab es sehr wohl Wandel, nicht nur politisch, sondern auch in anderen Lebensbereichen.
Mancher kam sogar zum Schluss, der ergiebigste Betrachtungszeitraum sei das »Zeitalter der Revolutionen«, wie Eric Hobsbawm den ersten Band seiner Geschichte der Jahre 1789 bis 1914 betitelte (The Age of Revolution, 1962). Übernommen wurde die Periodisierung Hobsbawms von Jonathan Sperber, der in seinem Buch Revolutionary Europe (2000) dieselbe Zeitspanne wählte wie Hobsbawm für seinen ersten Band: 1789 bis 1848. Doch die Entscheidung für diesen Zeitabschnitt hat ihren Preis, denn was folgte, war ein ganz anderes Europa, das sich sehr viel schwieriger mit einem einzigen Interpretationsrahmen fassen lässt. Es ist kein Zufall, dass Sperbers Folgeband Europe 1850 – 1914 (2008) einen langen Untertitel hat, der (zweifellos unbewusst) von den Schwierigkeiten des Autors zeugt, ein verbindendes Thema zu finden: Progress, Participation and Apprehension (»Fortschritt, Partizipation und dunkle Vorahnungen«). Hobsbawm schrieb zwei weitere Bände, The Age of Capital (1975; dt. Die Blütezeit des Kapitals), der die Jahre 1848 bis 1875 abdeckt, sowie The Age of Empire (1987; dt. Das imperiale Zeitalter), der die Geschichte bis zum Ersten Weltkrieg nachzeichnet. Wer sich vornimmt, eine Geschichte Europas im 19. Jahrhundert zu verfassen, kommt an diesen drei bahnbrechenden Büchern, die alles andere überragen, was über diese Epoche geschrieben worden ist, nicht vorbei. Und mit seiner verblüffenden Gabe, innovative Begriffe zu prägen, bezeichnete Hobsbawm die gesamte Epoche, die seine Trilogie behandelt, als das »lange 19. Jahrhundert« – ein Vorbild, dem viele Lehrbücher und Einführungen gefolgt sind, etwa William Simpson und Martin Jones in Europe 1783 – 1914 (2000). Allerdings ist das lange 19. Jahrhundert eine janusköpfige Epoche, wird sie doch von den Revolutionen von 1848 in zwei sehr ungleiche Hälften geteilt. Da nimmt es nicht wunder, dass viele Historiker, die über die Zeitspanne von der Französischen Revolution oder dem Sturz Napoleons bis zum Ersten Weltkrieg geschrieben haben, gar nicht erst den Versuch machten, ein übergreifendes Thema zu finden, und sich stattdessen, um das Beispiel von R. S. Alexanders politischer Geschichte zu nehmen, für nichtssagende Titel wie Europe’s Uncertain Path (2012) entschieden.
Über weite Strecken des 20. Jahrhunderts erachteten Historiker den Aufstieg der Nationalstaaten und die Konflikte zwischen ihnen als die zentralen Merkmale der europäischen Geschichte des 19. Jahrhunderts. Der Triumph des Nationalismus ließ neue politische und kulturelle Gebilde entstehen und entfachte Revolten gegen große, als unzeitgemäß erscheinende Vielvölkerreiche, Aufstände gegen die Unterdrückung durch andere Nationen oder den Ehrgeiz, andere Nationen zu beherrschen. Dieses Modell des Nationalstaats wurde im 20. Jahrhundert in die ganze Welt exportiert, was seine Entstehung im Europa des 19. Jahrhunderts um so wichtiger erscheinen ließ. Einst sahen Historiker diesen Prozess in einem positiven Licht und feierten in ihren Darstellungen die Einigung Italiens und Deutschlands, die Entstehung eines tschechischen und polnischen Nationalgefühls und andere Ergebnisse, die das Zeitalter des Nationalismus zeitigte. Als sich nationale und ethnische Rivalitäten allerdings im gigantischen Flächenbrand des Zweiten Weltkriegs entluden, erschien der Aufstieg des Nationalismus in einem weit düstereren Licht – eine Sichtweise, die von den Balkankriegen der 1990er Jahre verfestigt wurde. Seither jedoch leben wir in einem Zeitalter der fortschreitenden Globalisierung: Seit die Barrieren aus der Zeit des Kalten Kriegs gefallen sind, haben internationale Institutionen, weltumspannende Kommunikationsnetze, multinationale Firmen und viele weitere Einflüsse dafür gesorgt, dass nationale Grenzen zusehends durchlässig geworden und wir alle zu einer Weltgemeinschaft vereint worden sind. Seit der Jahrhundertwende hat das auch unseren Blick auf die Vergangenheit verändert, unter Historikern setzt sich zunehmend eine globale Perspektive durch. Der Ruf nach einer Weltgeschichtsschreibung an sich ist nichts Neues: Er wurde bereits in den 1970er Jahren laut, namentlich seitens des französischen Historikers Marc Ferro, und war schon in der Idee einer »Universalgeschichte« inbegriffen, wie sie im 19. Jahrhundert Leopold von Ranke und im 20. Jahrhundert Arnold Toynbee und William H. McNeill betrieben. Eine Globalgeschichte jedoch, die die verschiedenen Teile der Welt zueinander in Beziehung setzt, anstatt nur ihre je eigene Geschichte zu erzählen, ist erst in jüngerer Zeit entstanden, als Historiker sich Fragestellungen wie den Auswirkungen des Imperialismus auf die Volkswirtschaften, Gesellschaften, Kulturen und politischen Systeme Europas (vor allem, aber nicht nur, auf Großbritannien) zugewandt haben, dem interaktiven Geflecht globaler Wirtschaftsbeziehungen, das Europa mit anderen Erdteilen verband, sowie der Entstehung von Weltreichen als europaweitem Prozess, und nicht als spezifischem Phänomen in einzelnen europäischen Ländern. Zugleich haben Historiker eifrig die Geschichte einzelner Nationen im globalen Kontext neu geschrieben und dabei die Auswirkungen der europäischen Diaspora – der Millionen Europäer, die auf andere Kontinente emigriert sind – auf das »Mutterland« ebenso herausgearbeitet wie die Anreicherung des europäischen Nationalismus mit Elementen der Rassentheorie, die mit der Erfahrung der Kolonisation Afrikas oder Asiens einherging, und die Entwicklung einer globalen Geopolitik zu einem Schlüsselfaktor in den Beziehungen europäischer Staaten untereinander.
In besonderem Maße beeinflusst ist mein Ansatz in diesem Buch von dem deutschen Historiker Jürgen Osterhammel, der in seinem Werk Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts (2009) im Gegensatz zum Eurozentrismus von Hobsbawms Trilogie einen wahrhaft weltgeschichtlichen Ansatz verfolgt. Die einzelnen Kapitel befassen sich mit einer erstaunlichen Vielfalt von Themen wie »Gedächtnis und Selbstbeobachtung«, Zeit, Raum, Mobilität, Lebensstandards, Städte, »Frontiers«, Macht, Revolutionen, Staat, Energie, Arbeit, »Netze«, Hierarchien, Wissen, »Zivilisierung«, Religion und vielem mehr. Osterhammel befasst sich gezielt mit übergreifenden Themen, Verbindungen zwischen unterschiedlichen Erdteilen, parallelen Entwicklungen und globalen Prozessen. Allerdings geht die argumentative, reflektierende Präsenz des Autors über den Horizont der Menschen, über die er schreibt, in der Regel deutlich hinaus. Auch verbringen historische Überblicksdarstellungen häufig zu viel Zeit damit, die allgemeinen Interpretationslinien darzulegen, anstatt zu versuchen, sie aus dem Leben und den Erfahrungen von Zeitgenossen herauszupräparieren. In einem knappen Lehrbuch, dessen Hauptzweck darin besteht, Studenten auf Prüfungen vorzubereiten, mag das nachvollziehbar sein. Doch in einem umfassenderen Werk wie dem vorliegenden, das sich in erster Linie an eine breite Leserschaft richtet, ist glücklicherweise Platz, um auf Details einzugehen, die einen Eindruck von der Atmosphäre jener Zeit in ihrer Fremdheit und gleichzeitigen Vertrautheit vermitteln, und wann immer möglich die Zeitgenossen selbst zu Wort kommen zu lassen.
Andere, nicht weniger ambitionierte globalhistorische Werke, die etwa zur selben Zeit entstanden sind wie das von Osterhammel, haben sich dem 19. Jahrhundert mit einem anderen Ansatz genähert, der auf der Erkenntnis beruhte, dass es sich hier um eine Epoche handelt, in der Europa eine globale Führungsrolle übernahm und andere Teile der Welt beherrschte wie in keiner anderen. Historiker wie der jüngst verstorbene Chris Bayly in seinem beeindruckenden Buch The Birth of the Modern World (2004; dt. Die Geburt der modernen Welt) und John Darwin in seiner meisterhaften Untersuchung weltumspannender Reiche, After Tamerlane (2007; dt: Der imperiale Traum) haben mit einer Fülle vergleichender Analysen aufgezeigt, dass Anfang des 18. Jahrhunderts eine ganze Reihe von Kulturen überall auf dem Globus in nahezu jeder Hinsicht, vom Lebensstandard bis hin zu kulturellen Errungenschaften, gleichauf waren. Das Mogulreich in Indien, das Qing-Imperium in China, die großen vorkolonialen Reiche wie das Königreich Dahomey und seine Nachbarn in Afrika, das Osmanische Reich und andere Staaten waren Europa um 1700 im Wesentlichen ebenbürtig.
1815 war das nicht mehr der Fall. Europa hatte sich vom Rest der Welt abgesetzt – nicht wie manche Historiker, insbesondere Niall Ferguson in seinem weit ausholenden Buch Civilization (2011; dt. Der Westen und der Rest der Welt), behauptet haben, wegen seiner intrinsischen Überlegenheit, sondern wegen ganz konkreter historischer Umstände. Europa konnte seinen Vorsprung bis in die Anfangsjahre des 20. Jahrhunderts hinein aufrechterhalten und ausbauen, doch dann holten die Verfolger zusehends auf. Im Ersten Weltkrieg geriet die Vormachtstellung Europas ins Wanken; nach dem Zweiten Weltkrieg war sie endgültig dahin und mit ihr die weltumspannenden europäischen Kolonialreiche. Diese Phase der globalen Hegemonie ist die entscheidende Rechtfertigung dafür, die Jahre von 1815 bis 1914 als eigenständigen, bedeutsamen Abschnitt der europäischen Geschichte anzusehen. Im Lauf des Buches werden immer wieder der globale Kontext betont und Ereignisse und Prozesse auf anderen Kontinenten in die Darstellung eingeflochten, um besser erklären zu können, was sich in Europa in jenen Jahrzehnten ereignete.
Globale Geschichte heißt zugleich transnationale Geschichte. Viele Geschichten Europas bestehen aus im Wesentlichen unverbundenen Darstellungen der einzelnen Nationalgeschichten. In diese Kategorie fällt Europe in the Nineteenth Century (1927) von Arthur Grant und Harold Temperley, wie auch William Simpson und Martin Jones’ Europe 1783 – 1914 (2000), das getrennte Kapitel über Frankreich, Deutschland, Italien, Russland und das Habsburgerreich enthält. Die Geschichte Europas (2000) des deutschen Historikers Michael Salewski trägt den Untertitel Staaten und Nationen von der Antike bis zur Gegenwart und ist eine Abfolge von Geschichten einzelner Länder und ihrer Beziehungen zueinander. Dadurch verliert der Leser weitgehend aus den Augen, was (und ob überhaupt etwas) Europa als Ganzes verband, was die verschiedenen Länder gemeinsam hatten oder welche länderübergreifenden Prozesse sie prägten. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die alteingeführte und noch immer unvollständige Oxford History of Modern Europe, in der (mit Ausnahme der vier Bände, die für bestimmte Epochen die zwischenstaatlichen Beziehungen beschreiben) jeder Band einem einzelnen Land gewidmet ist. Und doch war Europa, wie ich in diesem Buch aufzuzeigen hoffe, nicht nur eine Ansammlung von sich weiterentwickelnden Einzelstaaten, es hatte auch als Ganzes ein unverkennbares Gesicht. Und zwar nicht als geographische Einheit; zumal die Ostgrenzen Europas unklar und schwer zu definieren waren und die gesellschaftlichen und kulturellen Grenzen im Zuge der Massenauswanderung in andere Erdteile mehr und mehr verwischt wurden. Dies vorausgeschickt lässt sich Europa am besten als eine Region beschreiben, die gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch und kulturell zahlreiche gemeinsame Merkmale aufweist und sich von Großbritannien und Irland im Westen bis nach Russland und zum Balkan im Osten erstreckt.
Indem ich einen möglichst transnationalen Ansatz wähle, trete ich ganz bewusst in die Fußstapfen von Lord Acton, der Ende des 19. Jahrhunderts die Cambridge Modern History begründete. In der Planungsphase dieses ehrgeizigen Unterfangens schrieb Acton an die mitwirkenden Autoren:
Universalgeschichte ist etwas anderes als die Summe der Einzelgeschichten, und sie sollte zuallererst, in ihrer unverwechselbaren Essenz, als Zeitalter der Renaissance, der Reformation, der Religionskriege, des Absolutismus, der Revolutionen etc. betrachtet werden. Die einzelnen Länder mögen zur allgemeinen Entwicklung beitragen oder nicht […] aber man sollte die Aufmerksamkeit nicht zu breit streuen, indem man Frankreich und Deutschland Portugal, Siebenbürgen und Island gegenüberstellt […]. Mein Plan besteht darin, die bloße Aneinanderreihung von Nationalgeschichten zu durchbrechen und so weit als möglich alles Länderübergreifende und Universelle einzubeziehen.
Leider starb Acton, bevor er dieses ambitionierte Projekt in die Tat umsetzen konnte, und als die Cambridge Modern History schließlich veröffentlicht wurde, herausgegeben vom effizienteren, aber konventioneller denkenden Sir Adolphus Ward, verfolgte sie im Wesentlichen doch einen Land-für-Land-Ansatz und spiegelte damit die national geprägte Perspektive der jüngeren Generation von Historikern wider, die in einem Europa lebten, dessen politische und kulturelle Atmosphäre sich gewandelt hatte. Erst mit dem Fall des Kommunismus, der Erweiterung der Europäischen Union um weite Teile Osteuropas und dem neuerlichen Fortschreiten der Globalisierung wurde es wieder möglich, wahrhaft europäische Geschichte zu schreiben. Allerdings ist es heute nicht mehr denkbar, diese wie Grant, Temperley und ihre Kollegen andernorts mit der Geschichte der nationalen Politik und der internationalen Beziehungen gleichzusetzen. Spätestens seit den 1970er Jahren hat die historische Forschung ihr Gesichtsfeld nach und nach erweitert, so dass es nun nahezu jeden Aspekt menschlicher Aktivität in der Vergangenheit einschließt. Schon Hobsbawms Age of Revolution aus den frühen 1960ern enthielt Kapitel über Religion, Weltanschauungen, Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft und vieles mehr. Wie man an der Liste der Themen Osterhammels ablesen kann, hat die Geschichtswissenschaft ihren Horizont seither noch weiter ausgedehnt, zuletzt auf die Landschafts- und Umweltgeschichte. Hobsbawm konnte seine Themen mit Hilfe einer überwölbenden Meta-Erzählung verbinden, in deren Fokus die Entwicklung und der prägende Einfluss des Kapitalismus stand. Im frühen 21. Jahrhundert, einer Zeit, in der große Erzählungen in Verruf geraten sind, genießen Historiker dieses Privileg nicht mehr: Das Maximum, was wir tun könnten, so drückt es Tim Blanning aus, sei das Nachzeichnen von »Entwicklungslinien«.
Zwei der wichtigsten Entwicklungslinien, die Blanning für die Jahre 1648 bis 1815 herausarbeitet – »die unaufhaltsam fortschreitende Eroberung der Hegemonie durch den Staat« und »die Entstehung einer neuen Form von kulturellem Raum: der öffentlichen Sphäre« –, zogen sich auch durch das 19. Jahrhundert. Sie entwickelten eine Wirkmächtigkeit und Dominanz, wie sie im 18. Jahrhundert nahezu unvorstellbar waren. Die staatlichen Strukturen, die nach 1815 in der Zeit der Restauration entstanden, wären Europäern, die dreißig Jahre zuvor gelebt haben, in mancherlei Hinsicht noch ziemlich vertraut vorgekommen, auch wenn der Schein vielfach trog. Noch waren die Macht des Staates und seine Einmischung in das Leben der Menschen vergleichsweise begrenzt. Trotz des plastischen Vorbilds der Französischen Revolution beschränkte sich die politische Partizipation des Volkes nach wie vor auf ein Minimum. Noch immer stand die »öffentliche Sphäre« fast ausschließlich der kleinen Schicht der Gebildeten und deren Institutionen offen, von den periodisch erscheinenden Veröffentlichungen bis hin zum Kaffeehaus oder Lesezirkel. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs jedoch hatte sich der Staat gewandelt. Zum einen gab es das allgemeine Männer- und in manchen Teilen Europas sogar Frauenwahlrecht sowie direkte Einflussmöglichkeiten des Volkes auf die nationale, regionale und lokale Politik, nicht zuletzt über organisierte politische Parteien. Auf der anderen Seite war es in Bereichen von der Bildung bis zur Gesundheit, vom Militärdienst bis zur Sozialarbeit zu einem enormen Zuwachs der Kontrollmöglichkeiten des Staates über seine Bürger gekommen.
Die von Blanning skizzierten, miteinander zusammenhängenden Prozesse Wirtschaftswachstum und Ausbau der Kommunikationswege beschleunigten sich im 19. Jahrhundert in einem Maße, das sich im 18. kein Mensch hätte vorstellen können. 1815 tauchten die Eisenbahn, die Telegraphie, das Dampfschiff und die Fotografie schemenhaft am historischen Horizont auf. 1914 schickte Europa sich an, in das Zeitalter der Telefone, Autos, Radios und Kinos einzutreten. 1815 befinden wir uns noch in einer Epoche mit Newton’schem Weltbild, gegenständlicher Kunst und klassischer Musik. 1914 hatte Einstein seine Relativitätstheorie formuliert, Picasso seine kubistischen Werke gemalt und Schönberg seine ersten atonalen Stücke komponiert. Zugleich trat Europa ganz unmittelbar in die Ära der Maschinengewehre, Panzer, U-Boote und Kampfflugzeuge ein. Der erste dokumentierte Luftangriff auf eine feindliche Stellung fand 1911 während der italienischen Invasion in Libyen statt, die ersten europäischen Konzentrationslager wurden in Südafrika von Briten und in Südwestafrika (Namibia) von Deutschen eröffnet. Diese Entwicklungen ließen bereits die ungeheure Gewalt und Zerstörungswut der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erahnen und sind daher eine Mahnung, das 19. Jahrhundert nicht wie die meisten Zeitgenossen als eine Epoche des linearen Fortschritts und der endlosen Verbesserungen zu betrachten. Der Fortschritt hatte seinen Preis, und – wie Ian Kershaw in Höllensturz zeigt, dem nächsten Band dieser Reihe – in der Folgeepoche zwischen 1914 und 1949 musste Europa dies leidvoll erfahren.
Was die Lebensumstände der großen Mehrheit der Europäer anbelangt, endet das Buch Blannings mit einem ziemlich düsteren Ausblick: Die Anfänge der Industrialisierung und das rasante Bevölkerungswachstum brachten »eine neue Form der Armut« mit sich – einer Armut, die »keine plötzliche Heimsuchung durch Hunger, Krieg oder Seuchen« darstellte, »sondern ein permanenter Zustand der Mangelernährung und Unterbeschäftigung« war. Tatsächlich gab es in Europa im 19. Jahrhundert vergleichsweise wenig Hungersnöte, Seuchen und Kriege. Zu erklären, warum das so war, wird eine der Aufgaben dieses Buches sein. Ein maßgeblicher Faktor waren in diesem Zusammenhang (wie bei so vielen Aspekten jener Zeit) die veränderten Beziehungen Europas zum Rest der Welt. Zwar kam es zu Hungersnöten, vor allem in Irland, Skandinavien und Russland, und auch zu Seuchen, namentlich zu periodisch über ganz Europa hinwegfegenden Choleraepidemien, doch waren diese weder so häufig noch so verheerend wie in mancher vorangegangenen Epoche, und Ende des Jahrhunderts gehörten sie in Europa weitgehend der Vergangenheit an.
Das bedeutet allerdings nicht, dass mit ihnen auch die soziale, wirtschaftliche und andere Formen der Ungleichheit verschwunden wären. Ein roter Faden, der sich durch dieses Buch zieht, ist die Beschreibung der Konturen der Ungleichheit, die sich im Lauf des 19. Jahrhunderts veränderten, indem ältere Formen, wie die Leibeigenschaft auf dem Land, von neuen abgelöst wurden, etwa der Lohnarbeit in der Fabrik. Das 19. Jahrhundert lässt sich als das Jahrhundert der Emanzipation schlechthin beschreiben. Millionen Menschen machten auf dem Weg zur Gleichberechtigung Fortschritte, darunter in wichtigen Aspekten die Mehrheit der Landbevölkerung, die Frauen und religiöse Minderheiten (insbesondere die Juden), dieses Buch zeichnet diese gewaltigen Veränderungen und wie sie zustande kamen detailliert nach. Doch wie die Jahre nach 1914 zeigen sollten, waren Gleichberechtigung und Emanzipation stets unvollständig und bedingt, und so gehört es zur Aufgabe des Historikers des 19. Jahrhunderts auch, die Einschränkungen zu beschreiben, die die Menschen während dieses großen Befreiungsprozesses erfuhren.
Diskussionen und Kontroversen über Ungleichheit waren im 19. Jahrhundert ein zentraler Bestandteil der politischen Auseinandersetzung. Aufbauend auf dem Erbe der Französischen Revolution begannen sich immer mehr politische Denker und Akteure, über Mittel und Wege Gedanken zu machen, wie Ungleichheiten aus der Welt zu schaffen seien, und versuchten, diese praktisch umzusetzen. Das Spektrum der Lösungsansätze reichte dabei von aristokratischem Paternalismus im Sinne des »noblesse oblige« bis – am anderen Extrem – zu den Versuchen von Anarchisten, den Staat zu zerstören. Dabei gaben der Sozialismus, der Liberalismus, der Kommunismus, der Nationalismus und viele andere Lehren unterschiedlichen Methoden den Vorzug, wie die Menschen vom Joch der Unterdrückung und Ausbeutung zu befreien seien – je nachdem, wie sie dieses Joch definierten. Diejenigen, für die Stabilität und Hierarchien an erster Stelle standen, erkannten (oder jedenfalls die meisten von ihnen), dass es als Überlebensstrategie nicht ausreichte, sich an die alte Ordnung zu klammern; und so stürzten auch sie sich in die große Debatte über Ungleichheit. Religionsgemeinschaften gaben auf diesseitige Probleme, so sie nicht von vornherein zur Flucht ins Jenseits rieten, eine breite Palette an Antworten. All diesen Denkrichtungen gemeinsam war der Wunsch, Macht zu erlangen und auszuüben, damit sie ihre Ideen in die Tat umsetzen konnten. So wie Tim Blanning seine Geschichte Europas von 1648 bis 1815 mit The Pursuit of Glory (»Das Streben nach Ruhm«) betitelte und damit die Prioritäten der herrschenden politischen Elite jener Ära auf den Punkt brachte, trägt daher die englische Ausgabe dieses Buches den Titel The Pursuit of Power (»Das Streben nach Macht«).
Das Streben nach Macht zog sich im 19. Jahrhundert durch die gesamte Gesellschaft. Staaten griffen nach der Weltmacht, Regierungen trachteten nach imperialer Macht, Armeen arbeiteten an der Macht ihrer militärischen Schlagkraft, Revolutionäre verschworen sich, um die Macht an sich zu reißen, politische Parteien führten Wahlkämpfe, um an die Macht zu kommen, Banker und Industrielle strebten nach wirtschaftlicher Macht, Leibeigene und Teilbauern wurden nach und nach von der willkürlichen Macht des landbesitzenden Adels befreit. Der entscheidende gesellschaftliche Prozess, der das Jahrhundert prägte, war die Emanzipation riesiger gesellschaftlicher Gruppen von Unterdrückten von der Macht ihrer Unterdrücker, und das verbreitetste Beispiel dafür war die Emanzipation der Frauen aus dem Geflecht von Gesetzen, Sitten und Konventionen, in dem sie gefangen waren und das sie der Macht der Männer auslieferte. Und so wie Feministinnen um Gleichheit vor dem Gesetz kämpften, so streikten in der neuen Welt der Industrie Gewerkschaften für mehr Einfluss auf Löhne und Arbeitsbedingungen, in der Kunstwelt stellten Vertreter der Moderne die Macht der Akademien in Frage, und Schriftsteller erkoren Machtkämpfe innerhalb von Familien und anderen gesellschaftlichen Institutionen zu zentralen Themen ihrer Romane.
Die Gesellschaft baute im 19. Jahrhundert ihre Verfügungsgewalt über die Natur aus: Staaten erlangten die Macht, die Auswirkungen von Hunger und Naturkatastrophen wie Bränden und Fluten abzumildern. Medizinforscher strebten im Labor nach der Macht, Krankheiten zu heilen. Um die Macht der Menschheit über die Natur zu vergrößern, kanalisierten Ingenieure und Planer Flüsse, legten Sümpfe trocken, vertrieben Wildtiere und rodeten Wälder; sie bauten Städte und Metropolen, Eisenbahnen und Kanalsysteme, Schiffe und Brücken. Darüber hinaus entwickelten und erschlossen Wissenschaftler und Techniker neue Quellen von Macht, vom Wasserdampf bis zum elektrischen Strom, vom mechanischen Webstuhl bis zum Verbrennungsmotor. Diese Macht konnte formeller oder informeller Natur sein, auf Übereinkunft oder Mehrheitsbeschluss beruhen, mit Gewalt oder Überredung ausgeübt werden, sie konnte wirtschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle, politische, religiöse, strukturelle oder eine Vielzahl anderer Formen annehmen. Je weiter das Jahrhundert fortschritt, desto mehr räumten die Menschen der Macht eine höhere Priorität ein als dem Ruhm, der Ehre und vergleichbaren Werten, die vor 1815 in den meisten Jahrhunderten bestimmend gewesen waren. Als die Europäer gegen Ende des Jahrhunderts ihre Hegemonie über ganze Erdteile zunehmend als Beweis für ihre Überlegenheit über deren Bewohner betrachteten, wurde Macht vermehrt auch in rassistischen Begriffen gefasst. Wie und warum es zu all dem kam und wie sich die sich rasant verändernde Machtbalance zwischen Europa, Asien, Afrika und anderen Erdteilen auf die Machtverhältnisse innerhalb Europas auswirkte (und umgekehrt) – derlei Themen stehen in diesem Buch im Fokus.
Gegliedert ist das Buch in acht Kapitel, die wiederum in jeweils zehn Abschnitte unterteilt sind. Die Kapitel 1, 3, 7 und 8 beschäftigen sich in erster Linie mit Politikgeschichte, die Kapitel 2 und 4 mit Wirtschafts- und Sozialgeschichte und die Kapitel 5 und 6 mit Themen, die im weiteren Sinne der Kulturgeschichte zuzuordnen sind. Das erste Kapitel ist der Geschichte der europäischen Politik von der endgültigen Niederlage Napoleons 1815 bis zu den letzten Nachbeben der Revolutionen von 1830 gewidmet. Das dritte Kapitel zeichnet die weiteren Entwicklungen bis zu den Revolutionen von 1848 nach sowie deren Nachwirkungen in der konfliktreichen und instabilen Phase bis zum Anfang der 1870er Jahre. Das siebte Kapitel analysiert, wie die Staaten Europas zwischen 1871 und 1914 auf die immer lauter werdenden Forderungen nach mehr Demokratie reagierten, und das achte und letzte Kapitel widmet sich der Unterwerfung (so unvollständig diese auch war) der meisten anderen Teile des Erdballs durch Europäer im Zeitalter des Imperialismus sowie den verheerenden Folgen, die diese mit dem heraufziehenden Ersten Weltkrieg für Europa selbst hatte. Zwischen den ersten beiden dieser chronologisch angelegten Kapitel findet sich eines zu den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Europa zwischen 1815 und 1848 – wobei eine umfassende Darstellung der wichtigsten Veränderung jener Jahre, der Bauernbefreiung in weiten Teilen des Kontinents, es erfordert, einige Entwicklungen in der ländlichen Welt bis 1914 nachzuverfolgen. Das vierte Kapitel beschreibt die wichtigsten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen in Europa nach der Jahrhundertmitte und die massiven Veränderungen, die in jenen Jahren zu beobachten waren. Das fünfte Kapitel befasst sich über die ganze Epoche hinweg mit dem Versuch, die Natur einer menschengemachten Ordnung und Kontrolle zu unterwerfen – von den Wäldern, Flüssen und Bergen Europas bis hin zu den mannigfaltigen Bemühungen, die menschliche Natur in den Griff zu bekommen. Das sechste Kapitel charakterisiert das Jahrhundert im Gegensatz zum vorangegangenen Zeitalter der Vernunft als ein Zeitalter des Gefühls und nimmt dabei verschiedene Betätigungsfelder des menschlichen Geistes in den Blick, in denen sich dieser grundlegende Wesenszug manifestierte, von Religion und Glaube über Kultur und Bildung bis hin zum Menschenbild an sich.
Um die menschliche Dimension dieser Geschichte zu unterstreichen, beginnt jedes Kapitel mit der Lebensgeschichte eines Menschen, dessen Überzeugungen und Erfahrungen viele Themen aufwirft, die im Folgenden abgehandelt werden. Jede dieser acht Personen kommt aus einem anderen Land, und es sind vier Männer und vier Frauen. Diese Ausgewogenheit war mir wichtig. Schließlich stellten Frauen – wie in so ziemlich jeder anderen Epoche – mehr als die Hälfte der europäischen Bevölkerung. Ebenso bedeutsam ist ein weiteres grundlegendes Kennzeichen jenes Zeitalters, nämlich dass selbst am Vorabend des Ersten Weltkriegs die übergroße Mehrheit aller Europäer auf dem und vom Land lebten. Bauern und Grundbesitzer werden in europäischen Geschichten des 19. Jahrhunderts, vor allem in jenen, in denen der Aufstieg der Industriegesellschaft im Mittelpunkt steht, häufig zu Randfiguren degradiert. Dabei ist es meiner Ansicht nach völlig falsch, diese Millionen von Menschen als bloße Opfer des historischen Wandels darzustellen oder sie unter einer Rubrik abzuhandeln, die Marx als »Idiotie des Landlebens« bezeichnete.
Das Buch ist dafür gedacht, dass man es von vorne bis hinten durchliest. Wer es als Nachschlagewerk nutzen will, findet hinten im Buch ein Register. Gemäß den Vorgaben in der Reihe »Penguin History of Europe« enthält dieses Buch weder Fuß- noch Endnoten. Wie jeder Autor einer Überblicksdarstellung stütze ich mich in erster Linie auf die Arbeit anderer; sofern man von Originalität sprechen kann, liegt diese in den vorgebrachten Argumentationen und Interpretationen sowie im Spektrum der behandelten Themen und den zwischen ihnen hergestellten Bezügen. Ich hoffe, die vielen Historiker, deren Spezialforschung und Schriften mir als Steinbruch dienten, werden es mir nachsehen, dass ich nirgends explizit auf ihre Werke verweise. Zumindest möge es mir gestattet sein, auf meine Quellen für die Biographien zu verweisen, die den einzelnen Kapiteln vorangestellt sind (ausführliche Angaben siehe unter »Weiterführende Literatur«): Für Kapitel 1, Kathinka Nohl (Hg.), Tagebuch eines napoleonischen Fußsoldaten; für Kapitel 2, Boris B. Gorshkov (Hg. u. Übers.), A Life under Russian Serfdom, Budapest 2005; für Kapitel 3, Máire Cross und Tim Gray, The Feminism of Flora Tristan, Oxford 1992, sowie Jean Hawkes (Hg. u. Übers.), The London Journal of Flora Tristan, London 1992; für Kapitel 4, Hermynia zur Mühlen, Ende und Anfang, Berlin 1929; für Kapitel 5, Wendy Bracewell, Orientations, Budapest 2009; für Kapitel 6, Brita K. Stendhal, The Education of a Self-Made Woman, Lewiston (NY) 1994; für Kapitel 7, Martin Pugh, The Pankhursts, London 2001; und für Kapitel 8, Ivor N. Hume, Belzoni, Charlottesville (VA) 2011. Die übrigen längeren Zitate stammen aus Originalquellen, mit Ausnahme von Zitat 1 (Dirk Blasius, Der verwaltete Wahnsinn, Frankfurt 1980); Zitat 2, Zitat 3 (Andrew Scull, The Most Solitary of Afflictions, London 1993); Zitat 4 (John A. Davis, Conflict and Control, London 1988); Zitat 5. (F. S. L. Lyons, Charles Stewart Parnell, London 1977); Zitat 6 (Hartmut Pogge von Strandmann, ›Domestic Origins of Germany’s Colonial Expansion under Bismarck‹, Past and Present, Februar 1969); Zitat 7 (Franco Venturi, Roots of Revolution, London 1960); Zitat 8 (Edvard Radzinsky, Alexander II, New York 2005); und Zitat 9 (Adam Hochschild, Schatten über dem Kongo, Stuttgart 2000).
Mit der Niederschrift dieses Buches habe ich 2009 begonnen, aber seine Ursprünge liegen sehr viel weiter zurück, in jenen Jahrzehnten, in denen ich an verschiedenen Universitäten die Geschichte des 19. Jahrhunderts lehrte, ehe ich mein Interesse 1998 mit dem Wechsel nach Cambridge dem 20. Jahrhundert zuwandte. Glücklicherweise konnte ich so auf die vielen Vorlesungen zurückgreifen, die ich im Lauf der Jahre über Europa im 19. Jahrhundert gehalten habe, an der University of Stirling in Schottland, an der Columbia University in New York, an der University of East Anglia in Norwich, am Birkbeck College der University of London sowie zuletzt am Gresham College in London. Ich danke meinen Studenten an all diesen Universitäten, die in Vorlesungen und Seminaren geduldig meinen Gedanken gelauscht und mit ihren Kommentaren dazu beigetragen haben, meine Herangehensweise zu überprüfen und meine Argumentation auszufeilen oder zu verändern. Ohne wissenschaftliche Mitarbeiter hätte ich ein so breit angelegtes Projekt wie dieses niemals in so kurzer Zeit zum Abschluss bringen können; mein besonderer Dank gilt daher meinen ehemaligen Studenten Daniel Cowling, Niamh Gallagher, Rachel Hoffman, Susie Lada und Georgie Williams, die mir Material zur Verfügung gestellt haben. Die historische Fakultät und das Wolfson College der Cambridge University haben mir 2012 durch die Einräumung eines Forschungssemesters unendlich wertvolle Zeit geschenkt, und die hiesige Universitätsbibliothek war dank ihrer unerschöpflichen Ressourcen und hilfsbereiten Angestellten bei der Informationssuche zu vielen Themen meine erste Anlaufstelle.
Viele Freunde und Kollegen haben dieses Buch oder Teile davon gelesen, Verbesserungsvorschläge gemacht und meine Fehler korrigiert. Der herausragende Lektor Simon Winder von Penguin hat zahlreiche Ideen zur Verbesserung eingebracht. Wegen ihrer gründlichen Lektüre der Kapitel 1, 3 und 6 stehe ich tief in der Schuld von Rachel Hoffman ebenso wie in der von David Motadel, der viele Korrekturen zu den Kapiteln 2, 4 – 5 und 7 – 8 beigesteuert hat, von Joanna Bourke wegen ihrer scharfsinnigen Kommentare zu Kapitel 5 sowie von Tim Blanning, Lucy Riall und Astrid Swenson, die dankenswerterweise das ganze Manuskript gelesen haben. Sämtliche verbleibenden Fehler liegen allein in meiner Verantwortung. Cecilia Mackay war unendlich hilfreich bei der Auswahl der Abbildungen; diese orientieren sich an der Abfolge der Kapitel und sollen das Verständnis der behandelten Themen vertiefen. Die im Text erwähnten Gemälde und Bilder sind problemlos im Internet aufzufinden. Andras Bereznay hat sich einmal mehr als gelehrter und inspirierender Kartograph erwiesen. Richard Mason hat als Korrektor zahlreiche Fehler eliminiert und an vielen Stellen die Lesbarkeit des Textes entscheidend verbessert. Dank schulde ich auch dem für die Herstellung verantwortlichen Richard Duguid.
Und schließlich stehe ich wie immer tief in der Schuld von Christine Corton, die ihre eigene Arbeit ruhen ließ, um die Fahnen zu lesen, und die mir zusammen mit unseren Söhnen Matthew und Nicholas während des langen Entstehungsprozesses dieses Buches Kraft gegeben hat.
Richard J. Evans
Cambridge, im Mai 2016
1Das Erbe der Revolution
Die Nachwehen des Krieges
Irgendwann Ende der 1820er oder Anfang der 1830er Jahre – wann genau, wissen wir nicht – machte sich der Steinmetz Jakob Walter (1788 – 1864) im württembergischen Ellwangen daran, seine Lebenserinnerungen aufzuschreiben. Er war eingezogen worden, um als gemeiner Fußsoldat in der Grande Armée des französischen Kaisers Napoleon Bonaparte (1769 – 1821) zu dienen, und marschierte mit ihr bis nach Moskau und zurück. In unverblümter, schlichter Sprache berichtete Walter vom furchtbaren Leid, das er auf dem Rückzug in den letzten Monaten des Jahres 1812 erfahren hatte. Walter wurde immer wieder von Kosaken überfallen, suchte in Abfällen nach Essbarem, trotzte Kälte, Dreck und Hunger, wurde von Banditen ausgeraubt und entging mehrmals nur knapp dem Tod. Als er in einer polnischen Stadt zum ersten Mal seit Wochen ein ordentliches Quartier zugewiesen bekam, wusch er sich:
Mit meinem Wassen der Hände, und dem Gesicht gieng es sehr langsamm, dan die Rufen an Hände, Ohren, und Nasen waren eine Forchen-Rinde mit Rize und Kolenschwarzen Schupen überwachsen, dass Gesicht glich einem mit Bart überwachsenen ruschen Bauren, und als ich in den Spiegel sahe habe ich mich selbsten über meine Fremde-Gesichtsbildung erstaunt, ich waschte dan eine Stunde lang mit heissem Wasser u: Seife […].
Alle Versuche, sich und seine Kleider von Läusen zu befreien, blieben allerdings fruchtlos. Als er mit seiner Einheit weiter nach Westen stapfte, bekam er Fieber – höchstwahrscheinlich Fleckfieber – und musste den restlichen Weg auf einem Karren gezogen werden. Von den 175 Männern in seinem Wagenkonvoi haben etwa 100 die Reise nicht überlebt. Als Walter, noch immer verlaust, in seiner Heimat anlangte, fürchtete er, seine Verwandten würden ihn nicht erkennen: »Ich hielt also meinen Einzug mit einen rusigen ruschischen Mandel, alten runden Huth, und unter meiner u: in meiner Kleitung unzähligen Reissgefärthen, worunter Russen, Polen Preisen u: Saxen waren.« Endlich konnte er sich ordentlich waschen, sich seiner verlausten Kleidung entledigen und langsam wieder gesunden. Die Leute im Ort grüßten ihn »als einen Russländer, so nante man damals jeden der darinnen war«.
Wie die übergroße Mehrheit der einfachen Leute damals in Europa hatte Walter keinerlei Interesse an (und auch keine Ahnung von) Politik. Er war 1806 von den Behörden des französischen Marionettenstaats Württemberg eingezogen und 1809 und 1812 erneut zu den Waffen gerufen worden. Eine Wahl hatte er ebenso wenig wie die vielen hunderttausend anderen, die in jenen Jahren als Soldaten rekrutiert wurden. In seinem Tagebuch finden sich keinerlei Anzeichen von Begeisterung für die französische oder wenigstens württembergische Sache, von Interesse am Ausgang des Krieges, von Hass auf die Russen oder vom Wunsch, diese zu töten. Als einfacher Fußsoldat verstand er von den strategischen Fragen hinter den Feldzügen, an denen er teilnahm, herzlich wenig. Walters einziges Interesse bestand darin, die Tortur zu überleben, derer er gegen seinen Willen unterworfen wurde. Der Elan der französischen Truppen, die in den frühen 1790er Jahren die Marseillaise singend der gegenrevolutionären österreichischen Armee entgegengezogen waren, gehörte längst der Vergangenheit an. Mittlerweile war nur noch ein kleiner Teil von Napoleons Soldaten, etwa die Kaiserliche Garde, motiviert und engagiert bei der Sache. Die Kriegsmüdigkeit, die sich durch das gesamte Tagebuch Walters zieht, war ein in ganz Europa weit verbreitetes Gefühl, und das mit gutem Grund: Nach nahezu einem Vierteljahrhundert mehr oder weniger ununterbrochenem Krieg waren die Menschen vor Leid und Verzweiflung wie betäubt. Wenn Jakob Walter irgendetwas wirklich am Herzen lag und Kraft gab, dann sein tiefer katholischer Glaube. Dieser hielt ihn allerdings nicht davon ab, in allen Einzelheiten die zunehmend entmenschlichende Wirkung zu schildern, die der Konflikt auf die Beteiligten entfaltete.
Nach der Rückkehr in seine Heimat führte Jakob Walter wieder sein unscheinbares Leben als Steinmetz. 1817 heiratete er und hatte mit seiner Frau zehn Kinder. Fünf von ihnen waren noch am Leben, als Walter, mittlerweile ein vergleichsweise gutsituierter Bauunternehmer und -aufseher, 1856 einen Brief mit Neuigkeiten aus der Familie an seinen Sohn schrieb, der nach Amerika ausgewandert war und in Kansas lebte. Im Jahr darauf reiste der junge Mann zurück zu seinen Eltern und heiratete ein Mädchen aus einem Dorf bei Ellwangen, die Tochter des dortigen Bürgermeisters. Der Familienüberlieferung zufolge nahm er die handschriftlichen Memoiren seines Vaters 1858 mit zurück nach Kansas. Dort blieben die Lebensaufzeichnungen im Familienbesitz, bis sie Anfang der 1930er Jahre der Wissenschaft zur Verfügung gestellt wurden. Jakob Walter selbst lebte noch ein paar Jahre in Ellwangen, wo er 1864 starb. Seine Frau überlebte ihn um neun Jahre. Wir wissen fast nichts über Jakob Walter, ebenso wenig wie über das Leben zahlloser anderer Dorfbewohner des 19. Jahrhunderts. Einzig seine Erlebnisse im Rahmen des verhängnisvollen Russlandfeldzugs der Grande Armée, die Tatsache, dass er ihn im Gegensatz zu den meisten Teilnehmern überlebte, und der glückliche Umstand, dass er seine Erfahrungen aus irgendwelchen Gründen aufzuschreiben beschloss, lassen ihn aus dem Dunkel hervortreten, in dem das Leben der großen Mehrheit der Europäer jener Zeit für uns liegt.
Auf dem Rückweg aus Moskau hatte Jakob Walter einmal einen Blick auf Napoleon höchstpersönlich erhascht, der sich an der Beresina zu einem Mahl unter freiem Himmel niedergelassen hatte. Er war nicht gerade beeindruckt:
Napolion […] sah seine Arme in ärbärmlichsten zustande um ihn vorbei zihen, was wohl auch sein Herz empfunden hat, ist nicht zu beurtheilen, sein Aeuserer Aber glich einen gleichgiltigen, und unbekümerten Sine für Gefühl des Ellendes seiner Soldaten, nur Habsucht und Ehrverlust mag in seinen Innern sein Anligen gemacht haben, und obgleich Franzosen und Verbündete mit vielen Schümpfen und Fluchen über seine schuldige Person in seine Ohren schrien, so konte er unberügt solches ertragen.
In dieser Phase des verheerenden Rückzugs aus Moskau hatten die meisten seiner noch lebenden Soldaten für Napoleon nur noch Hass und Verachtung übrig. Von der unersättlichen Rekrutierungsmaschinerie des französischen Kaiserreichs ihrem Alltagsleben entrissen, waren 685000 Soldaten aus Deutschland, Polen, Italien und Frankreich nach Russland marschiert (wobei die Grande Nation selbst weniger als die Hälfte stellte). Keine 70000 kehrten zurück. 400000 kamen ums Leben, mehr als 100000 gerieten in russische Gefangenschaft; die Zahl der Nachzügler und Deserteure, die sich auf eigene Faust nach Hause durchschlugen, ist unbekannt. Zu weiteren Blutbädern war es in den Schlachten gekommen, in denen Napoleon von einer Koalition europäischer Armeen unter Führung Großbritanniens, Preußens, Österreichs und Russlands unbarmherzig immer weiter nach Westen zurückgedrängt worden war. 1814 schließlich hatten die Alliierten Paris besetzt und Napoleon auf die Mittelmeerinsel Elba verbannt.
Lange herrschte die Ansicht, im Vergleich zu den Verwüstungen späterer Konflikte sei der von den Revolutions- und Napoleonischen Kriegen verursachte Schaden eher gering gewesen. Insgesamt jedoch waren dem Auf und Ab von 23 Jahren mehr oder weniger permanenter kriegerischer Auseinandersetzungen, die Europa nach der Französischen Revolution erlebte, Schätzungen zufolge fünf Millionen Menschen zum Opfer gefallen. Setzt man das in Relation zur europäischen Gesamtbevölkerung, so waren das ebenso viele, wenn nicht mehr als im Ersten Weltkrieg. Jeder fünfte zwischen 1790 und 1795 geborene Franzose hatte den Tod gefunden. In den Reihen von Napoleons Armee waren bis zu eineinhalb Millionen Männer gefallen. Moskau war von den Russen niedergebrannt worden, damit die Ressourcen der Stadt nicht dem Feind in die Hände fielen und zum Überwintern genutzt würden. Drei Tage lang, hielt ein Augenzeuge fest, »stand die ganze Stadt in Flammen, auf allen Seiten stiegen vielfarbig die Flammen bis in den Himmel, verdeckten den Horizont und sandten in alle Richtungen blendendes Licht und glühende Hitze aus«. Die französischen Soldaten hatten in diesem Chaos alles mitgenommen, was sie in die Finger bekommen konnten, Bauern aus der Umgebung hatten sich ihnen angeschlossen und sich an der Plünderung der Stadt beteiligt. Als die Feuer niedergebrannt waren, hatten die verkohlten Ruinen der ausgebrannten Stadt kaum noch etwas an Essbarem und Schutz zu bieten, was Napoleons Armee über den Winter hätte bringen können. Fast 7000 der etwas über 9000 Häuser, mehr als 8000 Geschäfte und Lagerhäuser und über ein Drittel der 329 Kirchen der Stadt waren völlig zerstört. Privatbesitz im Wert von etwa 270 Millionen Rubel war vernichtet, ohne dass irgendeine Aussicht auf Entschädigung bestand. Die meisten Einwohner, waren sie nicht bereits geflohen, verließen Moskau daraufhin; vor ihnen lagen Jahre des elenden Vagabundierens. Lediglich zwei Prozent der Bevölkerung waren geblieben, und ein großer Teil davon, darunter viele Soldaten, lebte nicht lang. Als die russische Armee Moskau schließlich wiedereingenommen hatte, hatte sie 12000 Leichen auf riesigen Scheiterhaufen verbrennen müssen. Der Wiederaufbau der Stadt kam erst 1814 ernsthaft in Gang. Wo sich einst ein Wirrwarr enger Straßen befunden hatte, entstanden nun Parks und Gärten nebst einem neuen großen Palast für den Zaren. Mehr als eine Generation lang blieb Moskau eine Baustelle: Die mit dem Wiederaufbau der Stadt betraute Kommission wurde erst 1842 aufgelöst, und selbst zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt noch einen weiten Weg vor sich, ehe sie ihre einstige Pracht zurückerlangte.
Derweil waren in Spanien zahlreiche Städte und Dörfer durch offene Feldschlachten und Belagerungen verwüstet worden. Puerto Real, das 1810 bis 1812 während der zwei Jahre dauernden Belagerung von Cádiz von den Franzosen besetzt gewesen war, hatte die Hälfte seiner ehemals 6000 Einwohner eingebüßt. Vierzig Prozent der Gebäude waren ebenso zerstört worden wie drei Viertel der Olivenbäume und ein Großteil des Pinienwaldes der Umgebung. Viele spanische Städte sollten sich nie wieder erholen. Überall war die Zahl der Rinder, Pferde, Schweine und Schafe aufgrund der Verwüstungen durch die Franzosen dramatisch zurückgegangen. Die Extremadura hatte nahezu 15 Prozent ihrer Vorkriegsbevölkerung verloren. Francisco de Goya (1746 – 1828) fing die Realität des Krieges in 82 Radierungen ein, die unter dem Titel Die Schrecken des Krieges bekannt sind. Die erst in den 1860er Jahren veröffentlichten Graphiken zeigen schreckliche Vergewaltigungen, Plünderungen, Verstümmlungen und Gemetzel. Auf einem der Bilder steigt eine Leiche aus dem Sarg, die ein Stück Papier mit der Aufschrift »Nada« (»Nichts«) in der Hand hält – ein Wort, das für den Maler zusammenfasste, was der jahrelange, erbittert ausgetragene Konflikt gebracht hatte.
Im Rheinland hatten die wiederholten Einfälle der französischen Truppen die Felder ihres Ertrags, die Bauern ihres Viehs und die Städte und Dörfer ihrer Vorräte beraubt. Noch verstärkt worden war der allgemeine Eindruck von zügelloser Habgier durch die horrenden Zahlungen, die den Bewohnern der Region von den Franzosen abverlangt wurden. Der Schaden war bereits in einer frühen Phase der Konflikts entstanden und hatte dauerhafte Folgen. Ein 1792 aus diesem Gebiet zurückkehrender französischer Regierungsbeauftragter berichtete: »Nicht einmal das Überlebensnotwendigste wurde zurückgelassen – nichts für die Tiere oder die Aussaat –, und auch andere Dinge sind in den Dörfern gestohlen worden.« Räuberbanden, die übers Land gestreift waren, hatten sich als französische Soldaten verkleidet, um ihre Opfer zu täuschen – was zeigt, dass die Bevölkerung an von den Besatzungstruppen verübte Vergewaltigungen, Plünderungen und Zerstörungen gewöhnt war. Tatsächlich hatte die französische Armee sofort bei ihrem Eintreffen in Aachen so ziemlich alles in der Stadt und im Umland an sich gerissen, was nicht niet- und nagelfest war: Getreide, Futter, Kleidung, Vieh …; als der Winter eingebrochen war, waren Hunderte Aachener Hungers gestorben.
Doch nicht nur die französische, auch andere Armeen hatten im Wesentlichen vom Land gelebt, durch das sie zogen, und das ging stets mit Plünderungen einher. Allesamt hatten sie gewaltige Anstrengungen unternommen, um die wichtigsten Vorräte zu organisieren, und zumindest in den Jahren 1812 bis 1814 hatte der wachsende Patriotismus in den Nationen der Alliierten dafür gesorgt, dass Adlige, Kaufleute und einfache Bauern in unterschiedlicher Form erhebliche freiwillige Beiträge leisteten, um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Doch angesichts des gigantischen Ausmaßes der Kämpfe hatte das kaum je ausgereicht. Als die russische Armee 1813/14 westwärts marschiert war, hatte sie ihren Grundbedarf an Nahrungsmitteln selbst organisiert und dabei die Nachschubwege an die Grenze ihrer Belastbarkeit gebracht. Allerdings hatte es sich bei ihren Vorräten um wenig mehr als um Schwarzbrot und die Grundzutaten für Getreidebrei gehandelt, und die Soldaten waren gezwungen gewesen, abwechslungsreichere und schmackhaftere Nahrung zu stehlen – bisweilen von ihren eigenen Verbündeten. Alle beteiligten Armeen hatten enorme Schwierigkeiten, die Ernährung der Tausenden Pferde sicherzustellen, die für die Kavallerie sowie als Zugtiere für die Feldartillerie und Versorgungswagen gebraucht wurden. Suchtrupps hatten weite Strecken zurückgelegt, um Hafer und anderes Futter zu organisieren. Als die russische Armee in Frankreich einmarschierte, waren im Zuge der Kämpfe ganze Dörfer verwüstet worden. Die Bauern waren in die Wälder geflüchtet, wie sie es schon gewohnheitsmäßig taten, um sich vor den Konskriptionsbeauftragten Napoleons zu verstecken, und waren hin und wieder aufgetaucht, um Nachschubkolonnen der Alliierten zu überfallen. Nach der Schlacht bei Waterloo wurde Frankreich von circa 900000 ausländischen Soldaten besetzt, deren Unterhalt in weiten Gebieten wirtschaftliches Elend auslöste.
Die Natur hat den Erholungsprozess nicht gerade befördert. Im April 1815 kam es auf der Insel Sumbawa im heutigen Indonesien zum größten bekannten Vulkanausbruch der Geschichte. Bei der Explosion, die noch in 2000 Kilometer Entfernung zu hören war, entstand eine gigantische, bis zu 43 Kilometer hohe Staubwolke. Gewaltige Mengen an Schwefel wurden in die Stratosphäre geschleudert, wo die winzigen Partikel mehr als zwei Jahre verblieben, den Himmel verdunkelten und für spektakuläre, orangefarbene Sonnenuntergänge sorgten. »Der Morgen kam und ging«, schrieb George Gordon, bekannt als Lord Byron (1788 – 1824), »– und kam, und brachte keinen Tag.« In Ungarn fiel im Januar 1816 brauner Schnee, ganze Häuser sollen unter Schneewehen begraben worden sein. Der Ausbruch des Vulkans ereignete sich in der Mitte eines ganzen Jahrzehnts kalter Sommer, das bereits 1811 begonnen hatte. Ursache waren Veränderungen der Sonnenaktivität und der um die Erde zirkulierenden Wettersysteme sowie ein früherer großer Vulkanausbruch in Kolumbien 1808. Ende 1816 war klar, dass die Ernteerträge in vielen Gebieten auf wenig mehr als ein Viertel der Normalwerte gefallen waren, und die (kümmerliche) Ernte konnte erst einen Monat später eingebracht werden als üblich. In den Niederlanden wurde die Sommerernte von heftigen Sommerstürmen zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen. »Von überall auf dem Festland erreichen uns traurige Berichte, dass es für die Jahreszeit ungewöhnlich nass ist«, meldete eine britische Zeitung im Juli 1816: »In mehreren holländischen Provinzen stehen die saftigen Weiden komplett unter Wasser, und die Knappheit und die hohen Preise lösen naturgemäß große Sorgen und Ängste aus. In Frankreich machen die Folgen von Überschwemmungen und heftigen Regenfällen dem Landesinneren schwer zu schaffen.« Das Pariser Observatorium verzeichnete Sommertemperaturen, die einige Grad unterhalb des Durchschnitts der Jahre 1740 – 1870 lagen, und über manche Gegenden brach der Winter herein, ehe die Weintrauben reif waren.
»Jedes Gewitter des vergangenen Sommers«, hielt ein 1818 in Württemberg zusammengestelltes Jahrbuch fest, »hatte überdieß die empfindlichste Kälte zur Folge, so daß man stets in Novembertagen zu leben glaubte.« Der Niederrhein trat fünf Monate lang über die Ufer, und im Königreich Lombardo-Venetien lag im Mai noch Schnee. Weiterer Schaden entstand im Herbst durch frühen Frost. Kärntner Bauern konnten im dritten Jahr in Folge kein Wintergetreide aussähen, und in Baden sagte man von der Getreideernte des Jahres 1817, sie sei die schlechteste seit Menschengedenken. In Südosteuropa starben im harten Winter von 1815/16 in der Gemeinde Bač in der Vojvodina Berichten zufolge mehr als 24000 Schafe, und Dauerregen zu Beginn des Frühjahrs löste an der Donau »großflächige Überflutungen« aus, wie der Chronist der Franziskanerabtei in Šarengrad festhielt. »Niemand, nicht einmal alte Leute, kann sich an eine vergleichbare Flut erinnern. Sie überflutete viele Dörfer an diesem wie am anderen Ufer der Donau, fruchtbares Land und Heufelder […]. Das Wasser stand teilweise mannshoch.« Der Pfarrer des kroatischen Dorfes Žminj bezeichnete das Jahr 1816 als »fatal«:
[…] wegen häufiger Regenfälle und anderer Schlechtwetterereignisse brachte [es] so wenig ein, dass viele Bürger nicht einmal genug Getreidevorrat für ein halbes Jahr anlegen konnten, und manche nicht einmal für zwei Monate. […] Schon im März überfiel diese Leute der Schwarze Hunger, aber solange sie irgendetwas zu essen hatten, halfen sie sich gegenseitig. […] Doch das währte nicht lange […]. In jämmerlichstem Elend liefen sie herum und fielen tot um, manche zuhause, manche am Straßenrand, manche im Wald usw.
In Kroatien war 1816 und mehr noch 1817 die Zeit der »Großen Hungersnot«. Die Getreidepreise lagen zwei- bis dreimal so hoch wie fünf Jahre später. Der Krieg hatte die Versorgungswege unterbrochen, so dass Hilfe schwer zu organisieren war. Die globale Klimakatastrophe hatte die schlechtesten Ernten zufolge, die Europa seit mehr als einhundert Jahren erlebt hatte. Und das ausgerechnet in einer Phase, in der Europa nach den Verwerfungen der Französischen Revolutions- und der Napoleonischen Kriege versuchte, Handel und Industrie wiederaufzubauen. Die britische Seeblockade und die als Reaktion darauf von Napoleon verhängte Kontinentalsperre hatten den Handel auf dem Kontinent ebenso ruiniert wie im Vereinigten Königreich die Märkte abgeschnitten und Tausende arbeitslos gemacht. Ende 1816 soll es allein im Londoner Stadtteil Spitalfields zwischen 20000 und 30000 arbeitslose Weber gegeben haben, und vergleichbare Zustände wurden auch aus Textilstädten in Sachsen, der Schweiz und den Niederlanden gemeldet. Hunderttausende Soldaten wie Jakob Walter wurden am Ende des Krieges demobilisiert, was das ohnehin große Heer von Arbeitslosen weiter anwachsen ließ.
Viele Menschen kämpften also schon mit dramatischen Einkommensverlusten, als die katastrophal schlechte Ernte von 1816 die Getreidepreise steil ansteigen ließ. Brot, das Hauptnahrungsmittel der meisten Leute, kostete 1817 in Paris mehr als das Doppelte als im Vorjahr. »Im Jahre 1816 war bekanntlich im ganzen südlichen und westlichen Deutschland ein gänzlicher Mißwachs, woraus im Jahre 1817 eine wahre Hungersnot entstand«, schrieb der preußische Armeeoffizier und Militärtheoretiker Carl von Clausewitz (1780 – 1831). Clausewitz war 1817 im Rheinland unterwegs und sah »[v]erfallene Gestalten, Menschen kaum ähnlich […] in den Feldern herumschleichen, um aus den nicht geernteten, unreif gebliebenen und nun schon halbverfaulten Kartoffeln sich noch Nahrung zu suchen«. Im Oberland der von Österreich beherrschten Lombardei lebten die Armen von Wurzeln und Kräutern. In Siebenbürgen und in den östlichen Provinzen Ungarns lag die Zahl der Hungertoten Schätzungen zufolge bei mehr als 20000. Der habsburgische Kaiser Franz I. (1768 – 1835) klagte 1816 in einem Brief an Metternich, in der Grafschaft Görz »solle die Noth so weit gekommen sein, daß die Menschen nur von Salat und Kräutersuppe leben und viele manche Tage gar nichts zu essen haben«.
In ihrer verzweifelten Lage blieb den Ärmsten der Armen nichts anderes übrig, als zu betteln, zu stehlen oder auf der Suche nach Essbarem in die Städte zu fliehen. In München, notierte ein Kommentator Ende 1816, »erschienen Bettler auf allen Seiten, gleichsam aus der Erdegrüfte hervorgebrochen«. Aus Ungarn hieß es, das Land werde von »Scharen von Bettlern überrannt«, und in Rom und Wien begann die Polizei, regelmäßige Razzien durchzuführen, um sie von der Straße zu holen und im Rahmen öffentlicher Projekte zu beschäftigen. »Die Zahl der Bettler«, schrieb ein Besucher des Schweizer Kantons Appenzell im Juni 1816, »hauptsächlich Frauen und Kinder, ist erschütternd.« Diese hätten, so ein anderer Beobachter, »die Blässe des Todes auf den Wangen«. Viele Arme trafen – unterstützt von lokalen Behörden, die sie nur allzu gern loswurden – die drastische Entscheidung, Europa ganz den Rücken zu kehren: In Baden machten sich 1818 mehr als 2000 Menschen nach Rio de Janeiro auf, 20000 Deutsche und 30000 Franzosen sollen sich 1817 auf den Weg in die Vereinigten Staaten gemacht haben, und mehr als 9000 verarmte Württemberger traten im selben Jahr den langen Marsch ins Russische Reich an, nachdem ihnen Zar Alexander I. (1777 – 1825) Unterstützung zugesagt hatte. In einer Zeit, die weder Hygienemaßnahmen noch Antibiotika kannte, lösten diese Wanderungsbewegungen großer Menschenmassen über weite Strecken hinweg Epidemien aus – nicht zuletzt aufgrund der unhygienischen Bedingungen, die in den Heeren und bei den Scharen mittelloser Migranten und Bettler herrschten. In Paris hat sich die Zahl der Pockentoten zwischen 1816 und 1818 nahezu vervierfacht, und auch in den Niederlanden kam es zu einer großen Pockenepidemie. Die Mangelernährung schwächte die Widerstandskräfte der Menschen und machte sie anfällig für Durchfall, die Ruhr und Ödeme; im norditalienischen Brescia registrierten die Krankenhäuser allein in der ersten Jahreshälfte 1816 fast 300 Fälle von Skorbut. Besonders rasch breitete sich das von der Kleiderlaus übertragene Fleckfieber aus. In England, Wales, Schottland und Irland blieb kaum eine Stadt verschont – in Glasgow, einer Stadt mit 130000 Einwohnern, wurden allein 1818 ungefähr 32000 Krankheitsfälle und 3500 Tote verzeichnet, die auf das Konto des Fleckfiebers gingen. Durch Hungerhilfemaßnahmen wurde die Ausbreitung der Krankheit nur weiter beschleunigt. Ein irischer Arzt stellte sehr zutreffend fest, die Seuche habe sich nicht nur »durch die Scharen, die auf der Suche nach Essbarem herumstreifen, rasant ausgebreitet«, sondern auch »durch Einrichtungen, in denen Suppe und andere Lebensmittel an die Armen verteilt werden, weil sich dort viele auf engem Raum zusammendrängen«.
Auf dem Balkan breitete sich die Beulenpest rasant aus. 1815 erreichte sie Italien, wo ihr im bei Bari an der Adria gelegenen Noja ein Siebtel der Einwohner zum Opfer fiel. Als die Seuche die Balearen erfasste, wurden diese regelrecht verwüstet; 1820 kam es dort zu 12000 Todesfällen. Besonders hoch war die Zahl der Pesttoten auch in Bosnien, wo etwa ein Drittel der Stadt- und ein Viertel der Landbevölkerung starb. Vom Hunger zur Verzweiflung getrieben strömten die Menschen auf der Suche nach Nahrung in verseuchte Städte, ohne sich um Quarantänemaßnahmen und Sperrgürtel zu scheren. In der dalmatinischen Stadt Makarska ging im Zuge der Epidemie die Einwohnerzahl von 1575 auf 1025 zurück, das Dorf Tucepi büßte 363 seiner 806 Bewohner ein. Die osmanische Verwaltung, der ein Großteil des Balkans nach wie vor unterstellt war, erwies sich als von dieser Katastrophe völlig überfordert. Es war die letzte große Pestepidemie in Europa, und es war eine der schwersten. Eine Studie kam zu dem Schluss, dass »die gesundheitliche und demografische Katastrophe, die sich in den Jahren 1815 – 1818 in Bosnien zutrug, in Europa seit dem Schwarzen Tod der Jahre 1347 – 1351 ohne Beispiel war«. Im westlichen Mittelmeer wurden eilig Quarantänemaßnahmen für ankommende Schiffe improvisiert. Zudem stellte die sogenannte »Militärgrenze« des Habsburgerreichs, die mit zahlreichen Garnisonen gesicherte Grenze zum Osmanischen Reich, eine weitere Barriere dar. Beides zusammen erwies sich als ziemlich effektiv, so dass die Pest sich nicht nach Norden und Westen ausbreitete. Trotzdem ließen all diese Faktoren, vor allem die Missernten und die Krankheitsepidemien, in der Summe die Sterbeziffern überall in Europa ansteigen. In den meisten westeuropäischen Ländern nahm die Sterblichkeit um acht bis neun Prozent zu. Einige Regionen traf es allerdings besonders hart: In der Ostschweiz zum Beispiel hat sich die Sterbeziffer im gleichen Zeitraum glatt verdoppelt.
In den Jahren ab 1816 erlebte Europa die großflächigste und gewaltsamste Serie von Hungerrevolten seit der Französischen Revolution. In Ostengland wurden die Häuser vermeintlicher Profiteure von hungernden Massen verwüstet, die mit eisernen Dornen besetzte Knüppel schwangen, Spruchbänder mit der Aufschrift »Brot oder Blut« trugen und eine Senkung der Brot- und Fleischpreise forderten. In Nordengland und Schottland besetzten Menschenmengen Kornspeicher und griffen die Häuser von Müllern, Ladenbesitzern und Getreidehändlern an. In vielen Teilen Frankreichs verhinderten Gruppen von Menschen den Abtransport von Getreide aus ihrer Region, in Italien wurden Kornspeicher und Bäckereien geplündert, und auch in Augsburg und München kam es zu Brotrevolten. Als die Getreidepreise im Juni 1817 in den Niederlanden ein nie dagewesenes Niveau erreichten, überfielen und plünderten Menschenmengen Bäckereien und demonstrierten anlässlich des zweiten Jahrestags der Schlacht bei Waterloo gegen den Brotpreis. An Überfällen auf Bauernhöfe im Osten Frankreich beteiligten sich derart große Menschenmassen, dass mancher sich an die Grande Peur, die »Große Furcht«, erinnert fühlte, die Bauernaufstände von 1789. In vielen Fällen hatten diese Revolten eine dezidiert politische Note, vor allem im Fall der Massenunruhen in Lyon 1817, deren Auslöser Gerüchte über die unmittelbar bevorstehende Rückkehr Napoleons waren. In Manchester beschlossen am 10. März 1817 mehrere hundert Weber (die sogenannten »Blanketeers«) einen Marsch auf London, mit dem sie Maßnahmen gegen die Krise der Baumwollindustrie erzwingen wollten. Politische Fragen spielten auch in der sogenannten »Pentrich Revolution« im Juni eine Rolle, einem gescheiterten Aufstand in Nottingham, ebenso wie in einer Revolte in Breslau am 23. August, bei der Rekruten sich weigerten, den preußischen Soldateneid abzulegen. Betrachtet man diese Unruhen aus der gesamteuropäischen Perspektive, so wird deutlich, dass sie letztlich nicht von lokalen oder nationalen politischen Faktoren ausgelöst wurden, sondern von der Subsistenzkrise, von Massenarbeitslosigkeit und -elend, sowie in vielen Fällen von der Furcht, es könnte noch schlimmer kommen. Von den 2280 strafrechtlichen Verfolgungen, zu denen es im Zuge des sogenannten »Weißen Terrors« im nachnapoleonischen Frankreich kam, bezog sich die übergroße Mehrheit auf Vergehen wie das Erzwingen niedrigerer Getreidepreise, das Behindern von Getreidetransporten, Widerstand gegen Steuereintreiber oder das Fällen von Bäumen in Privatwald. Die gegenrevolutionäre Politik war nur am Rande von Bedeutung.
Selbst als sich die Krise 1819 allmählich dem Ende zuneigte, rissen die Aufstände nicht ab. Im August wurde eine öffentliche Protestkundgebung auf dem St. Peter’s Field in Manchester, an der bis zu 60000 Menschen teilnahmen, vom Militär mit Waffengewalt aufgelöst; 15 Demonstranten starben. Die Aktion wird gemeinhin als »Peterloo-Massaker« bezeichnet, eine ironische Anspielung auf die Schlacht bei Waterloo. Im selben Jahr kam es in West- und Mitteleuropa zu einer Welle antisemitischer Krawalle, den sogenannten »Hep-Hep-Unruhen«, die die nervöse Obrigkeit den Machenschaften von Geheimgesellschaften zuschrieb. Aller Wahrscheinlichkeit nach war ihre Wurzel der verbreitete Unmut über den wirtschaftlichen Erfolg, den jüdische Geschäftsleute in den Augen der Aufrührer trotz der Krise genossen. Wütende Handwerker, die in Universitätsstädten von radikalen Studenten aufgewiegelt wurden, griffen Juden tätlich an, zerstörten jüdischen Besitz und zwangen viele zur Flucht. Die Unruhen breiteten sich von Würzburg nach Karlsruhe und Heidelberg aus, rheinabwärts nach Frankfurt, im Norden bis nach Kopenhagen und in die umliegenden Gemeinden (wo Matrosen sich den Bürgern anschlossen und Steine auf jüdische Häuser warfen), im Osten bis nach Krakau, Danzig, Prag und Riga und im Westen bis in die französischen Départements an Oberrhein, Niederrhein und Mosel. Da dabei Eigentum zerstört wurde, gingen die Behörden überall gegen die Randalierer vor, so dass die Welle der Unruhen 1820 vorüber war. Aufgrund der Tatsache, dass sich in manchen Städten gutsituierte Bürger und Universitätsstudenten an den Hep-Hep-Unruhen beteiligten, bekamen auch diese eine politische Dimension, die aus Sicht der Regierungen höchst alarmierend war.
So ungleich verteilt die Folgen der nachnapoleonischen Krise und die mit ihr einhergehenden europaweiten Unruhen waren: Sie nötigten die Regierungen, Fürsorgemaßnahmen zu ergreifen, es entstand die allgemeine Ansicht, dass es die Pflicht des Staates sei, die Not der ärmsten Bevölkerungsschichten zu lindern. Die Möglichkeiten europäischer Staaten, dieser Vorstellung entsprechend zu handeln, waren 1815 – 1819 oftmals allerdings sehr beschränkt. Die häufigen Grenzverschiebungen der vorausgegangenen Jahrzehnte, die Tatsache, dass viele neu geschaffene Staaten ihre Verwaltungsmaschinerie gerade erst aufbauten und auf abgelegene Gegenden ausdehnten, sowie die Schwierigkeiten, Getreide – in einer Zeit, in der das Straßennetz häufig noch rudimentär, die Eisenbahn noch Zukunftsmusik, die Zahl der Kanäle überschaubar und Flüsse schwer zu befahren waren – in betroffene Landesteile zu transportieren: All das bedeutete, dass die Bewohner abgelegener Gebiete zum Hungern verurteilt waren, wenn sie nicht umsiedelten, um näher an den Machtzentren zu sein. Gleichzeitig vergrößerten die Unruhen die latente Angst der Eliten, dass die Revolten sich zu einer Revolution auswachsen könnten, genau wie es 1789 der Fall gewesen war – mit allen Konsequenzen, die daraus folgten. Ebenso große Bedeutung wie der Zügelung etwaiger zukünftiger militärischer und politischer Ambitionen Frankreichs wurde in der nachnapoleonischen Friedensordnung daher dem Ziel beigemessen, Revolutionen vorzubeugen beziehungsweise drohende Revolutionen im Keim zu ersticken.
Nach Napoleon