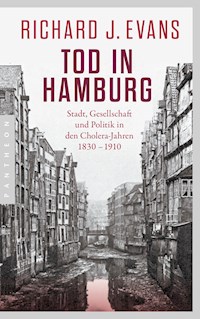5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was wäre gewesen wenn...
Was wäre, wenn Napoleon die Schlacht von Waterloo gewonnen hätte? Was, wenn Hitler 1930 bei einem Autounfall gestorben wäre? Solche Fragen haben Historiker und Geschichtsinteressierte seit jeher fasziniert – und wenn sie auch die Vergangenheit nicht zu ändern vermögen, so sind die Antworten darauf doch ein Spiegel der jeweiligen Gegenwart.
Warum stellen sich Menschen alternative Geschichtsverläufe vor? Der renommierte Historiker Richard J. Evans untersucht die soziale, kulturelle und politische Bedeutung solcher Überlegungen und beschreibt das Aufkommen kontrafaktischer Geschichtsschreibung aus dem Geist der romantischen Vergangenheitsverklärung. Prägnant zeigt Evans, welchen Wert das Nachdenken über jene Wege hat, die nicht beschritten worden sind – und warnt zugleich vor einer gefährlichen Nähe zu Verschwörungstheorien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
RICHARD J. EVANS
VERÄNDERTE
VERGANGENHEITEN
Über kontrafaktisches Erzählen in der Geschichte
Aus dem Englischen von Richard Barth
Deutsche Verlags-Anstalt
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel Altered Pasts. Counterfactuals in Historybei Brandeis University Press (An imprint of University Press of New England)
1. Auflage
Copyright © Richard J. Evans 2013
All rights reserved
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Typographie und Satz: Brigitte Müller/DVA
Gesetzt aus der Palatino
ISBN 978-3-641-14269-8www.dva.de
Für ChristineWenn wir uns nicht kennengelernt hätten …
Der Historiker […] muss gegenüber seinem Objekt einen indeterministischen Gesichtspunkt wahren. Er versetzt sich ständig in einen Augenblick der Vergangenheit, in dem die erkennbaren Faktoren noch verschiedene Ergebnisse zuzulassen schienen. Spricht er von Salamis, dann ist es noch möglich, dass die Perser siegen werden, spricht er vom Staatsstreich des Brumaire, so ist noch offen, ob Bonaparte nicht eine schmähliche Zurückweisung erfahren werde. […] [Doch] der Historiker hat das Bestreben, in der Überlieferung einer bestimmten Vergangenheit der menschlichen Gesellschaft eine Bedeutung zu erkennen. […] Der von uns aufgestellte historische Zusammenhang, eine Schöpfung unseres Geistes, hat nur Sinn, sofern wir ihm ein Ziel oder, wie wir sagen wollen, einen Weg zu einem bestimmten Ergebnis hin zusprechen. […] Deshalb ist die historische Denkweise immer zielstrebig. […] Die Frage der Geschichte lautet immer: Wozu und wohin? Sie muss als eine im höchsten Grade zielstrebig eingestellte Wissenschaft bezeichnet werden.
—JOHAN HUIZINGA1
1 Zit. n. Fritz Stern (Hg.), Geschichte und Geschichtsschreibung: Möglichkeiten – Aufgaben – Methoden. Texte von Voltaire bis zur Gegenwart, München 1966, S. 298 f.
INHALT
EINLEITUNG
KAPITEL 1 WUNSCHDENKEN
KAPITEL 2 VIRTUELLE GESCHICHTE
KAPITEL 3 ZUKUNFTSFIKTIONEN
KAPITEL 4 MÖGLICHE WELTEN
REGISTER
EINLEITUNG
Dieses Buch ist ein Essay über den Einsatz von kontrafaktischen Szenarien im Rahmen der historischen Forschung und Geschichtsschreibung. Unter kontrafaktischen Szenarien verstehe ich alternative Versionen der Vergangenheit, bei denen die Änderung eines einzelnen Ereignisses auf der Zeitachse zu einem anderen Ergebnis als dem führt, das sich tatsächlich ereignet hat. Zu den Beispielen, auf die in den folgenden Kapiteln näher eingegangen wird, gehören: Was wäre geschehen, wenn Großbritannien nicht in den Ersten Weltkrieg eingetreten, sondern neutral geblieben wäre? Welche Folgen hätte es gehabt, wenn Großbritannien 1940 oder 1941 einen Separatfrieden mit Nazideutschland geschlossen hätte? Oder: Wie hätten die Briten sich verhalten, wenn sie die Luftschlacht um England verloren hätten und Großbritannien von den Streitkräften des »Dritten Reichs« besetzt worden wäre?
Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die Geschichte kontrafaktischer Szenarien seit den Anfängen im 19. Jahrhundert und sucht nach Erklärungen für ihre Wiederbelebung und Popularität, vor allem in Großbritannien und den Vereinigten Staaten, in den 1990er Jahren und im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends. Im zweiten Kapitel werden die Argumente für und gegen den Einsatz von kontrafaktischen Szenarien abgewogen. Das Kapitel setzt sich kritisch mit einigen der wichtigsten Beispiele für dieses Genre auseinander und fragt nach den Folgen für das, was viele seiner Vertreter als »historischen Determinismus« bezeichnen. Das dritte Kapitel untersucht verschiedene Beispiele dafür, wie Historiker und Romanautoren die Vergangenheit zu ihren eigenen Zwecken neu erfunden haben, etwa indem sie auf der Grundlage einer veränderten Vergangenheit eine »alternative« Geschichte oder eine imaginäre Zukunft entworfen haben. Im vierten und letzten Kapitel wird all das zusammengefasst und versucht, eine Antwort auf die Frage zu geben, ob und, wenn ja, inwiefern kontrafaktische Szenarien ein nützliches Werkzeug für den Historiker sind und wo sie an ihre Grenzen stoßen.
Erstmals geweckt wurde mein Interesse an kontrafaktischen Szenarien, als ich 1998 in der Sendung »Robin Day’s Book Talk« auf BBC News 24 an einer Fernsehdiskussion mit Antonia Fraser und Niall Ferguson teilnahm. Letzterer hatte soeben sein wegweisendes Buch Virtuelle Geschichte veröffentlicht. Von mir war gerade Fakten und Fiktionen erschienen, und das Konzept der kontrafaktischen Geschichte ließ die fundamentalen Fragen zu den Grenzen zwischen Fakten und Fiktionen, mit denen jenes Buch sich beschäftigt hatte, in einem neuen Licht erscheinen. Die Einladung, im Oktober 2002 die Butterfield Lecture an der Queen’s University in Belfast zu halten, war eine gute Gelegenheit, eine eingehendere Auseinandersetzung mit jenen Fragen zu unternehmen. Eine überarbeitete Fassung dieser Vorlesung erschien unter dem Titel »Telling It Like It Wasn’t« im BBC History Magazine (Nr. 3, 2002, S. 2–4) und wurde später in der amerikanischen Zeitschrift Historically Speaking abgedruckt (Ausgabe 5/4, März 2004), wo sie zum Gegenstand mehrerer engagierter und umfangreicher Artikel wurde; eine Antwort darauf erschien in derselben Ausgabe (S. 28–31). Der gesamte Gedankenaustausch ist abgedruckt in: Donald A. Yerxa, Recent Themes in Historical Thinking: Historians in Conversation, Columbia 2008, S. 120–130.
An der Reaktion von Geoffrey Parker und Philip Tetlock in Historically Speaking, sowie an den ausgefeilteren Argumenten, die sie in Einleitung und Schluss ihres zwei Jahre später erschienenen Sammelbandes mit kontrafaktischen Szenarien, Unmaking the West, vorbrachten, wurde deutlich, dass der Anspruch der Anhänger kontrafaktischer Geschichte noch einmal überdacht werden sollte. Außerdem gibt es mittlerweile mehrere theoretische, nachdenkliche Auseinandersetzungen mit den von kontrafaktischer Geschichte aufgeworfenen Problemen, deren Spektrum von heftiger Kritik bis umsichtiger Rechtfertigung reicht. Dadurch wurde die Debatte auf eine neue Ebene gehoben. Als mir daher von der Historical Society of Israel, einer unabhängigen Organisation, deren Geschichte weit in die 1930er Jahre zurückgeht, die Einladung zukam, 2013 die Menahem Stern Jerusalem Lectures zu einem Thema von historischem Interesse mit besonderem Schwerpunkt auf dessen methodische und theoretische Aspekte abzuhalten, war das ein willkommener Anlass, die Auseinandersetzung mit der kontrafaktischen Geschichte erneut zu intensivieren. Das Ergebnis ist das vorliegende Buch.
Den ersten Dank schulde ich der Historical Society of Israel, ihrem Vorsitzenden, Professor Israel Bartel, ihrem Geschäftsführer, Herrn Zvi Yekutiel, und ihrem Vorstand, für die große Ehre, die sie mir mit der Einladung nach Jerusalem erwiesen haben. In die Fußstapfen von Historikern wie Carlo Ginzburg, Anthony Grafton, Emmanuel Le Roy Ladurie, Fergus Millar, Natalie Zemon Davis, Anthony Smith, Peter Brown, Jürgen Kocka, Keith Thomas, Heinz Schilling, Hans-Ulrich Wehler und Patrick Geary zu treten ist eine ehrenvolle Aufgabe; erleichtert wurde sie mir von Maayan Avineri-Rebhun, der wissenschaftlichen Sekretärin der Historical Society, die mit mustergültiger Liebenswürdigkeit und Effizienz alles arrangiert hat. Die Unterstützung durch Tovi Weiss war unbezahlbar, und die Mitarbeiter des Gästehauses und Kulturzentrums Mishkenot Sha’ananim, das von seinem erhöhten Standort einen Blick auf die Mauern der Jerusalemer Altstadt gewährt, waren ausnahmslos sehr zuvorkommend. Die geduldigen Zuhörer haben mit ihren Fragen zur Verbesserung der Argumente in diesem Buch beigetragen. Otto Dov Kulka hat mich nicht nur auf die Gedanken von Johan Huizinga zu diesem Thema aufmerksam gemacht, sondern erwies sich auf unseren Ausflügen in und um Jerusalem auch als herzlicher und stimulierender Gastgeber, und Ya’ad Biran hat uns kenntnisreich die faszinierenden Sehenswürdigkeiten innerhalb der Stadtmauern erläutert. Professor Yosef Kaplan, Herausgeber der Buchreihe zu den Stern Lectures, hat die Publikation meiner Vorlesungen vorangetrieben. Mein Agent Andrew Wylie und seine Mitarbeiter, allen voran James Pullen vom Londoner Büro der Agentur, haben viel geleistet, damit das Buch unter Bedingungen erscheinen konnte, die ihm hoffentlich eine breite Leserschaft sichern werden. Die Mitarbeiter der Brandeis University Press arbeiteten ebenso gründlich wie professionell; besonders dankbar bin ich Richard Pult und Susan Abel, die den Produktionsprozess überwacht haben, Cannon Labrie für das hervorragende Lektorat, sowie Tim Whiting von Little, Brown, für seine Arbeit an der Ausgabe für Großbritannien und den Commonwealth. Simon Blackburn, Christian Goeschel, Rachel Hoffman, David Motadel, Pernille Røge und Astrid Swenson haben innerhalb kürzester Zeit das Manuskript gelesen und viele Verbesserungen vorgeschlagen. Christine L. Corton hat mit geschultem Auge die Fahnen korrekturgelesen. Ihnen allen bin ich zu Dank verpflichtet; die Verantwortung für das Folgende liegt jedoch einzig bei mir.
Richard J. EvansCambridge, Juli 2013
KAPITEL 1 WUNSCHDENKEN
Was wäre gewesen, wenn? Was, wenn Hitler 1930 bei einem Autounfall gestorben wäre: Wären die Nationalsozialisten trotzdem an die Macht gekommen, hätte der Zweite Weltkrieg stattgefunden, wären sechs Millionen Juden vernichtet worden? Was, wenn im 18. Jahrhundert in Amerika keine Revolution ausgebrochen wäre: Wäre die Sklaverei dann früher abgeschafft, der Amerikanische Bürgerkrieg von 1860–65 verhindert worden? Was, wenn es die Balfour Declaration nie gegeben hätte: Wäre der Staat Israel je gegründet worden? Was, wenn Lenin nicht im Alter von 53 Jahren gestorben wäre, sondern zwanzig Jahre länger gelebt hätte: Wäre es dann zu den blutigen Grausamkeiten der Stalinzeit nie gekommen? Was, wenn im Jahre 1588 der Spanischen Armada die Invasion und Eroberung Englands gelungen wäre: Wäre England dann wieder katholisch geworden, und wenn ja, welche Auswirkungen hätte das auf die englische Kunst, Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft gehabt? Was, wenn Al Gore 2000 die amerikanischen Präsidentschaftswahlen gewonnen hätte: Hätte der Irakkrieg trotzdem stattgefunden? Was, wenn Napoleon – wie Victor Hugo in seinem Opus Magnum Les Misérables ausgiebig spekulierte – die Schlacht bei Waterloo gewonnen hätte? Denn wie um alles in der Welt, fragte der Romancier verblüfft, war es möglich, dass er verloren hat?2 Dinge, die geschehen sind, schrieb James Joyce in Ulysses, »sind nicht fortzudenken. Die Zeit hat sie unauslöschlich gezeichnet, und gefesselt sind sie nun untergebracht im Raum der unbegrenzten Möglichkeiten, die sie ungenutzt gelassen haben. Aber können die denn überhaupt möglich gewesen sein angesichts dessen, dass sie niemals waren? Oder war allein das möglich, was sich auch wirklich begab?«3
Die Frage, was hätte geschehen können, hat Historiker schon immer fasziniert. Lange glich diese Faszination jedoch, wie E. H. Carr unter der Überschrift Was ist Geschichte? 1961 in seinen Trevelyan Lectures in Cambridge feststellte, der eines unterhaltsamen Gesellschaftsspiels, einer amüsanten Spekulation von der Art, über die Blaise Pascal sich vor Jahrhunderten auf unnachahmliche Weise lustig machte, als er fragte: Was wäre geschehen, wenn Kleopatra eine kleinere Nase gehabt hätte, also nicht schön gewesen wäre und auf Mark Anton keine so verhängnisvolle Anziehungskraft ausgeübt hätte, so dass dieser nicht von seinen Vorbereitungen, Oktavian zu besiegen, abgelenkt worden wäre – und die Schlacht bei Actium gewonnen hätte? Wäre das Römische Weltreich dann nie entstanden?4 Höchstwahrscheinlich schon, wenn auch möglicherweise auf andere Weise und zu einem etwas anderen Zeitpunkt. Es waren größere Kräfte am Werk als die Verliebtheit eines einzigen Mannes. Auf eine vergleichbare satirische Absicht stößt man im 18. Jahrhundert in populären Geschichten wie dem 1732 in Paris veröffentlichten und wenig später ins Englische übersetzten Buch Les Aventures de M. Robert Chevalier, einem Gedankenspiel, in dem die amerikanischen Ureinwohner Europa entdecken und so Kolumbus zuvorkommen.5 Berühmt schließlich die Passage, in der Edward Gibbon sich in seiner Geschichte vom Niedergang und Verfall des Römischen Reiches über die Universität lustig macht, in der er die nach eigener Aussage langweiligsten und sinnlosesten Jahre seines Lebens zugebracht hatte: Wenn Karl Martell die Mauren 733 nicht besiegt hätte, so Gibbon, hätte der Islam vielleicht die Vorherrschaft in Europa erlangt, »an Universitäten wie Oxford würde möglicherweise die Auslegung des Korans gelehrt, und von ihren Kanzeln würde einem beschnittenem Volk die Heiligkeit und Wahrheit der Offenbarung des Mohammed verkündet.«6 Offensichtlich war Gibbon der Auffassung, dass sich letzten Endes, mutatis mutandis, zumindest was Oxford betraf, nicht sonderlich viel geändert hätte.
Kurze, verstreute Andeutungen von Alternativen zum tatsächlich Geschehenen finden sich in den Werken einer Vielzahl von Autoren aus allen Jahrhunderten, von den Spekulationen des römischen Historikers Livius, was passiert wäre, wenn Alexander der Große Rom erobert hätte, bis zur Phantasieerzählung Tirant lo Blanc von Joanot Martorelli und Martí Joan de Galba aus dem Jahr 1490 über eine Welt, in der das Byzantinische das Osmanische Reich besiegt hat und nicht umgekehrt. Wenige Jahrzehnte nach der tatsächlichen Eroberung Konstantinopels durch die Türken entstanden, war diese Phantasiegeschichte die erste ihrer Art und unverkennbar von Wunschdenken geprägt. Lange blieb sie jedoch ohne echte Nachahmer. Eine notwendige Vorbedingung dafür, nicht nur in fiktionalen, sondern auch in historiographischen Werken über mögliche Alternativen zum Geschehenen nachzudenken, war ein rationalistischer Ansatz wie der Gibbons, der eine Sichtweise ablöste, die die Geschichte der Menschheit als Resultat des Waltens der Göttlichen Vorsehung auf Erden betrachtete. Solange die Göttliche Vorsehung von Protestanten und Katholiken gleichermaßen für sich reklamiert werde, schrieb Isaac D’Israeli 1835 in der ersten Bearbeitung dieses Themas, seinem kurzen Aufsatz über die »Geschichte von Ereignissen, die nie passiert sind«, könne diese den neutralen Betrachter kaum überzeugen. Diese Erkenntnis war nicht neu, doch D’Israeli versuchte sie zu untermauern, indem er eine Reihe historischer Texte aufzählte, die (wenn auch zumeist nur kurze) Spekulationen darüber anstellten, was passiert wäre, wenn beispielsweise Karl Martell den Mauren unterlegen, die Spanische Armada in England gelandet oder Charles I. nicht hingerichtet worden wäre. Alles worauf D’Israeli hinauswollte war, dass Historiker die Idee der »Vorsehung« seiner Meinung nach durch die Konzepte »Unabwendbarkeit« und »Zufall« ersetzen sollten.7 Bevor derartigen Spekulationen breiter Raum zugebilligt werden konnte, war noch ein weiterer Schritt vonnöten. Wie andere Historiker zur Zeit der Aufklärung betrachtete Gibbon Zeit noch als einförmig und die menschliche Gesellschaft als statisch: seine römischen Senatoren kann man sich leicht als Perücken tragende Gentlemen des 18. Jahrhunderts bei einer Debatte im Unterhaus vorstellen, und die Charaktereigenschaften, die sie an den Tag legten, unterschieden sich kaum von denen, die Gibbon bei seinen Zeitgenossen antraf. Ehe die Frage gestellt werden konnte, inwiefern die grundlegenden Wesenszüge einer Epoche völlig unterschiedlich ausfallen hätten können, wenn die Geschichte einen anderen Verlauf genommen hätte, bedurfte es der neuen, romantischen Sichtweise, wie der Romanautor Walter Scott und sein historiographischer Schüler Leopold von Ranke sie einnahmen, derzufolge die Vergangenheit sich grundsätzlich von der Gegenwart unterscheidet.8
Wie nicht anders zu erwarten, war der Erste, der diese Idee ausführlich in die Tat umsetzte, ein französischer Bewunderer von Kaiser Napoleon: Louis Geoffroy. Schließlich verbrachte der Kaiser selbst einen guten Teil seiner Zeit auf St. Helena, dem Ort seines Exils nach seiner Niederlage bei Waterloo, mit Träumereien, wie er seine Feinde hätte besiegen können. Hätten die Russen Moskau nicht in Brand gesteckt, als die Grande Armée sich 1812 ihren Toren näherte, seufzte er, hätten seine Streitkräfte dort überwintern können, und dann, »sobald das Wetter sich wieder gebessert hätte, hätte ich meine Feinde angegriffen; ich hätte sie besiegt; ich wäre Herrscher über ihre Reiche geworden […] denn ich hätte gegen Männer und Waffen gekämpft, nicht gegen die Natur.« Es war die Geburtsstunde der Legende, Napoleon sei von »General Winter« besiegt worden.9 Geoffroy hielt es nicht für notwendig, die Flammen in Moskau zu löschen. Stattdessen ließ er den Kaiser in seinen »Napoleon-Apokryphen« von 1836 nach Norden marschieren, Richtung St. Petersburg, die russische Armee vernichtend schlagen, Zar Alexander I. gefangen nehmen und Schweden besetzen. Nachdem er das Königreich Polen wiederhergestellt und die Eroberung Spaniens abgeschlossen hat, startet er an der englischen Ostküste nördlich von Yarmouth eine Invasion und pulverisiert in der Schlacht von Cambridge eine unter dem Kommando des Duke of York stehende, 230 000 Mann starke englische Armee. England wird Frankreich angegliedert und in 22 französische Départements aufgeteilt. 1817 ist Preußen von der Landkarte getilgt, und vier Jahre später besiegt Napoleon in Palästina eine große muslimische Streitmacht, besetzt Jerusalem, zerstört sämtliche Moscheen in der Stadt und nimmt den schwarzen Stein aus der Ruine des Felsendoms mit zurück nach Paris.10
Damit sind seine Erfolge jedoch keineswegs zu Ende, denn wenig später erobert Napoleon Asien einschließlich China und Japan, wo er alle Heiligtümer anderer Religionen zerstört, erlangt die Hegemonie über Afrika und bringt, nachdem er auf einem 1827 in Panama abgehaltenen Kongress von sämtlichen nord- und südamerikanischen Staatshäuptern dazu aufgefordert worden ist, Amerika unter französische Kontrolle. In seiner Antrittsrede als »Weltherrscher« verkündet Napoleon, seine universelle Monarchie werde »in meinem Geschlecht vererbt, und von jetzt an wird es auf dem Globus bis zum Ende der Zeiten nur eine Nation und eine Macht geben […]. Das Christentum ist die einzige Religion auf Erden.« Mit dem neuen, vom Papst verliehenen Titel »Eure Allmacht« gerüstet, findet er sogar erneut das häusliche Glück, denn der Tod seiner österreichischen Gemahlin, die er nur aus politischen Gründen geheiratet hat, ermöglicht es ihm, seine geliebte Joséphine zu ehelichen.
Als er schließlich 1832 stirbt, hat er mehr erreicht als jeder andere Staatsmann oder General der Geschichte. Er ist alles andere als ein rücksichtsloser Diktator gewesen, hat die Legislative erhalten und sich als liberaler und friedliebender Monarch erwiesen. Wie das Zusammenfallen des Sieges Frankreichs mit dem Sieg des Christentums andeutet, geht all das in erster Linie auf das Walten der Göttlichen Vorsehung zurück, und zumindest in dieser Hinsicht war Geoffroys Ansatz ziemlich altmodisch. Auch wohnte ihm ein starkes Element von historischer, oder vielleicht besser pseudohistorischer Zwangsläufigkeit inne: eine einzige Veränderung des Laufs der Geschichte, in Moskau, führte unaufhaltsam zu einer ellenlangen Kette von Ereignissen, die ohne jede Möglichkeit der Abweichung oder Rückgängigmachung aus ihr folgten, ja schließlich gar zum Ende der Geschichte, wie Napoleon in seiner Antrittsrede als Weltherrscher verkündet. So weit ging nicht einmal Victor Hugo, der in Les Misérables argumentierte, die Göttliche Vorsehung habe bestimmt, dass in der Geschichte für einen Giganten wie Napoleon kein Platz mehr sei, so dass Waterloo, wo sich der nüchterne, phantasielose Charakter des langweiligen Militärstrategen Wellington gegenüber dem Genie Napoleons als siegreich erwiesen hatte, in einem weiteren Sinn einen deutlichen Wendepunkt in der Weltgeschichte markiere als lediglich im Hinblick auf das Ende des militärischen Ruhms Frankreichs.11
Natürlich hatte in Wirklichkeit die Vorsehung, wie Geoffroy wohlbekannt war, entschieden, dass Napoleon nicht die Welt beherrschen sollte, und Geoffroy erinnert den Leser mehrfach an diese Tatsache, etwa wenn er eine skurrile alternative Geschichte erwähnt, derzufolge Napoleon die Schlacht bei Waterloo verliert und ins Exil auf St. Helena geschickt wird, oder wenn er Napoleon nach der Eroberung Asiens an Bord eines Schiffes im Südatlantik St. Helena ausmachen lässt, ein Anblick, der ihm einen Schauer über den Rücken jagt und ihn für einen Moment den Blick über den Tellerrand seiner fiktiven Existenz hinaus auf die Realität richten lässt, die ihn tatsächlich umgibt. Der Leser wusste, dass Napoleon in Wirklichkeit vor Moskau besiegt worden war und dass die Russen 1812 genau deshalb Sieger geblieben waren, weil sie sich geweigert hatten, sich dem französischen Kaiser in einer offenen Schlacht zu stellen. Doch trotz all dieser Schwächen: das Buch Geoffroys stellt jedenfalls die erste deutlich erkennbare, ausführliche spekulative alternative Geschichte dar, und es erschien zu einem Zeitpunkt, Mitte der 1830er Jahre, als der Mythos Napoleon seinen Höhenflug antrat, um eineinhalb Jahrzehnte später mit den Ereignissen nach der Revolution von 1848, vor allem dem Staatsstreich Louis Napoleons und seiner Annahme des Titels »Kaiser Napoleon III.«, seinen großen Triumph zu feiern. Was für Pascal oder Gibbon nur ein Spiel gewesen, war hier handfesten politischen Absichten gewichen. Geoffroy war niemand anders als der Adoptivsohn Napoleons I. Er war von diesem unter seine Fittiche genommen worden, nachdem sein leiblicher Vater in der Schlacht bei Austerlitz gefallen war, und sein Vorname war in Wirklichkeit nicht Louis, sondern Louis-Napoléon. Demungeachtet büßte das Buch durch das gesamte 19. und bis ins 20. Jahrhundert hinein nichts an Faszination und Anziehungskraft ein und erlebte – damit die Franzosen nicht vergaßen, wie es auch hätte kommen können – zahlreiche Neuauflagen. Sein Erfolg war so nachhaltig, dass Robert Aron ihm 1937 eine Darstellung entgegensetzte, in der Napoleon die Schlacht bei Waterloo gewinnt, danach jedoch zu dem Schluss kommt, dass Krieg und Eroberung voll Übel sind, abdankt und trotzdem (allerdings freiwillig) ins Exil auf St. Helena geht – und somit seine »innere Größe« und seine »Einsicht in die Notwendigkeit« unter Beweis stellt.12
Geoffroys Darstellung war ohne Zweifel Wunschdenken reinsten Wassers. Ihre methodische Prämisse wurde zwanzig Jahre später, 1857, vom Philosophen Charles Renouvier in einer später in Buchform veröffentlichten Serie von Artikeln aufgegriffen und systematisiert. Renouvier gab ihr den Namen, unter dem sie seither im Französischen und Deutschen bekannt ist: Uchronie. »Der Autor produziert eine Uchronie, eine Utopie der Vergangenheit. Er schreibt Geschichte nicht so, wie sie gewesen ist, sondern wie sie gewesen sein könnte.«13 Ehrlicher wäre gewesen, Renouvier hätte geschrieben: »wie sie sein hätte sollen«. Er selbst verfolgte einen dezidiert politischen Ansatz. Er beschrieb seine Methode mit Hilfe eines Diagramms, das unterschiedliche Stadien zeigte, angefangen bei jenem Moment, in dem die erfundene Geschichte erstmals von der tatsächlichen abweicht, dem point de scission, der zur première déviation führt. Während der imaginäre Verlauf der Geschichte (trajectoire imaginaire) aus einer einzigen Linie besteht, die sich ohne Abweichungen in die imaginäre Zukunft erstreckt, zweigt der tatsächliche Verlauf (trajectoire réelle) immer wieder in kurze Linien ab, die in einer Sackgasse enden und nur dadurch miteinander verbunden werden können, dass man sie wieder mit der Hauptlinie des imaginären Verlaufs verbindet. Das Entscheidende ist der Winkel, in dem der imaginäre Verlauf vom realen abzweigt, und der, so Renouvier, hänge davon ab, welches Ziel der Autor verfolge.14 Im Falle Renouviers besteht das Ziel darin, die Sache der Freiheit voranzubringen, indem man sie mittels einer imaginären Vergangenheit verwirklicht. Zur Illustration liefert er eine Chronik der Religionsgeschichte seit den Römern unter Bezug auf das Prinzip der Toleranz.
Nach einer Beschreibung der Ausgangslage (die Intoleranz der Römer gegenüber dem Judentum – die er auf für französische Antisemiten Mitte des 19. Jahrhunderts nicht untypische Weise rechtfertigt, indem er die Juden als religiöse Fanatiker bezeichnet, die von der »Weltherrschaft« träumten –, und eine ähnliche Intoleranz gegenüber dem frühen Christentum), lanciert er die première déviation, indem er den römischen Kaiser Mark Aurel auf einem seiner Feldzüge irrtümlicherweise für tot erklären lässt, woraufhin dieser vom General Avidius Cassius abgelöst wird, einem Anhänger der Römischen Republik. Später startet Cassius gemeinsam mit dem auf den Thron zurückgekehrten Mark Aurel ein Reformprogramm, das zur Ablösung der Klasse der Sklaven durch ein freies Bauerntum und schließlich, nach vielen Umwegen, im Weströmischen Reich zur Entstehung einer Staatsreligion führt, die auf Hausgöttern beruht, aber andere Religionen toleriert. Im Osten dagegen setzt sich ein fanatisches orthodoxes Christentum durch, so dass es zu Kreuzzügen kommt – nicht gegen Jerusalem, sondern gegen Rom, dessen Einwohner von einer Streitmacht aus 400 000 eklatant intoleranten Kreuzrittern aus dem Osten zu dem bekehrt werden sollen, was diese für die wahre Lehre Jesu halten. Glücklicherweise schlägt dieses Ansinnen jedoch fehl, weil sie sich aufgrund von Streitigkeiten über den Inhalt dieser »wahren Lehre« alsbald gegenseitig bekämpfen. Durch das von der Intoleranz ausgelöste politische Chaos unterliegt der Osten den Barbaren, wohingegen der tolerante Stoizismus des Westens die Unabhängigkeitserklärungen der Gallier, Briten, Spanier und so weiter überlebt. Letztere schließen sich, unbelastet von religiösen Differenzen, zu einem Bund unabhängiger europäischer Staaten zusammen. Auch im Osten führen die siegreichen Barbaren das Christentum wieder ein, aber in reformierter Form, ohne Beichte, ohne Fegefeuer, ohne Klöster, und generell ohne das Brimborium des Katholizismus oder der Orthodoxie. Hier wie dort florieren Wissenschaft und Gelehrsamkeit, und am Ende appelliert Renouvier an die Menschheit, einen Völkerbund und einen internationalen Strafgerichtshof zu gründen. Indem er dieser harmonischen Geschichte in einer Reihe von Anhängen das gegenüberstellte, was er als die inhumanen und freiheitsfeindlichen Verwüstungen des Katholizismus im Lauf der Jahrhunderte betrachtete, betonte Renouvier den Kontrast zwischen idealer und realer Geschichte. Letztere erhält seiner Ansicht nach erst durch Erstere ihre Bedeutung, und nicht zufällig wird das Buch als Übersetzung eines alten Manuskripts vorgestellt, das eine Familie verfolgter religiöser Nonkonformisten aufbewahrt habe, um die Erinnerung daran wachzuhalten, dass die Dinge auch anders liegen könnten und um ein Haar alles besser gekommen wäre.15
Weder der kurze, in einem obskuren Pariser Verlag auf Englisch erschienene Essay D’Israelis, noch Geoffroys verwegene napoleonische Phantasieerzählung, so populär sie bei Teilen der französischen Leserschaft auch gewesen sein mag, noch die schwer zugängliche, argumentativ dichte antiklerikale philosophische Abhandlung Renouviers lösten einen Trend hin zu Spekulationen über unterschiedliche Wege aus, die die Geschichte hätte einschlagen können. Weiterhin erschienen nur sporadisch neue Beiträge zu diesem Genre, wie zum Beispiel der Essay »If Napoleon Had Won the Battle of Waterloo«, den der britische Historiker G. M. Trevelyan für einen 1907 von der Westminster Gazette ausgelobten Wettbewerb schrieb. Hätte Napoleon die Schlacht bei Waterloo gewonnen, so Trevelyan in Anknüpfung an die Spekulationen von Victor Hugo, so wären die Briten gezwungen gewesen, Frieden zu schließen, und unter der Ägide des erzkonservativen Lord Castlereagh hätten sich die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen (trotz eines von Lord Byron angeführten Arbeiteraufstands, der niedergeschlagen und der adlige Dichter hingerichtet worden wäre) verschlechtert. Liberale Briten wären nach Lateinamerika geflohen, wo die reaktionäre britische Regierung im Bündnis mit Spanien für die Sicherung der spanischen Kolonien gekämpft hätte, während auf dem europäischen Kontinent das Ancien Régime trotz des Einflusses von Napoleon weiterhin auf unreformierten, aufklärungsfeindlichen Pfaden gewandelt wäre. Napoleon hätte sich ganz und gar nicht angeschickt, die Welt zu erobern; angesichts der Kriegsmüdigkeit, die nach zwei Jahrzehnten, in denen sich ein bewaffneter Konflikt an den anderen gereiht hatte, in Frankreich und Europa insgesamt herrschte, hätte er vielmehr beschlossen, dass das Maß voll war, und sich friedlich zur Ruhe gesetzt. In diesem Szenario stirbt Napoleon schließlich, während er über einen neuen Krieg mit dem Ziel der Einigung Italiens nachdenkt – einen Krieg, zu dem es nicht mehr kommt.16
Trevelyan war ein begeisterter Anhänger der italienischen Einigung und schrieb drei umfangreiche Bände über deren Held, Giuseppe Garibaldi. Politisch war er ein engagierter Liberaler, genau wie sein Großonkel Lord Macaulay, der 1832 zu den lautstärksten Befürwortern einer Ausdehnung des Wahlrechts gehörte. Trevelyans Darstellung der Ereignisse nach einem angenommenen Sieg Napoleons bei Waterloo hat mit Wunschdenken denkbar wenig zu tun. Es handelt sich vielmehr um eine düstere Geschichte, die veranschaulicht, wie schlimm es hätte kommen können, und damit implizit betont, wie Waterloo, trotz einer vorübergehenden Welle der politischen Repression und der wirtschaftlichen Not, durch die Beendigung der Tyrannenherrschaft des französischen Kaisers die Grundlage für die vielfältigen Triumphe des Liberalismus im 19. Jahrhundert gelegt hat. Tatsächlich war all das, wie Trevelyan sehr wohl bewusst war, natürlich wenig plausibel, denn eine Niederlage der vom Duke of Wellington kommandierten Armeen 1815 hätte nicht unbedingt das Ende des Krieges bedeutet. Die Alliierten hätten sich neu formieren und weiterkämpfen können, bis Napoleon schließlich besiegt gewesen wäre – schließlich überstiegen ihre Ressourcen zu diesem Zeitpunkt die der erschöpften Franzosen bei weitem. Auch hier haben wir es also mit einer alternativen Geschichte zu tun, die in erster Linie auf politischen Motiven und Überzeugungen beruhte.17
In ihrer Funktion als unterhaltsamer Zeitvertreib waren kontrafaktische Szenarien allerdings alles andere als tot. 1932 erschien, herausgegeben von Sir John Collings Squire, unter dem Titel If It Had Happened Otherwise die erste Sammlung mit Aufsätzen dieses Genres; darin war auch der Aufsatz von Trevelyan über Waterloo erneut abgedruckt. Squire war ein konservativer Literaturkritiker und Dichter, der in den 1930er Jahren mit der British Union of Fascists sympathisierte und ein unverbesserlicher Gegner des literarischen Modernismus war. Er stellte sich gerne als Bier trinkender, Cricket spielender englischer Gentleman dar, der seinem Nachnamen (zu dt. »Gutsherr«) alle Ehre mache – Virginia Woolf und die Bloomsbury Group pflegten ihn und seinen Zirkel als »Squirarchie« zu bezeichnen –, und viele seiner Veröffentlichungen waren heiter und humorvoll.18 In diese Kategorie fiel auch If It Had Happened Otherwise. Die Beiträge stammten überwiegend von Literaten (Frauen waren nicht vertreten). Viele kehrten auf unterhaltsame und effektvolle Weise den Gang der Geschichte um: Der bekannte Historiker Philip Guedalla machte sich einen Spaß daraus, sich die Rolle des Islam in Europa auszumalen, wenn es den Mauren 1492 gelungen wäre, den Versuch ihrer Vertreibung aus Spanien zu vereiteln,19 und der Diplomat Harold Nicolson stellte sich Lord Byron genüsslich als griechischen König vor. Politischer war der Beitrag von Monsignor Ronald Knox, der in düsteren Farben ausmalte, was sich in Großbritannien zugetragen hätte, wenn der Generalstreik von 1926 erfolgreich gewesen wäre. Von Gewerkschaften und linken Sozialisten beherrscht, hätte das Land eine ähnliche Entwicklung durchgemacht wie das sowjetische Russland: Die Bildungs- und Meinungsfreiheit wären unterdrückt und alles vom Staat kontrolliert worden. Knox’ Aufsatz ist ein weiteres Beispiel für die dystopische Spielart der alternativen Geschichte, wie sie Jahre zuvor Trevelyan praktiziert hatte.
Doch nicht wenige der Autoren in Squires Sammelband ergriffen die Gelegenheit beim Schopf, ausgiebig in höchst nostalgischem Wunschdenken zu schwelgen. Was wäre geschehen, fragte sich G. K. Chesterton in seiner »kleinen literarischen Phantasie«20, wenn Ritter Johann von Österreich Maria Stuart geheiratet hätte – England also, ebenso wie der Autor, katholisch geblieben wäre? (Der Fortschritt in Großbritannien und Europa wäre beschleunigt worden.) Wäre Louis XVI. mutiger gewesen, mutmaßte der französische Schriftsteller André Maurois, so hätte die Französische Revolution nie stattgefunden und Frankreich wäre wie Großbritannien eine konstitutionelle Monarchie geworden. Wäre der liberal gesinnte Deutsche Kaiser Friedrich III. 1888 nicht nach wenigen Monaten der Regentschaft an Krebs gestorben, glaubte der deutsche Populärhistoriker und Biograph Emil Ludwig, so wäre Deutschland eine parlamentarische Demokratie geworden, anstatt der autoritäre Staat zu bleiben, der 1914 mit so katastrophalen Folgen für Deutschland, Europa und die ganze Welt in den Krieg zog. Sir Charles Petrie, ein weiterer konservativer Historiker, der den britischen Faschisten nahestand (allerdings stets gegen die Nationalsozialisten war), war der Auffassung, dass es für Großbritannien (insbesondere für das literarische und kulturelle Leben) besser gewesen wäre, wenn Bonnie Prince Charlie den Hannoveranern 1745 erfolgreich die englische Krone entrissen hätte. Und Winston Churchill argumentierte, hätte General Lee die Schlacht von Gettysburg gewonnen, hätte das letztlich zur Vereinigung der englischsprachigen Völker geführt – eine Idee, die er als Sohn eines englischen Vaters und einer amerikanischen Mutter gewissermaßen selbst verkörperte. Dass ein erheblicher Teil der Essays in diesem Band von Nostalgie und Bedauern über historische Fehlentwicklungen durchzogen war, machte sie zu mehr als einem bloßen literarischen Zeitvertreib. Dieses Merkmal von »Was wäre gewesen, wenn«-Geschichten sollte sich Jahrzehnte später erneut Bahn brechen, vehementer denn je.