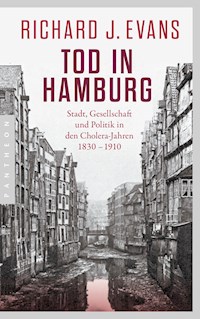
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Richard Evans' brillante Studie über den Cholera-Ausbruch in Hamburg im 19. Jahrhundert
Sie überfiel ihre Opfer jäh und ohne Vorwarnung, die Symptome erregten allgemeines Entsetzen, das Ende kam schnell und unter Qualen: 1892 wütete eine Cholera-Epidemie in Hamburg, 10.000 Menschen starben binnen 6 Wochen. In seinem scharfsinnigen Werk zeichnet Richard J. Evans ein lebendiges Bild der Stadt und ihrer Menschen im Griff der Seuche und untersucht die Gründe, warum Hamburg als einzige große europäische Stadt Schauplatz dieser Tragödie wurde. Er zeigt, dass es eine Verknüpfung politischer, ökonomischer, sozialer und medizinischer Bedingungen war, die einer eigentlich schon ausgerotteten Krankheit noch einmal Tür und Tor öffneten. Mit einem aktuellen Vorwort des Autors, das den Vergleich zwischen der damaligen Epidemie und der heutigen Situation mit SARS-CoV-2 zieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1394
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sie überfiel ihre Opfer jäh und ohne Vorwarnung, die Symptome erregten allgemeines Entsetzen, das Ende kam schnell und unter Qualen: 1892 wütete eine Cholera-Epidemie in Hamburg, 10 000 Menschen starben binnen sechs Wochen. In seinem scharfsinnigen Werk zeichnet Richard J. Evans ein lebendiges Bild der Stadt und ihrer Menschen im Griff der Seuche und untersucht die Gründe, warum Hamburg als einzige große europäische Stadt Schauplatz dieser Tragödie wurde. Er zeigt, dass es eine Verknüpfung politischer, ökonomischer, sozialer und medizinischer Bedingungen war, die einer eigentlich schon ausgerotteten Krankheit noch einmal Tür und Tor öffnete. Mit einem aktuellen Vorwort des Autors, das den Vergleich zwischen der damaligen Epidemie und der heutigen Situation mit SARS-CoV-2 zieht.
Richard J. Evans, geboren 1947, war Professor of Modern History von 1998 bis 2008 und Regius Professor of History von 2008 bis 2014 an der Cambridge University. Seine Publikationen zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und zum Nationalsozialismus waren bahnbrechend. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Wolfson Literary Award for History und die Medaille für Kunst und Wissenschaft der Hansestadt Hamburg. 2012 wurde Evans von Queen Elizabeth II. zum Ritter ernannt. Zuletzt sind von ihm bei DVA erschienen «Das europäische Jahrhundert. Ein Kontinent im Umbruch – 1815–1914» (2018) und «Das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien. Wer sie in die Welt gesetzt hat und wem sie nutzen – Von den ‹Protokollen der Weisen von Zion› bis zu Hitlers Flucht aus dem Bunker» (2021).
Richard J. Evans
TOD IN HAMBURG
Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830–1910
Aus dem Englischen von Karl A. Klewer
Pantheon
Die Originalausgabe erschien 1987 unter dem Titel «Death in Hamburg. Society and Politics in the Cholera-Years 1830–1910» bei Oxford University Press, Oxford.
Dieses Buch ist – außer dem neuen Vorwort des Autors – durchgehend in alter Rechtschreibung gehalten.
Die hier genannten Archive sind die der Entstehungszeit des Buchs in den 1980er Jahren. Einige Archive sind seither umgezogen oder wurden umbenannt.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by Pantheon Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
«Death in Hamburg» © 1987 by Richard J. Evans
Redaktion: Wolfgang Müller
Wissenschaftliche Beratung in Übersetzungsfragen: Volker Ullrich
Covergestaltung: Jorge Schmidt, München
Coverabbildung: Hamburger Fleete: Die Herrengrabenfleet bei Ebbe (Staatliche Landesbildstelle Hamburg)
Satz und E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-29028-3V001
www.pantheon-verlag.de
Für die Freunde von gestern und heute, mit denen ich das Leben in Hamburg genossen habe.
INHALT
Vorwort des Autors zur Neuausgabe 2022
Vorwort
1. Innenansicht einer Handelsstadt
Patrizier und Politik
Fraktionen des Kapitals
Ungleichheit im Alltag
Die Bedrohung von unten
2. Die Krise der städtischen Umwelt
Seife und Kultur
Die Ursachen der Verschmutzung
Trübe Wasser
Etwas anderes zu essen
3. Im Angesicht von Krankheit und Tod
Sterblichkeitsmuster
Die Ärzte am Scheideweg
Die Geißel aus Asien
Der Aufstieg des Bakterienreichs
4. Die große Epidemie
Vom Verschweigen zur Katastrophe
Die Kranken heilen
Angst und Panik
Die Suche nach den Schuldigen
5. Die Dimensionen der Ungleichheit
Reich und Arm
Vom Villenquartier zum Gängeviertel
Kaufmann und Kutscher
Männer und Frauen
6. Die Umgestaltung der Gesellschaft
Die Grenzen des Mitgefühls
Pettenkofers letztes Gefecht
Armut und der Staat
Hamburg, Deutschland und die Welt
Verzeichnis der Abkürzungen
Bibliographie
Anmerkungen
Verzeichnis der Karten
Verzeichnis der Abbildungen
Verzeichnis der Tabellen
Sachregister
Personenregister
Bildteil
Vorwort des Autors zur Neuausgabe 2022
Ob wir je aus den Fehlern der Geschichte lernen? Das vorliegende Buch, das 1987 auf Englisch und drei Jahre später auf Deutsch erschienen ist, wird dem deutschen Publikum nun erneut vorgelegt in der Überzeugung, dass wir dies können, wenn wir den darin gewonnen Erkenntnissen angemessene Aufmerksamkeit schenken. Zwar geht es in diesem Buch um eine verheerende Epidemie, die im Jahre 1892 eine einzelne norddeutsche Großstadt befallen hat, doch wirft es zugleich eine ganze Reihe weiterführender Fragen auf, die auch 130 Jahre später von erheblicher Bedeutung sind, in einer Zeit, in der die ganze Welt von einer katastrophalen Pandemie heimgesucht wird, die bereits Millionen Todesopfer gefordert hat und weitere Millionen Menschen treffen wird.
Es besteht kein Zweifel daran, dass die wissenschaftliche Medizin seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zahlreiche grundlegende Fortschritte gemacht hat. Bei Licht besehen war der lange herrschende Kampf zwischen den Anhängern der «Miasmentheorie» und den Verfechtern der «Kontagienlehre» 1892 schon entschieden. Nach Ansicht der einen riefen aus dem Boden aufsteigende unsichtbare Dämpfe (Miasmen) unter bestimmten klimatischen Bedingungen Krankheiten hervor, während sich nach Überzeugung der anderen Erreger in verseuchtem Trinkwasser befanden. Auch wenn die Vertreter der Kontagienlehre, an deren Spitze der hoch angesehene und einflussreiche Bakteriologe Robert Koch stand, den Streit für sich entschieden hatten, ließen einige Anhänger der Miasmentheorie nicht von ihrer Auffassung ab. Da ihre Stellung aus im Buch näher ausgeführten Gründen in Hamburg besonders stark war, hatte ihre Unbelehrbarkeit dort besonders unheilvolle Folgen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hingegen waren sich die Vertreter der wissenschaftlichen Medizin weithin sowohl über die Ursache von Infektionskrankheiten wie auch darüber einig, auf welche Weise man sie erkennen und bekämpfen konnte. Im 19. Jahrhundert benötigte man Jahre, mitunter sogar Jahrzehnte, bis man die Wirkmechanismen tödlich verlaufender Infektionskrankheiten wie Cholera, Tuberkulose oder Diphtherie begriff und Möglichkeiten fand, ihnen vorzubeugen oder Therapien gegen sie zu entwickeln. Heutzutage sind Medizinforscher in der Lage, den Vektor eines Virus zu isolieren, seine Genomstruktur mittels Sequenzierung zu identifizieren und binnen weniger Monate einen wirksamen Impfstoff herzustellen. Noch zügiger lassen sich Wege finden, die Ausbreitung eines Virus zu verhindern oder einzugrenzen.
Trotz dieser Fortschritte sind wir seit den Tagen der Hamburger Cholera-Epidemie in mancher Hinsicht nicht sehr viel weiter gekommen. Nach wie vor gibt es den automatischen Impuls, der sich im Fall des Hamburger Senats 1892 so katastrophal ausgewirkt hatte, aus Angst vor Beeinträchtigungen der Wirtschaft die Nachricht vom Ausbruch einer Epidemie zu unterdrücken. Auch die Regierung Chinas hat auf das Auftreten von Covid-19 in Wuhan anfangs mit einer vollständigen Mediensperre und der Bestrafung von Medizinern reagiert, die auf die Seuche aufmerksam machen wollten. Im Verlauf der durch das Coronavirus ausgelösten Pandemie hat der Widerstreit zwischen Wirtschaftsinteressen und Gesundheitspolitik das Handeln von Regierungen auf der ganzen Welt durchgehend bestimmt. Sicherlich beeinträchtigen die bewährten und generell wirksamen Maßnahmen zur Eindämmung von Seuchen heute wie damals zwangsläufig das Wirtschaftsleben und damit auch die Lebensbedingungen der Bevölkerung. Zu diesen Maßnahmen, die Robert Koch 1892 in Hamburg gegen den Widerstand des zögerlichen Senats durchgesetzt hat, gehören Isolierung von Infizierten und ihre Behandlung im Krankenhaus, Quarantäne und Lockdown sowie Beschränkungen der Reisefreiheit und des Handels. Was das angeht, haben einige Staaten inzwischen aus der Erfahrung gelernt und die wirksamsten dieser Maßnahmen unterstützt. Hier lässt sich ein deutlicher Gegensatz zur Situation im 19. Jahrhundert erkennen, denn damals waren es karitative Einrichtungen, auf denen die Hauptlast ruhte, sich um Arme und Arbeitslose zu sorgen.
Wie tief die Kluft zwischen den Schichten der Gesellschaft in Hamburg zur Zeit der Cholera-Epidemie von 1892 war, zeigt sich, wie in Kapitel 5 dargelegt wird, am krassen Unterschied zwischen Arm und Reich bei der Sterblichkeit infolge der Erkrankung. Bei Covid-19 verhält es sich nicht anders, und die Gründe dafür sind oft ähnlich, auch wenn es bedeutsame Unterschiede gibt. Während bei der Cholera-Epidemie das Entsetzen häufig daher rührte, dass ihr überwiegend junge Erwachsene zum Opfer fielen, die gewöhnlich den gesündesten Teil der Bevölkerung ausmachten, hat sich Covid-19, zumindest im Anfangsstadium der Pandemie, als besonders gefährlich für ältere Menschen erwiesen. Auch wenn das Coronavirus, ähnlich dem Tuberkulosebakterium, durch die Luft übertragen wird, der Cholerabazillus hingegen durch das Wasser, spielen überfüllte Wohnungen und ungesunde, beengte Lebensbedingungen eine bedeutende Rolle bei der Verbreitung der einen wie der anderen Krankheit. Die zur Vorbeugung erforderlichen Maßnahmen unterscheiden sich dagegen deutlich. Damit Tröpfchen und Aerosole das Coronavirus nicht übertragen, sollten die Menschen jederzeit einen angemessenen Abstand voneinander einhalten und in geschlossenen Räumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen; bei der Cholera hingegen bestand die wirksamste Vorbeugung darin, dass man sich nach der Zubereitung von rohem Gemüse und nach dem Toilettengang die Hände wusch. Das Händewaschen hat sich seit den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts als übliches Verhalten im Alltag durchgesetzt; es wird interessant sein zu sehen, inwieweit die Menschen nach dem Ende der gegenwärtigen Pandemie weiterhin Masken tragen und Abstand halten werden. Beide Seuchen waren ein Weckruf für die Einführung von Reformen mit dem Ziel, die beengten Wohnverhältnisse der Armen zu verbessern. Dass diese Reformen im Jahre 1892 letzten Endes äußerst geringfügig ausfielen, ist kein Grund, sie jetzt nicht durchzuführen.
Die Reaktionen des Staates auf die Epidemie bilden einen der Schwerpunkte dieses Buches, das deutlich macht, wie Vertreter wirtschaftlicher Interessengruppen entscheidende Reformen der Infrastruktur, insbesondere die Filtration von Trinkwasser in Hamburg, so lange behindert haben, bis es zu spät war. Der konservative Senat der Stadt hat sich in einen Konflikt mit den Verantwortlichen in Berlin verwickelt, aus dem letztere als eindeutige Sieger hervorgingen. Bemerkenswert an dieser Auseinandersetzung war, in welchem Ausmaß beide Seiten auf die Ansichten von Medizinwissenschaftlern angewiesen waren. Letzten Endes setzte sich Robert Koch durch, nicht zuletzt, weil sich die von ihm aufgrund seines naturwissenschaftlich untermauerten Verständnisses der Cholera vorgeschlagenen Maßnahmen als wirksam erwiesen und zahlreiche Menschenleben retteten. Daraus ließe sich eine Lehre nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft ziehen. Man denke nur daran, dass populistische Staatenlenker wie der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump und das brasilianische Staatsoberhaupt Jair Bolsonaro sowohl die Klimaforschung wie auch die medizinische Wissenschaft mit Hohn und Spott bedacht, die von ihr zum Kampf gegen die Pandemie vorgeschlagenen Vorgehensweisen gröblich missachtet und ihrerseits quacksalberische Mittel vorgeschlagen haben, die jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrten. In den Augen von Populisten, eine Kategorie von Politikern, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts so gut wie unbekannt war, gehören Naturwissenschaftler zu jener Elite, deren tief verwurzelte Interessen zu zerstören sie fest entschlossen sind. Ihr Misstrauen der Wissenschaft gegenüber hat Hunderttausende vermeidbare Todesfälle verursacht.
Die meisten gewöhnlichen Menschen fühlen sich bei einem Seuchenausbruch unter anderem deshalb unsicher und verängstigt, weil die zur Bekämpfung ergriffenen Maßnahmen das Alltagsleben empfindlich stören. Wie in diesem Buch beschrieben wird, sind 1892 manche aus der Stadt geflohen, andere haben Trost im Alkohol oder in einer verstärkten Religiosität gesucht. Einige wenige haben sich die Ausbreitung der Seuche mit Verschwörungstheorien erklärt, die in erster Linie antisemitischen Charakter hatten. Solche Verschwörungstheorien und andere irrationale Gedanken sind im 21. Jahrhundert deutlich weiter verbreitet und behindern die von Regierungen zum Kampf gegen die Pandemie ergriffenen Maßnahmen. Geschichte bedeutet nicht zwangsläufig Fortschritt, und wie groß der erzieherische Einfluss der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands seinerzeit auf die Arbeiterklasse war, ist auf den Seiten dieses Buches deutlich erkennbar. Im Jahre 1892 war die Welt eine andere als heute, die Menschen reagierten anders als wir auf Krisen und Katastrophen, doch waren ihre Reaktionen weder weniger rational noch emotionaler als die der heutigen Bevölkerung. Wenn Historiker eines Tages die politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 auf lokaler, nationaler und globaler Ebene untersuchen, werden sie neben Unterschieden vor allem Ähnlichkeiten mit früheren Epidemien finden, und diese werden letztlich wichtiger sein. Die Lehren, die sich aus der Hamburger Cholera-Epidemie des Jahres 1892 ziehen lassen, das zeigen die abschließenden Passagen dieses Buches, sind heute aktueller denn je.
Barkway, August 2021
R. J. E.
Vorwort
Dieses Buch beschreibt das Innenleben einer großen europäischen Stadt während der Hochblüte des Industriezeitalters. Es zeichnet nach, wie im Verlauf des 19. Jahrhunderts in dem Maße, wie sich aus dem bescheidenen, wenn auch bedeutsamen Seehafen eine neuzeitliche Großstadt entwickelte, die Schwierigkeiten wuchsen, die Einwohner am Leben und gesund zu halten, sie mit sauberem, frischem Wasser, reiner Luft, einwandfreier Nahrung und allem anderen zum Leben Notwendigen zu versorgen, und wie diese Schwierigkeiten schließlich zur Katastrophe führten. Es zeigt, wie eng die Lösung der Versorgungsprobleme mit den Strukturen gesellschaftlicher Ungleichheit und mit sozialen Konflikten in der Stadt verknüpft war und wie auch diese Gegensätze sich änderten, während die Stadt immer größer und komplexer wurde. Gesellschaftliche Konflikte mündeten in politische Auseinandersetzungen; sie spielen bei den hier berichteten Ereignissen ebenfalls eine bedeutende Rolle. Höhepunkt und Zentrum des Berichts ist die große Cholera-Epidemie, die 1892 Hamburg als einzige Stadt Westeuropas heimsuchte. Diese Katastrophe forderte in etwas mehr als sechs Wochen kaum weniger als 10 000 Menschenleben. In der Art und Weise, wie die Stadt mit ihr fertig wurde – oder auch nicht –, und in ihren Auswirkungen auf das spätere Leben in der Stadt liegen Parallelen und Lektionen für Probleme und Katastrophen, die sich ein Jahrhundert später im Zeitalter von Aids und Umweltvernichtung stellen.
Damit steht das Buch in der langen Reihe der «Seuchen-Literatur», die von Boccaccio über Defoe zu Camus und André Brink reicht.1 Während der Arbeit daran wurden mir die Formen und Konventionen immer deutlicher bewußt, die diese Art Literatur dem Autor auferlegt und die ihren Weg in einen großen Teil der im strengeren Sinn geschichtswissenschaftlichen Literatur zu diesem Gegenstand gefunden haben, von Jean-Noël Birabens «Les Hommes et la Peste» und Paul Slacks «The Impact of Plague in Tudor and Stuart England» bis hin zu Untersuchungen von Epidemien aus neuerer Zeit, wie beispielsweise Michael Dureys Arbeit über die Cholera in Großbritannien oder Alfred Crosbys Bericht über die große Grippewelle von 1918/19 in den USA.2 Die Aufdeckung der Nachlässigkeit und Doppelzüngigkeit der Behörden, die gemächliche Wiedergabe von Ursachen, Einflüssen und Vorwarnungen, auf die eine rasche Erzählung der eigentlichen Katastrophe folgt, der Wechsel des Blickwinkels von der Gesamtsicht zum Standpunkt des einzelnen und zurück, die kathartische Schlußbetrachtung am Ende der Erzählung, all diese charakteristischen Merkmale der «Seuchen-Literatur» wirkten sich in spürbarer Weise auf die Struktur dieses Buches aus.
Doch hat die Lektüre dieser «Seuchen-Literatur» auch mein Bewußtsein dafür geschärft, wie sich Epidemien metaphorisch ausdeuten lassen, so wie es unmittelbar und mit unvergeßlichem Nachdruck in Albert Camus’ klassisch gewordenem Roman «Die Pest» geschieht, abstrakter und beiläufiger in Thomas Manns Novelle, auf die der Titel des vorliegenden Buches zurückgeht.3 Die amerikanische Kritikerin Susan Sontag hat kürzlich vor der Gefahr gewarnt, Krankheit als Metapher zu verwenden. Allerdings gründet sich ihre Warnung auf ein Medizinverständnis, das, wie ich nachzuweisen hoffe, bestenfalls vereinfachend, schlimmstenfalls aber naiv ist.4 Daher läßt sich dies Buch auch in einem metaphorischen Sinn verstehen. Im Jahr 1892 sind in Hamburg nicht nur Menschen gestorben – die Epidemie jenes Jahres bildete auch, wie ein überlebender Bewohner der Stadt angemerkt hat, die Scheidelinie zwischen Altem und Neuem. Insbesondere läutete sie die Totenglocke des alten und bis dahin geltenden Systems, bei dem die Verwaltung der Stadt in den Händen von Honoratioren lag, die auf diesem Gebiet kaum mehr als Amateure waren. Die Epidemie kennzeichnete – auch wenn sie ihn nicht als einzige herbeiführte – den Sieg des Preußentums über den Liberalismus, den Triumph der staatlichen Intervention über das Laisser-faire. Sie markierte einen bemerkenswerten, symbolischen Augenblick in der Geschichte des deutschen Bürgertums und bereitete die Bühne für dessen Eintritt ins 20. Jahrhundert. Diese metaphorischen Anklänge des Buchtitels zeigen, wie ich hoffe, daß das Hauptanliegen dieses Werks weit über die bloße Beschreibung der Katastrophe hinausgeht, die über die Stadt gekommen war.
Als ich Ende der siebziger Jahre mit den Forschungsarbeiten für dieses Buch begann, war mir nicht klar, daß ich nahezu ein Jahrzehnt zu seiner Vollendung benötigen würde. Zur Geschichte Hamburgs fühlte ich mich hingezogen, teils weil ich den Eindruck hatte, es sei an der Zeit, etwas dagegen zu unternehmen, daß ein Großteil der modernen Geschichtsschreibung über das Deutschland nach 1871 von einer eingeengten, auf Preußen konzentrierten Sicht erfolgte, teils aber auch durch ein schon bestehendes Interesse an der Sozialgeschichte des deutschen Liberalismus. Mein Ausgangspunkt war der Ruf dieser Stadt – Deutschlands zweitgrößter nach Berlin –, im Deutschen Reich ein «Fremdkörper» und im kontinentaleuropäischen Zusammenhang eine «englische» Stadt gewesen zu sein. Ich nahm an, Hamburg könne als eine Art historisches Labor zur Überprüfung allgemeiner Begriffe dienen, mit denen der Kontrast zwischen England und Deutschland gemeinhin beschrieben wird. Es war nicht nur einfach eine Stadt, sondern einen großen Teil des 19. Jahrhunderts hindurch auch eine «Freie Stadt», ein autonomer Staat im Deutschen Bund und nach 1871 – wenn auch in begrenztem Maße – innerhalb des Deutschen Reiches. Das Wichtigste aber war, daß liberal gesinnte Kaufleute aus dem Bürgertum die Stadt regierten. Daher ließ sich Hamburg als Fallstudie zur Beantwortung einer der großen «Was wäre, wenn?»-Fragen in der deutschen Geschichtsschreibung der neueren Zeit heranziehen: Sofern das Bürgertum 1848 oder danach politische Macht errungen hätte, wäre dann eine gerechtere, gleichere, freiheitlichere, demokratischere, rationalere Gesellschaft das Ergebnis gewesen? Oder hätten sich Gesellschaft und Politik mehr oder weniger genauso entwickelt, wie sie es dann taten?
Anfänglich hoffte ich, mit Hilfe einer kurzen Querschnittsuntersuchung der Zeit von 1890 bis 1910 eine Antwort auf diese Fragen finden zu können; doch in dem Maße, in dem ich mich in das überaus umfangreiche Quellenmaterial im Hamburger Staatsarchiv einarbeitete, zog es mich unwiderstehlich weiter in die Vergangenheit zurück – und das ist der Hauptgrund, warum es so lange gedauert hat, das Buch abzuschließen. In seiner vorliegenden Form weist es drei Untersuchungsebenen mit zunehmender Spezifik auf, die jeweils einander bedingen. Auf der allgemeinsten Ebene bemüht es sich, einen Abriß der politischen und sozialen Geschichte der Stadt im 19. Jahrhundert zu geben, so wie sie sich anhand der Klassengegensätze und der Beziehungen von Staat und Gesellschaft herausarbeiten läßt. Mein Verständnis dieser keinesfalls unproblematischen Begriffe wird, wie ich hoffe, im ersten Kapitel deutlich werden. Auf einer zweiten Ebene geht das Buch diesen allgemeinen Fragen im Rahmen einer Fallstudie der Geschichte der städtischen Umwelt und ihrer Beziehung zu Krankheit und Tod nach. Nicht nur fragt es, wie das rasche Wachstum Hamburgs Leben und Gesundheit seiner Bewohner beeinflußte, sondern auch, auf welche Weise unterschiedliche Bevölkerungsgruppen diese Auswirkungen wahrnahmen. Besonders eindringlich wurden diese Fragen durch die großen Cholera-Epidemien aufgeworfen, von denen die Stadt in nicht weniger als sechzehn Jahren zwischen 1831 und 1892 heimgesucht wurde. Während des gesamten Zeitraums von 1830 bis 1910 wirkten sie auf Gesellschaft und Politik in Hamburg so nachdrücklich ein, daß es gerechtfertigt erscheint, diese Zeit «Cholera-Jahre» zu nennen. Ganz allgemein wird die Beschreibung zum Ende des Untersuchungszeitraums «dichter», und das führt zur dritten und detailliertesten Ebene des Buches, zum Bericht über die Cholera-Epidemie des Jahres 1892.
Diese Epidemie hat eine ungeheure Menge an Quellenmaterial «produziert», angefangen von Lebenserinnerungen, Tagebüchern, Briefen, Zeitungsartikeln und Fotos bis hin zu den Berichten amtlicher Untersuchungsausschüsse, statistischen Untersuchungen, Berichten karitativer und freiwilliger Hilfsorganisationen und selbstverständlich einer Fülle von Material in den Akten der einzelnen damit beschäftigten Ressorts der Stadtverwaltung. Die Epidemie rückte das Funktionieren von Staat und Gesellschaft ebenso deutlich in den Blick wie die Strukturen der gesellschaftlichen Ungleichheit, die Vielzahl von Werthaltungen und Ansichten, aber auch die materiellen Konturen des täglichen Lebens, die öffentlich vertretenen Ideologien und die nicht ausdrücklich erklärten Ziele politischer Organisationen.
Daher kann man dieses Buch auch als einen sechs Wochen im Spätsommer 1892 umfassenden Querschnitt durch die Strukturen des Lebens in der Stadt betrachten, verknüpft mit einer Längsschnittuntersuchung, die jedes einzelne der die Epidemie verursachenden Elemente auf seine Ursprünge bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zurückverfolgt und den Auswirkungen und Ergebnissen der Epidemie bis ins 20. Jahrhundert nachspürt. Die ersten zwölf Unterkapitel des Buches nehmen somit jeweils einen Faden des Ursachenknäuels auf und folgen ihm bis zum Vorabend der Epidemie von 1892, während die übrigen zwölf, beginnend mit dem ersten Teil des vierten Kapitels, eine Erzählung und Analyse der Epidemie selbst liefern und deren Bedeutung im Licht der anfangs gestellten allgemeinen Fragen behandeln.
Diese Vorgehensweisen und die Fülle der Quellen, auf die sich das Buch stützt, erlauben es, das Innenleben einer deutschen Großstadt im 19. Jahrhundert in beispielloser Detailtreue vor Augen zu führen. In den letzten Jahren sind viele Forschungsarbeiten zur Geschichte des Alltagslebens in Deutschland entstanden, zum großen Teil Lokalstudien. Diese Entwicklung ist auf Kritik gestoßen; ich hoffe jedoch, in diesem Buch nicht nur eine Fülle von Material zur Alltagsgeschichte vorzulegen, sondern vielleicht auch nachzuweisen, warum die Beschäftigung damit so wichtig ist. Im weitesten Sinn gestattet sie uns ein Nachdenken über zahlreiche Aspekte des menschlichen Lebens, die auch für heutige Leser bedeutsam sind, obwohl sie von Fachhistorikern gewöhnlich vernachlässigt werden: Ebenso wichtig ist aber auch die Erkenntnis, daß politisches Verhalten und politische Ziele nicht einfach in einer autonomen, eigenen Sphäre existieren, sondern in den Strukturen und Erfahrungen des Alltagslebens verwurzelt sind. Zwar betrachtet dies Buch die Vergangenheit auch «von unten», doch meine ich das in dem Sinn, daß die Sympathien eher bei der Masse des Volkes liegen als bei den wenigen, die sie regierten. Trotzdem denke ich nicht, daß es die oberen Ränge von Gesellschaft und Staat vernachlässigt oder nicht auch versucht, die Innenwelt von Hamburgs herrschenden Schichten mit so viel Sympathie zu schildern, wie der Verfasser aufzubringen vermag.
Zwangsläufig überschreitet ein Buch, das solche Ziele verfolgt, zahlreiche von der Wissenschaft gesetzte Grenzen: Es schließt demographische Geschichte und Geschichte der Lebensverhältnisse ebenso ein wie Umweltgeschichte und Geschichte der Arbeiterbewegung. Keinesfalls ist es eine medizinhistorische Studie im herkömmlichen Sinn; vielmehr nähert es sich der Geschichte von Medizin und Krankheit vom Standpunkt des Sozialhistorikers und siedelt diese Gegenstände in ihrem zeitgenössischen gesellschaftlichen und politischen Rahmen an, nicht aber in der langfristigen Entwicklung wissenschaftlicher Medizin, wie sie sich vom Standpunkt der Gegenwart aus darbietet. Beim Schreiben dieses Buches haben mich im Verlauf der letzten 25 Jahre erschienene Arbeiten zur Sozialgeschichte der Cholera in Amerika, Großbritannien, Frankreich und Rußland beeinflußt; bisher existiert keine solche Untersuchung für Deutschland. Da ich Vergleichsmaterial, insbesondere für Preußen, heranziehe, hoffe ich, mit diesem Buch einen Schritt auf dem Weg zu einer solchen Studie zu tun. Nicht nur die Medizinhistoriker mögen mir vergeben, daß ich mich auf ihr Fachgebiet gewagt habe, sondern auch die Fachleute zahlreicher anderer Unterdisziplinen, in die historische Forschung heutzutage unglücklicherweise zu zerfallen scheint – von der Geschichte des Wohnens bis zur Geschichte der Urbanisierung. Aber vielleicht können sie auch etwas lernen, wenn sie sehen, daß die Gegenstände, um die es ihnen geht, in einen allgemeineren Zusammenhang gestellt und sozusagen mit den Augen eines Außenseiters betrachtet werden.
Selbst wenn es so scheinen mag, ist dieses Buch keinesfalls als vornehmlich quantitative Untersuchung konzipiert. Um die soziale Ungleichheit in der Stadt in etwa zu belegen, hielt ich es für erforderlich, auf statistische Analysen zurückzugreifen, doch habe ich angesichts der zahlreichen Probleme, die sich durch das vorliegende Material ergeben, versucht, diese Analysen stets in einen qualitativen Zusammenhang einzubetten. Die Anwendung raffinierter Methoden statistischer Auswertung des Materials schien letztlich in keinem Verhältnis zum Aufwand zu stehen, den sie bedingt hätte, und so habe ich mich mit einer sehr einfachen Ebene statistischer Überprüfung begnügt. Um es mit quantitativem Material oder den in diesem Buch behandelten Gebieten unvertrauten Lesern nicht unnötig schwerzumachen, habe ich es vermieden, die hier benutzten statistischen Quellen und Analysen bis ins einzelne aufzuschlüsseln. Auch habe ich mich bemüht, so vielen Statistiken wie möglich die Form leicht faßlicher Karten, historischer Querschnitte und anderer graphischer Darstellungen zu geben. Wer sich in die Probleme der statistischen Analyse des vorgestellten Materials vertiefen will, sei auf den statistischen Anhang der englischen Ausgabe dieses Buches verwiesen, der nicht in die deutsche Ausgabe aufgenommen wurde.
Trotz allem bleibt bei einem Buch dieses Umfangs, das sich auf eine beträchtliche Menge bisher nicht veröffentlichter handschriftlicher Quellen stützt, der wissenschaftliche Apparat zwangsläufig recht unhandlich. Ich habe mich dem entgegenzuwirken bemüht und ihn so weit wie möglich beschränkt. Die Anmerkungen sind mit Absicht so abgefaßt, daß sie den Lesern einen Eindruck von der Art der Quellen vermitteln, auf die sich im Text gemachte Aussagen gründen. Sie können diese Quellen, sofern sie das wünschen, heranziehen und überprüfen. Mit ganz wenigen Ausnahmen sollen die Anmerkungen nicht dazu dienen, Themen von sekundärer Bedeutung zu behandeln; noch weniger ist beabsichtigt, die Sekundärliteratur zu allen behandelten Gegenständen vollständig aufzuführen. In ähnlicher Weise wurde auch die Angabe von Quellen streng auf solche begrenzt, die für die Analyse als nützlich empfunden und im Buch zitiert wurden. Zusätzliche Verweise lassen sich mühelos mit Hilfe der in den Anmerkungen genannten Monographien und Forschungsberichte auffinden. Am Ende des Buches gibt das Personen- und Sachregister die heutigen Ortsbezeichnungen zusammen mit den seinerzeit üblichen an, wie sie im Text verwendet wurden. Dies ist vor allem dort wichtig, wo sich inzwischen die Staatsgrenzen geändert haben. Einer möglichen Irritation der Leser sei an dieser Stelle vorgebeugt: Ich habe mich entschlossen, die Orthographie der Ortsnamen in den zitierten Quellen nicht zu verändern und die vom heutigen Gebrauch zum Teil abweichenden Schreibungen auch in meinen Text einzuführen. Wenn statt dem heute üblichen «Barmbek» oder «Billwerder Ausschlag» von «Barmbeck» oder «Billwärder Ausschlag» die Rede ist, dann sollen die historischen Namensschreibungen der Darstellung nicht Patina verleihen, sondern lediglich störende Doppelformen vermeiden helfen. Auch bei allen Zitaten aus den Quellen, die ich benutzt habe, sind die historischen und individuellen Eigentümlichkeiten der Rechtschreibung beibehalten worden; wo Quellen nach der Sekundärliteratur zitiert werden, ist die dort verwendete, zum Teil modernisierte Orthographie übernommen worden. Für die deutsche Ausgabe habe ich die Ergebnisse der neuesten Forschungen zur hamburgischen Geschichte und zur Geschichte der Cholera in den Text eingearbeitet.
Bei einem so weit ausgreifenden Projekt wie diesem ist der Autor mehr als sonst auf Hilfe angewiesen. Mein Dank muß vor allem der University of East Anglia gelten, die mir nicht nur Zeit und Möglichkeit zur Durchführung dieser Untersuchung zur Verfügung gestellt, sondern auch durch eine Vielzahl großzügiger Stipendien aus dem Special Travel and Research Fund of the School of Modern Languages and European History den Hauptteil der anfallenden Kosten getragen hat. Zu einer Zeit der allgemeinen Etatkürzungen und Einsparungen an den britischen Universitäten hatte ich in der Tat das Glück, einer Institution anzugehören, die nach wie vor den Mut besitzt, Forschung auf dem Gebiet der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften aus eigenen Mitteln zu unterstützen, was ihr freilich auf anderen Gebieten Nachteile einträgt. Außerdem stehe ich in der Schuld der Universität Hamburg, die mir bei meinen zahlreichen Besuchen zwischen 1978 und 1985 Unterkunft in ihrem Gästehaus gewährt hat, sowie dem Institut für Europäische Geschichte in Mainz und dessen Leiter, Professor Dr. Karl Otmar Freiherr von Aretin, für die ruhige und kollegiale Atmosphäre während der letzten Stadien der Niederschrift, der Alexander-von-Humboldt-Stiftung für großzügige finanzielle Unterstützung, dank deren ich dem vorliegenden Buch Zeit widmen konnte, als ich bereits an einem anderen, mit diesem verwandten Projekt arbeitete, sowie der British Academy dafür, daß sie meine Forschungsarbeit in einem früheren, entscheidenden Stadium gefördert hat.
Im Verlauf meiner Arbeit hatte ich Gelegenheit, an der ersten in Deutschland abgehaltenen Tagung zur Sozialgeschichte der Medizin im Zentrum für interdisziplinäre Forschung an der Universität Bielefeld teilzunehmen. Ich danke deren Organisatoren, Prof. Alfons Labisch und Prof. Reinhard Spree, daß sie mir die Teilnahme ermöglichten. Auch bei den ersten Treffen des Hamburgischen Arbeitskreises für Regionalgeschichte, die 1982 stattfanden, sowie bei den Zusammenkünften des UEA-Forschungsseminars zur modernen deutschen Sozialgeschichte habe ich viel gelernt. Insbesondere letztere haben mir geholfen, meine Interpretationen der deutschen Geschichte zu entwickeln und zu präzisieren. Eine Vielzahl von Seminarteilnehmern hat sich geduldig im Entstehen befindliche Kapitel angehört, und zahlreiche ihrer Anmerkungen und Anregungen haben in der einen oder anderen Gestalt ihren Weg in den Text gefunden. Insbesondere schulde ich Dank für die Nachsicht, mit der das Seminar der Wellcome Unit for the History of Medicine in Oxford und die Datenbank für Demographie an der Universität Umeå in Schweden meine ersten zögernden Schritte in Richtung auf die Geschichte der Medizin und Demographie aufgenommen haben. Außerdem zog ich Nutzen daraus, daß einige der in diesem Buch vorgelegten Argumente und Belege in Hamburg beim gemeinsamen Historiker-Kolloquium der UEA und der Universität Hamburg diskutiert wurden, wie auch im Institute for European Population Studies an der Universität Liverpool, dem von Richard Smith im All Souls’ College in Oxford organisierten Demographic and Family History Seminar, dem von Anthony Nicholls und Hartmut Pogge-von Strandmann am St. Antony’s College in Oxford geleiteten German History Seminar, dem achten UEA Research Seminar in Modern German Social History, das 1985 in Norwich stattfand, sowie in Seminaren oder Vorlesungen der State University of California (Long Beach), der University of California in Riverside, am Institut für Europäische Geschichte in Mainz sowie den Universitäten Bielefeld, Düsseldorf, Essen und der Ruhr-Universität Bochum. Mein Dank gilt all denen, die diese Diskussionen veranstaltet und sich an ihnen beteiligt haben.
Zahlreiche Einzelpersonen und Institutionen haben während der Forschungsarbeiten zu diesem Buch beigetragen. Nicht nur hat Peter Loewenberg in seiner Wohnung in Westwood, Los Angeles, eine äußerst anregende abendliche Diskussionsrunde zusammengeführt, sondern mich auch auf einen romanhaften Bericht über die Epidemie des Jahres 1892 aufmerksam gemacht, den sein Großvater Jakob Loewenberg verfaßt hat, der einer «Sanitätskolonne» der Stadt angehörte; Frau Helga Kutz-Bauer lieh mir einen von Paul Schurek verfaßten Roman über die Epidemie. Beiden bin ich tief zu Dank verpflichtet, wie auch Mrs. Ruth Evans (Oxford), die mir freundlicherweise gestattet hat, in ihrem Besitz befindliche Dokumente der Familie Mönckeberg einzusehen. Ausdrückliche Anerkennung für die Erlaubnis, aus Dokumenten zu zitieren, gebührt Carmen Gräfin Finck von Finckenstein-Jelmini und Dr. Edgar Petersen. Ebenfalls zu danken ist den Leitern und Angestellten der Bibliothek der University of East Anglia, der Bibliothek des Wellcome Institute for the History of Medicine (London), des Kirchenarchivs Hamburg, des Staatsarchivs Bremen, des Bundesarchivs Koblenz, des Stadtarchivs Berlin, des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, und des Staatsarchivs der Freien und Hansestadt Hamburg, die mir alle überaus großzügig Fragen beantwortet und Material zur Verfügung gestellt haben. Auch bin ich dankbar für die Erlaubnis, die aus den in der Liste der Bilder genannten Quellen stammenden Abbildungen in mein Buch aufzunehmen.
Einigen Personen gegenüber habe ich eine besondere Dankesschuld, die abzutragen ich kaum hoffen kann. Allen voran möchte ich Herrn Claus Stukenbrock vom Staatsarchiv Hamburg für die Geduld und Großzügigkeit danken, mit der er mir sein unvergleichliches Wissen über das Archivmaterial zur Sozialgeschichte Hamburgs in der Zeit, mit der ich mich beschäftige, zur Verfügung gestellt hat. Er hat sich während der vergangenen zwei Jahrzehnte den Dank mehr als einer Forschergeneration verdient. Ohne seine Hilfe und Anleitung hätte dies Buch nie beendet werden können. Zweitens danke ich Prof. Dr. Arthur Imhof (Freie Universität Berlin) sehr für die Ermutigung, die er mir in den frühen Stadien dieses Projekts zuteil werden ließ, noch mehr aber, weil er mir am Beispiel seines eigenen Werks gezeigt hat, daß sich statistisches Material leicht faßbar darstellen läßt, wenn man es graphisch aufbereitet. Besonderen Dank schulde ich in dieser Hinsicht Ian Brooke von der Graphics Unit der University of East Anglia für Ausdauer und Geduld, mit der er über mehrere Jahre hinweg sich unermüdlich einer wohl manchmal endlos erscheinenden Arbeit unterzogen und die Graphiken hergestellt hat, die einen wichtigen Bestandteil dieses Buches bilden. Wenn die statistische Analyse selbst überzeugend wirkt, ist das weithin das Verdienst von Joanna Bourke (Cambridge), die in letzter Minute dringend nötige Hilfe leistete. Paul Weindling (Oxford) hat mir großzügig Zeit und Einrichtungen zur Verfügung gestellt und mich nicht nur mit Nachweisen, Andrucken, Fotokopien und Ermutigungen auf einem Gebiet versorgt, auf dem er selbst eine führende Autorität ist, sondern auch kritische Kommentare zu einem Großteil des fertigen Typoskripts abgegeben. Sollten seine Bemühungen, mich im Hinblick auf die deutsche Medizingeschichte kundig zu machen, nicht sehr erfolgreich gewesen sein, liegt das ausschließlich an mir. Ich stehe ebenfalls tief in der Schuld von John Breuilly (Manchester); er hat mir in seiner üblichen Großzügigkeit nicht nur das von ihm im Lauf vieler Jahre zur Geschichte Hamburgs in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zusammengetragene Material zur Verfügung gestellt, sondern mich auch mit seiner Sachkenntnis unterstützt. Logie Barrow hat mir bei meiner Forschungsarbeit in Bremen selbstlos Gastfreundschaft gewährt, und ich schulde ihm für seine beständige Ermutigung viel. Lynn Abrams, Cathleen Catt, Barry Doyle und Graham Ford haben mich in der Endphase des Schreibens mit ihrem kritischen Interesse und ihrer Begeisterung unterstützt; ich danke ihnen allen dafür, daß sie das Typoskript gelesen und mir zahlreiche nützliche Anregungen gegeben haben. Das gilt insbesondere für Graham Ford, der sich der mühevollen Aufgabe unterzogen hat, das Korrekturlesen der Anmerkungen zu übernehmen. Mein Dank gilt auch Marjan Bhavsar für das Tippen zahlreicher früherer Entwürfe von einzelnen Kapiteln, Elvie Dobie für einen Teil der späteren Schreibarbeiten und Carol Haines, die mit beispielhafter Schnelligkeit und Tüchtigkeit ein genaues und sauberes, fertiges Typoskript hergestellt hat.
Mehr, als ich sagen kann, schulde ich Elin Hjaltadóttir Dank für ihre beständige Nachsicht und Unterstützung sowohl in den schwierigen Anfangsphasen der Forschungsarbeit, als noch keineswegs sicher war, was – wenn überhaupt etwas – als Ergebnis meiner Aufenthalte in den Archiven herauskommen würde, wie auch in den späteren Stadien des Schreibens, als es bisweilen so aussah, als habe die Cholera-Epidemie auf den Haushalt übergegriffen und mache sich darin breit. Gewiß hätte das Buch nie vollendet werden können ohne die kritische Beteiligung, das beständige Interesse, die moralische Unterstützung und die wiederholte großzügige Gastfreundschaft meiner zahlreichen früheren und jetzigen Freunde in Hamburg, die sich so große Mühe gegeben haben, meine Arbeit an diesem Projekt erfreulich und lohnend zu gestalten; unter ihnen Michael Grüttner, Liz Harvey, Alan Kramer, Mary Lindemann, Tony und Willy McElligott, Helga Stachow und Volker Ullrich. Ihnen und zahlreichen anderen Hamburgern ist als kleines Zeichen des Dankes dies Buch gewidmet.
Norwich, Juli 1986
R. J. E.
London, Juli 1990
Aus technischen Gründen konnten die Zahlen in den Karten und Abbildungen nicht durchgängig an deutsche Schreibweisen angepaßt werden. So steht zwischen Prozentangaben und Dezimalen ein Punkt (15.8%) statt eines im Deutschen üblichen Kommas (15,8%).
Bei Zahlenangaben über 1000 erscheint ein Punkt zur Kennzeichnung der Tausender etc. (2.000; 3.200.000) statt des Zwischenraums (2 000; 1 500 ). Autor und Verlag bitten, diese Anglizismen zu entschuldigen.
1. Innenansicht einer Handelsstadt
Patrizier und Politik
I
Das von Bismarck 1871 gegründete Deutsche Kaiserreich wird von manchen Historikern als «Fürstenbund» bezeichnet;1 strenggenommen war es jedoch keiner. Wohl faßte es in einem «ewigen Bündnis» 25 Mitgliedstaaten zusammen, über die ein Bundesrat, in dem sie alle vertreten waren, die souveräne Macht ausübte.2 Doch während es sich bei 22 von ihnen, angefangen vom Königreich Preußen bis hinab zum kleinen thüringischen Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt, in der Tat um Monarchien handelte, waren die drei übrigen – die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Lübeck – Republiken. Sie hatten ihre Unabhängigkeit als Angehörige des machtvollen Hansebundes im Mittelalter erworben und es auf die eine oder andere Weise fertiggebracht, sie von da an zu bewahren. Schon lange vor der Mitte des 19. Jahrhunderts war Hamburg die größte und bedeutendste der drei Hansestädte. Nach Berlin war es die zweitgrößte Stadt im Deutschen Reich, mit großem Abstand vor den folgenden. Der Grund dafür war vor allem die günstige Lage Hamburgs an der Elbe: Der Verkehr aus dem Hinterland von Berlin bis zum fernen Prag passierte die Stadt auf dem Weg zur rund hundert Kilometer entfernten Nordsee. An Wohlstand, Größe und Bedeutung ließ Hamburg Provinzhauptstädte wie München, Stuttgart, Leipzig und Dresden weit hinter sich.3
Im Unterschied zu den anderen wichtigen deutschen Städten – mit Ausnahme Bremens – brauchte sich Hamburg keine von außen einwirkende, unmittelbare Kontrolle seiner Angelegenheiten gefallen zu lassen: Es war ein selbständiger Bundesstaat. In neuerer Zeit ist es üblich geworden, das Deutsche Reich als eine Art vergrößertes Preußen4 anzusehen; und die weitverbreitete Annahme, Preußen und das Deutsche Reich seien so gut wie identisch gewesen, findet sich häufig in dem Begriff «Preußen-Deutschland» ausgedrückt, der auf das von Bismarck geschaffene politische Gebilde gemünzt ist.5 Auch das ist bestenfalls eine Halbwahrheit. Gewiß, die Mitgliedstaaten des Reiches konnten keine eigene Außenpolitik betreiben, und zweifellos wurden die auswärtigen Angelegenheiten des Reiches von Preußen geführt. Das Heer, obwohl dem Namen nach dezentralisiert, unterstand ebenfalls de facto Preußen, vor allem dann, wenn es darauf ankam – im Krieg. Überdies war Preußen, sofern es das wollte, imstande, sich auch im Bundesrat eine Stimmenmehrheit zu verschaffen. Trotzdem verblieb den einzelnen Bundesstaaten ein beträchtliches Maß an politischem Spielraum, denn sie besaßen Möglichkeiten, ihre eigenen Angelegenheiten selbständig zu regeln. Schul- und Bildungswesen, Polizei, Recht und Gesetz, Gesundheits- und Sozialfürsorge, Steuerwesen, Handels- und Wirtschaftspolitik: Diese und zahlreiche andere Bereiche überließ die Verfassung von 1871 weitgehend der Entscheidung der Bundesstaaten, wie dies auch schon in früheren Verfassungen der Fall war, beispielsweise in der des sehr lockeren Deutschen Bundes, in dem von 1815 bis 1866 die deutschen Einzelstaaten zusammengeschlossen waren.6
Letztlich bedeutete dies nichts anderes, als daß keinesfalls für das übrige Deutschland gelten mußte, was für Preußen galt. Preußen selbst war tief gespalten, denn die im Rheinland 1815 hinzugewonnenen neuen Gebiete hatten wenig mit dem ländlich geprägten Hinterland des alten ostelbischen Preußen gemein.7 Noch größer war die Vielfalt der im übrigen Reich vorherrschenden Überlieferungen, Institutionen und Denkgewohnheiten. Jeder Staat besaß seine eigenen Besonderheiten und seine eigenen Verfahrensweisen: Für kein Mitglied des Deutschen Reiches galt das mehr als für Hamburg. Historiker haben die Stadt sogar einen «Sonderfall in der Geschichte Deutschlands»8 genannt, einen «Fremdkörper in Preußisch-Deutschland»9 und «die allerenglischste Stadt des Kontinents».10 Als Insel republikanischer Gesinnung in einem monarchistischen Meer, als Bastion bürgerlicher Herrschaft in einem von Aristokraten beherrschten Reich scheint sich die Stadt nahezu jedem allgemeinen Urteil zu entziehen, das die Historiker über das deutsche Kaiserreich gefällt haben.
Selbstverständlich muß nicht eigens betont werden, daß Hamburg stets genötigt war, auf die Wünsche der die Stadt umgebenden größeren Gebilde Rücksicht zu nehmen. Eine der Schwierigkeiten bei der Analyse der Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft im Deutschland des 19. Jahrhunderts liegt in der notwendigen Erkenntnis, daß der Staat auf mindestens zwei verschiedenen Ebenen existierte, zwischen denen allerdings Wechselbeziehungen bestanden – auf Reichsebene und Länderebene. Diese föderative politische Struktur ermöglichte auf regionaler und manchmal auch auf lokaler Ebene ein beträchtliches Maß an Selbstbestimmung. Andererseits konnte der jeweilige Flächen- oder Stadtstaat nur innerhalb der auf Reichs- oder Bundesebene festgelegten Einschränkungen handeln. Diese wurden nach der Gründung des Norddeutschen Bundes 1867 deutlicher fühlbar und noch stärker nach der des Deutschen Reiches 1871.
Wegen seiner geographischen Lage gelangte Hamburg vor allem nach den auf das Jahr 1815 folgenden Gebietsveränderungen in den Bannkreis preußischer Macht.11 Zwar besaß die Stadt ihre eigene Streitmacht in Gestalt des Bürgermilitärs. Sie wäre aber kaum imstande gewesen, der Berufsarmee einer Großmacht mehr als symbolischen Widerstand entgegenzusetzen. Ohnehin war es Hauptaufgabe des Bürgermilitärs, die Ordnung innerhalb der Stadt aufrechtzuerhalten. Daher spielte Hamburg in Zeiten von Großmachtkonflikten eine Partei gegen die andere aus oder schlug sich, sofern das nicht möglich war, in der Hoffnung auf Zugeständnisse auf die Seite des Stärkeren. Beispielsweise ließ der Senat 1804, zu einer Zeit, als ein halbes Dutzend größere Armeen die Stadt hätten einnehmen können, als Geste des Friedens und des guten Willens die äußeren Befestigungen schleifen. Hamburg hatte bereits 1801 eine kurze dänische Besetzung erlebt, 1806 waren dann die Franzosen an der Reihe. Von 1807 bis 1808 waren rund 15 000 spanische Soldaten innerhalb der Stadtmauern einquartiert, anschließend traten erneut die Franzosen auf den Plan. Um weitere Unordnung zu verhindern, beantragte der Senat 1810 eine Mitgliedschaft in Napoleons Rheinbund; doch im folgenden Jahr gliederte der französische Kaiser das Land um die Unterelbe als «Département des Bouches de l’Elbe» seinem «Grand Empire» ein. Obwohl die Stadtverwaltung nach französischem Vorbild umgestaltet wurde, stammte die Mehrzahl ihrer Mitglieder aus den Reihen des früheren Senats und der führenden Kaufmannsfamilien. Keinem von ihnen, nicht einmal dem «maire» Amandus Abendroth, scheint später irgendjemand Vorwürfe gemacht zu haben. Abendroth wurde sogar 1815 Erster Polizeiherr und spielte weiterhin auf Jahre hinaus eine führende Rolle in den Angelegenheiten seiner Stadt, deren Bürgermeister er dann 1831 wurde.
Als sich die Franzosen 1813 zurückziehen mußten, setzten sich Kosaken in Hamburg fest. Bald schon besetzten die Franzosen erneut die Stadt und erlegten den unglücklichen Einwohnern eine enorme Geldstrafe dafür auf, daß sie sich von den Russen hatten erobern lassen. Die französische Besatzungsmacht hob auf, was die Stadt noch an Autonomie besaß, und kümmerte sich nicht um Hamburgs führende Familien. So kam es, daß die Bürger dankbar die alte Verfassung von 1712 wieder in Kraft setzten, als 1814 die letzten französischen Soldaten zum Stadttor hinausmarschiert waren. Doch wie der Historiker Barthold Niebuhr klagte, fand sich in der Bürgerschaft nur wenig nationale Begeisterung.12 Man wollte die Freiheit, sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern, nicht aber in ein größeres Staatswesen eingegliedert werden. Wie die Erfahrung der französischen Besetzung zeigte, war es den Bürgern Hamburgs gleichgültig, wer die Besatzungsmacht war, solange der Stadt ein hinreichendes Maß an Selbstbestimmung gewährt wurde. Immerhin waren zahlreiche der im 19. Jahrhundert wichtigen Hamburger Familien nicht deutschen Ursprungs, angefangen von den Amsincks bis zu den Chapeaurouges, Godeffroys, Slomans und O’Swalds. Der bayerische Diplomat von Homayer beklagte sich 1845, daß «ich in Hamburg blutwenig Deutsches zu finden vermag, außer der Sprache … von irgendeiner deutschen Ader ist da keine Rede».13
Verstärkt wurde diese Distanz zum deutschen Nationalismus und zur deutschen Nationalität durch die bei Hamburger Kaufleuten weitverbreitete Neigung, ihre Söhne in eine der Auslandsvertretungen Hamburger Firmen zu schicken, damit diese dort ihren Beruf gründlich erlernten. Es ist durchaus kennzeichnend, daß beispielsweise die späteren Senatoren Adolph Hertz, Charles Ami de Chapeaurouge, Max Hayn und Johann Stahmer ihre Jugend in Ostafrika, Indien, Mexiko und Westindien verbrachten, bevor sie sich in der Vaterstadt als Kaufleute niederließen. Die meisten Angehörigen der großen und reichen Kaufmannsfamilie Amsinck absolvierten ihre Lehrjahre im Ausland; so war beispielsweise Martin Garlieb Amsinck (1831–1905) am Bau von Brunels Schiff «Great Eastern» in Glasgow beteiligt.14 Häufig hieß es, Hamburger Kaufleute kennten sich in Peru oder auf Sansibar besser aus als im eigenen Land. «Beiläufig bemerkt», schrieb Julius von Eckardt über seine Zeit als Senatssekretär in den siebziger Jahren, «gab es in dem damaligen Hamburg Dutzende älterer Herren, die ‹jede Stadt am Mississippi› aus direkter Anschauung kannten, zwanzig Male in London, aber niemals in Berlin gewesen waren.»15 Besonders eng waren die Beziehungen zu England. In den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts wurde die Hälfte des Seehandels der Stadt mit englischen Schiffen abgewickelt.16 Viele der führenden Hamburger Firmen besaßen Filialen in London, und die größten Kaufmannsfamilien kultivierten selbstbewußt einen «englischen» Lebensstil, hielten sich englische Kindermädchen, kauften englische Kleidung17 und nannten ihre Söhne Percy, Henry, John oder William.18
Die nationalen Aspekte der Revolution von 1848 fanden aus diesem Grund in Hamburg nur wenig Widerhall. Lediglich die Schleswig-Holstein-Frage weckte in der Stadt eine gewisse nationale Begeisterung. Die Gründe dafür mochten darin liegen, daß es dabei um einen regionalen Markt und zugleich um einen für die Versorgung der Stadt wichtigen Raum ging, wie auch, daß das Herzogtum Holstein an die Unterelbe grenzte, Hamburgs Lebensader zum Meer.19 Auch wenn der Senat sie als Möglichkeit zur Unterdrückung der revolutionären Opposition begrüßte, zeigte die kurze Besetzung Hamburgs durch preußische Truppen im Jahr 1849, daß sich die Stadt nicht auf alle Zeiten von der Politik auf nationaler Ebene ausschließen konnte. Noch deutlicher wurde dies anläßlich der Besetzung Hamburgs durch österreichische Truppen im Jahr 1851.20 Der Stadt waren der preußisch-österreichische Sieg über die Dänen im Krieg von 1864 und die auf ihn folgende Abtrennung Schleswig-Holsteins von Dänemark nicht zuletzt deshalb willkommen, weil sich dadurch die Beziehungen zu den beiden Herzogtümern verbesserten. Im Jahr 1866 lagen die Sympathien des Senats bei Österreich, das der Stadt – im Gegensatz zu Preußen – während der Wirtschaftskrise von 1857 mit einem großzügigen Darlehen unter die Arme gegriffen hatte. Seit den Tagen des Frankfurter Paulskirchen-Parlaments von 1848 hatte der Senat sich konsequent gegen Versuche zur Errichtung einer wirksamen Zentralgewalt in Deutschland gewendet. Anfänglich neigte er nicht dazu, den 1866 gestellten preußischen Forderungen nachzugeben, zu denen es gehörte, das Bürgermilitär unter preußische Führung zu stellen. In ihnen manifestiert sich Bismarcks Absicht, die Autonomie der Stadt durch ihre Eingliederung in den neu gegründeten Norddeutschen Bund, den Vorläufer des Reiches von 1871, einzuschränken.21 Doch gab der Senat schließlich nach, und als letzter der norddeutschen Staaten trat Hamburg dem neuen Bund und 1871 dem Deutschen Reich bei.22 Dies geschah einerseits aus Furcht vor Bismarcks Drohung, Hamburg als eine preußische Stadt einzugemeinden, andererseits im Vertrauen auf seine Zusage, er werde den Status der Stadt respektieren und ihre Handelsinteressen bei seiner künftigen Wirtschaftspolitik berücksichtigen.
Die von Bürgermeister Martin Haller 1870 als «unser Kontrakt mit Preußen» bezeichnete Einigung Deutschlands führte zu erkennbaren Veränderungen im Alltagsleben der Stadt. Wie andere Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes auch besaß Hamburg eigene Maße, Gewichte und ein eigenes Postwesen; sie wurden im Norddeutschen Bund und später im ganzen Reich durch einheitliche Systeme ersetzt. An die Stelle der alten hamburgischen Währung – 12 Pfennig auf den Schilling, 16 Schilling auf die Mark Banco23 – trat die neue Dezimalwährung des Reiches, und die Hamburger Schiffe führten nunmehr statt des alten Hamburger Wappens – silbern in rotem Feld eine zinnenbekrönte Mauer von drei Türmen überragt – die schwarz-weiß-rote Reichsflagge. Das Bürgermilitär wurde abgeschafft und das Zweite Hanseatische Infanterieregiment preußischem Oberbefehl unterstellt. Ihren eigenen diplomatischen und konsularischen Dienst mußte die Stadt aufgeben, und ihre Bürger unterlagen jetzt der Besteuerung durch das Reich, was allerdings keine schwere Bürde bedeutete. Das hanseatische Rechtssystem mußte auf das des Reiches abgestimmt werden; die Verfassungsänderungen von 1879, bei denen die richterliche von der exekutiven Gewalt, wie auch die Richter von den Anwälten getrennt wurden, waren weitgehend eine Folge der Einführung des im Reich geltenden Strafrechts anstelle des bis dahin in Hamburg bestehenden.24
Nichts von alldem war der lautstarken Partei Alt-Hamburger Partikularisten im Senat recht, der die Bürgermeister Haller und Gossler sowie die Senatoren Sieveking und Rücker angehörten. Angeführt wurde sie von Bürgermeister Gustav Heinrich Kirchenpauer (geboren 1808, Senator seit 1843) und dem Senatssyndikus Karl Merck (geboren 1809, im Amt seit 1847).25 Von 1867 bis 1880 vertrat Kirchenpauer Hamburg im Bundesrat, in dessen Politik er einen «Imperialismus nach allen Richtungen» sah. Die Verfassung tadelte er als Gebilde, durch das «die Senate zu Magistraten herabgesunken» seien.26 Er widersetzte sich praktisch als einziger im Bundesrat Bismarcks Verfassungsvorschlägen und bekämpfte den Kanzler in den Fragen der Reichsflagge, des Militärdienstes und in vielen anderen. Selbst Bremen und Lübeck waren nicht bereit, ihn zu unterstützen. Bismarck seinerseits klagte, er sei in Kirchenpauer dem «engsten Partikularismus, einem Festhalten an Sonderinstitutionen, einer Abwehr gemeinsamer Lasten begegnet, wie bei keinem der Fürsten», löste eine Pressekampagne gegen Hamburg aus und zwang den Senat nachzugeben, was dieser unter schriftlichem Protest tat.27 Der mit Kirchenpauer gemeinsam für Hamburgs Außenpolitik verantwortliche Senatssyndikus Merck war noch stärker in partikularistischen Vorstellungen befangen als dieser. «Wir verhehlen es nicht», schrieb er, «wir wollen Hamburger bleiben, wir wehren uns mit Kopf und Fuß gegen die immer näher rückende Gefahr, denn was ist denn das ganze Wesen, welches Berlin erzeugt, anders als eine allmähliche Aussaugung?!» Er erwog 1869 auszuwandern, um dem zu entgehen, was er als demütigende Lage ansah, und verglich 1870, mitten im preußisch-französischen Krieg, den örtlichen preußischen Armeekommandanten in Hamburg mit Marschall Davout, der während der napoleonischen Kriege die französische Besatzungsmacht bei ihrer Plünderung Hamburgs angeführt hatte.28
Zwar weckte der bei Sedan 1870 erfochtene Sieg in Hamburg beträchtliche Begeisterung; doch zumindest von einem Senator hörte man, daß weitere rasche preußische Siege Hamburgs Autonomie gefährden würden.29 Tatsächlich sah der Senat Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts den Bundesrat ausschließlich im Licht kommunaler Eigeninteressen. So gelangt der Historiker Hans-Georg Schönhoff, der die Beziehungen Hamburgs zum Norddeutschen Bund untersucht hat, zu dem Ergebnis:
«Wie die Verhandlungen über die Verwaltungsgesetze, die Gewerbeordnung, die Matrikularumlagen und das Oberhandelsgericht zeigen, hat Hamburg sich stets gegen diese Maßnahmen gestemmt, um seine partikularen Eigenheiten zu wahren und möglichst wenig durch den neuen Bund in seinen bisherigen staatlichen Lebensgewohnheiten gestört zu werden.»30
Wenn es um Themen ging, an denen die Stadt kein Interesse hatte, was beispielsweise beim Kulturkampf der Fall war, folgte Hamburg der preußischen Linie; bei anderen, wie der Frage des Sozialistengesetzes, widersetzte sich die Stadt einfach deshalb, weil sie keinen Machtzuwachs für die Zentralregierung wünschte.31 Der Mehrzahl dieser Bemühungen war nur wenig Erfolg beschieden, obwohl der Senat bei der Gestaltung eines neuen Bankengesetzes32 eine Rolle zu spielen vermochte. Doch setzte sich Hamburg, was die Frage deutscher Konsulate betraf, gemeinsam mit Bremen durch und schlug, gewöhnlich mit Erfolg, für diese Posten, die für die Handelsinteressen der Hanseaten so bedeutsam waren, seine eigenen Kandidaten vor.33 All das machte die Hamburger bei den Preußen nicht gerade beliebt. «Die Hamburger», klagte der deutsche Botschafter in London im Dezember 1879, «sind die schlechtesten Deutschen die wir haben und mißbrauchen wo sie können die Reichsregierung nur für ihre Zwecke.»34 Der Senat nehme, wie ein anderer preußischer Beamter anmerkte, «an den Fragen der großen europäischen Politik höchstens so weit Anteil … wie sie auf das Börsengeschäft einwirkten».35
Zu jener Zeit jedoch gewann die pro-preußische Partei im Senat allmählich die Oberhand. An ihrer Spitze stand mit Johannes Versmann der bedeutendste Senator Hamburgs im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts.36 Es lohnt sich, seine Laufbahn näher ins Auge zu fassen, weil sie in mancherlei Hinsicht kennzeichnend für die Biographie zahlreicher führender Angehöriger des liberalen deutschen Bürgertums jener Zeit ist, aber auch, weil er bei den später in diesem Buch beschriebenen Ereignissen eine führende Rolle spielte. Er war einer jener seltenen Außenseiter, die allein durch Fähigkeiten und Charakterstärke ihren Weg in der Politik Hamburgs gemacht haben. Als Sohn eines Apothekers, dessen Vorfahren aus Uelzen stammten, 1820 auf St. Pauli außerhalb der Stadtgrenze zur Welt gekommen, gehörte er nicht zum inneren Kreis der vielfach miteinander verwandten Großkaufmannsfamilien der Hansestadt. Er war ein Schulfreund des späteren Althistorikers und liberalen Politikers Theodor Mommsen; beide gehörten von 1837 bis 1839 demselben wissenschaftlichen Verein an. Versmann besuchte in den Jahren 1839 und 1840 die Gelehrtenschule Johanneum in Hamburg und nahm dann ein Medizinstudium in Jena auf. Da ihm die Medizinische Fakultät in Jena nicht zusagte, wechselte er 1842 nach Göttingen und 1843/44 nach Heidelberg, wo er Jura belegte. Sein Studium schloß er 1844 ab. Nach Hamburg zurückgekehrt, trat er in eine Anwaltskanzlei ein und arbeitete dort zusammen mit Carl Petersen, später sein Mitsenator, auf dem Gebiet des Handelsrechts. Bald übernahm er eine aktive Rolle in der Politik. An der Universität hatte er bereits in liberalen Kreisen verkehrt und dort den späteren radikalen Demokraten Gustav Struve kennengelernt; im Jahr 1845 trat er dem St. Pauli-Bürgerverein bei und 1846 der Gesellschaft Hamburger Juristen – beides führende Institutionen der liberalen Opposition, die sich zu jener Zeit gegen die alte hamburgische Verfassung zu formieren begann.37
Die Revolution von 1848 rückte Versmann zum erstenmal in den Vordergrund. Er schloß sich einem Aufgebot von Freiwilligen an, das gegen Dänemark marschierte, am 9. April wurde er von den Dänen gefangen genommen und inhaftiert. Nach dem Waffenstillstand von Malmö wurde er entlassen und kehrte nach Hamburg zurück, wo er als einer der Sprecher der liberal-demokratischen Opposition auftrat und in die Konstituante gewählt wurde, die 1849 zusammentrat. Bald hatte er die Delegierten so beeindruckt, daß sie ihn am 14. März zum Vorsitzenden wählten. Aber die auf die preußischen Truppen gestützte Verzögerungstaktik des Senats machte das Werk der Konstituante zunichte. Versmanns letzte Ansprache vor ihrer Auflösung könnte als Motto über seiner gesamten politischen Laufbahn stehen. «Gegen die Macht der Ereignisse», sagte er, «vermag keiner anzukämpfen. Wohl uns, doppelt wohl, unter solchen Umständen, daß wir sagen können, wir haben unsere Pflicht getan.» Seine Bemühungen waren darauf gerichtet gewesen, Verwaltungskontinuität zu gewährleisten: Dabei sollten gerade so viele der alten Institutionen beseitigt werden, wie nötig war, um die Forderungen der Bevölkerung zu befriedigen. Geschlagen zog er sich aus dem öffentlichen Leben zurück, nahm seine Anwaltstätigkeit wieder auf und wurde 1859 Präses des Handelsgerichts. Die neue Verfassung von 1860 jedoch brachte Versmann die unmittelbare Wahl in die Bürgerschaft, deren Präsident er sogleich wurde. Seine erfolgreichen Bemühungen, mit dem Senat zu einem endgültigen Kompromiß über die verbleibenden Einzelfragen der Verfassungsreform zu gelangen, trugen ihm Zustimmung von allen Seiten ein. Er wurde 1861 Senator und bekleidete dieses Amt ohne Unterbrechung bis zu seinem Tod im Jahr 1899.
Während seiner ersten Jahre im Senat galt Versmann als «etwas isoliert», zweifellos wegen seiner eher einfachen Herkunft, wohl aber auch, weil er sich für Ziele einsetzte, die in Hamburg nicht allen am Herzen lagen. Beispielsweise war er ein Vorkämpfer der Verwaltungsreform; mehr als zwanzig Jahre lang bemühte er sich erfolglos, den Senat dazu zu überreden, er möge minder bedeutende Aufgaben einer mit Fachleuten besetzten Verwaltung übertragen. Er drängte auch darauf, fest besoldete höhere Beamte zu ernennen, lange bevor der Senat dies schließlich tat.38 Trotz des hohen Ansehens, das er im Senat genoß, war er nicht besonders beliebt – bei führenden Mitgliedern einer Körperschaft, die, um wirken zu können, in hohem Maße auf informelle gesellschaftliche Beziehungen angewiesen war, ein nicht gerade häufiges Phänomen. Johann Georg Mönckeberg, der private Nachrufe auf die Mehrzahl seiner Kollegen anlegte, hatte zu Versmann ausnahmsweise keine persönlichen Erinnerungen beizusteuern; er fügte lediglich ein Exemplar der saft- und kraftlosen Rede bei, die er bei der Vereidigung von Versmanns Nachfolger gehalten hatte.
Seine beherrschende Stellung im Senat gewann Versmann gleichermaßen durch seinen nüchternen politischen Realismus, die intellektuelle Kraft seiner Argumente sowie durch seine Geduld, Beharrlichkeit und bisweilen auch Gerissenheit, wenn er für eine Sache kämpfte, an die er glaubte (Mönckeberg nannte ihn «hartnäckig»). Vor allem aber war Versmann gründlich. Während sich andere Senatoren weiterhin ihren Geschäften widmeten oder einfach im Privatleben entspannten, arbeitete er, dessen «unermüdliche Arbeitskraft» ein Kollege hervorhob,39 sich in jede Materie ein, so daß er sich in allem auskannte, womit er sich beschäftigte. So kam es, daß andere, weniger energische Senatoren – die große Mehrheit also – einfach nichts gegen ihn auszurichten vermochten. Beispielsweise wurde 1887 Max Hayn als ältester kaufmännischer Senator zum Bürgermeister gewählt, um nach Kirchenpauers Tod für einige Monate die Lücke bis zur nächsten Wahl zu schließen. Doch: «Als Bürgermeister fungiert hat Hayn», Mönckeberg zufolge, «kaum, da Versmann mit großem Eifer die Geschäfte führte.»40 Von pessimistischem und schwermütigem Wesen, besaß Versmann einen scharfen Blick für die politische Wirklichkeit, wie er bereits 1849 bewiesen hatte – «jenen sechsten Sinn … der bei keinem wirklichen Politiker fehlen darf: die Witterung für das Mögliche und Erreichbare».41 Sein Biograph sah sich veranlaßt einzuräumen: «Hin und wieder hörte man allerdings, daß über seine kühle Zurückhaltung oder sein allzu absprechendes Urteil geklagt wurde.»42 Versmanns Ungeduld gegenüber Unfähigen wird auch bei einem nur flüchtigen Blick in seine umfangreichen Tagebücher hinreichend deutlich.
Er machte im Senat seinen Einfluß geltend, um die Alt-Hamburger Partikularisten 1866 und auch noch in den siebziger Jahren davon zu überzeugen, daß man dem preußischen Druck nachgeben müsse, und tat mehr als jeder andere, um die Einführung der Reichsgesetze und die Umorganisation des Schulwesens in der Stadt nach dem Beitritt zum Reich zu gewährleisten. Doch seinen größten Triumph erzielte er in der Frage des Zollanschlusses. Für die Hamburger Kaufleute galt als unumstößlicher Glaubensartikel, daß Freihandel die Grundlage wirtschaftlichen Wohlergehens sei. Nicht nur befürchteten sie, daß Zollschranken den Handel hemmen könnten, immer mehr Kaufleute waren auch im Import von Rohmaterial tätig, das sie weiterverarbeiteten und wieder ausführten, was nur in einem Freihandelssystem wirklich profitträchtig sein konnte. Daher weigerte sich Hamburg beharrlich, dem Deutschen Zollverein beizutreten, und erklärte bereits 1820: «Der Vorteil der deutschen Seestädte erheischte freien Handel. Von wem sie die Waren erhielten, wohin sie dieselben führten, käme gar nicht in Betracht.»43 Schon 1845 hatte Versmann, vorwiegend aus nationalen Gründen, einen Beitritt Hamburgs zum Deutschen Zollverein befürwortet.44 Doch noch dreißig Jahre später war sein Wunsch nicht erfüllt. Der Freihandel galt den Bürgern Hamburgs als eine Art Dogma; in ihm sahen sie nicht nur die Grundlage des Wohlstandes der Stadt, sondern ihrer gesamten Lebensweise. Diese Ansicht faßte der Präsident der Commerz-Deputation in einem Trinkspruch auf den englischen Freihandelsvorkämpfer Richard Cobden bei dessen Besuch in der Stadt 1847 zusammen: «Die Erzeugerin jeder anderen Freiheit, die Handelsfreiheit!»45 Wie der preußische Historiker Heinrich von Treitschke später klagte, hatten in Hamburg die Befürworter des Freihandels «nach deutscher Weise aus der Not nicht nur eine Tugend, sondern eine Theorie» gemacht.46
Nicht allein war es Hamburg gelungen, beim Beitritt zum Norddeutschen Bund 1866 seinen Status als zollfreier Hafen beizubehalten, die Stadt wollte auch noch nach der Gründung des Deutschen Reiches von 1871 nichts vom Zollverein wissen. Solange die Wirtschaftspolitik im Reich gleichfalls vom Freihandelsgedanken bestimmt wurde, schien es wenig Grund zur Sorge zu geben. Doch 1878 beendete Bismarck diese Periode, indem er die Einführung von Importzöllen verlangte: Er wollte zum einen den Finanzen des Reiches aufhelfen, aber auch die Nationalliberalen verwirren, auf die er seiner Ansicht nach zu sehr angewiesen war, zum anderen die Grundbesitzer und Industriellen beschwichtigen, die Schutz vor der ausländischen Konkurrenz verlangten. Die neue Ordnung erforderte, daß Hamburg, Deutschlands größtes Einfuhrzentrum, dem Zollverein beitrat. Die Alt-Hamburger Partikularisten verglichen diese Absicht mit der 1808 erfolgten Einverleibung der Stadt in das Reich Napoleons.47 Erneut stieß Kirchenpauer im Bundesrat mit Bismarck zusammen, diesmal aber war der vom Kanzler ausgehende Druck so stark – wozu auch die Drohung gehörte, Hamburg seinen Status als Freihafen mit Gewalt zu nehmen –, daß sich Kirchenpauer verpflichtet fühlte, seine Position als Bevollmächtigter Hamburgs im Bundesrat an Versmann abzutreten, da der Erfolg von Bismarcks Politik langfristig unaufhaltbar schien. Senat und Kaufmannschaft zerstritten sich in einer hitzigen Debatte über die Frage, ob die Stadt dem deutschen Zollverein beitreten sollte oder nicht. Versmann steuerte, unterstützt von Senatssyndikus Roeloffs, der zugleich sein «Alter ego» und seine rechte Hand war, einen behutsamen Mittelkurs zwischen den verfeindeten Parteien.48 Er verhandelte über einige Punkte, ohne den Senat davon in Kenntnis zu setzen, und organisierte in Hamburg sogar öffentlichen Widerstand gegen den Zollverein, um von Bismarck so viele Zugeständnisse zu erreichen, daß die neue politische Linie für die Freihandelsmehrheit im Senat annehmbar wurde.49 Schließlich wurde 1881 der von Versmann angebotene Vorschlag angenommen. Er sah im Hamburger Hafen ein riesiges neues zollfreies Gebiet vor, das zollrechtlich vom Hinterland abgeriegelt werden sollte. Diesen Freihafen, der der Exportindustrie Areale für ihre Produktion bot, durfte Hamburg selbst verwalten und erhielt auch die Zusicherung, das könne auf vergleichsweise unbürokratische Art geschehen.50
Die Eröffnung des neuen Freihafens und der Beitritt Hamburgs zum Deutschen Zollverein, der schließlich 1888 erfolgte, hatten tiefgreifende Auswirkungen auf das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben der Stadt. Zunächst aber bedeuteten sie das Ende der Alt-Hamburger Partikularisten und den Sieg der pro-preußischen Partei. Vom Augenblick seines Triumphes im Jahr 1881 bis zu seinem Tod im Jahr 1899 war Versmann, im Senat von einer immer größeren Anzahl seiner Schützlinge, wie beispielsweise Mönckeberg und Burchard, unterstützt, die beherrschende Figur der Hamburger Politik. Sein einziger Rivale, der 1808 geborene Senator Carl Petersen, war bereits ein älterer Herr und stimmte ohnehin zu jener Zeit in den meisten entscheidenden Fragen mit ihm überein. Nicht ohne Bedeutung war die Tatsache, daß Versmann am 21. März 1899 zum letztenmal auf der politischen Bühne ausgerechnet in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des hamburgischen Zweigs des Deutschen Flottenvereins auftrat. Dabei sprach er sich für den Bau einer deutschen Kriegsflotte aus. Dieser Sache hatte er sich bereits 1861 aktiv verschrieben. Als liberaler Nationalist, der seinen Zielen nie untreu geworden war, hatte er zusammen mit dem größten Teil des deutschen Bürgertums einen langen Weg vom Widerstand im Jahr 1848 zur Unterstützung der auf Expansion gerichteten Weltpolitik der Reichsleitung um die Jahrhundertwende zurückgelegt.51
Nationales Empfinden war jedoch keineswegs unvereinbar mit dem Wunsch, regionale Besonderheiten beizubehalten, noch weniger mit dem Verlangen, Hamburgs Handel die bestmöglichen politischen Bedingungen zu sichern.52 Ebenso wie Historiker die Heftigkeit und Stärke partikularistischer Gefühle im zweiten und dritten Viertel des 19. Jahrhunderts in Deutschland immer wieder unterschätzten, haben sie auch oft die Intensität überschätzt, mit der im Deutschen Reich in den letzten 25 Jahren jenes Jahrhunderts zentralistische und auf Vereinheitlichung gerichtete Tendenzen wirksam waren. Wie auch immer die Herrschenden in Hamburg die Interessen des Deutschen Reiches als Großmacht einschätzten, sie hielten unverrückbar an dem Grundsatz fest, nicht die Preußen, sondern sie selbst seien am besten imstande zu beurteilen, was für Hamburg gut war. «Hamburg möge die Eigenthümlichkeiten erhalten, welche Niemand schaden … Man möge sie schützen, so lange man könne.»53 Ob das in großem Ausmaß möglich sei, bezweifelten Männer wie Versmann unverhohlen, der eine mit «Aufzeichnungen betr. Maßnahmen und Forderungen bei Verlust der Selbständigkeit Hamburgs»54 gekennzeichnete Akte führte, doch daß die Selbstbehauptung der Hansestadt eines Versuchs wert war, mochte nicht einmal er bestreiten.
II
Hamburgs Besonderheiten begannen schon mit seiner halb- oder quasiparlamentarischen republikanischen Staatsverfassung. Während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts regierte sich die Stadt in allen wesentlichen Belangen selbst, entsprechend der als «Hauptrezeß» bezeichneten Verfassung, die ihr der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches 1712 in einem Versuch auferlegt hatte, einen über Jahre hinweg dauernden heftigen Streit zwischen Rat und Bürgern zu beenden. Nach dieser Verfassung wurde die Stadt vom Rat oder Senat gemeinsam mit der Erbgesessenen Bürgerschaft regiert. Allein solche Gesetze durften erlassen werden, die von beiden gebilligt wurden, obwohl der Erbgesessenen Bürgerschaft in der Praxis nur das Recht zustand, Entscheidungen ihre Zustimmung zu verweigern. Der Senat bestand aus vier Bürgermeistern55





























