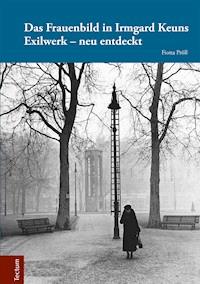
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum-Verlag
- Sprache: Deutsch
"Man darf da nicht bequem werden und die Augen schließen." Dieser Satz, den Irmgard Keun während ihres Exils an Arnold Strauss schrieb, fasst wie kaum ein anderer ihr literarisches Werk zusammen: das unbedingte Sehenwollen. Als Autorin verstand es Keun als ihre Aufgabe, die Augen angesichts des Zeitgeschehens offenzuhalten. Ihre Protagonistinnen sind visuelle Charaktere. Sie gehen mit einem wachen Blick durch eine Zeit, in der viele die Realität nicht wahrnehmen möchten. Fiona Pröll setzt sich mit dem Konzept des Sehens in Keuns Exilwerken "Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften" (1936), "Nach Mitternacht" (1937), "D-Zug dritter Klasse" (1938) und "Kind aller Länder" (1938) auseinander. Im Fokus ihrer Untersuchung steht der weibliche Blick auf die faschistische Gesellschaft – der Zusammenhang von weiblichem Sehen, Verbalisieren, Durchblicken, Handeln und zuletzt dem Bewältigen. Keuns Protagonistinnen zeigen sich dabei nicht als passive Sammelbecken der Sinneseindrücke, die auf sie einströmen. Das Gesehene arbeitet in ihnen weiter, wird überdacht, strukturiert und dient schließlich als Handlungsmotivation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag
Reihe Literaturwissenschaft
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag
Reihe: Literaturwissenschaft
Band 44
Fiona Pröll
Das Frauenbild in Irmgard Keuns Exilwerk – neu entdeckt
Tectum Verlag
Fiona Pröll
Das Frauenbild in Irmgard Keuns Exilwerk – neu entdeckt
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum VerlagReihe: Literaturwissenschaft; Bd. 44
© Tectum Verlag Marburg, 2017
ISBN: 978-3-8288-6627-0
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter
der ISBN 978-3-8288-3874-1 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung: Berlin, Am Dönhoffplatz, 1941; Bundesarchiv, Bild 183-B01618
Satz, Layout, Umschlaggestaltung: Mareike Gill | Tectum Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internetwww.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
„[…] als hätten wir Freikarten für einen Theaterplatz, auf den wir eigentlich nicht gehören […]“
Gerti, Nach Mitternacht
„Man darf da nicht bequem werden und die Augen schließen.“
Irmgard Keun, Briefe an Arnold Strauss
Inhaltsverzeichnis
1Einleitung: Der weibliche Blick in Irmgard Keuns Exilromanen
2Der weibliche Blick auf die faschistische Gesellschaft in Irmgard Keuns Exilromanen: Braucht es die Perspektive der Frauen, um die braune Lebenswirklichkeit zu durchblicken und aktiv zu bewältigen?
2.1Die Geschlechterrollen – stereotype Weiblichkeit und Männlichkeit?
2.1.1Von Frauen und Männern: Die Geschlechterrollen im Personal
2.1.2Was ist von der Neuen Frau übriggeblieben?
2.1.3Die sprachliche Darstellung als Mittel der Typisierung
2.1.4Die Protagonistin und ihr Identifikationspotential
2.1.5Die Geschlechterrollen im Spiegel der NS-Ideologie
2.2Was den Blick geprägt hat: Sehen in der Neuen Sachlichkeit
2.2.1Keuns Exilwerke als Weiterführung der Neuen Sachlichkeit
2.2.2Neue Sachlichkeit als Literatur des unverstellten Blicks auf die Realität
2.2.3Literatur wie Kino
2.3Die Erzählerinstanz
2.3.1Perspektive
2.3.2Stimme
2.3.3Erzähler oder Erzählerin?
2.4Der Blick als Voraussetzung für Aktivität
2.4.1Sehen und gesehen werden
2.4.2Vom Objekt zum Subjekt
2.5Arten des Sehens: Nur den eigenen Augen trauen?
2.5.1Mit offenen Augen durch die Welt gehen
2.5.2Das Beobachten
2.5.3Der intellektuelle Zugewinn durch die Sicht eines Zweiten
2.6Berichten von dem, was man gesehen hat
2.6.1Die Protagonistin als Reporterin
2.6.2Sprache und Stil
2.7Der Autor, die Autorin und die Sekretärin
2.7.1Das Modell des erfolglosen Autors
2.7.2Legitimation für weibliches Schreiben
2.8Die Sicht der Dinge – Ausdruck eines weiblichen Humors?
2.9Der Blick als Voraussetzung für Erkenntnis: Der Durchblick
2.9.1Der Überblick der Zeitspanne: Zurückblicken, sehen, voraussehen
2.9.2Strategien der Erkenntnisgewinnung
2.9.2.1Das Verfahren der reflektierten Naivität
2.9.2.2Das Durchleuchten
2.9.3Der Durchblick von Politik und konkreter Lebenswirklichkeit
2.10Die Überwindung des weiblichen Zweifels
2.11Das Bild, das sich dem Beobachter bietet: Das Leben im Nationalsozialismus
2.11.1Die scheinbar oberflächlich dargestellte Gesellschaft
2.11.2Faschistische Strukturen in der Gesellschaft
2.11.3Einblicke in die politische Lage
2.12Illusionen, Lügen und das große Schauspiel: Die Welt als Bühne
2.12.1Das Dritte Reich als Täuschungsspiel
2.12.2Der Alltag als Bühne
2.13Das Gesehene: Subjektive Wahrnehmung, Wahrheit oder beides?
2.13.1Das Ende des wahrheitsstiftenden Blicks?
2.13.2Objektivierungs- und Verallgemeinerungsstrategien des Gesehenen
2.14Der Blick als Voraussetzung zum Handeln
2.14.1Die traditionelle Zuschreibung der Handlungsfähigkeit zu den Geschlechtern
2.14.2Die Frau beginnt zu handeln
2.14.3Genügt einzig der Blick, um zu handeln?
2.15Die (Über-)Lebensstrategie
2.15.1Das selbstverantwortliche Gestalten des eigenen Lebens
2.15.2Das sich Stellen der Lebenswirklichkeit
2.15.3Die starke Frau gibt sich schwach
2.16Faschismus – ein männliches Problem?
2.16.1Charakteristika der faschistischen Ideologie
2.16.2Systemanhänger und Systemgegner
2.16.3Gründe für das Auftreten des Faschismus
2.16.4Strategien zur Überwindung: Hilft Weiblichkeit?
3Resümee: Der weibliche Blick – Synonym für einen am Leben interessierten Blick
Zusammenfassung der Ergebnisse
Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Sekundärliteratur
1Einleitung: Der weibliche Blick in Irmgard Keuns Exilromanen
„Man darf da nicht bequem werden und die Augen schließen.“1 Diesen Satz schrieb Irmgard Keun während ihres Exils an Arnold Strauss und er fasst wie kaum ein anderer zusammen, was Keuns gesamtes literarisches Werk ausmacht: das unbedingte Sehenwollen. Keun verstand es als ihre Aufgabe als Autorin, die Augen angesichts des Zeitgeschehens offenzuhalten. Mit einem wachen und „klare[n] Blick“2 spürte sie soziale und politische Missstände auf, verfolgte sie und machte sie zum Gegenstand ihrer literarischen Auseinandersetzung. Keuns Metier war stets der Zeitroman,3 in dem sie die Auswüchse ihrer Epoche anprangerte, „schonungslos offen“4 Einblicke in die Psyche ihrer Mitmenschen gewährte5 und gegen die „mit Falschheit möblierte Enge dieser Welt“6 anschrieb. Den Ausgangspunkt aller ihrer Romane bilden aktuelle Beobachtungen.7 Dementsprechend liest sich ihr sieben Oeuvre umfassendes Romanwerk auch wie eine Chronik der deutschen Gesellschaft, angefangen bei der Weimarer Republik bis hin zur Nachkriegszeit.8
Trotz ihrer offenkundig politischen und sozialkritischen Haltung tragen Keuns Romane den Anschein, „mit leichter Hand geschrieben“9 worden zu sein. Sie sind humorvoll und erzählen vom Leben der sogenannten kleinen Leute, sodass sie, wie Doris Rosenstein bemerkt, auf den ersten Blick „keine tiefgreifende Substanz erwarten“10 lassen. Stuft man die Werke als Trivialliteratur ein, wie es besonders in der zeitgenössischen Rezeption der Fall war, und versucht sie als leichte Unterhaltung zu lesen, so wird man immer wieder auf Passagen stoßen, bei denen sich die triviale Lesart an der Erzählung reibt und sie als falsch ausweist. Es handelt sich eben um jene Stellen, die radikale Schicksalsschläge oder Grausamkeiten der Lebenswirklichkeit abbilden, oder auch um solche, die aufgrund der Aussagen einzelner Figuren auf eine intellektuelle Ebene umschwenken.11 An diesen Stellen setzt die vorliegende Arbeit an. Sie wird versuchen zu zeigen, inwiefern sich die Werke auf einer höheren Sinnebene verstehen lassen – nicht zuletzt, da sie populäre Diskurse aufgreifen, explizite politische Aussagen enthalten und auch auf poetologischer Ebene entzifferbar sind, sodass sie einer literaturwissenschaftlichen Untersuchung zahlreiche Ansatzpunkte bieten.
Das hauptsächliche Interesse der Keun-Forschung galt meist ihren ersten beiden Romanen „Gilgi – eine von uns“ und „Das kunstseidene Mädchen“. Zur Zeit ihres Erscheinens Anfang der 30er Jahre wurde den Werken großes öffentliches Interesse zuteil, von Seiten sowohl eines großen Lesepublikums als auch der Literaturkritik. Namhafte Autoren wie etwa Kurt Tucholsky rezensierten die Neuerscheinungen. Ihre Position als eine der populärsten deutschsprachigen Autorinnen verlor Keun durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten abrupt. Ihre Romane wurden auf die Verbotslisten gesetzt, während des Dritten Reichs konnte keine öffentliche Auseinandersetzung mit ihrer Literatur mehr stattfinden. Die Werke, welche sie in der Emigration verfasste, blieben von der deutschen Öffentlichkeit ungelesen. Auch im Deutschland der Nachkriegszeit gelang es der Schriftstellerin nicht mehr, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Sie geriet zunehmend in Vergessenheit. Dank der feministischen Bewegung der 60er und 70er Jahre sowie der wachsenden Bereitschaft der deutschen Öffentlichkeit, sich literarisch wieder mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, entdeckte in den 70er Jahren eine breite Leserschaft Keun neu. Dementsprechend nahm auch das Forschungsinteresse an der Autorin zu, wie zahlreiche Arbeiten aus jener Zeit belegen, wobei vor allem ihre beiden Erstlingswerke im Fokus der Aufmerksamkeit standen.
Um die Jahrtausendwende erfuhr die Keun-Forschung einen erneuten Schub, der sich sicherlich auch mit Keuns hundertstem Geburtstag im Jahr 2005 erklären lässt. Werke wie Stefanie Arends und Ariane Martins gemeinsam herausgegebenes Buch „Irmgard Keun 1905/2005“ bekräftigen diese Annahme. Kennzeichnend für die Keun-Forschung des neuen Jahrtausends ist vor allem, dass das Interesse nun zunehmend auch den Exilwerken gilt. Vergleichende Arbeiten zu den Werken aus dem Exil sind jedoch bis heute weiterhin kaum vorhanden. Sichtet man die Forschungsliteratur zu Keun, so lässt sich zusammenfassend sagen: Generell hat die Forschung Keuns Werke relativ spät für sich entdeckt, vielleicht auch, da ihren Romanen lange der Status von Trivialliteratur anhaftete.
Im Überblick über die vorhandene Sekundärliteratur zeigt sich die Tendenz, Keuns Werke vom Ansatz der Gender Studies zu untersuchen. Zweifelsfrei bildet die Genderthematik einen Schwerpunkt in Keuns Oeuvre. Mit Ausnahme von Keuns letztem Roman „Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen“ steht in allen ihren Prosaerzählungen das Bewusstsein einer jungen Protagonistin im Mittelpunkt der Handlung.12 Wie Rosenstein in „Irmgard Keun: Das Erzählwerk der dreißiger Jahre“ ausführlich erörtert, vertreten die Heldinnen in den Romanen der Weimarer Republik den Typus der Neuen Frau. Meist machen die Forschungsarbeiten die Darstellung der Geschlechterrollen im Allgemeinen und der Neuen Frau im Besonderen zum Gegenstand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Doch auch in Keuns Werken, die zur Zeit des Dritten Reichs spielen, lassen sich – wie besonders Ritta Jo Horsley in „This Number is Not in Service“ detailliert nachzeichnet – noch Wesenszüge der Neuen Frau bei den Protagonistinnen erkennen. Sie können – ausformuliert in Barbara Dreschers „Junge ‚Girl‘-Autorinnen im Exil“ – als eine Weiterentwicklung des Typus verstanden werden. Die jungen Protagonistinnen verwirklichen „emanzipatorisch fundierte Ideale“13, obschon sich Keun selbst als auch ihre Werke stets von jeder Form eines radikalen Feminismus, der „irgendwie zu einer Sekte ausartet“14, distanzierte.
Die Ausgangsthese der vorliegenden Arbeit ist, dass die Zeit des Nationalsozialismus mit dem in den Werken aufgerufenen Bild von Weiblichkeit in Verbindung steht. Da davon ausgegangen werden soll, dass intertextuelle Referenzen zwischen den Exilwerken und den beiden Frühwerken bestehen, wird angenommen, dass der Leser dazu ermutigt wird, die Weiblichkeit in den ersten Romanen mit derjenigen in denen der Emigration zu vergleichen. Die männlichen Figuren sollen dabei als Abgleichsfläche zum Weiblichen dienen. Sie werden in der Argumentation angeführt, wenn sie als Kontrast dazu dienen, den weiblichen Standpunkt näher zu konturieren.
In enger Verknüpfung mit dem Sujet der Neuen Frau wird in zahlreichen Werken auch deren Blick untersucht, wie etwa in Anne Fleigs „Das Tagebuch als Glanz“. Keuns Protagonistinnen sind kein passives Sammelbecken der Sinneseindrücke, die auf sie einströmen. Sie sind visuelle Charaktere, ihr schärfster Sinn ist das Sehen. Sie gehen mit einem offenen Blick durch eine Zeit, in der viele die Augen verschließen. Die Heldinnen sehen genau hin und durchleuchten ihre Umwelt, wie Birgit Maier-Katkin in „Alterity, Alienation, and Exile in Irmgard Keun’s Nach Mitternacht“ anhand des Romans exemplarisch nachweist. Das Gesehene arbeitet in ihnen weiter, wird überdacht, strukturiert und dient letztlich als Handlungsmotivation.
Die Sekundärliteratur behandelt zumeist ausschließlich den Blick in den beiden Romanen der Weimarer Republik. Nur wenige Untersuchungen, wie etwa Horsleys „Witness, Critic, Victim“ setzen sich bislang mit dem Konzept des Sehens in den Exilwerken auseinander. Eine wissenschaftliche Untersuchung der Darstellung des Blicks, der Arten zu sehen und zu begreifen sowie eine Analyse des Einflusses, der vom Gesehenen auf das Handeln der Protagonistinnen ausgeht, fehlt bislang völlig.
Diese Forschungslücke will die vorliegende Arbeit schließen. Sie beschäftigt sich mit dem weiblichen Blick auf die faschistische Gesellschaft in Irmgard Keuns Exilromanen. Keun greift mit dem Sehen, dem sogenannten „Augenmotiv“15 als Sujet ihrer Werke ein beliebtes Konstrukt der neueren deutschsprachigen Literatur auf. Hier hat sich die Vorstellung durchgesetzt, unter dem Begriff des Sehens zugleich zweierlei Vorgänge zu verstehen: Während das äußere Sehen die optische Wahrnehmung der Umwelt bezeichnet, steht das innere Sehen für den geistig stattfindenden Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozess.16 Auch die vorliegende Arbeit begreift das Sehen in dieser Dichotomie.
Das Sehen gilt in der modernen abendländischen Kultur als die wichtigste Sinneswahrnehmung des Menschen17 und entsprechend zahlreich sind seit der Romantik die Versuche, sich ihm im Rahmen der Literatur zu nähern – sei es in Auseinandersetzung mit der Frage, inwiefern der Blick als das Ergebnis einer subjektiven Perspektive und Wahrnehmung18 durch persönliche Vorannahmen, Denk- und Wahrnehmungsgewohnheiten determiniert ist, wobei etwa Johann Wolfgang von Goethe in seinem Gedicht „Aug’ um Ohr“ mit den Worten „doch ein Blick am rechten Orte// Übrig läßt er keinen Wahn“19 für einen objektiven, die gesamte Umwelt erfassenden Blick plädiert, wohingegen sich zum Beispiel der Protagonist in Franz Kafkas „Der Process“ damit abfinden muss, dass er durch Guckkästen und Schlüssellöcher immer nur Ausschnitte zu erkennen vermag, welche er „spekulativ zu einem stimmigen Gesamten“20 zusammensetzen muss. Sei es im Ausloten der sozialen Funktion des Blicks, als einer „Wahrnehmung des Anderen“21 und von sich selbst in dem Gegenüber innerhalb eines eng gewobenen gesellschaftlichen Blickgeflechts, wie es etwa Valerio in Georg Büchners „Leonce und Lena“ mit der Bitte, „sehen Sie mich nicht so an, daß ich mich in ihren Augen spiegeln muß“22, thematisiert.
Dichtung, so Novalis, gestaltet sich als eine „Mahlerey für das innere Auge“23. Sie fungiert als Mittel, in der Diegese beschriebene Bilder dem Leser zu vermitteln und sie in seiner Vorstellung zu erzeugen. Um diese untersuchen zu können, müssen, Volker Mergenthaler zufolge, in der literaturwissenschaftlichen Analyse die Kategorien Literatur und Wahrnehmung strikt voneinander getrennt werden.24 Es ist als Prämisse anzunehmen, dass die Sinneserfahrung von Bildern nur in der realen Welt stattfindet und literarische Werke diese dann als Thema aufgreifen. Mergenthaler spricht in diesem Zusammenhang von „illusionserzeugender Selbstverleugnung“25 in Texten. Es gilt nachzuvollziehen, welcher Blick dem Leser durch die Erzählung vermittelt wird, und nicht, wie sich der Text selbst als Gegenstand der optischen Wahrnehmung des Lesers verhält.
Thematisieren literarische Werke das Sehen, verorten sie sich mit ihren Argumentationsstrukturen und Denkmustern innerhalb des interdisziplinären Blickdiskurses. Dementsprechend soll in der vorliegenden Arbeit das Konzept des Sehens in Keuns Romanen innerhalb des Diskurses gelesen werden. Dessen Ursprünge gehen bis auf die Antike zurück, mit Aristoteles’ Überlegungen, der die Welt als Abbild einer höheren Vorstellung begriff, welche wiederum durch Literatur und Kunst transkribiert bzw. abgebildet werden könne.26 Der moderne Blickdiskurs speist sich vor allem von Seiten der Philosophie, Psychoanalyse, der Theater- und Medienwissenschaft sowie aus Medizin, Wahrnehmungspsychologie und nicht zuletzt der Literaturwissenschaft. Wichtige Überblickswerke legen ihren Schwerpunkt auf das Aufzeigen von Parallelen und Anknüpfungsmöglichkeiten bezüglich der Ergebnisse der einzelnen zuarbeitenden Disziplinen. So verbindet etwa Jürgen Mantheys „Wenn Blicke zeugen könnten“ Befunde aus Literaturwissenschaft, Psychologie und Philosophie miteinander. Während zum Beispiel Mergenthalers „Sehen schreiben – Schreiben sehen“ das Zusammenwirken von physiologischen Erkenntnissen und Literatur darlegt. Auch einschlägige Forschungsarbeiten bedienen sich in ihrer Argumentation häufig der verschiedenen Wissenschaften, wie etwa Luce Irigarays Studien von Ansätzen aus Philosophie und Theaterwissenschaft geprägt sind.
In der vorliegenden Arbeit wird sich der Großteil der blicktheoretischen Argumente neben den eben angeführten Werken aus Jacques Lacans psychoanalytischen Arbeiten sowie Teresa de Lauretis cineastischer Blicktheorie, gerade aufgrund der in der Untersuchung nachzuweisenden Nähe der Romane zu den Konzepten von Kino und Theater, speisen. Ziel der in die Argumentation eingeflochtenen Blicktheorien ist es, das Blickmotiv in den Romanen im geistesgeschichtlichen Kontext der abendländischen Kultur anhand exemplarischer theoretischer Ansätze möglichst umfassend analysieren zu können.
In der vorliegenden Arbeit soll der Zusammenhang von Blicken, Verbalisieren, Durchblicken, Handeln und Bewältigen in den Romanen nachgezeichnet und die einzelnen Schritte im wechselseitigen Zusammenhang mit der faschistischen Lebenswirklichkeit, in der sich die Protagonistinnen bewegen, untersucht werden. Es wird zu einem Abgleich der einzelnen Protagonistinnen kommen. Die jungen Heldinnen sollen als Modelle verschiedener Überlebensstrategien vom Sehen bis zur Zielerreichung gelesen werden. Ihr Reüssieren oder Scheitern wird als wichtige Implikation für die Romanaussage verstanden. Da, wie bereits erwähnt, die Forschungslage zur Exilliteratur trotz des neueren Booms immer noch lückenhaft ist, stützt sich die vorliegende Arbeit teilweise auch auf Forschungswerke, welche sich auf die beiden Erstlingsromane beziehen. Ihnen werden Thesen und Argumente entliehen, um diese auf ihre Übertragbarkeit hin zu überprüfen.
Warum sollen nun die Exilwerke in Verbindung mit dem Blickmotiv das Thema der vorliegenden Arbeit sein? Keun schrieb mit den Werken aus der Emigration gegen das nationalsozialistische Regime an. Sie macht es zum Betrachtungsgegenstand der Protagonistin, sodass in den Romanen nicht nur der Vorgang des Sehens selbst von Bedeutung ist, sondern auch das Gesehene: die faschistische Gesellschaft. Es entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen der Sehenden und dem Gesehenen, zumal der Akt des Sehens, indem er in der Zeit des Nationalsozialismus verortet wird, in einer gefahrenträchtigen Ausnahmesituation stattfindet. Es wird in der vorliegenden Arbeit angenommen, dass in dieser Lage dem Sehen ein besonderer Stellenwert im Überlebenskampf zugeschrieben wird.
Irmgard Keuns Verortung gegenüber dem faschistischen Regime wird in der Forschung kontrovers diskutiert. Tatsache ist, dass die Autorin einen Antrag auf Annahme in der Reichsschrifttumskammer stellte. Sie wollte auch unter dem NS-Regime weiter im deutschen Literaturbetrieb veröffentlichen. Tatsache ist aber auch, dass die Bewerbung 1934 endgültig abgelehnt wurde und damit ein Berufsverbot gegen sie erging. Bereits ein Jahr zuvor war „Das kunstseidene Mädchen“ auf die „Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ gesetzt worden. 1935 wurde „Gilgi – eine von uns“ beschlagnahmt.27 Die Nationalsozialisten stuften Keuns Romane als nicht regimekonform ein – und das zurecht. Alle von Keuns Werken, besonders diejenigen nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, vertreten einen antifaschistischen Standpunkt. Über den Zugang des Blicks der Protagonistin soll in der vorliegenden Arbeit das antifaschistische Schreiben Keuns näher betrachtet werden. Irmgard Keun selbst sah ihre schriftstellerische Aufgabe „im Kampf gegen Nazitum“28. Sie schrieb gegen die Landsleute an, die „von der Parkettloge“29 aus das grausame Schauspiel der Nazis verfolgen. Keun verstand sich selbst als politische Autorin, „die anklagt“30 und Dinge beim Namen nennt.
Die vorliegende Arbeit begreift Irmgard Keun in ihrer Funktion als Schriftstellerin der Emigration. Am 4. Mai 1936 emigrierte sie nach Ostende.31 In den Exilromanen beobachtet sie das Geschehen in Deutschland aus der Ferne. Sie blickt in den Werken „mit den fremden Augen“32 ihrer Zeitgenossen und macht so deren Denken und Handeln nachvollziehbar. Als Exilwerke werden diejenigen Romane verstanden, die nach Keuns Ausreise aus Deutschland bei Verlagen im Ausland ihre Erstveröffentlichung hatten. Schwerpunktmäßig bilden die vier Werke „Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften“ (1936), „Nach Mitternacht“ (1937), „D-Zug dritter Klasse“ (1938) und „Kind aller Länder“ (1938) den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Für ein umfassenderes Verständnis von Keuns Schaffen im Exil werden zudem die Sammlung „Bilder und Gedichte aus der Emigration“ (1947) und die publizierte Korrespondenz „Ich lebe in einem wilden Wirbel. Briefe an Arnold Strauss. 1933 bis 1947“ der Analyse hinzugezogen.
Die Entscheidung, „Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften“, ein als fiktive Kindheitserinnerung verfasster Roman, der großteils noch vor der Emigration geschrieben wurde, als Exilwerk aufzufassen, begründet sich auf dem Abwägen mehrerer Gesichtspunkte. Seit Sommer 1933 plante Keun zu emigrieren. Zu jener Zeit begann sie die Arbeit an dem Buch.33 Sie befand sich schon in einer Form der inneren Emigration und distanzierte sich vom NS-Staat. Den Roman konnte sie in Deutschland nicht mehr veröffentlichen. Erst im Exil vollendete und publizierte sie ihn dann.
Zudem steht die Überlegung, wie sich Keuns Werk am sinnvollsten in Schaffensblöcke unterteilen lässt. Die vorliegende Arbeit plädiert für die drei Perioden: Werke der Weimarer Republik (1931 bis 1932), Werke der Emigration (1936 bis 1947) und Nachkriegswerk (1950 bis 1962). Geht man von Keuns Werken als Werken der Zeitkritik aus, so erscheint diese Dreiteilung anhand der gesellschaftlich-politischen Perioden in Deutschland gerechtfertigt.
In ihren ersten beiden Romanen „Gilgi – eine von uns“ (1931) und „Das kunstseidene Mädchen“ (1932) wird das Leben junger Frauen beschrieben, die in einer Gesellschaft, welche vom sich ankündigenden Ende der Weimarer Republik geprägt ist, aus ihrem Alltag ausbrechen,34 um einen für sie passenden neuen Lebensentwurf zu finden. Hier geht es um den Zweifel, „det einer wieder hochkommt, der mal bei’s Rutschen ist“35, exemplarisch nachgezeichnet an den Protagonistinnen, denn „was zuerst fällt, so daß alle es sehen, das ist immer die Frau“36. Die vorliegende Arbeit wird die beiden Romane innerhalb der Argumentation in denjenigen Aspekten aufgreifen, wo eine vergleichende Gegenüberstellung mit den Exilromanen lohnend erscheint.
In den Werken der Emigration rückt eine andere Thematik in den Mittelpunkt: das (Über-)Leben angesichts des NS-Regimes und dessen Bedrohungen für die Bevölkerung sowie für die politische Zukunft Deutschlands und Europas. Wie Sabine Rohlf anführt, lassen sich in „Nach Mitternacht“, „D-Zug dritter Klasse“ und „Kind aller Länder“ explizite politische Aussagen finden. In „Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften“ sei im Gegensatz dazu „keine direkte politische Stellungnahme“37 vorhanden. Die vorliegende Arbeit wird versuchen zu zeigen, dass auch hier antifaschistische Position bezogen und damit das NS-System angeprangert wird. Es lassen sich inhaltliche Parallelen zur faschistischen Gesellschaft, wie sie in den übrigen Exilromanen beschrieben wird, finden. Die Thematik der beiden Erstlingsromane, das Leben in der Weimarer Republik, findet sich hier nicht mehr. Dementsprechend kann „Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften“ sehr wohl als Keuns „Entree als Exilautorin“38 verstanden werden.
Da sich die vorliegende Arbeit im Ansatz der Geschlechterforschung begreift, wird zum besseren Verständnis von Keuns Genderauffassung punktuell auch auf ihre satirischen Textsammlungen aus der Nachkriegszeit „Scherz-Artikel“ (1951), „Wenn wir alle gut wären“ (1954) und „Blühende Neurosen“ (1962) zurückgegriffen, sowie auf Keuns Nachkriegsroman „Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen“ (1950), zumal hier eine erstaunlich feminin gezeichnete Hauptfigur auftritt.
Häufig stößt man in der Forschungsliteratur auf die Annahme einer engen Verflechtung von Keuns Biographie und den Inhalten ihrer Werke. In der vorliegenden Arbeit werden biographische Aspekte der Autorin ausgeklammert. Die Argumentation möchte die Werke unabhängig für sich analysieren. Bewusst soll dem früher weit verbreiteten Ansatz innerhalb der Gender Studies nicht entsprochen werden, der vor allem in den Werken von Schriftstellerinnen eine biographische Lesart wählte. Es mag ein Zitat aus Keuns Essay „Dienen lerne beizeiten das Weib…“ gelten: „Man soll nicht immer die Aussprüche seiner Figuren für die unumstößliche Meinung des Autors halten“39.
Um all diesen Überlegungen gerecht zu werden, wird die vorliegende Arbeit zunächst zeigen, wie typenhaft Keun die Geschlechterrollen innerhalb des Figureninventars gestaltet, wodurch das Konzept eines explizit weiblichen Blicks erst ermöglicht wird. Dann soll betrachtet werden, welche Ästhetik die Darstellung des Blicks geprägt hat. Keuns erste beiden Romane gelten als Werke der Neuen Sachlichkeit. Zahlreiche Forschungsarbeiten, wie zum Beispiel Irene Lorisikas „Frauendarstellungen bei Irmgard Keun und Anna Seghers“ weisen diese Zuordnung detailliert nach. Dass jedoch auch noch die Exilromane vom Wesen der Neuen Sachlichkeit geprägt sind, demonstriert unter anderem Gesche Blume in „Irmgard Keun. Schreiben im Spiel mit der Moderne“. Zudem soll untersucht werden, aus welcher Perspektive, mit welcher Erzählerinstanz sich der geschilderte Blick dem Leser bietet. Dass in Keuns Romanen das Sehen der Protagonistinnen durchaus unterschiedliche Formen annimmt, wird daraufhin gezeigt werden.
Nach dem Untersuchungsblock mit dem Sehen als Gegenstand der Auseinandersetzung steht anschließend dessen Verbalisierung im Fokus. Nachverfolgt wird, wie der Blick als Grundlage für das Berichten zu einer Legitimation für weibliche Autorschaft führt. Eng damit verbunden wird die Frage sein, inwiefern die dargestellte Sicht der Dinge als Ausdruck eines spezifisch weiblichen Humors verstanden werden kann. Dabei soll auf das Mittel der Satire, wie es Uwe Naumanns „Preisgeben, vorzüglich der Lächerlichkeit“ für Keuns Romane nachzeichnet, eingegangen werden.
Daraufhin wird der Übergang vom weiblichen Sehen hin zur weiblichen Erkenntnis, also vom Blick zum Durchblick, vollzogen. Es soll gezeigt werden, wie Sehen und Durchblicken das Zweifeln als Hemmschuh überwinden lassen. Danach wird sich die Arbeit dem Gesehenen, sprich dem Bild, welches sich Protagonistin und Leser bietet, zuwenden. Dass die Welt sich als Bühne für Illusionen präsentiert und das Verkleidungsmotiv bei Irmgard Keun eine wichtige Rolle spielt, soll der darauf folgende Punkt erläutern. Wenn die dargestellte Welt einer Bühne gleicht, kann dann das Gesehene überhaupt der Wahrheit entsprechen?
In einem weiteren Schritt soll der Blick als Voraussetzung um zu handeln näher bestimmt werden. Da die Exilwerke vom täglichen Kampf der Menschen für ein glückliches Leben trotz des unheilbringenden Regimes erzählen, soll die Frage nach einer erfolgreichen Überlebensstrategie gestellt werden, welche den Bogen vom weiblichen Sehen über das Verstehen hin zum Handeln und Bewältigen komplettiert. Doch warum nun lässt Keun ausschließlich weibliche Hauptfiguren auf das NS-System blicken und sich mit ihm auseinandersetzen? Klaus Theweleits These aus „Männerphantasien“, wonach es sich bei dem Faschismus um ein männlich generiertes Problem handelt, soll hierzu als Erklärungsansatz ausgetestet werden. Stehen die Protagonistinnen dem Regime aufgrund ihrer Geschlechterrolle außen vor? Lässt sich dieses vielleicht gerade nur durch Weiblichkeit überwinden?
1Häntzschel, Hiltrud: „Irmgard Keun. Dargestellt von Hiltrud Häntzschel“. Reinbek bei Hamburg, 2001. S. 65, Z. 8 f.
2Kreis, Gabriele und Majory S. Strauss (Hg.): Keun, Irmgard: „Ich lebe in einem wilden Wirbel. Briefe an Arnold Strauss. 1933 bis 1947. Herausgegeben von Gabriele Kreis und Majory S. Strauss“. Düsseldorf, 1988, S. 305, Z. 27.
3Kreis, G. und M. S. Strauss (Hg.): Keun, I.: „Ich lebe in einem wilden Wirbel“. S. 18, Z. 19.
4Antes, Klaus: „Ein Leben im Grandhotel Abgrund. Über Irmgard Keun“. In: Heigenmooser, Volker und Johann P. Tammen (Hg.): „Verlegen im Exil. Reden, Vorträge, Statements. Fakten & Fiktion. Lyrik und Prosa. Mit zahlreichen Photos. Dokumentation des Bremerhavener P. E. N.-Symposiums ’97“. Bremerhaven, 1997. S. 55 – 60. S. 55, Z. 10.
5Horsley, Ritta Jo: „Irmgard Keun. (1905 – 1982). Germany“. In: Fredriksen, Elke und Elizabeth Ametsbichler (Hg.): „Women Writers in German Speaking Countries: A Bio Bibliographical Critical Sourcebook“. Westport und London, 1998. S. 233 – 43. S. 234, Z. 31 f.
6Antes, K.: „Ein Leben im Grandhotel Abgrund“. S. 55, Z. 7.
7Horsley, Ritta Jo: „Witness, Critic, Victim: Irmgard Keun and the Years of National Socialism“. In Martin, Elaine (Hg.): „Gender Patriarchy and Fascism in the Third Reich: The Response of Women Writers“. Detroit, 1993. S. 65 – 117. S. 65, Z. 19 ff.
8Horsley, R. J.: „Irmgard Keun. (1905 – 1982)“. S. 234, Z. 29 f.
9Rosenstein, Doris: „Zum Exilroman Kind aller Länder von Irmgard Keun“. In: Bialek, Edward und Detlef Haberland (Hg.): „Zwischen Verlust und Fülle. Studien zur Literatur und Kultur. Festschrift für Louis Ferdinand Helbig. Herausgegeben von Edward Bialek und Detlef Haberland“. Wrocław und Dresden, 2006, S. 105 – 122. S. 105, Z. 6 f.
10Ebd. Z. 8.
11Blume, Gesche: „Irmgard Keun. Schreiben im Spiel mit der Moderne“. Dresden, 2005. S. 181, Z. 7 ff.
12Horsley, R. J.: „Witness, Critic, Victim”. S. 66, Z. 16 ff.
13Schüller, Liane: „Vom Ernst der Zerstreuung. Schreibende Frauen am Ende der Weimarer Republik: Marieluise Fleißer, Irmgard Keun und Gabriele Tergit“. Bielefeld, 2005. S. 239, Z. 27.
14Schüller, L.: „Vom Ernst der Zerstreuung“. S. 244, Z. 18 f.
15Amm, Marita: „Schauen und Sehen, Beobachten und Erkennen: Das Augenmotiv in der Literatur“. In: „wiener klinische wochenschrift. The middle european journal of medicine 110/8 (1998)“. S. 303 – 307. S. 303, Sp. 2, T.4.
16Amm, M.: „Schauen und Sehen, Beobachten und Erkennen“. S. 304, Sp. 1, Z. 49 ff.
17Ebd. Sp. 1, Z. 12 f.
18Amm, M.: „Schauen und Sehen, Beobachten und Erkennen“. S. 303, Sp. 2., Z. 32 f.
19Amm, M.: „Schauen und Sehen, Beobachten und Erkennen“. S. 304, Sp. 1, Z. 25 f.
20Mergenthaler, Volker: „Sehen schreiben – Schreiben sehen. Literatur und visuelle Wahrnehmung im Zusammenspiel“. Tübingen, 2002. S. 345, Z. 5.
21Rossum, Walter van (Hg.): Sartre, Jean Paus: „Der Blick. Ein Kapitel aus Das Sein und das Nichts. In der Übersetzung von Traugott König und Hans Schöneberg. Herausgegeben mit einer Einführung und einem Nachwort von Walter van Rossum“. Mainz, 1994. S. 39, Z. 18.
22Mergenthaler, V.: „Sehen schreiben – Schreiben sehen“. S. 109, Z. 8.
23Mergenthaler, V.: „Sehen schreiben – Schreiben sehen“. S. 382, Z. 24.
24Mergenthaler, V.: „Sehen schreiben – Schreiben sehen“. S. 394, Z. 21 ff.
25Ebd. Z. 15 f.
26Manthey, Jürgen: „Wenn Blicke zeugen könnten. Eine psychohistorische Studie über das Sehen in Literatur und Philosophie“. München und Wien, 1983. S. 167, Z. 26 ff.
27Kreis, G. und M. S. Strauss (Hg.): Keun, I.: „Ich lebe in einem wilden Wirbel“. S. 206, Z. 26 ff.
28Häntzschel, H.: „Irmgard Keun“. S. 64, Z. 36 f.
29Kreis, G. und M. S. Strauss (Hg.): Keun, I.: „Ich lebe in einem wilden Wirbel“. S. 169, Z. 9.
30Koch, Imke: „Irmgard Keun. (1905 – 1982)“. In: Jürgs, Britta (Hg.): „Leider hab ich’s Fliegen ganz verlernt. Portraits von Schriftstellerinnen und Künstlerinnen der Neuen Sachlichkeit. Herausgegeben von Britta Jürgs unter Mitarbeit Ingrid Herrmann“. Berlin, 2000. S. 109 – 123. S. 111, Z. 20.
31Kreis, G. und M. S. Strauss (Hg.): Keun, I.: „Ich lebe in einem wilden Wirbel“. S. 207, Z. 8 f.
32Antes, K.: „Leben im Grandhotel Abgrund“. S. 56, Z. 19.
33Horsley, R. J.: „Witnes, Critic, Victom“. S. 73, Z. 30 ff.
34Koch, I.: „Irmgard Keun“. S. 110, Z. 20 f.
35Keun, Irmgard: „Das kunstseidene Mädchen. Roman. Mit zwei Beiträgen von Annette Keck und Anna Barbara Hagin“. Berlin, 20089. S. 130, Z. 20 f.
36Keun, I.: „Das kunstseidene Mädchen. S. 170, Z. 19 f.
37Rohlf, Sabine: „Exil als Praxis – Heimatlosigkeit als Perspektive? Lektüre ausgewählter Exilromane von Frauen“. München 2002. S. 143, Z. 11.
38Kreis, G. und M. S. Strauss: Keun, I.: „Ich lebe in einem wilden Wirbel“. S. 132, Z. 3.
39Unger, Wilhelm (Hg.): Keun, Irmgard: „Wenn wir alle gut wären. Herausgegeben von Wilhelm Unger. Mit Quellenverzeichnis und Zeittafel von Gabriele Kreis“. München, 1993. S. 40, Z. 38 ff.
2Der weibliche Blick auf die faschistische Gesellschaft in Irmgard Keuns Exilromanen: Braucht es die Perspektive der Frauen, um die braune Lebenswirklichkeit zu durchblicken und aktiv zu bewältigen?
Boris Lawrenews Urteil zufolge lesen sich Irmgard Keuns „Bücher […] wie eine Proklamation zum Kampf gegen den Nationalsozialismus“40. Ihre Exilwerke weisen die Autorin als „klar blickende Antifaschistin“41 aus, die in ihren Romanen „das wahre Gesicht des faschistischen Alltags in Deutschland auf[deckt]“42. Laut Klaus Mann sind Keuns Werke mehr als schlichte literarische Erzählungen, sie sind eine „[ä]sthetische, der Wissenschaft vorauseilende Diagnose der Zeit“43.
Im Mittelpunkt aller vier Exilromane steht das Bewusstsein und der Blick der jeweiligen Protagonistin: der namentlich nicht genannten Titelheldin aus „Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften“, Sanna aus „Nach Mitternacht“, Lenchen aus „D-Zug dritter Klasse“ und Kully aus „Kind aller Länder“. Selbst wenn die Wahl von stets weiblichen Hauptfiguren keine bewusst reflektierte Entscheidung gewesen sein mag, so ist doch das Konzept von weiblichem Sehen in den Texten festgeschrieben, was es wiederum als Forschungsgegenstand einer literaturwissenschaftlichen Analyse rechtfertigt. Da Keun ausschließlich Heldinnen für ihre Romane, die zur Zeit des Nationalsozialismus spielen, entwirft, liegt die Frage nahe, ob die weibliche Perspektive nötig ist, um die braune Lebenswirklichkeit zu durchblicken und aktiv zu bewältigen. Stets entspinnt sich in den Protagonistinnen durch das Sehen der faschistischen Gesellschaft eine kognitive Auseinandersetzung mit dem Wahrgenommenen. Keun macht ihre Frauenfiguren in ihren „für Menschenwürde und Frauenwürde begeisterte[n] […] Bücher[n]“44 zu Subjekten. Sie lässt sie blicken, erzählen, denken und agieren. Damit löst sie diese aus ihrer traditionellen literarischen Funktionszuschreibung als Objekte der Handlung. Eben der Zusammenhang von weiblichem Sehen, Verbalisieren, Durchblicken, Handeln und Bewältigen soll im Folgenden nachgezeichnet und untersucht werden.
40Arend, Stefanie und Ariane Martin (Hg.): „Dokumentation der Rezeption in den Zeitschriften Das Wort und internationale Literatur (1937 – 1939)“. In Arend, Stefanie und Ariane Martin (Hg.): „Irmgard Keun 1905/2005. Deutungen und Dokumente“. Bielefeld, 20082. S. 217 – 237. S. 227, Z. 15 f.
41Arend, S. und A. Martin (Hg.): „Dokumentation der Rezeption in den Zeitschriften Das Wort und internationale Literatur“. S. 233, Z. 5 f.
42Ackermann, Michael: „Schreiben über Deutschland im Exil. Irmgard Keun: Nach Mitternacht. Anna Seghers: Das siebte Kreuz“. Stuttgart, 1986. S. 27, Z. 41 f.
43Marchlewitz, Ingrid: „Irmgard Keun. Leben und Werk“. Würzburg, 1999. S. 151, Z. 29 f.
44Arend, S. und A. Martin (Hg.): „Dokumentation der Rezeption in den Zeitschriften Das Wort und internationale Literatur “. S. 232, Z. 22 f.
2.1Die Geschlechterrollen – stereotype Weiblichkeit und Männlichkeit?
Beziehungen zwischen den Geschlechtern und weibliche Identität45 sind typische Themen für Keuns gesamtes Werk und somit auch für ihre Exilromane. Das Geschlechtermotiv dient in „D-Zug dritter Klasse“ als eines der wichtigsten Topoi und auch in „Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften“, „Nach Mitternacht“46 und „Kind aller Länder“47 wird es immer wieder aufgegriffen.
Da sich die vorliegende Arbeit mit dem weiblichen Blick in den Romanen beschäftigt, soll zunächst nachgewiesen werden, dass Keun explizit die Kategorien von Weiblichkeit und Männlichkeit aufruft, sodass sich überhaupt von einem weiblichen Blick der Protagonistinnen sprechen lässt. Dabei soll Gender, sprich das soziale Geschlecht,48 als zentrale Analysekategorie dienen.
Seit dem 18. Jahrhundert hat sich in der westlichen Gesellschaft die Vorstellung eines Geschlechterdimorphismus’ durchgesetzt.49 Verstand man zuvor die Frau als defizitäre Spielform des Mannes, so ging man nun von zwei Geschlechterkategorien aus. Annahme sind zwei sich grundsätzlich ausschließende Größen, die sich nicht nur aufgrund ihrer Biologie sondern auch durch Wesen und sozialen Status voneinander abgrenzen. Bis heute hat die Vorstellung von „was männlich ist, ist nicht weiblich, und umgekehrt“ durch das gesellschaftliche Prinzip der Zweigeschlechtlichkeit Bestand.50 Es soll nun nachgezeichnet werden, dass auch Keuns Figureninventar diesem Dimorphismus folgt, indem die dargestellten Frauen und Männer genaue Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit repräsentieren und dadurch in den Exilromanen, wie schon in Keuns früheren Werken, Aussagen wie „Wir Frauen! Ihr Männer!“51 innerhalb des Personals ermöglichen.
Um Weiblich- und Männlichkeit als Konzepte greifbar zu machen, ist es sinnvoll, sie innerhalb des sozialpsychologischen Begriffs der Geschlechterrollen zu definieren. Man versteht darunter die „Summe der von einem Individuum [von Seiten der Gesellschaft, F. P.] erwarteten Verhaltensweisen als Frau bzw. als Mann“52. Geschlechterrollen sind im kulturellen Kontext ständig präsent. Sie bestimmen Kleidungsstil und Verhalten ebenso wie Persönlichkeit und die Stellung, welche eine Person in der Gesellschaft innehat. Das Verständnis, was die Geschlechterrollen ausmacht, hat sich über die Zeit immer wieder verändert.53 Doch sie sind als Konzept so verbreitet, dass im Allgemeinen ein Konsens über deren Kerngehalt besteht. Sieht man etwas Weibliches, kann man es in der Regel zweifelsfrei als solches einordnen.54 Diese Tatsache macht sich Irmgard Keun zunutze. In ihren Werken führt sie dem Leser „sein erlerntes Geschlechterrollenverständnis […] vor Augen“55, indem sie die Rollen überdeutlich nachzeichnet, um sie dann von Figuren durchbrechen zu lassen.56 Diese literarische Technik funktioniert, da die Romane mit Geschlechterstereotypen, verstanden als die Vorstellung vom idealen Vertreter der jeweiligen Geschlechterrolle,57 spielen.
Judith Butler hat die Idee der sogenannten Performativität des sozialen Geschlechts populär gemacht. Butler nimmt an, dass eine Person ihre Geschlechterrolle ständig durch konkretes Handeln festschreibt.58 Dabei zitiert die Person die eigene Idealvorstellung, wie eine typische Frau bzw. ein typischer Mann zu agieren hat, verhält sich dementsprechend und wird dadurch von anderen als Vertreter der jeweiligen Geschlechterrolle gelesen. Auch die vorliegende Arbeit will das Handeln der dargestellten Figuren zum Ausgangspunkt nehmen, um auf ihre Geschlechterrolle zu schließen und sie als deren Repräsentanten zu begreifen. Insofern Keun, wie Anne Fleig feststellt, „die Performativität der Geschlechterbestimmung transparent macht“59 – beispielsweise in Textpassagen, worin die „performances von Weiblichkeit […] an die Männlichkeit des Gegenübers [appellieren, F. P.] […], seiner Rolle gerecht zu werden“60 – sollte dieser Ansatz fruchtbar sein. Da Keuns Werke „Männer als auch Frauen in ihrer jeweiligen Lebensrealität dar[…]stellen“61, folgt die Genderbestimmung in der vorliegenden Arbeit einem mimetisch-inhaltlichen Vorgehen. Die Figuren werden wie reale Menschen auf die Erfüllung ihrer Geschlechterrollen hin untersucht. Basierend auf qualitativen Kontrast- und Korrespondenzkorrelationen soll zwischen den dargestellten Frauen- und Männerfiguren das Bild von Weiblichkeit und Männlichkeit herausgearbeitet werden. Alice Schwarzer zufolge gestalten sich bei Keun die Frauenfiguren als „die wirklich Großen“62. Der Schwerpunkt der Analyse wird auf ihnen und ihrer Geschlechterrolle liegen.
2.1.1Von Frauen und Männern: Die Geschlechterrollen im Personal
Für die nähere Bestimmung der dargestellten Geschlechterrollen ist eine einheitliche Definition des Konzepts mit festgelegten Kriterien sinnvoll. Die vorliegende Arbeit stützt sich auf den Ansatz von Kay Deaux und L. L. Lewis, welcher äußere Erscheinung, Persönlichkeit, soziales Rollenverhalten und gesellschaftliche Stellung als die vier Komponenten von Geschlechterrollen benennt.63
Gemäß der Vorstellung von gendertypischer Erscheinung stellen sich Personen als Vertreter ihrer Geschlechterrolle dar.64 Für das Bild von Weiblichkeit ist äußere Schönheit besonders wichtig.65 Figur, Frisur und Kleidung gelten als wichtige Attribute der Frau.66 Diese stereotype Vorstellung nimmt in den Exilromanen großen Raum ein. Meist sind es die männlichen Figuren, die normativ auf das Bild von weiblicher attraktiver Erscheinung pochen. Hat schon in „Gilgi – eine von uns“ Martin von der Protagonistin gewollt, dass sie sich hübsch zurechtmacht, so wird diese Forderung in den Exilromanen beispielsweise durch Kullys Vater gegenüber seiner Frau und Tochter, durch Karl gegenüber Lenchen und Algin gegenüber Liska beibehalten.
Im Abgleich zu dem dargestellten gesellschaftlichen Zwang zu weiblicher Schönheit fällt auf, dass die männlichen Figuren äußerlich kaum beschrieben werden. Wird eine ausführlichere Schilderung ihrer Erscheinung angeführt, dann meist, um sie als Ausnahme vom Standard zu kennzeichnen, die wenig schmeichelhaft erscheint. Wie das Mädchen bemerkt, eignet sich männliche Kleidung ohnehin nicht dazu, ihren Träger hübsch aussehen zu lassen.67 Doch auch von Natur aus sind etwa sein Vater und Herr Kleinerz nicht schön. Dr. Breslauer, Herr Silias und Heini aus „Nach Mitternacht“ fallen durch Schuppen, speckige Erscheinung und mangelnde Körpergröße auf. Karl aus „D-Zug dritter Klasse“ wirkt nur „von hinten […] nicht hässlich“68 und Kully sieht einen Mann mit einem „Gesicht wie ein zusammengeknautschtes Blatt Papier“69.
Die meisten der beschriebenen Frauenfiguren stehen mit ihrer äußeren Erscheinung für das stereotype Bild von weiblicher Schönheit. Sie „glitzer[n]“70„schön wie eine Prinzessin“71, während der Mann daneben „schwarz[…]“72 wirkt. Ihre Weiblichkeit ist eng an ihre „hinreißende[…] Erscheinung“73 gekoppelt. Sie definieren sich durch ein betont weibliches Äußeres, ähneln „Weihnachtspuppe[n]“74 und präsentieren ihre „teutonische[n] Prachthüften“75. Stets gut frisiert und mit femininer Figur verkörpert besonders Kullys Mutter dieses stereotype Bild, denn selbst als sie abzumagern droht, werden ihre Rundungen durch eine erneute Schwangerschaft gesichert.76
Daneben gibt es Frauenfiguren, welche der gesellschaftlichen Forderung nach Schönheit nicht entsprechen, entweder da sie von Natur aus keine Veranlagung dazu haben oder da das Alter sie hat verwelken lassen. Bei ihnen scheint der negative, unfreundliche Charakter „Folge der fehlenden sexuellen Attraktivität“77 zu sein, denn „[a]lle normalen Mädchen [und Frauen, F. P.] möchten den Männern gefallen“78. Explizit formuliert Sanna den Zusammenhang in der Einschätzung ihrer Stiefmutter: „Und weil sie […] nicht hübsch aussieht, wollte sie wenigstens alles beherrschen“79. Weitere Beispiele sind die dicke Tante Millie, die „grau[e]“80 Tante Adelheid und die „altertümliche“81 Betty Raff. Da bei ihnen das Nichtentsprechen des weiblichen Geschlechterstereotyps mit einer unmissverständlich negativen Charakterisierung gepaart ist, wird zugleich Schönheit als natürliche Komponente einer angenehmen Weiblichkeit bekräftigt.
Dabei eröffnet sich ein Spannungsfeld zwischen der scheinbar naturgegebenen weiblichen Geschlechterrollenkomponente Schönheit und der kenntlich gemachten künstlichen Ausstaffierung des weiblichen Äußeren. Die Mutter des Mädchens friert auf dem Balkon, um braun zu werden, während Tante Millie ein Haarteil trägt. Auch Liska versteht es nach Sannas Einschätzung, ihre Vorzüge ins rechte Licht zu rücken, Bertchen Silias wird von ihrer Mutter über Stunden frisiert und Kullys Mutter brennt sich regelmäßig die Haare in Form. Zwar wird die Erscheinung als künstlich ausstaffiert geschildert, zugleich dient sie jedoch der äußeren Spiegelung der Persönlichkeit. Das Innere, das weibliche Wesen, erschafft sich seine Entsprechung im Äußeren, der betont weiblichen Erscheinung, sodass die scheinbar künstliche Schönheit als Ausdruck der natürlichen Weiblichkeit wirkt.82
Aus dem Bild betonter weiblicher Schönheit fallen die Protagonistinnen zeitweilen heraus. Das Mädchen rechtfertigt sich, beim Spielen nicht immer ordentlich aussehen zu können.83 Sanna fühlt sich unscheinbar wie unter einer Tarnkappe, da sie sich nicht zurechtzumachen versteht, ebenso wie Lenchen, die einen Rußfleck auf der Wange zu einer „etwas schmuddeligen weißen Seidenbluse“84 trägt. Kully wäscht sich nur selten und freut sich, als sie auf der Schifffahrt ihr Kleid nicht wechseln oder sich nicht kämmen muss. Gesellschaftlich toleriert wird diese optische Abgrenzung bei Kully und dem Mädchen aufgrund ihres jungen Alters. Da sie noch nicht in der Pubertät sind, erwartet man noch nicht von ihnen, stets betont weiblich zurechtgemacht zu sein, ebenso wie zum Teil auch bei den jungen Frauen Sanna und Lenchen noch über ein Abweichen vom Bild klassischer Weiblichkeit hinweggesehen wird.
Es kennzeichnet die Protagonistinnen jedoch ebenso, dass sie immer wieder das Stereotyp von weiblicher Schönheit aufnehmen, sich selbst zurechtmachen, und es somit bejahen. Das Mädchen sieht „rührend“85 aus, wenn es hergerichtet ist, womit es seinem eigenen Wunsch entspricht, so „wunderschön [zu, F. P.] sein wie eine Fee“86. Schwankt es während seiner Kindheit zwischen der Freude, hübsch zurechtgemacht zu sein, und der Ablehnung, dafür ständige Anstrengung wie etwa ein Korsett in Kauf zu nehmen, scheint es sich als Pubertierende das betont weibliche Äußere, beispielweise in Form bemalter Fußnägel, im Zuge ihres Erwachsenenwerdens auf natürliche Weise zu verinnerlichen. Nach erprobtem jungenhaften Äußeren kommt es auf der Schwelle zum Frausein zu einer umso affirmativeren Bejahung der Geschlechterrollenkomponente Schönheit. Ebenso freut sich Sanna, als sie zu Liskas Fest ein Kleid aus rosa Seide tragen kann, Lenchen ist von „wallenden Gewändern“87 als Inbegriff von Weiblichkeit fasziniert und Kully wird in einem Trachtenkostüm von allen bestaunt.88
Doch die Protagonistinnen werden auch ohne künstlich betonte Schönheit als hübsche Mädchen beschrieben. Lenchen etwa wird, obgleich sie nur ein schlichtes Kleid trägt, als „reizender […] als ihre vielen [zurechtgemachten, F. P.] Cousinen“89 geschildert. Die weibliche Geschlechterrollenkomponente Schönheit ist von Natur aus ein Bestandteil der Erscheinung der Protagonistinnen und verbürgt die in ihrem Wesen wohnende Weiblichkeit. Was sie auszeichnet, ist, neben ihrer naturgegebenen Schönheit und damit Weiblichkeit, die Tatsache, dass sie mehr als das sind. Sie verlassen die Grenzen der Geschlechterrollenkomponente des zurechtgemachten Äußeren immer wieder, um das von ihnen repräsentierte Bild von Weiblichkeit in seinem Spektrum zu erweitern.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Exilromane die Vorstellung der äußeren Erscheinung als Spiegel der Geschlechterrolle betonen. Die Figuren befinden sich im Einklang mit dem von ihnen präsentierten Erscheinungsbild. Was sich als weiblich darstellt, ist tatsächlich weiblich, was sich als männlich präsentiert, ist männlich.
Daneben stellt die gendertypische Persönlichkeit90 eine zweite Geschlechterrollenkomponente dar. Es handelt sich dabei um verinnerlichte Wesensmerkmale, die als typisch für Frauen bzw. Männer gelten.
Stereotyp männliche Eigenschaften werden unter dem Begriff der Instrumentalität zusammengefasst. Eine instrumentelle Persönlichkeit zeichnet sich durch ein durchsetzungsfähiges, zum Teil aggressives, unabhängiges, kompetentes, unemotionales und rationales Wesen aus, das von Verstand und Vernunft geprägt ist. Keuns Männerfiguren lehnen sich an dieses instrumentelle Konzept an. Besonders entspricht Karl dem Katalog männlicher Eigenschaften. Er setzt seine Vorstellungen, Deutschland zu verlassen, durch, wird Lenchen gegenüber aggressiv, fühlt sich niemandem in Abhängigkeit verbunden, wird als gefühlskalt und Geber rationaler Ratschläge geschildert. Er ist keine sympathische Figur, sein Charakter erscheint durch die Kombination tatsächlich aller instrumentellen Eigenschaften als fehlerhaft. Im Vergleich mit den anderen männlichen Figuren der Exilromane zeigt sich, dass Karl die einzige ausführlich geschilderte Figur unter den Gegnern des NS-Regimes ist, die alle Kriterien einer männlichen Persönlichkeit erfüllt. Der Vater des Mädchens etwa fügt sich zwar zum Großteil in das Bild instrumenteller Wesenszüge ein, wird zugleich von seiner Ehefrau jedoch auch als „rührender Mann“91 und damit als emotional und sanft beschrieben, was dem stereotypen Bild von männlicher Gefühlskälte zuwiderläuft. Sannas Freund Franz kann weder als unabhängig, durchsetzungsfähig noch kompetent gelten. Laut Irene Lorisika ist es vor allem seine Emotionalität, die einem stereotypen Bild von Männlichkeit widerspricht.92 Da den positiv dargestellten Männerfiguren jeweils Attribute einer stereotyp instrumentellen Persönlichkeit fehlen, ist ihr Wesen von Jungenhaftigkeit geprägt. Sie besitzen männliche Züge, die sie eindeutig der instrumentellen Geschlechterrolle zuordnen, füllen dabei jedoch nicht das Bild absoluter Männlichkeit aus. Das Jungenhafte wird innerhalb des Figureninventars als etwas Positiveres geschildert als das vollkommen Männliche.
Die stereotyp weiblichen Eigenschaften werden unter dem Begriff „Expressivität“ zusammengefasst.93 Eine expressive Persönlichkeit zeichnet sich durch ihr sanftes, unterordnendes, abhängiges, intuitives, emotionales, verständnisvolles und mütterlich-sorgsames Wesen aus. Keuns Frauenfiguren wie zum Beispiel die Mütter von Kully und dem Mädchen entsprechen diesem Eigenschaftskatalog sehr genau. Sie äußern den „Wunsch nach Umsorgtwerden“94, sie sind „empfindsam“95, ihr Gemüt ist „warm, ihre Gedanken einfach und gut“96. Die Protagonistinnen besitzen ebenfalls expressive Eigenschaften. Sie erfüllen die weibliche Geschlechterrolle vollständig. Auch sie sind zuweilen „schüchtern“97 und „anlehnungsbedürftig“98, sorgen sich um andere und sind sich ihrer Gefühle bewusst.99
Doch betrachtet man die Persönlichkeiten der Protagonistinnen in ihrem gesamten Spektrum, so fällt auf, dass einzig bei Lenchen die expressiven Eigenschaften das gesamte Wesen ausmachen. Für das Mädchen, Sanna und Kully hingegen gilt: Sie sind vollkommen weiblich, doch sie sind mehr als das. Alle drei verfügen neben den expressiven Eigenschaften auch über die instrumentellen Merkmale eines nüchternen Verstands, Durchsetzungsfähigkeit und Kompetenz. Auch wenn die Protagonistinnen über männliche Eigenschaften verfügen, bleiben sie Repräsentanten der Weiblichkeit – schließlich verkörpern sie vollständige Expressivität. Besonders deutlich wird dies im Abgleich mit den als negativ geschilderten Frauenfiguren, wie zum Beispiel Tante Adelheit oder Tante Millie. Diese haben sich im augenscheinlich unnatürlichen Übermaß instrumentelle Wesenszüge angeeignet, wodurch ihre expressiven Persönlichkeitsmerkmale verdrängt wurden. Beide lassen sich kaum als sanft, intuitiv, emotional, verständnisvoll oder sorgsam charakterisieren. Sie zeichnen sich vielmehr durch ihr unemotionales, aggressiv-durchsetzungsfähiges Wesen aus, passend zu Sannas Feststellung, niemand könne „so gemein und gehässig werden wie eine alte Frau“100.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zuweisung der expressiven Persönlichkeit zu den positiven Frauenfiguren und einem großteils durch instrumentelle Eigenschäften geprägten Persönlichkeitsmuster zu den Männerfiguren die Idee eines naturgegebenen, in den Figuren verankerten Geschlechterdimorphismus zusätzlich verstärkt. Auffällig erscheint, dass neben der Schilderung genderbezogener Persönlichkeitsmerkmale nur wenig über individuelle Vorlieben, Abneigungen, Stärken oder Schwächen gerade der Protagonistinnen bekannt ist. Sie sind wie zuvor Gilgi „ausdrücklich durchschnittlich“101 und wirken wie „Modellfigur[en]“102 ihres Genders, sodass ihr Blick in der größtmöglichen Typenhaftigkeit ein weiblicher ist.
Als dritte Komponente des Genders gelten geschlechtertypische Regeln über soziale Interaktionen103 Diese beruhen auf dem Stereotyp, dass für Frauen sozialer Umgang eine größere Bedeutung hat.104 Laut Geschlechterrollenstereotyp ist weibliches Sozialverhalten von mütterlichem Denken und einer „Ethik der Fürsorge“105 geprägt. Frauen handeln angeblich häufiger gemeinnützig und helfen anderen, indem sie sich um sie sorgen – wohingegen Männer zwar auch helfen, dies jedoch weniger durch aufopfernde Pflege als vielmehr rettendem Verhalten in Ausnahmesituationen. Keuns positive Frauenfiguren und damit auch die Protagonistinnen entsprechen dem Bild von umsorgender Weiblichkeit, sie handeln typisch weiblich. Das Mädchen kümmert sich um seinen kleinen Bruder, als er krank wird, Kully umsorgt ihre Haustiere, Sanna leistet der kränkelnden Liska Gesellschaft und Lenchen kümmert sich um ihre geistig verwirrte Tante Camilla. Kully ist der Meinung, man sollte ohnehin ganz selbstverständlich einander helfen.106107
Doch mit Ausnahme von Lenchen überschreiten die Protagonistinnen in ihrem Hilfeverhalten auch immer wieder das weibliche Stereotyp und helfen, indem sie andere durch große Taten retten, wie etwa das Mädchen ein kleines Kind, das zu nah am Wasser spielt, in Sicherheit bringen will.108
Den geschlechtertypischen Regeln über soziale Interaktionen entsprechen auch Freundschaften innerhalb des eigenen Geschlechterkreises. In Übereinstimmung damit pflegen viele der männlichen Figuren Männerfreundschaften, wie etwa der Vater des Mädchens und Herr Kleinerz, Franz und Paul oder Karl und der Früchtehändler. Auch Frauen schließen dem Stereotyp nach Freundschaften untereinander, doch verbindet sie dabei angeblich weniger Solidarität als vielmehr die Abgrenzung gegenüber dem anderen Geschlecht. Die Gegenüberstellung „Männerfreundschaft ist Männerfreundschaft – Frauenfreundschaft ist Männerfeindlichkeit“109 gilt für die Exilromane nicht. Zwar behauptet der Vater des Mädchens, Frauen würden stets Hassgefühle gegenüber ihren Geschlechtsgenossinnen hegen, doch seine Tochter widerlegt dies an sich selbst, denn sie mag ihre Mutter und die Haushaltshilfe sehr. Sie ist mit verschiedenen Klassenkameradinnen befreundet, wie auch Sanna mit Gerti eine innige Freundschaft verbindet, Lenchen sich ihrer Mitbewohnerin verbunden fühlt und Kully so sehr an ihrer Mutter wie an keinem anderen hängt. Dass ihr Zusammenhalt dabei jedoch nicht auf Feindseligkeit gegenüber dem anderen Geschlecht beruht, belegt etwa die Freundschaft, die das Mädchen und Hänschen Sachs verbindet.
Die Geschlechterrollen in den Exilwerken werden entscheidend durch die vom Konzept der Familie ausgehenden Rollenzuweisungen geprägt.110 Die Familie ist zentraler Bestandteil des Lebens der Protagonistinnen. „Die Hauptsache [für sie ist, F. P.] […], daß die Familie gesund und beisammen sei“111. Sie entstammen intakten Elternhäusern, halten engen Kontakt zu Eltern, Geschwistern, Tanten und Onkeln. In diesem „Familien-Wir“112 agieren sie selbst als Tochter, Schwester oder Nichte und damit innerhalb eng definierter weiblicher sozialer Rollen. Besonders auffällig ist dies bei den vorpubertären Figuren, dem Mädchen und Kully, da sie als Minderjährige noch zusammen mit Vater und Mutter leben. Doch auch bei Sanna und Lenchen fungiert die Familie als zentraler sozialer Handlungsraum, innerhalb dessen sie sich selbst verorten. Sanna zieht, nachdem sie das väterliche Haus verlassen hat, zunächst bei ihrer Tante ein, um später im Haushalt ihres deutlich älteren Bruders und seiner Ehefrau erneut eine Tochterposition einzunehmen. Eng verbunden mit der eigenen Familie zeigt sich auch Lenchen, die nur widerwillig den elterlichen Haushalt verlässt und gerne Zeit mit Verwandten, wie etwa Tante Camilla, verbringt. Die Familie wird als eine Schicksalsgemeinschaft verstanden. Familiäre Verpflichtungen und damit das Erfüllen der eigenen Rolle innerhalb der Familie werden selbst etwa durch die eheliche Untreue von Kullys Vater und Mutter oder die im NS-System bedrohliche Situation für Lenchen, eine scheinbar geisteskranke Tante in der Verwandtschaft zu haben, nicht angetastet. Ohne das Organisationsprinzip Familie würde der einzelnen ein wichtiger Bezugspunkt zur Festlegung der eigenen sozialen Rolle fehlen.
Neben der Familie dient in den Exilromanen die partnerschaftliche heterosexuelle Beziehung als Bezugsgröße für die sozialen Geschlechterrollen. Die Protagonistinnen definieren sich ab dem Eintritt in das Erwachsenenalter durch die weibliche Rolle, welche sie in ihrer Liebesbeziehung zu einem Vertreter des anderen Geschlechts einnehmen – obgleich sie sich, wie Imke Koch bemerkt, dabei in ihrer Person nicht nur auf „die Frau an seiner Seite“113 reduzieren lassen. Sanna ist Franz’ Freundin, Lenchen die Verlobte gleich dreier Männer und das Mädchen glaubt sich als die zukünftige Ehefrau seines Schwarms, einem Operntenor. Sie entsprechen damit der stereotypen Vorstellung, welche die beiden Geschlechter durch ihr Verhältnis zueinander definiert. In den Exilromanen braucht ein Mann eine Frau an seiner Seite, und auch die Frau „muß […] einen Mann haben, der ihr richtig gehört […], da hilft nichts“114. Wie streng gerade die weibliche Geschlechterrolle über ihre Partnerschaft definiert wird, zeigt die entsetzte Reaktion von Lenchens Mutter, als ihre Tochter erzählt, sie wolle Nonne werden.115





























