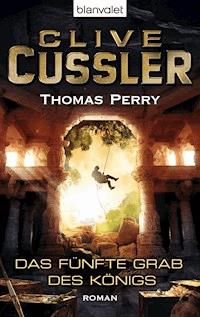
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Fargo-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Ein gigantischer Schatz, zwei waghalsige Schatzjäger, drei skrupellose Verbrecher, die bereit sind für das Gold zu töten ...
Die Schatzjäger Sam und Remi Fargo helfen einem befreundeten Archäologen, ein geheimnisvolles Manuskript zu bergen. Darin entdecken sie einen Hinweis auf eine noch wertvollere Beute: das Grabmal des Hunnenkönigs Attila. Ihre Suche führt sie durch ganz Europa. Dabei wird immer deutlicher, dass sie nicht die einzigen sind, die dem unermesslichen Schatz auf der Spur sind – und mindestens einer ihrer Konkurrenten geht sogar über Leichen, um das Gold des Hunnenkönigs in die Finger zu kriegen.
Archäologie, Action und Humor für Indiana-Jones-Fans! Verpassen Sie kein Abenteuer des Schatzjäger-Ehepaars Sam und Remi Fargo. Alle Romane sind einzeln lesbar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
& Thomas Perry
Das fünfte Grab des Königs
Ein Fargo-Roman
Aus dem Englischen von Michael Kubiak
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel
»The Tombs« bei G.P. Putnam’s Sons, New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen
der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © 2012 by Sandecker, RLLLP
By arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176-0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by
Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagmotiv: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung einer Illustration von © Max Meinzold
Redaktion: Jörn Rauser
HK · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-15181-2
www.blanvalet.de
1
PANNONIEN, 453 N. CHR.
Das Lager der Barbaren war von riesigen Ausmaßen. Es war eine große Stadt, die je nach Laune ihres unumstrittenen Herrschers, des Großkönigs, von Ort zu Ort zog. Aber im ungewissen Licht dieses heraufziehenden Tages herrschte in ihr das vollkommene Chaos. Hunderttausende Krieger, ihre kreischenden Frauen und ihre nicht zu bändigenden Kinder rannten durcheinander. Hunderttausende Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen blökten und wieherten in der allgemeinen Aufregung und füllten den Morgen mit einem ohrenbetäubenden Inferno aus Lärm. Hinzu kam der Gestank des Viehs, der sich mit dem Qualm zehntausender gleichzeitig entfachter Lagerfeuer mischte.
Priskos’ Diener hatte seinen Herrn in dem sicheren Bewusstsein aus dem Bett gezerrt, dass in diesem plötzlichen Aufruhr der barbarischen Horden ihr Leben ernstlich bedroht war. Priskos eilte über das unwegsame Gelände und achtete so gut wie möglich darauf, sich nicht in einer tiefen Wagenspur den Fuß zu verstauchen oder in ein Erdloch zu treten. Er folgte Ellak, wobei er vergeblich versuchte, mit ihm Schritt zu halten. Er trug nur leichte Sandalen, die lediglich dafür gemacht waren, über das glatte Pflaster von Konstantinopel zu schlendern. Ellak, berühmter Kämpfer und Nachfahr eines Geschlechts berühmter Krieger, hatte dank seiner Kraft und Schnelligkeit das Erwachsenenalter erreicht.
Als Priskos das imposante Tierhautzelt des Großkönigs erblickte – der Pfahl in seiner Mitte war so hoch wie eine römische Villa und seine Grundfläche groß genug, um Hunderten Platz zu bieten –, konnte er lautes Jammern und Schreien hören und wusste, was während der Nacht geschehen sein musste. Er verlangsamte seinen Schritt so weit, dass er seine aufrechte Haltung und die römische Würde beibehielt. Er war Diplomat und hatte daher gleichzeitig die Aufgabe, die Ereignisse dieses historisch bedeutsamen Tages schriftlich zu fixieren. Ellak, der Sohn des Großkönigs, hatte ihn geholt, weil Priskos im Umkreis vieler Leugen der gelehrteste Mann war und vielleicht wusste, wie man das Leben des Großkönigs retten konnte. Aber das Jammern konnte durchaus bedeuten, dass sie zu spät kamen.
Priskos ließ sich seine Angst nicht anmerken. Die Barbaren versperrten ihm den Weg, rannten aufgeregt herum und stachelten sich gegenseitig zu Raserei an. Wie Hunde konnten sie die Angst wittern. Seit ihrer Geburt waren sie ausgebildete und erfahrene Mörder, die sich mit äußerster Grausamkeit den Weg vom fernsten Asien bis nach Europa gebahnt hatten. Wenn sie lautes Gebrüll hörten, kamen sie herausgerannt, aber stets mit gezückten Schwertern und Dolchen, die ebenso zu ihnen gehörten wie Hände und Füße. Wenn heute jedoch einer von ihnen bei ihm – einem Fremden – Angst spüren sollte, so würde er ihn ohne Vorwarnung in Stücke reißen.
Ellak führte ihn in das gewaltige Zelt des Großkönigs. Priskos war fast einen ganzen Kopf größer als die Barbaren, die aus dem fernen Osten kamen, klein und stämmig, mit breiten Schultern und muskulösen Armen und Beinen, die Gesichter dunkel wie gegerbtes Leder. Priskos konnte über die Köpfe einiger Männer, die den Zugang zur inneren Kammer versperrten, hinwegschauen. Dort musste der König sein. Die Krieger, die der Kammer am nächsten waren, zückten bereits ihre kurzen Dolche und ritzten ihre Wangen mit so tiefen Schnitten, dass das Blut wie Tränen an ihnen herabrann.
Priskos gelangte dorthin, indem er zur Seite auswich und zwischen den Wächtern hindurchschlüpfte, die sich wie irr aufführten. Nun konnte er die junge Frau des Großkönigs, Ildico, sehen. Sie kauerte auf einem Stapel dicker Teppiche in einer Nische – so weit entfernt von ihrem Ehemann wie nur möglich. Sie weinte, aber keiner tröstete sie. Priskos konnte niemanden sehen, der ihre Anwesenheit auch nur zur Kenntnis nahm.
Während einer der Wächter seinen Freunden sein Gesicht zuwandte, damit sie sehen konnten, wie er sich mit einem kurzen Schwert verstümmelte, schlüpfte Priskos hinter ihm in die Kammer. Er blickte auf den Körper des Großkönigs hinab und erkannte sofort, weshalb die junge Frau derart geschockt war. Der große Barbar, als Flagellum Dei gerühmt, lag auf dem Rücken im seidenen Bettzeug, den Mund weit offen wie ein schnarchender Betrunkener. Blut rann aus seiner Nase und aus seinem Mund und bildete eine nass glänzende Pfütze unter dem Kopf.
Priskos trat in die Nische und zog Ildico aus ihrer Kauerhaltung hoch. Er schob die langen blonden Haare von ihrem Ohr weg und flüsterte: »Alles ist in Ordnung. Er ist tot, und du kannst hier nichts mehr tun. Komm.« Es waren lediglich beruhigende Worte, nur eine menschliche Stimme, die sie trösten sollte, ohne ihr irgendetwas Bedeutsames mitzuteilen. Ildico, die siebte Ehefrau des Großkönigs, war trotz ihrer Schönheit kaum älter als ein Kind. Sie war von ihrem germanischen Stamm zu den Hunnen gebracht worden, um den Eroberer zu heiraten. Sie verstand Priskos’ Latein genauso wie ihr eigenes Gotisch, aber er war sich nicht sicher, welche Sprache die Wachen beherrschten, deshalb sagte er nur wenig. Dann geleitete er sie hinaus in den Sonnenaufgang und die frische Luft. Sie sah bleich und schwach aus, ganz wie ein Geist. Er hoffte, sie so weit wie möglich von den Wachen und Kriegern weglenken zu können, ehe jemand auf die Idee kam, sie trüge am Tod des Königs Schuld. Die Unwissenden waren oft besonders misstrauisch, und selbst wenn jemand vom Blitz getroffen wurde, konnte ihn ein anderer auf das bedauernswerte Opfer herabbeschworen haben.
Priskos entdeckte einige von ihren weiblichen Bediensteten. Es war die kleine Gruppe von Zofen und Verwandten, die sie zu ihrer Hochzeit begleitet hatten. Sie standen in einiger Entfernung und beobachteten mit ängstlichen Mienen das Geschehen in und vor dem Zelt. Priskos übergab Ildico ihrer Obhut, und sie entfernten sich eilig von dem wachsenden Menschenauflauf.
Priskos schaute ihr noch eine Weile nach, um sicherzugehen, dass sie nicht aufgehalten wurden, als kräftige Hände unsanft seine Arme packten. Er reckte den Hals, um zu sehen, wer sich seiner bemächtigt hatte. Keinen der beiden Krieger erkannte er, obgleich er sie jedes Mal gesehen hatte, wenn er den Großkönig aufsuchte. Sie hatten sich als Zeichen ihrer Trauer Schnittwunden in den Wangen zugefügt, so dass die untere Hälfte ihrer Gesichter von Blut glänzte. Ihr Verhalten hatte sich verändert, seit Priskos in der vorangegangenen Nacht lachend und trinkend mit ihnen zusammengesessen und die Hochzeit ihres Herrn gefeiert hatte. Die beiden Männer zerrten ihn in das Zelt des Königs, und die Schar der Krieger teilte sich, um ihnen den Weg in die innere Kammer zu öffnen.
In der Kammer war der Körper des Toten nicht bewegt worden. Über ihn beugten sich Ardarich, König der Gepiden, und Onegesius, Attilas bester Freund und engster Vertrauter. Ardarich kniete nieder und ergriff den Krug mit dem Wein, den der Großkönig getrunken hatte, ehe er gestorben war. Er sagte: »Dies ist der Wein, den Ildico ihm gestern eingeschenkt hat.« Onegesius hob auch den Kelch auf, der neben dem König lag.
Priskos sagte: »Seit Wochen litt er unter einer Krankheit, von der seine Nase ständig blutete. Vielleicht wurde es schlimmer, während er schlief, und er ist in seinem eigenen Blut ertrunken. So sieht es jedenfalls aus, nicht wahr?«
Ardarich schnaubte zornig. »Niemand stirbt an Nasenbluten. Er hat sein ganzes Leben lang gekämpft. Er wurde sehr oft verwundet und ist nie verblutet. Es war Gift.«
»Glaubst du wirklich?«, fragte Priskos mit Augen, die vom Schock geweitet waren.
»Das glaube ich«, bekräftigte Ardarich. »Und ich denke an dich. Kaiser Theodosius hat dich vor vier Jahren zusammen mit dem Botschafter Maximinus zu uns geschickt. Dein Übersetzer, Vigilas, wurde bei einer Verschwörung ertappt, deren Absicht es gewesen war, Attila zu ermorden. Anstatt euch alle töten zu lassen, schickte dich Attila zu deinem Kaiser nach Konstantinopel zurück. Vielleicht war das ein Fehler. Und vielleicht war Vigilas nicht der Einzige, der hierherkam, um den König zu töten.«
Onegesius schüttete Wein in Attilas Kelch, dann hielt er ihn hoch. »Beweise, dass du ihn nicht vergiftet hast. Trink.«
Priskos sagte: »Ich weiß nicht, ob der Wein vergiftet ist oder nicht. Wenn er es ist, dann ist es noch kein Beweis, dass ich ihn vergiftet habe. Ich war ganz gewiss nicht während der Hochzeitsnacht beim König und seiner jungen Frau. Wenn ich den Wein trinke, könnte die einzige Folge die sein, dass ich ebenfalls sterbe.«
»Deine Angst verrät dich.« Onegesius’ freie Hand legte sich auf den Griff seines Schwerts.
Priskos nahm den Kelch. »Falls ich sterbe, denk immer daran, dass ich unschuldig bin.« Er setzte den Kelch an die Lippen und leerte ihn.
Die anderen warteten und beobachteten Priskos gespannt. Ellak kam näher. »Nun, Priskos?«
»Ich spüre nichts. Es schmeckt wie Wein.«
»Bitter? Sauer?«
»Wie jeder andere Wein – süß wie eine Traubenfrucht, aber mit ein paar Tropfen Essig.«
Ardarich roch an dem Kelch, tupfte ein wenig Wein mit dem Finger auf und benetzte damit seine Zunge. Er nickte Onegesius zu, ließ den Kelch auf den Teppich neben dem Leib des Großkönigs fallen und ging hinaus. Dort wandte er sich an die Krieger: »Es war kein Gift. Er ist an einer Krankheit gestorben.«
Priskos folgte Ardarich aus der Kammer und suchte sich einen Weg durch das Gedränge der Krieger. Mit ihren schmerzverzerrten, blutigen Gesichtern boten sie einen furchterregenden Anblick. Diese Männer hatten in ihrem bisherigen Leben nichts anderes getan als zu töten. Sie kämpften und aßen auf den Rücken ihrer Pferde. Manchmal schliefen sie sogar im Sattel. Im Verlauf von etwa drei Generationen hatten sie Stämme besiegt, vom Grasland jenseits der Wolga bis nach Gallien. An diesem Morgen war ihr größter Anführer von ihnen gegangen. Wer konnte mit Sicherheit sagen, was sie in ihrer Trauer und ihrem Zorn bereit waren, einem Fremden aus einem anderen Land anzutun?
Priskos ging mit schnellen Schritten und wagte nicht, einen der Krieger, die zum Zelt des Großkönigs strömten, offen anzusehen. Er begab sich in sein eigenes Quartier und bereitete einen Altar mit einigen brennenden Kerzen vor, um für Attilas Seele zu beten. Schließlich hatte Attila Priskos und den anderen Römern aufmerksam zugehört, als sie vom Christentum erzählt hatten. Und einmal war er mit Papst Leo in Mantua zusammengetroffen und hatte einen Vertrag mit ihm geschlossen. Vielleicht war dabei ein kleiner Funke Glauben in sein Bewusstsein gelangt. Auf jeden Fall schien es ihm das Beste, so auffällig wie möglich um ihn zu trauern. Priskos erbrach sich außerdem und trank viel Wasser und erbrach sich abermals und stellte fest, dass es ihn beruhigte.
Später dann, im Laufe des Tages, verließ er sein kleines Zelt und spazierte zur Lagermitte. Er sah, dass das Zelt des Großkönigs abgebrochen worden war. Dafür erhob sich an seiner Stelle eine imposante weiße Erscheinung. Staunend ging er darauf zu und berührte sie.
Ein riesiges Zelt aus weißer Seide war errichtet worden. Es flatterte und blähte sich im Wind, während er durch die Öffnung trat und hineinschaute. In der Mitte stand eine Totenbahre mit dem Leib des Großkönigs. Er lag dort, eingehüllt in Gewänder aus kostbarem violettem und rotem Tuch, wie es einem Kriegerkönig gebührte. An seiner Seite befanden sich die wertvollsten Waffen, mit Gold und Edelsteinen verziert.
Um die Bahre ritten die wilden Reiter, die besten Krieger des Großkönigs, viele von ihnen waren selbst Könige ihrer eigenen Stämme und Völker. Sie ritten in einem großen Kreis um den Toten herum und sangen von seinen Eroberungen und Siegen. Die Gesichter hatten sie voller Wunden, so dass das Blut wie Tränen über ihre Wangen rann. Sie sangen davon, dass er der größte Häuptling gewesen war, ein Mann, der nicht nur die silbern glänzenden Tränen der Frauen verdient hatte, sondern auch die roten Tränen der Krieger. Während sie unaufhörlich im Kreis ritten, konnte Priskos sehen, dass das Blut ihre Bärte tränkte und auf ihre Kleider und die Mähnen der Pferde tropfte.
Priskos kniete in Richtung des Königs gewandt nieder und verneigte sich so tief, dass seine Stirn den Erdboden berührte und die Krieger sehen konnten, dass er dem Verstorbenen auf seine eigene Art und Weise seinen Respekt erwies. Dann kehrte er in seine eigene Unterkunft zurück. Dort blieb er während der nächsten drei Tage und schrieb über Attilas Leben und Wirken als Großkönig und über seinen Tod in der Hochzeitsnacht. Besucher kamen zu Priskos und schilderten die umfangreichen Trauerzeremonien, die sie beobachtet hatten, und einige berichteten von der Rivalität zwischen Ellak, dem ältesten Sohn, und Dengizich, dem zweitältesten, und von der feindseligen Haltung Emakhs, des dritten Sohns, den die beiden ersten Söhne anscheinend gar nicht berücksichtigten. Einige Besucher erzählten ihm auch von Ardarichs Zorn darüber, dass die drei Söhne ihre Streitigkeiten nicht einmal so lange ruhen lassen konnten, bis ihr Vater beerdigt war.
Am vierten Tag begab sich Priskos wieder zu dem weißen Zelt und wurde Zeuge, wie der Großkönig im Lichtschein von einhundert brennenden Lampen für die Bestattung vorbereitet wurde. Attilas Leibdiener betteten seine sterbliche Hülle in einen dreifachen Sarg. Der äußere und größte war aus Eisen geschmiedet. Der zweite bestand aus Silber und der dritte aus Gold. Die Särge wurden außerdem mit den mit Edelsteinen besetzten Waffen zahlreicher Könige gefüllt, die Attila besiegt hatte. Er hatte gut einhundert asiatische Stämme unterworfen, die Alanen, Ostgoten, Armenier und Burgunder besiegt und war über den Balkan sowie über Thrakien, Skythien und Gallien hergefallen. Er hatte Mantua, Milano und Verona geplündert und den größten Teil Norditaliens an sich gerissen. Er hatte die Legionen der westlichen und östlichen Hauptstädte Roms und Konstantinopels vernichtend geschlagen.
Außerdem enthielten die drei Särge unglaubliche Mengen glitzernder Kleinodien und funkelnden Goldes, in denen sich das Licht der vielen Lampen brach. Die Särge selbst waren von unschätzbarem Wert. Priskos stellte sich vor, dass der innere Sarg wahrscheinlich aus den zweitausenddreihundert Pfund Gold bestand, den das Römische Reich als jährlichen Tribut an Attila entrichtete. Aber er konnte auch nicht das bunte Glitzern in den Särgen übersehen – das kühle Grün der Smaragde, die blutroten Rubine und die tiefblauen Saphire. Außerdem waren da noch feuriger Granat, blauer Lapislazuli, gelber Bernstein und erbsengrüne Jade, die um die bewundernden Blicke der Anwesenden buhlten.
Bei Anbruch der Dunkelheit versammelten sich eintausend Reiter, die aus der persönlichen Leibwache Attilas ausgewählt worden waren. Sie verschlossen die Särge mit den schweren Deckeln, wuchteten sie auf einen achträdrigen Pferdewagen, der das enorme Gewicht tragen konnte, und ritten los, ohne Fackeln anzuzünden, die ihnen in der Dunkelheit den Weg hätten weisen können.
Wochen später stellte Priskos eine Eselskarawane zusammen, um zu Kaiser Markian zurückzukehren und über seine Erlebnisse Bericht zu erstatten. Er würde einen Monat brauchen, um aus diesem wilden Land bis zu den Palästen von Konstantinopel zu gelangen – und war mittlerweile so weit, dass er sogar auf allen vieren dorthin zurückgekrochen wäre. Dann, im Laufe des Nachmittags, brach eine allgemeine Unruhe im Lager aus, als zahlreiche Bewohner mit den Fingern in die Ferne deuteten und in ihren jeweiligen Muttersprachen laute Rufe ausstießen. Daher machte er sich auf den Weg, um die Ursache zu ergründen.
Die ausgewählten Reiter des Leichenzugs kehrten ins Hunnenlager zurück. Sie näherten sich in vollem Galopp, und der Staub, den sie dabei aufwirbelten, war über der Steppe schon lange, ehe sie erschienen, als eine dunkle Wolke zu sehen.
Ardarich, Onegesius und die drei Söhne Attilas – Ellak, Dengizich und Emakh – sowie eine große Schar Krieger versammelten sich am Rand des Lagers, um sie zu begrüßen. Als die tausend Reiter anhielten, saßen sie ab und verneigten sich vor den versammelten Häuptlingen. In einer einzigartigen Ehrenbezeugung erwiderten die Häuptlinge die Verneigung. Ellak, der älteste Erbe Attilas, ging auf den Anführer des Bestattungskommandos zu, einen Mann namens Mozhu. Er legte Mozhu eine Hand auf die Schulter und sagte: »Berichte.«
Mozhu nickte und räusperte sich. »Wir brachten den Großkönig zu einem Ort in der Biegung eines weit entfernten Flusses, den Reisende nur selten passieren. Dort legten wir ein Grabmal an, so tief, wie zwei Männer groß sind, mit einem steil abfallenden Zugang, und trugen die Särge hinunter bis zum tiefsten Punkt. Danach schaufelten wir das Grabmal und den Zugang zu. Wir trieben unsere tausend Pferde mehrmals über den Platz, bis es unmöglich war, den genauen Punkt zu erkennen, wo sich das Grabmal befand. Dann leiteten wir den Fluss um, so dass er das Grab des Großkönigs für immer bedeckt.«
Ellak umarmte Mozhu. Dann kletterte er auf einen Ochsenkarren und hielt eine Rede, in der er sich bei den tausend Männern bedankte, die seinem Vater im Kampf zur Seite gestanden und seine sterbliche Hülle beschützt hatten. Ehe er vom Karren herabsprang, rief er: »Jetzt tötet sie.«
Die tausend Männer wurden von der Schar Krieger, die sie umringte, geradezu verschlungen. Für Priskos sah es aus, als versanken die tausend Angehörigen des Trauerzugs wie Schwimmer, die von einer Flutwelle in die Tiefe gezogen wurden – ein Kopf tauchte hier unter, dort ein paar weitere. Das Gewicht der gesamten Armee drückte sie hinab. Priskos sah niemanden, der sich gewehrt oder versucht hätte, sich in den Sattel zu schwingen, um zu fliehen. Er konnte nicht erkennen, ob es daran lag, dass ihre Exekution vollkommen überraschend erfolgte, oder ob sie von Anfang an geahnt hatten, dass jeder, der wusste, wo Attila begraben war, sterben musste.
Anschließend wurden die toten Reiter des Bestattungskommandos dort, wo sie gerade lagen, mit Erde bedeckt. Ihre Anführer lobten ihre Gefolgschaftstreue, ihre Ehrenhaftigkeit und Tapferkeit. Priskos schien es, als betrachteten die Hunnen dieses Massaker als einen ganz und gar natürlichen und unvermeidlichen Teil, der zum Tod eines großen Anführers dazugehörte. Beides war untrennbar miteinander verbunden.
Priskos verließ das weitläufige Lager im Morgengrauen des folgenden Tages mit seiner Karawane von einhundertfünfzig Eseln, die mit Vorräten und einigen wertvollen Gegenständen, die sich dazwischen versteckten, beladen waren – sowie dem von ihm eigenhändig verfassten Bericht über seine Mission bei den Barbaren, seinen persönlichen Büchern und einigen Geschenken seiner barbarischen Freunde. Begleitet wurde er außerdem von der halbwüchsigen Witwe Ildico, der er versprochen hatte, sie nach Germanien und zu ihren Eltern zurückzubringen, sofern ein solcher Umweg gefahrlos möglich war.
Als das Lager der Barbaren einen Tagesmarsch hinter ihnen lag, ging Priskos neben Ildicos Esel her und unterhielt sich mit ihr. »Siehst du, Kind? Ich sagte doch, dass alles vollkommen sicher ist. Sobald die Barbaren überzeugt waren, dass kein Gift im Spiel war, konnten wir, du und ich, kaum diejenigen sein, die ihn vergiftet haben.«
»Ich hörte, dass sie dich zwangen, den Wein zu trinken. Warum bist du noch am Leben?«
»Das Gift muss über einen längeren Zeitraum verabreicht werden, ehe es Blutungen auslöst und das Gerinnen des Blutes verhindert. Ich habe es Attila seit Wochen in kleinen Dosen gegeben. Genug, um sich in seinem Körper zu sammeln, so dass deine letzte Dosis dafür sorgte, dass er verblutete. Aber du solltest jetzt angenehmere Gedanken haben. Bald wirst du sehr reich sein.«
»Behalte alles Gold, das für mich bestimmt ist«, sagte sie. »Ich habe es für meine Leute getan, die er getötet hat. Bring mich nur nach Hause.«
»Der Kaiser wird dich gewiss mit einer Belohnung in deine Heimat ziehen lassen. Was du und ich getan haben, dürfte das Kaiserreich vor der Zerstörung bewahrt haben.«
»Das Kaiserreich interessiert mich nicht.«
Er setzte sich wieder an die Spitze der Karawane und dachte nach. Er hatte alles so gut eingefädelt – hatte den Wiesenklee selbst gesammelt und geduldig gelagert, bis sich Schimmel darauf gebildet hatte. Mit diesem hatte er dann ein Gift zubereitet, das nicht aufgespürt werden konnte und einen Tod verursachte, der aussah, als sei er die Folge einer Krankheit. Während er wanderte, formulierte er in Gedanken bereits Teile der Schilderung seines Aufenthalts bei den Hunnen. Er würde alles beschreiben – seine Mission vor vier Jahren mit Maximinus, als das Mordkomplott dem Übersetzer Vigilas angehängt wurde, die Taten der Barbaren und auch die Persönlichkeit ihres obersten Anführers.
Die Einzelheiten über den Tod des Großkönigs würde er natürlich weglassen. Jeder Trick, der nicht näher erläutert wurde, konnte noch einmal angewendet werden. Das Weströmische Reich würde von seinen Feinden über kurz oder lang überwältigt werden. Seine Legionen konnten unmöglich die Masse der Barbaren abwehren, jede Gruppierung war umfangreicher und grausamer als die vorangegangene. Es war ein reines Zahlenspiel. Die feineren Methoden des Oströmischen Reichs bemaßen sich nicht nach Zahlen – der Kaiser hatte nur einen einzigen Mann ausgesandt, um die Bedrohung durch die Hunnen zu beenden. Oder etwa nicht? Das Oströmische Reich würde weitere tausend Jahre überdauern.
Ildico war wirklich eine schöne junge Frau, dachte er. Die schlanke, anmutige Gestalt, die milchweiße Haut und das goldene Haar waren äußerst reizvoll. Wenn er sie für sich behielt, würde das auf gewisse Art seinen stillen Sieg über den großen Attila vollkommen machen. Aber nein, dachte er. Das wäre genau das, was ein gewöhnlicher Gesandter Roms täte.
2
VOR GRANT ISLE, LOUISIANA 2012 N. CHR.
Remi Fargo schwebte im warmen Wasser des Golfs von Mexiko und bewegte kaum die Schwimmflossen, während sie arbeitete. Sie legte die schartigen Bruchstücke eines Tontopfs, der halb im Sand vergraben gewesen war, als sie ihn gefunden hatte, in ihr Tragnetz. Sie schätzte, dass der Topf, sicherlich über eintausend Jahre alt, im heilen Zustand einen Durchmesser von etwa dreißig Zentimetern gehabt haben und etwa zehn Zentimeter tief gewesen sein musste, und sie war sich ziemlich sicher, sämtliche Scherben gefunden und eingesammelt zu haben. Sie wollte nicht riskieren, die glatte Oberfläche des Topfs zu zerkratzen, indem sie noch andere Fundstücke im Netz verstaute. Sie schaute zum gewölbten Bootsrumpf hinauf, der wie ein dunkles Phantom zwanzig Meter über ihrem Kopf unter der silbrig glänzenden Wasseroberfläche trieb. Als sie ausatmete, drangen Gasbläschen aus dem Mundstück ihres Atemreglers und tanzten als glitzernde Perlen dem Licht entgegen.
Remi fing den Blick ihres Mannes Sam auf, deutete auf ihr Tragnetz und dann mit dem Daumen nach oben. Er hielt etwas hoch, das wie ein Hirschgeweih aussah, wirkte so, als salutiere er, und nickte dann. Remi führte zwei träge Flossenschläge aus, und ihr schlanker, wohlgeformter Körper stieg begleitet von einem kleinen Schwarm glänzender Sardellen, die sie wie ein Wirbel aus Eiskristallen umkreisten, aufwärts. Die Fische verloren das Interesse an ihr, und sie strebte dem Boot entgegen.
Sie brach durch die Wasseroberfläche und sah sofort das andere Boot in einiger Entfernung. Sie tauchte wieder unter, schwamm zur anderen Seite des Tauchboots und wartete auf Sam. Hinter sich sah sie seine Gasbläschen aufsteigen, dann folgten sein Kopf und seine Maske.
Sie nahm das Mundstück heraus und atmete für einen Moment frische Luft. »Sie sind wieder da.«
Sam tauchte unter und kam am Heck wieder hoch. Er hielt sich dicht am Motor, so dass er mit der Silhouette des Bootes verschmolz. »Sie sind es, richtig – dasselbe Boot, schwarzer Rumpf und graue Aufbauten.« Er sah genauer hin. »Dieselben fünf – nein, sechs Leute.«
»Das ist schon der dritte Tag in Folge«, sagte Remi.
»Wahrscheinlich nehmen sie an, wir hätten die Stadt Atlantis gefunden.«
»Du machst zwar einen Scherz, aber es könnte natürlich stimmen. Nicht das mit Atlantis, aber sie wissen nicht, was wir hier tun. Schließlich ist das die Küste von Louisiana. Wir könnten nach einem alten spanischen Schatzschiff tauchen, das hier während eines Hurrikans untergegangen ist. Oder nach einem Bürgerkriegsschiff, das während der Blockade versenkt wurde.«
»Oder nach einem 2003er Chevrolet, den jemand flussaufwärts von einer Brücke gelenkt hat. Das Wasser ist hier zwanzig Meter tief. Wahrscheinlich sind sie bloß hier draußen, um ein Bier zu trinken und sich gegenseitig mit Sonnencreme einzuschmieren.«
Remi ließ sich zu Sam hinübertreiben und hielt sich an seiner Schulter fest, um das andere Boot sehen zu können. »Danke für deinen Mangel an Neugier, Mr. Witzbold. Sie verfolgen uns und beobachten, was wir tun. Hast du das gesehen? Das war ein Lichtreflex von einer Linse.«
»Bestimmt Paparazzi, die ein paar Bilder von mir schießen wollen.«
»Mach nur weiter so. Aber denk daran, Fremde im Nacken zu haben, die annehmen, dass wir etwas Wertvolles gefunden haben, kann genauso gefährlich sein, wie tatsächlich etwas Wertvolles zu finden. Diebe schlagen zu, ehe sie wissen, welche Schätze sie möglicherweise vorfinden.«
»Okay«, sagte er. »Sie sind seit drei Tagen auf Distanz geblieben. Sollten sie näher kommen, werden wir mit ihnen reden müssen. Bis dahin sollten wir aber dieses versunkene Dorf vermessen und kartographieren. Die letzten Wochen waren zwar durchaus interessant, aber ich habe keine Lust, den Rest meines Lebens mit Bergungsarchäologie zu verbringen.«
Sam und Remi Fargo betonten stets, dass sie ihren Ruf als Schatzjäger der Tatsache zu verdanken hatten, dass ein paar erfindungsreiche Reporter an einem besonders sensationsarmen Tag auf sie aufmerksam geworden waren. Ihnen beiden gemeinsam war das Interesse an Geschichte und der Drang, den jeweiligen Ort des Geschehens aufzusuchen und sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. In diesem Frühjahr hatten sie sich bereit erklärt, einige Tauchgänge für den Staat Louisiana durchzuführen. Ein Archäologe namens Ray Holbert hatte einige Küstenabschnitte auf Schäden durch Ölteppiche nach dem Brand einer Ölbohrinsel untersucht und war dabei auf einige Tonscherben gestoßen, die aus dem Golf an den Strand geschwemmt worden waren. Sie waren eindeutig einheimischen Ursprungs und ungewöhnlich alt. Er hatte bei der Ölbohrfirma finanzielle Hilfe beantragt, um zu bergen, was offenbar die Überreste eines versunkenen Dorfes waren. Als Sam und Remi von dem Projekt erfuhren, hatten sie sofort ihre Hilfe angeboten – unter Übernahme ihrer eigenen Kosten für Unterbringung und technische Hilfsmittel.
Remi sagte: »Komm mit mir runter. Ich glaube, ich habe eine weitere Feuerstelle gefunden. Nimm die Kamera mit.«
Sam zog sich über den Bootsrand, griff nach der Unterwasserkamera, und dann begaben sie sich wieder auf Tauchstation. Remi ging in ihrer Arbeit anscheinend völlig auf. Sie führte ihn zu der ummauerten Feuerstelle und überließ es ihm, sie eingehend zu untersuchen, während sie selbst die Kamera nahm und den Fundort aus jedem Blickwinkel fotografierte, um die jeweiligen Positionen der Tonscherben, die darum verteilt gewesen waren, festzuhalten. Sam verfolgte die anmutigen Bewegungen ihres Körpers – in ihrem Nasstauchanzug sah sie ein wenig wie ihr eigener Schatten aus – und entdeckte auf ihrer Stirn eine kleine Strähne kastanienbraunen Haars, die sich unter der Kapuze hervorgestohlen hatte. Er fing den Blick ihrer hellgrünen Augen auf, als sie ihn durch die Glasscheibe ihrer Maske fragend musterte. Daher zwang er sich, vorläufig auf den aufregenden Anblick zu verzichten und sich stattdessen dem Ring geschwärzter Steine zu widmen, den sie unter der Sandschicht entdeckt hatte. Dann füllten sie ihre Tragnetze vorsichtig mit weiteren Tonscherben, um sie ans Tageslicht zu bringen und zu katalogisieren, und markierten ihre Positionen.
Plötzlich hörten Sam und Remi das summende Geräusch eines Propellers. Es wurde lauter, und als sie nach oben blickten, gewahrten sie die Unterseite eines schwarzen Bootsrumpfs, der mit hohem Tempo Kurs auf ihr eigenes Boot nahm und dabei eine schäumende Bugwelle vor sich her schob. Sie konnten den Motor und die Schraube deutlich erkennen und sahen auch die lange Spur wirbelnder Luftbläschen dahinter.
Der Rumpf ihres Bootes schaukelte in den Wellen, und die Ankerkette spannte sich und zerrte am Anker, den sie im Sand versenkt hatten. Dann wurde die Kette schlaff, als das andere Boot abbremste und einen Meter von ihrem Boot entfernt ganz anhielt. Nach ein oder zwei Minuten nahm der schwarze Bootsrumpf wieder Fahrt auf und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit, wobei er von Wellenkamm zu Wellenkamm hüpfte.
Sam deutete mit dem Daumen nach oben, und sie stiegen zur Wasseroberfläche auf. Remi kletterte auf der Leiter ins Boot, und Sam folgte ihr. Während sie sich von ihrer Tauchausrüstung befreiten, sagte Remi: »Und? Das war doch deutlich näher, oder etwa nicht? Ich bin froh, dass wir nicht aufgetaucht sind, als sie angerast kamen.«
Sie sah, wie Sam die Zähne zusammenbiss und seine Kiefermuskeln arbeiteten. »Ich nehme an, sie wollten nachsehen, was wir vom Meeresgrund nach oben geschafft haben.«
»Ich hoffe, sie haben genug sehen können«, sagte sie. »Ich möchte nämlich nicht wegen ein paar Tonscherben und eines Abfallhaufens, der aus tausend Jahre alten Muschelschalen besteht, von einem Schiffspropeller zu Hackfleisch verarbeitet werden.«
»Mal sehen, wer sie sind«, sagte er, startete den Motor und ging zum Bug. Remi übernahm das Ruder und lenkte sie in Richtung Anker, damit seine Flügel vorwärtsgezogen und aus dem Sand befreit wurden. Sam hievte den Anker hoch und verstaute ihn unter dem Vorderdeck. Remi wendete das Boot, damit Sam die kleine Ringboje mit der Taucher-Warnflagge – rot mit einem weißen Querstreifen – auffischen, ihren leichten Anker hochziehen und beides im Bootsheck deponieren konnte.
Sie schob den Gashebel nach vorn und schlug mit zunehmendem Tempo die Richtung zum Grand Isle Harbor ein.
Sam trat neben Remi, stützte die Arme auf das Kabinendach und suchte mit Hilfe eines Fernglases den Horizont ab. Während sie an der Küste entlangjagten, flatterte Remis Haarsträhne im Wind. Sam sagte: »Ich sehe ihr Boot nicht. Sie müssen in den Hafen eingelaufen sein. Wir können ja mal nachschauen.«
Remi hielt mit Höchstgeschwindigkeit auf den Hafen zu, doch dann, als sie sich der Einfahrt näherten, nahm sie abrupt die Fahrt zurück. Während sie sich um den Hafendamm herumschoben, querte ein Boot der Küstenwache in einiger Entfernung ihren Kurs.
»Tolles Timing«, lobte Sam anerkennend. »Wahrscheinlich hättest du deinen verruchtesten Augenaufschlag einsetzen müssen, um unsere Freunde von der Wasserpolizei davon abzuhalten, uns einen Strafzettel wegen Rasens zu verpassen.«
»So was hab ich gar nicht nötig. Ich kriege keine Strafzettel, denn ich halte mich stets an die Gesetze«, sagte sie und klimperte mit den Wimpern in seine Richtung. »Du kannst jetzt übernehmen.«
Sie machte ihm Platz, und er legte die Hände auf das Ruder und bremste das Boot bis auf Schritttempo ab. Remi zog die Kapuze ihres Nasstauchanzugs herunter, beugte sich nach vorn und fuhr mit den Fingern durch ihr wallendes langes Haar, um es ein wenig zu glätten. Dann richtete sie sich wieder auf und sah Sam an. »Du suchst sie noch immer, nicht wahr?«
»Ich bin eigentlich nur neugierig. Ich frage mich, wie lange wir es noch ertragen müssen, dass uns Freizeitschatzsucher, Plünderer und Grabräuber auf Schritt und Tritt verfolgen.«
»Ich denke, du hast einige Interviews zu viel gegeben. Wahrscheinlich war es das mit dieser TV-Tante aus Boston mit den langen schwarzen Haaren.« Sie grinste ihn an. »Ich konnte ja gut verstehen, warum du ihr förmlich an den Lippen gehangen hast. Sie hatte einen derart kultivierten Akzent, dass die Fragen tatsächlich clever klangen.«
Sam erwiderte Remis Grinsen, ließ sich jedoch nicht zu einem Kommentar provozieren.
Auf der Suche nach dem schwarz-grauen Boot ließen sie die Blicke über die Liegeplätze wandern, während sie daran vorbeiglitten, entdeckten es jedoch nicht. Als sie den Slip für ihr gemietetes Tauchboot erreichten, bugsierten sie es hinein, machten es an den stabilen Klampen fest und hängten an den Seiten die Fender über den Bootsrand. Während sie mit einem Wasserschlauch ihre Tauchanzüge abspritzten und die Atemflaschen auf den Pier legten, damit sie zu Dave Carmodys Tauchladen gebracht und wieder aufgefüllt werden konnten, hielten sie weiter Ausschau nach dem schwarz-grauen Boot.
»Hey, Fargos!« Ray Holbert winkte heftig, während er auf den Pier trat und ihn dadurch auf seinen Pontons in ein leichtes Schwanken versetzte. Er war hochgewachsen, sein Gesicht war von der Sonne gerötet, und seine Bewegungen wirkten ausgesprochen schwungvoll. Seine Schritte waren lang und seine Gesten ausladend.
»Hi, Ray«, begrüßte ihn Remi.
»Haben Sie etwas gefunden?«
Sam hob den Deckel eines Schranks in Hecknähe hoch, so dass mehrere volle Tragnetze zu sehen waren. »Ein paar Tonscherben haben wir in der Nähe einer mit Steinen befestigten Feuerstelle gefunden, dazu einige Werkzeuge aus Feuerstein, ein Hirschgeweih, von dem ein paar Enden abgebrochen wurden, wahrscheinlich um sie als Pfeilspitzen zu verwenden. Außerdem haben wir den Fundort nahezu vollständig vermessen und davon Skizzen angefertigt.«
Remi reichte die Kamera nach oben. »Dort ist alles drin. Sie können es auf Ihren Computer runterladen und es dem Material hinzufügen, das Sie bereits gesammelt haben.«
»Ausgezeichnet«, sagte Ray. »Wir holen zeitlich ein wenig auf. Ich glaube, wir werden die drei versunkenen Dörfer vor diesem Küstenabschnitt identifizieren, vermessen und gründlich untersuchen können, ehe die Geldspende aufgebraucht ist.«
»Wir helfen aus, wenn es so weit kommen sollte«, sagte Sam. »Und können unsere Arbeit auch noch ein wenig ausweiten.«
»Warten wir erst mal ab«, sagte Ray.
»Folgen Sie uns mit Ihrem Lastwagen zu unserer Hütte«, sagte Remi. »Dort können wir Ihnen unsere letzten Fundstücke übergeben. Die Karten und die Fotografien liegen schon bereit, die Artefakte und Knochen sind etikettiert, und ihre Lage ist auf dem Gitternetz eingezeichnet. Ich fühle mich erheblich wohler, wenn Sie alles übernehmen.«
»Okay«, sagte Holbert. »Wir erfahren wirklich eine ganze Menge über diese Leute. Bisher wussten wir fast nichts über sie. Diese Dörfer lagen dicht oberhalb des Strandes. Die Kohlenstoffdatierung zeigt, dass sie durch das Ansteigen der Ozeane im Jahr 700 überflutet wurden. Sie alle sind anscheinend genauso groß wie Ihr Dorf – etwa fünf oder sechs Familien in kleinen Behausungen mit Feuerstellen aus Stein. Sie lebten von dem, was sie im Meer fangen konnten, aber weiter landeinwärts machten sie auch Jagd auf Rotwild. Diese erste Garnitur von Fundstätten war sehr ergiebig.«
»Wollen Sie damit sagen, dass es für die zweite Garnitur Zeit wird?«, fragte Remi.
»Ich möchte, dass wir übermorgen ein paar Meilen weiter nach Westen gehen. Dort gibt es noch ungefähr zwei Dutzend potentielle Fundstätten, und jedes Tauchteam hat bereits jeweils eine in Augenschein genommen. Übermorgen soll jedes Team einen ersten Blick auf einen Punkt an der Küste vor dem Caminada Headland werfen. Auf diese Art und Weise erhalten wir eine bessere Vorstellung davon, was wir noch tun müssen, ehe uns die freiwilligen Sommer-Hilfskräfte verlassen. Wahrscheinlich werden wir sowieso die meisten Grabungsstätten eliminieren, wenn wir uns unter Wasser einen ersten Überblick verschaffen.«
Nach zehn Minuten erreichten sie die kleine Hütte, die Sam und Remi einen Block vom Strand entfernt auf der Südseite von Grand Isle gemietet hatten. Es war ein einstöckiges Gebäude, auf Pfählen erbaut, mit weiß gestrichenen Schindelwänden und einer großzügigen Vorderveranda, wo sie am Ende des Tages gemütlich sitzen und die kühle Brise des Golfs von Mexiko genießen konnten.
Sam und Remi reisten gerne anonym, und an und in der Hütte gab es nichts, das jemanden auf die Idee gebracht hätte, dass die Mieter ein mehrere Millionen schweres Ehepaar waren. Das Haus verfügte über ein niedriges Dach über der Veranda, zwei große Panoramafenster mit einem nahezu uneingeschränkten Blick aufs Wasser, zwei Zimmer und ein Bad. Ein Zimmer hatten sie in einen Lager- und Arbeitsraum für diejenigen Objekte umgewandelt, die sie aus dem versunkenen Paläoindianerdorf geborgen hatten.
Ray Holbert kam mit ins Haus, und Sam zeigte ihm die gefundenen Artefakte, während Remi als Erste duschte. Sam reichte ihm den Lageplan mit dem Gitternetz und den präzise eingezeichneten Fundorten der einzelnen Objekte. Hinzu kamen Speicherkarten voller Fotos, die Remi geschossen hatte, um sicherzugehen, dass die räumliche Lage eines jeden Objekts im Verhältnis zu den anderen dokumentiert wurde. Die Artefakte selbst waren in Kunststoffkisten verpackt.
Holbert betrachtete den Rasterplan des Dorfes und die Fundstücke. »Dieser Menge von Hirschgeweihen und Knochen nach zu urteilen hat das ansteigende Wasser die Landschaft ziemlich gründlich verändert. Damals gab es sicherlich dicht bewaldete Bergrücken und Gebirgswälle. Heute findet man dort vorwiegend Sümpfe und flaches ebenes Land knapp über Meereshöhe.«
»Eigentlich ist es eine Schande weiterzuziehen«, sagte Remi. Sie hatte sich nach dem Duschen für die klassische Grand-Isle-Abendgarderobe entschieden – Shorts, ein weit geschnittenes kurzärmeliges Polohemd und Flip-Flops. »Auch wenn ich unsere Schatten sicher nicht vermissen werde.«
»Was meinen Sie?«, fragte Holbert.
»Wahrscheinlich ist es unsere Schuld«, sagte Sam. »Da war noch ein anderes Tauchboot, das uns ständig gefolgt ist. Sie haben genau aufgepasst, wohin wir fuhren, dann beobachteten sie uns mit Ferngläsern. Heute kamen sie sogar bis auf einen Meter an unser Boot heran, als wollten sie nachschauen, was genau wir aus dem Meer geholt hatten.«
»Seltsam«, sagte Holbert. »Das ist das erste Mal, dass ich davon höre.«
»Nun, wie ich schon angedeutet hatte, vielleicht sind wir selbst daran schuld. Das ist der Preis, den wir dafür zahlen müssen, dass unsere Namen ständig in der Zeitung stehen«, sagte Sam und sah zu Remi hinüber. »Oder vielleicht Remis Foto. Na gut, ich helfe Ihnen, das Zeug in Ihren Wagen zu laden, ehe ich unter die Dusche gehe.«
Innerhalb von zwanzig Minuten war Holberts Pick-up beladen, und nur wenig später saßen sie im Restaurant bei ausgelösten Austern, gegrillten Shrimps mit Remouladensauce, frisch gefangenem, ebenfalls gegrilltem Red Snapper und einer Flasche gekühltem Chardonnay von den Kistler Vinyards in Kalifornien. Nachdem sie die Mahlzeit beendet hatten, fragte Sam: »Was meinen Sie? Sollen wir noch eine zweite Flasche Wein köpfen?«
»Nein, danke«, lehnte Ray ab.
»Für mich auch nicht«, schloss sich Remi an. »Wenn wir nur noch einen Tag Zeit für dieses Dorf haben, möchte ich morgen so früh wie möglich loslegen. Danach könnte es sein, dass wir tagelang herumschwimmen und gar nichts finden.«
»Das ist richtig, das könnte passieren«, pflichtete Sam ihr bei. Sie wünschten Ray Holbert eine gute Nacht, kehrten zu Fuß zu ihrer Hütte zurück, verriegelten die Tür und löschten das Licht. Während der Deckenventilator träge über ihrem Bett rotierte, ließen sie sich vom gedämpften Pulsieren der Brandung am Strand in den Schlaf wiegen.
Sam erwachte beim ersten Sonnenstrahl, der durch den Vorhangspalt drang, dachte daran, sich auf Zehenspitzen aus dem Schlafzimmer zu schleichen, um Remi nicht zu wecken, und traf sie auf der Vorderveranda an, wo sie angezogen und unternehmungslustig bei einer Tasse Kaffee saß, das Panorama des Golfs von Mexiko betrachtete und auf ihn wartete.
Bei einem Café machten sie Halt, kauften Croissants und zwei Becher Kaffee und fuhren dann weiter zum Bootshafen. Sie gingen über den Pier zum Liegeplatz ihres gemieteten Bootes und blieben stehen. »Siehst du das?«, fragte Remi flüsternd.
Sam nickte. Er kniff bereits die Augen zusammen und blickte sich misstrauisch um. Gleichzeitig schlüpfte er aus seinen Schuhen und trat barfuß auf das Vorderdeck des Bootes. Die Kabinentür war geschlossen, doch das Schließband des Vorhängeschlosses war mit einem heftigen Schlag abgerissen worden. Sam öffnete die Schiebetür und schaute in die Kabine. »Unsere Ausrüstung wurde ruiniert.«
»Ist daran herumhantiert worden?«
»Das trifft es nicht ganz. Völlig zerstört passt wohl eher.« Sam holte sein Mobiltelefon hervor und tippte eine Nummer ein. »Hallo, Dave? Hier ist Sam Fargo. Wir haben heute Morgen offenbar ein Problem. Wir sind gerade im Bootshafen, und in das Boot, das wir von Ihnen gemietet haben, wurde eingebrochen. Sieht so aus, als hätten sie unsere Atemregler zertrümmert und den Gummi an Masken und Flossen zerschnitten. Keine Ahnung, was sie mit dem Luftflaschen getan haben, aber an Ihrer Stelle wäre ich vorsichtig beim Füllen. Den Motor und den Benzintank habe ich noch nicht kontrolliert. Wenn Sie uns umgehend Ersatz beschaffen würden, könnten wir trotzdem heute auslaufen. Inzwischen benachrichtige ich die Polizei.«
Dave Carmody sagte: »Gedulden Sie sich bitte noch ein wenig, Sam. Ich bin in ungefähr einer halben Stunde mit allem, was Sie brauchen, bei Ihnen. Und lassen Sie lieber mich die Polizei anrufen. Grand Isle ist ein kleines Nest, dort kennt man mich. Da wissen sie, dass sie mich noch mindestens die nächsten zwanzig Jahre ertragen müssen.«
»Danke, Dave. Wir halten die Stellung.« Sam steckte das Mobiltelefon ein und setzte sich aufs Vorderdeck. Für einige Zeit rührte er sich nicht, sondern starrte nur aufs Wasser hinaus.
Remi beobachtete ihn aufmerksam. »Sam?«
»Was ist?«
»Versprich mir, dass du keine unverhältnismäßigen Aktionen planst.«
»Nein, nichts Unverhältnismäßiges.«
»Sollte ich vielleicht genug Bargeld besorgen, um eine mögliche Kaution zu bezahlen?«
»Das ist nicht nötig«, wiegelte er ab.
»Hmmm«, sagte sie, während sie ihn prüfend musterte. Dann holte sie ihr eigenes Mobiltelefon hervor und tippte eine andere Nummer ein. »Delia?«, fragte sie. »Hier ist Remi Fargo. Wie geht es dir? Na, das finde ich toll. Ist Henry gerade bei Gericht? Meinst du, ich könnte ihn mal sprechen? Wunderbar. Danke.«
Während sie wartete, ging Remi zum Bootsheck. »Henry?«, sagte sie. »Ich wollte dich um einen kleinen Gefallen bitten.« Sie wandte sich von Sam ab und senkte die Stimme, während sie etwas sagte, das Sam nicht verstehen konnte. Dann wandte sie sich wieder um und ging auf Sam zu. »Danke, Henry, wenn du ihn schon mal vorwarnen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Bye.«
»Welcher Henry war das?«, wollte Sam wissen.
»Henry Clay Barlow, unser Anwalt.«
»Aha, der Henry.«
»Er erklärte mir, dass wir keine Kaution zahlen müssten. Stattdessen ruft er einen Freund in New Orleans an, der sich bereithält, um per Hubschrauber mit einem Koffer voll Geld und einem Antrag auf ein Haftprüfungsverfahren hierherzukommen, falls wir ihn brauchen. Henry sagt, er sei aalglatt und gerissen.«
»Für Henry ist das das höchste Lob. Was wird uns das kosten?«
»Kommt drauf an, was wir tun.«
»Gutes Argument.« Sam hörte ein Geräusch und schaute den Pier entlang. »Da ist Dave vom Tauchladen.«
Daves Pick-up hielt am Ende des Kais an. Er kam in Begleitung eines uniformierten Polizisten, der einen Werkzeugkasten trug, über den Schwimmpier. Der Polizist war groß und blond und hatte breite Schultern und einen Bierbauch, so dass es aussah, als würde jeden Moment ein Knopf von seinem Uniformhemd abspringen. »Hi, Sam«, sagte Dave und deutete dann eine Verbeugung an: »Hi, Remi.«
Sam erhob sich. »Das ging aber schnell, Dave.«
»Dies ist Sergeant Ron Le Favre. Er meinte, er sollte sich erst einmal umschauen, ehe wir Ihre Ausrüstung ersetzen.« Sobald Daves Blick über sein Boot wanderte, wurde er abgelenkt und deutete in eine bestimmte Richtung. »Sehen Sie sich mal diese Kabinentür an. Das ist importiertes Hartholz und wurde so aufwendig lackiert, dass man sich darin spiegelt.«
Sergeant Le Favre betrat das Boot. »Freut mich, Sie beide kennenzulernen.« Er holte eine Kamera aus seinem Gerätekasten und machte Fotos von den Beschädigungen. Gleichzeitig stellte er Fragen. »Mr. Fargo, haben Sie irgendeine Erklärung für diesen Vorfall? Wurde etwas gestohlen?«
»Mir fällt nichts auf. Es wurde nur zerstört.«
»Haben Sie hier Feinde?«
»Nicht dass ich wüsste. Alle waren bis jetzt ganz freundlich zu uns.«
»Haben Sie eine Theorie?«
Sam zuckte die Achseln. Remi sah ihn verwirrt und verärgert an.
»Okay, ich notiere das«, sagte Sergeant Le Favre. »Damit Dave den Schaden seiner Versicherung melden kann. Zuerst überprüfe ich, ob hier irgendjemand die vergangene Nacht auf seinem Boot verbracht hat. Vielleicht hat jemand etwas gesehen.«
»Vielen Dank, Sergeant«, sagte Sam und half anschließend Dave Carmody, die beschädigte Ausrüstung auf seinen Truck zu laden und die neuen Geräte aufs Boot zu tragen. Danach startete er den Motor, und er und Dave lauschten auf ungewöhnliche Geräusche, öffneten die Abdeckung des Motorraums und warfen einen prüfenden Blick auf die Treibriemen und Schlauchleitungen. Ehe sich Dave verabschiedete, sagte Sam: »Dave, das Ganze ist wahrscheinlich passiert, weil sich jemand zu heftig dafür interessiert hat, wonach wir tauchen. Wir haben in letzter Zeit ziemlich viel öffentlichen Wirbel ausgelöst, und das ist wahrscheinlich der Preis, den wir dafür zahlen müssen. Rechnen Sie die Kosten zusammen und setzen Sie alles auf unsere Rechnung. Ich möchte nicht, dass Sie Ihre Versicherung in Anspruch nehmen und Ihnen am Ende die Beiträge erhöht werden.«
Dave schüttelte ihm die Hand. »Danke, Sam. Das ist wirklich rücksichtsvoll.«
Sobald Sam und Remi allein waren, sagte sie: »Keine Theorien, Sam? Wie wäre es mit den Leuten im schwarz-grauen Boot, die uns seit Tagen beobachten?«
»Ich habe nicht nein gesagt, sondern nur mit den Achseln gezuckt.«
»Falls etwas anderes passiert, möchtest du dann nicht, dass sie im Bericht des Sergeants auftauchen?«
»Na ja, wenn etwas passieren sollte, das diese Leute in irgendeiner Weise verärgert, dann fände ich es nicht sehr günstig, wenn im Polizeibericht zu lesen wäre, dass ich sie im Verdacht habe, uns belästigt zu haben.«
»Ich verstehe«, sagte sie. »Dieser Tag wird sicherlich sehr interessant.«
Sam sah sich auf dem Boot um und nahm eine schnelle Inventur ihrer Ausrüstung vor, ehe er die Leinen löste. Remi startete den Motor und lenkte das Boot langsam aus dem Bootshafen in Richtung Golf. Vor ihnen bestand die Welt aus tiefblauem Himmel und einer ebenso tiefblauen See – beide trafen sich am Horizont und reichten anscheinend bis in die Unendlichkeit.
Sam stand neben Remi, als sie das Boot um den Hafendamm herummanövrierte und sein Tempo steigerte. »Ich hoffe, dass wir mit diesem Fundort heute fertig werden, so dass wir, ehe wir zum nächsten weiterziehen, ziemlich sicher sein können, alles gefunden zu haben, was sich zu finden lohnt.«
»Wunderbar«, sagte sie. »Das klingt ja nach ziemlich friedlichen Absichten.«
Sie bewegten sich an der grünen ebenen Küste Louisianas entlang zu dem Punkt, an dem sie am Vortag getaucht waren. Als sie sich jedoch der Position näherten, sagte Remi: »Jetzt sieh dir das an.«
Sam schaute über das Kabinendach hinweg. Er konnte das schwarz-graue Boot erkennen, das in einiger Entfernung ankerte. Die rot-weiße Flagge war aufgezogen, und einige Personen befanden sich im Wasser. »Interessantes Zusammentreffen«, sagte er. »Unsere Tauchausrüstung wurde sabotiert, und jetzt treffen wir diese Leute dabei an, wie sie in ›unserem‹ Gebiet tauchen.« Sam holte sein Fernglas hervor und nahm ein paar Sekunden lang das schwarz-graue Boot ins Visier. »Offenbar klettern sie gerade aus dem Wasser. Sie holen ihre Tauchbojen ein und streichen die Warnflagge.«
»Na ja, ist doch klar«, sagte Remi. »Die Fargos, die als Schatzsucher so berühmt sind, haben, wie sich herausstellt, nach zerdepperten Tontöpfen und Hirschgeweihen getaucht. Und das haben diese Leute soeben festgestellt.« Sie drosselte den Motor. »Geben wir ihnen Gelegenheit, von hier zu verschwinden. Ich gehe ganz sicher nicht ins Wasser und lasse unser Boot unbewacht zurück, während diese Leute noch in der Nähe sind.«
»Vielleicht ist das aber gar nicht der Grund, weshalb sie abhauen. Wenn wir sie sehen können, können sie auch uns sehen. Versuchen wir etwas anderes. Behalte sie mal für eine Minute im Auge.« Er stieg in die Kabine hinunter und kam mit einer Landkarte zurück. Er hielt sie hoch, damit Remi sie sehen konnte. »Fahr dort entlang in Richtung Vermilion Lake. Und wenn wir dort sind, dann such dir einen Weg in den Sumpf.«
»Das klingt ein bisschen vage.«
»Ich möchte deine Kreativität nicht einengen. Mal sehen, ob du sie abhängen kannst.«
Remi ging auf Vorausfahrt, schlug den gewünschten Kurs ein und gab Gas, was der 427-Chevrolet-Motor mit einem dumpfen Dröhnen quittierte. Dann schoss sie in beträchtlichem Abstand an dem grau-schwarzen Boot vorbei und behielt ihr Tempo bei. Nach ein paar Minuten tippte Sam ihr auf die Schulter, und sie blickte zurück. Als sie sah, dass ihnen das schwarz-graue Boot mit Höchstgeschwindigkeit folgte, legte sie den Kopf in den Nacken und lachte schallend. »Sie sind nicht besonders raffiniert, oder? Ich denke, es wird ein Wettrennen.« Sie schob den Gashebel bis zum Anschlag nach vorn, dann drückte sie mit der Handkante dagegen, um auch noch das letzte Quäntchen Leistung aus der Maschine herauszukitzeln. Während sie an den Caminada Headlands entlangrasten, funkelten ihre Augen vor Vergnügen.
Ab und zu traf das Boot auf eine Querwelle und machte einen Satz darüber hinweg. Remi beugte die Knie, um den Sprung wie ein Skiläufer abzufedern, behielt das Ruder fest in der Hand und duckte sich gelegentlich, um den Gischtwolken auszuweichen, die ihnen der Wind entgegenwehte. Sam stand dicht neben ihr und meinte: »Du kannst jetzt ein wenig langsamer werden. Wenn sie uns so schnell aus den Augen verlieren, geben sie vielleicht auf. Und wir wollen doch, dass sie mit Eifer bei der Sache bleiben.«
»Aye, aye«, sagte sie.
Sie setzte die Fahrt fort und achtete darauf, immer noch so eben in Sicht ihrer Verfolger zu bleiben, bis Sam schließlich sagte: »Okay. Und jetzt zum Vermilion Lake.«
Sie schwenkte nach rechts, pflügte durchs offene Wasser und steuerte dann auf die versumpften Flussarme zu. Während sie in den ersten engen, gewundenen Kanal hineinrauschte, nahm sie nach und nach das Gas zurück. »Hey, du kannst dich ruhig mal nützlich machen«, sagte sie. »Geh zum Bug und achte darauf, dass ich mit nichts kollidiere, das lebt oder Löcher in Booten hinterlässt.«
»Mit Vergnügen«, sagte Sam, stellte sich aufs Vorderdeck und deutete in die Richtung, die das schnellste Durchkommen versprach. Im Wasser hielt er Ausschau nach Hindernissen und Untiefen und dirigierte Remi um sie herum. Das Wasser war dunkel und fast vollkommen trüb, und der Kanal war mit Schilf und Bäumen gesäumt, die mit Moos und Schlingpflanzen überwuchert waren. Während sie weiter landeinwärts vordrangen, wurde die Vegetation dichter, die Bäume rückten zusammen und bildeten über dem Wasser ein gewölbtes Dach. Nach einiger Zeit rief Sam: »Schalte in den Leerlauf.«
Der Propeller stoppte, und das Boot trieb mit leise blubberndem Motor noch ein Stück weiter, dann hielt es im Schatten eines kleinen Wäldchens an. Irgendwo hinter ihnen konnten sie den Motor des schwarz-grauen Bootes hören. Sam und Remi nickten einander zu, dann gab Remi wieder Gas. Zwanzig Minuten lang behielten sie dieses Tempo bei, danach winkte ihr Sam abermals zu. Sie bremste bis auf ein langsames Kriechtempo herunter, während Sam nach achtern kam, um einen Blick auf die Landkarte zu werfen.
»Halt dich bereit zu ankern.«
»Bist du sicher?«
»Ist mit dieser Stelle irgendetwas nicht in Ordnung?«
»Es ist ein drückend heißer, von Moskitos wimmelnder Sumpf, in dem sich die Alligatoren und die seltenen und berühmten amerikanischen Krokodile kaum erfolgreich gegen Wassermokassins wehren können. Und gerade habe ich einen Reiher mit einem Hitzschlag aus einem Baum fallen sehen.«
»Großartig«, sagte Sam. »Lass uns die Nasstauchanzüge anziehen. Sie schützen uns vor den Moskitos. Zieh auch deine Stiefel an, denn wir werden ein Stück laufen. Und wir sollten auch Schwimmflossen mitnehmen, für den Fall, dass wir schnell sein müssen.« Sam studierte die Karte, dann markierte er einen Punkt, der etwa eine halbe Meile von ihrem Liegeplatz entfernt lag, mit einem roten Kreuz.
»Ist das nicht ein wenig plump?«
»Sie haben sich bisher so viel Mühe gegeben, um einen Blick darauf zu werfen, dass sie es einfach ernst nehmen müssen.«
Als sie so weit waren, benutzte Sam das stumpfe Ende des Bootshakens, um sie ans Ufer zu schieben, und hielt dann das Boot mit dem Haken in Position, während sie ausstiegen und in den Morast einsanken. Sam versetzte dem Boot einen Stoß, damit es wieder in die Mitte des Kanals trieb.
»Und nun?«, fragte Remi.
»Jetzt gehen wir auf Wanderschaft.«
»Reizend. Aber du läufst voraus.« Sie folgte ihm durch das Schilf und den Sumpf.
Ab und zu wandte sich Sam fürsorglich zu ihr um. Sie marschierte in gleichmäßigem Tempo, auf dem Gesicht ein entspanntes Lächeln. Nach etwa zwanzig Minuten zügigen Fußmarsches blieb Sam stehen. »Jetzt kommst du allmählich dahinter, nicht wahr?«
»Schon möglich.«
»Warum nur ›schon möglich?‹ »
»Nimmst du an, dass sie einen GPS-Signalgeber auf unserem Boot versteckt haben?«
Er grinste. »Ich habe ihn sogar gefunden. Ich hatte mich nämlich gefragt, weshalb sie den Motor nicht sabotiert haben, und erst dann wurde mir klar, dass wir nicht zu lange in den Motorraum schauen sollten.«
»Dann ja. Dann bin ich dahintergekommen. Lass uns weitergehen und sehen, ob sie unserer Spur bis zum Schatz folgen.«
Er sah sie bewundernd an. »Manchmal verblüffst du mich zutiefst.«
»Wirklich?«, fragte sie. »Noch immer?«
Er führte Remi tiefer in den Sumpf hinein und dann in einem weiten Bogen, so dass sie einen riesigen Kreis schlossen. Als sie zu ihrem Boot zurückkamen, ging Remi etwa einhundert Meter weiter bis zur nächsten Kanalbiegung und deutete auf etwas. Das schwarz-graue Boot ankerte dort, so dass sie es von ihrem Boot aus nicht sehen konnten.
Sam setzte sich auf einen umgestürzten Baumstamm, schlüpfte in seine Schwimmflossen und setzte seine Tauchmaske auf.
Remi legte eine Hand auf seinen Arm. »Das mit den Alligatoren war kein leeres Gerede, wie du hoffentlich weißt.«
»Verrat ihnen nicht, dass ich hier bin.« Er watete ins trübe Wasser und verschwand. Am Heck des schwarz-grauen Bootes tauchte er wieder auf. Dann machte er sich zum Bug auf, zog den Anker hoch und ließ das Boot stromabwärts treiben.
Remi watete eilig dorthin, wo sie ihr Tauchboot dicht am Ufer im Schutz der abgestorbenen Bäume zurückgelassen hatten. Mit dem Bootshaken stieß sie sich vom Ufer ab, lichtete den Anker und schaute über das träge dahinfließende Wasser des Kanals zu Sam hinüber, der in dem schwarz-grauen Boot langsam auf sie zutrieb. Sie konnte erkennen, dass er mit einigen Drähten herumhantierte, die er mit seinem Tauchermesser durchtrennt und abisoliert hatte.
Remi verfolgte, wie Sam zwei Drähte miteinander verband. Der Motor sprang an, und er lenkte das Boot durch den Kanal in ihre Richtung. Sie startete ebenfalls den Motor ihres Bootes und lenkte es in mäßiger Geschwindigkeit vor ihm kanalabwärts. Dabei verließ sie sich auf ihr Gedächtnis, was die Lage der versunkenen Baumstämme und Sandbänke betraf. Nach wenigen Minuten erreichte sie den Mud Lake, der im Grunde nicht mehr als Sumpftümpel war, danach den Vermilion Lake, und schließlich glitt sie auf den Golf hinaus. Sam holte nur Sekunden später zu ihr auf.
Als sie das offene Wasser weit vor den Caminada Headlands erreichten, lenkten sie die Boote nebeneinander und vertäuten sie. Remi stieg auf das schwarz-graue Boot um. »Das war einfach perfekt.«
»Danke«, sagte er. Sie begannen, das schwarz-graue Boot zu durchsuchen, und konzentrierten sich dabei vor allem auf die Kabine. Nach ein paar Minuten hielt Remi einen blauen Schnellhefter hoch, der etwa einhundert Blatt Papier enthielt. »Es ist eine Firma. Hast du schon mal etwas von Consolidated Enterprises gehört?«
»Nein«, sagte Sam. »Ziemlich vage, der Name. Klingt nach nichts Speziellem.«
»Ich denke, sie wollen sich alle Möglichkeiten offenhalten«, sagte sie.
»Zurzeit sind sie jedenfalls Schatzsucher.« Er deutete auf einen schwimmfähigen Metalldetektor, der auf dem Deck lag und jederzeit zu Wasser gelassen werden konnte.
»Warum sollte man so ein Ding benutzen, wenn man die Leute verfolgen kann, die die Schätze finden, dann ihre Ausrüstung zerstört und schließlich ihren Tauchplatz besetzt?«
Sam schaute sich in der Kabine um. »Sie sind zu sechst.«
»Zwei Frauen.« Sie nickte und schlug den Schnellhefter auf. »Da haben wir es. Sie sind ein ›Einsatzteam‹ komplett mit Fotos und Namen.«
»Nimm den Schnellhefter mit«, sagte Sam.
»Überschreiten wir damit nicht die Grenze des Erlaubten?«
»Liegt es etwa im Bereich des Erlaubten, sechs Leute in einem Sumpf vierzig Meilen von ihrem Zuhause entfernt stranden zu lassen?«
»Natürlich, du hast recht.« Sie klappte den Schnellhefter zu und ging an Deck. »Was geschieht mit ihrem Boot?«
»Wo befindet sich der Hauptsitz dieser Firma?«
»In New York.«
»Dann bringen wir es am besten in den Bootshafen«, sagte Sam. »Wahrscheinlich wurde es von jemandem gemietet, der es sich nicht leisten kann, es zu verlieren.«
Remi schwang die Beine über den Bootsrand und ließ sich in ihr eigenes Boot gleiten. Sam reichte ihr die Tauchmaske und die Schwimmflossen, dann streifte er seinen Tauchanzug ab und warf ihn ebenfalls ins Boot. Remi löste die Leine, die die beiden Boote miteinander verband. »Mal sehen, wer als Erster Grand Isle erreicht.« Sie startete den Motor. »Der Sieger darf auch als Erster duschen.«
Sam ließ den Motor des schwarz-grauen Bootes wieder an und nahm Fahrt auf. Mit Höchsttempo über die Wellen schießend, wobei die Boote immer wieder über Wellenkämme sprangen und hart in den Wellentälern aufschlugen, erreichten sie nahezu gleichzeitig nach fast einer Stunde den Bootshafen. Nachdem Sam das schwarz-graue Boot an einem Pier festgemacht hatte, kletterte er heraus, bekleidet mit einem kurzfristig ausgeborgten Sweatshirt, dessen Kapuze er sich über eine Baseballmütze gezogen hatte, die seinen Kopf bedeckte. Er verließ den Steg und betrat den benachbarten Pier, wo Remi soeben ihr Boot vertäute. Sie blickte auf. »Du siehst in deinem gestohlenen Outfit richtig selbstgefällig aus.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich lache nur gerne. Das heißt, ich bin völlig harmlos und immer freundlich.«
Sie zurrte die Leinen fest, dann ging sie zur Kabine und zog probeweise an dem neuen Vorhängeschloss. »Harmlos? Durchschaubar zu sein ist nicht das Gleiche wie harmlos. Lass mich lange und heiß duschen, führe mich anschließend in ein gutes Restaurant, und dann können wir vielleicht darüber reden, ob das mit dem Freundlichsein wirklich zutrifft.«
3
LA JOLLA, KALIFORNIEN
Selma Wondrash saß am Schreibtisch ihres Büros im ersten Stock der Fargo-Residenz am Goldfish Point in La Jolla. Es war erst früher Abend in Kalifornien, und sie schaute von dem Buch auf, in dem sie las, um zu verfolgen, wie die Sonne über der spiegelglatten Fläche des Ozeans unterging. Sie liebte diesen winzigen Moment, wenn die Sonne dicht über dem Horizont stand und wie das Gelbe eines Spiegeleis erschien. Die langen Wogen des Pazifik wälzten sich unterhalb des Hauses gegen den Fuß der Steilklippe, und sie stellte sich vor, wie sie die weite Reise von der anderen Seite der Welt bis hierher zu ihr gemacht hatten. Sie hatte nur selten Zeit, Bücher zum reinen Vergnügen zu lesen, aber die Fargos waren seit fast einem Monat in Louisiana, und was sie dort taten, machte den Einsatz ihrer Fähigkeiten als Chefin der Fargo’schen Recherche-Abteilung nur selten erforderlich.
Mit den Fingern fuhr sie sich durch das kurzgeschnittene Haar, schloss für einen Moment die Augen und dachte über das Buch nach, das sie gerade las, The Greater Journey – es war das von der Kritik hochgelobte Werk David McCulloughs über Amerikaner, die im neunzehnten Jahrhundert nach Paris gegangen waren. Sie waren wie sie, Menschen, die vom Wissen fasziniert waren. Für diese und für sie selbst war Lernen gleichbedeutend mit Leben.
Für sich hatte sie, da war sie absolut sicher, den richtigen Platz gefunden.
Als Kind hatte sich Selma manchmal ein gemaltes Porträt von sich vorgestellt und sich dabei als mausgraues, uninteressantes Wesen gesehen – Das Mädchen in der ersten Reihe mit der erhobenen Hand. Angefangen hatte sie als Hochbegabte, ein Kind, das bereits mit zwei Jahren lesen konnte, und das dann weitergelesen, gelernt, studiert und geforscht hatte, und jetzt war sie eine anerkannt hervorragende Rechercheurin.
Im großen Fenster, das auf den Ozean hinausging, entdeckte sie ihr Spiegelbild. Sie sah eine kleine – vielleicht auch gedrungene – Frau in den mittleren Jahren, wie sie sich ohne jede Eitelkeit eingestand, bekleidet mit einem Batik-T-Shirt und einer Khakihose. Eigentlich war es eine echte japanische Gärtnerhose und vor allem bei Japan-Fans modisch der letzte Schrei.
Schon seit längerer Zeit arbeitete sie für Sam und Remi Fargo. Sie hatten sie engagiert, kurz nachdem sie ihre Firma verkauft hatten, jedoch noch vor dem Bau dieses Hauses. Remi hatte erklärt: »Wir brauchen jemanden, der uns beim Recherchieren behilflich ist.«
»Was recherchieren Sie?«, fragte Selma.
»Wir suchen Antworten auf gewisse Fragen«, sagte Remi. »In allen Bereichen. Geschichte, Archäologie, Sprachen, Ozeanographie, Meteorologie, Computerwissenschaft, Biologie, Medizin, Physik, Spiele. Wir brauchen jemanden, der eine Frage hört und Möglichkeiten sucht und entwickelt, um sie zu beantworten.«
»Das kann ich«, hatte sie darauf erwidert. »Ich habe viele dieser Fächer studiert und selbst gelehrt. Während meiner Tätigkeit als Auskunftsbibliothekarin habe ich zahlreiche Quellen erschlossen und viele Experten für andere Bereiche kontaktiert. Ich nehme den Job.«
Sam sagte: »Aber Sie wissen noch gar nicht, wie viel Sie verdienen.«
»Sie auch nicht«, hatte sie erwidert. »Für drei Monate Probezeit bin ich mit dem Mindestlohn zufrieden, danach können Sie einen neuen Betrag nennen. Ich versichere Ihnen, er wird um einiges höher sein, als Sie jetzt annehmen. Sie können sich dann ein wesentlich besseres Bild machen als jetzt.«
Sie hatte zu keinem Zeitpunkt auch nur andeutungsweise den Entschluss bereut, für die Fargos zu arbeiten. Es war, als hätte sie niemals einen Job gesucht, sondern würde ausschließlich dafür bezahlt, Selma Wondrash zu sein. Sie hatte Sam und Remi sogar bei der Planung des Hauses geholfen. Sie hatte Architektur und Architekten, Baumaterial und nachhaltige Konstruktionsweisen recherchiert, und weil sie sich zuvor bereits gründlich über Sam und Remi informiert hatte, konnte sie Dinge berücksichtigen, für die sie eine Vorliebe hatten, und dafür sorgen, dass der dafür notwendige Raum vorhanden war. Außerdem hatte sie ihnen ausführlich erklärt, was für eine erstklassige Recherche-Abteilung nötig war.
Das Telefon klingelte, und sie entschied, Pete oder Wendy, einen ihrer beiden jungen Assistenten das Gespräch annehmen zu lassen. Diese Absicht hielt sie etwa eine halbe Sekunde lang durch, ehe sie, wie immer, ein Opfer ihrer eigenen ausgeprägten Wissbegierde wurde. »Hallo, Sie sind mit der Fargo-Residenz verbunden und sprechen mit Selma Wondrash.«
»Selma!«, erklang eine Stimme im Hörer. »Meine Liebe, wo sind denn Ihr Chef und seine bezaubernde Gattin?«
»Herr Doktor Fischer, ich grüße Sie. Sie tauchen zurzeit im Golf von Mexiko.«
»Ihr Deutsch wird von Tag zu Tag besser. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt und würde mich gerne mit Sam und Remi darüber unterhalten. Gibt es irgendeine Möglichkeit, sie jetzt direkt zu sprechen?«





























