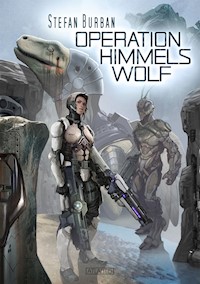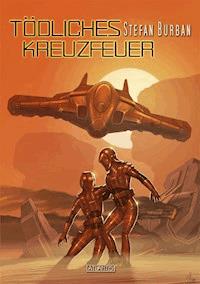8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das gefallene Imperium
- Sprache: Deutsch
Lieutenant General Finn Delgado, Oberbefehlshaber der Schattenlegionen, wird vermisst. Aufgebrochen zu einer Inspektionstour durch verschiedene Stützpunkte entlang der Randzone, bricht der Kontakt zum System ab, auf dem er zuletzt gemeldet wurde. In der Terranisch-Republikanischen Liga herrscht höchste Alarmstufe. Als schließlich unbekannte Schiffe über mehreren Welten auftauchen, die der Republik technologisch weit überlegen sind, ruft Präsident Mason Ackland die Generalmobilmachung aus. Hat der unbekannte Gegner etwas mit Delgados Verschwinden zu tun? Colonel Oliver Talbott, Kommandeur der 3. Schattenlegion, rückt mit Sturmkohorte Walkyre aus, das Verschwinden Delgados zu untersuchen. Ihr Auftrag: Den General lebendig zurückbringen oder seinen Tod bestätigen. Denn eines muss unter allen Umständen verhindert werden. Delgado sind sämtliche Einzelheiten der republikanischen Verteidigungspläne bekannt und er darf aus diesem Grund nicht lebendig in Feindeshand fallen. Noch während Sturmkohorte Walkyre aufbricht, reißt der Kontakt zu weiteren Welten ab. Die Republik ist noch damit beschäftigt, sich zum unvermeidlichen Kampf zu rüsten, als auch schon eine Katastrophe gleichermaßen über Menschen wie auch Drizil hereinbricht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Teil I. Unwillkommener Besuch
1
2
3
4
Teil II. Das Gesicht des Feindes
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Teil III. Auge in Auge
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Epilog
Weitere Atlantis-Titel
Stefan Burban
Feindkontakt
Prolog
Captain Scott Evans vom Angriffskreuzer Volcano gähnte herzhaft. Sein XO stand gelassen neben ihm und rührte genüsslich eine Prise Zucker in seinen Tee. Der Löffel verursachte in rhythmischen Abständen einen hohen Ton, wenn er gegen die Innenseite der Porzellantasse stieß.
Evans hatte seinen XO bereits mehrmals geraten, auf die Tassen der Offiziersmesse zurückzugreifen. Sie waren aus Plastik und während der hektischen Abläufe innerhalb eines Raumschiffes um einiges praktikabler. Sein Erster Offizier bestand jedoch darauf, sein Familienporzellan zu benutzen. Er wies beständig auf die Tatsache hin, dass es sich um ein Familienerbstück handelte und es für ihn Ehrensache sei, nur dies zu benutzen. Außerdem war er der felsenfesten Überzeugung, der Tee würde aus dieser Tasse wesentlich besser schmecken.
Evans ließ ihn gewähren. Jeder hatte so seine Marotten und sein XO bildete da keine Ausnahme. Die Vier-Planeten-Union befand sich am äußersten nördlichen Rand sowohl des von Menschen als auch von Drizil bewohnten Raumes. Es war eine beneidenswerte Position. Die Nachbarn der VPU waren allesamt friedlich und so drohte keine unmittelbare Gefahr. Die Nation, deren Raumstreitkräften er angehörte, besaß keine Feinde. In der heutigen Zeit musste man dafür durchaus dankbar sein.
Hinzu kam, dass sich die VPU sowohl aus einer menschlichen Population als auch aus zwei Drizilclans zusammensetzte, die sich hier nach Kriegsende angesiedelt hatten. Wenn jemand so dämlich gewesen wäre, die VPU anzugreifen, er hätte schon bald sein blaues Wunder erlebt.
Mit einem Mal gellten Alarmsirenen über die Brücke der Volcano. Evans schreckte augenblicklich hoch. »Bericht!«, forderte er.
Sein XO setzte die Tasse eilig auf einer Konsole ab, allerdings hing ihr Schwerpunkt noch in der Luft. Die Schwerkraft tat ein Übriges und plötzlich schepperte es und die Tasse zersprang auf dem Boden in tausend Scherben.
Weder der Captain noch sein Erster Offizier achtete sonderlich darauf. Evans schoss lediglich der Gedanke durch den Kopf, sein XO hätte doch besser die Plastiktassen der Messe benutzt.
Der Blick des XO zuckte in Richtung seines Kommandanten. Das Gesicht des Mannes war bleich wie der Tod. »Unidentifiziertes Schiff direkt über dem Planeten.«
Eine eisige Klaue griff nach Evans Herz und drückte so fest zu, dass er meinte, seine Brust müsse zerspringen. »Mitten im Schwerkraftfeld? Wo kommt dieses Mistding derart schnell her? Und warum haben die Patrouillen bei der Systemgrenze nicht reagiert. Schlafen denn da alle?«
»Die Patrouillenschiffe machen in diesem Moment kehrt und nehmen Kurs auf den Planeten. Die scheinen genauso überrascht wie wir.«
»Schicken Sie ihnen eine Nachricht. Ich will verdammt noch mal wissen, was da vor sich geht.«
»Aye, Sir«, bestätigte der XO.
»Was tut dieses Schiff?«
Der XO runzelte die Stirn. »Soweit ich das beurteilen kann … nichts.«
Evans drehte seinen Kommandosessel so, dass er seinen Ersten Offizier angestrengt mustern konnte. »Habe ich Sie gerade richtig verstanden?«
Der Mann nickte. Dicke Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. »Es driftet einfach nur im Raum, in der Nähe des Äquators knapp außerhalb des Orbits.«
»Können Sie es bereits identifizieren?«
Das Stirnrunzeln des XO vertiefte sich. Er sah abermals auf. Seine Mimik wirkte wie vom Donner gerührt. »Es gibt keine Entsprechung in der Kriegsdatenbank. Das Schiff ähnelt keiner bekannten Bauweise.«
Evans trommelte mit den Fingerspitzen einen unsteten Rhythmus auf die Lehnen seines Sessels. »Zeigen Sie es mir!«, beschied er schließlich.
Nahezu ohne Verzögerung baute sich vor Evans’ Nase das Hologramm eines unbekannten Schiffstyps auf. Der Kommandant der Volcano rückte neugierig näher. Er war gleichzeitig fasziniert und in höchstem Maße beunruhigt. Das Schiff war mit nichts vergleichbar, was er jemals zu Gesicht bekommen hatte. Es war von schlanker Stromlinienform, besaß aber unter und über der Zentralachse mehrere Ausbuchtungen, die dem Schiff ein irgendwie unförmiges Aussehen verliehen.
Was Evans besonders aufmerken ließ, war das Fehlen von Waffen. Zumindest ließ sich nichts erkennen, was auch nur entfernt an Waffen erinnerte, so wie Menschen – oder Drizil – dies definierten. Sehr merkwürdig. Auch das plötzliche Auftauchen des Schiffes mitten im Schwerkraftfeld ließ ein Gefühl der Bedrohung in seiner Magengrube wachsen.
Hierfür gab es nur zwei Möglichkeiten: Entweder das Schiff hatte sich an den Patrouillen entlang der Systemgrenzen vorbeigeschlichen oder es war einfach mitten im Schwerkraftfeld materialisiert. Ersteres ließ auf ein unverschämt hohes Selbstbewusstsein schließen, Letzteres auf ein technologisches Niveau, das dem der Menschheit oder der Drizil deutlich überlegen war. Doch warum war es hier? Bisher verhielt es sich in keiner Weise bedrohlich. Was es in Evans’ Augen aber erst recht gefährlich machte.
Dem Eindringling näherten sich im Moment mehr als vierzig Schiffe von unterschiedlichen Vektoren aus. Über die Hälfte davon menschlich, der Rest Drizil. Er war umzingelt und besaß keinerlei Fluchtmöglichkeit. Eine Schiffsbesatzung, die sich für unterlegen hielt, hätte sich spätestens jetzt zu erkennen gegeben, ihre friedlichen Absichten beteuert und sich vom Planeten entfernt, für den Fall, dass einem der Schiffskommandanten der Finger am Abzug juckte.
Diese Schiffsbesatzung allerdings tat rein gar nichts. Sie ignorierten die tödliche Bedrohung, die von allen Seiten zu ihr aufschloss, als würde sie das alles nichts angehen. Dies deutete auf ein hohes Maß an Dummheit hin oder Arroganz. Oder auf das unerschütterliche Selbstvertrauen, der hiesigen Militärmacht gewachsen zu sein. Mit Dummheit und Arroganz konnte Evans umgehen. Aber Selbstvertrauen war eine ganz andere Sache. Es konnte unbegründet sein – oder begründet. In letzterem Fall saßen sie gewaltig in der Tinte.
»Captain? Es tut sich was«, meldete sich sein XO zu Wort. »Das Schiff ändert seine Position.«
»Na endlich!«, hauchte Evans. »Sie haben ihre missliche Lage erkannt und entfernen sich vom Planeten.«
»Im Gegenteil«, korrigierte sein Erster Offizier. »Sie schwenken in den Orbit ein.«
»Anzeige auf mein taktisches Hologramm.«
Ein Bildausschnitt erschien. Das fremde Schiff umkreiste den Planeten nun in einem hohen Orbit. Mit einem Mal löste sich etwas von der Unterseite und raste mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf die Oberfläche zu.
»Was zum Teufel war das!«, herrschte Evans seinen XO an.
»Ist nicht zu bestimmen. Es war zu schnell und entzog sich jedem Versuch, es zu scannen. Aber es scheint keine Waffe gewesen zu sein. Auf der Oberfläche ist kein Einschlag zu verzeichnen. Es werden auch keine Zerstörungen gemeldet. Laut Sensoren ist es irgendwo nördlich der transkontinentalen Wüste niedergegangen.«
Ein Blitz flammte unvermittelt auf und verschlang das fremde Schiff in einem einzigen Augenblick. Es geschah so unwahrscheinlich schnell, dass Evans das Gefühl hatte, das Schiff wäre zwischen zwei Wimpernschlägen verschwunden.
»Was ist jetzt passiert? Wurde es zerstört?«
Der XO der Volcano studierte die einkommenden Sensordaten und schüttelte verständnislos den Kopf. »Keine Schiffstrümmer zu orten. Aber Energierückstände, die auf einen Sprung hindeuten.« Der XO sah auf. »Das Schiff ist einfach aus dem System gesprungen.«
Evans’ Gestalt versteifte sich. »Aus dem Schwerkraftfeld?« Er wandte sich erneut seinem XO zu. »Aus dem Orbit eines Planeten?« Er konnte nicht verhindern, dass seine Stimme mit jedem Wort lauter wurde.
Sein XO erwiderte nichts, doch seine Mimik sagte Evans schon alles, was er wissen musste. Der Captain des Angriffskreuzers räusperte sich. »Bericht an das militärische Oberkommando und die Regierung auf Ash-Achaum. Informieren Sie außerdem unsere Truppen auf der Oberfläche von Risena. Sie sollen sofort Einheiten zur Aufklärung entsenden. Wir müssen wissen, was das war.«
Der XO nickte und gab die Anweisungen sofort weiter. Evans atmete schwer, als er seinen Kommandosessel wieder in Richtung des zentralen Brückenfensters drehte. »Wir müssen unbedingt wissen, was das war«, wiederholte er so leise, dass ihn nur sein XO verstand. »Solange wir noch die Möglichkeit haben aufzuhalten, was immer auf die Oberfläche geschickt worden ist.« Evans erinnerte sich daran, wie das fremde Schiff aus dem Orbit von Risena einfach weggesprungen war, was nach allen bekannten Regeln der Raumfahrt und der Astrophysik eigentlich nicht möglich hätte sein dürfen. Und doch war er Zeuge von genau so einem Vorgang gewesen. Mit einem Mal fühlte er sich wie eine Ameise in der Gegenwart eines Kindes, das dabei war, seinen Fuß zu heben, um ihn zu zerquetschen. Ein eisiger Schauder lief ihm über den Rücken.
Der Planet Risena bestand zu sechzig Prozent aus Wüste, unterbrochen nur von mehreren Oasen, um die sich die Städte des Planeten gebildet hatten.
Risena war allerdings nicht so unfruchtbar, wie es auf den ersten Blick und aus dem Weltraum schien. In einer Tiefe von ungefähr anderthalb Kilometern war der Planet durchzogen von einem Netz unterirdischer Flüsse, in deren Fluten sich eine Algenart entwickelt hatte, die von Menschen als sehr nahrhaft empfunden wurde.
Zu ihrer Förderung und Weiterverarbeitung hatten sich Tausende kleiner Farmen und Gehöfte in den Wüsten des Planeten gebildet. Bei den meisten handelte es sich um Familienbetriebe, die sich den Härten der Wüste widersetzten und mit ihren Bohrmaschinen in die entsprechenden Tiefen vordrangen, um an das grüne Gold zu kommen, wie die Algen auf Risena auch genannt wurden.
Die Fördermenge war hoch genug, dass das grüne Gold nicht nur den Bedarf der hiesigen Bevölkerung deckte und in den Rest der Vier-Planeten-Union exportiert wurde. Auch in andere Sternennationen und sogar bis in die Republik wurden die Algen verkauft. Mittlerweile kamen sogar die Drizil – die eigentlich Lebendfutter bevorzugten – auf den Geschmack.
Bei einer der Farmen handelte es sich um die Sunrise-Ranch, die vom Familienclan der Kennedys geführt wurde. Sie bestand aus dem Familienoberhaupt Dalton Kennedy, seiner Frau Megan, seinen Söhnen Daniel, Carl und Michael sowie seiner schwangeren Schwiegertochter Rachel. Außer den Familienmitgliedern gab es noch an die dreißig Bedienstete und Saisonarbeiter auf dem Gut.
Rachel wischte sich den Schweiß von der Stirn und hob unter leichtem Ächzen den Eimer an. Ihr Mann Michael, dessen Brüder und ihr Schwiegervater hielten sich an der äußeren Begrenzung auf, wo sich das ergiebigste Bohrloch befand, um die Maschinen dort zu warten. In einem solchen Geschäft war Zeit Geld und diese wichtige und verantwortungsvolle Arbeit musste so schnell wie möglich vonstattengehen. Maschinen, die stillstanden, brachten keinen Ertrag.
Obwohl sie bereits im siebten Monat war, half Rachel gern bei der Arbeit. Sie stammte zwar aus der Stadt, liebte aber das Leben hier draußen. Es war einfach, genügsam, aber sehr erfüllend.
Sie benötigte knapp eine halbe Stunde, um das äußere Bohrloch zu Fuß zu erreichen. Die Bohrlöcher waren im Abstand von jeweils zwanzig Metern in einem Kreis um das Hauptanwesen angelegt worden. Damit entstand das Bild eines Wagenrads mit dem Hauptgebäude als Nabe. Der Kreis aus Bohrlöchern befand sich rund zweihundert Meter vom Wohnhaus entfernt.
Rachel ächzte, als sie die Arbeitsstätte ihres Mannes erreichte. Sie drückte ihm eine Kelle in die Hand und Michael schöpfte etwas Wasser aus dem Eimer. Er grinste seine Frau an und schüttelte die Kelle in ihre Richtung, um sie nass zu spritzen. Sie kicherte. Nacheinander bedienten sich auch Michaels Brüder und zu guter Letzt sein Vater an dem Trinkwasser.
»Du solltest nicht so hart arbeiten«, meinte Dalton Kennedy gutmütig. Er beschattete seine Augen mit der rechten Hand und sah gen Himmel. »Heute wird ein heißer Tag. Geh besser in den Schatten.«
Rachel rümpfte die Nase. »Ich bin schwanger, nicht krank.«
»Ich kannte schon Frauen, für die war das einerlei«, scherzte Dalton.
»Das sage ich Mum«, frotzelte Carl, wobei er sich eine gespielte Schelle von seinem Vater einfing.
»Ein Wort, und ich enterbe dich«, lachte Dalton. Der Patriarch wurde aber schnell wieder ernst, als er sich erneut Rachel zuwandte. »Ich meine es ernst, Kind. Geh zurück ins Haus. Das ist immerhin mein Enkel, den du unter dem Herzen trägst.«
»Zu Befehl, Majestät«, scherzte Rachel, drückte Michael noch zum diebischen Vergnügen seiner Brüder einen dicken Schmatzer auf den Mund und schlenderte gemütlich zurück zum Haupthaus.
Sie grinste den ganzen Weg über. Rachel hatte das Wohnhaus beinahe erreicht, als das Geräusch mehrerer Schüsse sie auf dem Absatz herumfahren ließ. Sie blinzelte gegen die Sonne, konnte jedoch nichts erkennen. Weitere Schüsse brandeten auf. Es schien ein regelrecht erbittertes Feuergefecht stattzufinden. Rachel konnte immer noch lediglich Schatten sehen, die in der Nähe des Bohrlochs miteinander rangen.
Brigantentum, Überfälle zwielichtigen Gesindels und Wegelagerei waren auf Risena nicht weit verbreitet, aber dennoch nicht undenkbar. Eines wurde Rachel unumstößlich klar: Sie wurden gerade angegriffen.
Die Arbeiter des Gehöfts bewaffneten sich und eilten auf den Ursprung all dieses Lärms zu. Rachel blieb wie angewurzelt stehen. Sie sorgte sich um alle, jedoch um ihren Mann Michael besonders.
Weitere Schüsse erfüllten die Luft. Die Farm war gut bewaffnet. Gegen die Angreifer schien sie sich trotzdem kaum halten zu können.
Mit einem Mal stand eine Gestalt neben ihr und packte sie grob am Handgelenk. Rachels erster Impuls bestand darin, ihren Angreifer ins Gesicht zu schlagen. Gerade noch rechtzeitig erkannte sie Michael. Sie schreckte zurück vor dem Anblick, den er bot. Seine Augen waren vor Schrecken weit aufgerissen. Doch das Schlimmste war, er war über und über mit Blut besudelt. Nicht alles war sein eigenes.
»Komm mit!«, herrschte er sie grob an und zerrte sie auf das Haus zu.
»Was ist denn los?«, schrie sie. »Michael? Was ist denn? Wo sind die anderen?«
»Ich muss dich in Sicherheit bringen, bevor sie hier sind!«, erwiderte er rätselhaft.
»Hier? Wer denn? Wer ist das? Vor wem hast du solche Angst?«
»Sie sind tot!«, entgegnete Michael. »Dad. Carl und Daniel. Sie sind tot. Sie haben sie umgebracht und ihre Leichen … sie haben mit ihren Leichen …«
Rachel stockte der Atem. »Was meinst du? Wer hat was gemacht? Bitte rede doch mit mir!«
»Keine Zeit.« Michael zerrte Rachel in den Keller des Haupthauses. Jede Farm auf Risena besaß in irgendeiner Form einen Panikraum. Nicht nur zum Schutz vor Räuberbanden und der einheimischen gefährlichen Tierwelt, sondern auch zum Schutz vor den hiesigen Sandstürmen, die ohne Weiteres auch ein stabil gebautes Haus hinwegfegen konnten.
Michael öffnete die Tür des in den Boden eingelassenen Panikraums. »Wo ist Mum?«, wollte er atemlos wissen.
»Deine Mutter?«
»Ja, verdammt!«, schrie er. »Wo ist sie?«
»Hinten im Garten, glaube ich«, erwiderte sie total verschreckt.
Michael fluchte. »Ich werde sie holen. Du bleibst aber auf jeden Fall hier in Sicherheit.« Bevor er seine Frau in den Panikraum hinabließ, packte er sie ein letztes Mal bei den Schultern und zwang sie, ihn anzusehen. »Hör mir zu! Du musst mir jetzt vertrauen. Dort unten ist genug Nahrung und Wasser, um bequem ein paar Wochen zu überleben. Außerdem gibt es ein Funkgerät. Du musst um Hilfe rufen. Die Frequenz des Militärs ist bereits eingestellt. Du musst nur den Knopf drücken und ins Mikro sprechen. Hast du verstanden?«
Rachel nickte wie betäubt. »Bitte! Bleib bei mir! Kommt mit!«
Michael schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht. Mum könnte immer noch leben. Ich muss sie suchen gehen. Es geht nicht anders.« Von außen waren immer noch vereinzelte Schüsse zu hören – und Schreie. Schreckliche Schreie.
In diesem Moment stieß jemand die Tür auf und Licht fiel in einem breiten Kegel in den Keller. Rachel und Michael sahen im selben Augenblick nach oben. Rachel vergaß für einen Moment sogar zu atmen. Vor ihr stand ein Wesen, dessen Anblick sie bis in ihre schlimmsten Albträume verfolgen würde. Mit einem Mal ging alles ganz schnell. Michael stieß seine Frau in die Öffnung, die zum Panikraum führte, und schlug die stählerne Luke hinter ihr zu.
Der Sturz schien nach ihrem Dafürhalten ewig zu dauern. Es konnte jedoch kaum eine Sekunde gewesen sein. Rachel fiel schwer auf den Rücken und rang nach Atem.
Die Angst um ihren Mann verschaffte ihr einen Kraftschub und sie stemmte sich in die Höhe. Sie aktivierte die Außenkameras des Panikraums sowie die Akustiksensoren. Sie wünschte, sie hätte es nicht getan.
Augenblicklich erfüllten Michaels Schreie den ganzen Raum und hallten von den mit mehreren Schichten Stahl verstärkten Wänden wider. Rachel hatte einen Logenplatz beim Tod ihres Geliebten. Sie wollte den Kopf abwenden, doch sie konnte es nicht. Die Kameras erfassten jede Einzelheit bei dem, was das Wesen Michael antat. Schließlich wollte sich die Kreatur Zugang zum Panikraum verschaffen. Als das nicht gelang, verlor es nach Kurzem das Interesse und machte sich auf der Suche nach leichterer Beute davon.
Für mehrere Stunden war Rachels Schluchzen das einzige Geräusch innerhalb des verschlossenen Raumes. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit erinnerte sie sich an Michaels letzte Worte. Sie fühlte sich unendlich matt und ausgelaugt. Sie brachte kaum die Kraft auf, die Hand zu heben und nach der Komanlage zu greifen. Nur die Angst um ihr ungeborenes Kind holte sie aus ihrer Katatonie.
Sie betätigte den Schalter, wie Michael es ihr erklärt hatte, und hob das Mikro dicht vor ihren Mund. »Hier ist die Sunrise-Ranch. Ich rufe jeden, der auf dieser Frequenz auf Empfang ist. Bitte … wir brauchen Hilfe. Wir wurden angegriffen. Bitte helft uns …« Sie schluchzte erneut. »Rettet uns!«
Sergeant Alexander Mallory von der 15. VPU-Legion bedeutete seinem Trupp vorzurücken. Vier Trupps gepanzerter Legionäre näherten sich der Sunrise-Ranch aus verschiedenen Richtungen. Mallorys Einheit übernahm dabei den Norden.
In etwa zwei Klicks Entfernung wartete der kleine Transporter, der die Legionäre hierhergebracht hatte. Ein weiterer Trupp sicherte die Landezone und hielt Ausschau nach unliebsamen Überraschungen, die ihnen so richtig den Tag versauen konnten.
In Mallorys Ohren knackte es. »Sarge? Das sollten Sie sich mal ansehen.«
Mallory bestätigte den Funkspruch wortlos durch einen zweimaligen Funkimpuls, den er über die Komanlage übertrug. Er hatte schon eine Ahnung, was ihn erwarten würde. Sie hatten noch immer keine Vorstellung davon, was den Farmen in der Wüste zugestoßen war. Innerhalb von weniger als vierundzwanzig Stunden waren mehr als tausend Notrufe eingegangen. Das Militär auf Risena hatte augenblicklich reagiert, war aber auf Notfälle dieser Größenordnung nicht vorbereitet gewesen. Es waren Hunderte von Feuertrupps in die Wüste entsandt worden, um die Notrufe unter die Lupe zu nehmen. Jeweils vier Feuertrupps bildeten eine Rettungseinheit.
Die Einheiten hatten das Einzige getan, was ihnen möglich gewesen war. Sie hatten die Notrufe nach der Reihenfolge ihres Eingangs abgearbeitet. Aus diesem Grund stand für Mallorys Trupp und die Einheiten, die ihn begleiteten, die Sunrise-Ranch der Kennedys erst nach vier Tagen auf dem Plan. Mallory war überzeugt, sie würden hier dasselbe vorfinden wie auf den anderen Farmen. Keine der ausgesandten Rettungskommandos hatte bisher Überlebende gemeldet. Alle Bewohner, eigentlich sogar jedes lebende Wesen – sogar die Haustiere und das Nutzvieh –, waren verschwunden.
Als Mallory das Bohrloch erreichte, wurde er von den Mitgliedern seines Trupps bereits erwartet. Alle wandten betreten den Blick ab. Der Sergeant seufzte. Die Maschine stand still. Das war keine große Überraschung.
Einer seiner Legionäre kniete am Boden und untersuchte etwas, das Mallory im ersten Augenblick für Dreck hielt. Bei näherer Betrachtung handelte es sich jedoch um getrocknetes Blut. Und noch etwas anderes.
Mallory kniete sich neben den Mann. »Heinz?«, sprach er den Mann an.
Dieser schüttelte aufgrund der unausgesprochenen Frage lediglich den Kopf. »So etwas habe ich noch nie gesehen. Wieder mal keine Leichen, nur Blut. Wie auch bei den anderen Farmen.« Er hob die Hand, während er Daumen und Zeigefinger aneinander rieb. »Und dann wieder das hier.« Zwischen seinen Fingern befand sich etwas wie eine seltsame grüne Schmiere, die sich nur schwer verreiben ließ und die am Panzerhandschuh klebte.
»Nimm ein paar Proben mit. Darüber sollen sich Leute den Kopf zerbrechen, die ein höheres Gehalt beziehen.«
Der Legionär nickte, holte eine kleine Phiole hervor und strich etwas von der Schmiere hinein. »Hey, seht euch das mal an!«
Mallory sah auf. Einer seiner Männer, den Abzeichen an der Rüstung nach zu urteilen Vladimir Sakalow, hob etwas in die Höhe. Mallory kniff die Augen zusammen. Das Ding, das Vladimir gefunden hatte, ähnelte auf frappierende Weise einem membranartigen Insektenflügel. Wenn man einmal davon absah, dass dieses Fundstück ungefähr zwei Meter lang war. Mallory biss sich auf die Lippen.
»Ebenfalls mitnehmen.« Der Sergeant aktivierte eine Verbindung zu den anderen drei Feuertrupps. »Meldung?«, forderte er.
Nacheinander bestätigten die drei Truppführer den Status ihrer Einheiten. Im Westen, Süden und Osten war also alles klar. Keine Feinde in Sicht. Das beunruhigte Mallory weit mehr, als es eine Front feindlicher Soldaten getan hätte. Er vertraute seinem Bauchgefühl und dieses sagte ihm, dass sie alle in verdammt großen Schwierigkeiten steckten.
»Zum Gebäude vorrücken!«, befahl er.
Seine vier Truppmitglieder schwärmten fächerförmig aus, mit ihm selbst als Anker und Zentrum der Formation. Sie marschierten zügig auf das Haupthaus zu. Die Spuren eines furchtbaren Kampfes waren allgegenwärtig: Leere Magazine, liegen gelassene Nadelgewehre und überall Blut. Jedoch fehlten auch hier die Leichen. Wer auch immer für den Angriff verantwortlich war, hatte sowohl die eigenen wie auch die gegnerischen mitgenommen. Warum auch immer.
Heinz und Vladimir sicherten die Tür, während die zwei anderen Legionäre unter Mallorys Führung hineinstürmten. Der Sergeant hielt unwillkürlich inne. Die Einrichtung des Gebäudes war komplett zertrümmert worden. Es wirkte beinahe wie der Tobsuchtsanfall eines Kindes. Der Legionär schluckte schwer. Mit knappen Bewegungen wies er seine Leute an, das Gebäude zu durchsuchen.
Er selbst und die Legionärin Martha Valeska übernahmen den Keller. Martha versuchte, das Licht einzuschalten. Es funktionierte nicht. Die Energieversorgung war vermutlich schon seit Tagen offline. Die beiden Legionäre aktivierten die Restlichtverstärkung ihrer Anzüge. Alles erschien nun in skurrilem grünen Licht. Mallory trat auf den ersten Treppenabsatz. Die hölzernen Stufen knirschten unter seinem Gewicht. Trotz des Unwohlseins, das sich in seinem Magen breitmachte, zwang er sich zu einem weiteren Schritt. Er hatte das Gefühl, eine Gruft zu betreten.
Ganz unten angekommen, ließ er den Blick schweifen. Martha wartete wachsam zwei Stufen oberhalb seiner Position. Ihr Nadelgewehr schwenkte auf der Suche nach einer potenziellen Gefahr von einer Seite zur anderen.
Mallory brauchte nicht lange, um den Zugang zum Panikraum zu finden. Ein großer getrockneter Blutfleck markierte den Standort. Er zwang sich, diesen zu ignorieren. Jemand war hier gestorben. Diese Menge Blut verlor man nicht mal so einfach und überlebte anschließend.
Mallory widerstand dem Drang anzuklopfen. Der Stahl war so dick, dass man ihn im Inneren wohl kaum hören konnte. Diese Dinger waren meistens schalldicht. Sie verfügten aber über hoch entwickelte Überwachungsanlagen. Wer auch immer dort drin weilte, müsste eigentlich bereits von der Anwesenheit der Legionäre wissen. Es sei denn, die betreffende Person wäre längst tot.
Mallory winkte Martha zu sich. Die Legionärin gesellte sich umgehend zu ihm. Er brauchte gar nicht zu erwähnen, was er von ihr wollte. Ein Blick auf die Luke genügte vollauf. Die Legionärin zögerte einen Augenblick.
»Fünfzehn Minuten«, beschied sie schließlich, ließ sich auf ein Knie nieder und packte eine Plasmafackel aus. Sie begann wortlos mit der Arbeit. Mallory wartete ungeduldig, zur Untätigkeit verdammt. Nach und nach stießen die drei anderen Legionäre seines Trupps zu ihnen. Sie alle schüttelten lediglich wortlos den Kopf.
Mallory nickte. Also gab es keine verwertbaren Spuren außer denen, die sie bereits gefunden hatten. Und es gab keine Überlebenden. Wie auf den anderen Farmen auch. Sein Blick richtete sich auf die Luke. Zumindest gab es dort oben keine Überlebenden.
Entgegen ihrer Aussage benötigte Martha insgesamt fast eine halbe Stunde, um die Luke aufzuschneiden. Das Ding war verdammt hartnäckig. Aber dafür war es im Endeffekt ja auch konstruiert worden.
Martha und Heinz zogen die Luke beiseite und Mallory sah nach unten. Es herrschte absolute Stille und totale Schwärze. Selbst mit der Restlichtverstärkung seiner Rüstung war nichts zu erkennen. Der Vergleich mit einer Gruft kam ihm abermals in den Sinn. Er erwartete nicht, noch Überlebende vorzufinden. Auch für den Panikraum war die Energie ausgefallen. Das bedeutete, die Lebenserhaltung und somit der Sauerstoffausgleich funktionierten nicht länger. Trotzdem musste der Raum gründlich überprüft werden.
Mallorys massiger Körper quetschte sich mitsamt Rüstung durch die Luke und ließ sich in die Tiefe fallen. Die Entfernung zum Boden betrug lediglich zwei Meter. Mallory wich an die Wand zurück, so weit dies möglich war. Beinahe wäre er auf den Körper einer schwangeren Frau getreten.
Er kniete sich neben sie. Nach allen gängigen Regeln hätte sie tot sein müssen. Und dennoch lebte sie. Seine Rüstung registrierte schwachen, aber beständigen Puls. Die Frau trug eine Maske über ihrem Gesicht, das mit einer Sauerstoffflasche verbunden war. Die Leute hier hatten an alles gedacht. Diese Flasche gehörte wohl zur Notfallausrüstung des Panikraums. Mit ihrer Hilfe hatte sie etwas länger durchgehalten.
Mallory runzelte die Stirn. Die Angreifer waren längst weg. Die Frau musste das zumindest geahnt haben. Doch sie hatte solche Angst gehabt, dass sie lieber das Risiko eingegangen war, hier unten den Erstickungstod zu erleiden.
Mallory bemühte sich, sie aufzuwecken. Es gelang ihm nicht. Die Anzeige der Sauerstoffflasche befand sich bereits im roten Bereich. Die Frau hatte Glück, dass die Legionäre gekommen waren. Sie hätte im Höchstfall noch für eine Stunde Luft zum Atmen gehabt.
Der Sergeant öffnete eine Funkverbindung. »Heinz? Ruf sofort den Transporter her. Wir brauchen hier dringend seine medizinische Notfallstation.« Mallory zögerte kurz, bevor er sich in dem Raum umsah. »Und Heinz?«, fügte er hinzu. »Gib eine Nachricht an das Oberkommando in Totos raus. Sag ihnen, wir haben Daten über den letzten Angriff sicherstellen können.« Sein Blick fiel auf die bewusstlose Frau zu seinen Füßen. »Und eine Überlebende.«
Brigadegeneral Henry Diaz von der 3. VPU-Legion führte seine aus fünftausendfünfhundert Mann bestehende Truppe in die Außenbezirke der Hauptstadt. Er hatte keine Ahnung, was genau los war. Um über derlei Dinge informiert zu werden, stand er nicht hoch genug in der militärischen Hackordnung.
Alles, was er wusste, hatte er aus der Gerüchteküche. Es hieß, sämtliche Farmen in der Wüste seien ausgelöscht worden, die Menschen verschwunden. Und all das innerhalb weniger Tage. Anschließend sei anscheinend der Kontakt zur Stadt Hinar abgebrochen, die ungefähr sechshundert Kilometer nordwestlich lag. Der Abbruch der Kommunikation konnte viele Gründe haben, vor allem auf einer Welt, die so von verheerenden Sandstürmen gepeinigt wurde wie Risena. Selbst Satelliten konnten die dadurch auftretenden Interferenzen oftmals nicht durchdringen.
Aber mit einem Mal waren alle ganz aufgeregt gewesen. Die militärischen Kommunikationskanäle quollen über vor Nachrichtenverkehr. Das meiste von so hoher Priorität, dass Diaz’ Berechtigung nicht ausreichte, die Nachrichten zu decodieren. Alles, was er hören konnte, war Kauderwelsch. Nur hin und wieder fing er eine Nachricht auf, die klar und deutlich über den Äther lief. Und sie zeichneten ein grausiges Bild.
Man sprach davon, dass die Menschen in den Farmen von einer unbekannten Macht abgeschlachtet worden waren. Man sprach vom Totalverlust der Stadt Hinar mit ihren 4,2 Millionen Einwohnern, und all das in erschreckend kurzer Zeit. Die Hauptwelt der VPU war sogar informiert und um Hilfe gebeten worden.
In Hinar waren fast hunderttausend Soldaten der Vier-Planeten-Union stationiert gewesen. Welche Macht hatte die Stadt angegriffen, ohne dass dieses Aufgebot sie hatte schützen können?
Mehrere planetare Bodenkampfflugzeuge der Drizil begaben sich über der Stellung seiner Soldaten in Position. Man sprach davon, dass die Drizil die Menschen umgebracht hätten. Verschwörungstheorien machten die Runde, nach denen die Fledermausköpfe nur auf den richtigen Augenblick gewartet hatten, um gegen die Menschen zuzuschlagen.
Wenn man Diaz fragte, dann war das alles ausgemachter Blödsinn. Seit über dreißig Jahren lebten, arbeiteten und kämpften die Drizil an der Seite ihrer menschlichen Nachbarn, und das ohne irgendeine Spur von Aggression. Diaz schüttelte den Kopf. Nein, hier ging etwas anderes vor. Etwas Dunkles. Etwas überaus Bedrohliches, das niemand – weder Mensch noch Drizil – so richtig verstand.
Sein Adjutant, Major Christian Schneider, begab sich an seine Seite. Ihm fiel auf, dass der Offizier die Bodenkampfflugzeuge der Drizil und die aus der Stadt marschierenden Panzerschleicher misstrauisch musterte.
Diaz öffnete seinen Helm und warf seinem Adjutanten einen verschmitzten Blick zu. »Sie hören doch wohl nicht auf die Gerüchteküche, Christian?!«
Der Mann räusperte sich verhalten. »Sie müssen zugeben, dass hier einiges nicht mit rechten Dingen zugeht.«
»Da rennen Sie bei mir offene Türen ab, aber trotzdem sollten wir keine voreiligen Schlüsse ziehen. Die Drizil haben bei einem Wiederaufflammen des Krieges genauso viel zu verlieren wie wir. Ich glaube nicht, dass die was mit diesen Vorkommnissen zu tun haben.«
Schneider schüttelte leichte den Kopf. »Ich weiß nicht so recht, General.«
»Vertrauen Sie mir, Christian. Was immer hier auch vor sich geht, die Drizil sind genauso überrascht und besorgt wie wir auch.«
»Wenn Sie das sagen?!«, meinte der Offizier wenig überzeugt.
Unvermittelt zeigte einer der Legionäre, der gerade dabei war, eine schwere Waffenstation aufzubauen, auf den Horizont. Schneider und Diaz verschlossen nahezu gleichzeitig ihren Helm und folgten mit ihren Augen dem Wink des Mannes.
Am Horizont, so weit man sehen konnte, zogen dunkle Wolken auf. »Haben Sie schon einmal so eine Gewitterfront gesehen?«, meinte Schneider plötzlich.
Diaz runzelte die Stirn und veranlasste die Optik seines HUD, einen Ausschnitt seines Blickwinkels zu isolieren und zu vergrößern. Der Bordcomputer der Rüstung gehorchte augenblicklich. Diaz’ Gehirn benötigte einen Moment, um zu begreifen, was seine Augen dort sahen. Der General schluckte schwer. »Das ist kein Gewittersturm«, erwiderte er mit trockener Kehle.
Teil I. Unwillkommener Besuch
1
Präsident Mason Ackland, gewähltes Staatsoberhaupt der Terranisch-Republikanischen Liga, eilte durch die verwinkelten Korridore des militärischen Zentralkommandos auf der republikanischen Hauptwelt Perseus.
Ihm begegnete eine Vielzahl an Offizieren und Würdenträgern. Deren Ehrbezeugungen und Grüße ignorierte er jedoch. Es war keine Unhöflichkeit, die ihn antrieb. Vielmehr hatte er den Kopf so voller Probleme, dass er schlichtweg nicht auf die Menschen achtete, deren Weg er kreuzte.
Mason trug nicht viel bei sich, lediglich einen Datenträger, der sich in der Innentasche seines Maßanzugs verbarg. Die Gedanken des Präsidenten der Republikanischen Liga rasten. Selten zuvor hatte er das Gefühl gehabt, die Ereignisse entglitten seinen kundigen Händen. Heute war ein solcher Tag. Er räusperte sich und versuchte damit den Kloß loszuwerden, der sich in seiner Kehle zu bilden drohte. Er hätte nicht gedacht, noch Zeuge zu werden, wie die alte Welt Gefahr lief, in Flammen aufzugehen. Tief in seinem Herzen hatte er gehofft, zu diesem Zeitpunkt bereits seit Langem tot und vergessen zu sein. Wie es schien, wurde ihm diese Gnade nicht zuteil.
Mason erreichte endlich den angestrebten Raum. Die beiden Legionäre der 18. Legion in voller Montur standen bei seinem Näherkommen stramm und präsentierten die Nadelgewehre, indem sie diese quer vor der Brust hielten. Mason nickte ihnen kurz zu und öffnete die Tür. Sie führte in einen großen Besprechungsraum mit einem der modernsten Holotanks, den man für Geld kaufen konnte. Der Raum war für militärische Planungen gedacht und bot ausreichend Platz für mehrere Hundert Offiziere und deren Adjutanten. Heute jedoch warteten lediglich zwei Personen auf ihn.
Die beiden Männer standen in der Nähe des großen Holotanks und unterhielten sich gedämpft. Bei seinem Erscheinen verfielen sie allerdings in neugieriges Schweigen.
Der Raum war angelegt wie ein Amphitheater, mit dem Holotank auf dem, was in einem Theater die Bühne gewesen wäre. Mason zügelte die eigene Ungeduld und schlenderte die Treppe zum Holotank betont gelassen hinab. Die zwei Offiziere sollten von seinem eigentlichen Gemütszustand nichts mitbekommen.
Mason erreichte die Tribüne und maß seine zwei Gegenüber mit neutraler Miene, erst dann nickte er ihnen angemessen zu. »Gentlemen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich Sie so kurzfristig zu mir gebeten habe. Umso dankbarer bin ich, dass Sie meiner Bitte umgehend nachgekommen sind.«
Der Mann zu seiner Linken trug die Ausgehuniform der Schattenlegion. Das Abzeichen am Revers wies ihn als Colonel und Kommandant der 3. aus. Die 3. Schattenlegion war erst ganz neu aufgestellt und wartete noch darauf, sich ihre Sporen verdienen zu dürfen. Sie waren hungrig. Deshalb hatte Mason diese Einheit ausgewählt. Die fünfzehntausend Mann einer Schattenlegion waren eine überragende Streitmacht. In den Besprechungen im engsten Kreis, die dieser Zusammenkunft vorausgegangen waren, hatte es Stimmen gegeben, die Bedenken geäußert hatten. Einige waren der Meinung gewesen, man sollte eine erfahrenere Einheit schicken. Mason hatte sie verworfen. Die 3. Schattenlegion war die richtige Truppe für diese Aufgabe. Im Übrigen waren die beiden anderen mit anderen Missionen beschäftigt und derzeit nicht verfügbar. Daher erübrigte sich ohnehin jede Diskussion in diese Richtung.
Der Name des Mannes war Colonel Oliver Talbot. Er hatte zunächst viele Jahre bei der 8. Legion des 3. Korps gedient. Der Mann hatte sich über fünf Jahre lang als Befehlshaber für die 3. Schattenlegion beworben, bevor man seinem Ersuchen schließlich stattgab. Mason persönlich hatte dafür gesorgt. Er war der Meinung, Talbot war der beste Kandidat für diesen Posten. Er verinnerlichte genau die richtige Mischung aus Logik und Instinkt. Viele Offiziere waren nicht in der Lage, dies zu kombinieren. Sie kannten nur entweder oder. Nicht so Talbot. Es war gerade diese Art, die ihm hoffentlich helfen würde, seine Leute in einem Stück wieder nach Hause zu bringen.
Mason wandte sich dem Mann zu seiner Rechten zu. Dieser trug die Uniform der Flotte. Captain Alvaro Gutierrez. Ein Mann des Weltraums durch und durch. Mason musste zugeben, dass Gutierrez nicht seine erste Wahl war, aber Carlo Rix hatte ihm nahegelegt, sich über persönliche Antipathien hinwegzusetzen.
Gutierrez war ein Mann der Zuerst-schießen-dann-Fragen-stellen-Generation. Er hatte sogar schon im Drizilkrieg gekämpft. Und das war über dreißig Jahre her. Normalerweise hätte er längst Admiral sein müssen. Das Problem war, der Mann hatte etwas gegen Befehle. Wenn er der Meinung war, Befehle seien Quatsch, dann ignorierte er sie schlichtweg und ging seinen eigenen Weg. Um genau zu sein, war er bereits mehrmals Commodore gewesen, war aber immer wieder wegen Befehlsverweigerung degradiert worden.
Dummerweise hatte er mit seiner Vorgehensweise meistens Erfolg, was es schwer machte, ihn gänzlich loszuwerden, sei es durch eine langjährige Gefängnisstrafe oder unehrenhafte Entlassung. Mason mochte den Mann nicht. Daraus machte er keinen Hehl. Als Staatsoberhaupt der Liga schätzte er Offiziere, die in der Lage waren, sich der Befehlshierarchie unterzuordnen.
Carlo Rix und verblüffenderweise auch Corben Baker, der Oberbefehlshaber der republikanischen Raumstreitkräfte, hatten sich für den Mann ausgesprochen.
Gutierrez war ein Eigenbrötler, ein Dickkopf und – man mochte es drehen und wenden, wie man wollte – ein Befehlsverweigerer. Aber – und das konnte man ebenfalls nicht leugnen – er gewann seine Schlachten. Gutierrez war ein unkonventioneller Denker. Und was vielleicht am wichtigsten war: Der Mann besaß ein unverschämt hohes Maß an Glück. Gerade das mochte ihm vielleicht helfen, die bevorstehende Mission nicht nur zu überleben, sondern vielleicht sogar zu einem Erfolg zu führen.
Mason war so in seine Gedanken über die beiden Männer versunken, dass er erst nach einigen Augenblicken bemerkte, dass er ihnen schweigend gegenüberstand. Die beiden Offiziere warteten darauf, dass er mit der Einsatzeinweisung begann. Der Präsident räusperte sich, nahm den Datenträger aus der Tasche und trat an den Holotank. Er steckte das kleine Speichergerät in die dafür vorgesehene Vertiefung und nahm einige wenige Einstellungen vor. Der Holotank erwachte schlagartig zum Leben und projizierte das Bild eines Planeten in die Luft. Im Orbit des Himmelskörpers schwebte ein unbekanntes Schiff. Vor allem Gutierrez war von der ersten Sekunde an fasziniert. Doch auch Talbot kniff leicht die Augen zusammen, während er Planet und Schiff einer eingehenden Untersuchung unterzog.
»Was sehen wir uns da an?«, wollte Gutierrez schließlich mit tiefer, voller Stimme wissen.
Mason räusperte sich erneut. Es gab keine einfache Art zu berichten, was geschehen war. Aus diesem Grund entschied er sich für den direkten Weg.
»Das, meine Herren«, er deutete auf das Hologramm, »ist Risena, eines der Systeme der Vier-Planeten-Union. Anfang Februar erschien dieses Schiff wie aus dem Nichts über der Welt und hat etwas abgeworfen. Es geschah so schnell, dass die Verteidigungskräfte nicht reagieren konnten.«
»Einen Augenblick«, unterbrach Gutierrez sofort. »Was heißt, es erschien wie aus dem Nichts über Risena?«
»Es heißt genau das, was ich gesagt habe«, erwiderte Mason. »Das Schiff erschien mit einem Lichtblitz über dieser Welt.«
Der Flottenoffizier zog beide Augenbrauen hoch. »Einfach so? Im Schwerkraftfeld?«
Mason nickte wortlos. Gutierrez stieß einen leisen Pfiff zwischen den Vorderzähnen aus. »Das ist unserem Stand der Technik weit voraus. Um genau zu sein, widerspricht es sogar unserem Verständnis der Astrophysik.«
»Sie sagten, es warf etwas über dem Planeten ab«, mischte sich Talbot ein. »Was genau?«
»Das weiß keiner«, erwiderte der Präsident wahrheitsgemäß. »Die Vier-Planeten-Union entsandte Truppen in die entsprechende Region, konnte aber nichts finden. Und dann fing es an.«
Beide Offiziere wechselten verständnislose Blicke. »Was fing an?«, fragte Talbot.
Mason seufzte. »Menschen verschwanden. Es gab Hilferufe, die plötzlich verstummten, und zu guter Letzt wurde die Kommunikation von und nach Risena komplett gestört. Und wie ich vor Kurzem erfahren habe, geschah genau dasselbe auf Kelardtor, dem nächstgelegenen Planeten zu Risena. Er gehört ebenfalls zur VPU.« Mason maß beide Offiziere mit festem Blick. »Von dem Moment, in dem abgeworfen wurde, was auch immer die auf den Planeten losgelassen haben, bis zu dem Moment, in dem der Kontakt zu Risena und Kelardtor abbrach, verging gerade mal eine Woche.«
Die beiden Offiziere keuchten unisono auf. »Das ist eine erschreckend kurze Zeitspanne«, meinte Talbot.
»Die VPU schickte Truppen auf den Planeten. Doch sobald sie die Atmosphäre erreichten, verschwanden auch sie. Spurlos. Sie hatten nicht einmal die Zeit, einen Notruf abzusetzen.«
»Wie wurde mit diesem Schiff verfahren?«, fragte Gutierrez und musterte das Hologramm erneut.
»Die militärischen Möglichkeiten der VPU sind beschränkt und darüber hinaus verfügen sie nur über Mittel aus dem Drizilkrieg, wie alle kleineren Nationen. Aber sie haben das Schiff angegriffen und dabei elf Schiffe verloren, ohne den Eindringling nennenswert in die Defensive zu drängen. Der Angriff auf ein ähnliches Schiff bei Kelardtor verlief ebenso erschreckend katastrophal.«
»In der VPU leben auch Drizil. Die sind weit besser ausgerüstet und aufgestellt als die menschliche Population. Was ist mit denen?«
Mason zögerte kurz, bevor er antwortete. »Die Drizil weigerten sich, nach Risena oder Kelardtor zu fliegen. Aus denen ist nicht viel rauszubekommen. Sie sagen nur immer wieder: ›Sie sind hier! Sie sind hier!‹ Die Drizil sind schon fast der Panik nahe, was uns alle ziemlich nervös macht.«
Talbot hatte sich das alles eine Weile lang schweigend angehört, doch nun mischte er sich wieder ein. »Hat es auf die Landung von Bodentruppen reagiert?«
Mason schüttelte den Kopf. »So wie wir das sehen, verteidigt es sich lediglich gegen Angriffe, aber es hat keinen Truppentransporter an der Landung gehindert.«
Talbot schnaubte. »Als wären wir keine Bedrohung.«
Gutierrez sah mit über der Nasenwurzel zusammengezogenen Augenbrauen auf. Sie wirkten wie eine Gewitterwolke, die sich drohend aufbaute. »Soll das heißen, die VPU hat fünfzig Prozent ihres Territoriums verloren? Innerhalb einer Woche und ohne Chance auf effektive Gegenwehr?«
»Genau so sieht es im Moment aus. Die VPU hat uns um Hilfe gebeten und sie wurde gewährt. Wir schicken Sie beide nach Risena.«
»Mit welchen Missionsparametern?«, fragte Talbot. Der Mann machte nicht den Eindruck, er habe Angst vor dem Ungewissen, das sie erwartete. Er wirkte vielmehr freudig erregt. Mason war sich nicht sicher, ob das die richtige Art war, mit dieser Bedrohung umzugehen.
»Informationen sammeln. Kampfhandlungen nach Möglichkeit vermeiden. Wir müssen erst einmal wissen, mit wem wir es zu tun haben und über welche Fähigkeiten sie verfügen.«
»Wie viele Einheiten schicken Sie?«
Mason zog leicht die Mundwinkel hoch. »Ein Schiff – und die komplette 3. Schattenlegion.«
Beide Offiziere merkten auf. Es war schließlich Talbot, der auf die neue Information einging. »Das wären über fünfzehntausend Mann. Das ist ein bisschen viel, um unauffällig zu bleiben und Informationen zu sammeln. Ich würde eine oder zwei Zenturien vorschlagen.«
Mason schüttelte den Kopf. »Das wurde ausgiebig diskutiert. Wir schicken eine ganze Schattenlegion. Es geht nicht nur darum, Informationen zu sammeln, wir müssen auch ein Zeichen senden. Sowohl an den Feind als auch an unsere Verbündeten.«
»Trotzdem erschwert eine hohe Anzahl die Mission. Wir müssen uns mit einer umfassenden Streitmacht über den Planeten bewegen. Sie können nicht erwarten, dass wir da unentdeckt bleiben. Von der Vermeidung von Kampfhandlungen ganz zu schweigen.«
Mason räusperte sich erneut. »Sie werden die zusätzliche Feuerkraft brauchen. Glauben Sie mir. Es gibt noch einen Aspekt dieser Mission, den ich bisher unerwähnt ließ.«
Talbot runzelte die Stirn. »Und der wäre?«
»Bergung«, erwiderte Mason knapp.
Talbot streckte seine muskulöse Gestalt. »Was sollen wir bergen?«
Mason schüttelte den Kopf. »Nicht was, sondern wen. Es befindet sich ein VIP der Republikanischen Liga auf Risena. Nach dem Dentano-Zwischenfall vor fünf Jahren erlaubten uns mehrere Sternennationen in der Nähe der Randzone, Überwachungsstationen auf einigen ihrer Welten einzurichten. Diese sind mit Analysten und Legionären der Schattenlegion besetzt und es ist ihre einzige Aufgabe, die Randzone nach Anzeichen der Ankunft feindlicher Kräfte im Auge zu behalten.«
»Und wer könnte so wichtig sein, um die Entsendung einer kompletten Schattenlegion zu rechtfertigen?«
»Lieutenant General Finn Delgado«, erwiderte Mason ungerührt.
Talbot versteifte sich von einer Sekunde zur nächsten. »Wie bitte? Ich hab mich wohl verhört!«
»Leider nein.« Mason schüttelte den Kopf. »Delgado befand sich auf einer Rundreise, um allen Überwachungsstationen einen Besuch abzustatten. Als Risena angegriffen wurde, befand er sich dummerweise gerade dort.«
»Dafür hat ein General doch seine Leute«, wetterte Talbot. »So was delegiert man.«
Mason schnaubte. »Sie kennen doch Delgado. Der gibt Aufgaben nicht aus der Hand.«
»Verdammter Mist!«, fluchte Talbot.
»Jetzt wissen Sie auch, warum die Mission nach Risena derart wichtig ist. Delgado kennt alle unsere Stärken sowie unsere Schwächen. Als Mitglied der obersten Kommandokette ist er auch bestens darüber informiert, wie unsere Verbündeten – einschließlich der Drizil – militärisch aufgestellt sind. Ich muss wohl nicht extra betonen, was die Folge wäre, wenn der Mann dem Feind in die Hände fällt. Man muss es denen ja nicht noch einfacher machen, als es jetzt schon ist.«
Talbot leckte sich über die Lippen. »Ich weiß, diese Frage macht mich jetzt sehr unbeliebt, aber woher wissen wir, dass er noch lebt? Nach unserem Wissensstand könnten die Populationen von Kelardtor und Risena längst ausgelöscht sein.«
Mason vergrößerte den Planeten, bis eine einzelne Stadt den ganzen Sichtbereich ausfüllte. »Die Überwachungsstation befindet sich in einer streng gesicherten und gepanzerten Anlage fünf Stockwerke unter der planetaren Hauptstadt. Sie ist völlig autark und in der Lage, mehrere Monate problemlos durchzuhalten. Falls er sich zum Zeitpunkt des Angriffs dort aufhielt oder es dorthin geschafft hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er noch lebt.«
Talbot überlegte angestrengt. Schließlich sah er auf. »Trotzdem würde ich eine Modifikation des ursprünglichen Planes vorschlagen.«
»Und der wäre?«
»Wir landen lediglich mit einer Kohorte, die ich persönlich auswähle.« Talbot nahm einige Einstellungen am Hologramm vor und der nächste Bildausschnitt zeigte das ganze System. »Der Rest der 3. geht hinter dem zweiten Mond des siebten Planeten des Systems in Wartestellung. Dort verbleiben sie und warten auf Abruf. Falls wir sie tatsächlich benötigen, wären sie innerhalb von einer, maximal zwei Stunden vor Ort. Diese Lösung wäre mir tausendmal lieber, als mit fünfzehntausend Mann auf einem vermutlich feindlichen Planeten zu landen. Eine volle Kohorte ist eigentlich schon zu viel, aber auf jeden Fall machbarer, als mit der ganzen 3. Schattenlegion zu landen. Außerdem bewegen wir uns wesentlich leichter und unauffälliger durchs Gelände.« Talbot sah erwartungsvoll auf.
Mason rieb sich nachdenklich über das Kinn und seufzte schließlich. »Na schön. Ich beuge mich Ihrer Erfahrung. Dann machen wir es so.«
Talbot lächelte erleichtert. »Wann geht es los?«
»Wie lange benötigen Sie, um Ihre Leute zu mobilisieren?«
»In zwölf Stunden könnte die Legion abmarschbereit sein.«
Mason nickte. »Dann ist das unser Zeitfenster.«
Gutierrez war noch nicht gänzlich von der Durchführbarkeit überzeugt. »Dieses Schiff macht mir noch Sorgen. Es verhindert zwar die Landung von Truppen nicht, aber es gibt mit Sicherheit Informationen an eine Basis auf der Oberfläche weiter. Wie sollen wir verhindern, dass es uns beim Anflug ortet und Talbots Männer genauso enden wie die Truppen der VPU?«
Mason schmunzelte. »Nur keine Sorge. Dafür haben wir uns schon was überlegt. Es wird ihnen gefallen. Sie bekommen ein neues Spielzeug.«
Gutierrez runzelte die Stirn angesichts dieser rätselhaften Antwort, gab sich aber vorläufig damit zufrieden. Mason nickte.
»Falls es keine Fragen mehr gibt, dann schlage ich vor, Sie beide machen Ihre Leute bereit. Es wartet viel Arbeit auf uns. Ich lasse Ihnen alle Informationen, die uns vorliegen, innerhalb der nächsten Stunde zukommen. Dann können Sie sich noch einmal gesondert mit allem vertraut machen.« Mason nickte beiden Offizieren noch einmal zu. »Das wäre dann alles, Gentlemen.«
Gutierrez und Talbot salutierten und strebten dem Ausgang zu. Als Talbot am Präsidenten vorüberging, hielt er ein letztes Mal inne und wandte sich Mason zu.
»Sir? Es ist so weit, nicht wahr? Das sind sie.« Er deutete auf das immer noch aktive Hologramm des unbekannten Schiffes über Risena.
Mason musste gar nicht erst fragen, wer mit sie gemeint war, und seufzte. »Ich wünschte, ich könnte etwas anderes sagen. Aber ja … ich denke, sie sind es. Der Krieg hat angefangen. Und wenn uns nicht schleunigst etwas einfällt, dann könnte es unser aller Ende sein.«
2
Der Präsident hatte nicht übertrieben. Captain Alvaro Gutierrez stand in der Aussichtslounge eines riesigen Hangars und starrte mit offenem Mund auf ein brandneues Schiff, aber keines, wie es schon irgendjemand zuvor gesehen hatte.
Ein Mann in mittleren Jahren im weißen Kittel der Ingenieure trat zu ihm. »Beeindruckend, nicht wahr?«
Alvaro nickte und schielte mit einem Auge auf das Namensschild des Ingenieurs. »Waren Sie an der Entwicklung beteiligt, Mister O’Shaunessy?«
Der Mann lächelte wie ein stolzer Vater, der zum ersten Mal sein neugeborenes Baby sieht. »Nennen Sie mich einfach Adrian. Und ja, ich war daran beteiligt. Aber ich war nur ein ganz kleines Licht in einer großen Maschinerie.« Der Ingenieur wandte sich Alvaro erstmals zur Gänze zu. »Der Präsident hat mich darüber unterrichtet, dass Ihr Sicherheitsstatus aufgewertet wurde. Sie dürfen nun alles erfahren, was mit diesem Schiff zu tun hat. Stellen Sie mir einfach Ihre Fragen. Ich bin sicher, Sie haben eine Menge.«
Alvaro lächelte. »Eigentlich nur eine: Was können Sie mir alles über dieses Schiff erzählen?«
O’Shaunessys Lächeln wurde breiter. »Die TRS Hector. Claudius-Klasse. Ein Schlachtkreuzer. Es wurde auf Grundlage neuester verfügbarer Technologie gebaut. Unter Verwendung von terranischer sowie Driziltechnik. Außerdem noch … einer dritten Fraktion.«
Alvaro fiel die Pause in den Worten des Ingenieurs auf. Er wollte schon darauf eingehen, doch etwas beschäftigte ihn mehr. »Die Form und die Außenhülle sehen seltsam aus.«
»Freut mich, dass Ihnen das auffällt. Es handelt sich um ein Tarnschiff.«
Alvaro wandte sich dem Mann mit hochgezogenen Augenbrauen zu. »Sagen Sie das noch einmal.«
»Sie haben richtig gehört. Dieses Schiff sollte auf keinen Sensoren und keiner Abtastung auftauchen. Theoretisch.«
»Theoretisch?«
»Wir haben es natürlich getestet. Aber uns ist nicht bekannt, über was für Fähigkeiten der Feind verfügt. Daher werden Sie die Tarnfähigkeit einem Praxistest unterziehen müssen.«
Alvaro schnaubte. »Ansonsten wäre es ja auch zu einfach gewesen.« Der Schiffskommandant runzelte die Stirn. »Wie haben Sie das geschafft?«
»Sie haben doch sicherlich vom Dentano-Zwischenfall gehört.«
»Natürlich. Jeder hat das.«
»Wovon Sie aber bestimmt nichts gehört haben, ist, dass die Republik damals ein intaktes Schwarmschiff der Nefraltiri für sich sichern konnte.«
Nun war Alvaro vollends verblüfft. »Das ist nicht Ihr Ernst!«
»Es ist vielleicht zu viel gesagt, dass wir es uns sichern konnten. Das Schiff verfügt über eine Form von Intelligenz und Bewusstsein. Es hat sich mit einem Menschen namens Bernadette Ward zu einer Art symbiotischem Verhältnis verbunden. Seitdem hilft es uns. In den letzten fünf Jahren haben wir unheimlich viel über die Nefraltiri und deren Technik gelernt.«
»Genug, dass wir eine Chance haben?«
O’Shaunessy zuckte leichtfertig mit den Achseln. »Werden wir sehen.«
»Sehr ermutigend.« Alvaro deutete durch das Fenster auf das Schiff. »Es sieht aber nicht so aus, als könnte die Hector eine ganze Schattenlegion befördern. Wie bringen wir die Soldaten sicher zur Oberfläche?«
»Der Truppentransporter der Legionäre wird sich die ganze Zeit über ganz dicht bei der Hector aufhalten. Auf diese Weise befindet er sich in ihrem Sensorschatten und für den Feind in einem toten Winkel.«
»Theoretisch?«, hakte Alvaro nach.
»Theoretisch«, bestätigte O’Shaunessy schmunzelnd. »Falls Sie zurückkommen, müssen Sie mir unbedingt die gesammelten Daten zur Auswertung überlassen.«
Alvaro schürzte die Lippen und sah großzügig über die flapsige Formulierung falls hinweg. Nicht wenige schienen der Auffassung zu sein, es handele sich hierbei um ein Himmelfahrtskommando. Alvaro neigte eher zu der Ansicht, es gäbe keine Probleme, sondern nur Lösungen. Allerdings war es schwer, eine optimistische Grundeinstellung beizubehalten, wenn jeder mit seinem Tod rechnete.
Der Ingenieur wandte sich ihm breit grinsend zu. »Hey, wollen Sie das gute Stück mal in Aktion erleben?«
Alle düsteren Gedanken fielen mit einem Mal von Alvaro ab. »Ich dachte schon, Sie fragen nie.«
Die Brückenkonfiguration war etwas anders, als Alvaro es gemeinhin gewohnt war. Es würde etwas Eingewöhnungszeit benötigen. Deshalb begrüßte er die Möglichkeit, mit der Hector eine Spritztour zu machen. Es handelte sich lediglich um eine kleine Runde um den Block. Aber auch das genügte schon, um sich einen Eindruck zu verschaffen und vielleicht die eine oder andere Kinderkrankheit festzustellen, auf die man ein Auge haben musste.
Das Schiff besaß annähernd die Größe eines Schlachtkreuzers, aber die Brücke selbst war kaum komfortabler als bei einem Begleitkreuzer. Der Kommandosessel befand sich wie üblich auf einer zentralen Position gegenüber dem Brückenfenster. Die Station des XO befand sich in einer Bodennische direkt davor. Zu dessen Linker befanden sich die Stationen für Kommunikation und Lebenserhaltung, zu dessen Rechter die der Taktik sowie der Navigation. Damit wurde die Brücke des Tarnkappenkreuzers wesentlich komprimiert und es wurde eine Menge Platz eingespart.
Alvaro reckte ein wenig unbehaglich das Kinn. Wenn man die Brücke eines Angriffskreuzers gewohnt war, stellte sich schon ein gewisses Gefühl der Klaustrophobie ein. Er streichelte fast zärtlich über die Lehnen seines Sessels. Sie waren beide mit mehreren Tasten versehen sowie einer großen, halbtransparenten Scheibe, die in seine rechte Lehne eingelassen war. Alvaro fuhr ihre Konturen mit der Hand nach. Sie besaß die Maße einer durchschnittlichen Männerhand.
Er war so konzentriert, dass er O’Shaunessy nur beiläufig bemerkte, der sich wie ein hilfreicher Geist an seine Seite stellte. Der Ingenieur bemerkte sofort das Interesse des Kommandanten für die Funktionen seines Kommandosessels.
Alvaro sah stirnrunzelnd auf. »Die Konfiguration ist anders als bei anderen republikanischen Kriegsschiffen.«
O’Shaunessy lächelte. »Freut mich, dass es Ihnen auffällt. Bei der Hector haben wir bereits die Kommandokonfiguration der neuesten Generation verbaut. Ursprünglich sollte sie erst in der nächsten auf Kiel gelegten Klasse von Kriegsschiffen zum Einsatz kommen. Aufgrund des Bedarfs, den Schiffsbau voranzutreiben, entschlossen wir uns aber, die Pläne gewissermaßen zu forcieren.«
In diesem Augenblick betrat seine XO, Commander Akari Sato, die Brücke, salutierte vor ihrem Befehlshaber und ließ sich geschmeidig in die für sie vorgesehene Nische gleiten.
Alvaro hatte die Kommandocrew seines alten Schiffes – des Angriffskreuzers Medusa – übernommen. Seine XO war die Letzte, die ihren Platz einnehmen musste. Alle anderen waren bereits anwesend. Er fühlte sich bedeutend wohler, wenn er mit Offizieren zusammenarbeiten konnte, mit denen er bereits ein eingeschworenes Team bildete. Es genügte vollauf, wenn sie sich alle an ein neues Schiff und neue Technik gewöhnen mussten. Eine neue Brückencrew war zu viel des Guten.
Alvaro nickte ihr mit freundlichem Lächeln zu und wandte sich wieder seiner Kommandostation zu. Abermals fuhr er die Konturen der halbtransparenten Scheibe nach. Der Ingenieur ließ ihn einen Moment gewähren, bevor er sagte: »Das ist ein Hologramminterface. Wesentlich effizienter als die früheren taktischen Hologramme.«
Alvaro sah auf. »Was kann es?«
O’Shaunessy lächelte geheimnisvoll. »Warum probieren Sie es nicht einfach aus?«
Alvaro zögerte nicht lange. Er legte seine Hand auf das Interface – und erstarrte. Vor seinem linken Auge baute sich ein Schema auf. Aber es war kein Hologramm im eigentlichen Sinn. Er nahm die Hand von der Scheibe und das Schema verschwand.
Verwundert drehte er sich zum Ingenieur um. »Was zum Teufel war das?«
»Taktische Hologramme sind veraltet«, erklärte der Mann geduldig. »Das Hologramminterface überspielt alle für Sie relevanten Daten direkt auf Ihre Netzhaut. Das ist nur für Sie sichtbar. Für keinen sonst. Falls ein anderes Schiff mit Ihnen Kontakt aufnimmt, wird Ihr Gesprächspartner auf ebensolche Weise auf Ihre Netzhaut direkt geschaltet. Das System nutzt Ihre Nervenbahnen, um sich Zugang zu Ihrem Sehnerv und Ihrer Netzhaut zu verschaffen. Das Prinzip ist relativ simpel, doch die Umsetzung hat Jahrzehnte gedauert. Wir wussten, welchen Weg wir einschlagen wollten. Wie wir allerdings von A nach B kommen sollten, das herauszufinden hat etwas gedauert. Wir sind alle enorm froh, dass wir es rechtzeitig genug geschafft haben, damit es in der Hector zum Einsatz kommt.«
Alvaro war etwas erschlagen von den ganzen Informationen, die auf ihn einprasselten. Er warf dem Interface einen misstrauischen Blick zu.
»Nur zu!«, ermunterte ihn O’Shaunessy. Der Mann grinste. »Es beißt nicht.«
Alvaro ignorierte den Spott und legte seine Hand erneut darauf. Augenblicklich baute sich wiederum das bekannte Schema auf. Es handelte sich um eine Risszeichnung der Hector. Alle wichtigen Systeme waren hervorgehoben. Alvaro erkannte, dass er hierüber im Bedarfsfall sofort Zugriff auf Verlust- und Schadensmeldungen des ganzen Schiffes besaß.
»Absolut cool«, hauchte er.
O’Shaunessy nahm ein elektronisches Klemmbrett zur Hand und gab sich nicht einmal die Mühe, seine tiefe Genugtuung zu verbergen.
»Wollen wir beginnen?«
Alvaro nickte. Es gab nichts, was er im Augenblick lieber getan hätte. »Bringen Sie uns raus, Marc.«
Lieutenant Marc Caldwell, der an der Navigation seinen Dienst versah, gab einige Befehle in seine Konsole ein. Auf dem Hologramminterface erwachte der Antrieb zum Leben. Die Hector schob sich aus dem Trockendock ins All hinaus. Langsam zunächst, doch mit wachsender Überwindung der Masseträgheit gewann das Schiff zusehends an Geschwindigkeit.
»Bringen Sie uns zum Übungsgelände!«, befahl Alvaro.
»Kurs auf Übungsgelände liegt an, aye!«, bestätigte Caldwell.
Das Schiff bewegte sich weitaus eleganter und leichter, als es bei Einheiten dieser Größe gemeinhin üblich war. Er war überrascht. Es handelte sich um ein schweres Kriegsschiff, besaß aber die Flugeigenschaften eines leichten Begleitschiffs.
Das militärische Übungsgelände im Perseus-System befand sich gut zwei Stunden Flugzeit vom Hauptplaneten und sämtlichen zivilen Flugrouten entfernt. Alvaro genoss jede einzelne Sekunde davon. Er war sich bewusst, dass O’Shaunessy ihn die ganze Zeit über neugierig beobachtete und seine Reaktionen abzuschätzen versuchte. Hier wurde er genauso wie das Schiff einem Test unterzogen.
»Trainingsgelände erreicht!«, meldete seine XO schließlich.
Alvaro lächelte. »Dann wollen wir mal.« Er nickte leicht über die Schulter.
O’Shaunessy gab etwas in sein elektronisches Klemmbrett ein. Mit einem Mal erwachten drei alte Schiffswracks direkt voraus zum Leben. Es handelte sich um einen alten Angriffskreuzer sowie zwei Drizilfregatten.
Auf seinem Hologramminterface leuchtete sogleich eine Warnung auf. Die drei ferngesteuerten Schiffe hatten gerade das Gefecht eröffnet und die Hector mit mehreren simulierten Torpedos angegriffen.
»Ausweichmanöver Beta eins fünf ausführen!«, befahl er sofort. »Abwehrmaßnahmen durchführen. Gegenangriff vorbereiten.«
Die Hector wich geschmeidig aus. Gleichzeitig woben die Punktverteidigungslaser ein Netz aus Energie rund um den Tarnkappenkreuzer ins All. Zwei Dutzend Lenkflugkörper wurden noch im Anflug zerstrahlt. Fünf kamen durch.
Das Hologramminterface registrierte mehrere Einschläge unter Bug sowie in der Nähe des Waffendecks und der Mannschaftsquartiere. Geringfügige Panzerungsschäden wurden angezeigt, aber kein Durchbruch. Das war interessant. Mindestens einer der Torpedos hätte eigentlich rein statistisch die Panzerung durchbrechen müssen. Alvaro wandte sich leicht zu O’Shaunessy um.
»Neue und verbesserte Panzerungslegierung«, informierte dieser die Frage vorhersehend. Er blickte dafür nicht einmal von seinem Klemmbrett auf. »Ich schlage vor, Sie führen einen Gegenschlag aus.«
Alvaro drehte seinen Kommandosessel wieder in Richtung Brückenfenster. »Einverstanden.« Er räusperte sich kurz. »Taktik: Torpedosalve vorbereiten. Auf den Angriffskreuzer konzentrieren.«
»Salve bereit« informierte der Offizier an der Taktik.
Alvaro zögerte lediglich eine Millisekunde. »Feuer!«, stieß er aus.
Die Hector stieß einen Schwarm von zwölf schweren und vier leichten Torpedos aus. Bei einem Kampf gegen Schiffswracks handelte es sich im Prinzip um nichts weiter als ein Tontaubenschießen. Dennoch lehnte sich Alvaro in seinem Sessel vor und verfolgte den Flug der Geschosse gebannt. Wäre der Sicherheitsgurt nicht gewesen, er wäre wohl vor Unruhe aufgesprungen.
Die sechzehn Geschosse hielten zielstrebig auf den Angriffskreuzer zu. Als sie schließlich einschlugen, überzogen sie den pockennarbigen Schiffskörper vom Bug bis zum Heck mit Explosionen. Alvaro musste die Augen abwenden, so grell war es, als der Angriffskreuzer zerplatzte. Zu seiner Verblüffung hüllte die Detonation auch noch eine der Fregatten ein und schickte sie ebenfalls ins Jenseits.