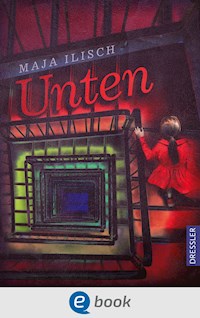19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Tymur Damarel – Prinz, Schwätzer, Meuchler – kann sich nicht mehr verstecken, sein Geheimnis ist gelüftet. Doch was hat er zu befürchten? Im Kampf gegen die Dämonen kommt es auf jeden an, erst recht auf den, der sie mit eigenen Waffen zu schlagen weiß. Doch über seiner größten List darf Tymur eines nicht vergessen: Kevron hat noch eine Rechnung mit ihm offen. Tymur ist falsch – aber Kevron ist Fälscher … Die Dämonen sind zurück – doch niemand weiß es. Unerkannt sitzen sie auf dem Königsthron, in der magischen Akademie und wer weiß wo noch überall, und umspinnen die Welt mit einem Netz aus Bosheit und Heimtücke. Wo Lügen regieren, hat die Wahrheit schlechte Karten – doch Prinz Tymur und seine Gefährten nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Nur der Kampf gegen den gemeinsamen Feind hält das zerbrechliche Bündnis noch zusammen und das Wissen, dass sie niemand anderem trauen können. Wenn das ganze Land Neraval auf einer Lüge erbaut wurde, für was lohnt es sich dann überhaupt noch zu kämpfen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 835
Ähnliche
MAJA ILISCH
DAS GEFÄLSCHTE LAND
DIE NERAVAL-SAGE3
KLETT-COTTA
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur
erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de)
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg
Unter Verwendung einer Illustration von © Max Meinzold, München
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-96477-6
E-Book ISBN 978-3-608-11854-4
Für Micha,die den Tiger rittim Schatten der Fortuna
O that this too too solid flesh would melt, Thaw, and resolve itself into a dew!
O schmölze doch dies allzu feste Fleisch, Zerging und löst in einen Tau sich auf!
William Shakespeare: HamletDeutsche Übersetzung von August Wilhelm v. Schlegel
PROLOG
Der Dämon war tot, doch das Schwert war noch ganz – da wusste Damar, dass etwas nicht stimmte. Er stolperte rückwärts, starrte nicht auf den reglosen Körper zu seinen Füßen, nicht auf die wachsende Blutlache, La-Esh-Amon-Ris Blut und Damars eigenes, nur auf die Klinge, immer noch silbern, immer noch glänzend, immer noch an einem Stück.
Das eissilberne Schwert, von ihm selbst geschmiedet. Sogar das Erz hatte er mit seinen eigenen Händen gehauen nur für diesen einen Moment, in dem er den Erzdämon töten und die Menschheit für alle Zeiten aus der Knechtschaft befreien würde. So musste es sein mit Waffen aus Eissilber, und wenn ihre Bestimmung erfüllt war, zerbrachen sie. Hier aber lag La-Esh-Amon-Ri, tot, und Damars Schwert war immer noch Schwert.
Damar unterdrückte die Schmerzen. Es war nur ein Schnitt am Arm, er würde nicht daran sterben, er hatte so viel Schlimmeres von diesem Kampf erwartet. Nur dieses Schwert konnte La-Esh-Amon-Ri töten und nur Damar es führen, ein wohlbemessener Stoß direkt ins Herz und hindurch, da konnte Damar es verschmerzen, dass ihn die Klinge des Dämons am Arm geritzt hatte. Selbst wenn es heftig blutete, es sich anfühlte, als flösse Damar das nackte Leben zum Körper hinaus – er war ausgezogen, einen Dämon zu töten, und solange das Schwert noch ganz war, war der Dämon noch nicht wirklich tot.
Ein weiteres Mal stieß Damar das Schwert in den Leib seines Widersachers, doch La-Esh-Amon-Ri regte sich nicht. Wenn Damar jemals einen Toten gesehen hatte, dann hier, und doch war es immer noch nicht genug. Er packte den Körper, zerrte ihn hoch und schlug ihm endlich den gehörnten Kopf von den Schultern. So wenig Blut war noch in dem Körper, dass es nicht mehr hervorsprudeln wollte, es sickerte aus der Wunde wie ein halberfrorener Quell, tot war tot, und dieser hier war noch toter, und das Schwert, das Schwert war immer noch ganz …
»Damar! Hör auf!« Marold und Sveta mussten ihn zu zweit packen, um ihn zurückzureißen, sonst hätte Damar von diesem Körper so lange nicht abgelassen, bis auch in ihm selbst kein Leben mehr war. »Er ist tot! Du hast es geschafft! Wir haben gesiegt!«
Damar antwortete nicht. Sein Blick suchte den von Ililiané. Alles, was er über die Dämonen wusste, hatte er von ihr gelernt, dass er das Schwert hatte schmieden dürfen, verdankte er nur ihr, und dass er überhaupt noch lebte, und alles, alles auf der Welt … Ililiané nickte.
»Sie haben recht, Damar«, sagte sie, ihre Stimme so sanft wie der Wind und doch laut genug, um fünf jubelnde Menschen zu übertönen. »Du kannst hier nichts mehr tun. La-Esh-Amon-Ri wohnt nicht mehr in diesem Körper.«
»Das heißt …«, stammelte Damar, und vor seinen Augen tanzte die Schwärze. Er kämpfte darum, auf den Beinen zu bleiben, es war nur ein Kratzer, mehr nicht … »Das heißt, er ist tot?« So viel Zeit hatte er unter den Alfeyn verbracht, so viel mit Ililiané, und doch gab es immer wieder diese Momente, in denen es ihnen schwerfiel, sich mit Worten zu verständigen. Mit ihren Augen, mit ihrem Blick konnte die Zauberin so viel sagen, und das direkt in Damars Herz hinein, die Sprache aber war zum Irren gemacht.
Valya war an Damars Seite, fing ihn auf, als er zusammenbrach, und Ililianés Stimme drang nur noch aus der Ferne in sein Ohr: »Hört mir genau zu! Unser Werk ist noch nicht vollbracht. Den Unerwünschten zu erschlagen, war erst der Anfang …« Dann wusste Damar nichts mehr. Schatten umfingen ihn, und an diesem Ort waren sie schwarz.
Damar wusste nicht, wie lang er dort lag, doch er wusste, er musste sich an den letzten Rest seines Bewusstseins klammern, sonst würde er niemals wieder aufwachen. La-Esh-Amon-Ri hatte seine Festung hier erbaut, Akar-Na-Sherosh, den Schwarzen Stein, und den Felsen, auf dem sie stand, hatte er gleich selbst mitgebracht. Ein Stück Dämonenreich, in die Menschenwelt geholt, obenauf die Festung wie ein Krönchen auf zu großem Kopf, doch sein eigentlicher Hort lag hier, so tief unter der Erde, dass man nicht mehr sagen konnte, in welcher Welt man sich gerade befand.
Nur hier war der Erzdämon verwundbar, hier hatten Sveta und Isjur ihn in eine Falle gelockt, hier hatten Valya und Marold seine Wachen niedergemetzelt, eine nach der anderen, damit Damar selbst den einen Stoß, auf den es ankam, setzen konnte; und selbst Astol, von der letzten Schlacht verwundet, war mit ihnen in die Tiefe hinabgestiegen in der bitteren Hoffnung, dass sie alle zusammen wieder ans Licht steigen würden, als sie selbst.
Der Erzdämon war tot, doch nicht tot genug, als dass Damars Schwert zersprungen wäre, und wenn Damar hier auch nur für einen Augenblick das Bewusstsein verlor, dann konnte die Seele von La-Esh-Amon-Ri von seinem Körper Besitz ergreifen, ihn zu einem neuen Dämon machen, und alles war vergebens. Damar kämpfte seine Augen auf. Bereits einmal war er den Dämonen zum Geschenk gemacht worden, ein zweites Mal durfte es nicht geben. Er siegte. Er lag in einer Lache Blut, das nicht sein eigenes war, in der Mitte eines Musters, das aussah wie ein Stern.
Damar blinzelte. Sein Bewusstsein wollte davonhüpfen, die Augen ihm wieder zufallen. Das war La-Esh-Amon-Ri, er hatte Damars Körper mit einer Kerbe als sein Eigentum markiert, nur geritzt, nicht geschlachtet, um ihn selbst noch benutzen zu können.
»Wir brauchen Hilfe!«, rief Valya, und erst da begriff Damar, dass sie immer noch an seiner Seite kniete. »Hat jemand einen Schluck Wasser? Er dämmert immer wieder weg!«
»Ich – dämmere – nicht«, brachte Damar hervor. »Alles ist gut.« Er hob den Arm, damit sie verstanden, welcher Teil von ihm wirklich Hilfe brauchte – dass er blutete, das durften sie sehen, aber den Kampf, den Damar in seinem Verstand ausfocht, den behielt er lieber für sich.
Natürlich reichte ihm dennoch jemand eine Trinkflasche, und Damar nahm einen beherzten Schluck, nur um dann prustend auszuspucken. Kein Erzdämon der Welt konnte jemals so etwas Abscheuliches erschaffen wie die vergorene Stutenmilch, die Marold niemals auszugehen schien und die mit jedem Mal, da Damar von ihr kosten musste, widerwärtiger wurde. Ein Gutes hatte es: Danach war er endgültig wieder bei sich.
Einen Augenblick lang schien alles wie an einem normalen Abend. Sie saßen beisammen, teilten ein herzhaftes Lachen über Damars Grimassen, Sveta verband seinen Arm, und hätten sie nicht in diesem beklemmend kalten, finsteren Keller gesessen, wo steinerne Säulen ihre langen, verzerrten Schatten auf sie warfen, sie hätten wie sonst darum würfeln können, wer die nächste Wache übernehmen musste, und sich die Zeit mit wilden Geschichten vertrieben von einer besseren Welt, in der es keine Dämonen mehr gab.
»Geht es wieder?«, fragte Sveta.
Damar nickte. »Danke«, sagte er und schüttelte sich. Es brannte noch, doch es blutete nicht mehr.
»Kannst du noch laufen?« Isjur blickte ihn eine Spur zu fragend an. »Wir dürfen nicht hierbleiben, wir müssen zusehen, dass wir fortkommen – bis wir Akar-Na-Sherosh hinter uns gelassen haben, darf keiner von uns auch nur an Schlaf denken. Du weißt, warum.«
»Sprich den Namen nicht aus«, flüsterte Astol und legte den Arm um seinen Geliebten. »Der Unaussprechliche ist tot, und sein Name muss ebenso in Vergessenheit geraten wie der dieses Ortes. Selbst wenn wir alle Dämonen dieser Welt töten, wir werden niemals diesen Splitter aus ihrer Flanke ziehen können. Aber wir können seine Macht brechen, indem wir ihm seinen Namen nehmen. Die Welt ist reif für einen Neuanfang.«
»So oder so.« Isjur schüttelte den Kopf. »Wir müssen hier weg. Schnell.«
»Wir müssen bleiben«, sagte Ililiané, und wieder wog jedes Wort so leicht wie eine Feder und so schwer wie der ganze Berg. »So lange, bis mein Ritual vollbracht ist.«
»Welches Ritual?« Ein Schauder lief über Damars Rücken. Hatte er doch das Bewusstsein verloren?
Ililiané bemerkte sein fragendes Gesicht. »Ein Ritual, um La-Esh-Amon-Ri zu bannen. Du hast ihn getötet, doch nicht vernichtet, und er darf niemals zurückkehren.«
»Was hast du vor?«, hörte Damar sich fragen, ruhig, fast neugierig, unter der Oberfläche aber bebte er. Er fühlte sich betrogen um seinen Sieg. Da hatten sie alle ihre Leben riskiert, für … für nichts?
»Wir können ihn bannen«, erwiderte Ililiané. »Ein Gefängnis, aus dem er niemals ausbrechen kann. Doch wir müssen es aus seinem eigenen Körper bilden – aus seiner Haut, aus seinem Blut. Das ist der Grund, warum ich bei euch bin. Den Unerwünschten töten konntet ihr auch ohne meine Hilfe. Ihn jedoch einsiegeln für alle Zeiten – das kann nur ich. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich sage euch, was zu tun ist.«
»Ich nehme an, wir ziehen ihm die Haut ab?« Sveta zückte ihr Messer mit einem Grinsen, als ob sie bereits den ganzen Tag drauf gewartet hätte. »Wenn es weiter nichts ist …«
Nur war es damit nicht getan. Einen Dämon einmal zu töten, das war eine leichte Sache. Ihn für immer zu besiegen, dazu gehörte mehr. So viel mehr …
Vielleicht war draußen bereits wieder Tag, vielleicht noch Nacht. Sie wussten es nicht, und obwohl ein jeder von ihnen hätte hinaufsteigen und nachsehen können, blieben sie unten, hockten inmitten des neunzackigen Sternes und sahen Ililiané zu. Es gab wenig, das sie sonst noch hätten tun können.
»Alles ist ruhig«, sagte Isjur und nickte in Richtung der Treppe. »Sieht aus, als ob deine Leute oben die Festung halten, Rold.«
Marold grunzte. »Was erwartest du? Die besten Krieger, die du finden kannst!«
»War mir nicht sicher.« Isjur lachte. »Haben ihre Pferde zurücklassen müssen – seid ihr dann überhaupt noch ganze Männer?«
»Dreimal mehr als du, möchte ich meinen.«
Sie alle wollten glauben, dass er recht hatte, dass oben immer noch Marolds Sippe über die Festung wachte und nicht alle in ihrem Blut lagen, dass die Treppe noch bis ans Licht führte und nicht auf halber Höhe in einem Steinhaufen endete.
Ililiané saß im Schneidersitz am Boden, strich mit ihren Händen über die abgezogene Haut des Dämons und murmelte dabei leise in einer Sprache, die noch nicht einmal Damar verstand. Vor ihr stand ein Kelch, ein einfacher hölzerner Trinkbecher, gefüllt mit La-Esh-Amon-Ris Blut. Es sah nicht nach viel aus, aber wenn Damar in seiner Zeit bei den Alfeyn eines gelernt hatte, dann, dass die Dinge dort nicht immer so waren, wie sie aussahen, und dieser unscheinbare Becher konnte ebenso gut einen ganzen Ozean halten. In Augenblicken wie diesem blieb die Alfeyn selbst Damar fremd. Die Art, wie sie über die abgezogene Haut strich, dass diese unter ihren Fingern zu verdörren schien, ließ ihn frösteln.
Die Müdigkeit nagte an ihm. Geduldig sein, das war eine Sache, doch sie waren seit mehr als einem Tag auf den Beinen, und sie alle, vielleicht bis auf Ililiané, waren erschöpft. Sie klammerten sich ans Wachsein. Damar, den sie zum Anführer gewählt hatten, musste mit gutem Vorbild vorangehen, doch je länger er saß, desto schwerer wurde es.
»He!« Marold stieß ihn gegen die Schulter, und Damar schreckte hoch, schuldbewusst, dass er sich seine Müdigkeit hatte anmerken lassen. »Bleib wach! So lang wird es schon nicht mehr dauern!« Doch während Marold, der mühelos zwei Tage am Stück im Sattel sitzen konnte und nur ermüdete, wenn er einmal laufen musste, sich noch gut hielt, sah das für die anderen nicht so gut aus. Der dunkle, ruhige Raum, Ililianés fortwährendes Murmeln – jede Stunde an diesem Ort geriet zu einer schieren Ewigkeit.
Nicht nur Damar ging es so. Isjur und Astol saßen Schulter an Schulter, hielten einander im Arm, und nur ihre offenen Augen kannten den Unterschied, ob sie nun gemeinsam wachten oder gemeinsam eingeschlafen waren. Sveta war aufgestanden, wanderte zwischen den Säulen hin und her mit keinem anderen Ziel, als wachzubleiben, und Valya –
Valya schlief. Ihr Kopf war ihr auf die Brust gesackt, und als wollte sie auch den letzten Zweifel ausräumen, drangen leichte Schnarchgeräusche von dort, wo sie saß, herüber. Wie lang ging das schon so? Es konnte nicht lange sein, und trotzdem wurde es Damar heiß und kalt, als er sie packte und mit mehr Gewalt als nötig wachrüttelte.
Valya fuhr hoch. »Wer? Was?«, stieß sie hervor, stolperte auf ihre Beine und griff nach ihrer Axt. »Was ist los?«
Sveta blieb stehen und lachte. »Nichts ist los!«, rief sie. »Eingeschlafen bist du! Dass du dich nicht schämst!« Die anderen lachten mit ihr, doch Damar konnte nicht mittun.
Ililiané blickte ihn an und bedeutete ihm, zu ihr zu kommen. »Das darfst du nicht zulassen«, sagte sie leise.
»Ich weiß«, erwiderte Damar. »Wir müssen wachsam bleiben, bis du fertig bist mit dem Ritual –«
»Ich habe noch nicht einmal angefangen«, sagte Ililiané und deutete auf das Stück Haut, das sie La-Esh-Amon-Ri aus dem Rücken geschnitten hatten. Es sah aus wie altes, gräuliches Leder. »Das hier sind erst die Vorbereitungen. Ihr dürft nicht schlafen, Damar!«
Damar musste gähnen. »Aber wir sind Menschen, Lié«, sagte er. »Du weißt, was passiert, wenn wir nicht schlafen.«
»Und du weißt, was passiert, wenn doch.« Sie sah zu Valya hin, und ihre Lippen wurden noch schmaler. »Lass sie nicht mehr aus den Augen, hörst du? Sie ist eingeschlafen – vielleicht ist es schon zu spät.«
»Kannst du nichts für uns tun?«, fragte Damar. »Hast du keinen Zauber, um uns zu erfrischen, um uns zu helfen, die Zeit bis zum Ritual zu überstehen?«
Ililiané senkte den Kopf. »Meine ganze Zauberkraft ist hier gebunden, im Blut des Unaussprechlichen, damit es nicht vergeht, bis der Rest bereit ist. Ich kann euch nicht helfen. Du warst einmal beinahe einer von uns, Damar Menschenkind. Du kannst ohne Schlaf auskommen, wenn du musst. Dann können sie das auch. Zeig es ihnen. Aber vor allem – gib acht auf Valya.«
»Denkst du, sie könnte …«, fing Damar an und brach ab. Ililianés Nicken war grimm. An diesem Ort hing die Seele von La-Esh-Amon-Ri, suchte nach einem neuen Körper und hatte vielleicht gerade einen gefunden. Damar atmete durch. »Es ist nicht sicher hier«, sagte er. »Ich muss die anderen rausbringen, das bin ich ihnen schuldig. Oben wacht Marolds Sippe, da können sie einen Schlafplatz finden, bis du fertig bist … Dich kann ich so lange allein lassen, dich kann er nicht besitzen, aber unsere Freunde –«
»Dafür ist es zu spät«, flüsterte Ililiané. »Wenn Valya schon nicht mehr ist, was sie zu sein scheint – willst du etwa Marolds Sippe dem Unerwünschten zum Fraß vorwerfen?«
Damar blickte zu Valya hinüber, sah, wie sie sich streckte und räkelte, sie sah so aus wie immer, wie der Mensch, den Damar jetzt seit bald drei Jahren kannte, seine Verbündete, Waffenschwester, Freundin … Doch die Saat des Zweifels war gesät. Eben noch hätte Damar Valya blind sein Leben anvertraut – nun wagte er es nicht einmal mehr, ihr den Rücken zuzukehren.
Valya setzte sich nicht wieder hin. Doch anders als Sveta, die immer noch auf und ab stromerte, weil sie so lange gefangen gewesen war, dass sie niemals mehr stillsitzen konnte, blieb sie stehen, wo sie war, fest und standhaft auf zwei Beinen. Valya war Kriegerin durch und durch – sie wusste, dass sie den Kampf gegen die Müdigkeit nicht gewinnen konnte, wenn sie ihre Kraft sinnlos vergeudete. Stehen und wachen, das sah ihr ähnlich. Valya. Kein Dämon. Und doch …
Damar wollte nicht glauben, dass ausgerechnet Valya als Erste von ihnen an den Unaussprechlichen gefallen sein sollte. Valya war wie ein Fels. Wer sie bezwingen wollte, dem lachte sie frech ins Gesicht. Wo Marold mit seinem Stamm keine drei Nächte an einem Ort bleiben mochte, um den Dämonen immer eine Pferdelänge voraus zu sein, wo Sveta schon in die Sklaverei hineingeboren worden war und den Dämonen, so jung sie noch war, nicht weniger als drei Kinder hatte schenken müssen, wo Astol beim Versuch, seinen gefangenen Geliebten zu retten, selbst die Freiheit verloren hatte, war Valya diejenige, die jedem Dämon trotzte und immer trotzen würde. Doch als sie sich nun zu ihm umdrehte, lag etwas seltsam Fremdes in ihrem Blick.
»Was ist mit dir?«, fragte sie. In ihrer Stimme schwang etwas mit, was da sonst nicht war. »Was gaffst du mich an?«
Damar wollte schon sagen, dass es nichts war, doch er wollte sie nicht anlügen. »Ich will mir sicher sein können mit dir«, antwortete er. »Du bist eingeschlafen – ich will wissen, ob du noch die Alte bist. Es ist nicht gegen dich –«
»Was?«, rief Valya laut. »Du nennst mich Dämon, und das soll nicht gegen mich sein?«
Damar hob die Hände. »Beruhige dich! Was denkst du, was ich tun soll? Wir müssen wach bleiben, du weißt, was davon abhängt, und du weißt, dass mein Misstrauen allen Grund hat.«
»Allen Grund?«, schrie Valya zornig. »Allen Grund! Weil ich einmal kurz die Augen zugemacht habe? Das sagt der Richtige! Wer hat La-Esh-Amon-Ri sein Blut gegeben? Wer ist hier bewusstlos zusammengebrochen?«
Damar schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid, Valya. Wir sind alle erschöpft und müde. Verzeih mir meine Worte.«
»Deine Worte sind mir egal!« Valya spuckte aus. »Deine Gedanken, die sind es! Dass du nach alledem in der Lage bist, so etwas von mir zu glauben –«
»Aber er hat recht«, sagte Astol. »Du bist eingeschlafen. Rede dich nicht heraus.« Isjur pflichtete ihm nickend bei.
Valya machte einen Schritt rückwärts, und in ihrem Blick lag eine Feindseligkeit, die wirklich nicht mehr zu ihr passte. Valya war stolz und aufbrausend, in ihrer Freundschaft aber unerschütterlich. »Ihr jetzt also auch?«, rief sie. »Was wird das hier? Braucht ihr alle eine Tracht Prügel, um wieder zu wissen, wer ich bin?«
Sveta trat zu ihr hin, wollte ihr eine Hand auf die Schulter legen, aber Valya stieß sie fort.
»Seht ihr nicht, was hier passiert? Seht ihr nicht, was er versucht? Er will euch gegen mich aufbringen – damit ihr nicht merkt, dass er selbst nicht mehr ist, wer er vorgibt!«
In die folgende Stille hinein lachte Isjur leise. »Eines müssen wir Valya lassen. Jetzt sind wir alle wieder wach.«
Damar versuchte ruhig durchzuatmen. Die Wunde an seinem Arm brannte heftiger. »Seid still!«, rief er. »Seid einfach nur still! Soll La-Esh-Amon-Ri doch noch den Sieg davontragen? Das ist es doch, was er will, dass wir uns gegenseitig zerfleischen, dass unser Bund zerspringt und wir einander an die Gurgel gehen. Valya, verzeih mir meine dummen Worte. Wir sind als Freunde gekommen, und wir wollen Freunde bleiben, bis der Dämon gebannt ist und für alle Zeit danach. So lange müssen wir stark bleiben, müssen dem Schlaf widerstehen und dem Misstrauen und dürfen nichts an uns heranlassen, das unsere Einigkeit verletzen kann!«
»Glaubt ihm nicht!«, schrie Valya auf der anderen Seite. »Jetzt, wo wir ihn durchschaut haben, beschwört er unsere Einheit – geht es noch armseliger? Noch offensichtlicher?«
Damar fühlte die Blicke seiner Gefährten, die zweifelnd von Valya zu ihm und wieder zurück schauten. Damar konnte ihnen sein Wort geben, aber dasselbe würde Valya tun. Einer von ihnen log, und das war nicht Damar.
An jedem anderen Ort der Welt hätten sie darüber gelacht. Es war nicht das erste Mal, dass sie stritten. Gegen die Dämonen zu kämpfen, zehrte an ihnen, sie alle hatten Dinge gesehen und Dinge erlebt, die man keinem Menschen wünschen mochte, und manchmal wurde es einfach zu viel. Dann konnten sie einander aus dem Weg gehen, sich prügeln oder den Freund zur Seite bitten und sich an einem abgeschiedenen Ort ungestört aussprechen. Nicht so in Akar-Na-Sherosh. Hier gab es kein Ausweichen, das Misstrauen hatte Einzug gehalten zwischen ihnen, und was immer La-Esh-Amon-Ris Schwert auch mit Damars Arm gemacht haben mochte, das wahre Gift hatte sie alle befallen und ihr Vertrauen zerfressen.
Damar blickte zu Ililiané. »Sag es ihnen«, rief er. »Deine Augen sehen mehr als unsere. Sag ihnen, wer ich bin – und wer Valya.«
Ililiané hob den Kopf, und Damar fühlte, wie ihr Blick ihn durchdrang. Sie war nicht da, um Damar einen Gefallen zu tun. Sie sah die Wahrheit, sie sprach sie auch aus, und sie prüfte Damar wie Valya gleichermaßen. In diesem Augenblick waren ihre Augen beinahe schwarz, als hätte sie den schillernden Film, der sonst über ihren Tiefen schwamm, beiseitegeschoben wie einen Vorhang.
Lange sagte niemand etwas, während Ililiané von einem zum anderen blickte. Sie sah einem jeden von ihnen so direkt ins Herz, dass man es fühlen konnte. »Warum fragst du mich noch, Damar?«, sagte sie dann. »Du weißt es selbst. Deine Augen sehen, was meine sehen. Das Gift des Unaussprechlichen kreist durch deine Adern, zieht dir den Schleier von der Wirklichkeit und zeigt die Dinge als das, was sie sind. Kein gewöhnlicher Mensch ist dieser Wahrheit gewachsen, doch du bist kein gewöhnlicher Mensch mehr, Damar.«
»Also doch«, rief Valya triumphierend. »Ich wusste es! Es ist Damar –«
»Nein!« Ililianés Stimme zerschnitt den Raum. »Damars Körper ist vergiftet, nicht seine Seele. La-Esh-Amon-Ri, dessen Schwert tausend Dämonen getötet hat, bis sie ihn als ihren Ersten anerkennen mussten, hat Damar geritzt, und das Blut von tausend Dämonen kämpft in ihm gegen sein eigenes. Es wird den Sieg davontragen, doch nicht jetzt, nicht heute. Aber es lässt ihn auch sehen. Schau sie an, Damar. Öffne die Augen, und die Augen hinter deinen Augen. Sieh selbst, was aus deiner Gefährtin geworden ist. Oder wer.«
Damar atmete durch. Die Welt, seine Freunde, alles sah aus wie immer – weil Damar sie so sehen wollte? Er schloss die Augen, dann öffnete er sie langsam wieder, und es war, als wäre ein Tuch von seinem Gesicht gezogen worden. Er fühlte das Gift in seinen Adern brennen, seine Augen schmerzten, als hätte er drei Tage und Nächte nicht mehr geschlafen, und die Ecken der Welt glänzten rötlich. Doch als er jetzt seine Gefährten anschaute, sah er sie alle in ihrer wahren Gestalt. Marold, Sveta, Isjur und Astol. Dort aber, wo eben noch Valya gestanden hatte … Damar zwinkerte. Es blieb, wie es war. Die Formen von Valyas vertrauter Gestalt wurde überlagert von einer anderen: der von La-Esh-Amon-Ri.
Damar erstarrte. Er wollte so gern glauben, dass sich seine Augen täuschten, dass sich die Dämonen seines Verstandes bemächtigt hatten, dass das Gift ihn Dinge sehen ließ, die nicht da waren – doch er wusste, Ililiané sah es auch. Und die anderen …
»Valya«, sagte er laut. »Oder wer immer du jetzt sein magst – wir fallen nicht auf dich herein. Du kannst uns nicht täuschen, nicht betrügen, wir durchschauen dich, in welcher Gestalt du auch vor uns stehen magst. Gib diesen Körper frei, oder ich töte dich ein weiteres Mal. Ich töte dich, so oft es sein muss, aber du wirst mir nicht entkommen, und du wirst diesen Ort niemals wieder verlassen.«
Er hatte die Hand an seinem Schwertknauf, doch noch bevor er die Waffe ziehen konnte, griff Valya nach ihrer Axt. »Genug!«, schrie sie. »Du bist nicht Damar! Damar würde vieles tun, aber niemals die eigenen Freunde verraten, und was immer du bist, ich werde nicht zulassen, dass du noch einem meiner Freunde ein Haar krümmst!«
Damar wusste nicht, wer von ihnen beiden dieses entsetzliche Lachen anstimmte und wer den markerschütternden Schrei, aber der finstere Ort griff beides auf, warf ein Echo zurück, das bis in die Knochen zu fühlen war, und selbst die steinernen Säulen schienen zu erzittern, als Damar und Valya aufeinander zutraten. Valya, wäre sie noch sie selbst gewesen, hätte Damar angestürmt mit allem, was sie hatte, Besonnenheit war ihr Ding nicht. Doch der Dämon, der sie nun war, kämpfte anders, erfüllt von einem Hohn, der ihn glauben ließ, unbezwingbar zu sein. So hatte er auch den ersten Kampf gegen Damar verloren, ohne ihm mehr als eine Scharte verpasst zu haben. Oder hatte La-Esh-Amon-Ri seine Niederlage nur gespielt, den Körper nur aufgegeben, um sich danach Damars Gefährten holen zu können, einen nach dem anderen?
Die Formen schienen miteinander zu kämpfen, die Bilder verschwammen und überlappten sich. Valyas Körper bewegte sich anders als der Dämon, beide drifteten auseinander und verschmolzen dann wieder, eine Gestalt, zwei Gestalten, irgendwo da drinnen war immer noch die alte Valya und rang um Freiheit, doch es war zu spät. Sie, die niemals ihren Körper kampflos hergegeben hätte, hatte verloren. Es brach Damar das Herz, ihr ein Ende setzen zu müssen, aber er hatte keine Wahl. Er hob sein Schwert –
»Ihr seid ja verrückt geworden!« Sveta sprang zwischen sie, die Arme ausgebreitet, dass Damar einen Satz zurück machen musste, um sie nicht zu verletzen. Einen Augenblick später stand auch Marold da, hielt Valya bei den Armen fest, und Isjur wollte Damar packen, aber er war nicht der Stärkste, und Damar stieß ihn von sich, so weit er konnte.
»Zurück!«, schrie er. »Alle drei! Bringt euch in Sicherheit, und Astol dazu! Habt ihr Lié nicht gehört? Ihr seht nicht, was ich sehe! Das hier, das ist nicht mehr Valya. Es ist er. La-Esh-Amon-Ri.«
»Und dann soll ich ihn loslassen?«, höhnte Marold. »Wo ich ihn einmal habe? Wo du ihn nur noch –«
»Nein.« Damar fühlte sich zittern. »Wenn ich Valya eines schulde, dann einen fairen Kampf …«
»Fair?« Valya spuckte aus. »Fair? Lügen über mich verbreiten, dann tun, als ob ihr mich notschlachten müsstet – fair nennt ihr das?« Sie riss sich los, doch es war nicht Damar, auf den sie zustürmte, es war der Treppenaufgang. Und wenn sie alle eines verstanden hatten, dann, dass sie den Dämon nicht entkommen lassen durften, nicht dorthin, wo so viele Körper darauf warteten, ihn zu Pferd in die Ferne zu tragen.
Damar wusste nicht, woher er plötzlich die Kraft nahm oder die Geschwindigkeit, aber er sprang vorwärts, wie er noch nie gesprungen war, und stieß Valya sein Schwert in den Rücken. Sie brach zusammen, ehe sie die Treppe erreichte, doch ihr verzweifelter Schmerzensschrei musste bis oben zu hören sein. Damar stand wie erstarrt – so oft hatte er töten müssen, doch niemals hatte er einen fliehenden Feind von hinten niedergestreckt, und niemals einen Freund.
Valyas Schreien wurde zum Gurgeln, während die Gestalt des Dämons aus ihr zu weichen schien, verblasste, bis nur noch sie zu sehen war, reglos am Boden in einer Blutlache. Valya war tot. In diesem Augenblick war die Zeit selbst zu Stein erstarrt. Die Gefährten standen da und starrten Damar an, keiner von ihnen würde jemals begreifen, dass er keine Wahl gehabt hatte – und selbst Damar, der das alles verstand und wusste, konnte sich nicht vergeben.
Am Rand saß Ililiané, versunken in ihrem Ritual, als hätte sie nichts von alledem mitbekommen. Erst hasste Damar sie dafür – dann war er ihr dankbar. Es musste weitergehen. Sie konnten um Valya trauen, Damar konnte bereuen, doch all das erst, wenn La-Esh-Amon-Ri für alle Zeit bezwungen war. Damar hatte den Erzdämon getötet, nicht einmal, sondern zweimal, diesmal wirklich –
Und dann sah Damar sein Schwert, das Blut an der silbernen Klinge. Valya war tot. Und das Schwert war immer noch ganz.
ERSTES KAPITEL
In diesem Moment gab es nur die Magie. Enidin versuchte alles andere zu ignorieren – die Kälte, die den Winter in die Wirtsstube hineinholte, die Schritte auf der Treppe, die Angst vor dem Scheitern wie dem Gelingen gleichermaßen. Nicht daran denken. Nur Magie.
Die Kugel lag bereit, dieser schmucklose, graue Kristall, der in sich doch eine ganze Welt barg und das Abbild dreier verzweifelter Männer. Sie drängten sich eng zusammen, als wollten sie ganz sicher sein, dass jeder von ihnen gerettet werden konnte, aber auch das versuchte Enidin zu ignorieren, die Angst in ihren Augen, die Erschöpfung, die Resignation. Was die drei da fürchteten, wusste Enidin nicht, und doch verstand sie, dass diese Männer, wenn der Zauber fehlschlug, sterben würden. Und dass es vielleicht sogar das Beste war …
Enidin fühlte die Magie unter ihren Fingerspitzen, als sie zwei Welten gleichzeitig berührte. Sie griff in die Kugel, als könnte sie die drei Männer einfach mit ihren Händen packen und in die Wirtsstube ziehen, und einen Augenblick lang verspürte sie eine schneidende Eiseskälte, die ihr die Fingerspitzen lähmte. Sie war auf dem richtigen Weg –
»He! Ihr da!« Die aufgebrachte Stimme peitschte durch den Zauber hindurch in Enidins Verstand. Eben noch waren es nur Schritte an der Tür, im nächsten Augenblick packte jemand Enidin bei der Schulter. »Wer seid Ihr? Was habt Ihr in meiner Stube zu suchen?«
»Zurück!«, fauchte Enidin. »Zurück, wenn Euch euer Leben lieb ist!« Sie konnte ihre Hände nicht aus dem Zauber nehmen, doch aus ihren Augen und ihrer Stimme schossen Dolche. »Verschwindet!«
Die Wirtin ließ sie los und wich zurück. Womit auch immer sie gerechnet hatte, als sie an diesem Morgen das Feuer in der Gaststube anzünden wollte, es war bestimmt keine Magierin gewesen, die in einer himmelblauen Robe auf dem Fußboden kauerte, Prismen und eine seltsame graue Kugel vor sich ausgebreitet hatte und dabei arkane Formeln murmelte.
Die Frau konnte das Bild in der Kugel nicht sehen und nicht die Schatten menschlicher Seelen, die bereits seit Wochen in dieser Wirtsstube nachhallten. Doch als diese Schemen in der Wirtsstube zu drei wirklichen, lebendigen Menschen wurden, so als hätte Enidin ein Portal in die Welt der Dämonen aufgestoßen, da tat die Wirtin, was wohl jeder andere Mensch auch getan hätte: Sie brüllte. Wie am Spieß.
Es gab nichts, was Enidin für sie hätte tun können. Wenn sie den Zauber jetzt nicht sauber abschloss, hingen die drei Männer zwischen den Welten, halb in Neraval und halb in Ailadredan. Enidin schrie die letzte Formel, als müsste sie die Wirtin übertönen. Dem Zauber konnte das egal sein, die Wirklichkeit war ein empfindliches Ding, das auch auf ein Flüstern ansprach, doch es wollte hinaus aus Enidin, die Angst und der Zorn und die Kälte. Dennoch war alles, was sie hören konnte, das Schreien der Wirtin, und als Enidin still war, kreischte die Frau noch immer.
Enidin starrte auf die drei Männer, deren Umrisse endlich klar waren, wartete darauf, dass nun endlich Bewegung in sie kam, und hoffte mit allem, womit sie hoffen konnte, dass die Wirtin ihre Panik nahm und davonrannte. Sie musste diese Frau aus dem Weg haben, bis sie sicher sein konnte, dass sie wirklich drei Männer herbeigezaubert hatte. Und nicht zwei Männer und einen Dämon.
Der Zauber war gewirkt. Leer und verlassen lag die Kugel auf dem Boden, zeigte nichts mehr als das Spiegelbild desjenigen, der auf ihre grau glänzende Oberfläche blickte. Die Männer waren wirklich, und wo kein Zauber sie mehr hielt, brachen sie nun kraftlos in sich zusammen, fielen auf Hände und Knie und verstanden nicht, wie ihnen geschah. Sie lebten. Für den Augenblick sollte Enidin das reichen.
Sie griff nach der Kugel und sprang zur Wirtin hin, die wie eingefroren dastand, nur noch ein erstarrter, seelenloser Schrei. Enidin packte sie beim Arm und drückte ihr die Kugel in die Hand. »Hier!«, rief sie und hoffte, irgendwie zu der Frau durchdringen zu können. »Nehmt das, lauft, versenkt es im tiefsten Brunnen, in der Jauchegrube, dort, wo kein Mensch es jemals wiederfinden kann!«
Die Wirtin zitterte. Ihr Mund stand offen, und alles Blut schien aus ihrem Gesicht gewichen, aber endlich kam Leben in sie. Sie ließ die Kugel fallen, stürzte zur Tür, riss sie auf und rannte, in Nachthemd und Holzpantinen, hinaus in die winterliche Morgendämmerung von Trastell.
Enidin fluchte. Sie musste die Kugel loswerden, auf schnellstem Wege, bevor die Alfeyn sie noch damit wiederfinden konnten – falls die nicht ohnehin längst Bescheid wussten. Mit dem Fuß versetzte sie dem Ding einen beherzten Tritt, dass es in Richtung Küche rollte, und wie aus dem Nichts stürzte sich eine dicke, graugetigerte Katze darauf. Es sollte Enidin recht sein. Wer immer noch so ein Gegenstück zu dieser Kugel besaß, konnte jetzt der Katze zuschauen. Zurück zu den drei Männern …
Sie waren noch genau da, wo Enidin sie zurückgelassen hatte. Lorcan lag am Boden, flach auf dem Bauch, und schien zu schwach, sich auch nur aufzustemmen. Seine Augen waren wach, und er atmete mit sichtbarer Anstrengung, doch als Enidin versuchte, ihm aufzuhelfen, schüttelte er den Kopf.
»Es geht schon«, stieß er hervor. »Kümmert Euch um die anderen!«
Denen schien es nur unwesentlich besser zu gehen. Kevron lag auf der Seite, zusammengerollt, die Arme um den Körper geschlungen, aber was seinen Anblick wirklich zu einem Bild des Schreckens machte, war, dass er von oben bis unten voll Blut war. Ein Teil davon mochte alt sein; als Enidin ihn zuletzt gesehen hatte, war Kevrons Jacke bereits blutgetränkt, und da er keine andere besaß, trug er sie noch immer. Nun aber waren auch sein Gesicht, seine Hände und Haare blutverschmiert. Er brachte ein schiefes Grinsen zustande, das ihn viel Kraft zu kosten schien. »Jetzt sind wir quitt, was?«, flüsterte er.
»Ich habe mich nie richtig –«, fing Enidin an, doch Kevron zischte durch die Zähne und deutete mit dem Kinn auf Tymur. Und damit konnte sich Enidin nicht mehr davor drücken.
Tymur Damarel. Prinz von Neraval. Schönster Mann der Welt. Mörder. Dämon. Und nun, dank Enidin, zurück in der Menschenwelt. Es konnte der größte Fehler sein, den sie jemals begangen hatte. Tymur kniete am Boden, versuchte, sich auf die Beine zu kämpfen, und als Enidin ihn ansah, erwiderte er ihren Blick und lächelte.
»Enid«, sagte er, und auch seine sonst so sanfte Stimme war nur noch ein heiseres Krächzen. »Ich sollte dir böse sein, wie du uns in Ailadredan hast sitzen lassen, aber jetzt verdienst du nichts mehr als mein innigstes Dankeschön.« Er versuchte eine Hand nach Enidin auszustrecken, doch er brauchte sie, um sich abzustützen, und wäre um ein Haar zusammengebrochen, ohne dabei dieses Lächeln zu verlieren.
»Was seid Ihr?«, fragte Enidin. »Wer seid Ihr wirklich?« Erwartete sie eine ehrliche Antwort? Tymur, der lächeln konnte, immer lächeln, und der doch kein Wort sprach, das nicht gelogen war – durfte sie jetzt die Wahrheit von ihm erwarten, nur weil sie ihm das Leben gerettet hatte?
Tymur senkte seinen Blick. »Ich bin es nur«, flüsterte er. »Und die Betonung liegt auf dem Nur. Hast du erwartet, an meiner Stelle einen Dämon anzutreffen?« Ein rauher Husten schüttelte ihn. »Ich muss dich enttäuschen. Er ist nicht hier. Er war es nie.«
Enidin nickte nur langsam. Konnte sie ihm glauben? Sie wusste es nicht. Aber sie nahm es als Versprechen, dass er zumindest nicht versuchen würde, der armen Wirtin etwas anzutun. Was war aus der Frau geworden? Die Tür stand immer noch offen, irgendwo draußen hörte man Hilferufe …
Einen Moment lang war Enidin versucht, hinterherzurennen, dem ganzen Dorf zu versichern, dass alles in Ordnung war, sie waren es doch nur, kein Grund zur Furcht, alles in Ordnung – aber da griff Tymur nach dem Saum ihrer Robe und hielt sie fest.
»Hilf mir!«, stieß er hervor. »Bitte.«
›Ich habe Euch schon geholfen‹, lag es Enidin auf der Zunge, doch stattdessen hörte sie sich fragen: »Was kann ich tun?«
»Mach Feuer im Kamin. Schließ die Tür. Wir sind fast erfroren. Ich kann nicht aufstehen, ich fühle meine Beine nicht mehr, und wenn das schon für mich gilt …«
»Immerhin fühlt Ihr noch Eure Zunge«, erwiderte Enidin und versuchte sich an einem Lachen, während sie sich innerlich verfluchte. Warum hatte sie nicht längst das Feuer im Kamin angezündet? Schnell zog sie die Tür zu. Von der Wirtin war weit und breit nichts mehr zu sehen, sie musste Unterschlupf gefunden haben, ihr Bruder lebte nur wenige Häuser entfernt, dort konnte sie sich aufwärmen, wieder zu Besinnung kommen und begreifen, dass sie diese vermeintlichen Dämonen kannte, dass alles in Ordnung war. Feuer. Sofort.
Der Kamin in der Gaststube war mächtig, groß genug, dass seine Wärme für das ganze Haus reichte. Jetzt lag darin nur noch ein Haufen grauer Asche, aber Enidin sah Reisig zum Zündeln, behauene Scheite daneben, und hatte nicht Kevron immer ein Feuerzeug dabei? Hektik überkam sie. Die Männer hatten bis jetzt überlebt, dann würden sie nicht ausgerechnet in den drei Minuten, in denen Enidin für Feuer sorgte, erfrieren. Aber plötzlich brach alles über ihr zusammen – die Magie war gewirkt, und wo es eben um Zahlen ging, um Symmetrie, um Theorie, gab es jetzt nur noch Menschen, Kälte und Angst.
In nervöser Panik rannte Enidin hin und her. Wenn das alles eine Falle war? Wenn Ervanka gewollt hatte, dass Enidin die Kugel stahl? Wenn es nur darum ging, La-Esh-Amon-Ri zurück in die Menschenwelt zu holen?
»Enid. Enidin. Hör mir zu!« Selbst jetzt hatte Tymurs Stimme nichts von ihrer beschwörenden Kraft verloren. »Keine Angst. Nimm den Schürhaken. Es ist noch Glut unter der Asche. Alles ist gut. Du hast uns das Leben gerettet, du musst mich nicht fürchten, es gibt hier keinen Dämon –«
»Ihr versteht nicht!«, schrie Enidin, so laut, dass selbst die Katze im Nebenraum einen Satz machte. »Nichts ist gut! Sie sind in Neraval, die Dämonen! Meine ganze Akademie ist voll von ihnen. Und der Königshof, Euer Vater, Eure Brüder – sie gehören alle auch dazu!«
Wann immer Enidin versucht hatte, diese Geschichte zu erzählen, die Leute zu warnen, war sie ausgelacht worden – von den Novizinnen ihrer Akademie, von den Schwestern und sogar von den Dämonen selbst, den Alfeyn oder wie immer sie sich gerade nennen mochten. Und Tymur tat dasselbe: Er brach in Gelächter aus, hohles, heiseres Gelächter. Aber es war nicht Enidin, über die er lachte. Es war die Welt.
»Ich wusste es!«, rief er und schaffte es dabei tatsächlich, auf die Füße zu kommen und einen Schritt in ihre Richtung zu stolpern, dass Enidin mechanisch nach dem Schürhaken griff und dann hastig anfing, damit in der Asche zu stochern. Tatsächlich: Dort, gut zugedeckt, um die Nacht zu überstehen, schwelte immer noch die Glut, Funken stoben, als Enidin Luft darunterwirbelte, und sie hielt schnell ein Büschel Reisig hinein, damit es brennen konnte.
»Ich wusste es!«, rief Tymur und stützte sich an einem dicken Balken ab. »Mein Vater, meine vermaledeiten Brüder – und die ganze Zeit über habe ich mir eingebildet, ich selbst wäre der Dämon!« Sein Lachen klang, als habe er in Ailadredan nicht nur seine Stimme zurückgelassen, sondern auch seinen Verstand. »Und ich reise bis ans Ende der Welt und darüber hinaus, statt zu Hause zu bleiben und zu tun, was ich zu tun habe!« Er wandte seinen Kopf dem Feuer zu, und seine fast schwarzen Augen schienen zu glühen. Niemals hatte er mehr wie ein Dämon ausgesehen als in diesem Moment.
»Wenigstens … wenigstens glaubt Ihr mir«, sagte Enidin und legte vorsichtig das erste Scheit ins Feuer, dann noch zwei hinterher. Drei Scheite für drei Männer, das sollte erst einmal reichen, sie wollte das kleine Feuerchen nicht überfordern. Aus den Ecken der Wirtsstube trug Enidin die größten Lehnstühle herbei, die das Haus zu bieten hatte, und stellte sie vor dem Kamin auf, half Tymur, sich in einem davon niederzulassen, und wollte als Nächstes Kevron holen, da versuchte Tymur schon wieder aufzustehen.
»Nicht den hier … Lorcan muss in der Mitte sitzen, ich nehme diesen hier rechts, da sitze ich gut.«
Enidin seufzte, half dem Prinzen in den Stuhl seiner Wahl und fragte sich, was in Ailadredan wohl geschehen war. Der Tymur, den sie kannte, musste immer im Mittelpunkt stehen. Doch jetzt, im Schein des Feuers, war unübersehbar, dass dieser Tymur nur noch ein Schatten seiner selbst war, schmutzig und abgerissen, mit tiefen dunklen Ringen unter den Augen und fahlen, unrasierten Wangen. Und mehr als das: Seine Haltung hatte sich verändert, er wirkte kleiner als zuvor, so als hätte Enidin vergessen, seinen Stolz, der ihm eine Handbreit Größe geschenkt hatte, mitzuportieren.
Es stand ihm nicht schlecht zu Gesicht. Nur wenn er kein Dämon war und nie einer gewesen: Warum hatte er dann Ililiané getötet? Enidin musste wachsam bleiben. Aber Lorcan und Kevron waren auch noch da. Und sie konnten Enidins Hilfe mindestens so dringend brauchen wie Tymur.
Kevron vom Boden aufzuhelfen war nicht schwer. Es kostete Enidin Überwindung, ihm die Hand zu reichen, das Blut schreckte sie mehr ab, als sie zugeben mochte, dann aber stand er. Er musste sich bei ihr abstützen, die Füße klappten ihm weg und die Knie gleich mit, aber er war ein Stückchen kleiner als Enidin und schmal gebaut. Kevron sagte nichts bis auf ein sehr leises »Danke«, doch als sie die Stühle erreicht hatten, schob er den seinen zur anderen Seite des Kamins, so weit weg von Tymur, wie er es konnte, ohne dabei die Wärme des Feuers zu verlieren.
Enidin fragte nicht, was das zu bedeuten hatte. Zuvor galt es, Lorcan aufzurichten, der in allem das Gegenteil von Kevron war. Er war groß. Er war schwer. Und er ließ sich nicht gern helfen.
»Es geht schon«, brachte er heraus, und Enidin musste sich auf die Zunge beißen, um ihn nicht anzuschreien, dass er sich gefälligst nicht so anstellen sollte. Aber war es verwunderlich, wenn er die größten Schmerzen von allen hatte? Enidin war aus Ailadredan geflohen, ohne zu wissen, ob Lorcan überhaupt noch lebte. Und wenn ihm sein Stolz dort geholfen hatte zu überleben, sollte er ihn auch jetzt behalten dürfen.
Drei halberfrorene Männer saßen am Kamin, streckten ihre Füße in Richtung Feuer, bis es nach angekokeltem Leder roch, und waren ansonsten kaum in der Lage, auch nur einen Finger zu rühren. Einer von ihnen war vielleicht ein Dämon. Einer war verwundet. Einer war ein Feigling. Enidin musste alles, was sie an Hoffnung hatte, zusammennehmen, um sich vorzustellen, dass sie gemeinsam etwas gegen die Alfeyn ausrichten konnten, dass diese drei nicht am Ende mehr Hindernis als Hilfe waren … Eines jedoch stand fest: Ohne Enidin wären die drei gestorben. Wenn man die Welt retten wollte, musste man irgendwo anfangen.
»Geht es besser?«, fragte Enidin, immer noch nervös. »Ich kann mehr Holz aufs Feuer legen, wenn das hilft – oder warme Decken, ich kann schauen, was in den Gästezimmern herumliegt … Tee! Würde Euch ein warmer Tee helfen? Wenn die Wirtin nur endlich wiederkäme!«
Diesmal war es Kevron, der zu lachen anfing. »Die Wirtin!«, rief er. »Was erwartest du denn? Wenn du uns von allen unfreundlichen Orten der Welt ausgerechnet nach Trastell holst …«
»Sie wird sich bestimmt wieder beruhigen«, antwortete Enidin. »Sie kennt uns ja. Ich hatte nur so wenig Zeit, vielleicht hätte ich sie wecken sollen und ihr erklären, was ich vorhabe, aber wenn Ihr währenddessen erfroren wäret –«
Draußen war es still, und langsam wurde Enidin das unheimlich. Wenn die Wirtin jetzt bei ihrem Bruder war, würde sie da erst einmal in Ruhe frühstücken oder nicht doch lieber herausfinden wollen, was da gerade in ihrer Wirtsstube passierte?
»Wartet hier kurz«, sagte sie. »Ich … ich gehe nachschauen.« Zu den dicken Butzenscheiben schien bereits goldene Morgensonne herein, als Enidin an die Tür trat, diese öffnete und auf der Schwelle erstarrte. Das Goldene, das war nicht die Sonne. Das Komitee schwertbewehrter Alfeyn, das sie einst in Ailadredan willkommen geheißen hatte, suchte zwar immer noch seinesgleichen, aber was dieses an kühler Anmut voraushatte, machte das Volk von Trastell mit seiner wütenden Entschlossenheit wett. Und mit seinen brennenden Fackeln.
Bestimmt vierzig, fünfzig Menschen hatten sich auf dem Marktplatz versammelt, Männer, Frauen, sogar Kinder. Die Wirtin war unter ihnen mit ihrem Bruder, nur die schnauzbärtige Gestalt des Schulzen sah Enidin nirgendwo. Einige hielten Waffen in den Händen, andere das, womit sie morgens in die Felder zogen, Spaten, Sensen, anderes Gerät, dessen Namen Enidin nicht einmal kannte.
»Da ist die Hexe!«, brüllte einer. »Was wartet ihr? Räuchert sie aus, ehe sie uns noch mehr Dämonen ruft!«
Enidin beneidete Lorcan um seine breiten Schultern, aber es musste auch so gehen. »Bürger von Trastell!«, rief sie. »Fürchtet euch nicht! Es sind keine Dämonen in eurem Dorf. Ich bin die Magierin Enidin Adramel!«
Weiter kam sie nicht, als ein Stein in ihre Richtung flog. Plötzlich war sie froh um ihre schmale Statur. Aber sie rührte sie nicht von der Stelle.
»Komm raus!«, johlte jemand. »Kommt alle raus, bevor wir Ernst machen!«
»Seid doch vernünftig!«, rief Enidin. »Ihr wollt doch nicht wirklich euer eigenes Dorf in Brand setzen?« Ihr Herz hämmerte. Ein zweites Wurfgeschoss traf sie am Bein – es war nur ein Apfel, aber scharf geworfen tat er weh. Mit zitternden Händen löste Enidin ihren Schleier. Wenn die Menschen erst einmal ihr Gesicht sehen konnten … Enidin war gut mit Worten. Sie war nur schlecht mit Leuten.
»Enid. Warte.« Von hinten kam eine Hand und schob Enidin zur Seite. Da stand Tymur, lehnte sich gegen den Türrahmen und konnte sich trotzdem nur mit Mühe auf den Beinen halten. »Bring dich in Sicherheit. Ich rede mit ihnen.«
»Da! Da ist noch einer!«, schrie jemand.
Tymur lachte. »Einer!«, rief er zurück, und die Wärme des Kamins musste seiner Stimme gutgetan haben. »Seht mich an! Ich bin es, Tymur Damarel, euer aller Lieblingsprinz, zurück in euren gastlichen Gefilden! Ihr kennt mich und meine Gefährten. Ihr wisst, wir nehmen niemals die Tür, wenn wir auch einen dramatischeren Auftritt haben können, aber Dämonen sind wir keine, das gebe ich euch mit Brief und Siegel!« Er hustete vor Anstrengung. Mit der freien Hand fuhr er sich durch das staubige, unordentliche Haar, und es war so eine typische Geste von ihm, dass Enidin bei ihrem Anblick ein Stechen in ihrem Herzen fühlte, dort, wo sie ihn vielleicht einmal ein bisschen geliebt hatte. Sie tat es längst nicht mehr. Aber es schmerzte dennoch.
Einer aus der Menge trat vor, er führte ein Schwert, das machte ihn mutiger als die anderen. »Komm raus!«, rief er. »Ich fürchte dich nicht! Komm raus und sag deinen Kumpanen, sie sollen sich zeigen, sonst zünden wir euch das Dach an.«
»Nicht anzünden!«, rief jemand weiter hinten, das war die arme Wirtin. »Ich hab das doch nicht so gemeint …«
Aber die Menge rückte näher, und der junge Bursche mit dem Schwert machte noch einen Schritt und noch einen.
»Auch gut!« Tymur hustete wieder. »Dann muss ich nicht so brüllen. Kommt heran, heran, Leute, seht mich an. Da! Mein Gesicht. Ihr kennt mich. Schulze! Wo ist der Schulze?«
Es schien nicht mehr viel Stimme in Tymur zu sein, aber auch gar keine Furcht – das sah ihm ähnlich. Tymur war einer, der die Dinge nicht ernst nahm, der lachte bis zum Schluss, und auch ohne viel von Menschen zu verstehen, wusste Enidin, dass Lachen jetzt falscher nicht hätte sein können.
Der Bursche mit dem Schwert streckte die Waffe von sich weg, dass es mehr aussah, als wollte er ihnen sein Erbstück vorführen. Enidin hatte Lorcan oft genug morgens mit dem Schwert trainieren sehen, sie verstand, dass dieser hier kein Kämpfer war, aber dem Mann selbst war das gleich, und sein Zorn machte wett, was ihm an Kampfkunst abging.
»Wenn ihr keine Dämonen seid«, schrie er, »wo ist dann meine Schwester? Wo ist mein Vetter? Was habt ihr mit meinem Onkel gemacht, ihr Schweine?«
Enidin wich zurück. Bis dahin hatte sie geglaubt, die Leute wären auf den Beinen, weil sonst nie etwas passierte in ihrem Dorf, weil sie sich nach dem großen Krawall sehnten. Jetzt aber verstand sie, dass die Welt nicht nur in der Hauptstadt aus den Fugen war. Die Dämonen waren zurück, auch in Trastell, und genauso, wie Enidin wusste, dass sich hinter der vertrauten Gestalt der Ehrwürdigen Frau Mutter etwas anderes verbarg, wähnte man sie hier auch in ihnen. Enidin und Tymur waren keine Dämonen. Aber dieses Mal würde ihnen das niemand mehr abkaufen.
Enidin schob sich an Tymur vorbei und trat vor das Haus, die Hände leer und offen. »Da!«, rief sie. »Ich bin draußen, wie ihr es gewünscht habt. Kein Dämon, nur ein Mensch – zeigt, dass auch ihr Menschen seid, und tut uns nichts!«
Das hätte sie nicht sagen dürfen. Panik überkam sie. Was, wenn das hier keine Menschen mehr waren, wenn hinter den Fackeln längst die Fratzen der Dämonen grinsten? Enidin begann zu zittern, und vor ihr stand der Bursche mit dem Schwert.
In seinen Augen stand Angst. Er hatte nicht mit Erfolg gerechnet, er hatte drohen wollen, und jetzt stand Enidin direkt vor ihm. Er holte aus. »Zurück!«, schrie er, dass sich seine Stimme überschlug. »Keinen Schritt näher, Hexe!«
Enidin erstarrte. Vor, zurück, alles war falsch. Sie wollte es diesen Leuten ja recht machen, ihnen geben, was sie haben wollten, damit die das Wirtshaus und die Männer darin verschonten, und jetzt stand sie selbst da, eingefroren vor Angst. Er drohte ihr nur, er würde niemals –
Der Moment, in dem der Mann vorwärts sprang, war derjenige, in dem sich von hinten jemand auf Enidin stürzte und sie aus dem Weg stieß. Sie fiel zu Boden, und die Klinge des Schwertes zog über sie hinweg und traf Tymur, der Enidin mit seinem Körper schützte, mitten in die Schulter.
Enidin landete der Länge nach auf dem kalten Boden. Das Schwert hatte sie vielleicht verfehlt, aber von Tymur mit aller Gewalt in den Rücken gerempelt zu werden, war schon schmerzhaft genug, und als der Prinz dann auf ihr landete, raubte es ihr den Atem. Sie biss sich auf die Zunge, um nicht aufzuschreien. Wenn einer schreien durfte, dann höchstens Tymur. Und der war still.
Einen Augenblick lang fürchtete Enidin, Tymur könnte bewusstlos sein, ernsthaft verletzt, vielleicht sogar tot. Sie hatte mitansehen müssen, wie Lorcan direkt in ein Schwert stürzte; dass er es überlebt hatte, war ein Wunder, das sich kaum wiederholen würde.
Doch da kam auch schon wieder Bewegung in Tymur. Er stemmte sich vom Boden hoch, dass Enidin unter ihm hervorkrabbeln konnte, kalt, nass, schmutzig und mit geknickter Würde, aber bis auf ein paar blaue Flecken unversehrt. Tymur selbst hielt sich die Schulter, aber Blut sah Enidin keines. Und der Mann mit dem Schwert stand daneben, starrte auf sie hinunter mit solch bestürztem Gesicht, als könnte er selbst am wenigsten verstehen, was er da gerade getan hatte. Hatte er zuvor bereits jung ausgesehen, so war er jetzt bestenfalls noch ein halbes Kind mit einem Schwert, das viel zu groß für ihn war.
»Das … das wollte ich nicht«, stammelte er.
»Natürlich nicht«, zischte Tymur, ohne seine Schulter loszulassen, und kämpfte sich auf die Füße. »Du wolltest sie treffen, nicht mich.«
»Nein, ich meine – ich wollte nicht …« Der Bursche ließ das Schwert fallen und bot Enidin seinen Arm, um ihr aufzuhelfen, doch sie schüttelte den Kopf.
»Schlag zu!«, brüllte jemand von hinten. »Worauf wartest du? Du hast ihn, du hast sie beide!«
Einen Augenblick lang dachte Enidin, dass es das war, dass die Meute mit den Knüppeln und Fackeln nun vorwärtsstürmen würde, vollenden, woran der Bursche gescheitert war. Doch im gleichen Moment ertönte von hinten: »Zurück! Auseinander! Aufhören! Habt ihr den Verstand verloren? Auseinander, sage ich!«
Die Leute wichen zurück, als sich ein Mann den Weg nach vorn bahnte. Endlich, der Schulze.
»Was geht hier vor? Was soll der Aufstand? Habe ich euch nicht schon hundertmal gesagt, hier gibt es keine Dämonen?« Er blickte Tymur an, dann Enidin und schüttelte den Kopf. »Ihr schon wieder! Was müsst Ihr ständig Unruhe anzetteln?«
»Ah, der Schulze.« Tymur lachte durch die Zähne, die Hand immer noch an seiner Schulter. »Wenigstes einer, der uns erkennt! Gut. Jetzt stellt Ihr Euch hier hin, genau hier, und sagt Euren Leuten, wer wir sind. Und dass sie gerade ein Schwert in den Sohn des Königs gerammt haben.«
Der junge Mann, der es geführt hatte, wurde noch blasser und sah aus, als ob er gleich zu weinen beginnen würde. »Es tut mir leid!«
»Leid?«, schnaubte der Schulze. »Leid? Willst du das dem König sagen, dass es dir leidtut? Hast du vergessen, was im Herbst geschehen ist? Ich musste ihm einen Brief schreiben, dem König, und um Vergebung bitten, dass ihr mir fast seinen Sohn erschlagen hättet – und jetzt geht ihr Rindviecher hin und erschlagt ihn mir noch mal?« Er schüttelte den Kopf, fassungslos. »Entschuldigt, Hoheit. Hat er Euch wirklich getroffen? Seid Ihr schwer verwundet?«
Tymur senkte Blick und Stimme. »Wenn ich schwer verwundet wäre, stünde ich kaum hier. Der Lümmel hat mich nur geritzt. Aber wäre ich nicht dazwischengesprungen, Enidin hier wäre tot.«
Der Bursche schrumpfte noch etwas weiter in sich zusammen, dann schien er die Scham abzuschütteln wie eine Wespe, die ihm unter den Kragen gekrochen war. »Hab nur versucht, das Dorf zu verteidigen, ja, das hab ich!«, rief er. »Was ist denn passiert, seit die das letzte Mal hier gewesen sind? Können mir zehnmal der Sohn vom König sein, Unheil haben sie über uns gebracht, damals, und jetzt sind sie wieder da! Gudras hat gesehen, mit ihren eigenen Augen, wie sie« – er deutete auf Enidin – »was in die Stube beschworen hat – und wo warst du, Schulze, um uns zu beschützen? Wo?«
»Ich kann dir genau sagen, wo der Schulze war«, antwortete Tymur sanft. »Er war in seinem Haus, am Fenster, hinter der Gardine, um abzuwarten, damit er hinterher sagen kann, er hat mit alledem nichts zu tun. Ist es nicht so, Schulze?«
Der Schulze hob abwehrend die Hände, aber derart enttarnt vor seinem ganzen Dorf, schrumpfte er in sich zusammen wie ein leerer Blasebalg. »Wie könnt Ihr das denken! Ich habe den Leuten gesagt, sie sollen Ruhe geben, es ist nichts, dieses Frauenzimmer von Wirtin sieht Dämonen, wo keine sind – was kann ich tun, wenn niemand auf mich hört?«
Tymur hob die Mundwinkel. »Auch das kann ich Euch sagen«, sagte er. »Zurücktreten als Schulze. Wenn das Eure Autorität im Dorf ist, bewundert für nichts als einen prachtvollen Schnauz, ausgelacht von den eigenen Leuten – was ist denn, wenn sie recht haben? Nicht wir sind die Dämonen, natürlich – aber es gibt sie wirklich. Im Herbst habt Ihr selbst mir noch erklärt, dass sie in den Bergen leben, und mich verhöhnt, als ich Euch nicht glauben wollte, und jetzt? Wollt Ihr zögern, bis Eure Leute in ihrer Verzweiflung bereit sind, das eigene Dorf abzufackeln?«
Er deutete auf den Burschen mit dem Schwert. »Er hier will wissen, wo seine Schwester geblieben ist, und ich bin nicht derjenige, ihm Antwort zu geben.« Er schüttelte anklagend den Kopf. »Euer Dorf braucht Euch, Schulze – lasst sie nicht im Stich, wenn es am dringendsten ist. Außer in diesem Moment. Da brauchen wir Euch und Eure Hilfe dringender als jeder andere hier.«
Wie er es geschafft hatte, so schnell mit nichts als Worten vom verhassten Dämonenführer zum Beschützer des Dorfes zu werden, würde Enidin so schnell nicht erfahren, aber sie sah die Leute bei Tymurs Worten nicken. Er verstand sie, wo es ihr Schulze nicht tat, und das war endlich ein Grund, die Fackeln und Hacken sinken zu lassen. Da stand Tymur, immer noch mit der Hand an seiner Schulter, und sein Schmerz machte ihn nur umso wahrhaftiger.
Er wandte sich zum Gehen und stolperte dabei. »Begleitet mich in die Gaststube, Schulze, und sammelt unterwegs Eure Wirtin wieder ein. Sie soll sich mit eigenen Augen überzeugen, dass sie uns nicht fürchten muss, und uns dann ein warmes Frühstück bereiten und ein Bad, so heiß es irgendwie geht. Die Lage ist ernst, Schulze, hier und überall, so ernst, dass ich Euch erst in der Verschwiegenheit Eures eigenen Hauses ins Vertrauen ziehen werde – diesmal werden wir nicht im Gasthaus nächtigen. Diesmal werden wir Eure Gäste sein. Wir können nicht zulassen, dass uns jemand in Brand setzt oder mit einem Schwert durchbohrt. Bei Euch wird uns das nicht passieren.«
Der Schulze drehte sich auf der Stelle. Schaute zu seinem schönen großen Haus, zum Wirtshaus, zum Prinzen und sah aus, als bereute er nichts mehr, als dass die Fremdlinge nicht doch zu Schutt und Asche verbrannt worden waren. »Ja«, machte er. »Ja, also. Also nein. Ja.«
»Zum Gasthaus, wenn ich bitten darf.« Tymur winkte ihn näher heran. »Oder wenn bei Euch bereits ein Feuer im Kamin brennt, nehmt uns direkt mit zu Eurem Haus. Je mehr ich darüber nachdenke, desto wichtiger ist das, was ich Euch zu sagen habe, selbst im Vergleich zu einem Bad. Auch wenn meine Gefährten und ich das wirklich sehr dringend nötig haben, halberfroren, wie wir sind.«
Zum Wirtshaus zurück waren es nur wenige Schritte, zum Haus des Schulzen musste man quer über den Platz, und jeder Schritt schien Tymur größte Probleme zu bereiten – doch er marschierte los, ohne auch nur eine Einladung abzuwarten.
Enidin wollte schon hinterherlaufen, aber da hielt sie der Bursche mit dem Schwert am Arm zurück. »Ihr – Ihr seid wirklich eine Zauberin, oder?«
Enidin schenkte ihm einen strafenden Blick und riss sich los. »Denkt Ihr, ich hätte Euch nur ein Haar gekrümmt? Ich bin eine Magierin. Von der Akademie der Lüfte, spezialisiert auf magische Portale. Ich bin keine Hexe, keine Beschwörerin. Und ich habe Euch keinen, wirklich keinen Grund gegeben, Euer Schwert gegen mich zu erheben.«
Der Bursche blickte zu Boden. »Es ist nicht einmal mein Schwert«, sagte er.
»Ich weiß.« Enidin verzog kein Gesicht. »Wenn Ihr damit umgehen könntet, wären entweder Prinz Tymur oder ich tot. Muss ich mich jetzt bedanken, dass Ihr ein Stümper seid?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein. Ich wollte nur sagen – wir haben Angst. Wirklich Angst. Unser Dorf ist verflucht. Ich verstehe nichts von Magie, aber als Ihr im Herbst hier wart, mit Eurem Zauber und was weiß ich nicht noch alles … Seid Ihr sicher, dass Ihr die Portale da wirklich wieder zugemacht habt? Weil ich glaube, es ist was rausgekommen …«
Enidin atmete durch. »Nicht durch mein Portal«, sagte sie. »Darauf gebe ich Euch mein Wort. Aber was den Rest angeht … Ihr habt ein Schwert. Seht zu, dass Ihr jemanden findet, der Euch beibringt, wie man damit umgeht. Ich will nicht sagen, dass Ihr es brauchen werdet, aber – nein, das stimmt nicht. Ich will Euch nicht anlügen. Ihr werdet es brauchen. Bald. Nur nicht gegen mich und meine Gefährten.«
»Aber gegen Dämonen«, sagte er leise und blickte vorsichtig in die Richtung, in die der Schulze mit Tymur verschwunden war.
Enidin sah den Mann an und das Schwert und brachte es nicht über sich, ihm die Wahrheit zu sagen. Dass er mit dieser Waffe, die er da geerbt oder gefunden hatte, vielleicht Tymur oder Enidin totschlagen, aber gegen einen echten Dämon nichts ausrichten konnte. Damar vor tausend Jahren, Damar hatte ein Schwert aus Eissilber, das La-Esh-Amon-Ri töten konnte. Diese Zeiten waren vorbei. Diejenigen, die jetzt Silberschwerter führten, waren die, die sie fürchten mussten. Aber es war doch besser, wenn der Mann zumindest daran glaubte. Mit hilfloser Angst war nichts gewonnen.
»Lernt, Euer Schwert zu gebrauchen«, wiederholte sie. »Aber wenn Ihr wissen wollt, was noch wichtiger ist: Benutzt Euren Kopf.«
Der Bursche biss sich auf die Lippe, dann nickte er. »Ihr seid deswegen zurückgekommen, oder?«, fragte er. »Um uns zu helfen. Und wir haben Euch …«
»Ja«, antwortete Enidin knapp. Sie zwinkerte, als sie verstand, dass sie allein waren. Tymur war mit dem Schulzen verschwunden, die Wirtin nicht mehr zu sehen, und auch der Mob mit den Fackeln hatte sich zurückgezogen, so lautlos, als wäre das ganze Dorf vor Scham im Boden versunken. »Aber zunächst einmal, da hat Prinz Tymur nicht übertrieben, sind wir es, die eure Hilfe brauchen. Wenn Ihr das von gerade eben wiedergutmachen wollt, dann packt mit an. Ich habe zwei Gefährten, die vor Schmerzen kaum laufen können, in der Wirtsstube am Kamin sitzen. Die müssen zum Haus des Schulzen. Und egal, ob Ihr etwas von Eurem Schwert versteht – Ihr habt kräftige Arme.«
Jetzt lachte der Bursche. Er sah erleichtert aus. »Wenn es weiter nichts ist«, sagte er und streckte Enidin seine Hand hin. »Wenn ich Euer Wort habe, dass Ihr alles tut, um meine Schwester wiederzufinden, meinen Vetter, all die Leute, die nicht mehr da sind …« Er wartete keine Antwort mehr ab, hatte sie sich längst selbst gegeben. Fremde waren im Dorf. Man konnte die ganze Angst an ihnen auslassen oder aber alle Hoffnung in sie setzen, dazwischen gab es nichts. »Zu Euren Diensten. Ich bin Tasko.«