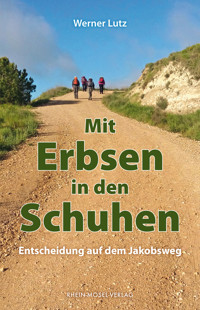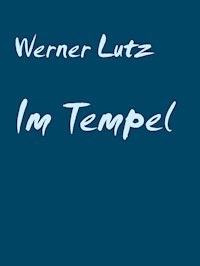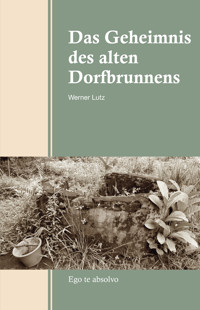
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bei einem waghalsigen Tauchgang in einen vergessenen alten Dorfbrunnen schafft Georg nicht nur altes Geschirr und Weltkriegsmunition aus dem jahrhundertealten Schlick ans Tageslicht, sondern auch spektakuläres Diebesgut und eine versiegelte Flasche mit einem Brief. Dieser Brief, ein anonymes Bekennerschreiben zu einem vor Jahren begangenen Verbrechen, ist von dem Täter mit dem Großbuchstaben A unterzeichnet. Auf der Suche nach dem vielleicht noch lebenden Täter geraten Georg und seine vier Freunde in eine Abfolge dramatischer Geschehnisse. Ihre ansonsten langweiligen Sommerferien werden zu einer gefährlichen Reise in die Vergangenheit ihres Eifeldorfes und seiner Bewohner, deren Geheimnisse menschliche Schwächen und Versagen aber auch menschliche Größe offenbaren. Der Autor versetzt den Leser durch seine bildhafte und lebendige Sprache in die sechziger Jahre und lässt ihn teilhaben an jugendlichen Abenteuern und geheimnisvollen Geschehnissen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2025 – e-book-AusgabeRHEIN-MOSEL-VERLAGBundesbahnhof 1, 56859 Bullay/MoselDeutschlandTel.: 06542/5151E-Mail: [email protected] Rechte vorbehaltenISBN 978-3-89801-958-3Lektorat: Gabriele Korn-SteinmetzKorrektorat: Melanie Oster-DaumAusstattung: Stefanie ThurFirdaus Aulia Rahman/shutterstock.com
Werner Lutz
Das Geheimnis des alten Dorfbrunnens
Ego te absolvo
Roman
Rhein-Mosel-Verlag
Ben
Ich wusste, dass es keine gewöhnlichen Sommerferien sein würden, die gerade begonnen hatten. Keine Ferien mit langem Schlafen, Fußballspielen oder auf der Lay im Dorf den Tag verdösen. Die Lay war ein felsiges brach liegendes Grundstück neben der Kirche, wo sich die Jugend unseres Dorfes immer traf. Ich musste mir keine Gedanken darüber machen, die Langeweile eines Eifeldorfes zu bekämpfen, war ich doch für Wichtigeres vorgesehen und brauchte mich um »Müßiggang«, wie Vater das bezeichnete, nicht zu kümmern.
Zwar würde ich mehr Freizeit haben, um mit meinen Freunden zu spielen, aber da unser Geselle Hans ab Montag für zwei Wochen Urlaub fuhr, war mir klar, dass zumindest für diesen Zeitraum Ferienspaß und Freizeit stark eingeschränkt wären. Der Ersatzgeselle für die Backstube war ich.
Es war also klar, dass sich für die nächsten zwei Wochen mein Tagesablauf ändern würde. Danach erst begännen die wirklichen Ferien für mich.
Was ich nicht wusste, war, dass sich mit diesen Sommerferien Ereignisse und Geschehnisse entwickeln würden, deren Weitwirkung ich nie hätte abschätzen können. Geschehnisse, die nicht nur mein Heimatdorf in Aufregung und Bestürzung brachten, sondern auch die Freundschaft mit meinen Freunden auf eine harte Probe stellten. Ja, sie fast zum Zerbrechen brachte.
Geheimnisse und Totgeschwiegenes kamen plötzlich ans Tageslicht, längst Vergessenes tauchte aus der Vergangenheit auf und forderte die Auseinandersetzung und Aufarbeitung.
»Du musst nicht schon um halb vier Uhr in der Backstube sein. Aber spätestens um fünf Uhr, wenn die Teige gemacht sind und aufgearbeitet werden, brauche ich deine Hilfe«, sagte Vater.
Na toll!
»Ach ja Georg, ehe ich es vergesse: morgen bringt Schäfers Jäb einen LKW mit Lava. Den kannst du dann hier auf dem Weg verteilen. Jeden Tag zehn bis fünfzehn Schubkarren, dann bist du in vierzehn Tagen fertig.«
Das war Vaters kurze Beschreibung meiner Tätigkeit für die nächsten zwei Wochen.
Erleichternd aber für mich war – er hob es als besondere Vergünstigung hervor – dass ich montags und mittwochs vom Brotausfahren auf die Dörfer befreit war. Also ein Doppelgewinn. Dafür musste meine Schwester Maria ran.
Unsere Landbäckerei konnte nicht allein vom Ladengeschäft leben, dafür war mein Heimatdorf zu klein. Ein Großteil unserer Kunden wohnte in den umliegenden Ortschaften Cochem, Dohr, Büchel, Gevenich und Weiler. Mit unserem VW-Bus, dem »Brotauto«, wurden sie jede Woche versorgt. Das Verkaufspersonal – wie gut das klingt – waren Maria und ich.
Zur der Zeit, als die Ereignisse unseren Ort überrollten, waren meine jüngeren Brüder Klaus und Robert sieben und sechs Jahre alt. Sie, sowie die zwei Nachkömmlinge Helga und Marcus, im Alter von drei und vier Jahren, traf noch nicht die Mitverantwortung in der elterlichen Bäckerei. Sie gehörten noch nicht zu dem billigen Personal.
Für mich war die Arbeit im häuslichen Betrieb eine Selbstverständlickeit, aber die blöde Lava zu verteilen, empfand ich als Schikane.
Als der LKW am nächsten Tag seine Ladung abgekippt hatte, lag ein riesiger Schuttkegel neben dem Haus.
»Guck mal«, unterbrach Vater meine Gedanken. Ich schaute nicht hin, denn ich war voller Wut auf die Scheißarbeit, die in den nächsten Tagen auf mich zukommen sollte.
»Der Sand ist voller Katzengold.«
Ich wandte mich um. Hatte ich Gold gehört?
Im Sand Gold?
»Hier, diese dünnen glänzenden Plättchen nennt man Katzengold, eigentlich sind sie wertlos, aber es glitzert besonders schön und leuchtet goldgelb, wenn man es ins Licht hält. Es ist eine Schwefelverbindung. Sieht doch aus wie Gold, oder?«
Tatsächlich. Der grobkörnige Lavasand, auch Lavakrotzen genannt, glänzte und glitzerte in dunklen, goldfarbenen Tönen.
Aber das half mir nicht, den Sand wegzukarren.
Vater legte großen Wert auf effektive Maschinen in seinem Betrieb und auf gutes Werkzeug. Zu diesem guten Werkzeug gehörte eine gummibereifte Schubkarre. Er hatte letztes Jahr das schwere Eisenrad aus der Schubkarre ausgebaut und durch ein Hartgummirad ersetzt. Somit ließ sich die Karre besser und leichter schieben. Das betonte er noch einmal mit fachmännischem Blick, als ich die ersten Sandladungen unter seinen Anweisungen auf den zu schotternden Weg kippte.
Trotzdem, es war nicht gerade die beste Ferienarbeit für einen Dreizehnjährigen.
Während ich die nächsten Tage in monotoner Arbeit und natürlich hoch motiviert Schubkarre für Schubkarre belud, kam mir eine Idee, eine geniale Idee, wie ich meinte.
Es war allerdings nicht meine Idee. Ich hatte sie einem gleichaltrigen Leidensgenossen abgeguckt. Und der lebte in einem Buch und hieß Tom.
Damals las ich gerade »Tom Sawyer und Huckleberry Finn« von Mark Twain.
Mein Leidensgenosse Tom war von seiner Oma verdonnert worden, den Gartenzaun zu streichen. Eine triste, langweilige und nervtötende Arbeit. Er verstand es aber geschickt, seinen Freunden diese Arbeit als etwas Besonderes und Ungewöhnliches anzupreisen, so dass diese erpicht darauf waren, auch einmal den Lattenzaun streichen zu dürfen.
Kein Problem für Tom. Er verlangte dafür aber von ihnen ein Entgelt in Form eines Preises. Von dem ersten erbat er sich einen Apfel, von dem anderen Süßigkeiten, von einem dritten ein paar Cents.
Zum Schluss strichen Toms Freunde den Zaun, er schaute nur zu und ließ sich dafür noch bezahlen.
Tolle Idee!
Mein erstes Opfer war mein Freund Günter, Messdiener und Fußballer wie ich. Er war ein Jahr jünger, schlaksig und sein schwarzes wirres Haar wirkte, als wäre es nur selten mit einem Kamm in Berührung gekommen.
Als er das Katzengold sah, wollte er sofort anfangen zu sammeln.
»Stopp! Das geht nur, wenn du mir hilfst, die Lavakrotzen mit der Schubkarre auf dem Weg zu verteilen.«
Ich wunderte mich, dass er sofort ja sagte.
Nach der achten Schubkarre aber zerplatzte meine geniale Idee. Dann nämlich tauchte Mia auf.
Ihr Vater war Schneider, der das ganze Dorf »benähte«. Seine einzige Tochter, zwei Jahre jünger als ich, fühlte sich eher zu Jungs hingezogen als mit gleichaltrigen Mädchen sittsam zusammen zu sein. Stattdessen nervte sie uns jedes Mal, wenn wir auf dem Bolzplatz waren und gab nicht eher auf, bis sie mitspielen durfte. Und das in einem Kleid! In diesem Kleid stand sie jetzt hinter mir.
Als sie mein Angebot hörte, sie dürfe sich ebenfalls Katzengold sammeln, wenn sie sich an der Transportaktion beteiligte, lachte sie mich aus.
»Auf den Weg zum Hinterwald haben sie gestern drei LKWs mit Lava abgekippt. Der Weg soll neu geschottert werden. Nun rate mal, was man dort in den Lavakrotzen finden kann?«
Idee zerplatzt!
Günter war noch nicht einmal sauer. Das war das Wichtigste.
Die erste Weisheit dieser Ferien lautete, dass man durch Lesen nicht unbedingt klug und weise werden kann.
Um es vorweg zu sagen, ich brauchte insgesamt 132 Schubkarren, um die Lava zu verteilen.
Mal zehn, mal zwanzig Karren pro Tag. Das war ganz schön anstrengend.
Zwei Tage nach meinem Versuch, die Arbeit auf meine Freunde zu übertragen, war ich wieder etwas schlauer.
Ich legte einen großen Stein an den Rand des frisch geschotterten Wegs und nahm Anlauf. Mit einem kräftigen Tritt schoss ich ihn entlang der nördlichen Seite unseres Hauses in Richtung der dahinter liegenden Äcker. Gestern hatte ich – eigentlich hätte ich es vorhersehen müssen – eine der kleinen quadratischen Scheiben des Garagenfensters getroffen, weil ich den Stein nicht mit der Fußspitze traf. Diesmal schoss ich den Stein entlang der Giebelseite und nicht auf die Hauswand zu.
Das Ergebnis meiner misslungenen Schießkunst hatte ich Vater sofort gebeichtet und, wie erwartet, eine Standpauke erhalten. Er hatte glücklicherweise auf eine Kostenübernahme verzichtet.
Wie großzügig! Wirklich großzügig!
»Vergessen wir mal die Sache, du hilfst mir ja für vierzehn Tage in der Backstube, wenn Hans Urlaub macht. Und das mit dem Weg hast du gut gemacht.«
Ich wunderte mich, dass ich gelobt wurde.
Heute hatte ich den Stein nicht allzu weit geschossen. Waren es zehn, zwölf oder nur acht Meter?
»So weit kann ich auch schießen.«
Eine unverkennbare Stimme hinter mir war zu vernehmen. Ich musste mich nicht umdrehen. Ich kannte diese Stimme. Es war Mia. Die hatte mir gerade noch gefehlt. Letztens hatte sie mir die geniale Idee mit dem Katzengold versaut und jetzt spuckte sie schon wieder schlaue Sprüche.
Sie stand im späten Nachmittagslicht, das schräg in die Einfahrt zu unserem Haus fiel. Ich sah nur ihre Silhouette umgeben von einem Strahlenkranz. Ihr Gesicht war nicht zu erkennen. Seltsam, ging es mir durch den Kopf, sie sieht aus wie die Muttergottes am linken Seitenaltar in der Kirche. Die ist auch mit einem Strahlenkranz umgeben, aber nicht zu vergleichen mit so einer Person wie die, die jetzt auf mich zukam.
Mia war zwölf, hatte einen Bubischnitt und trug neuerdings eine Brille.
Man hätte meinen können, sie hätte sie der Hexe aus unserem zerfledderten Märchenbuch geklaut.
»Guck mal!«, sprach die dunkle Silhouette und bückte sich, um einen Stein aufzuheben.
»Mit meinen neuen Schuhen schieße ich mindestens doppelt so weit wie du.«
»Du Angeberin«, entgegnete ich nur und schaute auf ihre neuen Schuhe.
Hohe Schuhe, raues helles Leder, mit glänzendem Fett eingeschmiert. Lederriemen.
»Die sind eigentlich für den Herbst und Winter, aber ich soll sie mal einlaufen, meinte Vater. Das Leder ist noch ›storzig‹.«
Eine passende Beschreibung für sprödes, hartes und ungeschmeidiges Leder. Oma bezeichnete eine widerspenstige Kuh als »storzig«, aber für Leder hatte ich diesen Ausdruck noch nicht gehört. Aus diesen »storzigen« Schuhen ragten zwei spindeldürre Beine heraus. Ein Paar wollene Socken, die über den oberen Rand der Schuhe geschlagen waren, verstärkten noch die Magerkeit der braunen Unterschenkel.
Mia bemerkte anscheinend meinen kritischen Blick und meinte: »Die Socken sind zwar zu warm für den Sommer, aber so bekomme ich keine Abschürfungen an den Beinen. Pass mal auf, wie weit ich mit den Dingern schießen kann.«
Mia schoss.
Klar, ihr Stein flog weiter. Ich fühlte mich in meinem Stolz verletzt. Und so entspann sich für die nächsten zehn Minuten ein regelrechter Wettkampf, bis Herbert, Franz Peter und Günter, die plötzlich hinter uns standen, diese sportliche Disziplin mit dem Vorschlag beendeten, nach Felchelen spielen zu gehen. Steineschießen sei langweilig.
Sie hatten recht.
Auf nach Felchelen.
Franz Peter und Herbert liefen schon den Feldweg hinab in das Wiesental hinter unserem Haus.
Die beiden waren auch Messdiener. Zusammen mit Günter und mir bildeten wir eine Messdienergruppe, die immer als Viererpack in Sonntags- und Festgottesdiensten auftrat.
Chef unserer Gruppe war Franz Peter mit seinen vierzehn Jahren. Er war nicht nur der Älteste und Längste von uns, er hatte sich auch angewöhnt, uns oft belehren zu wollen, was ihm aber nicht immer gelang. Mit seinen strohblonden Haaren war er in jeder Ansammlung von Erwachsenen oder Jugendlichen sofort zu erkennen.
Herbert war heute in seiner kurzen Manchesterhose aufgetaucht, die er, wie letztes Jahr, auch diesen Sommer tagaus, tagein bestimmt tragen würde. Er war zwölf Jahre alt, etwas dicklich und unser Physiker. Diese Auszeichnung hatte er deshalb bekommen, weil er über technisches und physikalisches Wissen verfügte, das uns anderen fremd war. Sein Wissen hatte er aus Büchern, die sein Vater ihm besorgte. Der hatte als Beschäftigter beim Gericht in Cochem Zugang zu der dortigen Stadtbücherei.
»Ich habe auch schon eine Idee, was wir machen können«, schlug Mia vor, als wir an der Eiche, von der aus man einen ersten Blick ins Tal werfen konnte, Halt machten. Sie zog aus der aufgesetzten Tasche ihrer Schürze, die sie über einem gemusterten Kleid trug, ein rotes Tuch. Ein Halstuch, wie es schien. Allein dieses Stück Textil hätte mich stutzig machen müssen, denn was sollte man wohl damit spielen? Mia antwortete mit wichtigtuerischem Gesicht: »Lasst euch überraschen.«
Es war bestimmt wieder ein Spiel, das Vater mit den Worten »Könnt ihr auch normal spielen?« kommentiert hätte, hätte er von unserer Aktion gehört.
Und die hatte es in sich.
In Felchelen – so nennt man das weite Wiesental mit Bach hinter unserem Haus – befanden wir uns in einer anderen Welt.
Hier hausten nicht nur Raubritter mit Knappen und Gesinde, hier standen auch die Wigwams der Irokesen, der Apachen und manchmal die der Komantschen. An den Hängen der Rocky Mountains, sprich am Steilhang von »Schäferchriste Reach« und in den Prärien – eigentlich die weite Talwiese – weideten Mustangs und Bisons und nicht hundsgewöhnliche Rindviecher.
Wir liefen vom Eichenbaum, der oben am Hang den Blick über unser Spielparadies freigab, hinab ins Wiesental. Aber seit Tagen war dies eingeschränkt, denn Schmitze Paul hatte unten, wo sich die Hangwiese dem flachen Tal anglich, einen Tierpferch errichtet. Der war groß. Viel zu groß. Denn mit seinen in den Boden eingerammten Pfosten versperrte er unseren Lauf.
Die eingezäunte Weide hatte etwa die Maße fünfzig mal dreißig Meter und stieß mit ihrer Schmalseite an einen Weg, der am unteren Ende von »Schäferchriste Reach« vorbeiführte. Ein Gattertor, bestehend aus zwei Holzpaletten, die mit Eisenscharnieren an den kräftigen Holzpfosten seitlich befestigt waren, bildete den Zugang zu der Wiese. Ein zwischen die Palettenhölzer eingeschobener Querbalken sowie eine Eisenkette mit Vorhängeschloss sicherten das Gatter.
In der Mitte der Weide stand seit Tagen der Gemeindebulle »der Steer«, von allen Ben genannt.
Er hatte uns sofort gesichtet und war an den Stacheldrahtzaun gekommen, um uns mit seinem bulligen Gesicht und dem Ring in der Nase anzuglotzen.
»Der ist gefährlich«, wusste Mia, »mit zwei Mann mussten sie den hier auf die Weide führen. Den kann man gut ärgern.«
Indem sie das sagte, buhte sie den Stier an und gestikulierte mit den Armen in zwei Metern Entfernung vor dem dreifachen Stacheldrahtzaun, der in Brusthöhe zusätzlich einen Elektrodraht hatte. Der Stier brüllte direkt los und stampfte mit den Füßen.
»Siehst du, wie ein Stier in der Arena.« Mia zeigte aufgeregt auf den schnaubenden Koloss. »Sollen wir nicht Torero spielen?«
Wir schauten uns etwas irritiert an. Herbert lachte: »Du meinst wir sollten den Stier ärgern und reizen und dann vor ihm herlaufen? So wie in Pamplona?«
Was der alles weiß, ging es mir durch den Kopf, bestimmt wieder aus seinen Büchern. Von Pamplona hatte ich gehört und als Herbert dann noch bildhaft die Stierhatz durch die Straßen der spanischen Stadt beschrieb, war die Spielidee geboren.
Wenn ich sage geboren, so ist das eigentlich falsch. Die Spielgeburt war geplant. Geplant von Mia, denn sie wedelte mit dem roten Tuch, das sie uns oben an unserem Haus mit geheimnisvoller Miene gezeigt hatte, vor unseren Augen herum.
»Habe ich rein zufällig dabei«, meinte sie.
Wir schauten sie lachend an. Sie lachte mit.
So wie sie immer lachte, wenn sie sich ertappt fühlte: Augen verdrehen, linken Mundwinkel hochziehen. Dabei bildeten sich kleine Grübchen auf ihren Wangen.
Die Spielidee sah folgendes vor:
Drei von uns stellen sich an die eine Ecke der Längsseite der Weide und ziehen die Aufmerksamkeit des Stiers durch Geschrei und Gestikulieren auf sich, während sich der Torero an die andere Ecke begibt. Dort klettert er unter dem Stacheldrahtzaun auf die Weide und beginnt von dieser Position aus zu rufen, zu springen, mit den Armen zu winken und das rote Tuch zu schwenken.
Ab diesem Moment verhalten sich die anderen ruhig. Irgendwann werde der Stier die andere Person bemerken und auf sie zulaufen, denn das rote Tuch werde ihn reizen.
Jetzt habe der Torero nichts anderes zu tun, als blitzschnell entlang der kurzen, etwa 25 bis 30 Meter langen Stirnseite auf die gegenüberliegende Ecke zu laufen und sich unter dem untersten Stacheldraht außerhalb der Weide zu rollen.
»Um dann am Stacheldraht hängen zu bleiben«, meinte Franz Peter sarkastisch.
»Nein, schau, da passt man wunderbar drunter durch.« Mia demonstrierte dies mit einer gekonnten Rolle in die Weidefläche hinein und wieder zurück hinaus.
Dies war auch das Signal für Ben, denn er kam sofort zu der Stelle am Zaun gerast, wo Mia ihre Rollübung vorgeführt hatte. Schnaufend den Kopf schüttelnd stand er am Zaun.
»Der hat seine Aufgabe schon verstanden«, meinte Herbert, während er den Stier laut anlachte, worauf der mit einem urigen Gebrüll antwortete.
Mir wurde ein bisschen mulmig, als ich den bulligen Körper betrachtete, das infernalische Gebrüll hörte und das Scharren der Hufe registrierte. Ich war froh um den dreifachen Stacheldrahtzaun und den Elektrodraht.
»Ich trau mich nicht, da mache ich nicht mit«, hörte ich Günter neben mir. »Was glaubt ihr, wenn einer ausrutscht, stolpert oder irgendwie hinfällt, dann trampelt der Stier ihn tot.«
»Ich zeig es euch«, war Mia zu hören und schon ging sie zu der linken Ecke der Weide. Ben beobachtete sie schnaufend.
Dann begannen wir mit unserem Ablenkungsmanöver. Wir schrien Ben an, machten Sprünge auf der Stelle und schwenkten die Arme wie vereinbart. Ben kam in Fahrt. Er brüllte, warf erst den Kopf in den Nacken, dann nach vorne und zuckte sofort zurück, denn der Elektrozaun wies ihn in seine Schranken. Er verdrehte die Augen und brüllte noch heftiger. Aus dem Innern der Weide gab Mia uns ein Zeichen.
Wir verstummten. Nur Mias Geschrei war zu hören. Es dauerte einen Augenblick, bis Ben registrierte, dass die mit Händen und Beinen gestikulierende Person am anderen Zaunende ihn provozierte.
Er warf den bulligen Körper zur Seite. Seine Vorderhufe stampften, dann startete er aus dem Stand mit beängstigender Geschwindigkeit in Mias Richtung, die mit dem roten Tuch schwenkte und loslief.
Wir sahen nur das Hinterteil des Stieres, sahen wie Erdklumpen und Grasfetzen aufwirbelten, als er quer über die Wiese stob.
Für einen Moment konnte ich Mia nicht sehen, weil Bens massiger Körper die Sicht versperrte. Jetzt kam sie wieder ins Blickfeld. Seelenruhig rollte sie unter dem Stacheldraht an der gegenüberliegenden Ecke aus der Weide heraus, während Ben erst die Hälfte der Strecke bewältigt hatte.
Schnaufend, mit den Hufen über das Gras schlitternd und laut brüllend stoppte er vor dem Eckpfosten, hinter dem Mia ihm mit dem roten Tuch zuwinkte.
»Der nächste bitte«, rief sie uns zu und kam lachend am Außenzaun zu uns zurück. Ben stob quer über die Weide und folgte ihr mit seinem Gebrüll, das mittlerweile gefährlich tief klang.
»Das war ja fast ein Spaziergang«, begann sie. »Man hat genügend Zeit, um an die andere Ecke zu kommen. Wer ist der nächste?« Dabei schaute sie fragend in die Runde.
»Es bleibt dabei«, sagte Günter, »ich mach da nicht mit.«
Seltsam, niemand machte eine dumme Bemerkung. Offensichtlich wollte keiner als Torero zur Verfügung stehen. Alle schienen Respekt vor dem bulligen Tier und vor Mias Mut zu haben.
Ich schaute an Mia vorbei auf den gegenüberliegenden Steilhang, um meine Verlegenheit zu überspielen. Bens Brüllen war in ein lautes Schnauben und Schniefen übergegangen. Er blähte seine Nüstern auf, ekelhafter, weißlich grüner Schaum hatte sich an den Rändern seines Mauls gebildet. Er scharrte mit den Vorderhufen und schürfte die Erde auf.
»So schnell kann ich nicht laufen«, begann stotternd Herbert, »ich habe mich gestern beim Fußballspiel vertreten. Das ist mir zu gefährlich.«
Was Franz Peter sagte, weiß ich gar nicht mehr. Dem Tonfall seiner Stimme nach, die ich nur schwach vernahm, hatte auch er eine Ausrede.
Ein Blick rundum zeigte mir, dass alle auf den Boden schauten. Wie gesagt, keine Bewerbung als Torero stand an.
Ich wusste, dass ich jetzt etwas sagen musste. Aber mein Mund war trocken und außerdem faszinierte mich Bens Verhalten. Er scharrte noch immer, warf den Kopf in den Nacken, senkte ihn, wie um zu stoßen und brüllte. Nur einmal. Es war so, als warte er auf unsere Antwort.
»Was ist mit dir, Georg? Du bist doch sonst immer der Schnellste von uns.«
Mia schaute mich frech, spöttisch und herausfordernd an.
Diesmal ohne Lachgrübchen, ohne hochgezogenen linken Mundwinkel. Verdammtes Weibsbild!
Ich spürte nur allzu deutlich, wie sie mich abwertend anguckte, dass sie kurz davor war, sich höhnisch abzuwenden, sich mit einer abschlägigen Handbewegung wegzudrehen.
»Bin ich als einziges Mädchen mutig …«
»Nein bist du nicht«, fuhr ich sie barsch an und stieß sie heftig an die Schulter.
»Gib das bescheuerte Tuch her.«
Zu den anderen gewandt fuhr ich erregt fort: »Erst wenn ich ›Los‹ rufe, hört ihr auf, Ben abzulenken. Klar?«
Ich hatte »Ben«, und nicht Stier gesagt, hatte ihn beim Namen genannt wie einen Spielkameraden.
Meine wahren Spielkameraden waren Feiglinge geworden.
Nun stand ich in der linken Ecke an der Schmalseite in der Weide. Mein Herz klopfte zum Zerspringen. Jeder Muskel meines Körpers war gespannt, wie kurz vor dem Start beim Einhundert-Meter-Lauf.
Von wegen, Mia die einzige, die sich traute, den Torero zu spielen. Die aufgeblasene Tunte!
Ich sah meine Freunde oben mit Armen und Beinen zappeln, schreien und Grimassen schneiden.
Ben hatte begonnen zu tänzeln, scharrte nach wie vor mit den Hufen, warf unruhig den Kopf in den Nacken und senkte ihn wieder ab.
Ich hob den Arm und rief »Los«.
Ben brauchte ein, zwei Sekunden, bis er registrierte, dass sich die Reizsituation in die linke Ecke der Weide verlagert hatte. Zu mir.
Er drehte sich mit dem Oberkörper in meine Richtung. Von weitem, es waren etwa geschätzte fünfzig Meter, sah er wie ein gelangweiltes Rindvieh aus, das von seiner Weide her einen lästigen, störenden Wanderer beobachtet.
Ich schwenkte das rote Tuch. Ben rührte sich nicht.
Wir übten beim Fußballtraining oft das unmittelbare Bremsen im Lauf, schnelles Wenden und wieder losstarten. Wir waren alle Dilettanten. Mehr noch, wir waren kriechende Ameisen, schleichende Figuren, einfach Stümper.
Das wusste ich in dem Moment, als Ben plötzlich aus der Drehung heraus mit einem Brüller losbrach und quer über die Weide auf mich zuraste.
Ich sah den gesenkten Kopf, den bulligen Körper, über dessen Hinterteil der hoch erhobene Schwanz senkrecht in der Luft stand, hörte das Stakkato seiner trampelnden Hufe.
Ich startete. Ich sah mein Ziel, die linke hintere Zaunecke, sah das Zugangsgatter, das etwa in der Mitte der Schmalseite lag, auf mich zukommen.
Rindviecher, also Kühe, Ochsen, Stiere, selbst die kleinsten Kälber machen Kuhfladen. Ich finde es bemerkenswert, dass unsere Sprache, die so facettenreich und bildhaft sein kann, bei den Exkrementen von Rindviechern nur den Begriff Kuhfladen und nicht Ochsenfladen, Stierfladen, Kalbsfladen verwendet. Sie gebraucht hier nur einen Begriff, einen Oberbegriff, eben das Wort Kuhfladen.
Diese Fladen können von unterschiedlicher Konsistenz sein.
Frisst eines dieser Rindviecher Getreide und Heu oder Silage sind diese Fladen wie ein zäher Matschklumpen. Man kann sogar leichte Wölbungen bei dieser Exkrementenart feststellen.
Ändert sich aber der Speiseplan des Rindviehs und wird mit Frischware, sprich Gras, Klee oder Rübenblätter angereichert, ändert sich auch die Konsistenz der Kuhfladen. Sie erinnern dann an Spinat, an grünlich braunen Spinat. Nicht nur in der Farbe, sondern vor allem in dem breiigen, tellergroßen Fladen.
Solch einen tellergroßen Spinatfladen sah ich, als ich mich dem Gattertor mit hoher Geschwindigkeit näherte.
Ein Sprung.
Gefahr übersprungen.
Ein zweiter, weit ausgeholter Sprung, nächstes Spinathindernis gemeistert.
Das dritte schaffte ich nicht, denn mein nach vorn gestrecktes Bein landete genau in der von Gras und Klee bestimmten Ausscheidungsmasse von Ben, meinem Spielgefährten.
Ich rutschte aus, schlitterte über den an dieser Stelle des Gatters zertrampelten Grasboden und kam auf den Rücken zu liegen.
Ich war nicht nervös, nicht zittrig oder gelähmt vor Schreck. Nein ich reagierte fast routiniert.
Später, als ich mir die Situation nochmals durch den Kopf gehen ließ, staunte ich selbst über meine Kaltblütigkeit, oder besser gesagt Besonnenheit. Ich reagierte instinkthaft, ohne Überlegung, aber richtig, genau richtig.
Ich rollte mich einfach in Richtung Zaun und Eingangsgatter, neben dem ich gelandet war, ab.
Und noch einmal und noch einmal.
Verflixt nochmal, wann bist du denn am Zaun, ging es mir durch den Kopf, während ich bei jeder Drehung in Richtung Ben schaute. Dessen bulliger, gesenkter Kopf mit den abstehenden Hörnern kam immer näher. Ich hörte nicht nur das Stampfen seiner Hufe, sondern spürte auch ein Vibrieren des Grasbodens. Wupp, Wupp, Wupp, Wupp. Dann sah ich bei der dritten Rollbewegung über mir deutlich gegen den blauen Sommerhimmel den querverlaufenden Stacheldraht.
Ich atmete tief durch, duckte mich und rollte noch einmal.
Ich war draußen.
Während ich auf die Knie kam und mich mit den Händen aufstützte, wunderte ich mich, warum ich beim Abrollen unter dem Stacheldraht hindurch ein splitterndes Knirschen und Krachen gehört hatte. Das wurde mir jetzt erst bewusst.
Ein erneutes Splittern von Holz ließ mich den Kopf heben, als ein singendes, sausendes Peitschen mich zusammenzucken ließ. Ich kannte das Geräusch. So gefährlich kann nur ein unter Spannung stehender, gerissener Draht singen. Ich hörte ein metallisches Klatschen auf Holz.
Dann sah ich die Bescherung, vielmehr hörte ich sie. Denn kaum vier Meter von mir entfernt sah ich Ben rechts in einer zertrümmerten Holzpalette stehen. Die gebrochenen Bretter leuchteten hell an den gesplitterten Bruchstellen. Ben schüttelte mehrmals den Kopf, warf ihn nach links und rechts und schnaubte laut.
Wie ein Blitz schoss es mir durch den Kopf, wenn der ausgeschnaubt, den Kopf ausgeschüttelt hat und dich sieht, dann Gnade dir Gott.
Mit einem Sprung hatte ich den Weg, der entlang der Stirnseite der Weide verlief, übersprungen. Vor mir der Steilhang des »Schäferchriste Reachs«.
Vor drei Jahren waren wir noch im Winter mit unseren Schlitten diesen steilen Hang hinuntergefahren. Nachdem aber Alois Hammes, dem diese Hangwiese gehörte, beim Mähen mit der Sense den Hang hinuntergefallen war und sich böse verletzt hatte, wurde hier nicht mehr gemäht.
Für uns war es damit auch für unsere Schlittenbahn aus. Die Natur hatte sich in wenigen Monaten den Hang zurückerobert. Ginsterbüsche, niedrige Schwarzdornhecken und sogar dünne Birkenstämmchen hatten den Hang besiedelt. Schlittenfahren war unmöglich geworden. Immer wieder blieben die Kufen des Schlittens in irgendeinem Strauch hängen. Es gab gefährliche Stürze. Das Ende der Schlittenbahn war besiegelt.
Für mich aber war der neue Bewuchs mein Glück.
Denn nach dem Sprung über den Weg begann ich, auf allen Vieren den Hang hinauf zu krabbeln. Ich zog mich an Ginsterbüschen und Schwarzdornhecken hoch, griff nach Birkenstämmchen und wuchernden Grasbüscheln. An allem, was ich greifen konnte, zog ich mich hoch. Dabei spürte ich nicht, wie die Dornen mir ins Fleisch piekten, Disteln mein Gesicht zerkratzten und meine Knie sich wundschürften.
Dreh dich ja nicht um, und schau nicht nach Ben. Du verlierst wertvolle Sekunden. Weiter, weiter, weiter. Mein Fluchtinstinkt dirigierte mich.
Ich sah den Heckenstreifen am oberen Ende der steilen Hangwiese Meter für Meter auf mich zukommen. Nach Atem ringend sank ich schließlich oben zusammen, drehte mich aber trotz meiner Atemnot um.
Mir bot sich ein fast friedliches Bild.
Unten, wenige Meter im Steilhang, stand Ben mit dem Gesicht nach oben schauend. Ich hörte sein Schnaufen. Er brüllte nicht. Er schien erschöpft zu sein. Offenbar hatte er aufgegeben und wandte sich zur Seite, wie um nach unten zu gehen. Aber da gab es Probleme, denn der Abhang war zu steil.
Jetzt brüllte er nach oben, wie um mich zu beschimpfen, dass ich ihm diese Situation beschert hatte.
Es dauerte bestimmt zwei, drei Minuten, ehe er sich nach mehrmaligem Schauen in die Tiefe rückwärts Schritt für Schritt fast tapsend nach unten bewegte, bis er mit zwei gewaltigen Sprüngen auf dem Weg zu stehen kam. Ein letzter Brüller , und er trottete zurück auf seine Weide. Dort legte er sich in den hinteren Bereich, immer nach mir schauend.
Ich hatte Glück.
Dass Ben den steilen Hang nicht schaffte, lag mit Sicherheit daran, dass er das ganze Jahr lang in einem Stall verbrachte und nur zum Ausmisten in den mit Holzplanken gesicherten Hof zum Auslauf durfte. Er hatte keine Bewegung und somit auch keine Ausdauer.
Die Holzpaletten des Gatters lagen zersplittert halb auf dem Weg.
Ein suchender Blick von mir rund um diese scheinbare Idylle fand meine Freunde nicht mehr. Sie waren verschwunden.
Halt, da oben an unserem Treffpunkt, am Eichenbaum winkten mir vier Gestalten zu. Schweigend.
Aha, dachte ich bei mir. Die wollen auf keinen Fall mehr Ben aus seiner Ruhepause aufschrecken. Ihre Gesten deuteten eindeutig darauf hin, dass ich zu ihnen kommen sollte.
Über den oberen, hinter der hohen Hecke vorbeiführenden Weg am Hangende, erreichte ich unseren Treffpunkt.
Sie kamen auf mich zugelaufen.
»Haltet bloß die Klappe!«, fuhr ich sie wütend an. »Ich verzichte auf eure Kommentare und auf euer Mitleid.«
Ohne ein weiteres Wort gingen wir Richtung Dorf, bis Mia das Schweigen brach und sagte: »Wir müssen dem Schmitz Bescheid geben, dass der Stier ausgebrochen ist, sonst geschieht noch ein Unglück.«
»Und wie sollen wir das machen, wenn ich unsere Torerospezialistin, die uns alles eingebrockt hat, fragen darf?«
Ich hatte eine Stinkwut auf Mia und auf die anderen, aber auch ein saugutes Gefühl, dieses Abenteuer ohne Hilfe und bravourös gemeistert zu haben. Ja ich war schon ein bisschen stolz auf mich.
»Mache ich«, sagte Mia, »ich habe uns das ja auch eingebrockt.«
»Uns?« Ich rempelte sie an. »Mir hast du das eingebrockt. Ja mach du das«, entfuhr es mir gönnerhaft, »du kannst von uns allen ja auch am besten lügen.«
Hinter dem Holzschuppen an Thelen Haus beobachteten wir, wie Mia mit Bauer Schmitz in seinem Hof sprach. Er schlug die Hände über dem Kopf zusammen und stieg augenblicklich auf seinen Traktor.
»Ich habe ihm gesagt, ich hätte unten in Felchelen an Omas Apfelbaum Äpfel für unsere Familie pflücken sollen, als mir das zersplitterte Gatter aufgefallen war.«
Super gelogen!
Eigentlich wollte ich mich am Wasserfass auf der Weide von Linden Johann im Winneburgerweg waschen. Aber Pech. Das Fass war leer.
Wo sollte ich nun meine spinatgrüngefärbte Lederhose und meine Beine abwaschen? Im ganzen Dorf gab es nur Ziehbrunnen, an der Kirche, auf der Queter und im Kirchweg. Das nächste fließende Wasser war der Almtbach. Er floss als dünnes Rinnsal durch ein flaches Wiesental Richtung Ellerbach im Westen des Dorfes. Um dort ungesehen hinzugelangen, mussten wir einen Bogen um den Ort machen und die Bundesstraße oberhalb des Friedhofes überqueren.
Mia stand mit abgewandtem Gesicht – darauf hatte ich bestanden – am Weg, während ich bei meinen Freunden großzügiger war. Sie durften – ich in Unterhose – den Waschvorgang meiner Lederhose und meiner verschmierten Beine feixend verfolgen. Das hätte noch gefehlt, dass Mia mich in Unterhose sähe.
Meine Knie hatten einige Schrammen abbekommen, wie sie entstehen, wenn man beim Fußballspiel stürzt. In meinem rechten Handballen aber steckte ein abgebrochener Dorn, der musste herausgezogen werden. Es bestand die Gefahr, dass eine Entzündung auftreten könnte.
Mia war wieder gefragt, denn sie war die Verbindungsperson zu unserem Wundarzt Bernfried.
Der Arzt Dr. Friederichs hatte sich in Faid nach seiner Pensionierung ein Haus gebaut und wohnte am unteren Dorfrand. Zweimal in der Woche hatte er noch Sprechstunde.
Mia behauptete, Bernfried sei ihr Onkel, doch Mutter hatte mir einmal erklärt, Mias Mutter sei eine Großcousine von Bernfried. Also Verwandtschaft über ein paar Ecken. Wir sahen ihn über den Gartenzaun in einem Gemüsebeet kniend arbeiten. Mia näherte sich ihm verlegen.
Bernfried richtete sich auf, schaute Mia an. Wir hörten ihn sagen: »Wenn ich dich nicht genau kennen würde, würde ich sagen, du kommst deinen Onkel besuchen.« Wir schauten uns an, also doch ihr Onkel?
»Aber da ich dich genau kenne, glaube ich, du brauchst meine Hilfe oder du bringst mir einen Verwundeten, mindestens aber einen deiner Freunde zur Behandlung.« Dabei blickte er Richtung Gartentor und sah unsere vier Köpfe.
»Also vier, das ist ja ein Großauftrag. Ich bin doch kein Lazarett«, begann er, wurde aber von Mia unterbrochen.
»Nein, es ist nur Georg, der sich verletzt hat. Er hat einen Dorn im Handballen stecken. Der ist abgebrochen.«
Er winkte mir, gab aber den anderen zu verstehen, draußen am Gartentor zu warten.
Ich saß auf der roten Liege im Behandlungszimmer, neben mir Mia. Mir gegenüber in der rechten Zimmerecke ein menschliches Skelett.
»Also«, begann Dr. Bernfried, »keine Märchen und Lügengeschichten. Ich will die Wahrheit.«
Ich erzählte wahrheitsgemäß von unserem Torerounternehmen, verschwieg aber, als ich Mias drohenden Gesichtsausdruck und zusammengekniffene Augen sah, dass sie die Sache eingefädelt, nein, geplant hatte. Sie hatte schließlich das rote Tuch dabeigehabt.
Während Bernfried meine Schürfwunden am Knie begutachtete und anschließend den Handballen untersuchte, meinte er kopfschüttelnd: »Warum könnt ihr nicht wie andere Kinder spielen? Fußball, Nachlaufen, Fahrradfahren, Ballwerfen, von mir aus auch Steine werfen. Nein, ihr habt immer Dinge im Kopf, die gefährlich, riskant und sogar tödlich sein können. Heute eine gefährliche Stierhatz. Also, ich weiß es nicht. Irgendetwas scheint mit euch nicht zu stimmen.«
Mia und ich sahen uns verlegen an. Er hatte ja so recht.
Die Schürfwunden an den Knien wusch er ab, desinfizierte sie und begann dann mit der Behandlung meiner Hand.
»Kannst du Schmerzen aushalten, oder soll ich dir eine Spritze geben?«
Ehe ich antworten konnte, sagte Mia: »Der kennt keinen Schmerz, der ist ein Indianer. Der ist ›fräd‹.«
Fräd ist der Ausdruck für zäh, widerstandsfähig und schmerzunempfindlich.
Ich hätte sie treten können.
Bernfried schaute mich fragend an.
»Klar«, kam meine gequälte Antwort.
Ein kleiner Schnitt mit dem Skalpell, was wahnsinnig weh tat. Dann die Pinzette, und der Dorn war draußen.
Ich hatte mir während der kleinen Operation das Skelett, das neben der Liege stand angesehen und mir vorgestellt, dass meine lädierte Hand ohne Haut und Knochen genauso aussähe wie die baumelnde Knochenhand. Das hatte mich abgelenkt.
Bernfried verband die Hand trotz meines Protestes, weil ich zu Hause bestimmt Ärger erwartete. Er aber blieb unbeeindruckt und bestand auf einer Untersuchung am nächsten Tag.
Das auch noch!
Was sollte ich zu Hause sagen? Eine Lügengeschichte erfinden?
Nein, das brauchte ich nicht. Herbert hatte sie bereits erfunden, als wir aus dem Behandlungszimmer kamen. Ich solle sagen, ich sei beim Fußball am Rande des Spielfeldes in einen Dornenzweig, der dort gelegen habe, gefallen. Meine Schürfwunden am Knie seien ja ein eindeutiger Beweis für einen Sturz beim Fußballspiel.
Vater glaubte mir, meinte aber, ob wir auch mal normal spielen könnten ohne Verletzungen.
Hatte ich doch recht mit meiner Vermutung!
Seltsam, er war einer Meinung wie Bernfried.
Am nächsten Tag ging das Gespräch durchs Dorf, der Gemeindestier sei ausgebrochen gewesen, wahrscheinlich gereizt von einem Hund, Fuchs oder Ähnlichem.
Wir atmeten alle auf.
Nochmal Glück gehabt!
Wie normale Kinder hatten wir nicht gespielt.
Aber wie langweilig waren Verstecken spielen, Fußball kicken, Klicker spielen oder Fahrrad fahren gegen eine Torerovorstellung?
Ich fühlte mich sauwohl.
Der Brunnen
Mit diesem leichtfertigen Torerospiel begann die ganze Dynamik der bald folgenden Geschehnisse.
Wäre im Winneburgerweg das Wasserfass, an dem ich mich waschen wollte, voll gewesen, wären wir nicht weiter zum Almtbach gelaufen, und den alten Dorfbrunnen, der in einem wild wuchernden Gebüsch am Wegrand meiner Waschstelle lag, hätten wir gar nicht erst entdeckt. Eigentlich wären wir nie auf die Idee gekommen, im Almttal zu spielen, wenn uns nicht der gemauerte, bröckelnde Steinkranz der Brunnenkrone gereizt hätte.
Wir trafen uns am nächsten Tag beim Backhaus an der Kirche und machten uns durch den Entenpfuhl auf in Richtung Hinterwald. Vor Linde Karls Haus in der Kurve bogen wir rechts in den Feldweg ein, der uns in das Wiesental »Almt« führte.
Unsere Expeditionstour hatte einen besonderen Grund.
Während ich mich nach der Aktion mit Ben, es war mittlerweile eine Woche vergangen, im Almtbach gewaschen hatte, waren meine Freunde in dem Heckengrundstück verschwunden, in dem die Quelle des Baches lag. Dort hatten sie den alten Dorfbrunnen wiederentdeckt und beschlossen, an diesem mysteriösen Ort in der nächsten Zeit zu spielen.
Frau Weyer, unsere Lehrerin, hatte in der Heimatkundestunde, für mich das interessanteste Fach, von den Anfängen unseres Heimatdorfes berichtet.
Wir hatten von der furchtbaren Brandkatastrophe im 16. Jahrhundert erfahren, hörten, dass 1689, als französische Truppen das Rheinland verwüsteteten, die Faider gezwungen wurden, den »Schinngraben«, den Schindergraben, ein etwa fünfhundert Meter langer Verteidigungsgraben auszuheben. Das Interessanteste an der militärischen Besetzung unseres Ortes war, dass damals ein französischer General auf dem Friedhof in Faid beerdigt wurde. Wir hatten weiter gehört, dass sich unser Dorf nach der Pestepidemie im Mittelalter nach Osten verschoben habe.
Das ursprüngliche Siedlungsgebiet, die Gemarkung »Almt«, im Westen des Ortes war aufgegeben worden. An das damalige Siedlungsgebiet, heute Wiesen- und Ackerland, erinnerte nur noch der ehemalige Dorfbrunnen.
Der »Faulbrunnen«.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie dort gewesen, denn meine Abenteuerwelt lag in Felchelen, dem kleinen Wiesental hinter unserem Haus.
Das Almtbachtal war langweilig. Es war ein Wiesental, in dem nur Heuwiesen lagen. Kein Baum, kein Strauch lockerte das Tal auf. Auch entlang des kleinen Baches, der schnurgerade durch die Wiesenau floss, gab es keine Büsche, nur Brennnesseln und ab und zu eine sumpfige Stelle, an der gelbe Sumpfdotterblumen und dunkelgrüne Binsen aus dem Gras herausragten. Parallel zu dem kanalisierten Bächlein verlief der Weg, der von drei querverlaufenden Wegen gekreuzt wurde. Somit waren große rechteckige Flächen entstanden, die innen ebenfalls einzeln parzelliert waren. Es sah aus wie ein Schachbrettmuster.
Wie ganz anders war mein Spielparadies, mein Felchelen. Mutter hatte mir einmal gesagt, sie hätten als Kinder damals Felchelen als »Märchenland« bezeichnet.
Es war ein kleiner Talkessel von etwa 400 Metern Länge und etwa 300 Meter an der breitesten Stelle, an dessen Sohle auf ein paar Wiesen, die durch schmale Heckenstreifen getrennt waren, drei Reihen Obstbäume wuchsen.
Ich wusste genau, in welcher Reihe die Apfelbäume und die drei Zwetschgenbäume standen.
Zwei dieser Apfelbäume trugen Augustäpfel, saftig, leicht sauer mit festem Fleisch. Sie waren als erste im Jahr reif. Es gab vier Bäume mit den länglichen Bohnäpfeln, und weitere vier Bäume trugen Äpfel der Sorte Winterrambour, Äpfel mit harter Schale und hartem Fruchtfleisch und eigentlich erst nach Weihnachten genießbar. Uns aber schmeckten sie auch im Herbst, denn es gab nichts Schöneres, als in festes Apfelfruchtfleisch zu beißen und mit den Zähnen ein Stück herauszubrechen.
Der kleine Talkessel war nach Osten und Norden von einem Hang begrenzt, dessen unterer Teil mit felsigen Klippen übersät war. In diesem Teil des Hanges wuchsen nur Heidekräuter, Ginster- und Wacholderbüsche und gelegentlich eine Birke. Die Beeren der Wacholderbüsche hatte ich schon öfters gepflückt, Oma brauchte diese zum Einschneiden von Sauerkraut.
Am oberen Rand des Hanges zog sich ein mächtiger Buchenwald.
Der kleine Bach, der unterhalb von »Schäferchriste Reach«, des Nordhanges, in einem Holunder- und Haselnussgebüsch entsprang, floss in Mäandern gegen Süden aus dem Kessel.
Waren im Almttal die Wiesengrundstücke rechteckig durch die querverlaufenden Wege parzelliert, waren die Wiesengrundstücke in Felchelen den Höhenlinien angepasst. Sie waren geschwungen, endeten abrupt an einer Wegebiegung oder an einer mit Brombeer- und Schlehdornhecken bewachsenen Böschung.
Was mir besonders auffiel, als wir uns dem Brunnengrundstück in Almt näherten, war die Stille. Ich hörte keinen Vogel, während in Felchelen das Vogelgezwitscher den ganzen Talkessel erfüllte.