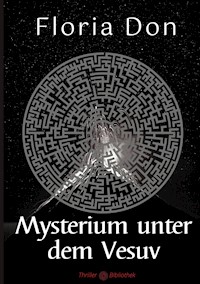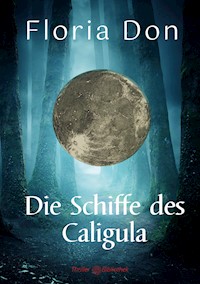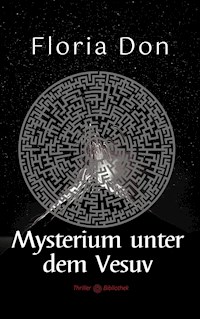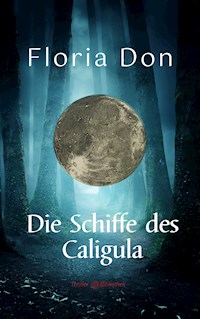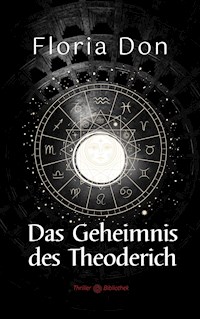
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 410 plünderte der Gotenführer Alarich Rom. Seine Beute war der größte Schatz, der jemals gestohlen wurde. Die Schätze des Tempels von Jerusalem, die Güter Syriens, das Gold und Silber der Kirchen von Rom. Als die Merowinger die Goten vor Carcassonne schlugen, wurde der Schatz zum letzten Mal gesehen. Theoderich der Große brachte ihn nach Ravenna. Seitdem fragt man sich, wohin er verschwand. Als ein Priester in einer der Gotenkirchen von Ravenna erhängt am Altar gefunden wird, findet man bei seiner Leiche einen Hinweis auf den legendären Schatz. Eine Jagd nach dem Mörder und den antiken Kunstwerken beginnt. Das Buch bezaubert durch seinen gründlich recherchierten historischen Hintergrund, authentische Charaktere und eine schnelle, unterhaltsame Handlung. „Ein geniales Buch. Sprachgewaltig, atemberaubend und voller Atmosphäre.“ „Ein Buch, das man nicht aus der Hand legen kann.“ „Ein Buch im Stil von ‚Da Vinci‘-Code.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Eine Entdeckung in den Katakomben
Ein Jahr später
Auf dem Weg in die Unterwelt
Therese ist außer sich
Cariello ist außer Gefecht
Ein Priester macht sich Sorgen
Rückkehr nach Padua
Ein Professor in Nöten
Sündenfall
Eine alarmierende Entdeckung
Angriff aus dem Hinterhalt
Auf der Jagd
Kolonel Camarata kommt zu Hilfe
Der Mann im Dunkeln
Ein Wiedersehen in Ravenna
Ein Professor braucht Hilfe
Eine überraschende Zeugenaussage
Das Bild auf dem Missorium
Die Obduktion des Geistlichen
Alte Kamellen
Das Rätsel der zwei Missorien
Unter Beobachtung
Chiara sucht ihre Kinder
Das Ergebnis der Obduktion
Ungewöhnliche Geschwister
Der Schatz
Der Erlöser
Erklärungen
Sergio
Verbündete
Ein bizarres Institut
Dan Kierkegaard
Die Reise zum Busento
Rettung in letzter Sekunde
Das Grab im Busento
Im Café in Ravenna
In Cosenza
Bergé macht sich bekannt
Das Geheimnis der Höhle bei Cosenza
Cariello wundert sich
Hinterhalt
Sergio hat Angst
Ein ungleicher Kampf
Kühler Empfang
Flucht
Der Bischof ist erbost
Ein Wiedersehen
Bergés Frau
Cariello ist verlegen
Überraschende Enthüllungen
Die Leiche Bergés
Die Lücken der Geschichte
Der Tempel Salomons
Entführung
Nackte Angst
Der Botschafter
Eine Frage des Testaments
Auf der Suche nach Theoderich
Geheimnisvolle Katakomben
Das Mausoleum Theoderich des Großen
Böse Überraschung
Das Rätsel in Marmor
Sesam öffne dich
Die Lage spitzt sich zu
Unter der Erde
Hierarchien
Im Grab
Vor dem Palast
Wenn alle Toten aufersteh‘n
Osterfest
Chiara
Impressum
Dieses Buches basiert auf realen Umgebungen und historischen Begebenheiten. Seine Handlung ist erfunden.
*Am Ende des Buches sind Bilder der Schauplätze und Kunstgegenstände eingefügt.
Des Goldes Schmuck schmäh'te er nicht, wüßte er all seine Wunder.
R. Wagner
Das Rheingold
Eine Entdeckung in den Katakomben
Der hagere Geistliche brütete bei hereinbrechender Nacht in seinem schäbigen Büro, begraben zwischen Stapeln von Predigten und Rechnungen für den Blumenschmuck des Altars. Er raufte sich die grauen Haare und presste die schmalen Lippen aufeinander. Er hatte schlechte Laune und ihm war kalt. Seine Soutane war abgegriffen und fadenscheinig. Es war, als wehe der Wind durch sie hindurch. Das Pfarrhaus lag stumm und dunkel, ohne Saft, Geschmack und Leben um ihn her.
Giovanni Rante hasste die leeren Räume, die unmodernen Möbel und den Geruch nach Erbsensuppe, der in allem hing. Durch das Fenster war die mächtige, hellerleuchtete Fassade der Basilika zu sehen, aber er schaute nicht auf sie. Der Ausblick interessierte ihn genauso wenig wie der süße Duft der weißen Rosen, die ein Zulieferer für die Hochzeit des nächsten Tages gebracht hatte. Die Blumen waren nicht für ihn und er hätte sie gern in hohem Bogen aus dem Fenster geworfen. Andere waren glücklicher als er. Sie würden sich Liebe schwören und er würde sich am Abend darauf eine weitere Konservendose öffnen.
Er seufzte und senkte den Kopf erneut über das karierte Blatt Papier vor ihm. Er hatte die Zahlenfolge, deren Summe seine Aufmerksamkeit erregt hatte, noch einmal durchgerechnet, aber starrte noch immer hilflos auf die Tabelle. ‚Wie sind die Leute auf diese Resultate gekommen?‘ Die Bürolampe warf ihr fades Licht auf die simplen Zeichen, aber er las sie wieder und wieder, ohne sie zu verstehen. Die Vermesser meinten, dass ein Gang im Unterbau der Ruinen des alten Gebäudes, welches hinter der Basilika stand und das man als Palast des Gotenkönigs Theoderich bezeichnete, unter der Erde kürzer sei als darüber.
Rante kaute auf seinen Fingernägeln herum und schob die Papiere schließlich beiseite. „Wie kann ein Gebäudeteil über und unter der Erde verschiedene Längen haben? Was für ein Unsinn. Die Vermesser haben einen Fehler gemacht. Und das bei dem Preis, den wir ihnen zahlen.“ Er schlug den Hefter zu und ging zu Bett.
Am nächsten Abend änderte ein Zufall seine Meinung. Rante hatte sich mit einem seiner Amtsbrüder in einem Restaurant der Altstadt verabredet, um dem Einerlei seiner Junggesellenküche zu entgehen. Als sein Kollege sich verspätete, ging er in den hinteren Anbau, um auszutreten, und verlief sich auf dem Rückweg zwischen aufgestapelten Stühlen und Weinfässern. Nachdem er den zweiten falschen Weg in dem Labyrinth genommen hatte, öffnete er auf gut Glück eine schmale Tür. Dann weiteten sich seine Augen und sein Kinn sank herab.
Was er sah, hätte gewöhnlicher nicht sein können.
Er stand vor einer Ansammlung von Besen. Mitten in der heruntergekommenen Unordnung des billigen Etablissements begriff er jedoch, was ihm am Vorabend entgangen war. „Ich bin blind gewesen! Es gibt einen verborgenen Raum unter den Mauerresten im Garten der Basilika.“
Hastig raffte er seine Soutane über den mageren Beinen zusammen und wandte sich um. Er rannte durch jeden der Gänge, bis er nach draußen fand. Sein verdutzter Kollege blieb in der Tür des Restaurants zurück, während Rante mit klatschenden Schuhsohlen durch den Regen und die dunklen Gassen Ravennas zurück zur Basilika eilte. Die Stadt lag stumm und verlassen, nur erhellt vom Mond, der dann und wann durch die Wolken brach und silberne Streifen auf die grauen Pflaster und die uralten Häuser malte. Niemand kam ihm entgegen und keiner fragte ihn, warum ein älterer Priester so atemlos durch die Nacht hastete. Nur ein dunkelgekleideter Passant hielt inne und sah ihm nach.
Als Rante die Basilika erreichte, lag sie einsam und verlassen in der Dunkelheit. Keines ihrer hohen Fenster war erleuchtet und die Tore waren verriegelt. Er atmete auf und versuchte, seinen Puls zu beruhigen. Mit klammen Fingern fischte er den Schlüssel aus der Soutane und schloss das wassertropfende Tor zum Vorplatz der Kirche auf. Als er es bewegte, zerriss ihr übliches, unangenehm kreischendes Geräusch die Nacht. Er zuckte zusammen und presste die Zähne aufeinander in der Hoffnung, dass niemand ihn gehört hatte. Zu seiner Erleichterung regte sich nichts. Nur eine Ratte huschte über den Rasen, ansonsten blieb alles still. Es wäre ihm schwergefallen, zu erklären, was er zu dieser Nachtzeit ganz allein in dem so sorgsam geschützten Gemäuer tat und es war besser, niemand sah ihn. Dass der Passant, den er bei seinem Sprint fast zur Seite gestoßen hatte, ihm gefolgt war, fiel ihm nicht auf.
Hastig zwängte er sich durch den Spalt und zog das Tor wieder zu. Er wollte nicht, dass irgendjemand mitten in der Nacht die Polizei rief, weil es offenstand. Die Basilika hütete wertvolle Mosaiken und Monstranzen.
Sein Gewissen würgte ihn, als er, ein Mann der Kirche, allein, nachts, über den Vorplatz des Gotteshauses und durch dessen Garten eilte wie ein gemeiner Dieb, aber er verdrängte seine Gefühle. Lautlos holte er Kabel, Schutzhelm und Schlaghammer aus dem Schuppen der Arbeiter, die mit den Restaurierungsarbeiten beschäftigt waren, und drang über eine verfallende Treppe in die Ruine im Garten ein. Die Goten hatten Ravenna in uralten Zeiten für ein paar Jahrzehnte zu ihrer Hauptstadt gemacht und hatten es dabei auf immer verändert. Mehrere Kirchen stammten von ihnen und ihr Herrscher Theoderich hatte die Ruinen seines Prachtbaus in der Innenstadt hinterlassen. Es herrschte Streit darüber, ob es die waren, die hinter der Basilika lagen.
Über den mehr als tausendjährigen Ziegelmauern konnte Rante am wolkenbehangenen, regnerischen Himmel den Mond sehen. In den Katakomben erwartete ihn jedoch nur absolute Finsternis. Eine Fledermaus flog ihm mit weit ausgebreiteten Flügeln ins Gesicht und jagte ihm einen Schrecken ein. Sein Magen revoltierte. ‚Reiß dich zusammen und höre auf, zu jammern.‘
Mit zusammengebissenen Zähnen tastete er sich im Schein seiner Taschenlampe zu der Wand am Ende des einsamen Tunnels vor. Wasser gluckste unter seinen Füßen und es roch beunruhigend nach Moder und Algen. ‚Hier unten war schon lange keiner mehr, außer diesen Vermessern. Und das wird auch so bleiben.‘ Trotz seiner Furcht lachte Rante mit zitternder Euphorie.
Nachdem er die raue, von der Zeit zerfressene Mauer erreicht hatte, begann er, den eilig über mehrere Verlängerungskabel an eine Steckdose angeschlossenen Schlaghammer auszupacken. Das Kabel hing er mittels seines Schals an der Wand auf, um es aus dem Wasser herauszuhalten, das den Boden bedeckte. Er war sich bewusst, dass die Szene grotesk war. Seine Soutane hing nass an ihm herunter, sein graues Haar klebte am knochigen Schädel und seine Hände zitterten wie Espenlaub. Schlamm haftete an seinen Priesterschuhen und er keuchte. Verbissen ignorierte er das lächerliche Bild, das er abgab, und das hinter seinen Schläfen hämmernde Pflichtgefühl des Pfarrers, der sich anschickte, seine eigene Kirche zu bestehlen. Er drückte die Schultern durch. ‚Jesus hat dem Räuber am Kreuz ins Paradies verholfen. Hör auf zu zittern.‘
Mit eisigen Händen und laut rasselndem Atem setzte er den Schlaghammer an die algenbedeckten Fugen der Wand. Sekunden später flogen ihm berstende Steine entgegen und regneten zu Boden. Der Lärm, den er verursachte, erfüllte den Gang wie ein außer Rand und Band geratener Traktor und hämmerte auf sein Trommelfeld.
Trotz des von ihm verursachten Chaos und Getöses, war Rante stolz. Es hatte ihn kaum eine Stunde gekostet, um vom Restaurant in die Katakomben zu hasten, und nun erfüllte bereits Staub die Luft. Wenn nur die Angst nicht wäre. Immer und immer wieder drehte er sich um, um nach dem Ausgang zu schauen, in der Hoffnung, dass niemand sein Tun bemerkte und dass weder Wachen noch Carabinieri oder Anwohner die Treppen herunterkommen würden. Fast erwartete er, den Teufel in Person hinter sich zu erblicken, einen schwarzbefellten Mann mit glühenden Augen, wie auf den Bildern in der Kirche. Aber niemand kam. Kein Nachbar und kein Teufel. Auch kein Alarm schellte. Nur der Regen klatschte eintönig in den Treppenaufgang.
Rante hustete und schloss die Augen, um den Schlagbohrer erneut in Bewegung zu setzen. Er hatte Angst, dass die berstenden Gesteinsstücke seine Augäpfel treffen könnten. Seine Zunge war voller Staub und seine Nase schmutzverklebt.
Die Geschichte von einem französischen Abt, die man ihm vor einiger Zeit erzählt hatte, trieb ihn trotz Gefahr und Kälte voran. Der Abt Saunière war, so hieß es, vor hundert Jahren für ein gottvergessenes Dorf in Frankreich zuständig gewesen. Man hatte ihn aus den großen Städten verbannt wie ihn. Die Legende besagte, dass ein Teil eines unermesslichen Schatzes des alten Volkes der Goten nach einer verlorenen Schlacht nach Rennes-le-Chateau gebracht worden sei, in das Dorf, in dem Saunière damals Priester war. Dorthin, wo er eines Tages reich wurde. „Saunière wurde reich und niemand wusste, woher der Reichtum kam“, flüsterte Rante heiser in die Dunkelheit. „Reich!“
Er erschauerte bei dem Gedanken. „Wo ist der andere Teil dieses Schatzes hingebracht worden? Der größere Teil? Hem, wo?“, murmelte er grimmig. Er wischte sich den Dreck aus den Augen. Seine Brust schmerzte. „Und wenn mir der ganze Dreckhaufen hier auf den Kopf fallen sollte oder ich an einem Herzinfarkt sterbe: Das, was hier dahinter liegt, gehört mir. Mir allein!“ Er schnaufte wie ein verendendes Tier, bis zu den Knieen im Schutt.
Die Historienschreiber sagten, dass der Schatz von einem gotischen General zum Teil nach Rennes und zum größeren Teil nach Ravenna gebracht worden sei, wo der Gotenherrscher Theoderich ihn von da an gehütet habe. Aber als die Byzantiner die Goten nach Theoderichs Tod unterwarfen und der siegreiche römische Feldherr Belisar ihnen Ravenna wieder abnahm, fand er zwar wertvolle Güter, aber nicht den von ihm gierig gesuchten Schatz.
Rante presste den Bohrer erneut gegen die Wand, immer härter, mit versagenden Kräften und zusammengepressten Lippen. ‚Belisar hat den Schatz nie gefunden.‘ Er lachte.
Dann plötzlich knackste es. Ein Teil der Wand gab nach. Staub stieg in einer erdrückenden Wolke auf und nahm ihm den Atem. Steine kamen ihm entgegen. Er presste panisch den Arm übers Gesicht und drückte sich gegen die Seite des Ganges, bereit zu fliehen, falls die zerbrechenden Mauern das Gewölbe mitreißen sollten. Es roch erstickend nach Verfall und Staub. Dann wurde es ruhig.
Rante nahm den Arm herunter und lugte in die Finsternis. Sein Herz machte einen Satz. Ein Loch klaffte in der Mauer. Dahinter war es dunkel. ‚Dort ist ein Raum!‘
Zitternd griff er nach einem mächtigen Brocken, der ihn daran hinderte, in das Loch zu steigen, aber die scharfen Kanten zerschnitten ihm die Hände. Er fluchte, zog daran, schob, trat, schimpfte. Sein Herz raste und er rang nach Luft. Er hätte schreien und weinen wollen in seiner Hysterie. Dann bewegte sich der Brocken. Das enge Loch war frei. Rantes Knie schmerzten und seine Hose zerriss mit einem trockenen Geräusch, als er durch die Wand kroch. Es war ihm egal. Ihm war übel bei dem Gedanken, dass das Gewölbe nachgeben und ihn unter sich begraben könnte, aber er ignorierte die Gefahr. Im Licht seiner Lampe sah er hinter der Mauer einen Haufen Schutt und einen schmalen Hohlraum, nicht größer als zwei mal drei Meter.
Erst sah er nur Geröll, dann jedoch erblickte er einen einfachen Altar und darauf etwas Schimmerndes. Das Hochgefühl, das wie eine heiße Welle durch seine Adern jagte, machte ihn die Enge, die Gefahr und die stinkende Luft vergessen. ‚Dort ist etwas …!‘
Mit fliegendem Puls griff er nach dem glitzernden Ding, das unter den zerborstenen Steinen hervorlugte. Sein Atem versagte, so sehr schlug ihm das Herz in der Brust. Der Gegenstand war groß, kühl und metallisch. Er zog daran, auf Knieen, mit dem Bauch über den Steinbrocken. Das Geröll setzte sich in Bewegung und kam ihm entgegen. Sein Blut gefror in den Adern. Spitze Mörtelstücke bohrten sich in seine Haut. Er zog weiter.
Was er schließlich nach verbissenen Anstrengungen unter dem Schutt hervorholte, entpuppte sich als riesiger Teller. Rantes Puls raste. Er wollte lachen, jubeln. Wenn man ihn nur jetzt nicht entdeckte … Er verbiss sich das Gejauchze. ‚Bleib ruhig, alter Freund. Ruhig!‘
Er griff seine Beute und robbte hastig rückwärts in den Tunnel. Der Teller war so groß, dass er Mühe hatte, ihn durch das Loch in der Wand zu ziehen. Eilig schob er die Steine, die die Kammer verschlossen hatten, zurück in die Mauer, und verwischte die Spuren seines brutalen Einbruchs, so gut er konnte. Dann trug er sein Diebesgut zusammen mit Schlaghammer und Kabeln Hals über Kopf nach oben, die Treppen hinauf. Er verbarg es unter seiner Soutane und brachte es hinkend und ächzend zur Sakristei der Basilika. Schmutzig, staubig, atemlos, in der Stille der Nacht.
Er legte die Platte auf einen kargen Tisch im Nebenraum der Kirche.
Sie war ein Wunder.
Seine Knie gaben nach. Ein weicher, warmer Schimmer füllte auf einmal den Raum um ihn. Der Schimmer von Gold und Silber und dem verwunschenen Zauber der Vergangenheit. Es roch nach Mythos und erhabener Majestät. Es war, als sei Theoderich der Große zu ihm in den Raum getreten und lege ihm die Hand auf die Schulter. Das Gefühl, das Rante übermannte, war unbeschreiblich. ‚So müssen sich die Hirten gefühlt haben, als ihnen die himmlischen Heerscharen auf dem Feld erschienen.‘ Seine Haut glühte, seine Schläfen hämmerten und jede Faser seines Körpers frohlockte.
Bebend versuchte er, den enormen runden Gegenstand mit Taschentüchern zu reinigen. Antike Figuren enthüllten sich vor ihm wie Grüße aus der Ewigkeit. Ernste Augen in runden Gesichtern, umrahmt von Locken, auf denen Kronen prangten. Rante rannen Tränen über die Wangen. „Ein Missorium. Ein echtes Missorium der Goten!“
Der Geruch von Weihrauch lag in der Sakristei und zum ersten Mal in mehr als dreißig Jahren atmete er ihn so tief und glücklich ein, wie er es getan hatte, als er noch ein Kind gewesen war und davon geträumt hatte, Priester zu werden.
Es hieß, der Schatz der Goten habe wertvolle Missorien enthalten, Münzen und smaragdbedeckte Kelche, goldene Kronen und den Schatz des Tempels von Jerusalem. Rante fuhr mit zitternden Fingern über das Metall. „Ich halte einen Teil des Schatzes in den Händen. Ich bin reich!“ Er wollte nicht mehr unbedeutend sein, missachtet, ein Niemand. Dieser Teller hob ihn hinauf zu den Bedeutenden, zu denen, die existierten.
Er sah sich in der Sakristei um. Es war lange nach Mitternacht. Nichts rührte sich. Seine Freude verebbte und stattdessen übermannte ihn Gier wie eine schlammig gelbe Woge aus dreckigem Schaum. ‚Dieses Missorium ist Millionen wert. Und da, wo es lag, kann der Rest des Hortes nicht weit sein. Ich werde einer der reichsten Menschen der Welt sein. Ich werde alles finden.‘
Er sah in seiner unmäßigen Erregung nicht, dass ihn der Passant, den er in der einsamen Gasse vor der Basilika fast angerempelt hatte, noch immer von fern beobachtete.
Ein Jahr später
Die Stadt stand Land unter.
Es schüttete seit Tagen ohne Unterlass aus nachtfinsteren Wolken und Millionen von Tropfen schlugen auf den Pflastersteinen der alten Gassen Blasen. Die Eisschmelze spülte zusätzlich lehmfarbenes Wasser aus dem Gebirge in die Stadt, das sich mit dem Dauerregen mischte. Die Alpen liefen genau wie die Wolken über und ergossen ihren flüssigen Überdruss in die Tiefebene. Ravenna hatte seit Menschengedenken nicht mehr derartige Wassermassen über sich hereinbrechen sehen und allseits herrschte ein von Angst geprägter Ausnahmezustand. Die betagten Kirchen waren überflutet und die Straßen blockiert von Strömen von Schlick und Bäumen, die in ihnen getrieben kamen.
Ein hochgewachsener schlanker Mann mit dunklen Haaren und schwarzen Augen beobachtete in einer schäbigen Polizeiwache am Rand der Innenstadt die ihn umgebenden, von Panik geprägten Szenen. Eine aus Sandsäcken aufgebaute Barriere hatte dem Druck nicht standgehalten und war gebrochen. Daraufhin hatte sich eine schmutzig braune Woge die abschüssige Straße hinuntergestürzt und hatte diese, sowie ein tieferliegendes Einkaufszentrum überrollt. Auch der dunkelhaarige Beobachter hatte sich nur in letzter Sekunde in Sicherheit bringen können. Er hatte es jedoch mit weniger Angst getan als die anderen Passanten, die es mit ihm in die Station der Stadtpolizei verschlagen hatte. Seine Kleidung war im Gegensatz zu der ihrigen noch halbwegs trocken und die Wache schien ihm sicher. Sie war mit Betonbarrieren und Sandsäcken verstärkt. Niemand anderes teilte seine Ruhe.
Cariello war am Morgen auf einer wissenschaftlichen Notsitzung gewesen, die sich mit den Überschwemmungsschäden an den Kirchen befasst hatte. Er bedauerte es, sich dafür gut gekleidet zu haben. Seine Lederschuhe zeigten Wasserränder. Ansonsten entschloss er sich zu stoischem Abwarten.
Die Passanten und die Besucher des gegenüberliegenden Shoppingcenters hatten andere Gefühle als er. Sie flohen in heller Aufregung in die Wache, da das gegenüberliegende Einkaufszentrum drohte, einzustürzen. In völlig aufgelösten, durchnässten Gruppen fluteten sie auf der Suche nach Schutz in den Raum. Schreie und Schluchzen füllten die Luft.
Cariello zog sich auf einen Tisch zurück, da auch in der höherliegenden Polizeiwache das Wasser stieg. Er war versucht, sich die Ohren zuzuhalten. Alarmsirenen heulten aus der flachen Betonkonstruktion herüber und mehr und mehr lärmende Menschen drängten sich zwischen die zunehmend durchnässten Akten und die technischen Ausrüstungsgegenstände. Die Flüchtigen waren in Panik. Weder auf der Straße noch aus der Luft war ein Durchkommen. Nur drei junge Stadtpolizisten versuchten, der Lage Herr zu werden. Ihre Gesichter spiegelten schnell das Entsetzen der Leute wider. Man ignorierte sie und drängte sich in Gruppen aneinander, um sich zu wärmen, die Gesichter fahl und die Hände zitternd vor Kälte. Die Menschen hielten Handtaschen und Beutel über die Köpfe, um sie im mit ihnen hereinflutenden Wasser nicht zu verlieren.
Eine junge Frau, die von einem der Polizisten in Sicherheit gezogen wurde, begann heftig zu weinen und zu rufen, dass ihr Baby in der Kinderstation des Einkaufszentrums zurückgeblieben sei. Ihre Schreie hallten von den kahlen weißen Wänden der Polizeistation wider und gaben der Lage einen apokalyptischen Anstrich. Sie raufte sich die langen Haare und riss den überforderten Polizisten am Ärmel. Sie wollte zurücklaufen, um das Kleinkind zu retten, aber hatte Angst um ihre zwei größeren Kinder, die sich verzweifelt an sie klammerten und sie nicht gehen lassen wollten.
Cariello beschloss, dass es an der Zeit war, seine bequeme Stellung aufzugeben, und kam dem Polizisten zu Hilfe. Er sprang vom Tisch, auf den er sich gesetzt hatte, und griff die Frau bei der Schulter. „Beruhigen Sie sich. Wo genau haben Sie das Kind zurückgelassen?“ Die Frau riss in ihrer Panik den Mund auf, aber bekam vor Schluchzen kaum ein Wort heraus. Er fragte erneut und schüttelte sie, bis er begriff, wo sich das Kleinkind befand. „In der Babystation im unteren Geschoss?“
Sie nickte.
Cariello drehte sich um und blickte auf die tobenden Wassermassen vor den Fenstern. Sie wälzten sich sepiafarben und schäumend die abfallende Straße hinunter. Eisklumpen kamen in den braunen Fluten mitgetrieben. Es schien ihm unmöglich, die Gasse noch einmal zu überqueren. Er schüttelte den Kopf. ‚Ich werde mich am nächsten Treibholz aufspießen oder vom Wasser in einen Graben gezogen werden. Die Lage ist aussichtslos. Worauf warte ich also?‘ Bevor der Polizist ihn daran hindern konnte, sprang er ins Freie und stürzte sich in die schlammigen Wogen, die ihm schnell bis zum Nabel reichten. Das Wasser zog ihm die Füße weg und er wurde innerhalb von Sekunden zum Spielball der Fluten. Die junge Mutter verfolgte sein Unternehmen mit über dem Mund zusammengeschlagenen Händen, während er selbst seine Entscheidung schon in dem Moment bereute, als Ströme von Eis und Wasser in seinen Anzug drangen. Er fühlte sich, als sei er in eine Tiefkühltruhe voller gefrostetem Schlamm gesprungen.
Der kollektive Schrei der Menschen in der Wache hinter ihm warnte ihn und er drehte sich um. Bestürzt sah er, dass ein enormer Baumstamm die Straße hinuntergespült kam. Die sperrigen Wurzeln der Eiche füllten die gesamte Breite der Gasse aus. Es blieb ihm wenig Zeit, sich zu entscheiden. Seine Möglichkeiten zur Rettung waren begrenzt. Er konnte tauchen, den Rückzug antreten oder springen.
‚Du bist verrückt gewesen. Du bist noch keine Minute im Wasser und bezahlst schon für deinen Leichtsinn.‘ Ihm schauderte beim Gedanken, seinen Kopf in den eisigen Schlamm zu versenken, und Rückzug schien ihm keine Option. Er griff daher in letzter Sekunde eine der mächtigen, auf ihn zutreibenden Wurzeln und zog sich an ihr hoch. Das Unterfangen war mehr als gewagt. Die Rinde zerriss ihm die Hände und die Wangen. In der Kälte und mit der von der Nässe schwer gewordenen Kleidung kam es ihm vor, als würden seine Muskeln zerreißen. Es hatte Momente in seinem Leben gegeben, in denen er weniger in Form gewesen war als in diesem und in denen er seinen Wagemut mit dem Leben bezahlt hätte. Er hatte jedoch unverhofft Glück.
Noch während das Baumende unter seinem Gewicht ins Wasser gedrückt wurde, fand sein Fuß Halt und er konnte sich abstoßen. Mit einem halsbrecherischen Sprung überquerte er den breiten Wurzelballen und erreichte den Eingang des Einkaufszentrums, erneut bis zur Hüfte umtobt von Schlamm und Schlick. Er spuckte den Dreck aus, der ihm den Mund füllte, und hielt sich hustend und keuchend an der Wand fest. ‚Wieso hast du Idiot den Helden spielen müssen? Dein Portemonnaie ist nass, dein Anzug dahin und dein Leben hängt an einem seidenen Faden.‘
Jemand rief etwas hinter ihm. Er wandte sich um und sah, dass ihm der Polizist, der die junge Mutter gerettet hatte, gefolgt war. Auch der Uniformierte hatte Mühe, das flache Betongebäude des Einkaufszentrums zu erreichen. Er schlug heftig im Wasser um sich, griff ein Geländer und versuchte, sich daran hochzuziehen, aber seine Lage wurde schnell prekär. Der Baum war zwar weitergetrieben, aber neuerliche Schlammwogen schwappten über seinen Kopf. Cariello sprang vor und griff den unter Wasser geratenden Mann am Kragen. Mit vor Kälte schmerzenden Händen zog er ihn in Sicherheit. Einen Moment standen sie beide an einen Türrahmen geklammert, dann konnten sie sich entgegen der Strömung ins Innere des Gebäudes ziehen.
Dessen moderne Glastür war längst zersprungen und vom Strom die Straße hinuntergetrieben worden. Rot-blinkende Werbung gab der Szene um sie etwas Surreales, als hätten sie den Angriff Außerirdischer abzuwehren, statt die Resultate einer übermäßigen Schneeschmelze. Cariello wunderte sich, dass die Elektrik noch funktionierte, und war zugleich darüber beunruhigt. Das Wasser leitete den Strom.
„Das nächste Mal überlassen Sie die Heldentaten den Ordnungskräften“, schimpfte der junge Uniformierte neben ihm.
Cariello schnalzte ironisch mit der Zunge. „Sie wollten die Fische wohl allein füttern?“ Er stieß sich ab und kraulte mehr, als dass er lief, durch die Korridore und die darin schwimmenden Waren. Es dauerte lange, bis sie die Babystation fanden. Eine ältere Dame mit rotgefärbten Haaren und tränenverschmierten Wangen hatte sich darin mit fünf heulenden Knirpsen auf eine Pyramide von Kindermöbeln gerettet. Sie kamen in letzter Minute.
Als Cariello und der Polizist mit den Kindern im Schlepptau am Eingang des Einkaufszentrums erschienen, wurde ihr Auftauchen von der anderen Straßenseite mit Jubelrufen begrüßt. Cariello verstand schnell, warum. Die Betonstruktur über ihnen war vom Wasser umspült, wie ein Fels in der Brandung, und ein Teil des Daches hatte nachgegeben. Er nickte dem Polizisten und der Erzieherin zu. „Wir sollten uns beeilen, bevor unser Schiff endgültig sinkt. Los! Es bleibt keine Zeit.“
Er und der Uniformierte hatten jeder zwei Kleinkinder auf den Arm genommen und die füllige Erzieherin folgte mit dem fünften Kind an ihre Brust gedrückt. Die Frau hatte schon allein Mühe, sich gegen die Fluten zu stemmen, geschweige denn mit dem schreienden Kind als Bürde. Ihre roten fleischigen Wangen blähten sich in Panik, ihre Haare waren nass und klebten ihr am Kopf. Sie gestikulierte um Hilfe, außer Atem und hysterisch vom Warten in dem sturmumtosten Gebäude, aber sie ließ das Kind nicht los. Cariello griff die tapfere Frau am Arm und schob sie im Schutz seines Körpers voran. Das Wasser zog ihm erneut die Füße weg und er hatte Mühe, in der eisigen Flut zu atmen. Er hatte die beiden größeren Kinder genommen, ein etwa dreijähriges Mädchen und einen nur wenig älteren Jungen. Mit schmerzenden Armen hielt er sie über Wasser und auch seine Kräfte kamen dabei zunehmend an ihre Grenzen. Die Kinder sahen ihn stumm mit angstgeweiteten Augen an.
Einige der die Szene beobachtenden Männer und eine junge Frau warfen sich aus der geschützten Polizeistation in den Strom, um der sich verzweifelt vorwärts kämpfenden Gruppe zu Hilfe zu kommen. Sie befanden sich jedoch bald selbst in Not und stemmten sich panisch gegen das schlammige Wasser. Die Kinder streckten ihnen die Arme entgegen und weinten, aber die Erwachsenen schrien bereits ihrerseits um Hilfe. Einer der willigen Retter, ein fülliger Mann, begann, in der Furcht zu ertrinken hysterisch um sich zu schlagen. Sein Gesicht wurde puterrot und er keuchte mit weit geöffnetem Mund. Angsterfüllt langte er nach dem Polizisten und hielt sich an ihm fest. Sein Gewicht brachte den Uniformierten gefährlich aus dem Gleichgewicht. Einen Moment sah es aus, als ob der Mann, der Polizist und die Kinder untergehen würden. Dann machte der Polizist von seinem Schlagstock Gebrauch: „Ich werde Sie vor Gericht bringen, wenn Sie noch einmal versuchen, sich an mir festzuhalten und die Kinder auf meinen Armen gefährden.“
Cariello versuchte, mit zusammengebissenen Zähnen Ruhe zu bewahren. Er brachte die Kinder, die er trug, in die Polizeistation, kehrte zurück und zog die füllige Erzieherin und das Kind, das sich krampfhaft an sie presste, ins Trockene. Dann kehrte er erneut zurück, um den panischen Mann zu bergen, der sich in Tränen an einer Straßenlaterne festhielt. Mit Mühe und Not brachte er schließlich den aufgeregten Haufen Menschen zusammen mit dem Uniformierten zur Vernunft und in Sicherheit.
In der Wache stellte die Gruppe der dort Ausharrenden inzwischen Tische übereinander, kletterte darauf und öffnete eine Dachluke. Sie stiegen voneinander gestützt auf das Flachdach, wo sie mit Planen einen Behelfsschutz gegen den tobenden Regen bauten. Unter diesem versammelten sich die verschreckten Menschen, die einer nach dem anderen nach oben geklettert kamen. Sie flohen vor dem immer noch steigenden Wasser, pitschnass, verfroren, aber im Moment in Sicherheit.
Cariello zog sich als einer der Letzten aufs Dach. Sein Magen war in Aufruhr und seine Beine gaben vor Erschöpfung nach, aber er atmete auf. Er hatte mit einem schlimmeren Ausgang des Dramas gerechnet. Alle Kinder waren geborgen worden und keiner der Retter fehlte zum Appell. Das Weinen wurde leiser und machte frierender, aber hoffnungsvollerer Stille Platz. Die verschreckten und erschöpften Menschen wurden eine halbe Stunde später vom Militär gerettet.
Der jugendliche Chef der Polizeistation nickte Cariello, der als einer der Letzten ausharrte, schließlich freundlich zu. „Nach Ihnen, mein Herr. Sie sind der Held des Tages, aber bei sinkenden Schiffen muss der Kapitän als Letzter von Bord gehen, sonst bekommt er Ärger mit der Hierarchie.“
Cariello lachte. „Warum sind die Helden im Film immer so viel präsentabler als wir beiden Schmutzgestalten?“ Er war erleichtert. Die Sturzfluten hatten an diesem Tag entgegen aller Wahrscheinlichkeiten kein einziges Opfer gefordert.
Auf dem Weg in die Unterwelt
Am Morgen nach der sintflutartigen Überschwemmung der Stadt war Cariello in hohen Gummistiefeln am Dom von Ravenna unterwegs. Er hatte sich eine Regenjacke übergezogen, die mit ihrem Dunkelgrün an eine Dschungelausrüstung erinnerte. Das Wasser der Regentropfen, die nur noch sporadisch vom Himmel fielen, perlte in langen Linien von ihr herab. Er stieg durch Wasserlachen und über Treibholz, dem Anschein nach unbeeindruckt von den Ereignissen, die er am Tag zuvor erlebt hatte. Sein Gesicht war verschlossen und er schwieg. Ein Stock half ihm, nicht im glitschigen Morast auszugleiten. Er umrundete mit Schlick bedeckte Fahrzeuge, die wie Leichname urzeitlicher Ungeheuer am Rand der Wege standen, und kletterte über am Boden liegende Caféhausstühle. Seine Augen glühten jedoch trotz seiner anscheinend stoischen Ruhe bei jedem Schritt finsterer.
Das Bild der Zerstörung vor ihm ärgerte ihn genauso sehr wie die Tatsache, dass er es allein zu betrachten hatte. Ein hässlicher Vorfall vom Morgen des Vortags ging ihm nicht aus dem Sinn.
Er seufzte. Ravenna, die malerische Rabenstadt der Goten, war berühmt für ihre uralten Gebäude und die spektakulären Mosaike ihrer Kirchen. Das Hochwasser der vergangenen Tage hatte sich wie ein Schlaghammer durch ihre historische Pracht gewühlt. Zwischen der Basilika San Vitale und den Ruinen des antiken Palastes Theoderich des Großen war der größte Schaden entstanden. Ein breiter Bereich des weichen Bodens war unterspült worden. Ein unterirdischer Hohlraum, dessen Existenz bis dahin unbekannt gewesen war, hatte dem Druck des Wassers nachgegeben und der Boden darüber war in das sich öffnende Loch gestürzt.
Der angerichtete Schaden war beträchtlich. Der gepflegte Garten vor der tausendfünfhundert Jahre alten Kirche war durchwühlt, als hätten Ochsen einen Pflug hindurchgezogen. Das berühmte Mausoleum der Galla Placidia war von Schlamm beschmiert und das Wasser stand hüfthoch darin. Es verwandelte den noblen Raum mit seiner von einem blau-goldenen Sternenhimmel geschmückten Decke in ein lehmgelbes Schwimmbad. Das Gras der Rasenflächen davor war zerstört und Schlick bedeckte alles in brauner Einheitlichkeit.
Cariello sah sich mit zunehmender Sorge die Schäden an. Am Vortag hatte man ihn als Archäologen mit verlässlichen Architekturkenntnissen für zuständig erklärt, die Mosaike und die Wände der Kirche zu untersuchen und an den Stellen Maß zu nehmen, an denen es einer dringenden Stützung der brüchigen Strukturen bedurfte. Die Furche über seiner Nasenwurzel wurde von Minute zu Minute tiefer. Er schritt den Garten ab und begann zu fluchen, ohne einen Zuhörer zu haben, der seine Trauer hätte teilen können. Die sonst so viel besuchte Anlage war aufgrund des Wetters menschenleer.
Cariello zog seine Gummistiefel mit jedem Schritt mühsam aus dem morastig riechenden Schlamm und hielt schließlich am Rand des zerfurchten Rasens inne. Prüfend stampfte er auf den Boden vor sich, nicht sicher, ob er ihn tragen würde. Er bereute seine Handlung umgehend. Ein knarrendes Geräusch war zu hören und die durchwühlte Erde gab wie schon an anderen Stellen nach. Ehe er es sich versah, brach er mitsamt der Hälfte der Grünfläche in eine darunterliegende Katakombe ein. Sein Sturz ging ins Bodenlose.
Steine und halb gefrorene Erde begleiteten seinen Fall. Ein gewaltiger behauener Brocken löste sich aus der einstürzenden Wand und traf mit einem dumpfen Geräusch sein Bein. Er brüllte vor Schmerz, aber keiner hörte ihn. Eine Woge von Schlamm ergoss sich stattdessen klatschend in das Innere seiner Kleidung. Sie war eisigkalt, als ob die Hand eines in den Katakomben verborgenen Skeletts nach ihm greifen würde. Sand und Morast stürzten mit ihm nach unten. Er schlug um sich und schob die Erde vom Gesicht weg, um nicht zu ersticken. In der zusammenstürzenden Wand aus Schlamm und Erde fand er keinen Halt. Er bekam nur weichen Dreck in die Finger und das Glück erwies sich ihm weniger hold als am Vortag. Cariello versank innerhalb weniger Sekunden in erstickender, sumpfig kalter Nacht in der Tiefe der Erde, auf dem Weg in die Unterwelt.
Als er seine Augen wieder vom Dreck befreite, fand er sich zu seiner Verwunderung in einem gemauerten Raum wieder. Vor ihm stand, bedeckt von einem Berg von Schlamm, ein grob gehauener Altar. Cariello starrte darauf, ohne zu begreifen, was er sah und wo er sich befand. Sein Bein schmerzte stechend und sein Schädel pulsierte wie von einem Schlaghammer getroffen. Erde füllte seinen Mund. Er blinzelte, spuckte und wischte sich den Schmutz von den Lippen. Dann sah er erneut auf den Steintisch. Er hatte noch wenige Minuten zuvor geschützt vor den Augen Unbefugter die Gezeiten überdauert. Seine Marmorplatte war an den freiliegenden Stellen trocken und von Staub bedeckt. Über ihm schwebte an einem Haken ein kreisrunder Reif, von dem in unerwarteter Friedlichkeit Spinnweben hingen. Ein massiver Teller stand darauf, dessen Metall so feinziseliert unter den Erdmassen hervorglänzte, dass Cariello erschauerte. Er hatte einen unerhörten Fund gemacht.
Adrenalin ließ ihn für einen kurzen Augenblick die Eiseskälte des Wassers vergessen, das über ihn rann. Er grub sich aus der ihn umgebenden Erde und versuchte, seine Umgebung zu erkunden. Der Raum war klein, achteckig und ursprünglich von einer nun in sich zusammengebrochenen Gewölbedecke geschützt gewesen. Seine Mauern bestanden aus grob behauenem Stein. Die Wände waren brüchig und wurden langsam vom herabströmenden schlammigen Nass des Regens durchtränkt. Keine Treppe und keine Tür führten aus dem in der Tiefe liegenden Saal. Der ursprüngliche Zugang musste sich dort befunden haben, wo sich jetzt Erde und Gestein häuften. Wasser bedeckte zunehmend den Boden und hoch über sich sah Cariello das fahle Licht der Wintersonne hereinscheinen. Er fluchte. ‚Wie soll ich aus diesem feuchten Grab herauskommen, um der Welt von meinem Fund zu berichten? Wie komme ich überhaupt wieder lebend aus dieser Kapelle heraus?‘
Sein Schädel dröhnte und sein Bein trug ihn nicht mehr. Es schmerzte erbärmlich. Cariello starrte nach oben. Er befand sich mehr als acht Meter tief unter Tage und bis zur Hüfte begraben in Schlamm und Erde … Und er hatte einen Fund gemacht.
Therese ist außer sich
Das möblierte Zimmer in Ravenna war schlicht und nur für einen Monat gemietet. Die überall aufgehängte nasse Kleidung gab ihm das Aussehen eines Feldlagers. Gummistiefel, Regenjacken und Pullover hingen am gekachelten Ofen. Ein aufgeklappter Schirm stand daneben. Grauer Nebel hing vor dem Fenster und die junge Bewohnerin hatte mehrere Lampen angezündet, die das Zimmer mit ihrem Licht erwärmen sollten, es jedoch nur noch fahler und trister wirken ließen.
Therese hatte den Kopf in die Hände gestützt und starrte in die Wolken, die sich erneut am Himmel zu türmen begannen, und den kaum erst erschienenen Sonnenschein des Morgens verjagten. Sie fühlte sich elend und erkältet.
Seit Wochen hatte sie an Ausgrabungen nahe der Basilika der Rabenstadt mitgewirkt. Cariello hatte sie überredet teilzunehmen, obwohl sie sich geschworen hatte, nicht mehr ihm zu arbeiten. Sie hatte nachgegeben und es bereits bereut, als er sie am Bahnhof abgeholt hatte. Ihr ehemaliger Professor hatte vor dem schlichten Gebäude gestanden und ihr reserviert zugenickt, die Lippen zusammengepresst, den Rücken steif und die Augen dunkel. Sobald er auftauchte, kribbelte es in ihrem Magen, aber die Schmetterlinge in ihrem Bauch blieben gefangene Insekten, die sich mit der Zeit in wütende Hornissen verwandelten. Sie suchte eine feste Beziehung, aber immer, wenn sie sich auf die Suche begab, tauchte Cariello auf. Cariello, mit Zornesfalten der Eifersucht, sobald er einen Mann in ihrer Nähe sah. Und Cariello, der ihr nie auch nur eine persönliche Frage stellte. Der immer den letzten Knopf seines Hemdes zuknöpfte und flamboyante Erklärungen einem vertraulichen Dialog vorzog. „Es wird Zeit, dieser Irrsinn hat ein Ende“, murmelte sie grimmig.
Sie biss auf einen Stift, mit dem sie wirre Anmerkungen in ein Notizbuch geschrieben hatte. Ihre Unordnung spiegelte das Chaos in ihrem Inneren wider. Sie hatte ein Recht, Beachtung zu verlangen. Sie war intelligent und verlässlich und zog selbst in der Provinzstadt Ravenna mit ihrer blonden Lockenpracht die Blicke auf sich. Nur einer beachtete sie nicht. Cariello.
Wenn man sie und ihn bei den Ausgrabungen sah, vermutete jeder, sie seien ein Paar. Der Superintendent der Region hatte es sich am Morgen des Vortags nicht versagen können, Cariello in ihrer Gegenwart zu seinem ‚Fang‘ zu gratulieren. Er hatte süffisant gemeint, es würden ja sicher sehr ‚schöne‘ Grabungen werden. Therese hatte in ihrem Zorn nichts zu sagen gewusst. Und ihre Wut war noch gestiegen, als Cariello es für nötig gehalten hatte, den Superintendenten kühl darüber aufzuklären, dass er nicht pflege, mit seinen Mitarbeiterinnen und Studentinnen zu schlafen. Seine Augen hatten dabei den Mann in ihrer Eiseskälte zu einem Nichts reduziert. Und Therese hatte sich geschämt, einen Augenblick erfreut gewesen zu sein, dass man ihr eine Liebschaft mit Cariello unterstellte. ‚Du benimmst dich wie ein Schulmädchen. Warum, verdammt noch mal, hast du nichts gesagt und dabeigestanden, als hättest du weder einen Mund noch ein Gehirn?‘ Sie hätte sich ohrfeigen können und kämpfte zur gleichen Zeit mit den Tränen. ‚Du bist erwachsen. Du bist nicht mehr seine Studentin. Benimm dich endlich so.‘
Ihr Telefon läutete und sie sah auf die Anzeige auf dem Bildschirm. Es war Cariello. „Wenn man vom Teufel spricht …“ Sie stieß das blinkende Gerät weg. „Soll doch der erhabene Herr Professor seine West- oder Ostgoten allein ausgraben.“ Sie hatte seit Tagen im Schlamm gewühlt, umgeben von Nässe und Kälte. Immer im Regen und nur, um vor den Wassermassen zu retten, was nicht mehr zu retten war. ‚Cariello will mich sicher erneut zum Sacktragen anfordern.‘ Sie hatten seit Tagen Sandsäcke getragen. Therese steckte unwirsch ihre Haare zusammen. Natürlich wollte sie Ravennas Kirchen retten, aber nicht mehr mit Cariello. Sie kam sich vor wie ein unterbezahlter Bauarbeiter. Ein Maultier, dem man Karotten versprach und das ihnen nachlief.
Das Telefon hörte nicht auf zu blinken. Sie fluchte und drückte schließlich auf den grün leuchtenden Knopf. „Ja?“
Cariellos Stimme klang eigenartig gezwungen und wie aus weiter Ferne zu ihr. „Therese. Wo sind Sie? Können Sie zur Basilika kommen?“
Sie setzte sich auf und zog die Brauen zusammen. Ihre Stimme klang eisig, als sie antwortete. „Professor. Guten Morgen. Ja, ich habe gut geschlafen. Ich hoffe, Sie haben gut gefrühstückt und auch gut geruht.“ Sie war sich ihres beißenden Tons bewusst. Tränen traten in ihre Augen und sie beschloss, noch am gleichen Tag abzufahren. Sie würde sich nicht noch einmal lächerlich machen.
Ein Schweigen und dann ein Räuspern am anderen Ende der Leitung ließ sie innehalten. „Ich habe Sie gestern verärgert. Ich weiß. Verzeihen Sie mir.“
Therese musste schlucken. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass Cariello bewusst war, was er tat. Sie hatte vor einem Jahr froh reagiert, als er sie nach Venedig gerufen hatte, und er war ihr ebenfalls erfreut erschienen, sie dort in der Lagunenstadt zu treffen. Sie hatten zusammengearbeitet und waren sich nähergekommen. Und dann war er zu seiner üblichen Kühle zurückgekehrt. Ethisch korrekt. Distanziert. Er schlief nicht mit seinen Studentinnen. Sie bemerkte, wie ihr heiß wurde, aber versuchte, ruhig zu erscheinen. „Es ist mir egal, ob Sie sich entschuldigen. Ich habe genug von Ihrem Benehmen. Suchen Sie sich eine andere Aushilfskraft, ich bin dabei abzureisen.“
Am anderen Ende der Leitung herrschte erneut das eigenartige Schweigen. Cariello hustete rau, dann antwortete er unerwartet zurückhaltend. „Ich dachte, Sie hätten das hier sehen wollen. Ich bin in eine alte Katakombe gebrochen. Leider kann ich mich nicht darum kümmern, sie zu vermessen und zu sichern. Das Sanitätspersonal besteht darauf, mich wegzubringen.“ Er fügte ein kurzes Lachen hinzu, um die Situation zu überspielen. Therese hielt inne. Sie hörte Cariello sein Zögern an. „Es ist nichts. Ein paar Steine, die auf mein Bein gefallen sind, aber es wäre mir lieb, wenn jemand hierbliebe, dem ich vertraue.“
Therese zog die Stirn in Falten. ‚Soll ich mich freuen, dass ich ‚jemand‘ bin, dem er vertraut? Er bringt es noch nicht einmal fertig, mich um etwas in aller Form zu bitten.‘ Sie entschied, dass sie weder eine Person seines Vertrauens sein wollte noch sein Mädchen für Alles. Ihre seit dem Vortag brodelnde Wut ging mit ihr durch. „Ich bin nicht dazu da, zu springen, wenn Sie pfeifen. Ich habe die Nase voll davon, für Sie Sandsäcke zu schleppen, egal, ob es zu einer Kirche ist oder zu einer Katakombe. Für immer. Voll. Ich habe auch genug von Ihrem Schweigen, Ihrer Nichtachtung und Ihrem Hochmut. Verarzten Sie Ihr Bein, wie Sie wollen. Es ist mir egal.“
Sie lauschte in den Hörer. Nichts. Es war Ruhe. Sie sah auf den Apparat. Die Verbindung war unterbrochen.
Tränen begannen, ihr übers Gesicht zu laufen und sie hätte sich ohrfeigen können. Sie hatte den bekanntesten Professor Italiens beleidigt und ihm eine Abfuhr erteilt. Eine lächerliche Abfuhr an einen Mann, der sie regelmäßig distanziert ignorierte, und in den sie schmerzhaft verliebt war. Ein Kloß setzte sich in ihrem Hals fest. Wenig später lief sie mit zusammengepressten Lippen zum Bahnhof und fühlte sich dabei zugleich vernünftig und kindisch. ‚Es ist Cariello mit Sicherheit egal, was ich fühle und denke. Ich bestrafe ihn mit einer Abreise, die ihm nichts bedeutet. Es wird Zeit, das alles hat ein Ende.‘
Es fing erneut an zu regnen.
Cariello ist außer Gefecht
Wind war aufgekommen und blies den erneut fallenden Nieselregen über den Kirchgarten. Er hing in Tropfen in den Buchsbaumhecken und den Gräsern. Alles wirkte grau und trostlos, umfangen vom Winternebel, der die Sonne abermals verschluckt hatte.
Cariello saß in lehmbeschmierter Kleidung neben dem Erdloch, aus dem man ihn mit viel Aufwand gezogen hatte. Er hatte die Notrufnummer wählen müssen, da niemand auf sein Rufen reagiert hatte. Sein Bein blutete und die dunkelrote Flüssigkeit mischte sich mit dem Schlamm, der seine Hose bedeckte und aus dem Gummistiefel quoll. Er sah nicht auf die Wunde, aber war sich bewusst, dass der Knochen offen lag und weiß unter der zerrissenen Kleidung hervorglänzte. Der Schmerz in seinem Bein und seiner Hüfte war beißend. Er nahm ihm den Atem und trieb ihm kalten Schweiß auf die Stirn.
Niemand von den Umstehenden sprach ihm sein Mitleid aus. Jeder ging seinen Aufgaben nach. Er, der sonst so flamboyante, souveräne Akademiker, war für einen Augenblick hilflos. Sprachlos. Gerettet wie ein aus einem Schlammpfuhl geborgenes Fahrzeugwrack. Man hatte ihn gefragt, was geschehen war, und seitdem ignorierte man ihn und sicherte vorerst die Grube. ‚Hoffentlich sieht mich niemand in diesem Zustand‘, dachte Cariello zähneknirschend. ‚Meine Kollegen würden jubilieren.‘ Erfolg brachte Neider mit sich und er hatte in den letzten Jahren viel Erfolg gehabt. Seine Bekanntheit schien in diesem Moment jedoch niemanden zu interessieren. Er war von einem angesehenen Professor innerhalb von Minuten zu einem Objekt der öffentlichen Notfallversorgung geworden, das man weiterreichte, aber mit dem man nicht sprach. Die Feuerwehr hatte sich um die praktische Frage seiner Bergung gekümmert. Die Polizei hatte den Ort abgesperrt. Sanitäter verbanden ihn. Aber niemand fragte auch nur nach seinem Namen. Ihn hatten im wahrsten Sinne des Wortes alle guten Geister verlassen. Sein Assistent litt seit Tagen an einer Erkältung, seine Studenten waren zum Frühlingssemester in ihre jeweiligen Hörsäle zurückgekehrt und nur Therese wäre da gewesen, um ihm zu helfen, aber seine Beziehung zu ihr hatte sich in den letzten Tagen dramatisch verschlechtert.
Er presste die Lippen zusammen. ‚Diese wunderschöne junge Frau hat jeden Tag treu an meiner Seite gestanden und hat versucht, mit mir die Ausgrabungen an den Kirchen von Ravenna durch Sandsäcke vor dem Regen zu retten. Und ich kommentiere jeden Abend die Zahl der Säcke und die Höhe des Schlamms, ohne ein freundliches Wort oder Anerkennung für sie.‘ Er fluchte und seine Hände gruben sich in den ihn umgebenden Dreck. ‚Ich bin so ein gottverdammter Idiot. So ein Kretin, diese intelligente Frau so zu beleidigen und diesem Superintendenten zu vermitteln, es sei absurd zu vermuten, Therese könnte auf mich anziehend wirken. Wann ist mir das passiert, dass ich so ein Narr geworden bin? Ich hätte diesem machohaften Gockel etwas anderes antworten sollen.‘
Er saß im wiedereinsetzenden Regen auf dem nassen Rasen und ihm wurde trotz der Decke, die man ihm gegeben hatte, so kalt, als ob seine Knochen gefrieren und seine Muskeln zu Eisklumpen würden. Ein unkontrolliertes Zittern erfasste seine Glieder, alles rings um ihn war feucht und klamm, selbst seine Lippen fühlten sich taub an. Zum ersten Mal seit Langem wurde er von Mutlosigkeit übermannt.
Er rang nach Luft und schüttelte sich, um den schwarzen Schleier zu verjagen, der sich über seine Augen zu legen begann. Es wäre ihm peinlich gewesen, bewusstlos zu werden. Er fragte sich, ab welcher Temperatur man die Kälte nicht mehr spürte und in der vermeintlich einsetzenden Wärme erfror. Alles war besser als das. Ein beißender Schmerz in seinem Bein rief ihn in die Realität zurück. Einer der Sanitäter hatte sich vor ihn gekniet und hantierte an seinem Gummistiefel herum. Der Mann versuchte, mit plastikbehandschuhten Händen eine Schiene anzulegen.
„Schmerzt das Bein?“ Sein Ton war so professionell ruhig, dass er auch nach der Uhrzeit hätte fragen können.
„Nein“, antwortete Cariello.
Im Vergleich zu dem, wie er sich anderweitig fühlte, tat das Bein gar nicht weh genug.
Ein Priester macht sich Sorgen
Die alte Basilika San Vitale lag grau und gewaltig im Schneeregen, der sich in bedrückender Tristesse über die Stadt ergoss.