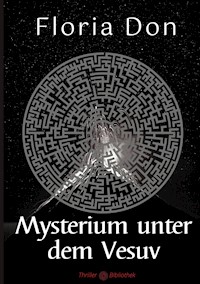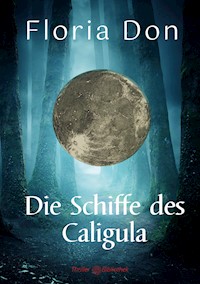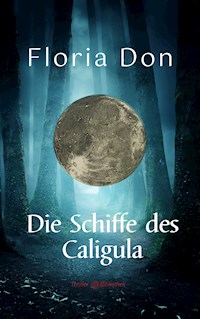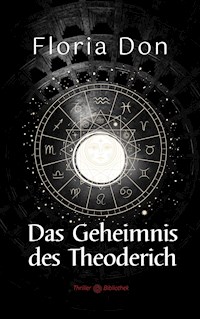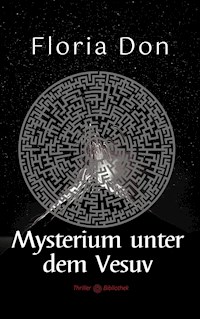
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Stil von ‚Name der Rose‘ und ‚Da Vinci Code‘ entführt das Buch ‚Aus Verborgenen Orten‘ den Leser auf eine spannende Jagd nach einem mysteriösen Schriftstück, das in den Tiefen des vom Vesuv verschütteten Herculaneum verborgen zu sein scheint. Es soll einen essentiellen Hinweises, von Bedeutung für die Zukunft der Menschheit, enthalten. Die Geschichte beginnt, als der behäbige Carabiniere Camarata mit einem Mord an einem brillanten Wissenschaftler konfrontiert wird, den ein greiser Archäologe in einem Tunnel in der Lava in den Ruinen Herculaneums entdeckt. Er konsultiert daraufhin einen Spezialisten, den neapolitanischen Professor Cariello, der schon bald eigenartigen Hinweisen in Bezug auf antike Gebeine und einem uralten Mordfall nachgehen muss. In einer berauschenden Atmosphäre, die sich des Kontrasts zwischen dem sonnenbeschienenen Golf von Neapel und den dunklen Gängen im Tuff des Vesuvs bedient, dreht sich die Handlung des Buches um tatsächliche historische Ereignisse, abenteuerliche Detektivarbeit und eine romantische Affäre. Die Geschichte beruht auf Tatsachen und wirft Licht auf tatsächliche Geheimnisse, die bis heute nicht gelöst wurden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Unter der Lava
Ein Erschlagener unter dem Vesuv
Ein Wunder
Seltsame Details
Gänge unter dem Vulkan
Mütterliche Kälte
Heimatliche Gefühle
Professor Cariello
Ein überraschendes Wiedersehen
Der geheimnisvolle Tunnel
Der Kolonel trifft einen ersten Verdächtigen
Der Professor hat eine Spur
Therese erlebt Eigenartiges
Feinseliges Zusammentreffen
Was vor langer Zeit geschah
Raubgräber
Morgendämmerung
Unangenehme Anrufe
Schwere Rückkehr
Auf der Spur des Vatikans
Ereignisse in der Nationalbibliothek
Der Name des Franzosen
Der Kolonel fürchtet Konsequenzen
Erschütternde Ereignisse
Der Fundort des Franzosen
Das Geheimnis der Villa
Die rätselhafte Karte
Familienbande
Ein gefährlicher Weg
Abstieg ins Ungewisse
Eine atemberaubende Entdeckung
In Lebensgefahr
Der verschwundene Papyrus
Unangenehme Enthüllungen
Die Wache
Cariello erinnert sich an ein Detail
Ein Rückruf
Das mysteriöse Paket
Böse Überraschung
Alte Spuren
Das Rätsel der Bilder
Marsilys Brief
Im Fieber
Das Rätsel der Färse
Die Papyri Epikurs
Da, wo mein Haus ist
Im Schock
Der zweite Tunnel
Das Schicksal eines Mörders
Bittere Rettung
Am Grab
Letzte Worte
Das Glück
Impressum
Dieses Buch basiert auf historischen Begebenheiten und realen Schauplätzen. Seine Handlung ist fiktiv.
So ist also der Tod, das schrecklichste der Übel, für uns ein Nichts:
Solange wir da sind, ist er nicht da,
und wenn er da ist, sind wir nicht mehr.
Epikur
Unter der Lava
Er konnte die Hand nicht vor Augen sehen. Kein Laut war zu hören, außer dem Glucksen von Wasser, das über die Wände des Ganges lief und von den Stalaktiten tropfte. Der modrige Geruch von Algen und Stein drang ihm in die Nase. Darunter lag ein anderer, süßlicher Geruch, der so intensiv war, dass er ihn auf der Zunge schmecken konnte. Der von Blut.
Manzoni fingerte nach der Taschenlampe und drehte sie an. Zitternd richtete er den Strahl ein zweites Mal vor sich auf den Boden des engen Tunnels unter der Lava. Der Tote lag noch immer da. Er konnte keine vierzig Jahre alt sein. Sein blondes Haar war nass von der karminroten Lache, die sich unter seinem Kopf gebildet hatte. Die grauen Augen standen weit offen, genau wie der sandgefüllte Mund, in dem die Zunge wirkte wie ein totes Reptil.
Manzoni versuchte, sich an der Wand festzuhalten. Er hatte den Eindruck, dass der Grabungstunnel schwankte. Er hatte diese Art von Stollen zusammenbrechen sehen. Einmal war einer von ihnen von hereinflutendem Grundwasser gefüllt worden und er wäre beinahe darin ertrunken. Anderswo gab es Stellen, da musste er sich mit Atemmaske fortbewegen, weil Vulkangase in die Gänge drangen. Aber er hatte noch nie Angst vor ihnen gehabt. Niemand wagte sich mehr hier herunter, aber er? Er war hier zu Hause.
Jetzt hatte sich alles geändert. Er fürchtete sich. Sein Herz hämmerte in wilden Sätzen bis zum Hals und er hatte Mühe, zu atmen. Kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn. Nicht der Tote schreckte ihn, sondern der Vulkan, der ihn umgab. Es war, als würde er grollen.
Manzoni wandte sich um und taumelte zum Ausgang, die Knie weich und die Glieder bebend. Hier unten hauste der Tod und der Nächste, den der Berg sich holen würde, war er selbst. Seit heute gehörte er ihm.
Ein Erschlagener unter dem Vesuv
Camarata ächzte und hätte am liebsten nach Hilfe rufen wollen, wenn er sich nicht davor gefürchtet hätte, sich lächerlich zu machen. Er rieb sich übers derbe Gesicht mit den buschigen Brauen, verschwitzt und überanstrengt. Die Wände des Stollens klemmten ihn ein. Durch die Enge des Tunnels was sein Gesicht ihnen so nah, dass er fürchtete, sich die Haut an herausstehenden Kieseln aufzureißen. Seine untersetzte Gestalt mit den breiten Schultern machte ihm die Durchquerung des Ganges nicht leichter. Er schob sich weiter und verfluchte die Tatsache, dass man von ihm erwartete, in den Berg hineinzukriechen, anstatt aus ihm heraus. Sein Rücken schmerzte, als würde jemand ihn mit einem Messer vorantreiben. ‚Wenn ich hier wieder rauskomme, dann kann ich mich und meine Uniform in die Wäsche geben. Und wenn ich stecken bleibe, müssen sie den Berg aufbrechen.‘
Als leitendem Kolonel der Carabinieri war es ihm zugefallen, den erschlagenen Mann in dem erstickend engen Tunnel im Tuff in Augenschein zu nehmen. Herculaneum war zu wichtig, als dass man einen Untergebenen gesendet hätte. Camarata hätte nur zu gern auf die Ehre verzichtet. Sein Nacken war voller Sand und sein Rachen ausgetrocknet. Seine Schultern kratzten über den Tuff und er fürchtete wiederholt, sich die Kordeln und Epauletten seiner Uniform abzureißen. Die Wächter der Anlage hatten ihn gewarnt, dass die alten Tunnel zusammenbrechen könnten, aber seine Kollegen hatten ihn nichtsdestotrotz gnadenlos in die Wand geschoben. Seit 250 Jahren hatte niemand die Stollen unterhalten. Mehr noch: Ferretti, die Chefin der Wachen, hatte ihm gestenreich versichert, dass sie schon bei ihrer Erschaffung instabil gewesen seien. ‚Aber reinkomplimentiert hat man mich trotzdem.‘
Camarata schüttelte sich. ‚Was für ein Ort.‘ Er besichtigte den Bauch der Erde und fühlte sich, als hätte man ihn gebeten, in seinem Grab Probe zu liegen. ‚Ich frage mich, was der Tote hier drin gewollt haben kann. Auch wenn die halbe antike Stadt noch im Stein liegt, kann er ja unmöglich beabsichtigt haben, sie mit bloßen Händen auszugraben – um Mitternacht und im Anzug.‘
Als er die Leiche schließlich erreichte, wäre Camarata am liebsten wieder umgekehrt. Der ausufernd große blonde Mann lag rücklings auf dem Boden, blut- und schmutzbedeckt, wenn auch gut gekleidet. Sein Kopf lag zu Camaratas Füßen, seine Beine waren zum Inneren des Berges hin ausgestreckt. Die Hände waren hoch erhoben und zu Fäusten geballt, der Kopf zertrümmert und der Mund stand weit offen.
Camarata blinzelte in die Dunkelheit und rieb sich die Stirn, um die in ihm aufkommende Benommenheit zu vertreiben. ‚Wieso kriecht man mit einer Statur von 1,90 m und geschätzten 150 Kilo Lebendgewicht in einen kaum einen Meter breiten Gang? Und wieso findet sich darin in aller Herrgottsfrühe auch noch jemand, der einem den Schädel einschlägt?‘ Er hielt es für wenig wahrscheinlich, dass man den Toten von draußen in den Tunnel gezerrt haben könnte. ‚Der Durchgang ist zu eng. Ich passe ja selbst kaum rein.‘
Camarata spürte den dumpfen Schock der Szene bis in die Haarspitzen. Als wäre seine Kopfhaut betäubt von dem, was er sah. Der Tote hatte um sein Leben gekämpft und den Kampf im finsteren Loch im Tuff verloren. Sein Blut befand sich überall an den Wänden. Der rote Abdruck seiner Hand bedeckte ein Mauerstück, an das er sich in seiner letzten Minute geklammert haben musste. Camarata hätte beinahe denselben Stein als Stütze verwendet und zuckte davon zurück.
Er hasste es, die leblose Hülle eines Menschen anzusehen. Es war ein beeindruckendes und zugleich erschütterndes Bild. Irgendwo tief drinnen rührte es an das Wissen um seine eigene Sterblichkeit. Von einem Augenblick zum anderen übermannte ihn der in dem Gang herrschende Geruch von Moder und Blut und er musste an sich halten, um sich nicht zu übergeben. Trotz der vielen Jahre im Dienst verstörten ihn solche Szenen. Ihr Anblick war einer der Gründe, warum er seinen Posten bei der Mordkommission verlassen hatte und zum Kunstschutz gewechselt war. ‚Und jetzt stehe ich schon wieder vor so etwas …‘
Camarata drehte sich um und robbte zurück ins Freie, froh, dass man im Moment nicht mehr von ihm verlangte, als einen Blick auf den Mann zu werfen. Alles Weitere überließ er herzlich gern Spurensicherung und Gerichtsmedizin.
Ein Wunder
Camarata hustete und spuckte, als er endlich wieder im Sonnenlicht ankam. Jemand reichte ihm ein paar Tempotaschentücher, damit er sich Gesicht und Hände abwischen konnte. Erschüttert stellte er fest, dass er Blut an den Fingern hatte. Die Gruppe der Carabinieri hatte sich inzwischen erweitert und jedermann war beschäftigt. Nur ein greiser Mann saß auf einem Stein nahebei, reglos wie eine Statue. Seine wirren weißen Haare standen um den Kopf herum und die von der Sonne tiefbraun gebrannte Haut schien darunter hervor. Camarata trat zu ihm. „Das waren Sie, der den Mann dort drinnen gefunden hat, richtig?“
Der Alte winkte ab, ohne aufzusehen. Seine Stimme erklang als heiseres Krächzen. „Reden Sie mit jemandem anderen. Ich mag jetzt nicht belästigt werden.“
Camarata blinzelte. Man hatte ihm bei seiner Ankunft gesagt, der Mann sei ein Archäologe von Weltruf und hatte ihm händeringend versichert, aufgrund seines hohen Alters und seiner Berühmtheit sei Armando Manzoni ein völlig unwahrscheinlicher Täter. Ein komischer Vogel schien er ihm trotzdem zu sein. Er fixierte die Ruinen der gegenüberliegenden Gasse, als gäbe es dort etwas zu sehen, was er unter keinen Umständen aus den Augen lassen dürfe.
Camarata rieb sich das Kinn. ‚Was hat diesen Typen mit seinen wirren weißen Haaren dazu getrieben, in aller Herrgottsfrühe durchs Erdreich zu kriechen? Nicht nur die Gegenwart des Täters in dem Tunnel ist erstaunlich, sondern auch die des Entdeckers der Tat.‘ Er beugte sich zu dem Greis, bis er ihm in die blauen Augen sehen konnte. Er musste den Alten fast zwingen, ihn anzusehen. „Sagen Sie: Warum sollte man jemanden dort drinnen erschlagen? Sie kennen sich doch hier aus, oder?“
Die Augen des Alten huschten fort, dann plötzlich fixierten sie ihn mit glühender Schärfe. Seine Antwort kam als Raunen. „Dort drinnen liegt ein Wunder, aber lassen Sie um Himmels Willen die Finger davon! Glauben Sie mir! Machen Sie, dass Sie wegkommen!“
Camarata knurrte verärgert: „Ein Wunder!? Der Gang ist völlig leer!“
Manzoni machte eine wirsche Geste, stand auf und schlurfte davon, ohne sich noch einmal umzuwenden.
Seltsame Details
Camarata hatte genug. Über der Tunnelbesichtigung und dem Eintreffen der Gerichtsmedizinerin war es Mittag geworden. Die Sonne brannte mittlerweile gnadenlos auf die Ruinen und die darüberliegende moderne Stadt. Die Zikaden waren erschöpft verstummt und nur von fern drang noch das Geräusch von Fahrzeugen herüber. Die Anlage war wegen des Mordes geschlossen worden und außer den Ermittlern war keine Menschenseele mehr zu sehen, nur ausufernder Oleander und Pinien. Über allem thronte reglos der Vesuv mit seinen grünen Hängen und der schuttbedeckten Spitze, Menetekel der Vergänglichkeit menschlichen Seins.
Camarata stieg keuchend die Rampe aus den Ausgrabungen hoch. Er war staubbedeckt, seine dunkle Uniform und das weiße Uniformhemd verschwitzt. Er hätte viel dafür gegeben, sich waschen zu können. Die vierzig Grad im Schatten machten ihm und seinen Kollegen zu schaffen, aber er versuchte, trotz dessen Würde zu bewahren. Im Gehen klopfte er den Dreck von den breiten Schultern und wischte sich den Schweiß vom Gesicht. Der Höhenunterschied von den Ruinen bis zu den Verwaltungsgebäuden betrug zwanzig Meter, vom antiken Strand dreißig. Er hätte nichtsdestotrotz weniger keuchen wollen. „Du bist von zehn Schritten außer Atem. Du wirst alt und fett, mein Freund.“
Nach den morgendlichen Strapazen fühlte er sich erschöpft und zudem vom Anblick des Tatorts erschüttert. Trotzdem hoffte er, dass ihm seine Kollegen das nicht ansahen. Es waren mittlerweile zwei Dutzend eingetroffen, allen voran der arrogante Chef der Mordkommission, Negri. Ihm waren der quirlige Antonelli von der Spurensicherung und Camaratas Lieblingsärztin Chiodi von der Gerichtsmedizin gefolgt. Das Labor Herculaneums war der letzte Ort, den Camarata noch selbst zu besuchen beabsichtigte, dann versprach er sich, eine Pause einzulegen und alles Weitere zu delegieren. Er musste nicht alles allein machen, auch wenn er oft dafür kritisiert wurde, es zu versuchen.
Die riesige Grube, die man gegraben hatte, um die antike Stadt aus dem Tuff zu befreien, lag hinter ihm. Vor ihm erstreckten sich die flachen Ziegelgebäude der Verwaltung der Anlage. Er versuchte, sich zu orientieren und fand das Labor dank eines Schildes zwischen den Oleanderhecken.
Als er eintrat, atmete er erleichtert auf. Der Raum war weiß, sauber und vor allem kühl. Eine Klimaanlage summte gleichmäßig vor sich hin und blies ihm kühlenden Wind entgegen. Plastikstühle und lange Tische standen in Reihen, Regale lehnten an der Wand und über allem lag der aseptische Geruch von Chemikalien. Camarata entspannte sich. Auf den Tischen ruhten unförmige Haufen bedeckt von Seidenpapier. Aus Neugier hob er eins der Blätter an, aber ließ es eilig wieder fallen. Ein kahler Schädel bleckte ihn an. ‚Accidenti. Noch einen Toten verkrafte ich heute nicht.‘
Eine heitere Frauenstimme erklang hinter ihm. „Keine Angst, der beißt nicht mehr.“
Camarata wandte sich um.
Eine junge Laborantin mit schmalem gebräunten Gesicht stand hinter ihm. Sie hatte die blonden Haare zu einem Knoten gebunden und wippte mit den Händen in den Taschen ihres Kittels auf den Zehenspitzen auf und ab. „Das Labor ist nicht öffentlich. Besucher haben hier nichts zu suchen.“ Sie bildete einen erfrischenden Kontrast zur Gluthölle der Ruinen und dem Ermordeten in ihren Eingeweiden.
Camarata war dankbar, die junge Frau zu sehen. Es war, als bewiese sie ihm, dass die Schönheit der Welt noch existierte. Er sah sich um. „Ist es bei Ihnen üblich, tote Leute auf den Tischen aufzuhäufen?“ Seine Bemerkung war banal, aber diente ihm als einleitender Smalltalk zu weit weniger trivialen Fragen.
Die junge Frau schürzte charmant die Lippen und warf einen Blick auf Camaratas schwarze Uniform. „Unsere Klienten fallen nicht in Ihr Ressort, Herr Kommissar, keine Sorge. Das sind antike Opfer des Vesuvs, die man unten am Strand gefunden hat. Ihr Ableben ist verjährt und niemandes Schuld.“
Camarata zögerte, ob er in den scherzenden Tonfall einstimmen sollte. Der Mord in den Ruinen hatte ihm die gute Laune vergällt. Er ächzte. „Die Skelette hier sind vom Strand?“
„Die Leute hatten sich in Bootshangaren versteckt, in der Hoffnung, dass die römische Flotte sie vor dem Vulkan retten würde.“
„Aber das ist nicht passiert?“
„Als der berühmte Plinius anlangte, waren die Wartenden bereits bei lebendigem Leib gekocht worden.“ Sie drehte sich zu einem der Labortische und griff eine murmelgroße Kugel. „Sehen Sie das?“
Camarata zuckte die Schultern.
„Das ist ein Gehirn.“
Er zog eine Grimasse. Er hatte nicht gedacht, dass Hitze ein Gehirn in eine Glasmurmel verwandeln könnte.
Das Lächeln um den vollen Mund der Laborantin vertiefte sich. „Jetzt muss ich Sie aber hinausbitten. Die Vorschriften ... Ich bekomme Ärger.“
Camarata räusperte sich. „Ich bin leider kein Müßiggänger. Francesco Camarata, Kolonel der Carabinieri. Man hat einen toten Mann in den Ruinen gefunden.“ Er holte sein Telefon aus der Tasche und hielt den Bildschirm vor die Laborangestellte. Darauf leuchtete das Foto des Erschlagenen, das man am Tatort geschossen hatte. Es war das Harmloseste unter einer weit blutigeren Auswahl.
Die junge Frau taumelte rückwärts. „Oh Gott. Das ist Gianni Perrone.“
Camarata realisierte, dass er sich von der Energie seines Gegenübers hatte verleiten lassen, ihr das Bild zu forsch vors Gesicht zu halten. Trotz eines gewissen Gefühls der Schuld war er erleichtert. Seine Leute befragten seit Stunden die Angestellten in der Anlage, um zu erfahren, um wen es sich bei dem Erschlagenen im Tunnel handelte und die Frau schien es zu wissen. „Perrone ist ein Kollege von Ihnen?“
„Ein Biochemiker aus Neapel … Er ist tot?“ Die Laborantin sank auf einen der Plastikstühle. „Gianni Perrone hatte hier genauso wenig zu suchen wie Sie … wie Touristen, meine ich. Aber er kam zweimal her. Daher weiß ich, wer er ist.“
Die Lippen der jungen Frau waren weiß. Camarata riss seinen Enthusiasmus am Riemen und dämpfte die Stimme. „Verzeihen Sie meine Grobheit. Darf ich Sie trotzdem fragen, was Perrone von Ihnen wollte?“
„Ich hatte ihm Knochenproben gesendet. Wir hatten die Skelette aus den Ausgrabungen zu Tests an Universitäten gesendet, aber ich habe eins im Lagerraum entdeckt, das man wohl vergessen hat. Perrone hat die fehlenden Untersuchungen durchgeführt und ist dann hier erschienen … wie …“ Sie zögerte und suchte nach Worten. „Wie eine Furie.“
„Er ist gekommen, obwohl er nicht hier sein sollte, und war was? ‚Eine Furie‘ soll heißen, er war wütend?“
Die junge Frau schüttelte den Kopf. Ihre hellen grauen Augen sahen ihn zweifelnd und voller Sorge an. „Er war erregt. Und aufdringlich. Ich fand Perrones Bemerkungen intelligent, aber er hat sich unmöglich betragen. Als ob die Knochenproben, die ich ihm gesendet hatte, etwas Unglaubliches wären. Etwas noch nie Dagewesenes. Er war wie ein großes, schnüffelndes Tier.“
„Knochenproben. Hm. Wir haben ihn in einem Tunnel im Tuff gefunden. Wo soll da die Verbindung sein?“
„Er lag in den Bourbonen-Tunneln? Als Biochemiker?“
Camarata stellte sich dieselbe Frage: Was suchte ein Biochemiker in einer archäologischen Ausgrabung mitten in der Finsternis? „Die Gerichtsmedizinerin meint, er sei keine drei Stunden tot gewesen, als man ihn entdeckt hat. Man hat ihn irgendwann nach Mitternacht erschlagen. Wann war Perrone das letzte Mal hier?“
„Gestern am späten Nachmittag. Gegen sechs.“
„Und warum sollte er ein paar Stunden später in den Gang gekrochen sein?“
Die junge Frau zuckte die Schultern. „Und das, wo die Tunnel lebensgefährlich sind. Vor allem im Dunklen. Wie ist Perrone überhaupt nachts in die Anlage gekommen?“
Camarata schob die Unterlippe vor. Heißer Wind wehte durch das offene Fenster herein und trug den Duft überreifer Feigen zu ihm. Es war der Geruch nach Sommer und dem Urlaub, aus dem er gerade erst zurückgekehrt war. Die Ruhe und Gelassenheit der freien Tage waren vom Anblick des Erschlagenen vertrieben worden. Er schob sich näher an die Klimaanlage, öffnete erneut das Telefon und hielt der jungen Frau ein Bild des Körpers des Toten hin. „Hier ist noch ein verstörendes Bild. Verzeihen Sie mir. Wenn Sie dazu bereit sind, noch einmal herzusehen …?“
Die junge Frau sah auf das Telefon und zuckte zurück.
Camarata tätschelte ihr die Schulter. „Verzeihung. Ich weiß, das ist unschön. Aber sehen Sie: Der Mann hat den Mund weit aufgerissen, den Rachen voller Sand und Kiesel und die zertrümmerten Hände über dem Kopf verkrampft. Die Medizinerin sagt, man habe ihm die Hände nachträglich so geformt und den Mund gewaltsam aufgerissen, bis der Kiefer gebrochen ist.“
Die Augen der jungen Frau weiteten sich. „Sie meinen, man hat Perrone hergerichtet?“
Camarata nickte. „Jetzt wo Sie es sagen … ‚Hergerichtet‘ ist das Wort, das ich gesucht habe. Wieso sollte jemand so etwas tun, wenn er den Toten in einem Grabungstunnel liegen lässt, in dem niemand vorbeikommt? Doch nicht in der Hoffnung auf Zuschauer …?“
Die junge Frau bebte. „Ich glaube, ich weiß, was das bedeuten könnte. Das nennt man die Faustkämpferstellung.“
„Wie?“
„Sie ist typisch für einen in der Hitze verkrümmten Körper.“
„Ah, wie bei Brandopfern. Die Muskeln ziehen sich zusammen. Aber was hat das mit Perrone …?“
„Viele der antiken Toten sehen so aus.“
Camarata begriff. „Sie denken, Perrone wurde hergerichtet wie ein Opfer des Vesuvs?!“
„Vielleicht wollte der Mörder antike Tote imitieren, sodass man später nicht auf den Mord aufmerksam wird? Es war doch kaum zu erwarten, dass man Perrone so schnell in dem Tunnel findet, oder?“
„Vielleicht.“ Camarata kratzte sich am Kinn. „Sagen Sie, was war mit dem Skelett, welches Sie im Lagerraum gefunden haben und von dem Sie Perrone Tests zugesendet haben? Sieht das auch so aus?“
„Das sind nur lose Knochen.“
„Also nichts Ungewöhnliches?“
„Im Gegenteil. Es ist viel weißer als die übrigen und es gibt bizarre Details. Es hatte mich auch verwundert.“
Camarata hätte die junge Frau schütteln mögen. „Sie sagten, es seien die Proben davon gewesen, die Perrone so in Aufregung versetzt hatten. Was ist damit? Was ist an dem Skelett anders?“
Die blonde Laborantin rieb sich die Schläfen, bemüht, sich nach dem Schock der blutigen Bilder zu sammeln. „Zuerst ist es mir nur aufgefallen, weil es nicht bei den archivierten Gebeinen lag. Man hatte es in einen Karton gezwängt und in die hinterste Regalecke geschoben, als hätte man es verstecken wollen.“
„Verstecken?“
„Es ist immer noch nicht hier, sondern im Lager, sonst würde ich es Ihnen zeigen. Und dann … Zum Beispiel sind die Zähne des Toten schlecht.“
„Ist das nicht erlaubt?“
„Die Toten von Herculaneum haben außergewöhnlich gute Zähne. Das Grundwasser der Stadt ist reich an Fluorid. Der Mann im Karton hatte Karies. Ich vermute daher, dass er nicht von hier stammte. Es könnte sich um eine Person aus Rom handeln. Die Gegend hier war ein Urlaubsdomizil. Die Kaiser hatten ihre Villen drüben bei Misenum. Ich hatte gehofft, jemanden Außerordentlichen zu finden. Man weiß nicht viel darüber, wer in Herculaneum starb … Aber … hm …“
Camarata verzog das Gesicht. Ein dumpfes Gefühl breitete sich in seiner Brust aus. „Es scheint, dass auch Perrone meinte, dass etwas an dem Skelett besonders wäre.“
„Sie denken, man hat ihn deswegen umgebracht?“
Camarata trommelte mit den Fingern auf den Tisch. Er verstand das Zögern der jungen Frau, aber das Indiz schien ihm vielversprechend. „Perrone kommt zweimal wegen dieser Knochen her, beim zweiten Mal kriecht er nachts in einer völlig unwahrscheinlichen Aktion in einen Grabungstunnel. Jemand folgt ihm und erschlägt ihn. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht wegen seiner Neugier geschah.“
„Wenn man nachts in eine Ruinen-Anlage einbricht, geht das über Neugier hinaus. Das ist strafbar.“
„Perrone hat in seiner Aufregung also noch nicht einmal vor einer Straftat zurückgeschreckt … Hat er Ihnen die Ergebnisse seiner Tests gegeben?“
Die Augen der Laborantin blitzten und eine Furche bildete sich über ihrer Nasenwurzel. „Ich denke, er hatte sie bereits vorliegen, aber er weigerte sich, sie mir auszuhändigen. Ich hätte ihn gestern fast deswegen rausgeschmissen. Wir haben uns angeschrien.“
Camarata musste schmunzeln. Mit der energischen jungen Frau hätte er sich nicht anlegen mögen. Es beruhigte ihn, dass sie den Schock des Mordes bereits verarbeitet hatte. „Rufen Sie mich an, wenn Ihnen noch etwas einfällt.“ Er drückte ihr seine Karte in die Hand. Dann wandte er sich zum Gehen, aber hielt noch einmal inne. „Verzeihung, wie heißen Sie eigentlich?“
„Therese Urquiola.“
Camarata dankte mit einem Nicken und trat ins Freie. Die junge Frau gefiel ihm.
Gänge unter dem Vulkan
Camarata kehrte zu den Ruinen zurück, wo sein Dienstfahrzeug und seine Leute warteten. Der gelbe Sand des Weges knirschte unter seinen Füßen und sein Rücken wurde schon nach wenigen Schritten erneut gnadenlos von der Sonne verbrannt. Ächzend entledigte er sich seiner Uniformjacke, aber von da an brannte die Sonne durch sein Hemd. ‚Vermaledeiter August. Da wird’s einem noch nicht mal kühler, wenn man sich nackt auszieht.‘ Er wollte ausspucken, aber sein Mund war zu trocken dafür. Schwitzend umrundete er die roten Oleanderbüsche der Hecken, aber war trotz seiner Unzufriedenheit über die Hitze besserer Laune als zuvor. Es ermutigte ihn, dass der Erschlagene von nun an einen Namen hatte. Ein Name war ein Anfang. Er stapfte die Metallrampe zu den ockerfarbenen Trümmern wieder hinunter. Herculaneum lag auf dem Grund der enormen Grube, die man in Lava und Tuff gegraben hatte, um es freizulegen.
Die moderne Kleinstadt Ercolano thronte hoch oben über der verschütteten antiken Stadt. Seit sie erbaut worden war, waren ebenfalls bereits ein paar hundert Jahre ins Land gegangen und Camarata hatte bei der Herfahrt gemosert, dass man es Ercolano ansähe. In der Stadt vor den Toren der archäologischen Anlage hingen Kabel und Wäsche von den Balkonen und eine Dunstglocke von Schmutz lag schon in den Morgenstunden über den Häusern. Lärm herrschte überall und Stau verstopfte die Straßen. Das neue Ercolano war nicht reich wie das alte Herculaneum. Es trug den ehrenvollen Namen auch erst, seit man die Ruinen entdeckt hatte, und hatte vorher Resina geheißen, ein Kaff, Vorstadt des Molochs Neapel und Ansammlung illegaler Bauten, die den Blick auf die malerische Bucht davor nicht verdienten.
Camarata seufzte erleichtert, der modernen Welt zu entkommen und in die Ruinen zurückzukehren. Ein Gefühl der Beklemmung bemächtigte sich seiner jedoch, je weiter er in die Tiefe stieg. Wie so oft in seiner Karriere fragte er sich, was in der Nacht geschehen war, um so viel Gewalt und Brutalität freizusetzen. Auf den Gassen und in den Ruinen wirkte alles friedlich und harmlos. Nur am Tunnel hatten sich seit sechs Uhr früh Spurensicherung und Ermittler die Klinke in die Hand gegeben, blass und geschockt von dem, was sie vorgefunden hatten.
Trotz des Ruhms der Ruinen waren Camarata die Gänge in der Wand der Grube unbekannt gewesen. Er hatte davorgestanden, als hätte man sie gerade erst entdeckt. Der Einstieg befand sich auf Hüfthöhe und sie waren kaum schulterbreit. Er war hineingekrochen wie ein überfütterter Hamster, der den Weg in seinen Bau nicht findet. Eine Zeile spukte ihm seitdem durch den Kopf, die er wie jeder Italiener in der Schule gelernt hatte: ‚Nel mezzo del cammin di nostra vita … In der Mitte des Weges unseres Lebens …‘ Die ersten Worte der Göttlichen Komödie Dantes, die beschrieben, wie sich der Dichter am Tor der Hölle wiedergefunden hatte, vor einem dunklen Loch ...
Camarata seufzte. ‚Zum Teufel mit Dante. Ich brauche eine Dusche, Kaffee und Wasser und möchte besser nicht an die hypothetische Mitte meines Lebens erinnert werden.‘ Sein fünfzigster Geburtstag lag hinter ihm.
Er blieb stehen und versuchte, mit zusammengekniffenen Augen den Weg zum Tatort wiederzufinden. Gepflasterte Gassen erstreckten sich vor ihm, eingegrenzt von hohen Mauerwänden aus braunen Ziegeln, durchbrochen von leeren Fensterhöhlen. Alles war von Staub bedeckt und ausgetrocknet. Sechs Schlammwellen waren über Herculaneum zusammengeschlagen. Der Luxus Roms mit Fensterglas, fließendem Wasser und Mosaikfußböden war unter Lava und Asche verschwunden. Nur Feigenbüsche, Spatzen und Oleander brachten Leben in die zurückgebliebene Ödnis.
‚Da macht man uns weiß, der Mensch entwickle sich hinein in eine immer bessere Zukunft. Wenn mal meine Mutter ein so schönes Haus gehabt hätte wie die Herren und Damen Römer.‘ Camarata war in beengten Verhältnissen aufgewachsen und die Entbehrungen seiner Kindheit saßen ihm im Blut. Er besah die bleiernen Wasserleitungen der Villen und die versteinerten Türen im Bewusstsein, dass die Leute, die sie besessen hatten, viel reicher gewesen waren als er. Er fragte sich, ob man dereinst auch seine Knochen aus der Erde kratzen würde, so wie die, die er im Labor gesehen hatte. ‚Ich lasse mich einäschern, bevor ich mich einer Archäologin ausliefere, die mein murmelgroßes Hirn rumreicht.‘
Er folgte der Gasse, die am Rand des ausgegrabenen Ruinenfeldes entlangführte, und verlief sich. Nur die Tatsache, dass seine Kollegen davorstanden, ließ ihn das Loch im Labyrinth der zerbrochenen Mauern schließlich wiederfinden.
Giovanni Mathis, seine rechte Hand, kam ihm entgegen. Der dürre, übersportliche Maresciallo wischte sich mit der Hand über den Glatzkopf und hinterließ dabei eine Staubspur. Seine schwarze Uniform war genauso von Schmutz bedeckt wie die Camaratas. „Wir lassen den Mann jetzt wegbringen, Kolonel. Schauen Sie, was wir gefunden haben. Das scheint mir eigenartig.“ Er hielt ihm einen Plastikumschlag entgegen, in dem sich eine grün-braune Karte befand. Sie war nass und bedeckt mit Blutflecken, die den Umschlag von innen beschmiert hatten.
Camarata griff danach. „Wir haben einen Namen für den Mann.“
„Einen Namen? Bravo!“
Camarata drehte den Umschlag nach allen Seiten und runzelte die Stirn. Darin lag eine technische Detailkarte der Ausgrabungen. Jede Wasserleitung und jeder Tunnel waren eingezeichnet. „Der Tote ist Biochemiker. Wo hat der so was her?“
Mathis zuckte die Schultern und blinzelte mit seinen kleinen, wimpernlosen Augen in die Sonne. „Keine Ahnung, Kolonel, aber gehen Sie vorsichtiger damit um. Die Karte lag in einer Wasserlache. Dort unten ist was draufgeschrieben. Nicht, dass es verwischt. Es scheint Tinte zu sein.“
Camarata hätte auch gern in einer Wasserlache gelegen. Mit zusammengekniffenen Augen hob er die Karte vors Licht. „Danz … Danz … Irgendwas mit Tanzen? Was heißt das?“
„Die Technik wird es rausbekommen. Wie gesagt, fassen Sie nicht drauf.“ Mathis warf ihm einen tadelnden Blick zu, grüßte und rettete sich wieder in den Schatten.
Camarata sah auf. Der Eingang des Tunnels, in dem man den Toten gefunden hatte, befand sich direkt vor ihm, im allgegenwärtigen, brüchigen Konglomerat aus Kieseln, Sand und Stein. Ein Team von Technikern in Schutzanzügen schob den Erschlagenen in diesem Moment in einem schwarzen Sack heraus. Camarata biss die Zähne zusammen, als ein Erdrutsch auf sie niederging und sie mit Dreck bedeckte. „Passt auf, ihr bringt die Wand zum Einsturz.“
„Danke für die Warnung. Das hören wir jetzt seit Stunden. Erklären Sie mir eins, Kolonel“, brummte Antonelli, der bejahrte Chef der Spurensicherung, der am Morgen zu ihnen gestoßen war und genauso hustend und spuckend aus dem Stollen kroch wie er zuvor. „Dass man eine Leiche in so einem Loch versteckt, das kann ich nachvollziehen. Aber dass man sie so kurze Zeit später findet … in einem Gang, der teilweise dazu zwingt, auf Knien vorwärtszukriechen, und innendrinn pitschnass ist … das ist schon ein unwahrscheinlicher Zufall.“
„Der Finder ist ein bekannter Archäologe.“
„Um sechs Uhr früh?“
„Was weiß ich, wie Archäologen ticken. Und da drinnen ist es sowieso dunkel. Vielleicht hatte er nichts zu tun oder konnte nicht schlafen.“ Im Stillen dachte Camarata sich, dass es an diesem Fall so einiges gab, was er nicht verstand. Unter anderem die Frage, warum ein Skelett im Labor einen Biochemiker in den dunklen Stollen vor ihm locken sollte.
Antonelli zuckte die Schultern und folgte den Trägern der Bahre auf ihrem Weg nach oben, die weißen Haare voller Dreck und Spinnweben. Die Zikaden hatten ausgesetzt, wie um ihm Zeit zum Sprechen zu lassen. Jetzt schnarrten sie so plötzlich wieder los, dass Camarata zusammenzuckte. Er hatte das Gefühl, dass jemand hinter ihm stand, und drehte sich um. Die Gasse war leer, aber das Geräusch von Schritten und die Bewegung der Blätter eines Feigenbaums zeigten ihm, dass er sich nicht geirrt hatte. Er sah mit zusammengekniffenen Augen auf die Ruinen. „Gaffer.“
Dann folgte er seinen Kollegen nach oben. Versunken in Gedanken an die weißen Knochen im Labor.
Mütterliche Kälte
Auf dem Weg von Herculaneum zurück nach Neapel ließ Camarata den Dienstwagen vor einem Haus halten, dessen Adresse man ihm als die des Erschlagenen gegeben hatte. Es handelte sich um ein malerisches, aber verfallenes Mietshaus am Meer. Die Gasse von der erhöhten Küstenstraße zum Ufer davor war eng und steil, die Hafenmauer verbaut und bedeckt mit Kieseln. Eine Handvoll Restaurants und Parkplätze teilten sich den engen Raum an der kleinen Bucht. Durch das Fenster roch es nach Sonnenöl und gebratenem Fisch. Der Ort hätte schön sein können, wenn nicht jedermann aufeinandergehangen hätte. Camarata war froh, dass er von Mathis hinchauffiert wurde. Die Enge der Serpentinengasse setzte ihn unter Stress und sie fanden wie erwartet keinen Zentimeter Platz, um das Fahrzeug zu parken, sodass Mathis mit blinkenden Lichtern auf der Straße stehenbleiben musste.
Es war bereits später Nachmittag und Camarata beabsichtigte, bei der Mutter Perrones vorbeizuschauen, um ihr die Nachricht vom Ableben ihres Sohnes zu überbringen. Pflichtbewusstes Mitleid war nur einer seiner Beweggründe. Er tat es auch, um zu sehen, was für ein Mensch der Erschlagene gewesen war, der, wie es schien, noch immer bei seiner Erzeugerin zur Untermiete gewohnt hatte.
Eine rothaarige Frau öffnete ihm die Tür einer gekachelten Erdgeschosswohnung. Die Einrichtung bestand aus einem Fernseher, einem Spanplattentisch und einer Couch, die sicherlich in der Nacht als Bett fungierte. Knallbunte Marienbilder hingen an der Wand. Camarata kannte diese Art Unterkunft, in der jede Ecke des Bodens mit dem Hader gewischt werden konnte und alles aus den achtziger Jahren stammte. Er verzog das Gesicht.
Mit steifer Förmlichkeit stellte er sich vor und berichtete, was geschehen war. Wie jedes Mal in solchen Situationen versuchte er, seine übliche brutale Direktheit abzuschwächen und Anteilnahme zu zeigen. In diesem Fall schien es, dass er sich die Mühe hätte sparen können. Die gleichgültige Reaktion der Mutter Perrones schockte ihn fast genauso sehr, wie dessen übel zugerichteter Leichnam. Er hatte Tränen und Schreie der Verzweiflung erwartet, aber sie setzte sich ihm emotionslos am Küchentisch gegenüber, nickte nur und fragte nach Kleinigkeiten, die Augen leer und sichtlich auf der Suche nach etwas, was sie sagen könnte, um ihn wieder loszuwerden.
„Jetzt weiß ich endlich, warum er nicht heimgekommen ist. So ist das also. Muss ich irgendwelche Papiere ausfüllen?“
Camarata brachte in seiner Verwunderung nur eine Routineantwort heraus. „Wir senden Ihnen eine Betreuerin vorbei, die Ihnen helfen wird.“
„Wo ist das Portemonnaie meines Sohnes? War da noch Geld drin?“
„Sie bekommen es zurückerstattet, sobald die Spurensicherung damit durch ist.“
Die faltige, übergewichtige Frau musterte ihn emotionslos und zog eine Grimasse. „Ich habe Gianni gesagt, dass er sich nicht überall einmischen soll. Alle diese Leute, mit denen er sich traf. Sein Zimmer ist voller Papier, Haufen von altem Zeug und dicken Büchern. Mein Sohn war nicht so, wie ein anständiger Mensch hätte sein sollen. Er dachte immer, er sei klüger und müsse etwas Großes tun.“
Camarata runzelte die Stirn und fragte sich, was die Frau unter anständigen Menschen verstand. „Er traf Leute? Können Sie mir Namen geben?“
„Ich habe immer nur mit halbem Ohr hingehört. Gianni schwatzte zu viel und in den letzten Tagen fast unaufhörlich. Wir passten nicht zusammen. Ich weiß nicht, wie ich zu so einem Sohn gekommen bin, der nie mit in die Kirche wollte und immer nur anderswo war. Aber er hat von Herculaneum geredet. Das stimmt.“ Sie winkte ab. „Ich war mal dort, als ich noch in der Schule war und das ist eine Weile her. Dort ist alles kaputt. Aber Gianni liebte solche Orte. Er betete sie regelrecht an.“
Camarata schüttelte sich innerlich. ‚Kaputt‘ war eine ungewöhnliche Beschreibung für antike Ruinen. „Noch einmal: Mit wem traf Gianni sich?“
„Zum Beispiel mit einem Kunstexperten, den er immer wieder erwähnt hat. Einem Francescati im Vomero. Francescati wie Frascati. Das ist ein Weißwein und den habe ich mal getrunken. Rotwein ist mir lieber.“
„Was wollte er bei ihm?“
„Ich sage Ihnen doch: Ich habe nicht hingehört. Aber ich habe ein Gedächtnis, in dem Namen hängen bleiben. Leider, nicht wahr.“
„Zum Glück, Signora, zum Glück.“ Camarata fischte eilig sein Notizbuch heraus und schrieb sich den Namen auf. „Francescati. Gut. Wer noch?“
„Gianni hat sich vor ein paar Wochen mit einem Mann in der Leitung von Herculaneum getroffen, einem Poldi Pezzoli. Hochtrabender Geck, scheint es, aber Gianni war am Anfang stolz darauf. Später hat er Gift und Galle gespuckt.“
„Wieso?“
„Keine Ahnung. Ich sagte doch …“
„Sie haben nicht hingehört. Sicher. Hatte Gianni Freunde? Ihm nahestehende Kollegen?“
„Einen Robert Hemmings. Ein Weltbescheißer und Engländer. Der war sogar mal hier. Ich habe Gianni gesagt, er soll sich unterstehen, noch mal solche Leute herzubringen. Vor allem solche. Ausländer. Die anderen Kirchen angehören. Gianni war unvorsichtig.“
Camarata seufzte. Die Kirche schien der Frau wichtig zu sein. „Hatte Gianni Angst vor einem der drei Männer, die Sie mir genannt haben? Francescati, Pezzoli oder … Hemmings?“
„Gianni hatte nur Angst vor der Wache von Herculaneum.“
„Inwieweit?“
„Was weiß ich. Gianni erwähnte das gestern früh. Dass er vor denen Angst habe. Ich weiß nicht, ob wirklich eine Anzeige drohte. Das war nur das übliche Geschwätz von Gianni. Wichtigtuerei. Alle diese Leute. Ich wusste, dass Gianni eines Tages Dummheiten machen würde. Immer voller Begeisterung, wie ein Panzer auf Angriff, ohne nachzudenken. Sicher hat ihn die Wache erschossen. Gianni hat zu viel gewollt. Mehr, als dem Menschen zukommt. Der liebe Herrgott hat ihn bestraft. Die Kirche hat recht: Man soll bescheiden bleiben. Vielleicht ist es gut so wie es ist. Ich will mit dem allen nichts zu tun haben. Wenn Sie dem Mörder haben, sagen Sie ihm das. Dass ich nichts mit der Sache zu tun haben will.“ Sie stand auf und winkte Camarata, ihr zu folgen. Ohne abzuwarten, schlurfte sie voran und öffnete eine Zimmertür.
Camarata erhob sich und trat näher. Der große, durch ein hohes Fenster erleuchtete Raum war ganz anders als der Rest des Appartements. Er war bis unter die Decke mit Büchern, Dokumenten und Zeichnungen gefüllt. Ein ungemachtes Bett stand in einer Ecke, ebenfalls bedeckt mit Papieren, einige davon offenkundig alt. Am Fenster stand eine ansehnliche Computeranlage, die sicher teuer gewesen war. Dahinter hing ein Spruch an der Wand: Fortes fortuna iuvat. Camarata konnte sich nicht erinnern, was das hieß und es stand nicht darunter.
„Sie räumen das aus, ja?“ Die Mutter Perrones schnarrte vorwurfsvoll, als sei es die Schuld der Carabinieri, dass selbst der Fußboden voller Dokumente war.
Camarata nickte stumm. ‚Wahrscheinlich träumt die Frau seit Jahren davon, hier mit dem Wischhader durchzugehen.‘ Als er schließlich wieder auf die Straße trat, tat er es mit schmerzendem Kopf, heilfroh, davonzukommen. Ihm war klar, dass er viele Fragen ungestellt gelassen hatte, aber war zu überwältigt von der Kälte der Frau, um sie im Detail zu befragen. Seine Leute konnten das später tun. ‚Ein glücklicher Mensch war Perrone nicht. Mit so einer Erzeugerin im Nacken.‘
Er stapfte an den überfüllten Restaurants am Meer vorbei zurück zum Dienstwagen und gab Mathis den Befehl, die Spurensicherung zu dem Haus zu senden. Alles, was er selbst noch wollte, war eine Dusche und ein Fußballspiel vor dem Fernseher. ‚Leute gibt’s. Diese Frau ist nicht mal traurig, dass man ihren Sohn tot aufgefunden hat. Man findet ihn ermordet vor und seine Mutter nickt nur. Ich habe von erschlagen geredet und sie behauptet, er sei erschossen worden, weil sie nicht zuhört. Hoffentlich vergesse ich zumindest im Alter, was ich gerade erlebt habe.‘ Trotzdem war er zufrieden, Namen zu haben und beschloss, bei dem Kunsthändler mit den Ermittlungen anzufangen.
Er seufzte. ‚Ein seltsamer Fall, dieser tote Perrone.‘
Heimatliche Gefühle
Der Abend sank auf Neapel herab, als Camarata nach Hause zurückkehrte. Die allgegenwärtige Hitze hatte nachgelassen, obwohl die untergehende Sonne die Dächer noch immer glühen ließ. Wie ein Schleier hing Dunst über den Stadtvierteln am Meer und verklärte die Umrisse der Häuser. Der Lärm der überfüllten Straßen der Metropole klang gedämpft aus der Altstadt herauf und die Töne eines Radios quäkten aus einem der ärmlichen Läden des Viertels.
Camarata zwängte sein Fahrzeug wie jeden Abend in den Hauseingang eines verfallenden Gebäudes, froh, seinen viel zu langen Tag zu beenden. Er legte eine Lenkradsicherung an und schälte seine gedrungene Gestalt aus dem ramponierten Wagen. Der Seitenspiegel war mit Klebeband befestigt und er zog es erneut fest. Die Hitze griff den Leim an, aber eine professionelle Reparatur lohnte sich nicht mehr. Sein Fiat war zwanzig Jahre alt. Mit seinem mageren Gehalt und seiner großen Familie hatte er kein Geld für einen neuen.
Bunte Wäscheleinen hingen vor den Fenstern der Nachbarn und überquerten die Straße wie Festtagsdekorationen. Camarata stieg in ihrem Schatten die ausgetretene Treppe zu seinem Haus hinauf und inhalierte dabei den gewohnten Geruch nach Waschmittel und Kaffee. Die Ruhe, die ihn sonst beim Anblick der menschenleeren Straße überkam, wollte sich nicht einstellen. Er war lange beim Morddezernat gewesen und hasste den Anblick von brutal ermordeten Menschen. Er mochte keine Erschlagenen mehr sehen, aber jetzt geisterten sie erneut durch sein Leben.
Camarata seufzte und sah über den azurblauen Golf, der die tieferliegende Altstadt Neapels begrenzte. Wie jeden Abend verabschiedete er sich von der Weite des Ozeans, bevor er seinen Hauseingang durchquerte. ‚Für immer liebst du, freier Mensch, das Meer.‘ Er hätte gern alles vergessen und abgeschaltet, statt über den Mord nachzudenken. Seine Haut wurde mit den Jahren dünner. ‚Irgendwann kann ich das hier nicht mehr machen. Dieser Perrone war noch keine vierzig und man hat ihm den Schädel in Stücke gespalten, als würde man eine Melone zertreten.‘
Als er durch die Wohnungstür trat, befand sich seine Frau Laura bereits in der Küche, die blonden Haare hochgesteckt und in einen Hausmantel gekleidet. Die Fenster standen weit offen und die Abendsonne flutete herein, begleitet vom Duft nach Basilikum und bratendem Fleisch. Camarata atmete aus, froh, zu Hause zu sein. „Ich bin spät. Tut mir leid. Ein Mord in Herculaneum.“
Laura sah auf. „Ola, wie das? Ein Tourist?“
„Ein Experte für DNA-Tests. Erschlagen in einem Tunnel und drapiert wie ein Opfer des Vesuvs. Eigenartige Geschichte.“
Er trollte sich ohne weitere Erklärungen ins Innere der Wohnung, gefolgt von Lauras fragendem Blick. Er fühlte sich schlecht, seine Frau so stehen zu lassen, aber brauchte einen Augenblick, um mit seinem Unbehagen fertig zu werden. Er fühlte sich ausgelaugt. Wie jeden Abend duschte er sich und ließ das Wasser über seinen Rücken laufen, als könne es den grotesken Mord fortwaschen. Als er nach dem weißen Handtuch griff, kehrten seine Gedanken jedoch erneut zu dem hellen Skelett zurück, das den Toten so fasziniert hatte. ‚Ein Mensch in einer Schachtel, versteckt in einem Lagerraum … Was für eine bizarre Geschichte.‘
In T-Shirt und Sporthose gekleidet kehrte er in die Küche zurück. Die altgewohnte weiß-rote Plastikdecke auf dem Tisch begrüßte ihn mit ihrem vertrauten Muster. Sie war das Hochzeitsgeschenk seiner Mutter gewesen zusammen mit einer ganzen Ansammlung von Töpfen. Zumindest er wurde von seiner Mutter geliebt. Seine Kinder rannten ihm entgegen, küssten ihm die Wange und präsentierten ihm Schulhefte. In seiner Grübelei nickte er nur stumm und setzte sich. Gerichtsmedizin, Spurenermittlung und die Kollegen vom Morddezernat arbeiteten bereits an dem Fall in Herculaneum, aber am Ende würde man ihn ansehen und Anweisungen erwarten. Was sollte er tun? Die Liste der Mutter Perrones abarbeiten?
Er sah zu seiner Frau auf der Suche nach Rat. Laura arbeitete am Observatorium, das den Vesuv überwachte, und kannte die verschütteten Städte besser als er. „Ich habe mir die Geschichte Herculaneums noch mal angesehen. Wie ist jemand darauf gekommen, sich vom Boden eines Brunnens in nassen Lavastein zu hacken, um antike Ruinen zu suchen? Mich hätten keine zehn Pferde dazu gebracht, mich in zwanzig Metern Tiefe durch den Tuff zu wühlen. Es ist kalt dort, nass und ungesund.“
Laura zuckte die Schultern. „Versunkene Schätze und tragische Unglücksfälle ergeben eine anziehende Mischung. Der Vesuv ist das bedrohlichste Ungeheuer des europäischen Kontinents und die Städte unter ihm waren Luxusresorts. Die Leute liebten es schon immer, die Reste der von ihm verursachten Katastrophe zu erkunden. Und wenn man dann noch was Wertvolles findet.“
„Und noch heute kommt jedermann in die Ruinen und bewundert mit Lust die Gebeine der Opfer. Was die Leute sich an Katastrophen ergötzen können.“ Camarata schüttelte den Kopf. „Meine Kollegen haben seit heute Morgen Hundertschaften von erbosten Besuchern wegschicken müssen, die Schlange standen, um die antiken Trümmer zu sehen.“
„Herculaneum ist seit seiner Entdeckung vor dreihundert Jahren eine Sensation. Als der Vesuv die Stadt zerstört hat, hat er drei Kubikkilometer Asche und Bimsstein in mehr als dreißig Kilometer Höhe geschleudert. Die Erde hat ihre Eingeweide ausgespuckt und ihre von der Eruption untergrabene Oberfläche hatte sich um vier Meter gesenkt. Auch ich empfinde bei der Statistik eine gewisse Sensationslust.“ Laura schmunzelte. „Öffentlich würde ich natürlich nur Besorgnis und Bedauern zugegeben.“
Camarata seufzte. „Vulkane … Mit denen ist es wie mit Seuchen und Kriegen: Man kümmert sich erst darum, wenn das Problem schon nicht mehr zu beheben ist.“
„Das ist mein tägliches Problem: Die Leute wollen die sie umgebenden Gefahren gar nicht so genau kennen.“
„Bah, die Mythen sehen es als größte Strafe für die Neugier der Zyklopen an, ihnen zu erlauben, den Moment ihres Todes vorherzusehen.“
Laura lachte. „Und du ignorierst daher auch immer stoisch, wenn ich dir sage, dass der Vesuv wieder Druck aufbaut?“
Camarata zuckte die Schultern. „Wir wohnen in Neapel, ob der Vesuv grollt oder schläft. Ich werde nicht wegen ein bisschen Grummelns umziehen.“
Laura grinste und spitzte die Lippen, um die Soße der Pasta zu kosten. Dann machte sie sich daran, den Kindern Teller zu geben. Alessandra, die Jüngste, nahm den ihren und ließ ihn und seinen Inhalt auf den Tisch fallen. Die sechzehnjährigen Zwillinge, Livio und Matteo, begannen zu schlingen, als hätten sie seit Tagen gehungert. Camarata realisierte, dass er dasaß, wie ein Gast und fühlte sich bemüßigt, als Vater auch etwas zu tun. Er wischte den Tisch ab und klopfte Matteo auf den Rücken. „Wie oft muss ich dich ermahnen, dich gerade hinzusetzen?“
Er sah auf die rote Soße auf dem Tuch in seiner Hand und versank erneut in Brüten. Perrone hatte in einem chaotischen Zimmer bei seiner Mutter gewohnt. Seine zwei Brüder hatten kaum Kontakt zu ihm gehabt, seine Mutter hatte er nicht interessiert. Er hatte allein für seinen Beruf gelebt, aber zumindest dort hatte man laut Mathis von ihm als von einem Wunderkind geredet. Aus seinem Apartment holte die Spurensicherung seit einer Stunde Berge von Büchern und Dokumenten als wäre sie in einer Bibliothek zugange. Was hatte Perrone in Herculaneum gewollt?
Camarata seufzte, griff nach dem Besteck und begann, sich die Tagliatelle in den Mund zu schaufeln, die seine Frau vor ihn hingestellt hatte. Sie standen dort schon ein paar Minuten. In seiner Achtlosigkeit rutschte ihm die Gabel aus der Hand. Er fluchte und Laura runzelte die Stirn.
„Ich bin ungeschickt.“ Er warf ihr einen entschuldigenden Blick zu. „Es tut mir leid. Ich war schon wieder in Gedanken …“
Sie hob die Brauen. „Hast du nicht gewechselt? Jetzt hast du schon wieder einen Mord am Hals. Ich kenne die Zeichen. Sollte das nicht aufhören? Schlechte Laune und grimmige Miene?“
„Hm.“ Camarata seufzte. Seine Frau hatte recht und wenn er sich nicht helfen ließ, würde er erneut einen Monat schlafloser Nächte vor sich haben. Allein würde seine Brigade nicht hinter das Geschehen in Herculaneum kommen, auch wenn Negri von der Mordkommission ihnen zuarbeitete.
Ein Name kam ihm in den Sinn. Professor Andrea Adalgiso Cariello.
Camarata hatte den prominenten Forscher mit den altertümlichen Rufnamen vor drei Jahren in einem obskuren Fall kennengelernt. Cariello hatte damals seine Frau verloren. Der Professor war weit entfernt vom Bild des Indiana Jones, das man sich gemeinhin von Archäologen machte. Ein gebildeter Mann, hochgewachsen, stattlich, aber auch verschlossen. Cariello war eine Koryphäe, was die Ausgrabungen am Vesuv betraf, auch wenn er Camarata bei ihrem letzten Zusammentreffen eingeschüchtert hatte. Cariello war wütend gewesen, keine Antwort auf die Fragen um den Tod seiner Frau zu erhalten, und hatte eisig reagiert. Camarata zögerte, ob er es wagen sollte, Cariello trotzdem zu konsultieren, aber begriff, dass er kaum eine Wahl hatte.
Etwas berührte ihn und er zuckte zusammen. Laura hatte ihre Hand auf die seine gelegt. Sie blickte ihn besorgt an. „Iss, Francesco. Du siehst aus, als ob dich der Fluch von Herculaneum verfolgen würde.“
Er lachte auf. „Was denn? Es gibt einen Fluch in diesen verdammten Ruinen?“
„Eine alberne Legende.“
Camarata wollte nachfragen, aber schüttelte dann den Kopf und schenkte Laura und sich selbst Rotwein ein. Die Flüssigkeit erinnerte ihn unangenehm an das Blut auf dem Boden des Tunnels, durch den er am Morgen gekrochen war. Er trank den Wein trotzdem, aber stürzte das Glas schneller herunter, als es der guten Sitte entsprochen hätte.
Professor Cariello
Es roch nach Holzkohlefeuer und gemähtem Gras. Vom Meer klang das Hupen der Fähren herüber. Camarata grüßte das erste Licht, das durch die Vorhänge schien, als Retter. Noch war alles still, aber er lag bereits seit fünf Uhr wach und dachte über den Toten in Herculaneum nach. Sein Kopf war ein Chaos. Tunnel, Skelette und geballte Fäuste tanzten vor seinem inneren Auge einen makabren Totentanz. In seinen Traum mischten sich wieder und wieder das Bild der Karte, die bei Perrone gelegen hatte und die Namen, die seine Mutter ihm zugeworfen hatte.
Die ersten Sonnenstrahlen überquerten das Dach der verfallenden Kirche, die vor seinem Fenster stand. Er begrüßte sie erleichtert und setzte sich auf.
„Es ist Sonntag ...!", murmelte Laura verschlafen.
Camarata küsste ihr zerrauftes Haar und schwang die Beine aus dem Bett. „Mein anheimelndes Familienleben verträgt sich nicht mit meinen wüsten Träumen. Ich komme gleich wieder.“ Als er wenig später in Uniform ins Freie trat, war die Luft noch angenehm kühl und der Geruch nach Espresso und Gebackenem hing über der Gasse. Irgendwo hämmerte jemand auf Metall und ein Angestellter der Stadt bearbeitete den Rasen im kleinen Park nahebei. Ansonsten war es ruhig.
Er wollte sein Fahrzeug aufschließen, als eine junge Frau auf ihn zugestürzt kam. Sie hatte einen Motorradhelm im Arm und hielt ein Telefon ausgestreckt vor sich. „Kolonel, Il Mattino – Napoli. Haben Sie schon ein Bauchgefühl, wer den Mann in Herculaneum umgebracht hat? Die Weltöffentlichkeit wartet auf Informationen.“
Camarata machte, dass er wegkam. Er hatte nichts am Hut mit der Weltöffentlichkeit und es schreckte ihn, dass seit dem Vorabend alle Schlagzeilen die Neuigkeit von dem toten Mann im Tunnel brachten. Die junge Journalistin wollte sich nicht abwimmeln lassen und schoss ein Foto von ihm. Es würde sicher in der Tagesausgabe erscheinen. ‚Ein verschlafener Carabiniere mit Tränensäcken unter den Augen. Wie ich das liebe.‘ Camarata hasste es, sein Bild in der Presse zu sehen, und sei es nur, weil er gern besser ausgesehen hätte.
Die Alleen waren noch leer und er erreichte Neapels Vorort Marechiare kurz vor acht. Die sonnenüberflutete Gasse, deren Namen er sich notiert hatte, führte von der Höhe der Straße nach Posillipo hinunter zum Meer. Er ließ seinen Wagen auf dem Gehweg stehen, legte sein Carabinieri-Zeichen unter die Scheibe und machte sich auf den Weg.
Marechiare beruhigte seinen Grimm. Unterhalb der hässlichen Palazzi, die die Aussichtsstraße über die Höhen am azurblauen Golf säumten, verbarg sich eine Ansammlung rot oder weiß getünchter Häuser. Sie lagen am Hang über dem Lapislazuli des Ozeans, eins neben dem anderen aufgereiht wie Perlen. Einige waren Ruinen, andere prächtige Villen umgeben von Palmen. Camarata hielt inne und atmete den Geruch ein, der vom Meer heraufwehte. Eine Mischung von Algen, Fisch und Schiffsöl. Darunter lag der Duft von Frangipani. ‚Ich bin Neapolitaner, ich sterbe, wenn ich nicht singe‘, stand an einer der Mauern der Innenstadt geschrieben. Die Fremdenführer zeigten darauf und summten die Melodie vom berühmten ‚Marechiare‘. Dem Marechiare, in dem der Mond aufging und in dem noch die Fische verliebt waren.
Als Kind hatte Camarata bei den Felsen am Strand gebadet und Kraken gefischt. Ein spindeldürrer, braungebrannter Bengel mit schwarzen Füßen und dichten Locken. Seitdem waren seine Haare lichter geworden, die Freunde in alle Welt versprengt und seine Großmutter, die nahebei gewohnt hatte, gestorben.
‚Spindeldürr bin ich auch nicht mehr‘, fügte er in Gedanken hinzu. Er hatte vor Kurzem die 100-Kilo-Marke erreicht und wusste, dass er abnehmen musste. Mit zusammengekniffenen Augen sah er über die Dächer. Der Vesuv thronte mächtig und kahl auf der anderen Seite des Golfs. Wie jeder Neapolitaner liebte er den alten Brocken.
Er passierte mehrere der Villen und erreichte die Nummer zehn. Beeindruckt sah er an dem von ausladenden Pinien umrahmten Gebäude empor. Vor drei Jahren hatte Cariello in einem anderen Stadtteil gewohnt. Nicht bescheiden, aber durchaus nicht so verschwenderisch. Das massive grüne Tor in der Mauer aus hellen Steinen war mit Eisenzacken bewehrt wie die Pforte einer Festung. Camarata fühlte sich klein vor dem unerwartet luxuriösen Gemäuer. ‚Accidenti! Manche Leute kommen aus armen Familien und manche aus reichen.‘
Er läutete und wartete, bis sich Schritte näherten. Ein Riegel wurde zurückgeschoben und eine weißhaarige Frau mit faltigem Gesicht schaute durch den Spalt, die Stimme schnarrend und voller Abweisung. „Sie möchten?“
„Ich will den Professor sprechen.“
„Erwartet er Sie?“
„Er kennt mich. Camarata. Carabinieri.“
Adleraugen musterten ihn, dann trat die Frau zurück. Seine breite Gestalt und sein Alter überzeugten sie wohl mehr als die Uniform, die sie geflissentlich ignorierte. „Der Herr Professor ist gerade aufgestanden. Bitte.“
Camarata sah sich um und war nahe daran, wieder umzukehren, so sehr schüchterte ihn die Umgebung ein. Die verschwenderisch renovierte Villa stammte aus dem 18. Jahrhundert, der Garten dahinter war ein Park mit Palmen und Bougainvillea. Es roch nach Buchsbaum und Rosen. Die Alte kommentierte weder seine gehobenen Brauen noch seinen offenen Mund und brachte ihn zu einer weitläufigen Terrasse.
Auf deren Schwelle blieb Camarata stehen. „Alle Achtung. Von hier oben kann man schaun, ob die Erde rund ist.“ Der Golf von Neapel erstreckte sich schier grenzenlos vor seinen Augen. Links im Dunst thronte die mächtige Silhouette des Vesuvs, rechts lag auf einer Halbinsel die Geisterstadt von Rione Terra. Ein Frangipani-Baum wucherte über die Brüstung, halb eingelassen in den marmornen Boden. Ein Meer von weißen Blüten, das ihm den Atem nahm.
„Gefällt Ihnen die Aussicht, Kolonel?“
Camarata drehte sich um. Er hätte Cariello nicht wiedererkannt. Er saß in helle Leinenhosen und einen roten Morgenmantel gekleidet an der Balustrade, die langen Beine übereinandergeschlagen, einen Cappuccino in der Hand. Seine Füße waren nackt und die schwarzen Haare glänzten in der Sonne. Mit dem markanten Gesicht und den scharfen Brauen wirkte er wie ein spanischer Grande.
Camarata versteifte sich. Er wusste, dass Cariello aus einer Diplomatenfamilie stammte. Sein früh verstorbener Vater war Botschafter in den Vereinigten Staaten gewesen und seine Mutter kam aus sizilianischem Adel. Mit dem zur Schau gestellten Reichtum hatte er trotzdem nicht gerechnet. „Schön haben Sie es hier, Professor. Haben Sie im Lotto gewonnen?“
Cariellos Blick wanderte ungeniert über Camaratas Bauch. „Kaffee?“
Camarata ließ sich ächzend auf einen der Korbsessel fallen. Er fühlte sich beklommen angesichts Cariellos eleganter Gelassenheit.
Cariello reichte ihm einen Espresso weiter, den seine Haushälterin brachte, und wartete, die Brauen gehoben, die Augen dunkel.
‚Natürlich hofft er auf Neuigkeiten über seinen Bruder.‘ Camarata fühlte sich schuldig, nicht damit dienen zu können. Er kam als Wissensdurstiger, nicht als Überbringer von Neuigkeiten. Vor drei Jahren, als er Cariello kennengelernt hatte, war dessen junge Frau gestorben und seinen Bruder verschwunden. Ihm war selten ein Mann begegnet, der so am Boden zerstört gewesen war wie er. „Ich weiß leider nichts Neues zu berichten“, knurrte er. „Ich komme nur als Bittsteller …“
Cariellos Schultern senkten sich. Er rührte in seinem Kaffee. „Sie kommen wegen des Mannes in Herculaneum?“ Die Sonne zeichnete Spiele von Licht und Schatten auf seine scharfgeschnittenen Züge. Er überschlug die Beine erneut in der für ihn charakteristischen Art und Weise und sah ihn abwartend an.
Camarata nickte. „Der Tote, den wir gestern im Tunnel gefunden haben, ist nicht einfach irgendjemand. Es handelt sich um einen bekannten Wissenschaftler. Er hat hier in Neapel im Labor Ihrer Universität gearbeitet. Sein Chef hat uns gesagt, er sei ein Genie gewesen. Gianni Perrone. Kennen Sie ihn?“
Cariello hob die Brauen. „Flüchtig. Er ist in der Tat bekannt. Er ist es, den man umgebracht hat? Perrone? Die Presse hat das nicht erwähnt. Was wollte er in dem Tunnel?“ Cariellos Baritonstimme klang warm und angenehm.
„Das versuchen wir herauszufinden. Was wissen Sie über ihn?“
Cariello zuckte die Schultern. „Perrone ist ein Biochemiker, aber mir war er wegen seines historischen Wissens bekannt. Er wusste sprichwörtlich alles. Manchmal kam er bei mir im Büro vorbei, um meine Schriften zu kommentieren. Anmerkungen, Kritik, Anregungen. Er hatte immer recht.“ Ein spottendes Zucken schlich sich in Cariellos Mundwinkel. „Er entnervte mich mit seiner Besserwisserei, aber er war brillant. Haben Sie ihn erlebt?“
„Nur tot.“
„Hm.“ Cariello trank seinen Kaffee aus und setzte die Tasse ab. „Perrone war ein übergewichtiger Riese mit durchschnittlichem Gesicht, aber wenn er begeistert war, blühte er auf. Dann predigte er über antike Politik und historische Weltanschauungen. Wir waren nicht befreundet und nicht einmal Kollegen, aber ich habe zuweilen mit ihm diskutiert.“ Er seufzte. „Unfassbar, dass er tot ist. Wieso hat man einen so brillanten Menschen in Herculaneum erschlagen?“
Camarata seufzte. „Das wollte ich von Ihnen wissen, Professor. Sie kennen die Ruinen. Man hat mir gesagt, Sie hätten lange in den alten Grabungstunneln gearbeitet und wären eine Koryphäe …“
„Eine Koryphäe. Hm. Ich kenne die Gänge, aber ob ich Ihnen deswegen in einem Mordfall weiterhelfen kann …? Die Tunnel sind speziell. Herculaneum wurde durch sie erforscht, bevor man es ausgrub. Bis heute ist nur etwa ein Viertel der Stadt freigelegt. Der Rest liegt im Tuff und ist nur durch die Stollen zugänglich oder gar nicht, inklusive seiner Tempel und bedeutender Villen.