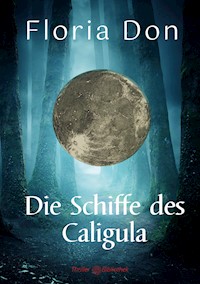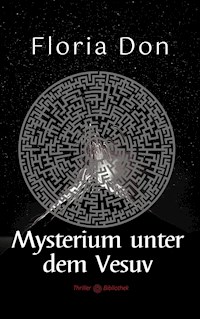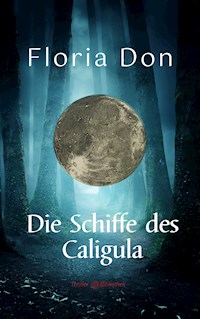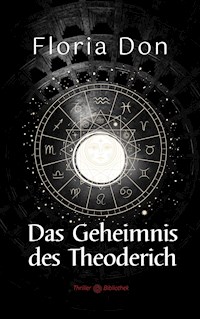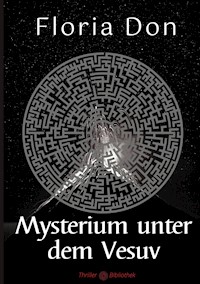
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Archäologie-Krimis
- Sprache: Deutsch
Die antike Stadt Herculaneum liegt halb begraben im Tuffstein, versteckt an den Hängen des Vesuvs im Süden von Neapel. Tief im Inneren, in der Lava, ruht bis heute einer der größten Schätze der Welt - die berühmte Villa der Papyri, deren Arkaden bisher nur teilweise erforscht wurden - durch Tunnel, dreißig Meter unter der Erde... Ein begabter Wissenschaftler wird in einem Gang, der zu dieser Villa führt, erschlagen aufgefunden. Colonel Camarata und Professor Cariello machen sich auf die Suche nach dem Geheimnis seines Todes und einem mysteriösen Manuskript. Am Fuße des Vesuvs, am azurblauen Golf von Neapel und in den dunklen Tunneln der Lava entspinnt sich eine fesselnde und rätselhafte Jagd nach Mördern und Geheimnissen. Ein Thriller, der auf wahren Begebenheiten beruht. "Für Archäologie-Fans". "Ein Muss für Liebhaber von Spannung und Geschichte im Stil von 'Da Vinci Code' oder 'Der Name der Rose'." "Ein neues Lieblingsbuch für Fans von Italien und der Wärme des Südens. Sehr gut recherchiert, spannend und wundervoll beschrieben." "Eines der besten Bücher der letzten Zeit."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist für Loris und Rohan.
Dieses Buch basiert auf historischen Begebenheiten und realen Schauplätzen. Seine Handlung ist fiktiv.
So ist also der Tod, das
schrecklichste der Übel, für
uns ein Nichts:
Solange wir da sind, ist er
nicht da,
und wenn er da ist, sind
wir nicht mehr.
Epikur
Inhaltsverzeichnis
Unter der Lava
Ein verborgenes Skelett
Gänge unterm Vulkan
Bei Camarata
Professor Cariello
Cariello erlebt ein Wiedersehen
Der geheimnisvolle Tunnel
Der Kolonel trifft einen Zeugen
Der Professor hat eine Spur
Ein eigenartiges Erlebnis
Die griechische Schrift
Was vor langer Zeit geschah
Raubgräber
Morgendämmerung
Unangenehme Anrufe
Schwere Rückkehr
Der Vulkan
In der Nationalbibliothek
Der Name des Franzosen
Der Kolonel grübelt
Mord in den Archiven
Der Fundort des Franzosen
Das Geheimnis der Villa
Die geheimnisvolle Karte
Familienbande
Ein gefährlicher Weg
Abstieg ins Ungewisse
Eine Entdeckung unter der Lava
In Lebensgefahr
Der verschwundene Papyrus
Die Wahrheit über Pezzoli
Auf den Spuren des Vatikan
Ein Anruf in Paris
Auf der Spur des Vatikans 2
Ein Anruf aus Paris
Das mysteriöse Paket
Böse Überraschung
Alte Spuren
Das Rätsel der Bilder
Marsilys Brief
Fieberhafte Suche
Das Rätsel der Färse
Die Papyri Epikurs
Da wo mein Haus ist
Im Schock
Der zweite Tunnel
Das Schicksal eines Mörders
Rettung
Am Grab
Letzte Worte
Das Glück
Nachwort
Unter der Lava
Er konnte die Hand nicht vor den Augen sehen. Kein Laut war zu hören, nur das Glucksen von Wasser, das über die Wände des Ganges lief und von den Stalaktiten tropfte. Der modrige Geruch von Algen und Stein drang ihm in die Nase. Darunter lag ein anderer – süßlicher, und so plastisch dichter, dass er ihn auf der Zunge schmecken konnte - der von Blut.
Manzoni fingerte zitternd nach der Taschenlampe und drehte sie an. Er richtete den Strahl ein zweites Mal vor sich auf den Boden des bedrückend engen Tunnels unter der Lava. Der Tote lag noch immer da. Er konnte keine vierzig Jahre alt sein. Sein blondes Haar war nass von der karminroten Lache, die sich unter seinem Kopf gebildet hatte und die grauen Augen standen weit offen, genauso wie der aufgerissene, sandgefüllte Mund, in dem die Zunge wirkte wie ein totes Reptil.
Manzoni versuchte, sich an der Wand festzuhalten. Er hatte den Eindruck, dass der Grabungstunnel schwankte. Er hatte diese Stollen zusammenbrechen sehen. Einmal war einer von hereinflutendem Grundwasser gefüllt worden und er wäre beinahe darin ertrunken. Hinten, weiter bei der Villa, gab es Stellen, da musste er sich mit Atemmaske fortbewegen, weil Vulkangase in die Gänge drangen. Aber er hatte trotzdem nie Angst gehabt. Niemand wagte sich mehr hier herunter, aber er war hier zu Hause.
Jetzt jedoch fürchtete er sich. Sein Herz pulsierte in wilden Sätzen bis zum Hals und er hatte Mühe zu atmen. Es war nicht der Tote, der ihn schreckte, sondern der Vulkan.
Er wandte sich um und taumelte zum Ausgang, die Knie weich und die Glieder bebend. Hier unten hauste der Tod und der Nächste, den der Berg sich holen würde, war er selbst.
Ein verborgenes Skelett
Es war fast Mittag geworden. Die Sonne brannte auf die Ruinen und die darüberliegende Stadt. Die Zikaden waren verstummt und nur von fern war das Geräusch von Fahrzeugen zu hören. Die Anlage war wegen des Mordes geschlossen worden und keine Menschenseele war mehr zu sehen, nur ausufernder Oleander und Pinien. Am Horizont thronte der Vesuv mit seinen grünen Hängen und der schuttbedeckten Spitze, drohendes Menetekel der Vergänglichkeit menschlichen Seins.
Ein untersetzter Mann mit grauen Haaren und dem südländischen Gesicht des Neapolitaners kam die Rampe aus den Ausgrabungen herauf. Seine dunkle Uniform war bedeckt von Staub und Kletten. Buschige Brauen beschatteten schwarze Augen, die intelligenter aussahen, als es die korpulente Figur und der Stiernacken hätten vermuten lassen. Sein weißes Uniformhemd war verschwitzt und spannte sich über dem Bauch. Mit seinem ruhigen Schritt und der breiten Figur verbreitete er eine Aura von gewichtigem Ernst.
Francesco Camarata wischte sich den Schweiß vom Gesicht. Die Hitze machte ihm mit ihren vierzig Grad im Schatten zu schaffen. Der Höhenunterschied von den Ruinen bis zu den Verwaltungsgebäuden betrug zwanzig Meter, vom antiken Strand dreißig. „Du bist von zehn Schritten außer Atem. Du wirst alt, mein Freund.“
Als leitendem Kolonel der Carabinieri war es ihm zugefallen, den Erschlagenen in dem erstickend engen Tunnel im Tuff zu besichtigen. Er hätte gern darauf verzichtet. Sein Nacken war voller Sand und sein Rachen ausgetrocknet. Kopf und Rücken schmerzten. Die Wächter der Anlage hatten ihn gewarnt, dass die alten Tunnel zusammenbrechen könnten, dann hatten sie ihn gnadenlos vorangeschoben. Seit zweihundertfünfzig Jahren hatte niemand die Stollen im Tuff unterhalten. Mehr noch: man hatte ihm gestenreich versichert, dass sie schon bei ihrer Erschaffung instabil gewesen seien. ‚Aber reinkomplimentiert haben sie mich trotzdem.‘
Camarata zog die Schultern hoch. ‚Was für ein Ort.‘ Das Wort ‚besitzergreifend‘ spukte ihm durch den Kopf. Er hatte an diesem Morgen den Bauch der Erde besichtigt. ‚Ich frage mich, was der Tote dort unten drin gewollt haben kann. Die halbe antike Stadt liegt noch im Stein, aber er kann ja unmöglich beabsichtigt haben, sie mit bloßen Händen um Mitternacht auszugraben.‘
Auch wenn sie den blonden Mann blut- und schmutzbedeckt gefunden hatten - er war gut gekleidet gewesen. ‚Wieso kriecht man mit einer Statur von einem Meter neunzig und guten hundertfünfzig Kilo Lebendgewicht in einen kaum einen Meter breiten Tunnel? Im Anzug. Und wieso findet sich darin in aller Herrgottsfrühe jemand, der einem einen Stein über den Schädel schlägt?‘ Er hielt es für wenig wahrscheinlich, dass man den Toten dort hineingezerrt haben könnte. ‚Der Gang ist zu eng. Dann hätte er nicht so tief drinnen gelegen.‘
Camarata war erschöpft und von dem blutigen Tatort, den er gesehen hatte, erschüttert. Trotz der vielen Jahre im Dienst verstörten ihn Szenen von Gewalt und Brutalität noch immer. Er spürte den dumpfen Schock bis in die Haarspitzen. Der junge Mann hatte um sein Leben gekämpft und den Kampf im finsteren Loch im Tuff verloren. Sein Blut war überall an den Wänden gewesen. Der rote Abdruck seiner Hand hatte ein Mauerstück bedeckt, an das er sich in seiner letzten Minute geklammert hatte.
Camarata ächzte. Er hasste es, die sterbliche Hülle eines Menschen zu sehen, aus der der Atem des Lebens gewichen war. Es war ein beeindruckendes und zugleich erschütterndes Bild. Irgendwo tief drinnen rührte es an das Wissen um seine eigene Sterblichkeit.
Das Labor Herculaneums war der letzte Ort, den er besuchen würde. Es musste sich in den einstöckigen Bauten unter den Bäumen befinden. Die riesige Grube, die man gegraben hatte, um die antike Stadt aus dem Tuff zu befreien, lag hinter ihm. Vor ihm erstreckten sich die flachen Ziegelgebäude der Verwaltung. Er versuchte, sich zu orientieren und fand das Labor schließlich dank eines Schildes zwischen den Oleanderhecken.
Als er eintrat, atmete er auf. Es war weiß, sauber und vor allem kühl. Plastikstühle und lange Tische standen in Reihen, Regale lehnten an der Wand und über allem lag der aseptische Geruch von Chemikalien. Auf den Tischen ruhten unförmige Haufen bedeckt von Seidenpapier. Er hob eins an, aber ließ es eilig wieder fallen. Ein Totenschädel bleckte ihn an.
„Keine Angst, die beißen nicht.“
Camarata fuhr herum.
Eine junge Frau mit schmalem, gebräunten Gesicht stand hinter ihm. Sie hatte die blonden Haare zu einem Knoten gebunden.
Mit den Händen in den Taschen ihres Kittels wippte sie auf den Zehenspitzen auf und ab, die grauen Augen spottend. „Das Labor ist nicht öffentlich. Besucher haben hier nichts zu suchen.“ Sie bildete einen erfrischenden Kontrast zur Gluthölle der Ruinen und dem Ermordeten in ihren Eingeweiden.
„Warum haben Sie tote Leute hier liegen?“
Die junge Frau zog das Seidenpapier zurück über die Knochen, schürzte charmant die Lippen und warf einen Blick auf seine schwarze Uniform. „Die fallen nicht in Ihr Ressort. Das sind antike Opfer des Vesuvs, die man unten am Strand gefunden hat.“
Camarata fühlte sich alt und staubig gegenüber der jungen Frau. „Am Strand?“
„Die Leute hatten sich in Bootshangaren versteckt, in der Hoffnung, dass die römische Flotte sie vor dem Vulkan retten würde.“
„Aber das ist nicht passiert?“
„Sonst hätten wir sie nicht hier … Ein gewisser Plinius sah den Ausbruch gegen Mittag und war noch vor Sonnenuntergang in Herculaneum - aber die Leute waren bereits bei lebendigem Leib gekocht worden.“ Sie drehte sich zu einem der Labortische und griff eine murmelgroße Kugel. „Sehen Sie das?“
Camarata zuckte die Schultern.
„Das ist ein Gehirn.“
Er zog eine Grimasse.
Das Lächeln um den vollen Mund der Laborantin vertiefte sich. „Jetzt würde ich Sie aber hinausbitten.“
‚Ich muss mitgenommen aussehen, dass sie mich so erheiternd findet‘, dachte Camarata brummig. Die junge Frau war so groß wie er, schlank und selbstsicher. Wesentlich selbstsicherer als er selbst sich fühlte, dick, dreckig und verschwitzt wie er war. „Ich bin leider kein Besucher, sondern dienstlich hier.
Francesco Camarata, Kolonel der Carabinieri. Sie sehen die Uniform. Man hat einen toten Mann in den Ruinen gefunden.“ Er holte sein Telefon aus der zerbeulten Tasche seiner Jacke und hielt den Bildschirm vor sie. Darauf leuchtete das Foto des Toten, das er am Tatort geschossen hatte. Es war das Beste unter einer weit blutigeren Auswahl.
Die junge Frau machte einen taumelnden Schritt zurück. Er realisierte zu spät, dass er sich von ihrer Energie verleiten lassen hatte, ihr das Bild zu forsch vors Gesicht zu halten.
„Oh Gott. Das ist Gianni Perrone.“
Trotz seines Schuldgefühls, sein Gegenüber so erschüttert zu haben, war Camarata erleichtert. Hätte er nicht befürchtet, als belästigend eingestuft zu werden, hätte er ihr um den Hals fallen mögen. Sie befragten seit Stunden die Angestellten in der Anlage, um zu erfahren, wer der erschlagene Mann im Tunnel gewesen war. „Ist das ein Kollege von Ihnen?“
„Er ist ein Biochemiker aus Neapel. … Perrone ist tot?“ Die Laborantin sank erschüttert auf einen der Plastikstühle. „Gianni Perrone hatte hier genauso wenig zu suchen wie Sie … wie Touristen, meine ich. Aber er kam zweimal her. Daher kenne ich ihn.“
Camarata wunderte sich über die Welle von Emotionen, die sich auf dem Gesicht der jungen Frau widerspiegelten. Der Tod Perrones schien sie mehr zu verstören, als ihre Worte vermuten ließen. Ihre Lippen waren weiß. Er riss sich am Riemen und dämpfte seine Stimme. „Darf ich fragen, was Perrone von Ihnen wollte?“
„Ich hatte ihm Knochenproben gesendet. Wir hatten die Skelette aus den Ausgrabungen an Universitäten zu Tests, aber ich habe eins im Lagerraum entdeckt, das man vergessen hatte. Perrone hat die fehlenden Untersuchungen durchgeführt und ist dann hier erschienen … wie …“ Sie zögerte und ihr Tonfall klang unsicher. „Wie eine Furie.“
Camarata runzelte die Stirn. „Er hätte nicht herkommen sollen?“
„Nein.“
„Aber er ist trotzdem gekommen und war was? Wütend?“
Sie schüttelte den Kopf. Ihre hellen grauen Augen sahen ihn voller Zweifel und Sorge an. „Erregt. Und aufdringlich. Ich fand Perrone intelligent, aber er hat sich unmöglich betragen. So als ob die Knochenproben, die ich ihm gesendet hatte, etwas Unglaubliches wären. Er war wie ein großes, schnüffelndes Tier.“
„Er kam wegen eines antiken Skeletts? Hm. Wir haben ihn in einem Tunnel im Tuff gefunden. Sagt Ihnen das etwas?“
„In den Bourbonen-Tunneln? Als Biochemiker?“
Die Frage stellte Camarata sich auch. Was suchte ein Biochemiker in einer archäologischen Ausgrabung mitten in der Finsternis? „Der Gerichtsmediziner meint, er sei keine drei Stunden tot gewesen, als man ihn entdeckt hat. Man hat ihn irgendwann nach Mitternacht erschlagen. Wann war Perrone das letzte Mal hier?“
„Gestern am späten Nachmittag. Gegen sechs.“
„Hm. Warum sollte er von hier weggegangen sein, um dann ein paar Stunden später unten in den Gang zu kriechen?“
Die junge Frau zuckte die Schultern. „Die Tunnel sind lebensgefährlich. Und dann noch im Dunklen? Wie ist er überhaupt nachts in die Anlage gekommen?“
Camarata konnte ihre Frage nicht beantworten. Heißer Wind wehte vom Fenster herein und trug den Duft überreifer Feigen herein. Es war der Geruch nach Sommer und dem Urlaub, aus dem er gerade zurückgekehrt war. Die Ruhe und Heiterkeit der freien Tage waren aus ihm verschwunden. Die zerschmetterten Knochen des Erschlagenen hatten sie ausgelöscht. Er öffnete erneut das Telefon und hielt der jungen Frau ein Bild des Körpers des Toten hin. „Schauen Sie ...“
Sie zuckte zurück.
„Ich weiß, das ist unschön. Aber sehen Sie sich das an. Der Mann hat den Mund weit aufgerissen, den Rachen voller Sand und Kiesel und die zertrümmerten Hände über dem Kopf verkrampft. Der Mediziner sagt, man habe ihm den Mund gewaltsam aufgerissen bis der Kiefer brach.“
Die junge Frau biss sich auf die Lippen. „Man hat Perrone hergerichtet?“
Camarata sah ihr mit Insistenz in die Augen. „Wieso sollte jemand einen Toten mit so viel Aufwand herrichten, wenn er in einem Grabungstunnel liegt, in dem niemand vorbeikommt? In der Hoffnung auf Zuschauer …?“
Sie stand auf. „Ich glaube, ich weiß, was das bedeutet. Kommen Sie.“ Sie brachte ihn zu einem der Tische und zog das darübergebreitete Papier zur Seite. Ein Skelett kam zum Vorschein, dessen Haltung durch Tuffstücke bewahrt war. Sein Gebiss bleckte weit offen und die Skeletthände waren über dem Kopf geballt. Ein Geruch nach Konservierungsmitteln und Verwesung schlug ihm entgegen.
Er pfiff leise. „Das sieht aus wie der Mann im Tunnel.“
„Die Faustkämpferstellung ist typisch für einen in der Hitze verkrümmten Körper. Viele der antiken Toten sahen so aus.“
„Perrone wurde hergerichtet, wie ein Opfer des Vesuvs?“
„Vielleicht wollte der Mörder die Leiche kaschieren, so dass man später nicht auf den Mord aufmerksam wird?“
„Was war mit dem anderen Skelett, dem, welches Sie im Lagerraum gefunden haben. Sieht das auch so aus?“
„Das sind nur lose Knochen, aber viel weißer als die hier. Es ist …anders.“
Camarata hätte die junge Frau schütteln mögen. „Perrone kam wegen des losen Skeletts her? Sie sagten doch, es seien die Proben gewesen, die ihn so in Aufregung versetzt hatten. Was ist damit? Was ist anders?“
Die blonde Laborantin rieb sich die Stirn. „Ich habe keine Ahnung. Mir fiel das Skelett nur auf, weil es nicht bei den archivierten Gebeinen lag. Man hatte es in einen Karton gezwängt und in die hinterste Regalecke geschoben, so als hätte man es verstecken wollen.“
„Verstecken?
„So sah es aus.“ Sie zog das Papier zurück über die Gebeine. „Und die Zähne sind schlecht.“
„Ist das nicht erlaubt?“
„Die Toten von Herculaneum haben außergewöhnlich gute Zähne. Das Grundwasser der Stadt ist reich an Fluorid. Der Mann im Karton hatte Karies. Er war nicht von hier. Ich dachte, dass es sich um eine Person aus Rom handeln könnte. Die Gegend hier war ein Urlaubsdomizil. Die Kaiser hatten ihre Villen drüben im Norden Neapels, bei Misenum. Ich hoffte, jemanden Außerordentlichen zu finden. Man weiß nicht viel darüber, wer in Herculaneum starb …“ Camarata verzog das Gesicht. Sein Puls hämmerte. Der Tod eines Menschen war etwas, dass auch an einem Ermittler nicht spurlos vorüberging und die bizarre Atmosphäre der Tunnel im Tuff hatten ihr Übriges getan. Er war beunruhigt, nervös. „Es scheint, auch Perrone dachte, dass etwas an dem Skelett besonders wäre.“
„Sie denken, man hat ihn deswegen umgebracht?“
Camarata trommelte mit den Fingern auf den Tisch. „Er kommt zweimal wegen dieser Knochen her, beim zweiten Mal kriecht er nachts in einen Grabungstunnel. Jemand folgt ihm und erschlägt ihn. Es müsste schon mit schlechten Dingen zugehen, wenn das nicht wegen seiner Neugier geschah.“
„Wenn man nachts in eine Ruinen-Anlage einbricht, geht das über Neugier hinaus.“
„Hm … Hat Perrone Ihnen die Ergebnisse seiner Tests übersandt?“
Die Augen der Laborantin blitzten und eine Furche bildete sich über ihrer Nasenwurzel. „Ich denke, er hatte sie bereits, aber er weigerte sich, sie mir zu geben. Ich hätte ihn gestern fast deswegen rausgeschmissen.“
Camarata musste schmunzeln. Mit der energischen jungen Frau hätte er sich nicht anlegen mögen. Sie hatte den Schock bereits verarbeitet und schien zu wissen, was sie wollte. „Rufen Sie mich an, wenn Ihnen noch etwas einfällt.“ Er drückte ihr seine Karte in die Hand. Dann wandte er sich zum Gehen, aber hielt noch einmal inne. „Wie heißen Sie eigentlich?“
„Therese Urquiola.“
Camarata dankte mit einem Nicken und trat ins Freie. Die junge Frau gefiel ihm.
Gänge unterm Vulkan
Camarata kehrte schweren Schritts zu den Ruinen zurück. Sand knirschte unter seinen Füßen und sein Rücken brannte unter der Sonne. Ächzend entledigte er sich seiner Uniformjacke, aber von da an brannte die Glut durch sein Hemd. ‚Vermaledeiter August.‘
Die ockerfarbenen Trümmer Herculaneums lagen auf dem Grund einer enormen Grube, die man in die Lava und den Tuff gegraben hatte. Dahinter thronte grau und reglos der Vesuv. Die moderne Kleinstadt Ercolano, deren zerfallende Bauten er in der Ferne sah, war über die Ruinen der verschütteten antiken Stadt gebaut worden. Seitdem waren ein paar hundert Jahre ins Land gegangen. Er hatte zu dem Fahrer, der ihn am Morgen hergebracht hatte, gemeint, dass man Ercolano das ansähe. Der Mann hatte zustimmend gelacht.
In der Stadt vor den Toren der Anlage hingen Kabel und Wäsche von den Balkonen und eine Dunstglocke von Schmutz lag bereits in den Morgenstunden über den Häusern. Das neue Ercolano war nicht reich wie das alte Herculaneum. Es trug den ehrenvollen Namen erst seit man die Ruinen entdeckt hatte und hatte vorher Resina geheißen. Es war ein Kaff, Vorstadt des Molochs Neapel und eine Ansammlung illegaler Bauten, die den Blick auf die malerische Bucht davor nicht verdienten.
Camarata ging den staubigen Weg und die enorme Rampe hinunter, erleichtert, der modernen Welt zu entkommen. Ein Gefühl der Beklemmung ergriff ihn jedoch, je weiter er in die Tiefe stieg und er fragte sich, was war dort unten in der vergangenen Nacht geschehen war.
Trotz des Ruhms der Ruinen, die im Tuff unter der neuen Stadt lagen, waren ihm die Gänge, die in die Wand der Grube führten, unbekannt gewesen. Er hatte davorgestanden, als hätte man sie gerade erst entdeckt. Eine Zeile spukte ihm seitdem durch den Kopf, die er wie jeder Italiener in der Schule gelernt hatte: „Nel mezzo del cammin di nostra vita … In der Mitte des Weges unseres Lebens ...“ Die ersten Worte der Göttlichen Komödie Dantes, die beschrieben, wie sich der Dichter am Tor der Hölle wiederfand, vor einem dunklen Loch ...
Er seufzte. Er brauchte eine Dusche, Kaffee und Wasser und es war besser, er vergaß im Moment die hypothetische Mitte seines Lebens. Sein fünfzigster Geburtstag lag hinter ihm und laut Statistik die Mitte seines Lebens auch.
Mit zusammengekniffenen Augen versuchte er, den Weg zum Tatort wiederzufinden. Die gepflasterten Gassen erstreckten sich zwischen hohen Mauerwänden aus braunen Ziegeln und leere Fensterhöhlen klafften ihm entgegen. Alles war von Staub bedeckt und ausgetrocknet, auch wenn er erkennen konnte, dass es sich bei den Trümmern einst um Villen gehandelt hatte. Sechs Schlammwellen waren darüber zusammengeschlagen. Der Luxus Roms mit Fensterglas, fließendem Wasser und Mosaikfußböden war unter Lava und Asche verschwunden. Eine ganze Stadt lag um ihn her im Tuff versteinert.
‚Da macht man uns weiß, der Homo sapiens entwickle sich hinein in eine immer besser werdende Zukunft. Wenn mal meine Mutter ein so modernes Haus hätte.‘
Er fragte sich, ob man dereinst auch seine Knochen aus der Erde kratzen würde, aber knurrte nur. „Ich lasse mich rechtzeitig einäschern, bevor ich mich einem Archäologen ausliefere.“
Er sah nach oben. Der Vesuv ragte als schemenhafter Umriss aus dem Dunst über den Ruinen, ein grauer Schutthaufen ohne Bewuchs und Zeichen von Aktivität. Seine Frau Laura arbeitete am Observatorium, das ihn überwachte. Sie sprach oft davon, dass der Vulkan wieder Druck aufbaue. Der Berg war nach ihren Worten das bedrohlichste schlafende Ungeheuer des europäischen Kontinents. Was ihn hier unten in der Grube umgab, war das Werk des Schuttbergs über ihm. Und jeder kam hierher und bewunderte mit makabrer Sensationslust die Gebeine der Opfer.
„Was die Leute sich an Katastrophen delektieren können.“ Er schüttelte den Kopf. Seine Kollegen hatten seit dem Morgen ganze Hundertschaften von erbosten Besuchern weggeschickt. Herculaneum war seit dreihundert Jahren eine Sensation.
Als der Vesuv die Stadt zerstört hatte, hatte er drei Kubikkilometer Asche und Bimsstein in mehr als dreißig Kilometer Höhe geschleudert. Die Erde hatte ihre Eingeweide ausgespuckt und ihre von der Eruption untergrabene Oberfläche hatte sich um vier Meter gesenkt. Laura gab zu, dass auch sie bei der Statistik eine Mischung aus Besorgnis, Leidenschaft und Sensationslust empfand. Öffentlich hätte sie nur die Sorge zugegeben.
Camarata zuckte die Schultern. Mit Vulkanen war es wie mit Seuchen und Kriegen. Man kümmerte sich erst darum, wenn das Problem schon nicht mehr zu beheben war. ‚Und warum auch nicht? Es kommt nicht von ungefähr, dass die Mythen es als größte Strafe für die Neugier der Zyklopen ansehen, ihnen zu erlauben, den Moment ihres Todes vorherzusehen. Ich wohne in Neapel, ob der Vesuv grollt oder schläft.‘
Er folgte der Gasse, die am Rand des ausgegrabenen Ruinenfeldes entlangführte, um den Eingang des Gangs wiederzufinden, in dem man den Toten entdeckt hatte. Der Zugang war von rotem Oleander überwuchert, aber er sah besorgt, dass der überall war. Nur die Tatsache, dass seine Kollegen davorstanden, ließ ihn das Loch im Labyrinth der zerbrochenen Mauern schließlich wiederfinden.
Giovanni Mathis, einer seiner Leute, kam ihm entgegen. Der dürre, übersportliche Maresciallo wischte sich mit der Hand über den Glatzkopf und hinterließ dabei eine Staubspur. Seine schwarze Uniform war genauso von Schmutz bedeckt, wie die seine. „Wir lassen den Mann jetzt wegbringen, Kolonel. Schauen Sie, was wir gefunden haben. Ich finde das eigenartig.“ Er hielt ihm einen Plastikumschlag entgegen, in dem sich eine grün-braune Karte befand. Sie war nass und bedeckt mit Blutflecken, die den Umschlag von innen beschmiert hatten.
Camarata griff danach und runzelte die Stirn. Es handelte sich um eine technische Detailkarte der Ausgrabungen. Jede Wasserleitung, jeder Tunnel waren eingezeichnet. „Der Tote ist Biochemiker. Wo hat der so was her?“
Mathis zuckte die Schultern. „Keine Ahnung. Seien Sie vorsichtig. Die Karte lag in einer Wasserlache. Dort unten ist was draufgeschrieben. Nicht, dass es verwischt. Es scheint Tinte zu sein.“
Camarata hätte auch gern in einer Wasserlache gelegen. Er starb vor Durst. Mit zusammengekniffenen Augen hob er die Karte vors Licht. „Danz … Danz … Irgendwas mit Tanzen? Was heißt das?“
„Die Technik wird es schon rausbekommen. Fassen Sie besser nicht drauf.“ Mathis salutierte, setzte seine Sonnenbrille wieder auf und rettete sich in den Schatten.
Camarata sah auf. Der Eingang des Tunnels, in dem man den Toten gefunden hatte, befand sich direkt vor ihm. Er lag in Hüfthöhe im Tuff, dem allgegenwärtigen, brüchigen Konglomerat aus Kieseln, Sand und Stein. Ein Team von Technikern in Schutzanzügen schob den Erschlagenen in diesem Moment in einem schwarzen Sack heraus. Camarata biss die Zähne zusammen, als ein Erdrutsch auf sie niederging und sie mit Dreck bedeckte. „Passt auf, ihr bringt die Wand zum Einsturz.“
„Danke für die Warnung. Das hören wir jetzt seit Stunden. Erklären Sie mir eins, Kolonel“, brummte Antonelli, der bejahrte Chef der Spurenermittlung, der am Morgen zu ihnen gestoßen war und hustend und spuckend aus dem Stollen kroch. „Dass man eine Leiche in so einem Loch versteckt, das kann ich verstehen. Aber dass man sie dann so kurze Zeit später findet … in einem Gang, der teilweise nur eine kriechende Fortbewegung erlaubt und innendrinn pitschnass ist … das ist schon ein unwahrscheinlicher Zufall.“
„Der Finder ist ein bekannter Archäologe.“
„Sechs Uhr früh?“
„Was weiß ich, wie Archäologen ticken. Und da drinnen ist es sowieso dunkel. Vielleicht hatte er nichts zu tun oder konnte nicht schlafen.“ Im Stillen dachte sich Camarata, dass es an diesem Fall so einiges gab, dass er nicht verstand.
Antonelli zuckte die Schultern und folgte den Trägern der Bahre auf ihrem Weg nach oben, die weißen Haare voller Dreck und Spinnweben. Die Zikaden hatten ausgesetzt, wie um ihm Zeit zum Sprechen zu lassen. Jetzt schnarrten sie so plötzlich wieder los, dass Camarata zusammenzuckte. Er hatte das Gefühl, dass jemand hinter ihm stand und drehte sich um. - Die Gasse war leer, aber das Geräusch von Schritten und die Bewegung der Blätter eines Feigenbaums zeigten ihm, dass er sich nicht geirrt hatte. Er sah mit zusammengekniffenen Augen auf die Ruinen. „Gaffer“, knurrte er kopfschüttelnd.
Dann folgte auch er seinen Kollegen nach oben. Versunken in Gedanken an ein weißes Skelett, das jemand im Labor versteckt hatte.
Bei Camarata
Es war bereits abends, als Camarata nach Neapel zurückkehrte. Die Hitze hatte nachgelassen, obwohl die untergehende Sonne die Dächer noch immer glühen ließ. Wie ein Schleier hing Dunst über den Stadtvierteln am Meer und verklärte die Umrisse der Häuser. Der Lärm der überfüllten Straßen der Metropole klang gedämpft aus der Altstadt herauf und die Töne eines Radios quäkten aus einem der ärmlichen Läden des Viertels.
Er zwängte sein Fahrzeug wie jeden Abend in den Hauseingang eines verfallenden Gebäudes, legte eine Lenkradsicherung an und schälte seine gedrungene Gestalt aus dem ramponierten Wagen. Er hatte seinen Seitenspiegel mit Klebeband befestigt und zog es erneut fest. Die Hitze griff den Kleber an, aber eine professionelle Reparatur lohnte sich nicht. Sein Fiat war zwanzig Jahre alt.
Bunte Wäscheleinen hingen vor den Fenstern der Nachbarn und überquerten die Straße wie Festtagsdekorationen. Langsam stieg er die ausgetretene Treppe zu seinem Haus empor und inhalierte dabei den Geruch nach Waschmittel und Kaffee. Die Ruhe, die ihn sonst beim Anblick der menschenleeren Straße überkam, wollte sich nicht einstellen. An sich sollte er den Anblick von gewaltsam gestorbenen Menschen gewöhnt sein. Er war lange beim Morddezernat gewesen. Aber ein Fall wie dieser war selbst für ihn ungewöhnlich.
Der Greis, der die Leiche entdeckt hatte, war nicht bereit gewesen, sich zu seinem morgendlichen Ausflug in den Gang im Tuff zu erklären. „Er sei zu geschockt“, hatte er nur gesagt und hatte mit den Händen gefuchtelt. Der Mann war ein Archäologe von Weltruf und, wie man Camarata versicherte, ein unwahrscheinlicher Mörder. Aber ein komischer Vogel war er trotzdem. ‚Was hat diesen Manzoni mit seinen wirren weißen Haaren dazu getrieben, in aller Herrgottsfrühe durchs Erdreich zu kriechen?‘ Camarata erinnerte sich an die rätselhaften Worte, die der Alte im Fortgehen geraunzt hatte. „Am Ende dieses Tunnels liegt ein Licht. Ein Wunder. Aber lassen Sie die Finger davon.“ ‚Ist das eine Metapher?‘
„Ein Wunder!“ Camarata seufzte und sah über das azurblaue Wasser, das die tieferliegende Altstadt Neapels begrenzte. Wie jeden Abend verabschiedete er sich von der Weite des Golfs, bevor er seinen Hauseingang durchquerte. ‚Für immer liebst du, freier Mensch, das Meer.‘ Er hätte gern alles vergessen und abgeschaltet, statt über den Mord nachzugrübeln. Seine Haut wurde mit den Jahren dünner. Das Bild der Gewalt, das er in dem Stollen gesehen hatte, nagte an ihm. ‚Irgendwann kann ich das hier nicht mehr machen. Man sieht die Toten am Ende für Jahre im Traum.‘
Als er in seine Wohnung trat, stand Laura bereits in der Küche, die blonden Haare hochgesteckt und gekleidet in einen Morgenmantel. Die Fenster standen offen und die Abendsonne flutete herein, ihre Wärme untermalt vom Duft von Basilikum und bratendem Fleisch. Er atmete aus. Erleichtert und mit dem Gefühl, vorerst in Sicherheit zu sein. „Ich bin spät. Ein Mord in Herculaneum.“
Sie sah auf. „Ein Tourist?“
„Ein Experte für DNA-Tests. Erschlagen in einem Tunnel und drapiert wie ein Opfer des Vesuvs. Eigenartige Geschichte.“
Er trollte sich ohne weitere Erklärungen ins Innere der Wohnung, gefolgt von ihrem fragenden Blick. Er fühlte sich schuldig, sie so stehen zu lassen, aber brauchte einen Augenblick für sich, um mit dem Unbehagen fertig zu werden, das ihn seit dem Ausflug in die Tunnel ergriffen hatte. Sein Rücken schmerzte und er fühlte sich ausgelaugt.
Er duschte sich und ließ das Wasser über seinen Rücken laufen, als könne es den grotesken Mord wegwaschen. Als er nach dem Handtuch griff, kreisten seine Gedanken jedoch noch immer um das Skelett, das den Toten so sehr fasziniert hatte. ‚Ein Skelett in einer Schachtel, versteckt in einem Lagerraum … ein Mensch in einem Karton. Was für eine bizarre Geschichte. Wer ist das, der dort in der Schachtel liegt?‘
Er kleidete sich in T-Shirt und Sporthose, ging in die Küche und setzte sich an den Abendbrottisch. Die weiß-rote Plastikdecke, die Laura wie jeden Abend darübergelegt hatte, begrüßte ihn mit ihrem vertrauten Muster. Seine Kinder küssten ihm die Wange und präsentierten ihm Schulhefte. In seiner Grübelei nahm er sie kaum wahr. Er brütete.
Gerichtsmedizin, Spurenermittlung und die Kollegen vom Morddezernat arbeiteten an dem Fall in Herculaneum und er würde sich am nächsten Morgen mit ihnen beraten, aber am Ende würde man ihn ansehen und Anweisungen erwarten. Was sollte er sagen?
Das Übliche?
Er rieb sich übers Gesicht und sah zu seiner Frau. „Wie ist jemand vor dreihundert Jahren darauf gekommen, sich vom Boden eines Brunnens in nassen Lavastein zu hacken, um Schätze zu suchen? Mich hätten keine zehn Pferde dazu gebracht, mich in zwanzig Metern Tiefe durch den Tuff zu wühlen. Er ist kalt, nass und hochgradig ungesund.“
Camarata hatte am späten Nachmittag die Mutter Perrones besucht, um ihr die Nachricht vom Ableben ihres Sohnes zu überbringen. Die Reaktionslosigkeit der kleinen, rothaarigen Frau hatte ihn fast genauso geschockt wie der übel zugerichtete Leichnam. Ihre Kälte saß ihm noch immer in den Knochen. Er hatte Tränen und Schreie der Verzweiflung erwartet, aber sie hatte emotionslos in ihrer hässlichen gekachelten Erdgeschosswohnung gesessen und nach Kleinigkeiten gefragt. Nach Papieren, die sie ausfüllen solle und dem Portemonnaie ihres Sohnes.
„Die Mutter des Mordopfers wollte nicht einmal wissen, warum man ihren Sohn gerade in Herculaneum gefunden hat. Man findet einen Biochemiker in einer Grubenwand und seine Mutter nickt nur.“
Laura schüttelte den Kopf und seufzte, während sie aß und ihren drei Kindern half. Alessandra, die Kleinste, spuckte auf den Tisch. Livio und Matteo schlangen, als hätten sie seit Tagen gehungert. Camarata fühlte sich bemüßigt, als Vater auch etwas zu tun. Er klopfte seinem Ältesten auf den Rücken. „Wie oft muss ich dich ermahnen, dich gerade hinzusetzen?“ Dann wanderten seine Gedanken erneut ab.
Wie sich herausgestellt hatte, hatte Perrone allein gewohnt. Seine zwei Brüder hatten kaum Kontakt zu ihm gehabt, seine Mutter anscheinend noch weniger. Es schien sie auch nicht zu kümmern. Perrone lebte für seinen Beruf, aber zumindest dort hatte man von ihm als von einem Wunderkind geredet.
Er sei ‚ein Genie‘ gewesen, hatte sein Vorgesetzter am Telefon gesagt, aber habe immer ‚mehr gewollt als andere‘. ‚Zu viel gewollt.‘ ‚Mehr Glück, als dem Menschen zukommt.‘
Camarata seufzte. „Was will man, wenn man mehr will, als einem zukommt, aber das magere Gehalt eines Biochemikers im Staatsdienst akzeptiert?“
Er griff eine Gabel und begann, sich die Tagliatelle in den Mund zu schaufeln, die seine Frau vor ihn hingestellt hatte. Sie standen dort schon zehn Minuten. In seiner Achtlosigkeit rutschte ihm die Gabel aus der Hand. Er fluchte. Laura runzelte die Stirn.
„Ich bin ein Trampeltier.“ Er warf ihr einen entschuldigenden Blick zu. „Es tut mir leid. Ich war in Gedanken …“ Sie lächelte. „Du bist in letzter Zeit oft in Gedanken. Du arbeitest zu viel. Hast du nicht gewechselt? Jetzt hast du schon wieder einen Mord am Hals.“
„Hm.“ Camarata seufzte erneut. Seine Frau hatte recht und wenn er sich nicht helfen ließ und delegierte, würde er erneut einen Monat voll schlafloser Nächte vor sich haben. Allein würde seine kleine Brigade nicht hinter das Geschehen in Herculaneum kommen. Ein Name drängte sich ihm auf.
Professor Andrea Adalgiso Cariello.
Er hatte den prominenten Forscher mit den altertümlichen Rufnamen vor ein paar Jahren kennengelernt. Cariello war weit entfernt vom Bild eines Indiana Jones, das er sich von Archäologen machte. Ein gebildeter Mann, hochgewachsen, stattlich, aber auch verschlossen. Eher ein analytisch kühler Sherlock Holmes als ein Jäger des verlorenen Schatzes. Ein Sherlock Holmes mit einer dramatischen Familiengeschichte, die ihn befremdete und durch die er nicht durchblickte.
Cariellos Frau hatte sich das Leben genommen und sein Bruder war in der gleichen Nacht, in der sie gestorben war, verschwunden. Der Professor hatte aus seiner Wut keinen Hehl gemacht, als die Carabinieri die Ermittlungen einstellen mussten. Trotzdem hatte er Camarata beeindruckt. Cariello war eine Koryphäe was die Ausgrabungen am Vesuv betraf und ein Mann voller Charisma, auch wenn er zuweilen ein so kühles Benehmen hatte, dass er ihn einschüchterte. Er sollte ihn fragen.
Camarata zuckte zusammen. Laura hatte ihre Hand auf die seine gelegt. Sie blickte ihn besorgt an. „Iss, Francesco. Du siehst aus, als ob dich der Fluch von Herculaneum verfolgt."
Er lachte brummig. „Was denn? Es gibt einen Fluch in diesen verdammten Ruinen?"
„Eine alberne Legende."
Er schüttelte den Kopf und schenkte ihr und sich selbst Rotwein ein. Die Flüssigkeit erinnerte ihn unangenehm an das Blut auf dem Boden des Tunnels, durch den er am Morgen gekrochen war. Er trank den Wein trotzdem, aber stürzte das Glas schneller herunter, als es der guten Sitte entsprochen hätte.
Professor Cariello
Es roch nach Holzkohlefeuer und gemähtem Gras. Vom Meer klang das Hupen der Fähren herüber. Camarata grüßte das erste Licht, das durch die Vorhänge schien, als Retter. Noch war alles still, aber er lag bereits seit fünf Uhr wach und dachte über den Toten in Herculaneum nach. Sein Kopf war ein Chaos.
Tunnel, Skelette und geballte Fäuste tanzten vor seinem inneren Auge einen verstörenden Totentanz. Und in all das mischte sich wieder und wieder das Bild der Karte, die bei Perrone gelegen hatte. ‚Ein Skelett, das jemand versteckt hat, bringt einen Biochemiker dazu mit einer gestohlenen Karte in einen Tunnel zu kriechen. Warum? Was ist das für ein Tunnel?‘
Die ersten Sonnenstrahlen überquerten das Dach der verfallenden Kirche, die vor seinem Fenster stand. Tauben gurrten. Er setzte sich auf.
„Es ist Sonntag ...!", murmelte Laura verschlafen.
Camarata küsste ihr zerrauftes Haar und schwang die Beine aus dem Bett. Sein anheimelndes Familienleben vertrug sich nicht mit seinen wüsten Träumen. „Ich muss wissen, was dieser Perrone in dem Tunnel wollte. Das lässt mir keine Ruhe.“
Als er wenig später in Uniform ins Freie trat, war die Luft noch angenehm kühl und der Geruch nach Espresso und Gebackenem lag über der Gasse. Irgendwo hämmerte jemand auf Metall und ein Angestellter der Stadt bearbeitete den Rasen im kleinen Park nahebei. Ansonsten war es ruhig. Eine junge Frau kam auf ihn zu. Sie hatte einen Motoradhelm im Arm und hielt ein Telefon ausgestreckt vor sich. „Kolonel, Il Mattino – Napoli. Haben Sie schon ein Bauchgefühl, wer den Mann in Herculaneum umgebracht hat?“
Camarata sah sie mit großen Augen an und schüttelte den Kopf. Die junge Frau hatte sage und schreibe seine Tür überwacht. „Wenn Sie sich auch mal um die Finanzierung meiner Behörde so viel Gedanken machen würden wie um mein Bauchgefühl, Signorina. Ich brauche eine funktionierende Klimaanlage, neue Computer und Regale. Schreiben Sie das in Ihrem Artikel.“
Er stieg in sein Fahrzeug und ließ den Motor knatternd an. Die junge Journalistin schoss ein Foto. Es würde sicher in der Tagesausgabe erscheinen. Ohne die Sache mit den neuen Computern natürlich. ‚Ein verschlafener Carabiniere mit Tränensäcken unter den Augen. Wie ich das liebe.‘
Camarata machte, dass er davonkam. Er war sich bewusst, dass er nicht sehr freundlich gewesen war. Er war nie besonders freundlich, wenn er es recht bedachte.
Die Alleen waren noch leer und er erreichte Neapels Vorort Marechiare schon kurz vor acht. Die sonnenüberflutete Gasse, deren Namen er sich notiert hatte, führte von der Höhe der Straße nach Posillipo hinunter zum Meer.
Marechiare beruhigte seinen Grimm. Unterhalb der hässlichen Palazzi, die die Aussichtsstraße über die Höhen am azurblauen Golf säumten, versteckte sich eine Ansammlung rot oder weiß getünchter Häuser. Sie lagen am Hang über dem Lapislazuli des Ozeans, eins neben dem anderen, wie Perlen an steilen Gassen. Einige waren Ruinen, andere prächtige Villen umgeben von Palmen. Für ihn war Marechiare der Inbegriff von Neapel. Uralt, halb griechisch, halb italienisch, voller Leben und Glut.
Er hielt inne und atmete den Geruch ein, der vom Meer heraufwehte. Eine Mischung von Algen, Fisch und Schiffsöl. ‚Ich bin Neapolitaner, ich sterbe, wenn ich nicht singe‘, stand an einer der Mauern der Innenstadt geschrieben. Die Fremdenführer zeigten darauf und summten die Melodie vom berühmten ‚Marechiare‘. Dem Marechiare, in dem der Mond aufging und in dem noch die Fische verliebt waren.
Er ließ seinen Wagen auf dem Gehweg stehen, legte sein Carabiniere-Zeichen unter die Scheibe und schritt die Gasse hinunter. Als Kind hatte er bei den Felsen am Strand gebadet und Kraken gefischt. Ein spindeldürrer, braungebrannter Bengel mit schwarzen Füßen und dichten Locken. Seitdem waren seine Haare lichter geworden, die Freunde in alle Welt versprengt und seine Großmutter, die nahebei gewohnt hatte, gestorben.
‚Spindeldürr bin ich auch nicht mehr‘, fügte er in Gedanken hinzu und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er hatte vor kurzem die 100-Kilo Marke erreicht und wusste, dass er abnehmen musste. Sein Schwager Domenico, der Arzt war, hatte ihm eine Diät verordnet. Sein Atem ging schwer trotz des abfallenden Weges. Er sah über die Dächer der Villen. Der Vesuv thronte mächtig und kahl dahinter auf der anderen Seite des Golfs.
Im Gehen las er die Nummern der Häuser über den Toren, bis er die zehn fand. Das von ausladenden Pinien gerahmte Gebäude war ihm unbekannt und er sah mit gehobenen Brauen daran empor. Vor drei Jahren hatte Cariello in einem anderen Stadtteil gewohnt. Nicht bescheiden, aber durchaus nicht so verschwenderisch. Das massive grüne Tor in der Mauer aus hellen Steinen war mit Eisenzacken bewehrt, wie die Pforte einer Festung. Er fühlte sich klein, vor diesem Palast. ‚Manche Leute kommen aus armen Familien, wie ich, und manche eben aus reichen.‘ Seine Großmutter hatte dazu nur gemeint: Ein armer Idiot ist ein Idiot, ein reicher Idiot ist ein Reicher.
Er musste über die Erinnerung schmunzeln. Er läutete, aber zuckte zurück. ‚Verdammt, wer bringt eine metallene Klingel mitten in der Sonne an.‘ Sie war glühend heiß. In der Stille rührte sich nichts. Er läutete erneut, diesmal mit einem Taschentuch über den Fingern, und wartete, bis sich Schritte näherten und ein Riegel zurückgeschoben wurde.
Eine weißhaarige Frau mit faltigem Gesicht schaute durch den Spalt, die Stimme schnarrend von Abweisung. „Sie möchten?“
„Ich will den Professor sprechen.“
„Erwartet er Sie?“
„Er kennt mich. Camarata. Carabinieri.“
Die Frau trat zurück. Seine breite Gestalt und sein Alter überzeugten sie mehr als die Uniform, die sie ignorierte. „Der Professor ist gerade erst aufgestanden. Er ist vorn.“
Camarata sah sich um und war nahe daran, wieder umzukehren, so sehr schüchterte ihn die Umgebung ein. Die renovierte Villa stammte aus dem 18. Jahrhundert. Der Garten dahinter war ein wahrer Park mit Palmen und Bougainvillea. Es roch nach Buchsbaum und Rosen. Die Alte kommentierte seine gerunzelte Stirn nicht und brachte ihn zu einer weitläufigen Terrasse.
Auf ihrer Schwelle blieb er stehen. „Alle Achtung. Von hier oben kann man schaun, ob die Erde rund ist.“ Der Golf von Neapel erstreckte sich schier grenzenlos vor seinen Augen, azurblau und am Horizont von goldenem Schimmer verklärt. Links lag die mächtige Silhouette des Vesuvs im Dunst, rechts die Geisterstadt von Rione Terra. Ein Frangipani-Baum wucherte über die Brüstung, halb eingelassen in den marmornen Boden. Ein Meer von duftenden weißen Blüten.
„Gefällt Ihnen die Aussicht, Kolonel?“
Camarata drehte sich um. Er hätte Cariello nicht wiedererkannt. Der Professor saß in helle Leinenhosen und einen roten Morgenmantel gekleidet an der Balustrade, die Beine übereinandergeschlagen und einen Cappuccino in der Hand. Seine Füße waren nackt. Die schwarzen Haare glänzten in der Sonne und er wirkte mit dem markanten Gesicht und den geschwungenen Brauen wie ein spanischer Grande.
Camarata wusste, dass Cariello aus einer Diplomatenfamilie stammte. Sein früh verstorbener Vater war Botschafter in den Vereinigten Staaten gewesen und seine Mutter kam aus sizilianischem Adel. Aber mit seinem Reichtum hatte er trotzdem nicht gerechnet. „Schön haben Sie es hier, Professor. Haben Sie im Lotto gewonnen?“
Cariellos Blick wanderte ungeniert über seinen Bauch. „Kaffee?“
Camarata ließ sich ächzend auf einen der Korbsessel fallen. Er fühlte sich beklommen angesichts Cariellos erhabener Gelassenheit.
So wie er bemerkt hatte, dass Cariello ein schöneres Haus besaß, hatte Cariello bemerkt, dass er zugenommen hatte.
Cariello reichte ihm einen Espresso, den seine Haushälterin brachte, und wartete, die Brauen gehoben, die Augen dunkel.
‚Natürlich hofft er auf Neuigkeiten über seinen Bruder.‘ Camarata fühlte sich schuldig, nicht dienlich sein zu können. Er kam als Parasit, nicht als Überbringer guter Neuigkeiten. Vor drei Jahren, als er Cariello kennengelernt hatte, hatte dieser seine junge Frau verloren. Ihm war selten ein Mann begegnet, der so am Boden zerstört gewesen war wie er. Es erleichterte ihn zu sehen, dass es Cariello besser ging. Soweit er wusste, war er jedoch noch immer nicht an die Universität zurückgekehrt. Die Rektorin hatte ihn angerufen. Es schien, der charismatische Professor wurde vermisst.
„Ich weiß leider nichts Neues zu berichten“, knurrte er behäbig. „Ich komme nur als Bittsteller und aufgrund meiner profunden Ignoranz …“
Cariellos Schultern senkten sich. Er rührte in seinem Kaffee. „Sie kommen wegen des Mannes in Herculaneum.“ Die Sonne zeichnete Spiele von Licht und Schatten auf seine scharfgeschnittenen Züge. Er überschlug die langen Beine erneut in der für ihn charakteristischen Art und Weise.
Camarata nickte. „Der Tote, den wir gestern im Tunnel gefunden haben, ist nicht einfach irgendjemand. Es handelt sich um einen bekannten Wissenschaftler. Er hat hier in Neapel im Labor Ihrer Universität gearbeitet. Man hat uns gesagt, er sei ein Genie gewesen. Gianni Perrone. Kennen Sie ihn?“
Cariello hob die Brauen. „Flüchtig. Er ist in der Tat bekannt. Er ist es, den man umgebracht hat? Perrone? Die Presse hat das nicht erwähnt. Was wollte er in dem Tunnel?“ Seine Baritonstimme war warm und angenehm.
„Das versuchen wir herauszufinden. Was wissen Sie über ihn?“
Cariello zuckte die Schultern. „Perrone ist ein Biochemiker, aber ist mir wegen seines historischen Wissens bekannt. Er wusste sprichwörtlich alles. Manchmal kam er bei mir im Büro vorbei, um meine Schriften zu kommentieren. Anmerkungen, Kritik, Anregungen. Er hatte immer recht.“ Cariello lächelte. „Er entnervte mich mit seiner Besserwisserei, aber er war brillant. Haben Sie ihn gesehen?“
„Nur tot.“
„Hm.“ Cariello trank seinen Kaffee aus und setzte die Tasse ab. „Perrone war groß, füllig und hatte ein durchschnittliches Gesicht, aber wenn er begeistert war, blühte er auf.
Dann redete er über antike Politik und historische Weltanschauungen. Wir waren nicht befreundet und nicht einmal Kollegen, aber ich habe zuweilen mit ihm diskutiert. - Wieso hat man einen so brillanten Menschen in Herculaneum erschlagen?“
Camarata seufzte. „Das wollte ich von Ihnen wissen, Professor. Sie kennen die Ruinen. Man hat mir gesagt, Sie hätten lange in den alten Grabungstunneln gearbeitet und wären eine Koryphäe …“