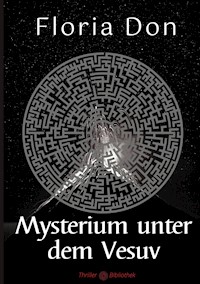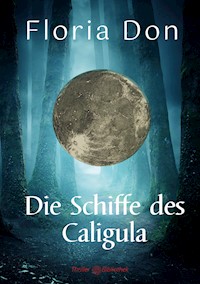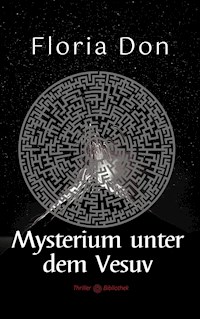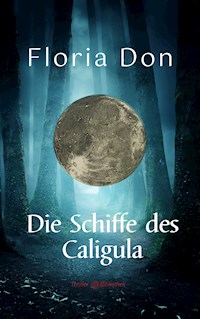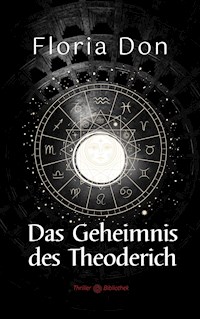3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einem uralten Palast am Canale Grande in Venedig wird ein Toter gefunden, während aus dem Dom von San Marco dessen wertvollster Besitz gestohlen wird. Die Carabinieri rätseln. Was haben die beiden Ereignisse miteinander zu tun? Schon bald zeigt sich - die Wahrheit ist ein wertvolles Gut, das sich leicht entstellen lässt. Ein ungewöhnlich fesselnder Thriller um einen Toten, dessen Identität Rätsel aufgibt und um eine Stadt, die in den Fluten versinkt. Das zauberhaft schöne Venedig setzt eine stimmungsvolle Szene für eine Geschichte voller Geheimnisse. Das gleißende Sonnenlicht des Canale Grande und die mysteriösen Nebelschleier auf der nächtlichen Lagune geben dieser atemberaubenden Erzählung für Fans von historischen Fakten und von Venedig ihren Rahmen. "Faszinierende Venedig-Atmosphäre und spannende Geschichte!" "Spannend! Wem Venedig gefällt oder wen es interessiert, sollte diesen Krimi unbedingt lesen." "Tolle Sprache und exzellente Recherche."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Um Mitternacht
Eine bizarre Bekanntschaft
Eine schreckliche Entdeckung
Beängstigende Neuigkeiten
Damoklesschwert
Der Tote im Palazzo Dario
Der Fluch des Ca‘ Dario
Auf der Wache
Unverhofftes Wiedersehen
Die Kontakte des Kolonels
Ein seltsamer Gast
Ein nächtlicher Zwischenfall
Eine verblüffende Enthüllung
Ein seltsamer Presseartikel
Gefahr droht
Eile ist geboten
In den Fängen der Politik
Ein alarmierender Hinweis
Beunruhigende Bilder
Verwirrende Spuren
Eine traurige Nachricht
Camarata schlägt über die Stränge
Ein bizarres Indiz
Der alexandrinische Thron
Ein Leichnam verschwindet
Wer ist der Mörder?
Ein einsamer Heimweg
Das Rätsel um den Thron
Eine bizarre Theorie
Das Versteck von Kadir Uysal
Alexander der Große
Entsetzen im Dom
Das Rätsel der Mumie
Wohin floh Kadir Uysal?
Ein Angriff in der Nacht
Im Hotel
Eine Entführung nach Mitternacht
Ein Anruf
Markus versus Alexander
Alarm
Auf dem Weg zum Dogenpalast
Nachtwache
Hindernisse auf dem Weg
Einbruch im Dogenpalast
Die Carabinieri grübeln
Eine Verfolgungsjagd beginnt
Hilfe naht
Auf der Suche
Auf der Schwelle des Todes
Sonnenaufgang
Epilog
Impressum
Möge der Herr Dich wiegen wie die Wellen des Meeres.
Italienische Redewendung
Um Mitternacht
Die breite marmorne Treppe war nur spärlich von altmodischen Lampen erleuchtet, zwei der Glühbirnen in dem spinnwebbehangenen Lüster, der sie beleuchtete, waren zersprungen. Ihr metallener Handlauf lag in seiner Hand wie ein verendetes Tier. Als er darüberstrich, blieb Staub auf seinen Fingern zurück. Der Eindruck der Verlassenheit, den das Gebäude ausatmete, wurde durch die von Algen grün gefärbten Marmorstufen unter seinen Füßen verstärkt. In dem Gemäuer lebte niemand mehr. Es war einst prächtig und erhaben gewesen, aber jetzt war es dem Verfall und dem von seinen Fundamenten aufsteigenden Meer anheimgefallen.
Beklemmung kroch ihm unter die Haut. Die Atmosphäre von vergangenem Glanz erdrückte ihn. Hätte er weniger Champagner getrunken, wäre er seinem Führer nicht durch das verzogene Bronzetor gefolgt. Der Palast galt als verflucht.
Er musterte seinen breiten Rücken und den ausladenden schwarzen Mantel vor sich. „Warum müssen wir unbedingt hierher gehen?“
„Ich wohne hier.“
„Hier? Niemand wohnt hier.“
„Jetzt schon.“
Es roch nach Moder und Nässe und ihre Stimmen hallten von den Wänden wider. Weder Vorhänge noch Möbel dämpften das Echo. ‚Egal‘, ermutigte er sich. ‚Wenn ich nur zum Ziel komme.‘
Der stattliche Mann vor ihm stieß eine mächtige geschnitzte Eichentür auf, die in den Ballsaal in der ersten Etage führte. Durch die hohen gotischen Fenster, die ihn begrenzten, drangen die Lichter der Nacht herein. Vom Kanal glänzte tröstend die goldene Fassade eines Renaissance-Palazzos herüber. Der Hausherr betätigte den Lichtschalter und einige wenige der Glühbirnen der Murano-Leuchter glimmten auf. „Treten Sie ein, der Herr. Dies ist mein Reich.“
Langsam folgte er der Einladung, erregt, mit hämmerndem Puls. Das Parkett knarrte unter seinen Schuhen. Der Schlag kam von hinten und lähmte ihn sofort. Das Letzte, was er dachte, war, dass er recht gehabt hatte, argwöhnisch zu sein.
Eine bizarre Bekanntschaft
Die Nacht funkelte und schimmerte. Der Übermut des Karnevals hatte Venedig gefangen genommen. Spitzen und Rüschen füllten die Gassen und Walzer schwenkten wie satter roter Wein durch das Blut der Menschen, die aus aller Herren Länder in die heiterste und filigranste aller Städte gekommen waren, um vom Saft des Lebens zu trinken. Die engen Brücken über die Kanäle waren überfüllt von einer jubilierenden Menge, die mit ihren Dreispitzen, Degen und weit ausgreifenden Röcken die Wege versperrte. - Und über allem lag der Duft des Vergänglichen. Ein Bühnenspiel der überbordenden Pracht ohne Morgen.
Ein groß gewachsener, schlanker Mann mit rabenschwarzen Haaren stand am Fenstersims eines der hell erleuchteten Palazzi am Canale Grande, die dunklen Augen fiebrig vom Widerschein der Festlichkeiten. Er sah auf den Trubel und das schlammfarbene Wasser, versunken in Gedanken. Sein blassgrüner Samtrock mit den Goldbordüren am Revers glitzerte in seltsamem Kontrast zu seiner steinernen Miene. Der Abend war bereits weit fortgeschritten, aber noch war der Ball in vollem Gang. Es roch nach Parfüm, dem Bienenwachs der Kerzen auf den Tischen und Champagner. Man tanzte im Drei-Viertel-Takt.
Cariello fühlte sich wie in einer surrealen Szene, als wäre er eine reich dekorierte Marionette und Teil eines bizarren Traums. Das Gemäuer, in dem er sich befand, hatte einst einer Dogenfamilie gehört, Eroberern und Händlern, die die Geschichte des Mittelmeers geprägt hatten. Sein historischer Stuck verbarg sich jedoch unter dem modernen Design teuer verkleideter Korridore, dem Geruch von Edelparfums und Sandelholz. Das Gebäude hatte Millionen verschlungen, als man es restauriert hatte. Teppiche, Brokat und Leder spülten nun Geld in die Taschen anonymer Holdings in Hongkong und namenloser Gesellschaften in Luxemburg. Jede der Türen und jedes Fenster war mit gläsernen Hochwasserbarrieren verkleidet, die wirkten, als seien sie in Murano von Hand gefertigt worden. Die Sorge vor dem Wasser gab es hier genauso wie überall in Venedig, aber man versteckte sie unter Glanz und Dekoration. Das Glucksen des Meeres wurde übertönt vom Stampfen der Füße und dem Jauchzen der Feiernden.
Cariello wippte auf den Zehenspitzen, die Arme vor der Brust überschlagen. Der feuchte Nebel, der über der Stadt lag, war noch dichter geworden. Er zog in die Gassen zwischen den Häuserschluchten, nur durchdrungen vom Funkeln der Masken. Die Medien kündigten an, dass der Wind in den nächsten Stunden das Wasser der Adria an die Küste und in die Lagune drücken würde. Im Saal bemerkte man nichts von den Unheilsprognosen. Es war, als gäbe es sie nicht.
Die Geigen des Orchesters schluchzten immer wilder im Takt und tanzende Masken wogten durch den weitläufigen Raum mit seiner vergoldeten Kastendecke. Der Rosenduft der Frauen drang selbst am Fenster zu ihm. In diesem Palast gab es keine Sorgen. Man war reich, jung und die Probleme der Welt weit entfernt, während der Scirocco die Wolken über dem Meer immer tiefer sinken ließ.
Cariello presste die Lippen aufeinander. Er sah sich selbst zu, wie er am Fenster stand und auf den Trubel schaute. Er war seit mehreren Stunden auf dem Ball. Barock-Schuhe mit silbernen Schnallen und hohen Absätzen kleideten ihn. Sie und das historische Eichenparkett unter seinen Sohlen erzeugten in ihm ein Gefühl, als sei der Abend eine Fälschung.
Er strich sich über die schmerzenden Brauen unter der steifen Kante seiner goldverbrämten Gesichtsbedeckung. ‚Wie bin ich hierher geraten? Auf einen Maskenball, der eine Mischung ist aus einer Reise in die Vergangenheit und einem Touristenspektakel. Als ob diese Stadt kein reales Leben mehr hätte. Als ob sie nur eine Fassade wäre, hinter der sich die auf sie zukommenden Kümmernisse verbergen.‘
Am Vortag hatte ihn die überraschende Einladung zum Ball erfreut. Jetzt sorgte es ihn, aufgemacht wie ein Zirkuspferd gesehen zu werden. Er war Professor an einer der angesehensten Universitäten Italiens und das akademische Umfeld vergab keine Eskapaden.
Er stellte sich in den Schatten der mächtigen Vorhänge, zog seine ausgeliehene Maske vom Gesicht und rieb sich die Stirn. Sein Leben war in letzter Zeit nicht einfach gewesen. Seine Familie lag in Scherben, in seinem Liebesleben versagte er kläglich und Freundschaften unterhielt er nicht mehr. Er quälte sich durch Albtraum geplagte Nächte, in denen er sich regelmäßig gegen drei Uhr morgens erhob, um dem Herumwälzen in Schweiß-getränkten Laken ein Ende zu machen. Im Schlaf sah er die Szenen vor sich, die ihm seit nunmehr fünf Jahren immer wieder erschienen. Seine junge Frau tot auf den Klippen am Meer, seine Mutter gefangen vom Wahnsinn und sein Bruder unauffindbar verschwunden. Es kam ihm vor, als würde die Zeit seine Qual nur schlimmer machen, statt sie zu lindern.
Der Lehrdienst an der Universität half ihm nicht über diese Stunden hinweg. Seine Kollegen scherten seine Probleme nicht. Man hatte ihm mit feierlichen Worten kondoliert und war zur Tagesordnung übergegangen. Mehr noch, es gab einige unter ihnen, die ihm in den Rücken fielen oder sich über ihn mokierten.
Cariello seufzte. Ihm wurde der Alltag in seiner Heimatstadt Neapel zunehmend eine Last. Er fühlte sich wie ein Angehöriger einer verlorenen Generation von Kriegsrückkehrern, die nach aufwühlenden Erlebnissen in die fade Bürgerlichkeit heimkehrt. ‚Und nun bin ich in Venedig. Als wäre ich in einer anderen Welt gestrandet und als ob mein Gestern nicht mehr existieren würde und vom Gestern einer ganzen Stadt ersetzt würde.‘
Der bedeutendste Maskenball des venezianischen Karnevals fand im Hotel Monaco & Grand Canal statt. Um Punkt sieben hatten ihn weiß gekleidete Debütanten eröffnet. Cariellos Kollege San Bernardo, der ihn eingeladen hatte, hatte ihm zu verstehen gegeben, dass mehr Asiaten und Amerikaner dabei sein würden als Einheimische. Er hatte recht behalten. San Bernardo war erleichtert gewesen, die Ausländer wiederzusehen, nachdem die vergangenen Jahre für Venedig Hungerjahre gewesen waren, geprägt von einer unerwartet ernsthaften Überschwemmung und einer unmittelbar darauffolgenden Pandemie. Cariello war weniger glücklich über die Menge der Fremden. Er fühlte sich selbst wie ein Ausländer an diesem Ort, der nicht mehr in Italien zu liegen schien. Von Venedig blieben nur prächtige Fassaden, in denen das echte Leben versiegte und hinter deren melancholischen Mauern sich die Trauergäste betranken.
Er legte die Hände auf das Sims des Fensters, an dem er lehnte, auf der Suche nach etwas Realem in dem anhaltenden Trubel. Der mächtige Bau mit den hohen Arkaden schillerte in den Lichtern, die bis auf die überfüllte Straße hinausleuchteten. Menschenmengen drängten sich davor in der engen Gasse. Auf der Kanalseite fuhren Gondeln vor und spien immer weiter Gäste in die brodelnde Menge. Er sah ihnen zu, von den samtroten Vorhängen verborgen, in Gedanken und angewidert von dem chaotischen Gedränge.
Als man ihn unverhofft ansprach, zuckte er zusammen.
„Professor? Kann ich Sie stören?“ Ein in Weiß als Casanova gekleideter Mann war neben ihn getreten.
Cariello wandte sich zu ihm. Der Maskierte war schlank, muskulös und jung, geschmückt von einer auffallenden goldenen Maske, bei der es sich um ein authentisches Stück zu handeln schien. Die gepuderte Rosshaarperücke stand im Kontrast zu seiner sonnengebräunten Haut und den wachen schwarzen Augen. Seine Sprache klang gepflegt. „Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Domenico Mocenigo.“
Cariello runzelte die Stirn.
Sein Gegenüber lächelte entschuldigend und deutete eine Verbeugung an. „Ich stamme in der Tat aus der Mocenigo-Familie, die der Stadt sieben Dogen gestellt hat. Neben Ihrem Kollegen Professor San Bernardo bin ich einer der wenigen Venezianer hier … Er hat mir gesagt, dass ich Sie hier finde.“
Cariello wunderte sich. Die Mocenigo waren über Jahrhunderte eine der einflussreichsten Familien Venedigs gewesen und eine der reichsten. Sein Blick fiel auf den eigentümlich geschnittenen, goldenen Ring am Finger des Mannes. Es war kein gewöhnliches Juwel, genau wie die Maske des Casanova nicht aus einem Kostümverleih stammte. Er hätte nicht erwartet, hier auf dem Ball, zwischen Besuchern aus aller Herren Länder, einen Mocenigo zu treffen. Es war, als träfe er einen Tizian oder einen Tintoretto in einer Horde fotografierender Touristen.
Ein Kellner trat näher und bot ihnen Champagner an. Cariello wollte ablehnen.
„Bitte, Professor. Es ist nur einmal im Jahr Karneval.“ Mocenigo reichte ihm ein Glas. „Sie fragen sich vielleicht, warum ich Sie störe. Ich wollte Sie als den anerkanntesten Archäologen Italiens konsultieren. Wir sind Kollegen, auch wenn ich in keiner Weise mit Ihrem Ruf und Ihrer Erfahrung konkurrieren kann. Ich arbeite für die UN, indem ich Kunstwerke verifiziere. Ich wollte Ihre Meinung zu einer Angelegenheit wissen … Wenn ich darf?“ Die Augen Mocenigos huschten hinter seine Schulter und er trat näher, um ein Gespräch unter vier Augen bemüht.
Eine Polka begann, durch den Saal zu toben, begleitet von Posaunen. Der Lärm überdeckte seine Stimme. Cariello griff den jungen Mann kurzentschlossen am Arm und zog ihn mit sich ins Freie auf die Terrasse zum Kanal. Nachdem er die Tür geschlossen hatte, wurde es ruhiger. Nur von der Gasse klangen noch das Lachen und Rufen der verspäteten Ballgäste herauf. „Erzählen Sie, was kann ich für Sie tun?“
Mocenigo sah sich erneut um, neigte sich zu Cariello und sprach gedämpft: „Mein Anliegen mag Sie erstaunen, Professor … Vielleicht beginne ich unter dem Siegel der absoluten Diskretion mit der Mitteilung, dass der türkische Staat von Italien die Rückgabe der Pferde der Quadriga von San Marco verlangt und man mich in den Fall involvieren will.“
Cariello runzelte die Stirn. „Sie sprechen von den Pferdestatuen des Markus-Doms? Im Ernst? Die Türkei verlangt ihre Herausgabe? Warum ist nichts davon in der Presse zu lesen?“ Er fühlte trotz der eisigen Kälte Adrenalin durch seine Adern schießen. Die Pferde gehörten zu den wichtigsten Kunstwerken der Welt. Ihr Verlust wäre ein herber Schlag für Venedig.
Mocenigo zog die Schultern empor und senkte seine Stimme noch mehr. „Ich vertraue auf Ihr Schweigen, Professor. Das Ganze ist noch nicht offiziell, aber ich dachte mir schon, dass es Sie interessieren würde.“
„Sicher tut es das!“ Die kalte Nachtluft, die mit ihrem Geruch nach Algen und Salz von den grün-braunen Wassern des Kanals herüberwehte, jagte Cariello eine Gänsehaut über den Rücken. Das Orchester beendete die Polka und begann den Radetzkymarsch zu spielen. Die rasende Musik und die Worte Mocenigos taten das ihre, um ihn aus seinem Champagnernebel zu rütteln. Er bemerkte, wie sich seine Nackenmuskeln anspannten. „Die Pferde des Markusdoms befinden sich seit Jahrhunderten hier. Warum fordern die Türken sie zurück. Ist das ein politischer Schachzug?“
Mocenigo zuckte die Schultern. „Die Pferde standen früher im Hippodrom von Konstantinopel. Sie wurden 1204 bei der Plünderung der christlichen Stadt durch die Kreuzfahrer gestohlen. Die Türken haben ihre Rückgabe an Konstantinopel, das heutige Istanbul, verlangt. Wenn man möchte, kann man das durchaus rechtfertigen.“ Seine Haltung wirkte im Freien auf der Terrasse steifer und Cariello bemerkte, dass Mocenigo bebte. Seine Hände spielten nervös mit den Kordeln seines Kostüms.
Es schien Cariello bizarr, dass ein Nachkomme der raubenden Dogen von einst darin involviert sein sollte, die berühmten Pferdestatuen an die Türken herauszugeben - an die Türken, die das byzantinische Konstantinopel ebenfalls nur im Krieg erobert hatten und das mehr als zwei Jahrhunderte später als die Venezianer. Er fragte sich, wessen Seite Mocenigo vertrat und warum er gerade ihn zu Rat zog. Er war Archäologe und Auswärtiger.
Mocenigo lächelte verlegen, halb verhüllt von seiner Maske. „Seien wir ehrlich - ich glaube nicht an den Erfolg der Rückgabeanfrage. Sie sicher auch nicht, Professor. Die Pferde sind zu bekannt. Aber ich habe mich leider verpflichtet, mit einer wissenschaftlichen Studie auszuhelfen.“
„Sie haben sich bereits verpflichtet? Mit einer Studie?“ Cariello wusste nicht, was er entgegnen sollte.
Mocenigo befeuchtete seine Lippen mit Champagner. „Ich weiß, was Sie denken mögen. Meine Familie teilt Ihr tadelndes Schweigen … Ich besitze seit heute Morgen die elektronische Zugangskarte für die Sicherheitspforte des Markusdoms, um die Pferde zu begutachten, aber meine Mutter würde es gern sehen, wenn ich sie nicht benutzen würde.“ Mocenigo klopfte sich auf seine Brusttasche und Cariello wunderte sich, dass er eine Zugangskarte zum Dom in seinem Karnevalskostüm bei sich trug.
Mocenigo leerte sein Glas mit einem zu großen und zu hastigen Zug. Seine Lippen zuckten zu einem ironischen Lächeln. „Der Markusdom ist ein Juwel. Ich weiß. In dieser Stadt ist jedes Haus von historischem Wert, unantastbar und zudem bis unters Dach voll mit Feuchtigkeit und Schimmel. Jeder will Venedig retten, aber keiner tut es.“ Er lachte mit einem bitteren Unterton. „Niemand rettet Venedig. Venedig war einmal. Warum soll ich da um die Pferde des Markus-Doms weinen, oder? Sie sind, wie meine Familie und diese ganze Stadt, Vergangenheit. Längst obsolet. Eine Staffage, die kaum noch aufrechtsteht. Man kommt, man geht, man feilscht um das, was übrigbleibt.“
Cariello schob die Unterlippe vor. Ihm war nicht klar, was der verbitterte Dogenspross von ihm erwartete. ‚Will er, dass ich ihn ermutige, ihn tröste oder ihn von seinem Tun abhalte?‘ Mocenigo schien dem Champagner zu reichlich zugesprochen zu haben. Er sprach undeutlich und reagierte fahrig.
Cariello antwortete ihm mit kühler Distanz. „Ich glaube nicht, dass die Pferde des Markusdoms bereits obsolet sind, mein Herr.“
Mocenigo zuckte zusammen. Seine Augen huschten zur Seite, dann zog er den Kopf ein und trat noch näher. Er griff Cariello so heftig am Arm, dass es schmerzte. In der Dunkelheit des fortgeschrittenen Abends bemerkte Cariello seinen Geruch nach Moschusparfum und Alkohol. Mocenigos schwarze Augen sahen ihn direkt und drängend an. „Ich kann bei den Nachforschungen über die Pferde meine Zeit nutzen, um einem größeren Geheimnis nachzuspüren. Ich bin nicht wegen der Bronzen im Dom. Natürlich nicht. Als Mocenigo …“ Es klang arrogant und gleichzeitig wie eine Rechtfertigung. „Mir geht es um etwas Wichtigeres, Professor! Ich bin dabei, eines der größten Rätsel der Weltgeschichte zu lösen und wollte Sie deswegen zu Rate ziehen. Es ist dringend und es eilt.“ Seine Stimme klang erregt und seine Augenlider zuckten.
Cariello machte einen Schritt zurück. ‚Der Mann ist ein Nervenbündel. Was geht hier vor?‘ Er hätte viel darum gegeben, hinter die Maske Mocenigos sehen zu können. Mit dem Kostüm und der Perücke war er nur ein Abbild seiner selbst.
Sie wurden unterbrochen, als man die Terrassentür öffnete. Es war San Bernardo. Die Walzer trieben die Masken aufs Parkett und er forderte sie mit heiteren Gesten auf, in den Saal zurückzukehren und mit seinen Töchtern zu tanzen. Sie gehorchten notgedrungen, aber während Cariello sich unter die Tanzenden mischte, blieb ihm ein bitterer Geschmack im Mund zurück. Erst nach und nach wurde ihm klar, wie beunruhigend es war, dass Mocenigo von einem zweiten, größeren Geheimnis als dem der Pferde gesprochen hatte. Er hatte keine Zeit gehabt, zu fragen, worum es sich handelte ... aber wie war es möglich, dass die weltbekannten Pferde von San Marco zum Streitobjekt wurden und trotzdem etwas wichtiger sein sollte als das? ‚Was will dieser Mocenigo eigentlich im Dom? Die Pferde müssen doch auch ihm am Herzen liegen.‘
Während Maskierte ihn von rechts und links anstießen und er die blonde Tochter San Bernardos durchs Getümmel lotste, fühlte Cariello wie sich ein flaues Gefühl in seinem Magen ausbreitete. Es fuhr ihm von dort unter die Haut und kulminierte schließlich in Panik. Eilig entschuldigte er sich bei seiner jungen Partnerin, drehte sich um und verließ die Tanzfläche. Mit weit ausgreifenden Schritten kehrte er zum Tisch San Bernardos zurück, aber fand Mocenigo nicht mehr daran vor. Er wandte sich um und ließ den Blick über die Menge schweifen. Der goldstrotzende Casanova war nirgends zu sehen. Masken und Perücken waren überall, alle funkelten gleichermaßen, in Bewegung und im Takt.
Dann entdeckte Cariello den Gesuchten. Mocenigo befand sich weit jenseits des Getümmels. Er verließ an der Seite eines weiß-maskierten, hochgewachsenen Mannes in schlichtem schwarzen Umhang und Dreispitz den Saal. Der Begleiter drehte sich für einen kurzen Moment um und es schien Cariello, als sähe er zu ihm herüber. Ein Blick aus dunklen Augen traf ihn aus den Sehschlitzen der Kostümierung, dann legte der Mann seine Hand wie eine Rabenklaue auf Mocenigos Schulter und schob ihn aus der Pforte.
Die Szene dauerte nur einen Atemzug lang, aber sie ließ eine Gänsehaut über Cariellos Rücken huschen. Er fragte sich, ob er Mocenigo folgen sollte, aber entschied sich dagegen. Was wusste er schon von dem jungen Mann? Trotzdem verließ er den Ball zwei Stunden später mit dem Gefühl, dass etwas Beunruhigendes im Gang war.
Eine schreckliche Entdeckung
Der rosige Sonnenschein des Morgens tauchte Venedig am nächsten Tag in ein ätherisches Licht. Es war so unwirklich und heiter, wie man es nur in der Serenissima kannte. Die ersten Gondeln wagten sich auf die Gewässer des Canale Grande und schoben sanfte Bugwellen vor sich her. Frühe Touristen wanderten durch die verwinkelten Gassen und verliefen sich darin. Die Luft war lau und der Himmel strahlte in hellem Azur. Der Tumult des Karnevals hatte sich beruhigt. In den luxuriösen Palästen am Canale Grande öffnete man die schweren Vorhänge und die Jalousien. Fensterläden wurden aufgeschlagen und Türen geöffnet. Der Glanz des Abends machte der Reinheit eines herrlichen Wintermorgens Platz. Der Duft von Kaffee zog durch die Straßen und erste Frühaufsteher begaben sich allerorts zum Frühstück.
In einem der Paläste jedoch, dem romantischen, weiß-golden schimmernden Palazzo Dario am Canale Grande, ging das Öffnen der Fenster mit einem Schrei einher, der über den Kanal widerhallte und dem Personal der nahen Vaporetto-Station durch Mark und Bein ging.
Ein Zimmermädchen hatte die Vorhänge des großen Prachtsaals im ersten Stock aufziehen wollen und war auf eine schreckenerregende Szene gestoßen: Der Besitzer des Palastes lag auf dem Rücken in der Mitte des eichengetäfelten Raums. Er trug noch einen Teil seines Karnevalskostüms der vorhergegangenen Nacht … und er war tot. Eine karminrote Blutlache glänzte unter seinem Körper. Seine Augen stierten blicklos durch die Maske, die noch immer sein Gesicht bedeckte, und sein Portemonnaie lag aufgeschlagen neben ihm.
Das bosnische Zimmermädchen lief händeringend hinaus zum Telefon, um die Carabinieri zu verständigen. Ihre schwarzen Schuhe klapperten dabei auf den gewienerten Böden und sie rang nach Luft. Es war auf den ersten Blick zu sehen, dass der Tod des Hausherrn kein friedlicher gewesen war.
Beängstigende Neuigkeiten
Die Sonne schien durch ein kaum ellenbogenbreites Fenster in den schmalen Raum mit den mächtigen Deckenbalken. Sie spiegelte sich im Glas der billigen Gravuren an der gelben Wand und huschte über die abbröckelnde Farbe an den verzogenen Türen. Es roch nach aufgewärmten Brötchen vom Vortag und nach dem alten Holz der abgegriffenen Möbel.
Die schmale junge Frau, die am Tisch in der Zeitung blätterte, hätte aufstehen und sich auf den Weg machen sollen, aber goss sich stattdessen Espresso nach. Das blaue Uniformhemd der Carabinieri, das sie trug, und ihr kurz-rasiertes schwarzes Haar wirkten männlich. Ihr Gesicht mit dem breiten roten Mund und den schneeweißen Zähnen hatte jedoch ausgesprochen feminine Züge. Die Sonne spielte ein Schattenspiel darauf und reflektierte sich in ihren dunklen Augen. Zwei kleine Jungen stritten sich neben ihr um ein Brötchen und zerrissen es in Stücke. Sie ähnelten ihr mit ihrer feingliedrigen Statur.
Chiara Ferro legte die Finger der rechten Hand um die abgenutzte Porzellantasse und trommelte mit der Linken auf die Zeitung vor ihr, ohne sie zu lesen. Ihr Blick huschte immer wieder zum Fenster. Sie nahm die Schlagzeilen des klaren, lauen Februarmorgens nicht wahr. Es war ein schöner Tagesanfang im sonnenbeschienen Venedig, aber genau das ließ sie zögern. Sie fand ihn zu schön, um ins Büro zu gehen und sich mit ihrem ungeliebten neuen Kollegen abzugeben. Zu schön, um sich in den Alltag zu stürzen und Andanti wiederzusehen. Der kleine blonde Venezianer mit dem übertriebenen Ego und der beginnenden Glatze löste Widerwillen in ihr aus. ‚Er ist vom ersten Tag meiner Ankunft in Venedig an auf mich neidisch gewesen. Neidisch wegen jeden Zentimeters Büro, das man mir gegeben hat, und eifersüchtig, wenn ich das Wort ergreife.‘
Es gab Tage, da hatte sie Angst, zur Wache zu gehen. Sie war erst vor Kurzem in die Stadt versetzt worden und war froh gewesen, Rom zu verlassen. Die Trennung von ihrem Ehemann hatte sie aus der Metropole gejagt. Der neue Posten war ein neuer Anfang und allem Anfang hätte bekanntlich ein Zauber inne gelegen - wenn Andanti nicht gewesen wäre.
Sie sah auf den Kanal und die Stadt, über der das Licht des Morgens leuchtete wie in einem rosafarbenen Gemälde. Die kleine Wohnung, die sie nach langem Suchen in dem hohen alten Haus gemietet hatte, war dunkel und feucht, die Wandschränke abgenutzt und der Fußboden aus dem typischen gescheckten venezianischen Marmorgemisch. ‚Aber wir sind gerade erst angekommen, später findet sich Besseres.‘ Der Ausblick übers Wasser entschädigte sie im Moment. Sie konnte durch das schmale Fenster graugrüne Wellen, Boote und Meer sehen, so weit der Blick reichte. Möwen schrien und flogen im Sturzflug an den Vaporettos vorüber. Weiß-schäumende Bugwellen umgaben die Schiffe, die die Lagune überquerten, auf dem Weg zum Lido, nach Padua oder hinaus auf die Adria. ‚Wir werden uns schon einleben. Trotz der fremden Leute und der feuchten Wände.‘
Das Schrillen des Telefons unterbrach ihre Gedanken. Auf dem Bildschirm leuchtete eine Dienstnummer auf.
‚Verdammt. Ich bin zu spät und gerade heute sucht man mich …‘ Sie war fast drei Monate in der Stadt, aber bisher war sie jeden Morgen ohne Hast zur Wache gekommen. Schwerere Kriminalfälle waren in Venedig rar. Eilig griff sie nach dem beharrlich läutenden Apparat und antwortete. Als sie wieder auflegte, war sie blass. Sie hatte nicht damit gerechnet, zu einem Mord gerufen zu werden. Und erst recht nicht zum Palazzo Dario.
Dem Palazzo Dario …
Ihr Kollege hatte ihr nicht den Weg erläutern müssen. Selbst als Neuankömmling kannte sie das Gebäude. „Sicher, keine Sorge, kenne ich …“, hatte sie gemurmelt.
Der Ca‘ Dario war ein Palast direkt am Canale Grande, unweit der Kirche Santa Maria della Salute. Weißer und rosafarbener Marmor umrahmte Fenster mit Bögen, die aussahen, wie aus Spitze gewoben. Goldene Mosaike gaben der Fassade einen Glanz, der sie aus den anderen Palästen am Kanal herausstechen ließ. Dahinter lagen noble, eichengetäfelte Räume und einer der raren Gärten Venedigs, eine Oase im Dschungel der baumlosen Gassen der Lagunenstadt. Aber das alles war es nicht, was den Palast unvergesslich machte.
Auf ihrer ersten Venedig-Rundfahrt hatte Chiara ihn vom Boot aus gesehen und ihn bewundert. Der Vaporetto-Fahrer neben ihr hatte hingegen nur den Kopf geschüttelt und sich bekreuzigt. „Der Palast steht schon lange leer“, hatte der bejahrte Mann in der abgegriffenen Uniform geraunzt. „Der alte Kasten ist verflucht und in seiner Vergangenheit wimmelt es von Morden und Bankrotten.“ Er hatte das faltige Gesicht mit dem Stoppelbart und den rissigen Lippen zusammengezogen und heftige Gesten gemacht. „Manche Besitzer sind im Ca‘ Dario umgekommen, andere hat sein Fluch ans Ende der Welt verfolgt. Das Gemäuer ist von Geistern und Vampiren bewohnt. Es hat den Malocchio – den bösen Blick.“
Der venezianische Dialekt des alten Mannes hatte das Seinige getan, um der Geschichte die Aura des Bedrohlichen zu geben. Er hatte in den Kanal gespuckt und die arthritischen Finger zu Teufelshörnern geformt, um den Beelzebub zu beschwören. Chiara hatte den Eindruck gehabt, dass der Alte das Boot unmerklich weiter fortgelenkt hatte, um das Gebäude am Ufer zu meiden.
‚Und jetzt das. Man ruft mich zu diesem eigenartigen Ort. Wer in aller Welt hat sich dort umbringen lassen?‘ Es war ihr erster großer Fall und sie hätte sich freuen sollen, aber eine unsichtbare Hand drückte ihr die Kehle zu. Sie war allein mit ihren zwei kleinen Jungen in der unbekannten Stadt. Und man schickte sie ausgerechnet zum Ca‘ Dario.
Damoklesschwert
Cariello war am Vorabend erst weit nach Mitternacht vom Maskenball zurückgekehrt. Er hatte zu viel Champagner getrunken und hatte die Gesellschaft der Töchter San Bernardos schließlich recht amüsant gefunden. Recht amüsant, nicht mehr. Er war sich bewusst, dass sein höfliches Ablehnen der Telefonnummer seiner Tanzpartnerin deplatziert gewesen war, aber konnte nicht über seinen Schatten springen. ‚Mir ist egal, ob die Leute denken, ich sei ein Eisblock oder ein Misanthrop, wenn sie mich nur in Ruhe lassen.‘
Er hoffte trotzdem, dass ihm sein venezianischer Kollege verzeihen würde, kein Interesse für seine hübschen Töchter gezeigt zu haben, die er ihm so zielgerichtet präsentiert hatte. ‚Ich bin ein Grobian und habe nur an Mocenigo und die Pferde in der Basilika denken können.‘
Cariello rieb sich die Schläfen. Für einen Professor war er mit seinen 45 Jahren jung und gut in Form, aber er hätte sich umgänglicher benehmen und weniger trinken sollen. Er hatte Champagner nie gemocht und gemischt mit den Neuigkeiten Mocenigos sprengte er ihm den Schädel …
Vorm Fenster seines mit schwarzem Samt und teuren Möbeln ausgestatteten Hotelzimmers trieben Gondeln den Canale Grande hinunter. Er sah ihnen einen Augenblick zu.
Jeder in dieser Stadt schien sich zu amüsieren. Jeder, außer ihm. Sein Zimmer mit den Brokatvorhängen und den geschwungenen Bettpfeilern lag still in seinem Rücken und er war sich dessen unerträglich bewusst. Der Verlust seiner Frau hatte ihn Barrieren aufbauen lassen. Es verging kein Tag, an dem er nicht an Lucrezia und seinen Bruder Avelardo dachte. Es war nicht die Liebe, die ihn quälte, es war die Schuld. Ein Gefühl der Reue überkam ihn, das er eilig beiseite wischte. „Zeit, mich auf den Weg zu machen.“
Nach der Information Mocenigos, dass die Türkei die Herausgabe der Pferde von San Marco verlange, verspürte er die Verpflichtung, sich die Sache anzusehen. Am Nachmittag hatte er einen Vortrag an der Universität zu halten und musste aufbrechen, wenn er den Dom sehen wollte.
Die vom halboffenen Fenster hereinwehende Luft roch nach Meer und Weite. Aus Vorsicht zog er sich eine gefütterte Parka an und schloss die Knöpfe in Erwartung des kalten Windes, der ihm in den letzten Tagen zu schaffen gemacht hatte. Kaum ein Ort war so feucht und unwirtlich wie die nebeligen Gassen Venedigs im Februar. Die Hotels und Restaurants waren edel und brokatverziert, aber die dunklen Straßenschluchten dahinter ruhten im Nebel, gefangen in eisiger Feuchtigkeit.
Als Cariello vors Hotel trat, grüßte ihn jedoch statt der befürchteten Kälte Frühlingsluft. Das helle Rosa der Fassaden der Serenissima und das blassgrüne Glänzen des Canale Grande verjagten seinen Missmut. ‚Winterstürme wichen dem Wonnemond.‘ Er lächelte und atmete aus.
Myriaden von Gondeln trieben an ihm vorbei, als kämen sie aus einem anderen Jahrhundert. Ihr lautloses Gleiten war untermalt vom babylonischen Sprachgewirr auf den Uferpromenaden. Weiße Tauben flatterten durch die Häuserreihen. Cariello wich ihren Flügelschlägen aus und knöpfte sich die Jacke wieder auf. Für einige wenige Stunden würde er dem Winter entkommen und das enge Gefühl in seiner Brust ließ nach. Die Steine der Gassen rochen nach Algen und der Nässe, die von der schimmernden Wasseroberfläche der Kanäle herüberzog. Es war ein Geruch nach der Weite des Meeres und Freiheit.
Er erreichte den Markusplatz, nachdem er sich zweimal in den ewig gleichen Gassen verlaufen hatte. Der weite Platz war trotz der frühen Stunde überfüllt. Maskierte standen überall und die Sonne glänzte in den Fenstern der Renaissance-Paläste, die ihn umgaben. Von den Podien der Kaffeehaus-Orchester kratzte das Geräusch der Musiker herüber, die ihre Geigen stimmten.
Eine Seite des Platzes war vom Hochwasser überflutet. Die gleißende Sonne reflektierte sich darin. Cariello blieb stehen. ‚Als ob das Licht aus dem Paradies kommen würde.‘ Venedig war längst seiner einheimischen Bewohner beraubt, ein Touristenspektakel, überlaufen und dem Untergang geweiht, aber an diesem Morgen war es erhaben. Eine Aura des Festlichen lag über allem. Frühling wärmte die Luft und einige ephemere Augenblicke lang bewegte Cariello sich nicht. Er wäre noch länger stehen geblieben, wenn nicht eine plötzliche Kälte durch seine Schuhsohlen gedrungen wäre. Er sah nach unten und sprang beiseite.
Das Hochwasser quoll nicht nur über die Kai-Mauer auf den Platz, sondern auch durch Löcher im Boden. Unter den Steinfliesen befanden sich Rinnen, die bei Regen das Wasser in den Kanal ableiten sollten, aber sich jetzt ungewollt in einen Zufluss verkehrten. Das Meer nahm die Stadt ein wie ein Monster, das im Untergrund der Häuser wohnte und darauf lauerte, sie zu verschlingen. Venedig war auf Pfeilern aus Holz gebaut. Wasser war überall und die Stadt stand im Ozean, der jedes Jahr weiter anstieg und drohte, sie bald endgültig zu verschlingen.
Trotz aller trauriger Umstände, die den edlen Palazzi ihr nahes Ende ankündigten, machte das Hochwasser Venedig an diesem strahlenden Morgen noch heiterer. Die Gebäude spiegelten sich im Wasser auf dem Platz und es sah aus, als existiere die Stadt zweimal. Die Szene war von einem prächtigen Goldton geprägt, als wäre Venedig eine Schatzkammer. Eine Schatzkammer des Meeres, die dieses einen Augenblick lang den Menschen geschenkt hatte und sodann drohte, sie mit seinen Wasserhänden zu ergreifen, um sie sich zurückzuholen.
Cariello strich seine Schuhsohlen trocken und überquerte den Platz, indem er die Wasserlachen umging. Er fühlte sich besser, die Lungen voller Luft und die Augen voller Sonne. Er atmete durch. Der Markus-Dom war geöffnet und die Schlange der Touristen trotz des Tohuwabohus auf dem Platz noch kurz. Er beschleunigte den Schritt.
Die Torbögen der Kirche glitzerten ihm entgegen. Rostflecke auf den mächtigen byzantinischen Kuppeln darüber wirkten so lebendig, als würden sie Engel verbergen, die auf dem grauen Dach ein Sonnenbad nähmen. Er nickte den imaginären Gottesboten zu. ‚Was für ein eigenartiges Gebäude ihr behütet. Byzanz mitten in Italien. Man hat ein Prachtwerk gebaut, nachdem der Mob einen Dogen und seinen vierjährigen Sohn zusammen mit der Vorgängerkirche verbrannt hatte.‘
Cariello näherte sich dem Dom mit der breiten, Mosaik-verzierten Fassade, die Gesichter von Heiligen und Helden blickten ihm in bunter Farbenpracht entgegen. Er wurde begleitet vom Läuten der Glocken des Campanile. Es schlug zehn.
Auch im Inneren der Kirche herrschte Reichtum. Kuppeln und Wände waren bedeckt von Mosaiken, Lampen und Skulpturen, verschleiert von andächtigem Halbdunkel. Rote Lichter glitzerten am baldachinbedeckten Altar und gaben der Basilika etwas Morgenländisches. Es roch nach dem Weihrauch der kaum beendeten Morgenandacht und fast hätte Cariello tanzende Haremsdamen im Dämmerlicht des Kirchenschiffs erwartet.
Venedig war einst unermesslich reich und Herr des Mittelmeeres gewesen. Man hatte sich vor seinen Dogen verneigt. Den Dandolo, den Falier, den Foscari und den Mocenigo.
‚Den Mocenigo …‘
Cariello gab sich einen Ruck. Er war nicht als Tourist gekommen. Er kaufte eine Eintrittskarte und drängte sich an den ins Freie strömenden Gottesdienstbesuchern vorbei ins Innere der Kirche. Schon nach wenigen Schritten hielt er erneut inne. Auch im Eingangsbereich der Basilika stand das Wasser. Im Radio hatte ein Nachrichtensprecher angekündigt, dass der Höhepunkt des Aqua Alta noch nicht erreicht sei, aber es bedeckte bereits die Marmorfliesen der Kirche. Er starrte darauf. ‚Wie habe ich das in den letzten Tagen übersehen können?‘
Er war seit seiner Ankunft der Arbeit an der Universität nachgegangen und hatte dem Zustand Venedigs kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Die Touristen waren ihm aufgefallen und der Trubel des Karnevals, die Preise und die überfüllten Vaporetti. Aber nicht das steigende Meer.
Jetzt blickte er auf die durchsichtigen Wellen, die über die Marmorornamente zu seinen Füßen huschten. Sie zitterten bei jedem Schritt, der das Wasser durchquerte, als habe der Fuß eines Riesen das Gotteshaus selbst zum Wanken gebracht. ‚Niemand hätte eine Kirche so gebaut, dass sie von Zeit zu Zeit unter Wasser steht, vor allem, wenn man darunter eine Krypta anlegt, die die Gebeine von Heiligen und Patriarchen beherbergen soll.‘ Die Zeitungen hatten viel davon geredet, aber jetzt sah er es selbst - die Stadt der Dogen versank in den Wogen. Ihm kamen die Worte Mocenigos in den Sinn: „Niemand rettet Venedig.“
Die Erbauer der Stadt hatten Vermögen besessen und die halbe damals bekannte Welt beherrscht. Wie musste man sich fühlen, wenn die Ahnen Heldentaten vollbracht hatten und man selbst wie der junge Mocenigo tatenlos zusehen musste, wie die berühmte Heimatstadt an Fremde verkauft wurde, verdammt dazu, schon bald in der Tiefe der Lagune zu versinken?
Man sprach schon lange vom Ansteigen des Meeresspiegels, vom potenziellen Hunger in der Welt und drohendem Massensterben. Cariello hatte solche Prognosen immer mit Vorsicht betrachtet, aber was er sah, war Realität. Und diese Realität verschlang ohne Mitleid das Kleinod des Mittelmeers. Der noble Dom von Venedig war dem Untergang geweiht, wie die Stadt, die ihn umgab, während man ihn noch fotografierte und Eintrittskarten verkaufte.
Die Basilika war in 1200 Jahren sechs Mal geflutet worden, viermal davon in den letzten zwanzig Jahren und am schlimmsten am 12. November 2019. In den Medien sprach man von der Angst, dass es in den nächsten Tagen zu einer erneuten Überschwemmung kommen könnte. Das letzte Mal hatte der Boden bis zum Altar der Madonna Nicopeia unter Wasser gestanden. Die Madonna, die der heilige Lukas selbst gemalt haben sollte und die die Kreuzfahrer wie die Pferde des Doms aus Konstantinopel gestohlen hatten, befand sich nahe des Hauptaltars. Wenn das Wasser bei ihr stand, war die Basilika geflutet. Das Salz würde die Marmorböden zerfressen und den Mosaiken ihren Glanz rauben.
Cariello starrte auf sein Spiegelbild in der Lache zu seinen Füßen, bis ihn eine Gruppe hereindrängender Asiaten in den Rücken stieß. Er richtete sich auf. ‚Meine bestürzten Blicke werden an der Situation nichts ändern, aber meine Schuhe werden ruiniert.‘ Das kalte Wasser begann, durch das Leder zu dringen. Er war betroffen. ‚Was kann der Mensch gegen eine solche Katastrophe tun?‘
Er stieg über die Pfützen und begab sich hinauf zum Balkon des Doms, auf dem sich die bronzenen Pferde befanden. Er fühlte sich dabei wie ein Verdammter nach der Verkündung des Datums des Jüngsten Gerichts. ‚Wer weiß, ob ich diese Stufen noch oft emporsteigen kann.‘
Er erreichte die noch fast leere obere Etage, in deren Inneren die Statuen der berühmten Zugpferde der letzten antiken Bronzequadriga standen. Auf dem Balkon, im Freien, stand ihre Kopie. Die Tiere glänzten, erleuchtet von Sonnenstrahlen, die durch das Domfenster drangen, und darüber glitten, als wollten sie die erstarrten Rösser zum Leben erwecken, geheimnisvolle Herolde einer längst verlorenen Schlacht, von deren Scherbenfeldern man sie gestohlen hatte. Sie sahen ihm entgegen, als hätten sie ihn erwartet.
‚Euch will man also zurück nach Istanbul bringen.‘ Cariello hätte sie streicheln mögen. ‚Der Dom versinkt im Wasser und man macht sich daran, seine Schätze zu plündern. Was für ein Streit. Und das nach achthundert Jahren!‘ Düster besah er die vier Statuen. Die Erzählung seiner Bekanntschaft vom Vorabend wunderte ihn. ‚Warum ist der junge Mocenigo in diese Angelegenheit verwickelt? Warum gerade er, ein Nachfahre der Dogen?‘
Cariello umrundete die Pferde. Niemand wusste, woher sie ursprünglich kamen, aus Rom, aus Griechenland, oder woher auch immer. Auch die Byzantiner schienen sie nur gestohlen zu haben, so wie die Knochen der Apostel, die Reliquien Christi und die Schlangensäule aus Delphi. Manche Zungen behaupteten, der berühmte Lysippos habe die Pferde geschaffen, andere sagten, sie stammten vom Forum Romanum. Aber was würde man nachprüfen können? ‚Wenn die Pferde aus Rom kommen, wäre es zumindest schwer, ihre Rückführung nach Istanbul zu verlangen …‘
Cariello sah sich in der Loggia um. Nichts deutete darauf hin, dass die Pferde bewegt werden sollten. Sie standen, wo sie seit Jahrhunderten gestanden hatten. Wenn Mocenigo recht hatte, würde sie bald eine Schlammschlacht umtoben. Niemand würde die Pferde aus Italien herauslassen - das war, als verlange man die Mona Lisa aus Paris zurück. ‚Aber die Sache wird Unheil, Hass und Vorwürfe bringen. Und noch weiß sichtlich keiner davon.‘
Cariello drehte den Statuen den Rücken zu. Es wurde Zeit, dass er in die Universität fuhr. Er würde Mocenigo am Abend anrufen, um ihn zur Raison zu bringen und sich gegen diese Verhandlungen zu stellen. Er wollte zudem von ihm erfahren, welches ‚andere‘ Geheimnis der venezianische Dogenspross zu entschlüsseln versuchte.
Cariello traute Mocenigos Angaben nicht. Der Venezianer hatte ihm nicht in die Augen geschaut und war viel zu hastig verschwunden.
Seufzend wandte er sich zum Gehen. Noch bevor er die Treppe nach unten erreichte, stieß er mit einem schwarzgekleideten Mann zusammen, der am Eingang der Empore stand. Er murmelte eine Entschuldigung, aber schaute nicht auf. Ein eigenartiger Geruch drang ihm im Vorübergehen in die Nase. Ein Geruch, an den er sich zu seiner Verwunderung noch den ganzen Tag erinnerte.
Der Tote im Palazzo Dario
Als Chiara in dem Motorboot, das man ihr von der Wache gesendet hatte, am Palazzo Dario anlangte, war das Fahrzeug ihrer Kollegen bereits eingetroffen. Techniker in weißen Schutzanzügen standen auf der hölzernen Mole, die sich in den Canale Grande erstreckte. Die Spurenermittlung trug Geräte hinein und zog Absperrbänder.
Sie stieg aus und blickte an dem im Sonnenlicht schimmernden Gemäuer hinauf. Sein Eingang zur Kanalseite stand weit offen. Blassgrüne Wellen zerschlugen ihre Schaumkronen an den bemoosten Treppen davor und ein breiter Korridor öffnete sich dahinter ins dunkle Innere.
Außer dem Untergeschoss mit Marmorboden und Magazinen besaß das Gebäude drei Etagen, deren hohe gotische Fenster mit Bögen aus Stein verziert waren, die wirkten wie gewebt. Im dritten Stock gab es einen schmalen Balkon. Kreisrunde Intarsien verbrämten die prächtige Fassade aus weißem und gelblichem Marmor, die sich im Wasser des Kanals spiegelte.
Nahe der Tür befand sich eine Inschrift. ‚Genio urbis joannes dari.‘ Der Erbauer des Gebäudes, Giovanni Dario, hatte mit dem Text und dem Palast dem Genius der Stadt Venedig gehuldigt.
Die alten Mauern waren zur Seite geneigt. Der noble Geniestreich versank in den Wogen. Ein Dichter hatte einst gesagt, der Ca‘ Dario sei eine alte Kurtisane, die sich unter dem Gewicht ihrer Juwelen krümme. Chiara hätte ihr aufhelfen wollen. Die Kurtisane war trotz der Gerüchte über den ihr anhaftenden Fluch noch immer wunderschön.
Ein Räuspern unterbrach ihre Betrachtung. Es kam von einem jungen Carabiniere, der ihr bedeutete, ihm zu folgen. Er brachte sie zu Andanti, der sie im ersten Obergeschoss erwartete. Ihr Magen verkrampfte sich. Andanti war einer jener hellhäutigen, blonden Langobarden, deren Kopfhaut unter dem schütteren Haar durchschimmerte, klein, mager und mit von einer zu heftigen Rasur irritierten Wangen. Auch er war nicht froh, sie zu sehen. Seine Mundwinkel zuckten abfällig, dann drehte er ihr den Rücken zu.
Chiara schwieg und trat hinter ihm zur Tür des Saales, in dem die Techniker am Werk waren. In dem weitläufigen, aber dunklen Raum mit venezianischem Fußboden und Kastendecke hatte man Lampen aufgestellt, um die Leiche zu fotografieren. Sie sah die Umrisse eines auf dem Boden liegenden Mannes im Dunst des aufgewirbelten Staubs, der in den durch die Fenster hereindringenden Sonnenstrahlen glitzerte. Seine Beine und Arme waren lang ausgestreckt. Er lag auf dem Rücken und von Weitem sah sie, dass etwas Braunes, Dunkles sein Gesicht verformte, als säße ein Dämon auf seiner Stirn und fräße von ihm.
Zu ihrem verkrampftem Magen gesellte sich ein Kloß in der Kehle. Was war das, was der Tote dort vor dem Gesicht hatte? Bevor sie nähertreten konnte, zog der junge Carabiniere sie zurück. „Die Messungen sind noch im Gang.“
Benommen folgte sie ihrem Kollegen und Andanti durch die anderen Räume des Palastes. Auch deren Atmosphäre erwies sich als bedrückend. Ihr Herz beschleunigte, je weiter sie sich in den dunklen Korridoren verloren. Sie hätte es sich nicht träumen lassen, so schnell das Privileg zu haben, den berühmt-verrufenen Ca‘ Dario zu betreten und schwankte zwischen Beklemmung und Neugier. ‚Wenn man erst einmal die Legende von seinem Fluch kennt, scheint jedes Zimmer verwunschen.‘
Ein luxuriöses Bad lag dunkel und verlassen, schwere Vorhänge waren halb zugezogen. Die rampenlosen Marmortreppen erstreckten sich weitläufig und fahlweiß, verbrämt mit ehemals eleganten Bordüren. Die Möbel der Schlafräume waren ausgeräumt und nur in einem der Flügel des schmalen Palastes stand Hausrat. Sessel und Tische waren neu und schienen gerade erst geliefert worden zu sein. Ein Teil von ihnen war noch in Plastikfolie verpackt.
Nach einer Wanderung durch totenstille Räume hörte Chiara im zweiten Stock Geräusche. Lautes Weinen echote in den verlassenen Gängen wider. Beklommen stieß sie die Tür auf, hinter der sie das Wimmern hörte, und war erleichtert festzustellen, dass es von einer Normalsterblichen stammte und nicht von einem der in den Touristenbroschüren angekündigten Gespenster. Eine Carabiniere tröstete auf einer Bank eine banal in Rock und Bluse gekleidete Frau. Es musste sich um das Zimmermädchen handeln, das die Leiche gefunden hatte.
Der Raum, in dem die beiden saßen, wirkte bewohnter. Die Wände waren mit verblichenem altrosa Seidenstoff bespannt. Eine vergoldete Holzkonsole wurde von einem Spiegel im üppigen venezianischen Stil gekrönt und ein weißer Steingutofen thronte daneben. Die Ausstattung wirkte, als hätte eine Person aus dem 18. Jahrhundert sie gerade eben noch benutzt.
Chiara wollte eintreten, aber zuckte zurück. Die stechenden Augen einer Frau sahen ihr aus einer schwarzen Maske entgegen. Sie benötigte einen Augenblick, um zu begreifen, dass sie auf ein Gemälde schaute. ‚Ich sollte mich schämen, als Carabiniere vor Geistern Angst zu haben.‘ Sie trat ein. „Maresciallo Ferro, Carabinieri. Sie sind die Reinigungskraft? Fühlen Sie sich im Stande, mir ein paar Fragen zu beantworten?“
Die Frau sah auf. Ihre blassblauen Augen flossen von Tränen über. Mit zitternden Fingern betastete sie die abgegriffene, rote Perlenkette, die sie über der geblümten Kittelschürze trug.
Chiara versuchte, sich zu beruhigen. Die Frau vor ihr war verängstigt genug. Sie gab ihrer Stimme einen formelleren Klang. „Können Sie mir sagen, seit wann Sie hier arbeiten?“
Die Frau rang ihr Taschentuch. „Fünf Tage. Ich Bosnierin. Nach Venedig kommen, um Arbeit finden. Als man Stelle angeboten, hat mir Venezianerin, bei der ich Zimmer miete, abgeraten. Palast verflucht, hat sie gesagt. Aber ich naiv gewesen, habe aus Geldnot angenommen.“ Die Frau strich sich die wirren blonden Haare aus dem Gesicht. „Gehalt gut, aber ich nichts davon bekommen.“ Ihre Worte gingen in hemmungsloses Schluchzen über, diesmal, wie es schien, mehr aus Verzweiflung über ihre finanzielle Lage als aus Schock über den Mord.
Chiara wartete, bis die Frau sich gefasst hatte, und kauerte sich vor sie. „Wissen Sie, wer der Tote ist?“
„Tote ist neue Besitzer von Palast. Ist Türke. Heißt Kadir Uysal. Palast erst vor Kurzem gekauft - mehr ich nicht wissen.“ Der grobschlächtigen Frau liefen die Tränen über die Wangen. Sie nahm den Kopf in die Hände und begann sich wimmernd vor und zurück zu wiegen. Chiara sah, dass sie nicht mehr erfahren würde, stand auf und kehrte auf den Flur zurück, wo Andanti in sein Telefon vertieft wartete. Er schaute erst auf, als der junge Uniformierte, der sie herbegleitet hatte, die Treppe heraufkam und ihnen zuwinkte. „Sie können den Toten jetzt sehen.“
Chiara folgte ihm mit Andanti zurück zum Saal mit dem Mordopfer. Eine Art von Lampenfieber gemischt mit Angst erfasste sie. Man gab ihr weiße Schutzkleidung und Handschuhe. Die Muskeln in ihrem Nacken verkrampften sich. Tod und Gewalt gingen auch an einer Carabiniere nicht spurlos vorüber. Sie mochte keine Leichen sehen.
Hinter der Tür traf sie auf eine Szene, die wirkte, wie ein düsteres Bühnenbild. Der große, hohe Saal, der die ganze Etage einnahm, war mit Holz getäfelt und mit Murano-Lüstern ausgestattet. Schwere Eichenbalken stützten die Kastendecke. Eine Seite war mit einem Chorgestühl aus einer Kirche verziert. Davor standen massive Tische, majestätische Sessel und zwei Globen. Im hinteren Teil der Galerie befand sich ein kleines Becken, in dem ein dünner Wasserstrahl plätscherte. Sein Geräusch war das einzige in der lastenden Stille.
Wie oft in Venedig war das Innere des Gebäudes düsterer, als es von der Wasserseite des lichtumfluteten Canale Grande den Anschein hatte. Die Luft wirkte dunsterfüllt und dicht, angereichert mit Herrenparfüm und Lavendel. ‚Als hätte diesen Saal seit Jahrzehnten niemand betreten.‘
Ein Mann in Barock-Hose lag halb nackt in der Mitte des Raums, in dem weder Fernseher noch Telefon die Ordnung störten. Sein Gesicht war geschminkt und das, was Chiara als braunes Etwas wahrgenommen hatte, erwies sich als ungewöhnlich ausladende lederne Karnevalsmaske. Nur der daneben liegende Geldbeutel fiel aus dem historischen Rahmen. Er ruhte in der Blutlache, die den Kopf und den unbekleideten Oberkörper des Opfers umgab – ein dickes Portemonnaie aus Leder. Chiara trat näher und griff danach. Es enthielt den türkischen Ausweis des Toten. Der Name darauf lautete Kadir Uysal. Sie fand außerdem Mitglieds- und Visitenkarten und diverse Papiere, die alle auf den gleichen Namen ausgestellt waren. Ansonsten war das Portemonnaie leer. Das Geld fehlte.
Sie gab die Papiere Andanti weiter und kauerte nieder, einen Kloß im Hals angesichts dessen, was sie sah. Der Schädel des leblosen Mannes war zertrümmert. Eine schwere silberne Vase lag daneben, beschmutzt mit Blut. Auch das schwarze Haar war getränkt davon. Das Gesicht bedeckte die traditionelle Larve des venezianischen Pestarztes, eine braune Maske mit überlanger Nase, in die man zu Pestzeiten kampfergetränkte Lappen gelegt hatte, um sich vor Ansteckungen zu schützen. Sie war auffällig und unschön, durchzogen von dicken Falten. Ihre Wahl verriet einen Geschmack fürs Groteske. Schon im Mittelalter war man vor ihr geflohen.
Chiara bemerkte, dass das Blut darunter hervorgetreten war, und realisierte mit Schaudern, dass man sie dem Ermordeten erst nach seinem Tod aufs Gesicht gesetzt haben musste.