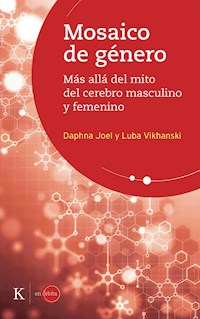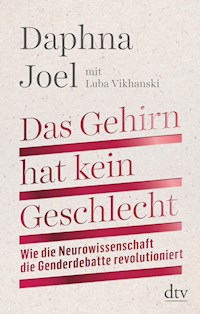
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Märchen von männlichen und weiblichen Gehirnen Noch immer hält sich der Mythos, Frauen und Männer würden sich in Eigenschaften und Verhaltensweisen grundlegend unterscheiden. Auch die Wissenschaft versuchte lange zu beweisen, dass männliche und weibliche Gehirne von Natur aus unterschiedlich ticken. Die israelische Neurowissenschaftlerin Daphna Joel widerlegt diese Theorie. Anhand neuester Studien und ihrer eigenen bahnbrechenden Forschung belegt sie, dass jedes Gehirn ein einzigartiges Mosaik ist, das sowohl »männliche« als auch »weibliche« Merkmale in sich vereint. Und sie erklärt, warum wir alle verlieren, wenn wir an Geschlechterstereotypen festhalten. Ein faszinierender Blick auf unser Gehirn und ein starkes Plädoyer für die Abkehr von einem System, das Menschen aufgrund ihres Geschlechts in zwei Kategorien einteilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Johanna Wais
Für unsere Mütter
Vorbemerkung zur deutschen Ausgabe
Die zentrale These dieses Buches lautet, dass es das weibliche und das männliche Gehirn nicht gibt, sondern jeder Mensch ein einzigartiges Mosaik aus »männlichen« und »weiblichen« Eigenschaften besitzt. Um dies auf der sprachlichen Ebene zu spiegeln, haben wir uns in der deutschen Ausgabe dazu entschlossen, englische Ausdrücke, die keine weibliche oder männliche Endung besitzen, wie zum Beispiel scientist oder researchers, im Deutschen zu gendern.
In vielen Fällen verwenden wir den Genderstern, da er ein binäres Genderverständnis negiert und die sprachliche Gleichbehandlung aller Geschlechter anstrebt. Wenn auf eine Gruppe von Personen Bezug genommen wird, die alle weiblich oder alle männlich sind, wird die weibliche bzw. männliche Form verwendet. Bisweilen finden sich auch die männliche und weibliche Form eines Wortes in Kombination, beispielsweise wenn deutlich gemacht werden soll, dass an einer Studie sowohl Frauen als auch Männer teilnahmen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich die erwähnten Personen als ausschließlich weiblich oder als ausschließlich männlich identifizieren.
Diese Art zu gendern mag nicht perfekt sein. Doch wir denken, dass ein Nicht-Gendern einem Buch nicht gerecht würde, das die Einteilung von Menschen in zwei Geschlechter zur Diskussion stellt.
Dr. Daphna Joel, Luba Vikhanski und dtv
Teil 1Geschlecht und Gehirn
Kapitel 1Mein Erwachen
An einem Sommermorgen vor über zehn Jahren war ich mit meinen drei Kindern zu Hause, als ich draußen vor dem Mietshaus das Zischen eines geplatzten Wasserschlauchs hörte. Mit dem jüngsten auf dem Arm, damals noch ein Baby, lief ich in den Garten, bog das sprudelnde Ende des Gummischlauchs eines automatischen Bewässerungssystems nach oben, sodass das Wasser nicht weiter herauslaufen konnte, und schickte meine beiden älteren Kinder los, um einen nebenan wohnenden Freund zu holen. Er kam, und ich ging davon aus, dass er die Sache in die Hand nehmen würde, aber er stand nur da, offensichtlich ratlos. Da erst dämmerte mir, dass er genauso wenig Ahnung vom Klempnern hatte wie ich. Ich bat ihn, den abgeknickten Schlauch zu halten – und das Baby – und ging auf die Suche nach dem Haupthahn, um das Wasser abzudrehen.
Erst durch den überforderten Ausdruck auf dem Gesicht meines Freundes wurde mir meine eigene Voreingenommenheit bewusst. Ich muss zugeben, es war mir peinlich. Ich war immer eine Verfechterin der Gleichberechtigung gewesen und hatte geglaubt, mein Leben entsprechend zu führen. Doch da stand ich nun und erwartete von einem Mann, einen technischen Notfall zu regeln.
Ungefähr zur selben Zeit bekam ich eine ausgezeichnete Gelegenheit, meine eigenen Gendervorurteile und die anderer Leute eingehend zu untersuchen: Eine Kollegin bat mich, ein Seminar über die Psychologie der Geschlechtsidentität zu übernehmen, das sie an der Universität Tel Aviv unterrichtet hatte. Zur Vorbereitung las ich ein Jahr lang Bücher und wissenschaftliche Aufsätze über die Entwicklung von Frauen und Männern vom Moment der Empfängnis an. Als Neurowissenschaftlerin interessierte mich besonders der Zusammenhang zwischen Geschlecht und Gehirn.
Bald erfuhr ich, dass viele Wissenschaftler*innen – genau wie andere Menschen auch – glauben, dass die Gehirne von Männern und Frauen sich grundsätzlich unterscheiden und dass dies wesentliche Unterschiede zwischen Mann und Frau auf fast jedem Gebiet bedingt, von kognitiven und emotionalen Fähigkeiten über Interessen und Vorlieben bis hin zum Verhalten. Selbsthilfebücher, die uns beibringen wollen, wie man mit dem anderen Geschlecht zurechtkommt und kommuniziert, basieren auf dieser Überzeugung.
Eine beliebte Version der Geschichte lautet: Das weibliche Gehirn verfügt über ein ausgeprägtes Kommunikationszentrum, einen großen Bereich, der für Emotionen zuständig ist, und es ist auf Empathie ausgerichtet. Beim männlichen Gehirn hingegen sind die Bereiche für Sexualität und Aggression besonders stark entwickelt, und es ist vor allem für systematisches Denken geeignet.
Diese Geschichte scheint uns eine fein säuberliche biologische Begründung für unsere Erfahrungen im täglichen Leben zu liefern. Sie erklärt, weshalb Frauen sensibler und emotionaler sind, Männer dagegen aggressiver und stärker sexuell orientiert, weshalb vor allem Frauen den Lehrberuf ergreifen und hauptsächlich Männer Ingenieure werden.
»Es sind die Hormone, Dummerchen«, sagt man uns. Im Mutterleib, so geht die Geschichte, sorgt eine gewaltige Welle an Testosteron, von den Hoden des männlichen Fötus produziert, dafür, dass sein Gehirn sich von der Standardversion – die weiblich ist – in ein männliches verwandelt. Mädchen werden also mit einem weiblichen Gehirn geboren und Jungen mit einem männlichen. Die übrigen Details der Geschichte variieren je nach Autor*in, aber sie alle erklären, warum Frauen und Männer sich entsprechend der herrschenden Geschlechterstereotype verhalten. Mädchen sind nett und einfühlsam, Jungen sind aggressiv und aktiv – weil diese oder jene Hirnregion bei Mädchen kleiner und bei Jungen größer ist oder weil sie mehr oder weniger von diesem oder jenem Hormon haben.
Überraschungen gibt es nicht. Egal, wie die Ergebnisse im Einzelnen aussehen, sie werden nie auf eine Art und Weise interpretiert, die den herrschenden Geschlechterstereotypen zuwiderläuft. Zum Beispiel glaubte man viele Jahre lang, dass die Amygdala, eine für Emotionen zentrale Gehirnregion, bei Männern im Durchschnitt größer sei als bei Frauen. Keiner behauptete jedoch jemals, Männer seien wegen der Größe ihrer Amygdala von Natur aus das gefühlvollere Geschlecht. (Neuere statistische Analysen haben gezeigt, dass sich die durchschnittliche Größe dieser Hirnregion bei Frauen und Männern nicht unterscheidet.1)
Die Vorstellung eines männlichen gegenüber einem weiblichen Gehirn passt gut zu der populären Ansicht, dass Männer und Frauen verschiedenen Planeten entstammen – aber passt sie auch zu den wissenschaftlichen Befunden? Mein eigener Versuch, diese Frage zu beantworten, begann mit einer aufrüttelnden Studie, auf die ich vor ungefähr zehn Jahren bei der Vorbereitung auf das Seminar über die Psychologie der Geschlechter stieß.
Wussten Sie, dass dreißig Minuten Stress genügen, um das »Geschlecht« bestimmter Hirnregionen von männlich zu weiblich und umgekehrt zu verändern? Auch mir war das nicht klar gewesen. Die Lektüre dieser Studie veranlasste mich zu jahrelanger, umfangreicher Forschung, die das, was ich über Geschlecht, Gender und Gehirn dachte, vollkommen auf den Kopf stellte.
Nachdem ich Hunderte Hirnscans ausgewertet hatte, wurde mir bewusst, dass geschlechtsspezifische Unterschiede sich bei Individuen nicht einheitlich zu einem »männlichen« oder »weiblichen« Gehirn ergänzen. Man beachte, dass ich nicht behaupte, zwischen weiblichen und männlichen Gehirnen würden keine Unterschiede bestehen; ganz im Gegenteil, mein Team hat, genau wie viele andere, zahlreiche solcher Unterschiede dokumentiert. Was ich sagen will: Diese Unterschiede verbinden sich in jedem Gehirn zu einem einzigartigen Mosaik von Merkmalen, wovon einige häufiger bei Frauen auftauchen und andere bei Männern. Dieses Verständnis geht einher mit etwas, das viele Menschen sicher bereits wissen: Wir alle besitzen ein Patchwork aus »femininen« und »maskulinen« Charakterzügen. Aber meine Auffassung geht noch darüber hinaus, sie legt nahe, dass es so etwas wie ein »männliches« oder »weibliches« Gehirn nicht gibt – und entsprechend auch keine »männliche« oder »weibliche« Natur.
Bevor ich erläutere, wie ich zu der Idee des Gehirns als Mosaik kam und was das bedeuten könnte, möchte ich einige spannende Tatsachen über die Gehirne von Männern und Frauen vorstellen und zeigen, wie sich die Wahrnehmung dieser Fakten über die vergangenen Jahrhunderte hinweg gewandelt hat.
Kapitel 2Eine Geschichte verdrehter Tatsachen
Als im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert überall in Europa egalitäre Ideen zu zirkulieren begannen, standen die Männer vor einem peinlichen Dilemma. Die neuen Prinzipien implizierten, dass alle Menschen, Frauen und Männer, von Natur aus gleich seien. Dieser Gedanke gefährdete die bestehende soziale Ordnung, in der Frauen ausschließlich in unterlegenen Rollen anzutreffen waren. Man befürchtete, Gleichberechtigung würde die Grundpfeiler der Gesellschaft ins Wanken bringen – und vor allem, dass gleichberechtigte Frauen den Männern nicht mehr zu Diensten stehen würden.
Molière parodierte diese Ängste 1672 in seiner Komödie Die gelehrten Frauen. Darin wettert der Ehemann gegen seine Frau und alle anderen, die sich mehr für die Wissenschaft als für ihre häuslichen Aufgaben interessieren: »[S]ie schreibt und träumt nur noch von Büchermacherei; kein Feld der Wissenschaft ist ihr zu hoch und tief […] man weiß, wo jeder Stern auf seiner Bahn hinfliegt, Venus, Saturn und Mars […] und mit dem ganzen Kram, den man im All studiert, weiß keine, was zur Zeit im Suppentopf passiert.«2
Die Wissenschaft war herausgefordert, den politischen Streit über die Rolle der Frauen in einer egalitären Gesellschaft zu lösen. In Schöne Geister schreibt Londa Schiebinger von der Stanford University, die Mission sei gewesen zu zeigen, dass nicht die Männer, sondern die Natur für die Ungleichheit der Geschlechter verantwortlich war. Schiebinger legt dar, wie die wissenschaftliche Erforschung der weiblichen und männlichen Anatomie – auch der Gehirne – zu einer politischen Angelegenheit wurde. Ohne das Axiom der Gleichberechtigung aufzugeben, beschäftigte man sich in medizinischen und wissenschaftlichen Kreisen zunehmend mit den Unterschieden zwischen den Geschlechtern. »Von nun an galten die Frauen im Verhältnis zum Mann nicht mehr einfach als minderwertig, sondern als fundamental verschieden und somit als nicht mehr mit ihm vergleichbar«, schreibt sie.3
Die geschlechtlichen Unterschiede zwischen Frauen und Männern sind offensichtlich, aber unterscheiden sich ihre Körper insgesamt und auch ihre Gehirne? Es stand eine Menge auf dem Spiel: Bejahte man diese Frage, konnte dies dazu verwendet werden, die ungleiche soziale Stellung von Frau und Mann zu begründen; eine Verneinung würde nahelegen, dass Frauen jahrhundertelang ungerechtfertigt unterdrückt worden waren und es großer gesellschaftlicher Umwälzungen bedurfte. Viele Philosophen und andere Denker – nahezu ausnahmslos Männer – tendierten dazu, das Ausmaß der Unterschiede so groß wie möglich zu fassen. Schiebinger zitiert einen französischen Mediziner aus dem achtzehnten Jahrhundert mit den Worten, die Natur mache »durch die besondere Form, die sie den Knochen der Frau gegeben hat, erkennbar, daß der Geschlechterunterschied sich nicht nur in ein paar wenigen oberflächlichen Unterschieden ausprägt, sondern vielleicht das Ergebnis von Unterschieden ist, die so zahlreich sind wie die Organe des menschlichen Körpers.«4
Die Wissenschaft wurde zum Austragungsort, wie geschaffen, um solche Debatten zu führen und zu entscheiden. Im Gegensatz zur Religion, die das Problem hatte, dass sie bis zur naturwissenschaftlichen Revolution der Neuzeit die Minderwertigkeit der Frauen vertreten hatte, galt die Wissenschaft als unparteiisch und insofern geeignet, objektive Argumente im Streit um die Fähigkeiten der Frauen zu liefern. »Vielleicht würde das Messer des Anatomen auch den Unterschied der Geschlechter freilegen und seine Grenzen endgültig umreißen«, schreibt Schiebinger, »vielleicht stellte sich heraus, daß alle Unterschiede, bis hin zu den geistigen, tatsächlich wäg- und meßbar waren.«5
In der Tat, schreibt Stephanie Shields von der Pennsylvania States University, wurden das Wiegen und Vermessen des Schädels und später des Gehirns – das inzwischen als Sitz des Geistes etabliert war – äußerst wichtig.6 Im alten Griechenland hatte Galen die Hoden für den edelsten Körperteil gehalten – was absolut sinnvoll schien, weil sie nur beim »überlegenen« Geschlecht zu finden waren. Aber im siebzehnten Jahrhundert wurde das Gehirn als das vortrefflichste und göttlichste Organ angesehen: Sitz der Sinne, des Verstands und des Urteilsvermögens. Daher war es absolut notwendig zu beweisen, dass Männer die leistungsstärkeren Gehirne hatten.
Anfangs schien das eine leichte Aufgabe zu sein. Der Schädel – von dem man die Größe des Gehirns ableiten zu können glaubte – war bei Frauen im Durchschnitt kleiner als bei Männern. Wie hätte sich die Minderwertigkeit der Frauen besser erklären lassen (nun, abgesehen davon, dass sie keine Hoden besaßen)?
Aber man hatte sich zu früh gefreut. Schließlich besitzt eine ganze Reihe von Tieren größere Schädel als wir. Die von Pottwalen zum Beispiel sind um einiges größer als die von Menschen. Wissenschaftler, die die Überlegenheit von Männern gegenüber Frauen beweisen wollten – aber sicher nicht die von Pottwalen gegenüber Menschen – suchten nach einem Weg, diese unbequeme Tatsache zu umgehen. Sie schlugen vor, dass vielleicht nicht die Größe des Schädels, sondern das Verhältnis von Schädel- zu Körpergröße entscheidend sei.
Doch auch damit erhielt man nicht die gewünschten Ergebnisse. Ja, schlimmer noch, einige Wissenschaftler fanden tatsächlich heraus, dass die Schädel von Frauen in Relation zum Gesamtgewicht ihres Körpers größer waren als die von Männern. Daraus schlossen diese Wissenschaftler jedoch keineswegs, dass Frauen deshalb intelligenter wären. Weiterhin unbeirrt auf der Jagd nach »wissenschaftlichen« Beweisen für die Dominanz des Mannes, legten einige Forscher ihre Ergebnisse so aus, dass sie die geringere Intelligenz der Frau bewiesen. Frauen, so behaupteten sie, ähnelten Kindern, deren Schädel im Verhältnis zu ihrer Körpergröße ebenfalls ziemlich groß sind, was nur bedeuten konnte, dass Frauen weniger entwickelt und demzufolge intellektuell weniger qualifiziert waren als Männer.
Wenn ich heute auf die Geschichte der Hirnforschung zurückblicke, bin ich beeindruckt von der Kreativität, mit der wissenschaftliche Fakten verdreht wurden, um einer gesellschaftlichen oder politischen Agenda zu dienen. Gefiel Wissenschaftlern nicht, was sie herausfanden, interpretierten sie es häufig einfach anders oder nahmen Abstand von dem Messverfahren, welches das unerwünschte Resultat hervorgebracht hatte, und suchten stattdessen nach »besseren« Methoden. Shields zufolge wurden Berge von Papier im Streit über »richtige« Messungen für die Schädelgrößen von Männern und Frauen vollgeschrieben. War es das Verhältnis von Schädel- zu Körpergewicht? Oder war es eine Frage der Knochendichte des Schädels im Vergleich zum übrigen Skelett? Das Problem erwies sich als unlösbar: Bei bestimmten Verfahren waren die Ergebnisse »günstiger« für die Männer, bei anderen für die Frauen.
Die Vorstellung, dass größer besser ist, blieb weiterhin populär, als Wissenschaftler entdeckten, dass nicht nur der Schädel, sondern auch das Gehirn bei Männern durchschnittlich größer war als bei Frauen. Paul Broca, bedeutender Neurowissenschaftler des neunzehnten Jahrhunderts, gehörte zu denen, die sich diplomatischer ausdrückten, aber auch er vertrat entschieden diese Ansicht: »Wir können uns fragen, ob die geringe Größe des weiblichen Gehirns ausschließlich mit ihrer geringen Körpergröße zusammenhängt«, schrieb er 1861 in einem Wissenschaftsmagazin. »Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Frauen durchschnittlich etwas weniger intelligent sind als Männer, ein Unterschied, den wir zwar nicht überbetonen sollten, der aber dennoch existiert.«7 Der prominente Evolutionsbiologe George Romanes sagte es unverblümter: Die geringere Größe des weiblichen Gehirns sei verantwortlich für die geistige Unfähigkeit der Frauen, schrieb er 1887, was »sich überdeutlich in dem vergleichsweisen Mangel an Originalität zeigt, insbesondere bei intellektueller Arbeit auf höherem Niveau.«8 Theodor von Bischoff, ein angesehener Biologe im neunzehnten Jahrhundert, ging sogar so weit zu behaupten, dass Frauen wegen ihrer kleinen Gehirne nicht die notwendigen geistigen Fähigkeiten für ein Studium besäßen und dass zu viel Bildung die Entwicklung der reproduktiven Organe heranwachsender Mädchen behindern könne.9
Diese älteren Versionen des Glaubens, weibliche und männliche Gehirne würden sich fundamental unterscheiden, erscheinen uns heute absurd. Heutzutage, da Frauen Männern in so vielen Studienbereichen zahlenmäßig überlegen sind, erscheint es absurd, dass Wissenschaftler glauben konnten, Frauen seien aufgrund der Größe ihres Gehirns ungeeignet, eine Universität zu besuchen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Es ist nach wie vor so, dass weibliche Gehirne durchschnittlich kleiner sind als männliche. Geändert haben sich nicht die Gehirne, sondern die gesellschaftlichen Normen, die Frauen einst verboten oder sie davon abhielten zu studieren.
Während das Thema der Größe des Gehirns ein Eigenleben entwickelte, hatte sich die Suche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, die die Überlegenheit des männlichen über das weibliche Geschlecht beweisen sollten, in der Zwischenzeit auf ein neues Feld verlagert. Nachdem im neunzehnten Jahrhundert entdeckt worden war, dass verschiedene Hirnregionen unterschiedliche Funktionen haben, begannen Forscher, diese Regionen bei Frauen und Männern zu vergleichen. Es überrascht kaum, dass sie auch hier anatomischen Rückhalt für die höhere Intelligenz von Männern fanden.10
Ein großer Teil der Aufmerksamkeit richtete sich auf den Cortex, da dieser äußere Teil des Gehirns verantwortlich ist für bewusstes Handeln, Perzeption, Kognition, Sprache und Gedanken. Er besteht aus der sogenannten grauen Substanz, die Milliarden Nervenzellkörper enthält – die Neuronen. Unter dem Cortex befindet sich eine Schicht weißer Substanz, die hauptsächlich aus den Fasern besteht, welche die Neuronen verbinden. Der Cortex wird traditionell in vier Hauptlappen unterteilt, benannt nach den Schädelknochen, die sie schützen.
Als die Rolle des Frontallappens bei kognitiven Funktionen entdeckt wurde, wiesen viele Neurowissenschaftler rasch darauf hin, dass diese Lappen bei Männern größer und weiter entwickelt waren als bei Frauen. Dann behaupteten einige Neurowissenschaftler, der Sitz des Intellekts befinde sich in den Parietallappen an der Oberseite des Gehirns und nicht in den Frontallappen. Nun, da die Parietallappen für wichtiger erachtet wurden, revidierten einige Wissenschaftler prompt die Interpretation der anatomischen Befunde, sodass sie der allgemein anerkannten Vorstellung über die männliche Überlegenheit entsprachen.11 Im Jahr 1895 zum Beispiel schrieb der amerikanische Psychologe George Thomas White Patrick in der Popular Science Monthly, dass »die Frontalregion nicht, wie bisher angenommen, bei Frauen kleiner, sondern relativ gesehen größer ist […] Aber […] eine besonders ausgeprägte Frontalregion deutet keineswegs auf intellektuelle Dominanz hin […] in Wahrheit ist die Parietalregion die wichtigere.«12
Über hundert Jahre sind vergangen, seit diese Worte geschrieben wurden. In dieser Zeit haben Neurowissenschaftler*innen weitere Unterschiede zwischen den Gehirnen von männlichen und weiblichen Tieren und Menschen gefunden. Ich werde im nächsten Kapitel näher auf sie eingehen, hier aber vorweg ein paar Beispiele. Ein Großteil des Cortex ist im Durchschnitt bei Männern dünner als bei Frauen; Männer besitzen im Mittel einen geringeren Anteil an grauer Substanz und einen höheren an weißer Substanz. Hinzu kommt, dass Männer voluminösere Ventrikel haben – mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume in der Mitte des Gehirns (dies sind die dunklen Bereiche, die man auf medizinischen Scans sieht). Leser, die sich gefreut haben, dass Männer größere Gehirne als Frauen besitzen, sind vielleicht enttäuscht, dass bei Männern auch die Hohlräume größer sind.
Wenn Sie glauben – wie es die Wissenschaftler im neunzehnten Jahrhundert taten –, dass die Größe des Gehirns ausschlaggebend ist, ist es in der Tat seltsam zu erfahren, dass das größere Gehirn zugleich – wie soll ich es sagen? – mehr Leerstellen aufweist. Aber die Botschaft, die ich hier vermitteln möchte, ist, dass beide Geschlechter keinerlei Grund zur Beunruhigung haben. Männer kommen mit ihren größeren Ventrikeln genauso gut zurecht wie Frauen mit ihren kleineren Gehirnen.
Was in der Tat beunruhigend ist: Nach wie vor werden die Unterschiede zwischen den Geschlechtern herangezogen, um die fehlende Gleichberechtigung zwischen ihnen zu rechtfertigen. Heutzutage würde es niemand mehr wagen, auf biologische Vergleiche zwischen Ethnien oder sozialen Schichten zurückzugreifen, um Rassismus oder den ökonomischen Status der Armen zu verteidigen – wie es bis zum zwanzigsten Jahrhundert getan wurde –, aber immer noch werden die Unterschiede zwischen den Gehirnen von Mann und Frau bemüht, um die untergeordnete Stellung der Frau zu begründen. So drückt Schiebinger es aus: »Der angebliche Defekt weiblicher Gehirne hat sich über die Zeiten verändert: Im späten 18. Jahrhundert nahm man an, daß die weibliche Schädelhöhle zu klein sei, um ein leistungsfähiges Gehirn zu bergen; im 19. Jahrhundert behauptete man, daß übermäßige Gedankentätigkeit die Eierstöcke der Frauen verkümmern ließe. In unserem Jahrhundert [gemeint ist das zwanzigste] wurde die These aufgestellt, daß Besonderheiten in der rechten Gehirnhälfte Frauen möglicherweise unfähig machten, räumliche Verhältnisse wiederzugeben.«13 Im einundzwanzigsten Jahrhundert geht die Suche nach dem »entscheidenden« Unterschied zwischen dem männlichen und dem weiblichen Gehirn weiter, und sie steht allzu häufig im Einklang mit historischen Mythen über die Verschiedenheit der Geschlechter.
Kapitel 3Die Unterschiede häufen sich
Vor einigen Jahren nahm ich an einer wissenschaftlichen Diskussion teil: »SeX X oder SeX Y: Ein Dialog über das weibliche und das männliche Gehirn«. Sie fand im Rahmen eines neurowissenschaftlichen Symposiums an der Standford University statt.14 Meine Diskussionspartnerin Louann Brizendine argumentierte, Frauen seien Frauen, weil sie ein weibliches Gehirn besäßen, und Männer seien Männer, weil ihr Gehirn männlich sei – eine Position, die sie auch in ihren Büchern vertritt, die sich bestens verkaufen. Ich legte meine eigene Meinung dar, dass Menschen und ihre Gehirne aus einzigartigen Mosaiken »weiblicher« und »männlicher« Merkmale zusammengesetzt seien. Nach der Diskussion hörte ich, wie jemand zu einer der Organisatorinnen sagte: »Das Problem ist, dass Louann ein weibliches Gehirn hat und Daphna ein männliches.« Diese Person wollte damit wahrscheinlich sagen, dass Brizendine und ich wegen unserer unterschiedlichen Argumentationsstile nicht gut zusammen auftreten konnten.
Aber hier ist die Ironie. Diese Bemerkung untergrub die Ansicht, die Brizendine und viele andere vertreten – dass das männliche Gehirn durch den Einfluss eines hohen Testosteronspiegels im Mutterleib und im späteren Leben entstehe, wohingegen das weibliche Gehirn praktisch das Standardmodell sei, das sich bei niedrigem Testosteronspiegel im Mutterleib bilde und im weiteren Leben durch »weibliche« Hormone geprägt werde. Wenn das der Fall wäre, wie um Himmels willen hätte ich als typisch weiblich entwickelte Frau, die später durch drei Schwangerschaften und insgesamt drei Jahre des Stillens hohen Mengen »weiblicher« Hormone ausgesetzt war, ein männliches Gehirn besitzen sollen?
Ironie beiseite, die Überzeugung »männliche Gehirne sind so und weibliche so« ist nach wie vor ungeheuer weit verbreitet, in der Wissenschaft ebenso wie in der breiten Öffentlichkeit. Heute – genau wie in vergangenen Jahrhunderten – herrscht die allgemeine Überzeugung, dass die Unterschiede zwischen den Gehirnen von Männern und Frauen ursächlich für angebliche fundamentale Differenzen zwischen den Geschlechtern sind. Kein Wunder, dass dieses Forschungsgebiet so intensiv beackert wird. Ein Forschungsüberblick über wissenschaftliche Literatur, der 2014 in Neuroscience & Biobehavioral Reviews veröffentlicht wurde, listete 5600 Studien des vergangenen Vierteljahrhunderts, in denen das Volumen und die Dichte verschiedener Hirnregionen von Männern und Frauen verglichen wurden.15
Inzwischen wurden Hunderte von vermeintlich geschlechtsbedingten Unterschieden im Gehirn entdeckt. Die Gehirne von Frauen und Männern divergieren sowohl in der Gesamtgröße als auch in der Größe bestimmter Regionen. (Viele der letztgenannten Unterschiede lösen sich auf, wenn man die Gesamtgröße des Gehirns berücksichtigt, andere werden abgeschwächt oder umgekehrt – das heißt, eine Region mag im Durchschnitt bei Frauen kleiner sein, kann aber relativ zur Größe ihres Gehirns dennoch größer sein.)16 Der technologische Fortschritt erlaubt es Forscher*innen, zunehmend tiefer und detaillierter in das Innere des Gehirns vorzudringen, und so wurden Unterschiede zwischen den Geschlechtern auch in verschiedenen Systemen chemischer Botenstoffe, sogenannter Neurotransmitter, entdeckt. Darüber hinaus wurden Unterschiede in der Mikroanatomie des Gehirns festgestellt – in der neuronalen Struktur und der Dichte der Rezeptoren, jener Moleküle, welche die Neurotransmitter binden.
Man beachte, dass dies alles durchschnittliche Unterschiede sind – sie treten in Erscheinung, wenn Frauen und Männer als Gruppen verglichen werden, jedoch nicht notwendigerweise, wenn man die Individuen vergleicht. Wir können zum Beispiel feststellen, dass eine bestimmte Hirnregion im Durchschnitt bei der männlichen Gruppe größer ist als bei der weiblichen. Aber wenn wir uns die Individuen anschauen, werden wir ziemlich viele Übereinstimmungen entdecken – nämlich, dass dieser Teil des Gehirns bei vielen Frauen und Männern gleich groß ist; zudem wird er bei einigen Frauen groß, bei einigen Männern hingegen klein sein. Das gilt für die meisten bekannten Differenzen in der Gehirnstruktur beider Geschlechter. Die durchschnittlichen Verschiedenheiten sind gering, und es bestehen viele Gemeinsamkeiten zwischen Männern und Frauen.17
Einige Wissenschaftler*innen behaupten jedoch, die Gehirnstruktur möge sich zwar nur geringfügig unterscheiden, dennoch könnte dies verantwortlich für größere Unterschiede in der Funktion des Gehirns sein, mit anderen Worten: Die Gehirne von Frauen und Männern, obgleich strukturell ähnlich, könnten unterschiedlich funktionieren. Das ist der Hintergrund von Studien, die darauf abzielen, geschlechtsgebundene Abweichungen in den Mustern der Gehirnaktivität bei verschiedenen geistigen Aufgaben zu entdecken.
In Wirklichkeit sind die Muster der Hirntätigkeit bei Frauen und Männern ähnlich. Viele Studien, die darauf ausgelegt waren, derartige Unterschiede zu finden, blieben ergebnislos. Wurde doch einmal einer entdeckt, dann in der Regel in der Funktion einzelner Hirnregionen, die an der Durchführung der Aufgabe beteiligt waren, während andere bei beiden Geschlechtern in ähnlicher Weise aktiviert waren. Das Problem ist, dass diese Gleichförmigkeit in den meisten Fällen nicht erwähnt wird, wohingegen die Unterschiede sowohl in wissenschaftlichen als auch allgemeinen Medien viel Aufmerksamkeit bekommen.
Genau dies geschah mit einer verbreiteten Theorie: Frauen würden beim Verarbeiten von Sprache stärker als Männer beide Gehirnhälften benutzen. In einer 1995 in Nature publizierten Studie verwendeten Forscher*innen der Yale University zum Beispiel eine Methode, die funktionelle Magnetresonanztomografie genannt wird, um die Hirnaktivität von neunzehn Frauen und neunzehn Männern zu messen, die drei sprachbezogene Aufgaben erfüllen mussten.18 In ihrem wissenschaftlichen Aufsatz schenkten die Forscher*innen den beiden Aufgaben, bei denen sie keine Differenzen zwischen Männern und Frauen feststellten – Buchstabenerkennen und Wörter nach Bedeutung in Gruppen ordnen –, wenig Beachtung. Stattdessen berichteten sie detailliert über die dritte Aufgabe – Reimen –, bei der sie einen geschlechtsspezifischen Unterschied feststellten: Männer aktivieren eine Reihe von Hirnregionen der linken Gehirnhälfte, während Frauen dieselben Regionen auf beiden Seiten aktivieren. Die Gehirnscans für das Reimen, bei denen divergierende Muster sichtbar wurden, waren dem Aufsatz hinzugefügt worden, die Scans für die anderen beiden Aufgaben nicht.
Die Studie erzeugte viel Wirbel – sie passte gut zu den Stereotypen der Geschlechterunterschiede, die angeblich so weit reichen, dass sogar die Gehirne von Frauen und Männern anders mit bestimmten Aufgaben umgehen. Manche werden sich an die Schlagzeilen und Fernsehberichte erinnern. Hier ein recht dramatisches Beispiel aus der New York Times: »Studie enthüllt: Männer und Frauen benutzen Gehirn unterschiedlich.«
Eine Reihe weiterer Studien zeigte keine konstanten Unterschiede in der Hirnaktivität bei Frauen und Männern, die verschiedene sprachbezogene Aufgaben durchführten. (Wie derart stark voneinander abweichende Ergebnisse entstehen, ist auch ein interessantes Thema; ich werde darauf in Kapitel 8 eingehen.) In dem Versuch, die Kontroverse zu lösen, untersuchten Wissenschaftlerinnen vom Medizinischen Zentrum der Universität Utrecht (UMC) die Resultate von sechsundzwanzig Studien zu dem Thema in einer Meta-Analyse. Ihr Fazit, 2008 in der Zeitschrift Brain Research veröffentlicht, lautete, dass kein Beweis für geschlechtsgebundene Unterschiede in der Verarbeitung von Sprache erbracht wurde.19 Erinnern Sie sich an Medienberichte dazu? Ich auch nicht.
Eine derart selektive Berichterstattung, in der die Unterschiede hervorgehoben und die Ähnlichkeiten ignoriert werden, geschieht in der Regel nicht bewusst. Sie geschieht, weil es viel interessanter ist, über Unterschiede zu schreiben als festzuhalten, dass keine entdeckt wurden. Letztendlich entsteht dadurch jedoch der Eindruck, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern viel größer sind, als es tatsächlich der Fall ist.
Indes argumentieren einige Wissenschaftler*innen, selbst wenn jeder einzelne Unterschied gering ist und es nur wenige von ihnen gibt, addierten sie sich zusammen doch zu einer großen Andersartigkeit von Frauen und Männern. Das ist es, was die meisten Menschen glauben, und sei es nur implizit. Deshalb wurde, als man in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr geschlechtsspezifische Varianten in puncto Gehirnstruktur und -funktion entdeckte, die Überzeugung immer stärker, es gäbe tatsächlich männliche und weibliche Gehirne. Alle hielten es für ausgemacht, dass diese Unterschiede zusammen zwei verschiedene Arten von Gehirnen ergäben, ein weibliches und ein männliches. Aber stimmt das?
In diesem Buch werde ich darlegen, weshalb ich denke, dass dies nicht der Fall ist. Bestimmte Merkmale unterscheiden sich, im Durchschnitt, zwischen Männern und Frauen, aber im Allgemeinen summieren sich Merkmale, die häufiger bei Frauen vorkommen, nicht einheitlich in jedem weiblichen Gehirn, genauso wenig wie sich die Eigenarten, die durchschnittlich eher bei Männern zu finden sind, bei jedem einzelnen Mann zeigen. Im Gegenteil, diese Unterschiede vermischen sich, sodass menschliche Gehirne – genau wie psychologische Charakteristika und Verhaltensweisen – Mosaike von Merkmalen darstellen, von denen einige vermehrt bei Frauen auftreten, andere bei Männern. Diese Schlussfolgerung hat nichts zu tun mit dem heiklen Thema, weshalb einige Merkmale bei einem Geschlecht verbreiteter sind als andere.
Kapitel 4Anlage oder Umwelt?
In einer Folge der BBC-Autosendung Top Gear, die ich zufällig sah, begleitete der Moderator ein Paar in den Vierzigern bei einer Probefahrt seiner Sportlimousine. Während der ganzen Fahrt ließ die zierliche, feminine Frau sich über die Kraftübertragung des Fahrzeugs aus, über den Hubraum und verschiedene andere technische Eigenschaften. Die Miene des Moderators, der ihrem äußerst sachkundigen Vortrag lauschte, veränderte sich von ungläubigem Staunen zu der eines gewieften Entertainers, dem es gelungen ist, seinem Publikum ein sprechendes Pferd vorzuführen.
In der Tat kennen Männer sich im Allgemeinen besser mit Autos aus als Frauen, und sie sind erfolgreicher darin, Automarken zu erkennen. Müssten wir das neuronale Netz für Auto-Expertentum identifizieren, würden wir vielleicht Unterschiede zwischen Männern und Frauen finden. Aber auch wenn das der Fall sein sollte, würde dies auf eine angeborene Differenz zwischen Mann und Frau hindeuten oder auf ein im Durchschnitt für die Dauer des Lebens unterschiedlich starkes Interesse an Autos?
Solche Fragen ergeben sich im Hinblick auf alle Unterschiede