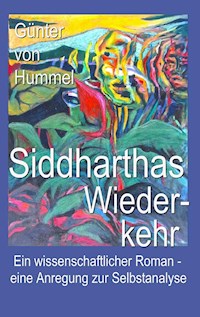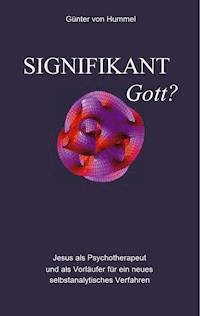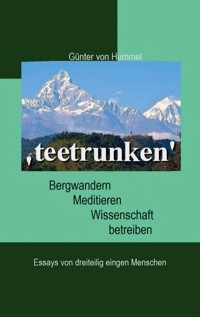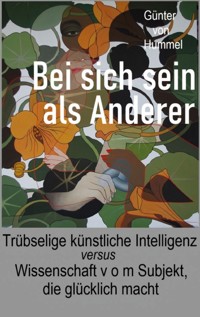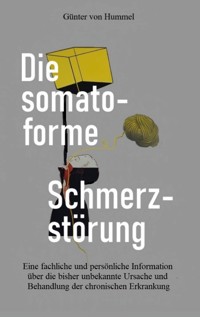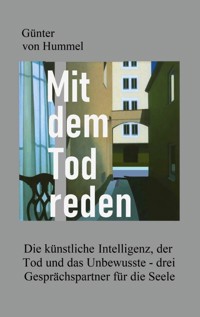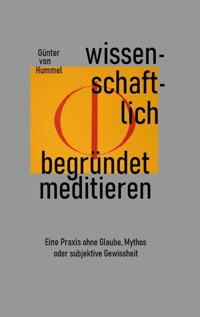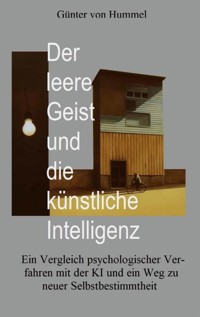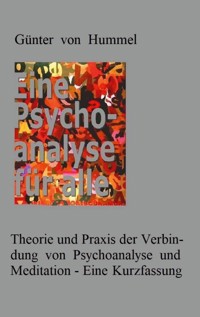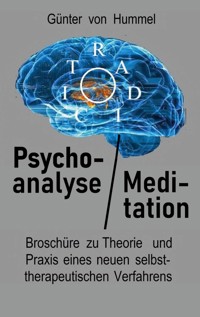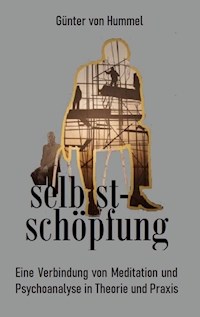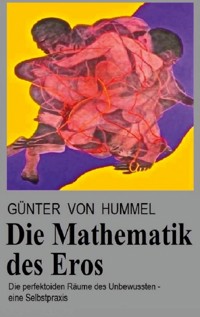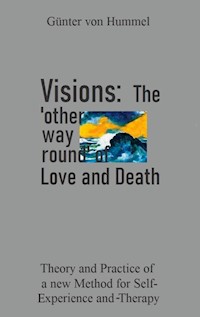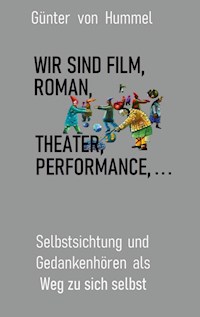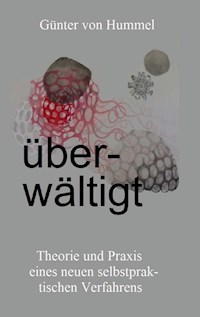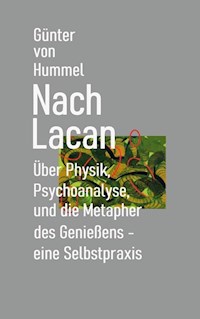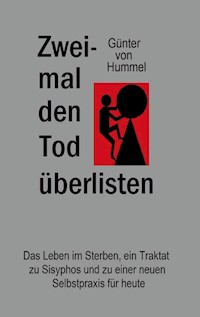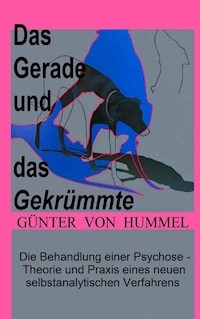
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch geht es um eine Psychoanalyse "!andersherum", mittels der auch komplexere psychische Erkrankungen und psychosomatische Störungen behandelbar sind. Anhand einer Fallgeschichte zeigt der Autor nicht nur den Erfolg der Behandlung auf, sondern erklärt auch Theorie und Praxis dieses etwas anders gearteten analytischen Verfahrens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theorie und Praxis eines neuen selbstanalytischen Verfahrens
Das Umschlagsbild von T. Heydecker zeigt exemplarisch für alle Lebewesen einen Hund in seiner Vielschichtig- und Schattenhaftigkeit, kurz: in seiner Mehrdimensionalität. So muss man sich auch die unbewusste Seele des Menschen vorstellen, die – laut dem Psychoanalytiker J. Lacan in ihrer topologischen Struktur verwunden, gestaucht, verwickelt und verzogen ist. Dennoch zeigt das Bild die Seele gerade in ihrer sich aufrichtenden, noch oben strebenden Gestaltung als Möglichkeit der Menschwerdung.
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
I.
DIE PSYCHOANALYSE VON STEFAN R.
I.1 Erste Stellungnahme zur Fallgeschichte
I.2 Versuch einer ersten Deutung
I.3 Psychoanalyse oder Mystik
II.
DER ANDERE UNSER SELBST
II.1 Der Schlag der Fremdheit
II.2 Eine Psychoanalyse des
Anderen
III.
DER DISKURS ALS SOLCHER
III.1 Praktische Anwendung
III.2
Pass-Worte
, gerade und gekrümmt
III.3
Analytische Psychokatharsis
Nachwort
LITERATURVERZEICHNIS
„Während jene als verrückt gelten, die den Verlust der menschlichen Werte nicht mehr ertragen, wird denen Normalität bescheinigt, die sich von ihren menschlichen Wurzeln getrennt haben“ (Arno Gruen)
VORWORT
„Schneeblumenscharte, Kindstagstraum und Märzschmelze, die hereinbricht mit endlosen Tagen. . . später dann hieß es: ‚ist für uns gestorben, was heißt für uns? Wer sagt das? Die Theologen? Für uns Kinder jedenfalls nicht. Ich habe gelesen, dass der Tod ein Skandal ist, ein Skandalon, eine Schande . . . schade . . . .“
,,Spreche ich so? So geartet, geh´ artig, A- r - Tick? Wir taumelten durch, traumverspielt. . . ja selbst geträumt, gedacht, nachtgemacht . . Aber um was geht es eigentlich? Ich kann mit der Welt nichts mehr anfangen. Ich passe nicht hierher. Ich habe nie hierher gepasst. Ich will auch nicht hierher passen. Meine Kindheit ist an mir vorübergegangen wie ein eigenartiger Film. Ein Heimatfilm, eine Berg-, Waldwege- und Feldwiesenschnulze. Wie ein Plot von gekrümmten, halbstummen, schlichten, schlichtest-schlichten und einfachst-einfachen Menschen. Ich habe keinen Raum für die Zeit und keine Zeit für den Raum mehr. Und nichts für niemand . .?“
So beginnen die ersten Seiten tagebuchartiger Notizen des 42-jährigen psychisch verstörten Stefan R., der im Januar 1985 zu mir in psychoanalytische Behandlung kam, die ich unter dem Gesichtspunkt eines ganz einfachen Konzeptes darstellen will. Die psychoanalytische Behandlung von ‚Psychosen’1 ist bis heute umstritten, obwohl es vor allem in neuerer Zeit zahlreiche Veröffentlichungen dazu gibt. Aber die meisten dieser Arbeiten beschäftigen sich mit der Theorie, und die Praxis, vor allem der praktische Effekt nach langer Behandlungs- und Beobachtungszeit, bleibt offen. Zudem sind die Behandlungskonzepte (mehr lerntherapeutische oder mehr psychoanalytische) sehr widersprüchlich. Freud hatte festgestellt, dass ‘Psychosen’ psychoanalytisch nicht behandelbar sind, weil der „psychotisch“ Kranke keine Übertragung aufweise. Unter Übertragung versteht man in der Psychoanalyse den Vorgang einer Verschiebung, Aktualisierung und Verdichtung von Bedeutungen, die der Patient in Richtung auf die Person des Psychoanalytikers vornimmt. Sie ist das wesentlichste Element in der psychoanalytischen Behandlung, weil der Therapeut damit in der Lage ist, nicht nur das vom Patienten Erzählte als Faktisches, als bare Münze, als gradlinig zu nehmen, sondern die in diesem Erzählten auf seine Person übertragenen Bedeutungen zu interpretieren, zu erhellen und bewusst zu machen. Es handelt sich dadurch um einen völlig anderen Vorgang als er bei einem üblichen Gespräch stattfindet. Statt einer gradlinigen Unterhaltung, wo ein Aspekt den nächsten ergibt, findet ein gekrümmter, kontrapunktischer, querdenkerischer Dialog statt, in dem mehr etwas enthüllt als kommuniziert wird.
Der französische Psychoanalytiker J. Lacan geht sogar so weit zu sagen, dass, „wenn das Sprechen als Vermittlung fungiert [also als Kommunikation] so deswegen, weil es sich nicht als Enthüllung erfüllt hat.“ D. h. wir reden ständig nur um den heißen Brei herum oder aneinander vorbei, weil wir im Grunde genommen nicht echt und enthüllend miteinander sprechen. Wir teilen vielleicht jemanden etwas mit, aber nicht uns selbst. In der analytischen Sitzung wird dies dann durch das Äußern freier Einfälle und deren Deutung nachgeholt. Im Fall einer ‚Psychose‘ sind die Dinge natürlich etwas anders zu sehen. Dennoch geht es auch hier genau um diesen Punkt, denn in der ‚Psychose‘ steht das enthüllende Sprechen schon von vornherein im Vordergrund. Nur enthüllt der in dieser Weise psychisch Kranke genauso wie wir die Dinge nicht so, dass sie gleich verständlich sind, und vor allem ist er auch oft nicht gewillt, mit uns am besseren Verständnis zu arbeiten. Oft ist ihm ja auch sein eigenes Sprechen unverständlich, denn meistens sind – wie er sagt – selbst die „Stimmen“, die er manchmal hört, nur „verstellt“.
Doch was hieße wirklich Verständnis? Eine Eins z. B. ist nicht einfach von sich aus eine Eins, vielmehr „repräsentiert eine Eins“, so die Lacansche Mathematik, „eine Null für eine andere Eins.“2 Ich als die eine Eins war in gewisser Weise eine Null für Stefan R., dieser zweiten Eins, und natürlich auch umgekehrt. Aber trotz dieser recht krassen Abstraktion ergibt sich auf diese Weise dennoch eine Mathematik! Denn die Herstellung des Null-Eins-Abstandes ist für die Mathematik – und so war es auch für uns – seit jeher große Leistung! Dieser Abstand ist nicht einfach natur- oder gottgegeben. Auch wenn jeder für den anderen – und selbstverständlich nur in gewisser Weise – eine Null repräsentiert, so war jeder sich doch des gegenseitigen Null-Eins-Abstandes gewiss, und damit kann man zu zählen anfangen! Auch die Null ist ja nicht Nichts, sie stützt ja diesen Abstand, und wenn man zusammenblieb um doch wenigstens etwas Arithmetik zu betreiben, war schon sehr viel gewonnen. Verständnis ist nicht alles. Mathematik ist vielleicht mehr als Verständnis.
Dass man das Sprechen nicht versteht, passiert schließlich ständig im Leben und auch in den normalen Psychoanalysen, wo „frei“ – und das heißt ja oft: unzusammenhängend – „assoziiert“ werden soll. Doch dafür lässt sich dann anschließend normal über diese „freien Einfälle“ diskutieren. Es liegt beiden Situationen, im Leben und in den Psychoanalysen, das gleiche und von Freud „unbewusst“ genannte Denken zugrunde, das – so könnte ich sagen – eben gekrümmt / gerade ist,3 und das man also gut mit diesem Schrägstrich (oder wie man modernerweise sagt: slash) schreiben kann (ich habe es – wenn man es perfekt gekrümmt / gerade gebraucht – an anderer Stelle auch das konjekturale Denken genannt4).
„Warum muss man immer denken, warum hört das Denken nicht auf? Das Denken denkt sich selbst immer weiter, es will sich fortpflanzen, sich vermehren, es will alles zuwuchern, zuschütten, nur um selbst immer weiter denken zu können. Das Denken ist die Hölle und die Menschen tun nichts anderes als den Gedanken zu glauben, als ihnen zu huldigen, als sie anzubeten mit immer neuem Denken. Das Denken ist die Krankheit nicht ich . . .“
Die Psychoanalytikerin C. Schmidt-Hellerau hat in ihrer Veröffentlichung vom „Entwurf“ Freuds ausgehend5 und neurowissenschaftliche Aspekte einbeziehend ein nicht ausgesprochen mechanisches, aber doch strikt formales Modell der gesamten Freudschen Lehre vorgelegt, das – genau in diesem gerade / gekrümmten Sinne – widerspruchsfrei funktioniert.6 Für das Vorhaben meines Buches hier erweist sich dieses Formale als besonders nützlich, denn wenn es auch manchmal recht gekrümmt ist, muss es doch wenigstens formal klar sein, und d. h. also doch wieder etwas gerade gebogen. Freud folgend postuliert Schmidt-Hellerau zwei Grundphänomene, „Grundvariable“, des Modells. Die eine ist in Form der Triebe gegeben, die von „innen“ des Psychismus nach außen wirken, die andere in Form der Hemmung, der „Verdrängung“, die von außen nach innen wirkt. Beide sind durch „Schalter“ und „Regler“ (Freud sprach von Kontaktschranken und anderen Reglermechanismen) verknüpft, „verschaltet“. Der Begriff Trieb – dies sollte ich gleich vermerken – hat nichts mit dem tierischen Instinkt zu tun, vielmehr handelt es sich um unbewusste Strebungen, Begehren, Tendenzen, die einen aktiv treibenden Charakter haben (und auch das sind nur vorläufige Bestimmungen). Freud nannte die Triebe konstante Kräfte, es bestehen also keine „triebhaften“ Impulse.
Soweit also der Ausgangspunkt, der, was dieses Buch angeht, auch schon genügt, um uns als vollwertiges Rüstzeug für ein neues – besser eigentlich nur: neu formuliertes – therapeutisches Verfahren zu dienen, das gerades und gekrümmtes Denken in sich einschließt, ja in sehr vereinfachter Weise kombiniert. Ich will anhand einer Fallgeschichte zeigen, wie es damit gelungen ist, die ‚Psychose‘ des gerade oben zitierten Stefan R. zu behandeln. Denn wenn auch die erwähnten modernen Autoren mit den komplexen Instrumenten der „Selbst- und Objektbeziehungsrepräsentanzen“ erfolgreich arbeiten, so wird doch in dieser Fallgeschichte ein direkteres und vereinfachtes Verfahren entwickelt, 7 das der Patient zum großen Teil auch alleine anwenden kann. Wie der Mathematiker und Psychoanalytiker A. Sciacchitano so schön sagt: Die Psychoanalyse heilt auch ohne Therapie.8 Zumindest ohne diesen immensen Aufwand hunderter Therapiestunden und verwirrender Theorien. Man muss nur im Gerade / Gekrümmt-Denken ein sehr formal enthüllendes Element einbauen, also damit denken und dann auch direkt sprechen lernen, von der Eins zur Null und wieder zurück zur anderen Eins, und wie dies geht, will ich noch ausführlich anhand der folgenden Geschichte erklären.
Das Problem mit dem schwierigen Verständnis gilt also inter- wie auch intrasubjektiv, denn es gibt etwas, das ständig von außen nach innen wirkt, und das ist mit dem, was von innen nach außen wirkt, verschaltet, verknüpft, also in komplexer Weise verbunden. Es gibt am Anfang einen Knoten, eine verknotete, kombinierte „Gerade-Gekrümmtheit“, und nicht, wie uns die Naturwissenschaften klar machen wollen, etwas starr Objektives: Objekte, Energie, Materie etc., also alles, was man objektiv greifen und messen kann. Oder etwas, was man mit einem einheitlichen, einheitsbewirkenden Begriff, den man schon vorher einführen muss, schließlich als Ergebnis herausbringt, wie es die Geisteswissenschaften versuchen. Sie führen z. B. den Begriff „Geist“ ein, und am Schluss erklären sie – sozusagen tautologisch – „Geist“ als das Ergebnis ihrer Wissenschaft. Sie haben die Eins und die Null schon in einem Begriff vereinnahmt ohne den so wichtigen Abstand der beiden zu erklären.
„Von dem Moment an, wo es auch ein Subjekt gibt, existiert ein Riss, eine Spaltung,“9 und damit ist es mit der Einheit erst mal vorbei. Wenn das Subjekt wichtig ist und wissenschaftlich angegangen werden muss, ist nichts mehr nur objektiv oder auch nur subjektiv. Dieser Knoten, diese Spaltung, dieses Gerade / Gekrümmte ist beim sogenannten ‚Psychotiker‘ also deutlicher zu sehen, auch wenn er es selbst vielleicht ganz besonders verleugnet. Aber im Grunde betrifft es jeden. Es ist eine conditio humana. Gewiss hat man – um nochmals zur Naturwissenschaft zu kommen – mit der Inflationstheorie des Universums oder mit dem Begriff der Quantengravitation etwas in die Naturwissenschaften eingeführt, das nur noch abstrakt zu erfassen ist, und das kann bedeuten: kein Proton, kein Neutron ist stets gesichert dem anderen gleich. Es kommt auf die Einbettung im Quantengravitationsfeld an,10 auf die Einschreibung in eine bestimmte mathematische Formulierung, ob es ein besonderes Proton ist oder nicht.
Mit anderen Worten: Wenn die Einheit, die in der Physik wirkt, an zwei Punkten zugleich sein kann, dann bekommt sie eine subjektbezogene, irrationale, höchstens noch mathematisch oder psychoanalytisch erfassbare gekrümmte Form.11 Ähnlich muss man also die esoterischen, mythischen und magischen Versuche verstehen, das Objekt / Subjekt-Problem zu lösen beispielsweise auch in der Homöopathie, deren in ihren Medikamenten wirkende „Information“ man auch auf etwas wie eine derartige Einschreibung, „Einbettung“12, Gekrümmtheit beziehen müsste, wenn sie als messbare
Einheit eben an zwei Punkten zugleich ist. Der Esoteriker müsste seine Essenz real verdoppeln, multiplizieren können, obwohl sie die gleiche bleibt. In gewisser Weise behaupten die Leute das auch, aber sie benutzen das Wort Energie nicht als messbare, an die Konstanz einer Ziffer gebundene Einheit, sondern als „Irgendwie-Energie“ (z. B. Bioenergie) und damit werden sie eben mystisch, magisch, enigmatisch, ungenau. Dennoch will ich alle diese Auffassungen nicht verteufeln, denn sie sind eine Eins, die nur eine Null für eine andere Eins repräsentiert, und damit müssen wir leben.13
„Eins und Eins ergibt Eins, denn wenn zwei sich addieren, bleiben sie dennoch einer Eins gleich. Ein mal Eins aber ist zwei, denn wenn zwei sich mal nehmen, mählen, vermählen, haben sie sich wirklich erkannt, wirklich gezählt, sind sie wirklich zwei Eine.“
Modern ausgedrückt: in all diesen Fällen sogenannter physikalischer „Verschränkungsexperimente“ wird „eine präzise Definition von ‚Messung‘ nicht gegeben. Das ist auch nicht möglich. Denn physikalisch gibt es keinen Unterschied zwischen einem Messprozess und einer beliebigen Interaktion. Ferner sind Messgeräte keine natürliche Art von Gegenständen, die in der Natur unabhängig von unseren Interessen vorkommen wie Elektronen, Sauerstoffatome, DNA-Sequenzen oder Katzen [bezieht sich auf die Theorie von ‚Schrödingers Katze‘]. Vielmehr können beliebige Dinge von Experimentatoren entsprechend ihren Absichten als Messgeräte verwendet werden.“ Und weiter: „Wenn man definitive numerische Werte für Eigenschaften für makroskopische Objekte anerkennt – wie etwa lebendig oder tot zu sein für Katzen – und wenn man die Quantenmechanik als vollständige Beschreibung der mikrophysikalischen Wirklichkeit anerkennt, dann muss man die Möglichkeit des Übergangs zu wohlbestimmten numerischen Werten in die Dynamik einbauen, die man für die Zeitentwicklung von Quantensystemen ansetzt.“14
Der Homöopath, Radiästhesist, Esoteriker muss also wenigstens im Sinne dieser Einschreibung mittels wohlbestimmter numerischer Energiewerte belegen können, wie gerade er als Subjekt der Wissenschaft (also außerhalb eines rein objektivierenden Vorgehens) diese Möglichkeit versteht. Dies ist bisher noch nicht geschehen.15 Das Gleiche gilt für die Geisteswissenschaftler und Theologen. Sie dürfen nicht das Wort Gott, Transzendenz oder Ethik benutzen, das schon von vornherein „wohlbestimmt“ ist, um es dann als Resultat ihrer Bemühungen gleichermaßen bestimmt wieder herauszugeben. Aber es ist üblicherweise der einzige Weg, den sie haben. Ich will in moderner wissenschaftlicher Weise zeigen, dass in der Psychoanalyse und davon abgeleitet in dem Geraden / Gekrümmten eine noch genau zu benennende und durchaus auch wohlbestimmte Einheit doch zu finden ist, die an zwei Punkten zugleich sein kann.16 Wo die Einsen sich selber gegenseitig als Einsen zählen gerade weil sie durch die Null haben hindurchgehen müssen.
„Die Atome sind nicht meine Welt, ich gehöre nicht zu ihnen und bestehe auch nicht daraus, ich bin ein Außer-Mir, ein Außer-Sich, ein Außer-Außen. Ich kann nicht lachen, umhergehen, in Freude sein und arbeiten wie alle hier lachen, umhergehen, arbeiten und in Freude sind, und die können es wieder nicht so sehen wie ich es sehe. Wir stimmen nicht überein. Woher die menschliche Substanz nehmen, die für alle gleich ist? Nicht einmal im Ein-heits-brei sind wir eine genaue Zahl, eins- oder zwei- oder- hunderttausend. Wir sind Keins, Kains – Wut-und Wundmenschen! Außer-Uns, Außer-Allen.“
„Was ist Seele und was Gehirn? Ich mag diesen ganzen Neuro-Psycho-Rigo-Plunder nicht. Ich würde gerne zürnend durch die Welt laufen, mit der Rage der Wahrheit, mit ‚. . . .‘ vom Zorn, von dem uns die Göttin in der Ileas singt, vom anklagenden Groll . . mit der Rage des Helden ist man immer auf der sicheren Seite.“
Noch stelle ich die Texte Stefan R.s einfach so in den Raum. Lange habe ich sie so gekrümmt stehen lassen müssen, bis ich – und auch er selbst – wir also irgendwann mehr damit anfangen konnten. Ein von mir geschätzter Psychoanalytiker, M. Krill,17 zitierte einmal als seine Auffassung über das Seelische Folgendes: „Seelisches Leben gründet auf einem molekular-anatomisch abgebildeten, sehr komplexen, äußerst plastisch formbaren Netzwerk mit teils hierarchischer, teils dezentralisierter Struktur und vorwiegend (zu 90 %) intrazerebral, intrapsychisch ablaufenden Informationsvermittlungen (Spitzer, Geist im Netz, 1996).“ Dagegen schreibt Stefan R.: „Die Seele ist das, was immer auf viele Orte verteilt ist. Immer ist die Seele Ich und ein Anderer, nie bin ich mich allein, nie hat der Andere mich für sich, Seele – Sich-Ander, Mich-Ander, Mä-Ander. . . .“ An mindestens zwei Stellen befindet sich die Seele also, wie auch ich nach dem oben Gesagten glaube (Eins von innen nach außen und Eins von außen nach innen), und was mir mehr einleuchtet, als die Definition von M. Krill und Spitzer. Denn „Seele“ und ihr Andere(s)(r), kurz und in Stefan R.s Terminologie: der Mich-Ander wäre die einzige Einheit, die an mehreren Punkten zugleich sein könnte, doch „Seele“ und „Anderer“ sind natürlich noch nicht die Begriffe, die Einheiten, die wissenschaftlich und präzise genug sind.
Auch Neurophilosophen mit mathematischem Hintergrund bemühen sich um Beweise solcher Einheit.18 Aber sie greifen zu schnell und zu kurz. Und natürlich könnte auch Gott das sein, was an zwei Punkten zugleich ist. Aber er wäre dann nicht der Gott der Religionen. Schon Schiller sagte: „Welche Religion ich bekenne? Keine von allen – und warum keine? Aus Religion!“ Wenn es ein übergeordnetes Wesen gibt – so könnte man sagen – dann nur so eines, das innen als Rede auftaucht, die außen nichts gilt (dafür wäre Stefan R. ein gutes Beispiel), dafür ist es dann außen für einen Augenblick der Gott, der wirklich existiert (das wäre mein Beitrag zur Theologie). Umgekehrt könnte man bezüglich der Neurowissenschaft sagen: ihre Rede gilt außen, aber von innen her, von dem sie doch Wissenschaft sein will, hat sie kein Wesen, nichts Wesenhaftes oder Wesentliches.
Es sind stets die gleichen Wege der Erkenntnissuche, die auch Informatiker, Kognitionswissenschaftler, KI-Forscher und Andere interessieren. Es ist nicht nur die Mathematik, die hier Wissenschaftlichkeit und Präzision zu garantieren scheint, indem man diese Einschreibung in berechenbarer Weise vornimmt, auch bestimmte Formen der Kunst könnte man hier zitieren, weshalb z. B. der Maler Matta von seiner Malerei als einer „mathematic sensible“ sprach. Die Kunst eignet sich vielleicht überhaupt sehr gut dazu, dieses Phänomen zu präsentieren: Vor einem bestimmten Bild, vor einem Kunstwerk, sollten zwei Betrachter die gleiche Empfindung, die gleiche ästhetische Wallung wahrnehmen – aber sie tun es natürlich meist nicht. Kunst schafft eine Einheit, aber nur flüchtig, solange wir sie zusammen betrachten und vielleicht auch noch zusätzlich darüber reden. Aber dann ist es vorbei.
Ich will also etwas finden und beschreiben, was wirklich, real, und von der Benennung her zugleich diese wirkliche „Doppel-Einheit“ darstellt und dazu kommt mir kurioserweise die Geschichte von jemand wie Stefan R. gerade recht. Schließlich sprach er – wie ja schon an ein paar Beispielen gezeigt – gerade / gekrümmt, und das ist vielleicht sogar besser, als die reine herkömmliche Mathematik. Es geht um das, was auch der oben zitierte A. Sciacchiatano meint, wenn er von der geschwächten binären Logik spricht. Man muss, sagt er, den starken logischen Binarismus schwächen, bei dem das Wahre und das Falsche strikte Gegensätze sind. Selbst in der extremsten Wahrheit steckt ein klein bisschen Falsches und umgekehrt, und gerade so betreibt man moderne Mathematik.19 Sie hat sich nur noch nicht so ganz durchgesetzt.
Man kommt diesem Problem viel näher, wenn man es umgekehrt ausdrückt: Da ist nicht schon etwas vorhanden, sondern anfänglich „fehlt etwas an seinem Platz“.20 Eine Kluft (Spaltung), ein Mangel, der ersetzt und ausgeglichen werden muss, steht am Beginn von allem, und eben das erzeugt den gerade erwähnten Knoten, die Gerade / Gekrümmtheit, und ihre Einschreibung! Etwas fehlt, eher ist also eine ursprüngliche Hemmung, Spaltung, eine (wie Freud später sagen wird) Ur-Verdrängung da, die wie von außen nach innen wirkt, und dann sind da eben auch noch Strebungen des Subjekts, die von innen nach außen treiben. Nicht die Einheit ist zuerst da, sondern die Spaltung, nicht ein klar geknüpfter Knoten, sondern einer, der von innen nach außen und von außen nach innen durchschlungen und durchwunden ist, wie ich dies in Abb. 1 dargestellt habe.
Abb. 1 Möbiusband (li oben), Skulptur „Raum - spur“ (re oben) und Grafik von D. Braml (unten)
.Man hat nämlich – wie erwähnt – versucht, diesem Sachverhalt in der modernen (Nicht-Euklidischen) Geometrie oder Topologie besser Rechnung zu tragen und hat derartige Knotenbildungen mathematisch formuliert und gezeichnet (z. B. das Möbiusband oder die Boysche Fläche, ein sich selbst durchwölbendes, durchdringendes Band oder Gebilde, bei dem die Außenfläche stets auch in die Innenfläche übergeht). Aber auch Religion und Kunst haben sich also um diesen Gordischen Knoten, dessen zwei Enden man nie zusammenbekommt und so auch nicht aufknüpfen kann, bemüht. Deswegen habe ich neben dem (topologischen) Möbiusband dieses Bild einer Graphikerin, die Stefan R. kannte, und eine spirituelle Skulptur zur Veranschaulichung dieses Knotens, dieser Spaltungsverwicklung, an den Anfang gesetzt. Am Ende will ich also ein Gebilde zeigen, das die Spaltung zu überwinden erlaubt: durch einen „sprachlichen Knoten“ oder könnte man auch sagen: „Knochen“?
Das erinnert nämlich an Hegels Aussage vom Menschen als Knochen. „Die Wirklichkeit und Dasein des Menschen ist sein Schädelknochen . . . Wenn das Sein als solches oder Dingsein von dem Geiste prädiziert wird, so ist darum der wahrhafte Ausdruck hiervon, dass er ein solches wie ein Knochen ist.“21 Diese Aussage eines hochkarätigen Philosophen hat viele Menschen immer schon verwundert und konsterniert. Doch kurz: was Hegel meint ist exakt das Gleiche was Stefan R. nur empfindet und halt nicht philosophisch oder ‚normaler‘, also normalsprachlicher ausdrückt: das ‚Wahrhaftsein‘, das Sein in Wahrheit, ist nicht etwas realistisch-äußerlich Existierendes, sondern Knochenartiges. Es hat Festigkeit, Härte, Körper, aber existiert nicht als Form oder Gestalt. Man kann von dem Wenigen, das es an sich hat, nicht auf den Menschen schließen (das große Problem der Paläoanthropologen, die nur ein paar Knochen zur Verfügung haben, um vom Frühmenschen etwas zu sagen). Dass das menschliche Sein in Wahrheit, also in einer gewissen Abstraktion und doch gleichzeitigen Konkretheit, Körperhaftigkeit ein „Knochen“ ist, klingt so gesehen nicht ganz unplausibel.
„Ich wäre lieber ein Knochen, der noch reden kann“, schreibt Stefan R.. Ich komme mir so knochig vor, so wenig, so trocken, einfach knöchern halt. Wären die Menschen doch nur Knochen-Menschen, man könnte sofort sehen, wer sie sind, nämlich gar nicht tot, wie es uns der Sensenmann glauben machen sollte.“
Viele Stunden redeten Stefan R. und ich über alle möglichen Themen, redeten durcheinander, planlos. Für den Anfang war dies sicher die richtige Methode, um zu sehen, „um was es eigentlich geht“, wie Stefan R. gerne sagte. Und ganz unrecht hatte er ja nicht. Selbst in Politik, Wirtschaft und in der ‚high society‘ wissen die Leute oft nicht, um was es eigentlich geht. Jeder weiß nur, um was es ihm selber geht, für so etwas hatte Stefan R. ein gutes Gespür. Er konnte schrecklich entlarvend sein, denn gesellschaftlich relevante Ängste kümmerten ihn nicht. Deswegen hatte er es sich, als er zu mir kam, bereits mit vielen seiner Freunde, die noch aus Schülerzeiten zu ihm hielten, verdorben. Etliche von ihnen sorgten sich nämlich und standen strikt zu ihm, und alle waren sich einig, dass Stefan R. nur ein Opfer der ‚Jagdszenen aus Niederbayern‘ war, ein Stück von X. Kroetz, das in der Zeit der maßlos korrupten bayerischen ‚Amigos‘ spielte, deren Namen Gerold Tandler, Gustl Lang und ein paar weiterer schon von sich aus nach Striezl- und Spezl-Kumpaneien klang. Doch kehren wir wieder zurück zur Psychoanalyse.
Kurze Biographie
Stefan R, war also in einer niederbayerischen Kleinstadt aufgewachsen, der Vater ein Fabrikarbeiter, die Mutter verharrte lebenslang in bigotter Religiosität. Es gab noch zwei ältere und eine jüngere Schwester. Nach der Volksschule wurde Stefan R. aufs humanistische Gymnasium geschickt, auf ihm ruhten alle Hoffnungen der Familie, während die Schwestern Lehrberufe absolvierten. Die Mutter war anscheinend stark davon erfüllt, dass ihr Sohn Priester werden sollte. Aber auch aus finanziellen Gründen schickte man ihn in ein katholisches Priester-Konvikt, wo die Gymnasiasten kostenlos versorgt wurden und wohnten. Erst nach zwei, drei Jahren konnte Stefan R. sich von seinen Eltern erbetteln, dass er mit dem Zug täglich dorthin und wieder zurück nach Hause fahren, um so dem Internatsdruck entfliehen zu können. Den Priestertraum musste die Mutter allerdings später aufgeben, als Stefan R. kurz vor dem Abitur sich entschloss, Sport, Kunst und Germanistik für das Lehrfach zu studieren. Zum Vater bestand eine ablehnende Haltung. Für den Sohn war dieser stets nur mit der Kraft seiner Hände in der Arbeit und zu Hause argumentierende Vater zu grob, zu roh, einsilbig und simpel. Während der Vater den Sohn verspottete, weil dieser nichts richtig Handwerkliches zu tun vermochte, verachtete der Sohn den Vater, weil dieser keine Bildung hatte und intellektuell nicht argumentieren konnte. Dennoch gab es auch eine starke Anziehung zwischen diesen beiden ‚Mannsbildern‘ (ein Ausdruck der dortigen Bevölkerung). Nach dem Studium erhielt er eine Assistentenstelle im sprachwissenschaftlichen Institut der Universität. Als er dort nicht weiterkam machte er eine Reise nach Griechenland, von der er krank zurückkehrte. Ich ergänze später diese Biographie beim Beschreiben der Psychodynamik.
Bleiben wir also nochmals kurz beim Formalen der Psychoanalyse. Etwas wirkt von innen nach außen (und das nennen wir vorwiegend Trieb) und etwas von außen nach innen (vorwiegend Hemmung, Verdrängung).22 Freud selbst hat bereits die Verdrängung als einen Gegentrieb aufgefasst, weshalb Schmidt-Hellerau auch davon spricht, dass das Grundmodell Trieb-Verschaltung-Trieb heißen könnte, worin sich gleichzeitig auch das Wesen der Struktur selbst ausdrückt, die die Verdrängung enthält. Aber was heißt das alles? Was bedeutet diese dreifache Verknotung (Trieb-Verschaltung-Trieb)? Ist das nicht alles zu nüchtern und formal, auch wenn es dann mit all den Freudschen Begriffen vom Es, Ich und Überich, vom Bewussten und Unbewussten, von den Selbst- und Objektrepräsentanzen gefüllt werden könnte? Und wo bleibt die farbige Rhetorik, die Freud in seinem Entwurf begonnen hat und die uns alles viel lebendiger herüberbringen würde und wo der wissenschaftliche, konkrete, praktische Zugang zu all dem? Eine wirklich praktische, greifbare Einschreibung?
Im antiken Mythos finden wir auch dieses andere, gekrümmt / gerade Denken, und weil Stefan R. ja im humanistischen Gymnasium war, zitiere ich auch aus seinem Tagebuch: „Ich bin gegen Aristoteles und das Gute, gegen das „Immer-Nur-Das-Beste-Gewollt-Haben“, das immer Gutsein, ständig gut, nur gut, gut gut. Es gibt kein Gutes, das man sagen könnte. Hinter dem Guten steckt immer einer, der sein Schlechtes verbergen will, der Gutmann, der Zum-Gut-Hinredner, der Beschwichtiger, Beteurer, der Gutsherrenanhäufler, der Gutmanieren-Vergutiger, der Guteleute-Verläuterer, der Zu-Gut, Viel-Zu-Gut . . . und wer nicht gut genug war wurde als Tantalus oder Sisyphos gequält.“
Camus hat den Mythos des Sisyphos neu interpretiert, indem er behauptete, man müsse sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Ausgerechnet der gequälteste Mensch sollte der glücklichste sein! War nicht Stefan R. selbst ein bisschen Sisyphos, der direkt aus dem Schmerz, also der Hemmung und/oder der Lust, also dem Trieb und seiner Verschaltung heraus zu denken und zu leben versteht? Man muss sich Sisyphos nicht als einen glücklichen Menschen vorstellen, sondern als einen neurotischen, einen in sich eingesperrten Menschen. Nicht umsonst hat Freud deswegen ebenfalls einen Mythos zur Erstellung seiner psychoanalytischen Wissenschaft gewählt, den Mythos des Ödipus.
Denn dieser Mythos besteht darin, dass ein König (Laios), also ein besonderer Mann, trotz dieser Herausgehobenenheit, trotz dieses Geraden seiner Aufrichtung und Größe, wegen der Pest in seinem Land Hilfe von Jenseits, also von oben, von woanders her, vom Über-Außen, kurz: von einem im Diesseits zum Jenseits und wieder zurück Gekrümmten hat holen müssen! Von einem G, o und Doppel-t, von einem also, über den der Philosoph M. Foucault sagt, er wohne eben nicht im Ganz-Jenseits-Woanders, „sondern im Diesseits unserer Sätze“, im Geheimnis unserer diesseitigen Sprache, in Syntax und Linguistik, deren Funktionieren uns immer noch rätselhaft ist. Diesem König, diesem Hoch-Gegradeten raunte das Delphische Orakel nämlich ins Ohr: „Von der Pest wird dein Land befreit, aber wehe du zeugst einen Sohn! Der würde dich umbringen müssen!“ Gekrümmtes par excellence! Gerade / Gekrümmte Psycho-Linguistik.
Doch seine Frau – wie immer treten alle Akteure des Lebens auf und agieren gekrümmt gegen den sonst allzu geraden Verlauf des Lebens – wollte einen Sohn. Sie machte ihren König-Mann betrunken, im wollüstigen Rausch, in der chaotischsten Form der Liebe, wurde nun dennoch der Sohn gezeugt, wodurch sich der Schicksals-Knoten endgültig zuschnürte. Ödipus wurde geboren, und man musste das „mordsüchtige“ Kind nunmehr aussetzen, doch das Gekrümmte des Orakelspruchs erfüllte sich schnurgerade hintenherum, um sich dann nochmals gerade / gekrümmt ins Ziel zu winden. Ödipus, der Geradlinige, und die allzu gerade gespiegelten „Selbstrepräsentanzen“ gehen von innen nach außen. Das Orakel dagegen, das Gekrümmte, die „Objektrepräsentanzen“ gehen von außen nach innen. Ich bleibe bei diesem einfachen roten Faden der zwei Grundelemente für mein Buch.
„Selbst“- und „Objektrepräsentanzen“, beide müssen getrennt voneinander erfahren und auch konstruktiv kombiniert werden können. Eben weil diese Repräsentanzen bei Ödipus unbewusst verknotet sind, gekrümmt-gerade sind, ist Ödipus der wissenssüchtige und angstlose Held, denn selbst die sexistische Sphinx beunruhigt ihn nicht. Aber dann holt ihn eben die Angst doch in Form einer grenzenlosen Lust, eines Ur-Bildes, Ur-Blicks ins Schlafzimmer der Mutter, und als aggressions- und vaterbezogene Wahrheit in Form des Orakels wieder ein. „Wie oft musste ich rufen: Vater, die Mutter!! Oder: Mutter, der Vater!! Vatermutter, Vatmuter, Vermuter, Vertut er.. . “ raunte Stefan R. „Wir sind zu sehr an der Mutter gehangen, der Muuuhhhuuter, wir haben zu sehr an den Vater geglaubt, an den Vaatttter, Varrattter . . . Es war immer Spannung im Hause, nicht fassbar, atmosphärisch, psychoklimatisch, warm-kalt, hell-dunkel, heimeligunheimlich, lebendig-tot . . .“
„Selbst- und Objektrepräsentanzen“ sind nicht immer getrennt oder klar kombiniert. Sie gehen ständig durcheinander. Nicht nur das Begehren hin zum gegengeschlechtlichen und der Hass auf den gleichgeschlechtlichen Elternteil bestimmt diese frühen Komplexe, sondern sadistische Aggressivität und sexistisches Liebesverlangen verbinden sich zu extremen Mischungen. Ich stelle dies alles am Anfang meines Berichtes zur Diskussion, weil es für die Geschichte von Stefan R. wesentlich ist. Bei ihm geht es um diese ganz frühen – fachlich auch präödipal genannten – Komplexe, die mit dem Ödipuskomplex nicht ganz gefasst werden können.
Stefan R. selbst berichtete in der Therapie von sexuellen Phantasien und Träumen, auch einigen mit einer seiner Schwestern. Es hatte zu dieser Schwester in seiner Jugend immer ein Anziehungs-Abstoßungs-Verhältnis gegeben. Die „Chaosliebe “ (ein Ausdruck des Chaostheoretikers Cramer) war in Stefan R.s Leben immer schon da. Auch in Phantasien hatte er sich ausgemalt, wie er sich seiner Schwester hätte nähern können, aber die Gesetze und Regeln in seiner ländlichen Heimat waren streng. Die Schwester hätte einer erotischen Beziehung nicht nur nie zugestimmt, sie hätte es auch sofort den Eltern oder anderen Personen verraten. In seinen Tagebüchern fanden sich unzählige obszöne Bilder von Frauen und Darstellungen skurriler sexueller Träume. Nähe, Intimität, Persönliches waren für ihn immer im Konflikt mit Sexualität, mit Aggressiv-Erotischem.
Mehrmals erwähnte Stefan R. das Problem der ‚unbeabsichtigten Erektion‘, ein Begriff, der erst vor kurzem im letzten Buch der Reihe ‚Sexualität und Wahrheit von M. Foucault erschienen ist. Foucault argumentiert ganz klar, dass nicht die Unterdrückung durch die Kirche und die christliche Religion das Problem darstellte. Er schildert Clemens von Alexandrien, der sich schon in der ersten christlichen Jahrhunderten um gute Ratschläge bemühte, doch wenn es etwas gibt, das nicht durch ein Sexualobjekt, durch eine definitive Beziehung hervorgerufen wird, wie soll man dann damit vorgehen? Wie umgehen mit dem, das direkt vom Unbewussten kommt? Solche Dinge beschäftigten Stefan R. ganz pragmatisch, war er doch auch der, der immer ohne Absicht, ohne Kultur- und Fremdbezug, stets nur er selbst sein wollte.
„Wie soll man wissen, wer man ist, wenn schon mit dem Ist das Wissen verbunden ist, es nicht denken zu können? Descartes hat es sich zu einfach gemacht: er war, wenn er dachte. Mich aber zersprengt das Denken in tausend Ichs. Ich bin selbst das Ich der anderen, das Denken des irgendeinen oder gar von niemand, ich bin ein Denker der Nicht-Denker, ein Sein ohne Wissen des Seins . . . . das Wissein, Weisesein, das Weinensein . . . Lieber weine ich über die ganze Welt, als dass ich sie zu verstehen suche. Die sie verstehen, pressen sie nur in die Windungen ihres Gehirns. Ich weine sie weg, die Welt, . . . ..“
Am Ende ihres durchformalisierten Modells der Freudschen Psychoanalyse kommt Schmidt-Hellerau nämlich letztlich (und von mir jetzt etwas vereinfacht) zu dem Ergebnis, dass das Ich samt seiner unbewussten Anteile (Strukturvorgänge als Triebe aufgefasst) seinem Anderen gegenübersteht (Triebe als Strukturkomplexe aufgefasst). Wörtlich sagt sie, dass sie darauf hinauswill: „dass ein Teil des Ichs (der den psychischen Apparat gleichsam „von außen“ wahrnimmt und in dem alles spiegelverkehrt ist) aus einer jenseitigen Perspektive arbeiten könnte, „indem sich Trieb und Struktur wie Figur und Grund umkehren, . und dass [in] diesem jenseitigen Bereich die Strukturbildungsprozesse des diesseitigen Ichs den Triebvorgängen entsprächen, wohingegen die diesseitigen Triebvorgänge im jenseitigen Ich-Bereich strukturierende (begrenzende) Funktion innehätten.“
Vereinfacht also: Das Subjekt samt seinem Anderen
Der Andere ist der, der aus dieser aufs Sprachliche bezogenen Quadrierung herauszusprechen scheint. Das Subjekt und sein Anderer, wie ich es oben gerade erwähnt habe, dient uns ja als grundlegendes Strukturkonzept, und es ist insbesondere auch von dem französischen Psychoanalytiker J. Lacan so konzipiert worden. Ich habe jetzt gewiss hier in der theoretischen Darstellung etwas vorgegriffen, komme jedoch noch ausführlicher dazu. Wir brauchen es – dies sei nochmals betont – nicht so kompliziert zu machen. Das Subjekt (also Ich plus Struktur), samt seinem Anderen (also Struktur plus Trieb), diese Verschaltung wird uns weiterhin als einfaches Grundkonzept für alles Folgende dienen.
„Uneins mit sich, mischt´s sich mit sich. Ich kann dieses Leid der Menschheit nicht mehr sehen, kann nichts davon hören, nichts ertragen. So viele Kinder müssen arbeiten, so viele Menschen hungern, all das macht Angst, Angst vor dem Nichts, Angst vor den liebenden Menschen, vor denen, die mich lieben, denn die Liebe bedroht mich. . . . Die Liebe ist so übergroß, so übermächtig, größer als das Universum und so muss sie alles erdrücken. Und doch ist sie ja ein so viel versprechendes Wort! Sie schallt von den Wänden wider: Lieben, leben, ebenlieb-be-lieb-ige-liebe. Die Liebe ist überall, sie hat keine eigenen Grenzen oder gibt es eine Liebe, die Wissen hat, die weiß? Das wäre die Erlösung.“
Am besten ist es den psychisch Kranken so sprechen zu lassen (und auch malen zu lassen, wie es die Bilder von Stefan R. in diesem Buch zeigen), um zu hören und zu sehen, dass hier eine Wahrheit herausschimmert, die wir anders gar nicht finden könnten, obwohl wir sie für uns selber brauchen würden. Diese scheinbar ganz andere Struktur des ‚Psychotikers‘ (besser: des der menschlichen Grundstörung besonders ausgelieferten Subjekts), aber auch diese so emotional-mystische Metaphysik oder „Spiritualität“ Altägyptens (oder auch anderer Primärkulturen) ist tatsächlich das total Andere zur rational-intellektuellen Diesseitigkeit, und die Unterschiede zusammenzudenken ist nur mit einem derartig einfachen Modell möglich, wie ich es gerade beschrieben habe. Ist nicht schon so ein Wort wie ‚Psychose‘ einseitig und verfremdend? Urteilen wir nicht schon mit einem Wort über das Wesen, mit einem Begriff über das wirkliche Sein eines Menschen, wenn wir ‚Psychose‘ sagen?