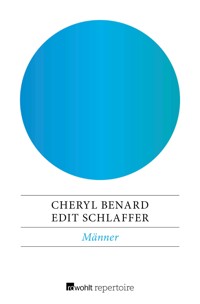9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Indien, in Pakistan, im Iran oder in Saudi-Arabien sind Frauen nach wie vor allenfalls Menschen zweiter Ordnung. Die, sei es traditionell, sei es religiös, legitimierte Macht der Männer gilt in diesen Kulturkreisen auch heute noch mehr als das Menschenrecht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Mädchen, die gegen ihren Willen verheiratet werden und die ihr Leben lang aller Rechte beraubt und zur Unsichtbarkeit verdammt sind, junge Ehefrauen, die von der Schwiegerfamilie ausgebeutet, gequält und bedroht werden, Vergewaltigungen, Züchtigungen, Arrestierungen, Witwenverbrennungen oder die Steinigung von Ehebrecherinnen – dies sind die prägenden Merkmale für eine Atmosphäre der Gewalt, die sich mit dem westlichen Begriff «Diskriminierung» nur sehr unzureichend beschreiben läßt. Hier findet vielerorts ein Krieg statt, dessen Opfer ungezählt sind. In eindringlichen Reportagen, in denen eine grauenvolle Realität transparent wird, berichten Cheryl Benard und Edit Schlaffer anhand zahlreicher Einzelbeispiele von Frauenschicksalen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Cheryl Benard • Edit Schlaffer
Das Gewissen der Männer
Geschlecht und Moral – Reportagen aus der Despotie
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
In Indien, in Pakistan, im Iran oder in Saudi-Arabien sind Frauen nach wie vor allenfalls Menschen zweiter Ordnung. Die, sei es traditionell, sei es religiös, legitimierte Macht der Männer gilt in diesen Kulturkreisen auch heute noch mehr als das Menschenrecht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Mädchen, die gegen ihren Willen verheiratet werden und die ihr Leben lang aller Rechte beraubt und zur Unsichtbarkeit verdammt sind, junge Ehefrauen, die von der Schwiegerfamilie ausgebeutet, gequält und bedroht werden, Vergewaltigungen, Züchtigungen, Arrestierungen, Witwenverbrennungen oder die Steinigung von Ehebrecherinnen – dies sind die prägenden Merkmale für eine Atmosphäre der Gewalt, die sich mit dem westlichen Begriff «Diskriminierung» nur sehr unzureichend beschreiben läßt. Hier findet vielerorts ein Krieg statt, dessen Opfer ungezählt sind.
Über Cheryl Benard • Edit Schlaffer
Cheryl Benard (geb. 1953) und Edit Schlaffer (geb. 1950) leiteten als Sozialwissenschaftlerinnen die «Ludwig Boltzmann-Forschungsstelle für Politik und zwischenmenschliche Beziehungen» in Wien.
Inhaltsübersicht
Upon an island hard to reach
the East beast sits upon his beach
upon the West beach sits the West beast
each beach beast thinks he’s the best beast
which beast is best?
I used to think that East was best and West was worst
but as I look from West to East
I find I like the East beast least.
Dr. Seuss
Vorwort
Viele Länder der Erde sind mit fast unlösbaren ökonomischen und politischen Problemen und Benachteiligungen konfrontiert. Im internationalen Vergleich geht es uns in Europa ausgesprochen gut. Das ist aber kein Grund, die Dritte Welt in eine moralische Sonderkategorie zu entlassen. Es passieren dort Dinge, die mit jedem humanen Rechtsgefühl – und völlig unabhängig von kulturellen Unterschieden – unvereinbar sind. Häufige Opfer dieser Verstöße: die Frauen. Sie werden getötet, mißhandelt, gehaßt, liquidiert: von den eigenen Männern. Auch bei uns gibt es Gewalt, aber nicht folgenlos, quasi als Teil der Tradition und einer kulturellen Praxis.
Diese Fakten zu verheimlichen oder gar zu entschuldigen, nur weil es sich um andere Kulturkreise handelt, wäre der wahre Rassismus; denn damit wäre gesagt, daß diese Frauen unerheblich sind und ihre Männer nicht entwickelt genug, um nach allgemein menschlichen und moralischen Kriterien gemessen zu werden.
Im Koran beispielsweise wird die Frage der moralischen Verantwortung und des Gewissens ganz speziell zum Schutz der Frauen aufgegriffen. Bezug nehmend auf die Praktik der Tötung neugeborener Mädchen, werden die Männer gewarnt, daß sie sich am Tag des Jüngsten Gerichts für solche Vergehen werden rechtfertigen müssen. Die alltägliche Behandlung von Frauen in vielen Ländern heute ist sehr weit von dieser Handlungsmaxime entfernt.
Man kann Kulturen nicht vergleichen. Sie sind nicht besser oder schlechter, sondern lediglich anders. Vor allem wir in Europa dürfen uns nicht anmaßen, andere zu bewerten oder zu beurteilen: Dies wäre kultureller Imperialismus, das wäre westliche Überheblichkeit, und angesichts unserer schmählichen kolonialen Vergangenheit sollen wir lieber in Demut schweigen und überlegen, in welchen Punkten die traditionellen, einfachen Gesellschaften uns überlegen sind.
So lautete das kulturpolitische «Ave-Maria», das wir in unserer Studentenzeit herunterzubeten lernten.
Zum Teil war das berechtigt. Daß Gerechtigkeit und Wahrheit immer auch von der jeweiligen Perspektive abhängig sind, daß die Mächtigen sich oft den Titel der Gerechten verleihen – dies alles ist historisch verbrieft. Nur in der Pauschale gehen diese Einsichten zu weit. In ihrem Schlepptau folgen dann andere Pauschalierungen, bis eine Suppe aus Entschuldigungen und Relativierungen jegliches moralische Urteil verschüttet.
Wer leidet darunter? Wenn wir diese Frage stellen, zeigt sich die Kontur einer ungewöhnlichen politischen Schichtung. Es gibt die Starken, es gibt die Schwachen – und dann gibt es noch die Schwächsten, die echten Verdammten dieser Erde. Sie haben keine Parolen, sie können niemanden des Rassismus oder des Neokolonialismus bezichtigen, ihr Protest bleibt ungehört, ja er wird nicht einmal erlaubt, sondern ertönt bloß zaghaft, um sofort erstickt zu werden. Das Mädchen, das gegen seinen Willen mit einem Siebzigjährigen verheiratet wird, oder die junge Frau, die ihr Mann einsperren und zum Tode verurteilen darf, indem er ihr ärztliche Hilfe verbietet – diese Frauen sind oft die Opfer derjenigen, die dem Westen rechtschaffen eine moralische Rechnung präsentieren wollen. Wenn wir diesen Frauen, um Kritik zu vermeiden, unsere Solidarität verweigern, dann haben wir nicht nur diese Frauen verraten, sondern auch den besten Teil unserer Zivilisation: unseren Glauben an Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit, der sich nicht mit billiger Apologetik befriedigen läßt, sondern manchmal auch nach Konfrontationen verlangt.
Die erste Verantwortung angesichts der Mißstände, die in diesem Buch beispielhaft angeführt werden, trifft die Angehörigen der betrachteten Kulturen. Sie müssen reflektieren, wie sie ihren humanitären Auftrag besser realisieren können. Aber auch der Westen hat hier eine Mitschuld: die Schuld des Mitwissenden, der dem Opfer seine Hilfe verwehrt und im Angesicht krasser Gewalt einfach schweigt.
Einleitung
Ich bin Ausländerin – Frauen als Fußnote der Moral
Aus der Dritten Welt zu kommen soll kein Stigma sein, aber auch kein Freibrief. Gewalt gegen Frauen, gegen Kinder oder gegen Minderheiten darf, wenn Frauen, Kinder und Minderheiten denselben menschlichen Wert besitzen wie ein Mann der jeweils dominanten Zugehörigkeit, nicht ignoriert werden.
Sonst üben wir nicht Solidarität, sondern machen uns zu Komplizen eines Opfers in seiner Rolle als Täter.
«Ich bin Ausländer» – ein T-Shirt mit dieser Aufschrift kann man in Deutschland erwerben, um seine Solidarität zu bekunden. Solidarität – ein schönes, ein erbauliches Wort. Und ein tückisches. Es will verhindern, daß rassistische Ängste und Verallgemeinerungen den Weg zur Menschlichkeit versperren, daß wir Leute nur als wandelnde Hautfarbe oder Nationalität betrachten und sie ablehnen, ohne uns jemals mit ihnen und ihrer Situation auseinandergesetzt zu haben.
Aber tückisch ist es trotzdem. Denn vor Vorurteilen, Pauschalbeurteilungen und Ungerechtigkeit gibt es auch dann kein einfaches Entkommen, wenn wir uns «solidarisieren». Die Gruppe der Opfer ist vielfältig, in sich gespalten und nochmals unterteilt in zahllose Abstufungen von Recht und Unrecht. Die Opfer von Rassismus können selber rassistisch sein, die Opfer von Gewalt selber gewalttätig.
Vorurteile sind simpel; das macht ihre Anziehungskraft aus. Sie bieten eine einfache Erklärung, ein ganz einfaches Denkschema. Die Solidarität darf nicht ebenfalls simpel sein, darf sich nicht sozialen und politischen Wahrheiten verschließen im Namen einer pauschalen Anteilnahme. Dann nämlich werden abermals Ungerechtigkeiten verleugnet, wird wieder Gewalt verübt und verschwiegen, werden Dinge zu sehr vereinfacht auf Kosten derjenigen, die das bequeme Erklärungsmuster verwirren könnten. Es mag linguistische Ungenauigkeit sein, wenn das T-Shirt sich mit dem Ausländer solidarisiert und mit der Ausländerin nicht, aber politisch ist es um so präziser. Denn die Frauen sind in vieler Hinsicht aus dieser Solidarität ausgeschlossen, und damit werden sie die Opfer einer zu simplen Solidarisierung. Was ihnen von ihren Männern angetan wird, soll ein Geheimnis bleiben, um die Sympathien für diese Männer nicht zu gefährden. Das ist in jedem Fall einfacher, als sich in eine lange Diskussion über kulturelle Werte, Gewalt gegen Frauen, Menschenrechte und Geschlechtszugehörigkeit einzulassen. Aber nur weil etwas «einfacher» ist, ist es noch lange nicht richtig. Auch Vorurteile sind einfach. Wenn ein Mann, dem ein Unrecht widerfahren ist, seine Frau mißhandelt, die von ihm abhängig ist und der darüber hinaus auch noch dasselbe Unrecht widerfahren ist wie ihm, dann können wir weder das spezielle Schicksal dieser Frau noch das unrechte Verhalten des Mannes einfach unter den Teppich der «Solidarität» kehren. Genau das aber geschieht, und es sind nicht zuletzt die Liberalen, die Engagierten, die Aufgeklärten, die dies tun.
Aus der Dritten Welt zu kommen soll kein Stigma sein, aber auch kein Freibrief. Gewalt gegen Frauen, gegen Kinder oder gegen Minderheiten darf, wenn Frauen, Kinder und Minderheiten denselben menschlichen Wert besitzen wie ein Mann der jeweils dominanten Zugehörigkeit, nicht ignoriert werden. Sonst üben wir nicht Solidarität, sondern machen uns zu Komplizen eines Opfers in seiner Rolle als Täter.
Die Angst, Vorurteilen zuzuarbeiten, wird als Grund angegeben, die Situation von Frauen nicht – es heißt dann meist: noch nicht – zu berücksichtigen. Wenn das Verhalten eines arabischen Immigranten seiner Frau gegenüber kritisiert wird, so lautet dieses Argument, dann werden damit bloß Stereotype über «die Araber» gestärkt. Und das schadet letztendlich auch der betroffenen Frau. Wir wollen fest daran glauben, daß dieses Argument ehrlich gemeint ist. Denn eine andere mögliche Erklärung ist weit schlimmer, und sie würde von einer sehr großen und gefährlichen politischen Naivität zeugen: Daß das Schicksal der Frauen deswegen verheimlicht werden soll, nicht diskutiert werden darf, weil es den liberalen Aktivisten gleichgültig ist. Weil sie ihr Wunschbild der edlen Verfolgten nicht komplizieren wollen, weil sie Frauen nicht denselben menschlichen Stellenwert zubilligen, sondern in diesem einen Punkt selbst noch von Vorurteilen befangen sind.
Die Wahrheit hat die unbequeme Eigenschaft, sich aus gegensätzlichen Komponenten zusammenzusetzen: Hinter ihr verbergen sich oft noch eine zweite und eine dritte Wahrheit und eine hundertste Wahrheit, von denen die eine schön, die andere häßlich, die eine erbaulich, die andere bedrückend und alle miteinander in gleichem Maße und zur gleichen Zeit «wahr» sind. Es können gute Dinge geschehen aus schlechten Beweggründen, während gute Absichten ins Verderben führen können. Freunde können sich fälschlich für Feinde halten, Feinde sich anfreunden, Freunde erkennen, daß sie sich ineinander getäuscht haben. Die Diskussion zwischen den Kulturen ist in hohem Maße von all diesen Verwirrungen betroffen.
Und die Frauen haben international eine Eigenschaft gemeinsam: Sie machen alles immer so kompliziert. Dieser Jack Unterweger, so ein guter Dichter; leider steht er im Verdacht, sieben Prostituierte ermordet zu haben. Der Herr Meier von unten, so ein netter Kerl; leider schlägt er seine Frau.
Indien, ein so tolles, spirituell so reiches Land; leider werden dort jährlich Tausende Mädchen aus gemeiner Geldgier erwürgt oder verbrannt. Lästig, diese Frauen; immer ruinieren sie das gute Verhältnis zwischen Männern mit ihrem vorwurfsvollen Jammerschicksal.
Aber nicht wirklich. Ist bei Staatsbesuchen in Ländern der Dritten Welt die Problematik der Frauen jemals ein Thema, fragten wir in einer Blitzumfrage zehn westeuropäische Politiker? Die krausten die Stirn, dachten nach und sagten einstimmig: nein.
Ist die brutale Mißhandlung von Frauen ein Thema, wenn Liberale mit ihren männlichen Solidaritätsschützlingen sprechen? Niemals. Man will sich ja nicht die «Vertrauensbasis ruinieren». Man will sich nicht einmischen. Man will um Gottes willen nicht andeuten, daß man die eigene Kultur und die eigenen Sitten zum Maß der Dinge macht. Man fürchtet dies und meidet jenes, und auf der Strecke bleiben diejenigen, die in der schwächsten Position sind, denn ihre Partei ergreift niemand. Bei der Solidarität bleiben sie ausgespart.
Wobei – auch dies eine Facette in der Vielfältigkeit der Wahrheiten – die Solidarität mitunter auch von denjenigen abgewehrt wird, denen sie zugute kommen soll. Bekundungen der Freundschaft und Solidarität werden von manchen Frauen aus den betreffenden Kulturkreisen aggressiv zurückgewiesen. Wenn das geschieht, ist es nicht immer der westliche Part, der ein «falsches Bewußtsein» an den Tag gelegt hat. Diese Abweisung muß man ertragen, denn man ist nicht deshalb solidarisch, weil man Applaus und Dankbarkeit bekommen möchte, sondern um der eigenen moralischen Prinzipien willen.
Eine Reise nach Indien
Ist Herr Singh ein Mörder?
Indien – das ist Mystik, Farbe, gandhische Friedfertigkeit, bunte Saris, spirituelle Erhabenheit.
Indien, das ist Geldgier bis zum Mord, Frauenhaß bis zur systematischen Ausmerzung.
Wir fuhren nach Indien, um einen Kulturbericht zu schreiben, und schrieben statt dessen einen Kriegsbericht. Unbeobachtet von Blauhelmen, herrscht hier ein Krieg gegen die Frauen.
Neu-Delhi. Das obere Stockwerk eines Einfamilienhauses. Wir sitzen im Wohnzimmer; draußen, auf der Veranda, blühen Geranien. Uns gegenüber sitzt das Ehepaar Chhabra: ein gutmütiger, freundlicher Mann, Eigentümer einer Werkstatt für die Produktion von Maschinenteilen, und seine Frau, die uns Tee serviert und Nüsse. In der Ecke steht ein Fernsehgerät, mit Video; wir sehen einen Film. Es ist ein Film über die älteste Tochter der Chhabras, Shalina, über ein Mädchen, das in Indien berühmt wurde. Sie kam sogar ins Fernsehen, wo sie fünf Minuten lang eine kleine Ansprache hielt, eine kleine Ansprache über ihre Ehe. Mit fünf Medienminuten beendete Shalina ihr Leben; ein Dokumentarfilmteam nahm ihren qualvollen Verbrennungstod und ihre gestöhnte Anklage auf Video auf. Deswegen ist sie berühmt; ihre Bekanntheit speist sich darüber hinaus noch aus einem anderen bizarren Detail, in dem sich ihr Tod von den Tausenden Verbrennungsmorden an jungen Ehefrauen unterschied, die jährlich in Indien stattfinden: Shalina wurde nicht mit Benzin übergossen, wie die meisten, sondern mit Whisky.
Herr Chhabra spielt uns, auf unseren Wunsch, diesen Film vor. Er sieht ihn sich mit uns an und ergänzt die Sätze seiner Tochter dort, wo ihre Stimme versagt und man sie nur schlecht verstehen kann. Seine Frau sieht weg, ihr Blick zielt auf die entgegengesetzte Ecke des Zimmers, aber hören muß sie. Wie erträgt sie es, diese Filmkassette in ihrem Wohnzimmerregal aufzubewahren, diesen Film vorspielen zu lassen, immer wieder, für Journalisten, für Interessierte? Immer wieder die Stimme ihrer Tochter zu hören, aus einem gehäuteten, in Folie gewickelten Gesicht; immer wieder zu hören, wie sie zuerst den Tathergang beschreibt und dann, zuletzt, nur noch schwach nach ihrer Mutter ruft, ein bißchen wimmert und dann stirbt? Frau Chhabra erträgt es nicht; sie weint, lautlos, während die letzten Sekunden des Films abspielen und die Namen des Filmteams abrollen. In der Tür steht Shalinas Schwester, die zweitälteste Tochter, und nun sehen wir alle einige Minuten lang auf den Fernsehschirm, der nur noch schwarz flimmert, ehe Herr Chhabra sich besinnt und aufsteht, um ihn auszuschalten.
«Die Ehe in Indien ist ein Geschäft», erklärt uns später, angewidert, eine Sozialarbeiterin. «Wenn Sie vier Söhne haben, sind Sie Millionär. Wenn Sie vier Töchter haben, sind Sie ruiniert.»
Dabei ist der Ursprung dieser Sitte ein harmloser. Mitgift, ursprünglich war das nur eine Ausstattung, die liebende Eltern ihrer Tochter mit in die Ehe gaben. Und manchmal fügten sie noch ein paar kleine Aufmerksamkeiten für die Schwiegerfamilie hinzu. Dieser Brauch uferte jedoch schrecklich aus. Heute geht es in zahllosen Fällen nicht mehr um Geschenke, sondern um Bestechungen, Strafzahlungen und Lösegeld. Wer seine Tochter unter die Haube bringen will, muß viel bieten: ein aufwendiges Hochzeitsfest sowieso, goldene Armbanduhren, einen Kühlschrank, ein Motorrad, Schmuck für die Schwiegermutter, Saris für alle Frauen der Schwiegerfamilie, einen Farbfernseher. Geschickte Familien warten bis kurz vor der Heirat, um ihre Forderungen noch zu erhöhen. Denn die Hochzeit kurzfristig abzusagen, wäre dem Brautvater so entsetzlich peinlich, daß er ja sagen muß. Einige ganz besonders gierige Menschen warten sogar bis nach der Hochzeit. Sie sehen in dem jungen Mädchen nicht so sehr eine Braut als vielmehr eine Geisel. «Sag deinem Vater, daß er uns ein Auto kaufen soll.» «Dein Vater hat uns einen billigen, schlechten Fernseher gekauft. Sag ihm, daß er ein besseres Gerät schenken soll.» Um die Forderungen zu untermauern, wird das Mädchen beschimpft, beleidigt, geschlagen. Sie wird auch bedroht. Dann ist das, was «Ehe» heißt, eigentlich Terrorismus. «Dein Vater soll endlich das Auto bezahlen, sonst …»
Manchmal verheimlicht das Mädchen ihren Eltern solche Drohungen, weil sie sich schämt, weil sie ihrer Familie nicht noch zusätzliche Kosten verursachen will oder weil sie weiß, daß ihr Vater sich das Auto sowieso nicht leisten könnte. Manchmal gibt sie die Forderungen weiter und erhält von ihren Eltern die knappe Auskunft, daß man nun wirklich schon genug in sie investiert habe und sie jetzt selber sehen müsse, wie sie zurechtkommt, wie sie ihre neue Familie durch Fleiß, Demut und vielleicht eine schnelle Schwangerschaft auch ohne weitere Zahlungen für sich gewinnen kann. Und manchmal, gar nicht so selten, endet dieser Konflikt, wie Geiseldramen eben manchmal enden: mit der Hinrichtung der Geisel.
Dies geschieht sogar derart häufig, daß die indische Polizei vom Gesetzgeber bereits einschlägig Weisung erhalten hat: Wenn eine indische Frau in den ersten sieben Jahren ihrer Ehe stirbt, ist die Polizei angewiesen, von einem Mord auszugehen und entsprechend nachzuforschen.
Wir beginnen unsere eigenen Nachforschungen auch bei der Polizei. Die indischen Polizeistationen sind heimelig. Unter lieben Pastellbildern von turtelnden Tauben und flauschigen Kätzchen sitzen die Beamten und blättern für uns, nachdem wir die entsprechenden Bewilligungen eingeholt haben, in ihren Ordnern. Ja, gestern nacht, ein Mordversuch, das Mädchen liegt in der Verbrennungsklinik. Oder hier, vor zwei Tagen, eine Strangulierung, es ging um einen Motorscooter.
Bei Shalina ging es um Geld. Der Pandit, das ist der brahmanische Geistliche, der die Ehe arrangiert hatte, beschrieb die Familie zwar als gutsituiert. Tatsächlich aber gab es viele Probleme. Dieser junge Mann sollte einen Job kriegen, jener sein Studium finanziert bekommen, dieser Teil vom Haus renoviert und jenes neue Geschäftsunterfangen der Familie mit Kapital ausgestattet werden. Shalina wurde, um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen, geschlagen. Tagelang bekam sie nichts zu essen. Das sollte sie ihrem Vater berichten, damit er Angst bekam um sie und zahlte. «Ich habe ihr angeboten, daß sie wieder heimkommen kann», sagt Herr Chhabra. «Aber sie war sehr tapfer. Sie wollte uns nicht in Verlegenheit bringen. Sie wollte nicht, daß ihre Schwestern ihretwegen Heiratsschwierigkeiten haben.»
Shalina ertrug es bis zum Schluß, um ihre Familie nicht durch eine Trennung zu blamieren. Der Schluß: Ihr Mann überschüttete sie mit einer Flasche Whisky und setzte dann ihren alkoholdurchtränkten Sari in Brand. Dann schloß er sie, brennend, in ihrem Zimmer ein, damit sie nicht auf die Straße laufen und Hilfe erhalten konnte. Ein Nachbar hörte sie jedoch schreien und polterte so lange an der Tür, bis man ihn hereinließ. Mit einer Decke löschte er die Flammen. Aber die Familie schaltete schnell. Sie packten Shalina ins Auto, und dann fuhren sie so lange mit ihr ziellos durch die Straßen, bis sie schwor, ihre Verbrennung als Selbstmord auszugeben. Erst dann durfte sie in ein Krankenhaus.
Bei der Einlieferung war sofort klar, daß Shalina keine Überlebenschance mehr hatte, zu hochgradig waren ihre Verbrennungen. Der Arzt, Freund eines engagierten Filmemachers, rief das Videoteam herbei. Und Shalina war schon jenseits ihrer lebenslangen Rücksicht, ihrer Angst vor Skandalen und einem schlechten Ruf. Sie konnte, mit ihren letzten Worten, die Wahrheit sagen.
Viel hat es nicht genützt. Eine «Aussage auf dem Sterbebett» ist zwar nach indischem Recht ein unwiderlegbares Beweisstück. Es gab auch Zeugen und Beweise für die vorangegangenen Mißhandlungen und Bedrohungen. Aber Verurteilungen gibt es in solchen Fällen selten. Brautverbrennung, das ist Alltag, eine Privatangelegenheit. «Alle Leute sagen mir, daß ich die Sache vergessen soll», sagt Herr Chhabra. «Sie sagen, daß ich mir bloß noch größere Probleme aufbürde, wenn ich einen Skandal mache. Daß sich dann niemand finden wird, der meine anderen Töchter nimmt. Aber ich muß doch versuchen, eine Verurteilung zu erreichen. Nicht nur für Shalina, auch für die Tausende anderer Mädchen, die sonst noch umgebracht werden. Ich habe selber vier Mädchen, ich vertrete die Väter von Töchtern.»
Uns tut Herr Chhabra leid. All die Väter, die wir treffen und die den Verlust einer Tochter beklagen, tun uns leid. Sie haben alle denselben Gesichtsausdruck: eine Art ratloses Unverständnis. Die meisten von ihnen sind Geschäftsmänner; bis jetzt haben sie über Bilanzen und Schrauben und Motoren nachgedacht, sich als indische Patriarchen und Familienoberhäupter wohl gefühlt, ihre Töchter geliebt und sie der Sitte und dem Brauch entsprechend an einen Ehemann abgegeben. Und nun sind diese Töchter tot, und all die Orientierungsgrößen, an die sie ein Leben lang geglaubt haben, geraten in Zweifel: die Justiz, die Politiker, die ganze Gesellschaft. Statt dessen stehen sie ganz plötzlich auf einer Seite, die ihnen wildfremd ist. Herr Chhabra kramt in seinem dicken Adreßbuch, um zwischen den Namen der Lieferanten und Speditionen und Autofirmen die Telefonnummer seiner neuen Bündnispartner für uns herauszusuchen: die Feministische Aktionsgruppe Gegen Mitgift, die Frauengruppe Saheli. Die Väter tun uns leid, obwohl ihr Anteil an den Tragödien so deutlich ist. Sie waren es, die diese Ehen arrangiert haben, oft gegen den Willen ihrer Töchter. Sie waren es, die der Tochter zu Langmut und Gehorsam rieten und sie zurückschickten zu ihren Peinigern. Noch heute dominieren sie das Geschehen, beantworten sie alle Fragen, beherrschen sie jedes Gespräch, während ihre Frauen, die Mütter der Mädchen, schweigend neben ihnen sitzen. Noch während sie um die älteste Tochter trauern und sich Vorwürfe machen, steht für sie fest, daß auch die nächste Tochter in eine arrangierte Ehe geschickt wird. Was denn sonst? So macht man es eben.
Manchmal sprechen die Mütter zu uns. Hastig, wenn die Männer aus dem Zimmer sind. «Ich weiß», sagt die Mutter eines Mädchens, «bei euch ist es anders. Ihr habt es gut, ihr könnt euch eure Männer selber aussuchen.» Manchmal sprechen die jüngeren Töchter zu uns. «Wie gefällt Ihnen Indien?» fragt unvermittelt die Schwester eines Opfers. Wir halten es für eine Höflichkeitsfrage und stammeln eine passende Antwort: Gewiß, ein sehr interessantes Land. Das Mädchen schweigt kurz. «Ich hasse dieses Land», sagt sie dann. «Es ist ein schreckliches Land.» Dann kommt ihr Vater ins Zimmer zurück, und sie ist wieder still.
Unserem Kollegen, dem Fotografen Jai, tun die Väter hingegen überhaupt nicht leid. Er, der abgehärtete Kriegsreporter und Profi, entwickelt eine tiefe Empörung. Bald ist er ein Einmannkomitee gegen die Mitgift. Wo immer er eine junge Frau entdeckt, am Hotelempfang, im Autoverleih, erkundigt er sich streng nach ihrem Familienstand und hält ihr, wenn sie ledig ist, einen warnenden Vortrag. Sie soll bloß keinen Mann heiraten, den sie nicht kennt. Wenn sie sich gefährdet fühlt, soll sie sofort abhauen. Auf jeden Fall soll sie ihre Ausbildung beenden. Die Väter tun ihm gar nicht leid. Ihre Tränen rühren ihn nicht, und ihre Reue findet er unglaubwürdig.
Narindar Singh, Vater von Arveen, ist eigentlich ganz seiner Meinung. «Ich bin der Mörder meiner Tochter», sagt er.
Strenggenommen stimmt das natürlich nicht; strenggenommen ist sein Schwiegersohn der Mörder, denn dieser hat Arveen erwürgt. Aber Herr Singh ist, wie er nur zu gut weiß, daran nicht unbeteiligt. Er hat die Tochter unter Druck gesetzt, einen Mann zu heiraten, der ihr auf den ersten Blick (ein zweiter wurde ihr sowieso nicht erlaubt) nicht gefiel. Er hat seine Frau überstimmt, die von einem Besuch bei den zukünftigen Schwiegereltern mit alarmierenden Botschaften über deren Habgier zurückkehrte und auf Auflösung der Verlobung drängte. Und dann hat er noch die herzzerreißenden Briefe ignoriert, in denen seine Tochter um Wiederaufnahme im Elternhaus flehte und ihr Unglück auf endlosen tränenverwaschenen Seiten schilderte. Diese Briefe trägt Herr Singh heute mit sich herum, um sich damit zu geißeln. Er zeigt sie allen Menschen, die ihm über den Weg laufen; er drängt sie, die Briefe zu lesen, und dann sollen sie ihm sagen, ob er nicht ein Mörder ist. «Wirf mich nicht weg, Papa», steht in den Briefen. «Du kannst dir nicht vorstellen, wie schlecht es mir hier geht. Laß mich heimkommen, Papa, bitte, sonst muß ich hier sterben.»
Die späteren Briefe sind nicht mehr an den Vater adressiert, sondern an die Mutter. «Sag Papa nichts von dem, was ich dir erzähle», bittet sie darin die Mutter. «Sonst ist er wieder böse auf mich.»
«Warum war sie nur so brav!» flucht ihr Vater heute. «Hätte sie sich doch geweigert, ihn zu heiraten, statt mir zu gehorchen! Hätte sie doch nur darauf bestanden, ihn zu verlassen!» Das sagt er heute. Auf ihre Anrufe, auf ihre Briefe hatte er damals eine andere Antwort: Er riet der Tochter zur Geduld. Er riet ihr, ein Kind zu bekommen, um die Familie milder zu stimmen. Sogar diesen letzten Rat hat sie noch brav befolgt und der Familie damit ein weiteres Erpressungsopfer geliefert. Heute sagt der Schwiegersohn, daß Arveens Eltern das Enkelkind haben können – wenn sie die Mordanklage zurückziehen.
«Ich habe nichts als Fehler gemacht», sagt Narindar Singh und muß sich kurz abwenden, um seine Tränen wegzuwischen. Wir sitzen, wieder einmal, in einem Wohnzimmer. Diesmal in Bombay, in einem Apartment im Luxusviertel der Emporkömmlinge und Neureichen, für das spöttische Zungen den Namen «Follywood» erfunden haben. Wir trinken wieder einmal Tee, und eine stumme, resignierte Mutter bringt uns Kekse und serviert uns Äpfel in dünnen Scheiben.
Ein Jahr ist es her, seit Arveen getötet wurde, und ihre Familie hat sich scheinbar für immer in einem Mausoleum eingerichtet. Ein übergroßes Porträt der Tochter ziert den Couchtisch. Die Kleider des Enkelsohnes, vor langer Zeit gekauft für einen erhofften Besuch, sind fein säuberlich in einem Koffer verstaut; ohne sie erhalten zu haben, ist er ihnen längst entwachsen. Es gibt auch das obligate Hochzeitsvideo, auf dem wir Arveen in schillernden Kleidern sehen; der Bräutigam steht, mit einer Girlande aus Geldscheinen um den Hals, neben ihr. Und noch ein Bild von Arveen, aus dem gerichtsmedizinischen Institut, mit einer Girlande aus Würgemalen um den Hals.
Das Speisezimmer ist zur Kommandozentrale für Arveens Rächer geworden. Akten, Zeitungsausschnitte, Schreiben an Politiker stapeln sich auf dem Eßtisch, ihr Bruder verhandelt telefonisch mit Anwälten in Delhi. Während er früher Werbekampagnen entwarf, arbeitet Herr Singh heute an einer besonderen Anzeigenkampagne: «Meine Tochter ist tot. Sie wurde ermordet von ihrem Mann und ihren Schwiegereltern.» Diese Botschaft soll an die Öffentlichkeit, nach einem sorgfältigen Plan, der genau danach kalkuliert ist, den Schwiegereltern die größtmögliche Peinlichkeit zuzufügen.
Sein Sohn und Assistent in dieser Kampagne ist verlobt. Wir sehen das Verlobungsvideo. Seine Braut hat ein glitzerndes Kleid an, und seinen Hals ziert eine Girlande aus Geldscheinen.
Bis jetzt kennen wir die Mädchen nur über ihren Nachlaß: Familienalben, glitzernde Hochzeitsfotos, flehentliche Briefe und zum Abschluß ein Polizeifoto von der Leiche. Deshalb ist uns ganz besonders daran gelegen, mit «Bebi» zu sprechen. Sie hat, nach 78 Stunden im Koma, einen Mordversuch überlebt.
Es ist ein beeindruckendes Haus, vor dem unser Taxifahrer hält. Mehrere teure Autos stehen davor, der schattige Garten ist von einer Mauer umgeben. Bebis Bruder, der uns öffnet, ist adrett, modern; er studiert in England und ist nur zu Besuch da. Bebi ist nicht zu Hause; sie ist mit ihrem Vater beim Anwalt. Außerdem gibt es ohne «Daddy» ohnehin kein Gespräch; er muß entscheiden, ob die Familie mit uns spricht oder nicht. Während uns das alles erklärt wird, kommen Bebis Mutter dazu, ihre jüngere Schwester und ihr anderer Bruder, ein interessierter Nachbar und auch der Taxifahrer, der über diesen Fall in der Zeitung gelesen und dazu eine Meinung hat. Und schon wird ausführlichst erzählt, im Garten, während Millionen Moskitos unsere Beine zerstechen und wir uns dringend in einen bodenlangen Sari hineinsehnen. Und dann, viel später, werden wir freundlich verabschiedet und gebeten, morgen früh wiederzukommen, wenn Daddy da ist.
Am nächsten Morgen ist Daddy noch im Bad. Aber es wäre zu unhöflich, uns erneut auf der Straße stehenzulassen, also empfängt Bebi uns im modernen Wohnzimmer. Sie ist ein schönes Mädchen: lange, schwarze Haare, ein weiches Gesicht, ein eleganter blitzblauer Sari, eine sanfte Stimme, eine gewählte Ausdrucksweise. Sie war auf der Uni, hat studiert. Ihre Brüder gehen beide in London zur Schule. Sie aber mußte, nach ihrer Diplomprüfung, traditionsgemäß verheiratet werden.
Der erste Kandidat hätte Bebi gut gefallen. Aber der war dem Vater zu modern; er trug keinen Turban mehr und hatte sich den Bart rasiert, beides Dinge, die ein frommer Sikh nicht tun darf. Der nächste Kandidat kam aus einer strenggläubigen Familie, durfte daher auch Ansprüche stellen. Er war bereit, Bebi zu heiraten. Aber ihr Vater mußte ihm ein Auto kaufen, das Mädchen sollte keinerlei Kontakt mit ihrem Elternhaus mehr pflegen, und sie durfte keinen Beruf ausüben. Statt dessen sollte sie eine gefügige, demütige indische Braut sein und sich ganz an ihre neue Familie anpassen. Kein Wunder, daß Bebi mit einem flauen Gefühl im Magen ihren Hochzeitstag begann. «Ich habe den ganzen Tag davon geträumt, daß mein Vater die Zeremonie unterbricht und sagt: ‹Komm Bebi, wir gehen wieder heim.›»
Er sagte nichts dergleichen. Und Bebi zog mit ihrem neuen Mann zu seinen Eltern, seiner Schwester und seinen drei Brüdern. Dort hatte jedes Familienmitglied Anweisungen für sie. Ihre Kleider waren häßlich. Sie saß komisch da. Ihr Englisch war nicht gut genug. Sie war nicht schön genug. Sie sollte nicht sprechen. Worum es wirklich ging, war Geld. Bebis Vater war wesentlich wohlhabender als diese Familie, und er sollte mit zusätzlichen generösen Geschenken eine bessere Behandlung seiner Tochter erkaufen. Als sie es gar nicht mehr aushielt, flüchtete Bebi zu ihren Eltern. Die Mutter wollte sie gerne dabehalten, aber Daddy schickte sie zurück; die Schmach einer Trennung, das war undenkbar. Eine Frau verläßt ihren Mann nicht. Er schickte sie zurück, und wenige Tage später versuchte ihr Mann, sie mit dem Schal ihres Saris zu erdrosseln. Dann kam Bebi ins Krankenhaus, auf die Intensivstation. Und ihr Mann kam ins Gefängnis.
Bebi ist eine außerordentlich liebe, intelligente junge Frau. Ihre Brüder sind aufgeschlossen, Anteil nehmend, besorgt. Ihre Mutter ist liebevoll, kultiviert, nachdenklich. Die Stimmung ist gut. Bebi lächelt sogar, und wir sprechen von ihrer Zukunft. Es werden einige Ideen entwickelt. Sie könnte mit ihren Brüdern in London leben, dort weiterstudieren. Sie könnte zu Verwandten nach Delhi ziehen – auch so könnte sie dem Skandal ausweichen. Sie könnte, ihr lebenslanger Traum, die Hotelfachschule besuchen und dann am Empfang eines großen Hotels arbeiten, eines Hilton, eines Interconti. Dort machen viele indische Mädchen aus guter Familie Karriere, das gilt als respektabel.
Aber nun kommt Daddy. Frisch gebadet, im strahlendweißen neuen Turban, schreitet er diktatorisch im Wohnzimmer ein. Und Daddy hat einen anderen Plan. Er hat, gerade eben, mit seinem Anwalt organisiert, daß der Schwiegersohn auf Kaution freikommt.
Seine Tochter wird sich einige Wochen lang erholen, denn sie ist sehr «nervös».
Und dann wird er die «jungen Leute versöhnen».
Denn eine junge Braut gehört zum Ehemann, und Probleme kann es am Anfang einer Ehe immer geben. Den eigenen Ehemann dagegen anzeigen, sich scheiden lassen – das ruiniert den Ruf eines Mädchens, ihrer Schwester und ihrer Familie endgültig. Das kann Daddy nicht zulassen.