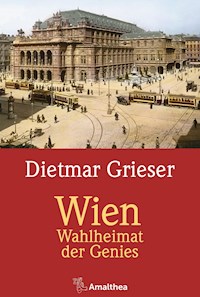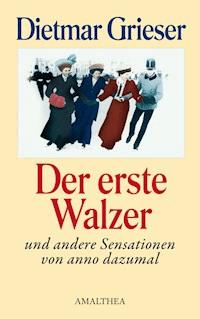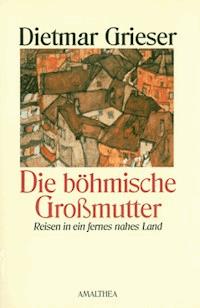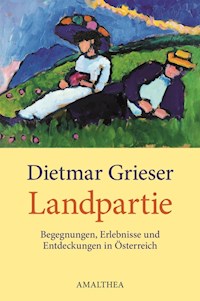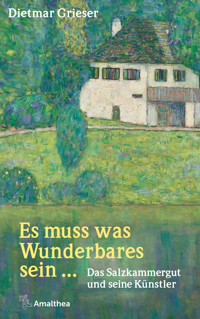Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wien mit den Augen eines Zugereisten Spurensucher Dietmar Grieser führt uns an seine Lieblingsplätze, in seine Stammlokale, zu den "Aussichtspunkten", an denen er sich auf die Lauer legt, um seine Mitmenschen zu beobachten. Wir lernen die Originale seines Wohnbezirks, die Geheimnisse seiner Schreibwerkstatt sowie eine Fülle lokaler Besonderheiten kennen, die in keinem der gängigen Reiseführer verzeichnet sind. Keine selbstgefällige Autobiographie, sondern ein witzig-spritziger Anekdotenschatz für alle, die Wien lieben. "Dietmar Grieser hat mir seinen Büchern die literarische Reportage zu neuer Hochblüte gebracht." BUCHKULTUR "Ein wunderbares Lesevergnügen." MANNHEIMER MORGEN
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietmar Grieser
Das gibt’snur in Wien
Eine autobiographische Spurensuche
Besuchen Sie uns im Internet unter amalthea.at
2. Auflage, Oktober 2012
© 2012 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Kurt Hamtil, verlagsbüro wien
Umschlagmotiv: imagno/Harry Weber/Kaiser-Franz-Joseph-Statue
im Burggarten
Bildredaktion: Mag. Victoria Bauernberger
Herstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger
& Karl Schaumann GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der 11,25/15 Punkt New Caledonia
Printed in the EU
ISBN 978-3-85002-805-9
eISBN 978-3-903083-96-7
Für Thomas und Claudia
Inhalt
Vorwort
Der Spaziergänger
Menschen im Hotel
Grünes Glück und grünes Pech
Bühne des Lebens
Erdberger Spaziergänge
Vom Papiermacherplatzl zur »Musikmeile Wien«
Die Grießergasse
»Sag danke, Opa!«
Absolution
Traumwelt Kino
Erst, wann’s aus wird sein …
Die Waldohreulen von Stammersdorf
Peking-Ente auf wienerisch
Der Genießer
Von Beiseln und Weinschenken, von Kaffeehäusern und Luxusrestaurants
Wiener Küche
Mein Meißner
Der Alltagsmensch
Die Sache mit der Staatsbürgerschaft
Diese Deutschen
Vierteltelefon und Hektograph
Unterm Dach
Nachrichten aus dem Grätzel
Hussein
Ein Dackel muß es sein!
Der Autor
Signierstunde
Lesung im Riesenrad
Nichts als Pannen
Hausbesuch
Das T-Shirt mit den drei Fischen
Vier Buchstaben
Der Vorlaß
Mein Nobelpreis
Was ich an Wien mag
Was ich an Wien nicht mag
Was ich an Wien mag
Was ich an Wien nicht mag
Was ich außerdem an Wien mag
Personenregister
Vorwort
Was, noch ein Wien-Buch? Ist zu diesem Thema nicht längst alles, alles, alles gesagt? Und habe nicht ich selber mit sage und schreibe acht einschlägigen Titeln diesbezüglich jedes zulässige Maß überschritten?
»Alte Häuser – große Namen« war das erste in der Reihe meiner Wien-Bücher; es folgten Porträtsammlungen wie »Wien – Wahlheimat der Genies«, das Pendant »Heimat bist du großer Namen« und »Verborgener Ruhm«, das Erotikon »Eine Liebe in Wien«, die Spurensuche »Weltreise durch Wien« und die Praterparade »Gustl, Liliom und der Dritte Mann«. Auch »Schauplätze österreichischer Dichtung«, »Köpfe« und »Der erste Walzer« sind Titel, die über weite Strecken Wien zum Gegenstand haben. Kaum eine der großen Figuren aus der opulenten Kulturgeschichte dieser Stadt, der ich mich nicht aus diesem oder jenem Blickwinkel genähert hätte.
Nur ein Aspekt schien mir bei meiner anhaltenden Beschäftigung mit dem Topos Wien entbehrlich: der Blick auf meine eigenen Erfahrungen mit dieser Stadt und ihren Menschen. Dazu habe ich mich allenfalls gesprächsweise geäußert. Doch immer öfter wurden Stimmen laut, ich sollte dies doch auch in Buchform tun.
Dem großen Humanisten Reinhold Schneider hat ein Aufenthalt von vier Monaten genügt, um das Material für den 300-Seiten-Band »Winter in Wien« zusammenzutragen. Es ist ein bedeutendes, ein überragendes Werk geworden, an das nichts, was ihm an Vergleichbarem gefolgt ist, heranreicht. Aber sind deswegen wir anderen, denen Wien ebenfalls – und oftmals über weit größere Zeitspannen hinweg – zum Schicksal geworden ist, zum Schweigen verurteilt?
55 Jahre lebe ich nun in dieser Stadt – das ist kein Lapperl. Da sammelt sich schon einiges an Erfahrungen, Erlebnissen, Erinnerungen an. Gemessen an dem großen Vorbild Reinhold Schneider mögen es Petitessen, Momentaufnahmen, Episoden mit Hang zum Anekdotischen sein. Sollten sie dennoch den vielen (und bekannten) Facetten Wiens die eine oder andere neue hinzufügen, hätte sich die Arbeit an dem vorliegenden Buch gelohnt.
Dietmar Grieser, im April 2012
Der Spaziergänger
Menschen im Hotel
Das Stephanushaus in der Ungargasse ist ein von katholischen Ordensschwestern geführter Beherbergungsbetrieb, der in punkto Kategorie schwer einzuordnen ist. Für ein Hotel zu wenig alert und freizügig, für eine Frühstückspension zu wenig intim und für ein Kloster wiederum zu weltlich, ist das sechsstöckige Haus aus den Sechzigerjahren, das über neunzig Betten, eine Empfangshalle, einen Gemeinschaftsraum, ein Fernsehzimmer und eine Kapelle verfügt, vor allem eines: preiswert und sauber. Seit vielen Jahren bin ich Stammkunde, führe dem Stephanushaus immer wieder Gäste zu, die auf Luxus weniger Wert legen als auf Solidität und Billigkeit. Den kargen Charme, den die Betreiberinnen – circa fünf Nonnen überwiegend fortgeschrittenen Alters – ausstrahlen, macht die günstige Verkehrslage des Hauses wett: Die Straßenbahn der Linie O vor der Tür, ist es auch nur wenige Schritte zur U-Bahn-Station Rochusgasse, man ist also im Nu im Stadtzentrum, auf den diversen Bahnhöfen, an den Hotspots des Sightseeing-Tourismus.
Hervorgegangen ist das Stephanushaus aus einer Priesterherberge, die in früheren Zeiten vornehmlich durchreisenden Geistlichen aus Ungarn offenstand, und in den oberen Etagen gibt es noch immer eine Reihe von Zimmern, die mit Dauergästen aus dem kirchlichen Bereich belegt sind: Priestern, die hier – wie in einer Art Ausgedinge – ihren Lebensabend verbringen.
Damit sie wissen, was sie erwartet, kläre ich die Gäste, die ich ans Stephanushaus vermittle, stets darüber auf, mit welchen Vor- und welchen Nachteilen sie zu rechnen haben, mit welchen Rechten und Pflichten, mit welchen Beschränkungen und auch – vorausgesetzt, sie bringen eine kräftige Dosis Humor mit – mit welchen Skurrilitäten.
Das Stephanushaus ist nichts für Leute, die an eine 24stündig besetzte Rezeption, an liebevolle Umsorgung durch ein Heer dienstbarer Geister oder an Extras wie Hausbar, Souvenirshop und Kosmetiksalon gewöhnt sind. Auch die den Schwestern eigene Strenge, die nur wenig Raum läßt für den gerade von Touristen hochgeschätzten Wiener »Schmäh«, ist wohl nicht nach jedermanns Geschmack. Am besten kommen mit Atmosphäre und Stil des Stephanushauses Leute mit Jugendherbergserfahrungen zurecht, und auch eine gewisse Nähe zur katholischen Glaubensgemeinschaft kann, wiewohl den Gästen nicht das Mindeste an Frömmigkeit abverlangt wird, von Vorteil sein. Der polnische Germanistikstudent Waldemar J., der im Frühjahr 2007 für eine Woche nach Wien kam, um Material für seine Doktorarbeit über mein literarisches Schaffen zu sammeln, und jeden Morgen zur Frühmesse in der hauseigenen Kapelle erschien, durfte sich ebenso der besonderen Zuwendung der Schwestern erfreuen wie jene Reisegruppe aus Portugal, die es sich nicht nehmen ließ, beim gemeinsamen Frühstück regelmäßig das Tischgebet zu sprechen.
Weniger Glück hatte ich mit jener fanatischen, ja fundamentalistischen Protestantin aus dem westfälischen Bocholt, die, treue Leserin meiner Bücher – nach jahrelangem nur brieflichen Kontakt mit mir – mit dem Wunsch nach Wien gekommen war, ihrem Lieblingsautor für ein paar Tage auch physisch nahe zu sein. Es war ein Fehler, sie im Stephanushaus einzuquartieren. Es war Hochsaison, das Haus war überbelegt, für Carla G. blieb nur ein Zimmer im fünften Stock, das normalerweise für pensionierte katholische Priester reserviert ist. Als ich Frau G. noch am Tag ihrer Ankunft – wie vereinbart – zu einem gemeinsamen Stadtbummel abholte, erfuhr ich, was geschehen war. Sie hatte ihr Zimmer bezogen, hatte ihren Koffer ausgepackt und war gerade im Begriff, ihre Sachen zu verstauen, als es beim Öffnen des Kleiderschranks zum Eklat kam: Das gute Möbelstück war prall gefüllt – und zwar mit lauter Meßgewändern: dem einfachen Werktagsund dem feierlichen Sonntagsornat, dazu Chorrock, Stola und Kollar.
Für die glühende Protestantin, der alles Katholische ein Greuel ist, ein schwerer Schock. Die Schwestern des Stephanushauses hatten in der Hektik des Betriebes versehentlich verabsäumt, das Zimmer von jenen Habseligkeiten zu befreien, die einer ihrer Dauergäste für die Zeit bis zu seiner Wiederkehr zurückgelassen hatte. Für Carla G. eine schier unerträgliche Zumutung: Nie im Leben würde sie es über sich bringen, ihre Kleider, Röcke und Blusen in einem Schrank zu verstauen, der mit »andersgläubigem« Gewand angefüllt war. Frau G., außer sich vor Empörung, bestand darauf, auf der Stelle das Quartier zu wechseln – wie hatte ich sie nur einer solchen Brüskierung aussetzen können! Es kostete mich alle meine Überredungskunst, sie zu beruhigen und – falls dies überhaupt möglich sein würde – zum Bleiben zu veranlassen. Ich rang nach Argumenten, appellierte an die allgemeinchristlichen Tugenden der Toleranz und Sanftmut, beschwor den Geist der Ökumene, flehte sie an, die Sache mit Humor zu nehmen, und brachte die verfahrene Situation schließlich doch zu einem guten Ende: Carla G. blieb.
Als wir einige Zeit später – mein Gast war inzwischen in sein Bocholt heimgekehrt – unsere Korrespondenz wieder aufnahmen, war ihr Zorn verflogen, sie bedankte sich überschwänglich für »die schönen Tage in Wien«, und sogar über ihr Mißgeschick mit dem »katholischen« Kleiderschrank konnte sie inzwischen, wie ich aus ihrem Brief herauslas, von Herzen lachen. Und ich bin sicher, auch die strengen Schwestern des Stephanushauses, die von dem Vorfall nichts mitbekommen hatten, würden, wenn ich ihnen heute davon erzähle, in Carlas Lachen fröhlich einstimmen.
Was meine eigenen Erfahrungen mit Wiener Beherbergungsbetrieben betrifft, so ist zunächst einmal festzuhalten, daß ich nicht nur zur Spezies der »Urbomanen« zähle (wie Paul Nizon unseresgleichen einmal genannt hat), sondern ein bekennender Hotelmensch bin. Es hängt wohl mit meiner angeborenen Neigung zu Bequemlichkeit und meiner Scheu vor den praktischen Dingen des Alltags zusammen, daß ich die Sorgen um Wohnen und Einrichten, um Möblieren, Reparieren und Instandhalten gerne anderen überlasse. Noch heute, wo ich längst glücklicher Eigentümer einer komfortablen Atelierwohnung in bester Wohnlage bin, könnte ich mir leicht vorstellen, auf Dauer in einem erstklassigen Hotel zu residieren – so wie das in früheren Zeiten unter Künstlern nichts Außergewöhnliches gewesen ist. Joseph Roth ist von einem Hotel ins andere übersiedelt, Marcel Prawy hat bis zuletzt im Sacher, Fritz Eckhardt bis zuletzt im Intercontinental gewohnt. Oskar Werner ist sogar in einem Hotelzimmer gestorben – es ist der Europäische Hof in Marburg, wo er im Zuge seiner letzten Deutschland-Tournee für ein paar Tage abgestiegen war. Es ist übrigens dasselbe Hotel, in dem auch ich regelmäßig logiere, wenn ich mich in der betreffenden Region aufhalte. Ich gebe allerdings zu, daß ich mein Zimmer im zwischenzeitlich in Marburger Hof umbenannten Haus stets mit gemischten Gefühlen beziehe – wer will schon, wenn er zu später Stunde in sein Quartier zurückkehrt und sich zum Schlafen niederlegt, an Todeskampf und Tod seines Vormieters erinnert werden?
Auch Wien ist reich an Gasthöfen, Pensionen und Hotels, in denen namhafte Personen ihr Leben ausgehaucht haben – so etwa der (nicht mehr existierende) Altenburger Hof in der Walfischgasse, wo dem englischen Schriftsteller W. H. Auden am 28. September 1973 die letzte Stunde schlug. Eine Gedenktafel erinnert an das traurige Ereignis, was übrigens eine rühmliche Ausnahme ist, läßt sich doch mit dem Tod keine Reklame machen und sei der betreffende Gast auch noch so prominent.
Als ich im Oktober 1957 nach Wien übersiedelte und mich nach einem ersten Quartier umsah, fiel meine Wahl weder auf ein bescheidenes Untermietzimmer noch gar auf eine »richtige« Mietwohnung: Ein preiswertes Hotelzimmer sollte es sein, von dem aus ich in aller Ruhe nach einer festen Bleibe würde Ausschau halten können. Die Tage in meinem Provisorium – so lautete der Plan – würde ich dazu nützen, die mir bis dato fremde Stadt kennenzulernen, ihre Wohnmöglichkeiten zu erkunden und sodann über meinen künftigen Verbleib zu entscheiden. Dieses »Wartezimmer« fand ich im Hotel Adlerhof am Hafnersteig, einer engen, nur für Fußgänger erreichbaren Gasse zwischen Fleischmarkt und Schwedenplatz.
Wienkundige Freunde in Münster, wo ich mein Universitätsstudium absolviert hatte, hatten mir auf dem Weg in mein neues Leben diese Adresse mitgegeben und im Hinblick auf meine kargen Finanzen sogar die Zimmernummer genannt, nach der ich fragen sollte. Nr. 32 war eine jener fensterlosen Schlafkammern unterm Dach, die zwar nur das Allernötigste an Mobiliar aufwiesen, dafür aber spottbillig waren.
Ich hatte Glück, Nr. 32 war frei, ich hatte an meinem künftigen Wohnort Wien ein Dach überm Kopf. Daß sich mir noch am Tag meiner Ankunft der »wahre« Charakter meines Domizils erschloß, schreckte mich nicht nur nicht, sondern machte die Sache nur noch interessanter: Das Hotel Adlerhof zählte zu jenen Etablissements, in denen Zimmer nicht nur für längere Aufenthalte, sondern auch für stundenweisen Gebrauch abgegeben werden. Weder das ständige Kommen und Gehen der einschlägig eskortierten Gäste noch die aus den Nachbarzimmern dringenden Begleitgeräusche störten mich. Im Gegenteil: Ich fand es aufregend, ohne eigenes Zutun am Liebesleben der Stadt teilzuhaben, und es lag lediglich an der etwas »einseitigen« Möblierung meines Zimmers (kein Schreibtisch, nur ein riesengroßes Bett), daß ich nach Ablauf einer Woche doch lieber auszog und mich nach einer neuen, einer »richtigen« Unterkunft umsah.
Als ich in späteren Jahren auch die noblere Seite der Wiener Hotellerie kennenlernte, bildete sich eine Reihe von Favoriten heraus, von denen ich mir gut vorstellen konnte, mich unter ihrem Dach auf Dauer niederzulassen. Das war und blieb natürlich ein unrealistisches Spiel mit extravaganten Begehrlichkeiten. Wer, mit solch bescheidenen Einkünften wie meinen, konnte sich ein Logis im Imperial leisten? Meine Erfahrungen mit den Wiener Luxusherbergen blieben also auf eine Reihe berufsbedingter Treffs mit prominenten Gästen beschränkt, die mich in »ihren« Hotelhallen zum Gedankenaustausch oder Interview empfingen.
Carl Zuckmayer, ein Mann von besonders unkompliziertem und leutseligem Naturell, ließ mich sogar in seine Suite ein – es war im damals noch nicht ganz so luxuriösen Sacher, in dem der schon betagte Dichter bei jedem seiner Wien-Aufenthalte mit Gattin Alice Herdan abzusteigen pflegte. Das Ehepaar bezog zwei nebeneinanderliegende Zimmer mit Verbindungstür. Zuckmayer war nach einem Herzinfarkt gesundheitlich angeschlagen; vom Nebenraum aus wachte Frau Alice darüber, daß ich die mir vom behandelnden Arzt zugestandene Gesprächszeit von einer halben Stunde um keine Minute überzog. Dafür war es Zuckmayer selber, der sich über das gebotene Limit lässig hinwegsetzte: Der Redefluß des sich wieder im Vollbesitz seiner Kräfte Wähnenden ließ keinen Blick auf die Uhr zu, und auch die mahnenden Worte seiner mehrmals in die Unterhaltung eingreifenden Ehefrau konnten den Dichter nicht zum Stoppen bringen. Eine Anekdote jagte die andere, und auch als ich mich schon fast verabschiedet hatte, rief er mir mit letzter Kraft noch eine weitere, eine allerletzte Schnurre nach, die sich gerade erst vor ein paar Tagen zugetragen hatte: Der damalige Bundeskanzler Klaus hatte durch einen seiner Emissäre anfragen lassen, ob der Dichter geneigt wäre, einen Orden der Republik Österreich anzunehmen. Zuckmayers Antwort: »Nein danke, eine Kiste Wein wäre mir lieber.« Bundeskanzler Klaus ging willig darauf ein: Noch am selben Tag wurde Zuckmayer das Gewünschte in die Hotelsuite geliefert, und es bedarf wohl keiner weiteren Erwähnung, daß es sich dabei um ein Gebinde aus den edelsten Sorten handelte, das selbst den ausgewiesenen (und einer rheinhessischen Winzerdynastie entstammenden) Weinkenner Zuckmayer in Jubel ausbrechen ließ.
Ein weiteres Wiener Luxushotel, in dem ich mich wiederholt mit Interviewpartnern traf, war das altehrwürdige Imperial am Kärntnerring, das allgemein dafür bekannt war, seinen Gästen auch die ausgefallensten Wünsche zu erfüllen. Hatten sie Kaiser Selassie von Äthiopien während seines ÖsterreichBesuchs nicht sogar den von ihm erbetenen Betsessel und König Baudouin von Belgien einen Beichtstuhl ins Schlafgemach gestellt?
Auch die Jugendstilpracht des Bristol wußte ich zu schätzen. Im dortigen Festsaal hatte ich als Gast der von Bundesratspräsident Herbert Schambeck geleiteten Österreichisch-Deutschen Kulturgesellschaft meine ersten Wiener Vorträge gehalten – die nachfolgenden Bankette im mustergültig geführten Hotelrestaurant waren jedesmal ein Fest.
Bei einer dieser Gelegenheiten erfuhr ich von einer wahrhaft grotesken Episode, die sich Anfang 1938 im Bristol abgespielt hat. Joseph Roth, vor der nun auch Österreich bedrohenden »braunen Gefahr« längst nach Frankreich emigriert, traf an der Seite seiner damaligen Lebensgefährtin, der Schriftstellerkollegin Irmgard Keun, zu einem letzten Kurzaufenthalt in Wien ein. Das Bristol war überbelegt, sämtliche Doppelzimmer vergeben. Joseph Roth und Irmgard Keun, frisch verliebt, mußten sich mit Einzelzimmern begnügen. Doch das noch größere Problem war die Unterbringung des zur selben Zeit in Wien weilenden Roth-Kollegen Anton Kuh. Der vier Jahre Ältere, berüchtigt für sein grenzgeniales Schnorrertum, nützte die Gelegenheit, sich mit Hilfe seines Freundes Joseph Roth ein Gratisquartier zu erschwindeln. Der Plan, den man gemeinsam ausheckte, sah vor, daß Roth den Kollegen Kuh heimlich in sein eigenes Zimmer einschleuste und seinerseits in dasjenige von Irmgard Keun zog. Der Coup wäre unbemerkt geblieben, wäre Anton Kuh nicht, wie es mitunter seine Gewohnheit war, splitternackt durch den Hotelkorridor gelaufen. Ein Zimmermädchen, des unverfrorenen Gastes ansichtig werdend, meldete den skandalösen Vorfall bei der Direktion des Hauses, und der Spuk endete, wie er enden mußte: mit schmachvollem Hinauswurf des »blinden Passagiers«.
Ein besonderes Faible hatte ich auch für das alte, damals noch nicht generalsanierte Ambassador in der Kärntnerstraße. Ich kannte es von den Recherchen, die ich im Lauf der Jahre für das eine oder andere meiner Buchthemen angestellt hatte. Im Ambassador (damals noch – unter dem Namen seines Gründers – als Hotel Krantz firmierend) hatte beispielsweise Mark Twain am 17. September 1898 eine Suite im zweiten Stock bezogen, von deren Fenstern aus der Dichter Kaiserin Elisabeths Beisetzung in der gegenüberliegenden Kapuzinergruft beobachten konnte, und auf dem Weg nach Venedig hatte im Frühsommer 1911 die polnische Aristokratenfamilie von Moes im Hotel Krantz einen Zwischenaufenthalt eingelegt (Sohn Wladyslav, ein bildhübscher, blondlockiger Knabe von zwölf Jahren, sollte einige Jahre später – als Hauptfigur der Thomas-Mann-Novelle »Tod in Venedig« – unter dem Namen Tadzio in die Weltliteratur eingehen). Auch mein Interesse für Karl Mays letzte Vortragsveranstaltung, die – zehn Tage vor dessen Tod – in den Wiener Sophiensälen stattfand und dem Autor des »Winnetou« einen Zuhörerrekord einbrachte, führte mich zu Recherchen ins Ambassador: Hier logierte der Siebzigjährige mit Gattin Klara im März 1912, hier machte ihm Bertha von Suttner ihre Aufwartung, hier versteckte man ihn vor den andrängenden Journalisten und vor den Massenhuldigungen der beim Kartenvorverkauf leer ausgegangenen Fans.
Das alte Ambassador war übrigens eine Zeit lang auch für mich selbst einer der bevorzugten Aufenthaltsorte. Hier, im links vom Hoteleingang gelegenen Café, das heute Teil des Verkaufsraums einer internationalen Modehauskette ist, nahm ich hinter den großen Fenstern mit Blick auf die Kärntnerstraße meinen Vormittagskaffee oder meinen Five-o-clock-Pernod ein, las die in reicher Vielfalt aufliegenden Zeitungen, traf meine Freunde, ordnete meine Notizen. Die schwache Besucherfrequenz, die morbide Eleganz des plüschig-verstaubten Mobiliars und die Diskretion des Bedienungspersonals machten das Lokal zu einem Geheimtipp, den unter anderem auch Einzelgänger wie Thomas Bernhard klug zu nutzen wußten. Sein (als »Komödie« titulierter) Roman »Alte Meister« ist über weite Strecken eine einzige Liebeserklärung an jene »Fensterecke« des Café Ambassador, wo der Dichter seinen Protagonisten, den Musikwissenschaftler Reger, tagtäglich Platz nehmen ließ – an dem Tisch »neben dem Judentisch, der vor dem Ungarntisch steht, der hinter dem Arabertisch steht«.
Zwei Dinge sind es vor allem, die Thomas Bernhards Romanfigur den Aufenthalt im Café Ambassador unentbehrlich machten: die jahraus jahrein gleichbleibende Raumtemperatur von 23 Grad und »die nicht nur architektonisch, sondern auch sanitär-soziologisch bis in die kleinsten Einzelheiten hinein perfekte Beschaffenheit der Toiletten«, die sich – so Bernhard – wohltuend abhob von den himmelschreiend elenden Sanitärverhältnissen der Wiener Gastlokale, Institutionen und Wohnungen. »Die Wiener Toiletten«, so holte Thomas Bernhard im Mittelteil der »Alten Meister« zu einem ebenso furiosen wie amüsanten Rundumschlag aus, »sind insgesamt ein Skandal. Selbst auf dem unteren Balkan finden Sie nicht eine einzige solche verwahrloste Toilette. Wien ist ein einziger Toilettenskandal; selbst in den berühmtesten Hotels der Stadt befinden sich skandalöse Toiletten. Wien ist ganz oberflächlich wegen seiner Oper berühmt, aber tatsächlich gefürchtet und verabscheut wegen seiner skandalösen Toiletten. Wenn Sie mit einem Wiener in seine Wohnung gehen, bleibt Ihnen meistens vor Schmutz der Verstand stehen.« Wovor ihm, dem Musik- und Kunstkenner Reger, besonders ekelte, seien die diesbezüglichen Verhältnisse im Kunsthistorischen Museum gewesen, die ihn förmlich dazu gezwungen hätten, sich zur Verrichtung seiner Notdurft ins Ambassador zu retten. Thomas Bernhards Resümee: »Wenn ich das Ambassador nicht hätte, überlebte ich nicht.«
Zu der Zeit, da ich selber häufig im Ambassador verkehrte, wurde das Hotel von zwei alten Damen geführt. Sie waren Schwestern, beide schon etwas gebrechlich, mit dem Management des Hauses eindeutig überfordert. Der Betrieb ging schlecht, es fehlte an neuen Ideen, an Marktstrategie, an Werbung. Ich schlug ihnen daher vor, Thomas Bernhards wortmächtige Elogen auf das Ambassador für ihre Reklamezwecke zu nutzen, keinen besseren Apologeten könnten sie sich wünschen als den inzwischen allseits, ja weltweit berühmten Dichter. Doch die beiden Damen rümpften die Nase und wehrten verschreckt ab: Um Himmels Willen, die Auslassungen dieses zügellosen »Herrn Bernhard« seien keineswegs nach jedermanns Geschmack, würden bei der noblen Klientel des Ambassador auf heftigsten Widerstand stoßen, und das mit den Toiletten, wenn es auch noch so gut gemeint sei, wäre überhaupt indiskutabel, unter keinen Umständen für einen Hotelprospekt wie den ihren geeignet. Ich gab meinen Kampf auf, das Kapital blieb ungenutzt, und mit dem Ambassador ging es in der Folge weiter bergab (bis zu seinem späteren Neuaufschwung).
Grünes Glück und grünes Pech
Wenn ich in meinem Wohnviertel aus dem Haus trete, im Arenbergpark meine Runden drehe und dabei auf die Gärtnerinnenbrigade treffe, die die Blumenbeete pflegt, das Unkraut auszupft und neue Pflanzen setzt, geselle ich mich mitunter zu den ebenso geschickten wie fleißigen Arbeiterinnen und lobe sie für ihre hervorragenden Dienste. Zuerst begegneten sie mir mit Mißtrauen, hatten wohl erwartet, daß ich irgendetwas zu beanstanden hätte, zu »matschkern«, wie man in Wien sagt. Inzwischen kennen sie mich, begrüßen mich und machen mich von sich aus darauf aufmerksam, welche Blumen beim nächsten Turnus vorgesehen sind, oder machen mir gar Hoffnung, meine eigenen Anregungen aufzugreifen und an den zuständigen Revierleiter im Gartenamt weiterzuleiten.
Ja, Wien ist eine Stadt, die über die herrlichsten Grünflächen und Parks verfügt und sie auch mustergültig pflegt. Daß sogar manche der abgasverseuchten Hauptverkehrswege von Blumenrabatten gesäumt sind, versetzt mich regelmäßig in Verwunderung: Wie schaffen es diese tapferen Gewächse, dem permanenten CO2-Ausstoß zu trotzen und, davon unbeirrt, ihre Blütenpracht zu entfalten?
Unter den zahlreichen öffentlichen Grünanlagen der Stadt sind neben »meinem« Arenbergpark der elegante Burggarten, der abwechslungsreiche Türkenschanzpark und der lehrreiche »Botanische« meine Favoriten. Auch Stadtpark, Volksgarten und Prater möchte ich nicht missen, und selbst dem einen oder anderen »Beserlpark«, obwohl arm an Schönheiten, vermag ich gewisse Reize abzugewinnen und sei es nur das Erstaunen darüber, wie sich auch in den ärgsten Betonwüsten so manches Stückchen Flora zu behaupten weiß.
Was mir weniger gefällt, sind die Horden von Joggern, Nordic-Walkern und Gymnastikern, die in zunehmendem Maß von den Wiener Parks Besitz ergreifen. Müssen sie unbedingt vor meiner Nase ihre Glieder recken, ihren Schweiß ausdünsten und ihre seltsamen Geräte in Betrieb setzen?
Woran es in Wien – so wie in anderen Großstädten auch – fehlt, ist lediglich der nach außen sichtbare Blumenschmuck der Wohnhäuser: Ich sehe reihenweise Fenster, Veranden und Balkons, aus denen nicht das kleinste bißchen Grün sprießt. Wie gut täte da der Millionenstadt ein Schuß Alpbach, Sankt Jakob im Walde oder Altaussee!
Ich gebe allerdings zu, daß auch mein eigener Beitrag zur pflanzlichen Behübschung der Stadt zu wünschen übrig läßt. Ich habe mir zwar in früheren Jahren alle Mühe gegeben, meine Fenster mit Blumenkästen und meine Terrasse mit Topfpflanzen zu schmücken, scheiterte jedoch wieder und wieder an meiner gärtnerischen Unzulänglichkeit und gab daher meine Bemühungen, mit der Aufzucht von Pelargonien, Stechpalmen und Bananenstauden zu brillieren, entmutigt auf. Erst recht mißlang es mir, das Prachtexemplar eines Bonsais, der mir geschenkt worden war, durchzubringen: Eine Massenattacke gefräßiger Raupen killte den heiklen Gesellen bis aufs letzte Blatt. Mit den heftigsten Schuldgefühlen denke ich auch an jene Kostbarkeit zurück, die mir der hochgeschätzte Kollege Heinz Knobloch vor Jahren als Gastgeschenk aus Berlin mitgebracht hatte: ein wunderschönes Exemplar von Goethes Urpflanze. Bis heute habe ich dem freundlichen Spender verschwiegen, daß sein »Bryophyllum« an dessen neuem Bestimmungsort kläglich eingegangen ist. Ich werde also wohl mit der schmerzlichen Einsicht leben müssen, daß ich nicht über jene Gabe verfüge, die man in Wien ein »grünes Handerl« nennt.
Hatte ich mich mit diesem Defizit nicht schon in Kindertagen abfinden müssen, als mein Vater – es war in den gemüse- und obstarmen Jahren nach 1945 – die Idee gehabt hatte, uns drei Söhne zu individueller gärtnerischer Aktivität anzuspornen? An den wiesenreichen Ausläufern der Kleinstadt, in der unsere Familie damals lebte, war meinem Vater vom Magistrat eine herrenlose Grünfläche von vier mal sechs Metern zugesprochen worden, die er in drei gleichgroße Beete aufteilte und meinen beiden Brüdern und mir zur selbständigen »Bewirtschaftung« überließ. Das Nützliche mit dem Didaktischen verbindend, schwebte ihm vor, jeder der drei Buben würde auf seinem Beet nach Gutdünken Nutzpflanzen aufziehen, die – falls das Experiment gelänge – dem notleidenden Haushalt unserer Mutter zugute kommen würden. Karotten, Erbsen und Fisolen aus dem eigenen Garten – welch verlokkende Aussicht!
Die Rechnung meines Vaters ging zum Teil auf – jedenfalls, was meine Brüder betraf. Die Saat ihrer beider Beete ging wunschgemäß auf; insbesondere Helmut (der denn auch in späteren Jahren prompt Gartenarchitekt wurde) konnte mit stattlichen Erträgen prahlen. Nur auf meinem Beet rührte sich wenig, und meine angeborene Scheu vor jeder Art von Wettstreit tat ein Übriges, meine gärtnerischen Ambitionen alsbald zum Erliegen zu bringen.
35 Jahre später – nun schon in Wien ansässig und Besitzer einer geräumigen Atelierwohnung mit allen Möglichkeiten der Begrünung – unternahm ich einen neuen (und wohl letzten) Anlauf, mich als »Pflanzer« zu bewähren. Amaryllis, Clivia und Philodendron bevölkerten mein Heim, und auch wenn sich die Lebensdauer meiner grünen Lieblinge in Grenzen hielt, konnte ich doch – bei strenger Einhaltung der Pflegevorschriften – gewisse gärtnerische Erfolge verbuchen. Vor allem mein 1982 erworbener, zu der stolzen Höhe von vier Metern aufragender Ficus lyrata wurde mir zu einem geliebten Hausgenossen, ohne dessen Blätterpracht ich mir mein Leben kaum noch vorstellen konnte. Doch leider leider – auch diesmal ging die Sache schief.
Ich nenne keine Namen, verrate weder Sender noch Sendung. Ich sage nur so viel: Das Fernsehen hat meinen schönen Baum auf dem Gewissen. Aber bin ich nicht letztlich selber daran schuld? Hätte ich nicht aufpassen müssen, daß die Eindringlinge, als sie zum Interview in meiner Wohnung anrückten und ihre Vorbereitungen für den Anderthalb-Stunden-Dreh trafen, kein Unheil anrichten?
Kameramänner, Toningenieure und Beleuchter sind in der Regel freundliche und unkomplizierte Leute, mit denen man sofort auf ein Bier gehen würde, denen man sorglos Wohnungsschlüssel und Tresorcode anvertrauen könnte. Nur eines macht den Umgang mit ihnen problematisch: ihr unstillbarer Drang nach Veränderung. Sie stellen in den Räumlichkeiten, die sie zum Drehort gewählt haben, alles auf den Kopf. Um die bestmögliche Perspektive und den optimalen Bildhintergrund zu erzielen, lassen sie keinen Stein auf dem anderen. Tische werden verrückt, Sessel und Stehlampen hin und her geschoben, Bücher und Papierstapel umgeschichtet: Kein Gegenstand ist vor ihnen sicher. Und ziehen sie nach getaner Arbeit ab, ist der Raum, in dem sie gewerkt haben, nicht mehr wiederzuerkennen. Dem Gastgeber fällt dabei die stumme Rolle des tatenlos Zusehenden zu: Wer, den es ins Fernsehen drängt, würde es wagen, einem Kamerateam ins Handwerk zu pfuschen?
Diesmal aber – so wurde mir nach Beendigung der Aufnahme klar – hätte ich eingreifen, hätte ich mich querlegen müssen. War es denn unbedingt nötig, daß sie sich auch an meinem Baum vergreifen, ihn drehen und wenden, ihn herumschieben wie ein lästiges Möbelstück?
Der Baum – das ist, wie schon erwähnt, mein vier Meter hoher Ficus lyrata, der seit fast dreißig Jahren seinen immer gleichen Platz zwischen Atelier und Terrasse innehat. Schon wegen des immensen Gewichts des dazugehörigen Kübels habe ich den sanften Riesen in all den Jahren kein einziges Mal verrückt – mit meinen schwachen Kräften wäre ich dazu sowieso nicht imstande gewesen. Ich erinnere mich gut, wie er mir seinerzeit von einem Helfertrupp der Schönbrunner Bundesgartenverwaltung ins Haus geliefert wurde. An einem Freitagmorgen rückten sie zu zweit an, um das riesige Gewächs in den fünften Stock zu hieven. Doch das Unternehmen mußte abgebrochen werden, Baum und Kübel waren zu schwer. Wir einigten uns darauf, ihn übers Wochenende im Eingangsbereich des Hauses ruhen zu lassen und am folgenden Montag, nun aber um zwei Männer verstärkt, einen zweiten Anlauf zu versuchen. Und diesmal klappte es: Die Gärtner, in puncto Raumstatik ebenso ausgewiesene Kenner wie in puncto Lichteinfall, wiesen meinem Ficus den für sein weiteres Gedeihen idealen Standort zu, und dabei blieb es für die folgenden drei Jahrzehnte. Nichts wurde an seiner Position geändert, und da ich mich auch hinsichtlich Wässerung und Düngung streng an die Empfehlungen der Fachleute hielt, entwickelte sich mein grüner Hausgenosse prächtig. Auch meine Angewohnheit, regelmäßig mit ihm zu sprechen, ihn bei frischem Sprießen zu loben und bei eklatantem Verdorren zu tadeln, tat ein Übriges, sein Wachstum zu fördern. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, zwischen meinem Ficus und mir habe sich mit den Jahren so etwas wie eine Liebesbeziehung entwickelt.
Natürlich war diese Beziehung auch mancherlei Schwankungen ausgesetzt: Vor allem in letzter Zeit stellten sich an diesem und jenem der Äste Ermüdungserscheinungen ein, die Blattverluste häuften sich, schon war das Schlimmste zu befürchten. Doch immer, wenn der grüne Greis schlappzumachen schien, »derrappelte« er sich wieder, produzierte frische Blätter, erfreute mich mit überraschenden Signalen neuer Hoffnung.
Bis zu dem Tag, da das Fernsehen zu mir kam …
Ach, hätte ich doch aufgepaßt und die ahnungslosen Filmleute davon abgehalten, meinen Ficus herumzubugsieren! Abgelenkt durchs stille Memorieren der zu erwartenden Interviewfragen und -antworten, war meinem Blick entgangen, was da wenige Schritte von mir entfernt vonstatten ging, und als ich schließlich das ganze Ausmaß des Unglücks erkannte, war’s für jedes Eingreifen zu spät. Nur wenige Tage gingen ins Land und mein armer Baum warf in rasanter Folge seine Blätter ab, wurde von Stunde zu Stunde nackter und nackter, hatte seine Standortveränderung nicht verkraftet. Ich konnte mir ausrechnen, wann es so weit sein würde, endgültig von ihm Abschied nehmen zu müssen.
Es wurde ein trauriger Abschied. Um den erlittenen Verlust weder dem Leichtsinn der ansonsten so netten Fernsehleute noch meiner eigenen Unachtsamkeit anlasten zu müssen, flüchtete ich mich in den Gedanken, irgendwann wäre es wohl sowieso mit meinem grünen Hausgenossen zu Ende gegangen. Gewiß, gewiß. Und dennoch: nur ein schwacher Trost.
Bühne des Lebens
Es war eine Werbeveranstaltung in den noblen Räumlichkeiten des Palais Kinsky auf der Freyung; die Spitzen der Dresdner Tourismuswirtschaft hatten im Verein mit der Deutschen Botschaft zu einer Multimedia-Show über die Schönheiten der sächsischen Barockmetropole eingeladen, die von Kennern gern als Elbflorenz gepriesen wird. Man erfuhr eine Menge über die berühmten Bauwerke der 1945 zerstörten und nach dem Krieg mustergültig wiederaufgebauten Stadt: über Zwinger und Frauenkirche, über Semperoper und Grünes Gewölbe und über vieles andere mehr. Eine der Referentinnen, deren Ausführungen wir lauschten, rühmte vor allem die leichte Erreichbarkeit all der Sehenswürdigkeiten, und sie verwendete dafür eine Wortschöpfung, die ich zum ersten Mal hörte: Dresden, so führte sie aus, sei eine Stadt von optimaler »Fußläufigkeit«.
Ich kann nicht sagen, daß mir dieser Begriff gefiel. Bei »Läufigkeit« denkt unsereins eher an das Sexualverhalten geschlechtsreifer Hündinnen, aber immerhin war klar, was damit gemeint war: die Möglichkeit, die Wegstrecken zwischen den einzelnen Bauten auf bequeme Weise zu Fuß zurückzulegen. Du brauchst für deine Rundgänge keine öffentlichen Verkehrsmittel, gelangst ohne Touristenbus oder Taxi ans Ziel, kommst mit deinen zwei Beinen aus.
Auch wenn ich wenig Neigung verspüre, den von den Dresdner Touristikexperten geprägten Begriff »Fußläufigkeit« in meinen Wortschatz aufzunehmen, stimme ich ihm in der Sache zu – umso mehr, als auch Wien zu jenen Städten zählt, in denen sich der Besucher weitgehend per pedes bewegen kann. Ob vom Stephansdom zur Oper oder von der Hofburg zum Belvedere – überallhin sind es nur wenige Schritte, bloß in den Prater, auf den Kahlenberg oder nach Schönbrunn wird man auf U-Bahn oder Bus zurückgreifen.
Und doch: Das Fußgängerparadies Wien hat auch Mängel. Was Wien – etwa im Gegensatz zu Paris – fehlt, sind die Lokale, von denen aus man, bequem in seinem Sessel ruhend und genüßlich seinen Aperitif schlürfend, das Leben und Treiben der Straßenpassanten verfolgen kann. Die Pariser Cafés mit ihren demonstrativ zum Gehsteig hin aufgestellten Tischen und Sesseln bilden einen idealen Aussichtspunkt, das Völkergemisch der Passanten, ihre modischen Eigenheiten und die Besonderheiten ihrer Selbstdarstellung zu beobachten, zu bestaunen und zu kommentieren.
Nicht so in Wien: Hier sind die nach außen geöffneten Lokalitäten – ob Ringstraßencafé, Hotelterrasse oder Schanigarten – nicht der Straße, sondern dem Lokalinneren zugewandt, ja durch Zaun, Spalier oder Kübelpflanzenarrangement vom Passantenstrom abgeschirmt: Man will für sich sein, ungestört vom Rest der Welt, will nur die Gesellschaft seiner Zechkumpane genießen, nicht aber das Spektakel, das sich hinter dem Rücken der Gäste abspielt.
Auch der »Corso« der Italiener, die sich zu bestimmten Stunden und an bestimmten Plätzen zu lockerem Flanieren, zu lauthals geführtem Gedankenaustausch und zu genüßlichem gegenseitigen »Ausrichten« treffen, ist den Wienern fremd. Ich kenne nur wenige Örtlichkeiten in dieser Stadt, an denen man lustvoll den Freuden der Menschenbeobachtung frönen kann.
Der Stadtpark mit seinem üppigen Angebot an Sitzgelegenheiten ist eine dieser raren Bühnen mit hohem Observierpotential. Wenn die im nahen »Intercontinental« logierenden Großfamilien aus den orientalischen Ländern zum Nachmittagsspaziergang ausschwärmen – Vater »Pascha« vorneweg, die Kinderschar und die tiefverschleierten Ehefrauen in gemessenem Abstand hinterdrein –, bietet sich dem Passanten ein faszinierendes Bild exotischen Lebensstils, das sich in Türkenvierteln wie dem Kardinal-Nagl-Platz oder dem Brunnenmarkt aufs malerischste wiederholt.