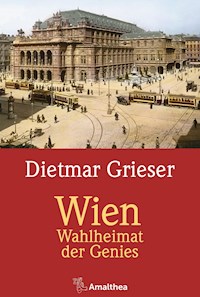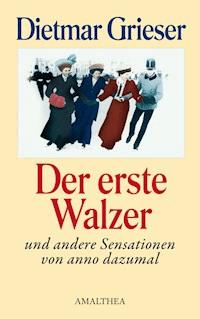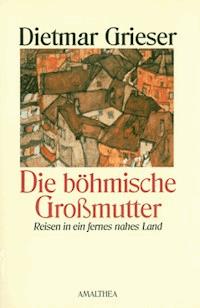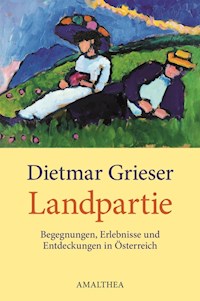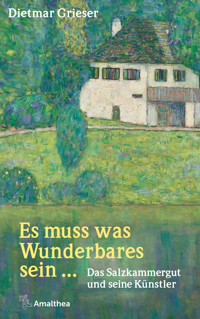Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Vom Glück der Spätberufenen Die Dienstmagd Anna Mary Robertson ist 75, als sie unter dem Künstlernamen Grandma Moses zur "Weltmeisterin der naiven Malerei" aufsteigt, die Bäuerin Anna Wimschneider erobert als 66-Jährige mit ihrem Roman "Herbstmilch" sämtliche Bestsellerlisten, und der Wiener Bürgermeister Theodor Körner ist gar schon 78, als er zum Bundespräsidenten der Republik Österreich gewählt wird. Das berühmte Köchel-Verzeichnis ist die Fleißarbeit eines pensionierten Staatsbeamten aus Krems, das Sozialwerk "Künstler helfen Künstlern" die Initiative einer abtretenden Burgschauspielerin, Axel Munthes "Buch von San Michele" der Geniestreich eines ehemaligen (und inzwischen erblindeten) Modearztes. Der Chansonnier Charles Aznavour ist 85, als er das Amt des Botschafters seines Heimatstaates Armenien antritt. Auch Daniel Defoe, der Autor des Abenteuerromans "Robinson Crusoe", zählt zu den Spätberufenen, und die englische Rockband "The Zimmers" setzt sich aus Rentnern zusammen, deren Altersdurchschnitt 78 beträgt. Auch im Privatleben alternder Stars kommt es zu erstaunlichen Ausbrüchen später Jugendlichkeit. So lernt George Bernard Shaw erst mit 68 Tanzen, Charlie Chaplin wird mit 73 Vater, und Pablo Casals tritt mit 80 vor den Traualtar. Spurensucher Dietmar Grieser hat die interessantesten unter den Spätberufenen mit der ihm eigenen Entdeckerfreude und Sensibilität porträtiert – es ist seine ganz persönliche Antwort auf den heute alles beherrschenden Jugendkult. Das richtige Buch zur richtigen Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietmar Grieser
Es ist nie zu spät
Ihr zweites LebenVon Charlie Chaplin bis Karlheinz Böhm
Besuchen Sie uns im Internet unter amalthea.at
1. Auflage Juni 2010
2., durchgesehene Auflage August 2010
3. Auflage Dezember 2010
© 2010 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Kurt Hamtil, verlagsbüro wien
Umschlagmotiv: »Birthday Cake« von Grandma Moses
© by Gallery St. Etienne/Bridgeman
Bildredaktion: Victoria Bauernberger
Herstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger
& Karl Schaumann GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der 11/14 Punkt New Caledonia
Druck und Bindung: CPI Moravia Books GmbH
Printed in the EU
ISBN 978-3-85002-718-2
eISBN 978-3-903083-94-3
Für Ursula
Verachtet mir die Alten nicht und ehrt mir ihre Kunst.
(frei nach Richard Wagner:»Die Meistersinger von Nürnberg«)
Inhalt
Vorwort
Vernissage mit Marmeladebrot
Fachwechsel
»Nichts bleibt immer so …«
»Flicki« und die Kühe
Ein Spätling namens Robinson
Therapeutikum Wien
Von Schmerzen gebeugt
Ein blinder Seher
Von der Muse geküßt
Die strümpfestopfende Bestsellerautorin
Kirchenrecht und Meuchelmord
Das Spätwerk des Herrn von Köchel
Tagliatelle alla Bergonzi
Ein tolles Comeback
Die rüstigen Rentner
Ohne Mantel und Hut
Eislaufen mit Worten
Der singende Botschafter
Kein Heim wie jedes andere
Im Anfang war die Wette
Newmans Vermächtnis
Körper mit Seele
Tanzstunde
Das achte Kind
Heirat mit achtzig
Der Themenpark des Monsieur Cheval
»… und vergiß nicht aufs Knickserl!«
Toga und Olivenzweig
»Es ist nichts dabei!«
Die Königin der Diebe
Literaturverzeichnis
Vorwort
Ich hoffe, niemand erwartet von mir einen Beitrag zur ohnehin überbordenden Gattung Ratgeberliteratur. Für Tipps, wie man sorglos durchs Alter kommt oder gar das letzte Lebensdrittel für einen »Neubeginn« nützt, sind andere zuständig.
Nein – auch in dem hier vorliegenden Buch bin ich der, der ich immer war: Spurensucher, Porträtist, Geschichtenerzähler. Daß ich dabei auf das Phänomen der »Spätberufenen« gestoßen bin, die erst in vorgerückten Jahren zu ihrer eigentlichen Bestimmung gefunden haben, hat einen einfachen Grund: Auch ich selber habe die 75 überschritten, denke vermehrt über den Prozeß des Älterwerdens nach, lasse mich von Menschen faszinieren, die es geschafft haben, zu einem Zeitpunkt, da die meisten anderen längst ihre Hände in den Schoß gelegt haben, sich zu etwas ganz Neuem aufzuraffen und damit vielleicht sogar Berühmtheit zu erlangen.
Die Kulturgeschichte kennt viele solcher großen Namen, die erst im hohen Alter Karriere gemacht beziehungsweise ihrer Karriere eine neue Richtung gegeben haben. Von dem französischen Moralisten Nicolas de Chamfort, einem Zeitgenossen Mozarts, stammt das schöne Wort »Es tritt der Mensch in jedes Alter als Novize ein«. Von einer Reihe solcher »Novizen«, denen erst in späten Jahren ihre berufliche oder auch private Erfüllung geglückt ist, soll in diesem Buch die Rede sein. Daß ein großer Teil von ihnen dem österreichischen Kulturraum entstammt, hängt mit meiner eigenen Biographie zusammen: Ich lebe seit meinem 23. Lebensjahr in Wien.
Vernissage mit Marmeladebrot
Ihre Bilder tragen Titel wie »Apfelpflücker«, »Waschtag« oder »Der Postbote war da«. Jedes einzelne erzählt eine Geschichte, wie sie ältere Menschen – vor allem auf dem Lande lebende – aus ihrer eigenen Kindheit in Erinnerung haben: »Drachensteigen«, »Kerzengießen« oder »Zuckerernte im Ahornwald«. Den einen spricht »Großvaters Haus« oder »Landstreicher am Weihnachtstag« mehr an, den anderen »Der eichene Brunneneimer« oder »Das erste Automobil«. Über 1600 sind es insgesamt, das meiste auf Preßholz gemalt und in Öl, durchwegs in hellen, leuchtenden Farben und passend gerahmt.
Sähe man sie alle an einem Ort versammelt, wären sie wohl das, was man ein Lebenswerk nennt.
Doch es ist ein Lebenswerk, das erst im Alter von 75 einsetzt. Und auch erst mit 101 endet. Der Name der Künstlerin: Anna Mary Robertson alias Grandma Moses. Die Großmutter – pardon – Großmeisterin der naiven Malerei.
Eines gleich vorweg: Sollten Sie – etwa beim Besuch eines der einschlägigen Museen – Gelegenheit haben, sich in Grandma Moses’ Œuvre zu versenken, sich dabei in ihre Bilder verlieben und davon träumen, selber eines davon zu besitzen, wird es wohl beim Träumen bleiben. Selbst die kleinsten Formate sind heute für einen Normalmenschen unerschwinglich, auch gelangt davon kaum noch etwas in den Handel. Alles ist seit Jahr und Tag in fester Hand. Grandma Moses’ Bedeutung für die Welt besteht daher in etwas ganz anderem: in ihrer Vorbildwirkung. Genauer gesagt: in der Botschaft, die sie mit ihrem Werk aussendet. Und diese Botschaft lautet: Auch als alter Mensch kannst du es zu etwas bringen – zu sinnvoller Beschäftigung, zu künstlerischer Erfüllung, ja zu Weltruhm. Und sogar (woran dieser Anna Mary Robertson allerdings am wenigsten lag) zu Geld.
Selbst für Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ist es eine Erfolgsgeschichte ohne Beispiel. Am 7. September 1860 kommt Anna Mary Robertson in Greenwich im US-Bundesstaat New York zur Welt. Ihre Vorfahren sind schottisch-irischen Geblüts, der Vater betreibt eine kleine Farm in Washington County. Über ihre sorglos-glückliche Kindheit auf dem Lande wird sie später zu Protokoll geben:
Ich schaukelte die Wiege der kleinen Schwester, erhielt von der Mutter Unterricht im Nähen und vergnügte mich mit den Brüdern. Wir machten Flöße und ließen sie auf dem Mühlteich schwimmen, wir streiften durch die Wälder, wir sammelten Blumen und bauten Luftschlösser.
Härter wird ihr Leben, als Anna Mary in die Schule kommt. Die Winter sind in ihrer Heimat streng, auch fehlt es den Kleinen an warmer Kleidung. Außerdem fällt daheim eine Menge Arbeit an, auch die Kinder müssen im Haushalt mithelfen. Der Schulunterricht bleibt auf sechs Monate im Jahr beschränkt – drei im Sommer, drei im Winter.
Schon mit zwölf verläßt Anna Mary das Elternhaus, verdingt sich als Dienstmagd. Ihre erste Stelle findet sie bei einem betagten Ehepaar: gutherzige, fromme Presbyterianer, die der Heranwachsenden die aufopfernde Haushaltsarbeit und Krankenpflege mit ziehelterlicher Zuwendung belohnen:
Eine meiner Pflichten bestand darin, sie am Sonntagmorgen mit dem Pferdewagen in die Kirche zu fahren, einen Strauß Blumen auf die Kanzel zu stellen und niemals den Text der jeweiligen Lesung zu vergessen. Wenn der Pastor zu den Whitesides auf Besuch kam, durfte ich das feine Linnen, das Porzellan und das schwere Silber aus dem Schrank holen. Es gab kleine heiße Kuchen, selbstgemachte Butter und Honig und hausgeräuchertes Fleisch – darauf war ich stolz.
Es folgen andere Dienstgeber, und auch die Wohnorte wechseln. Mit 17 heiratet Anna Mary Robertson: Thomas Salmon Moses ist wie ihr Vater Landwirt – zuerst in einem kleinen Pachtbetrieb, dann in der 600 Morgen großen eigenen Farm. Anna Mary spezialisiert sich auf Butter und – eine Neuheit zu dieser Zeit – geröstete Kartoffelscheiben. Sie beliefert mit ihren Produkten die Märkte in der Umgebung.
Zehn Kinder kommen zur Welt, fünf von ihnen überleben. Als die Sprößlinge groß genug sind, wird in den Bundesstaat New York übersiedelt. Und wieder ist es eine gutgehende Meiereiwirtschaft, die die siebenköpfige Familie Moses ernährt. Als im Jänner 1927 Thomas Salmon Moses stirbt, tritt der jüngste Sohn das Erbe an und übernimmt die Farm. Witwe Anna Mary Moses, inzwischen 66 Jahre alt, könnte sich also aus dem Arbeitsleben zurückziehen, bräuchte nur noch für ihre Enkel da zu sein. Doch das genügt ihr nicht, füllt sie nicht aus und so verlegt sie sich auf das Verfertigen von Bildern – zunächst in Wolle, bald auch in Öl. Landschaften, Häuser, Tiere – so, wie sie es aus ihrem Alltagsleben kennt.
Schon als Kind hat sie sich im Zeichnen versucht:
Als ich noch ganz klein war, kaufte der Vater mir und meinen Brüdern manchmal bogenweise weißes Papier, das für Zeitungsdruck verwendet wurde. Er sah es gern, wenn wir zeichneten; der Bogen kostete einen Penny pro Stück und hielt länger vor als Süßigkeiten. Mein ältester Bruder zeichnete am liebsten Dampfmaschinen, der zweite verlegte sich auf Tiere. Was mich betrifft, so wollte ich richtige Bilder haben – je bunter, desto besser. Zuerst fertigte ich eine Skizze an, dann folgte das Malen – entweder mit Trauben- oder Beerensaft. Das Wichtigste war: Es mußte rot sein, richtig schön rot.
Sollte sich in diesen frühkindlichen Versuchen schon das spätere Talent ankündigen? Während ihrer vierzig Ehejahre und der damit einhergehenden harten Tagesarbeit auf der Farm kann es sich jedenfalls nicht entfalten – abgesehen von zwei kaum nennenswerten Gelegenheiten, die Anna Mary zu Pinsel und Farbtopf greifen lassen. Das eine Mal ist es das Brett, mit dem der offene Kamin im Wohnzimmer verkleidet ist, das andere Mal der alte Klapptisch in der Küche, unter dessen Platte die Familie ihr Zinngeschirr aufbewahrt. Beides kommt Anna Mary »nackt« vor, unansehnlich, verschönerungsbedürftig. Also verziert sie die Gegenstände mit Landschaftsbildern. Nur so. Aber doch schon recht gekonnt. Ja, für einen blutigen Laien, der sie ist, fast professionell. Es sind ihre Werke Nummer eins und zwei …
Bis die Nummer drei folgt und überhaupt der »Betrieb« voll einsetzt, vergehen allerdings noch 15 Jahre: Anna Mary Moses spart sich das in ihr schlummernde Talent für ihren Lebensabend auf. Daß sie sich damit so lange Zeit läßt, hat einen einfachen Grund. Es hängt mit ihrer Gesundheit zusammen:
Um die Wahrheit zu sagen: Ich hatte so arge Nervenschmerzen und Arthritis, daß ich nur noch wenig Arbeit verrichten konnte. Ich mußte mich aber immer beschäftigen, um die Zeit zu vertreiben. Zuerst versuchte ich es mit gestickten Bildern, dann ging ich zu Ölmalerei über. Und jetzt male ich beinahe die ganze Zeit. Es ist eine sehr angenehme Liebhaberei, wenn man sich nicht beeilen muß. Ich lasse mir gern Zeit, um alles richtig zu Ende zu bringen. Anfangs habe ich nur zum Vergnügen gemalt. Dann aber wurde mehr von mir verlangt, als ich tun konnte, um meinen Versprechungen nachzukommen.
Welchen Versprechungen?
Unsere Künstlerin behält ihre Tätigkeit nicht für sich, sondern zeigt ihre Kreationen im Familien- und Bekanntenkreis herum, verschenkt hie und da etwas an Leute, die daran Gefallen finden, läßt sich das eine oder andere auch für ein paar Dollar abkaufen. Das Material, das sie für ihre ersten Arbeiten verwendet, könnte schlichter nicht sein: ein Stück Leinwand zum Beispiel, das beim Flicken der Schutzdecke für die Dreschmaschine übriggeblieben ist, oder ein Holzbrett, das im Gerümpelschuppen herumliegt. Auch die Farben braucht sie nicht extra zu kaufen: Es sind die Reste, die vom letzten Anstrich der Haus- und Zimmerwände übriggeblieben sind.
Der Zuspruch, den ihre ersten Malversuche finden, ermutigt Anna Mary eines Tages dazu, die Inhaberin des Drugstores im Nachbarort Hoosick Falls, wo sie ihr Petroleum, ihr Waschpulver und ihr Speisesoda kauft, um die Gefälligkeit zu bitten, ein paar ihrer Bildchen ins Schaufenster zu hängen. Das lockt Kunden aus dem Ort an und bald auch Kunden, die sich nicht bloß mit dem Angebotenen begnügen, sondern eigene Wünsche äußern: Ob Mrs. Moses nicht vielleicht bereit wäre, ein Haus, eine Landschaft, eine Szene ihrer Wahl zu malen? Die ersten Aufträge …
Dabei würde es wahrscheinlich bleiben, verschlüge es nicht um Ostern 1938 den New Yorker Kunstsammler Louis Caldor in das kleine Hoosick Falls: Der fremde Besucher wird auf die »Ausstellung« in der Auslage des Drugstores aufmerksam, betritt den kleinen Laden, sieht dort weitere Bilder der ihm noch Unbekannten, äußert sein Entzücken, fragt nach der Adresse, sucht Anna Mary in ihrem Haus auf, fordert die Künstlerin dazu auf, mit ihrer Arbeit fortzufahren, kehrt einige Zeit später nach Hoosick Falls zurück und überrascht Mrs. Moses schließlich mit dem Wunsch, den inzwischen angehäuften Schatz nach New York mitzunehmen, um auch dort, in der Millionenstadt, für seinen Fund zu werben.
Doch Mr. Caldor wird überall abgewiesen: Was soll dieses Zeug? Ist ja ganz nett, aber doch ohne Bedeutung. Und überhaupt – die Hobbymalerei einer beinahe Achtzigjährigen!
Kunstsammler Caldor ist nahe daran, aufzugeben, da erfährt er von dem Vorhaben des »Museum of Modern Art«, unter dem Titel »Unbekannte zeitgenössische amerikanische Maler« eine Ausstellung zu organisieren – die Einreichfrist ist noch nicht abgelaufen. Caldor versucht sein Glück, legt dem Komitee eine Auswahl der von ihm »verwalteten« Grandma-Moses-Bilder zur Prüfung vor und – erhält grünes Licht: »Das erste Automobil«, »Ahornzucker-Ernte« und »Daheim« werden als Leihgaben akzeptiert und zusammen mit Proben weiterer 17 Künstler für die Dauer eines Monats in einem der Säle des weltberühmten »Museum of Modern Art« ausgestellt.
Das Echo hält sich in Grenzen. Dennoch gibt Louis Caldor nicht auf, bleibt mit seinem Schützling in Verbindung, versorgt sie mit besserem Malmaterial und hält unterdessen weiter nach Abnehmern ihrer Kunst Ausschau.
Herbst 1939. In Manhattan, 46 West 57 Street, wird eine neue Galerie eröffnet. Es ist die US-Filiale der renommierten Pariser Kunsthandlung St. Etienne, die an und für sich auf Expressionismus spezialisiert ist, aber auch Volkskunst anbietet, Vertreter der sogenannten naiven oder primitiven Malerei. Betreiber der New Yorker Gallery St. Etienne ist ein österreichischer Emigrant: Otto Kallir. Unter dem später abgelegten Namen Otto Nirenstein 1894 in Wien geboren, blickt er, als er sich 1939 in New York niederläßt, auf eine reiche Tätigkeit in der Alten Welt zurück. Seine 1922 in Wien gegründete »Neue Galerie« versammelt in ihren Beständen Werke so bedeutender Künstler wie Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Alfred Kubin und Max Beckmann.
Otto Kallir kommt mit dem Grandma-Moses-Fan Louis Caldor ins Gespräch, läßt sich ein paar Proben seines Schützlings vorlegen und äußert schon nach dem wenigen, das er zu sehen bekommt, Interesse. Man trifft einander auf einem Autoparkplatz in Riverdale, etwa eine Fahrstunde von Manhattan entfernt. Da Caldor untertags arbeitet, kann die Begutachtung der auf dem Rücksitz seines Wagens verstauten Kollektion erst am Abend stattfinden. Es ist bereits finster auf dem Parkplatz; fürs Inspizieren der Bilder muß man eine Taschenlampe zu Hilfe nehmen. Um eine genauere Prüfung des ihm Angebotenen vornehmen zu können, läßt Kunsthändler Kallir die teils auf Karton, teils auf Preßholz, vereinzelt auch auf Leinwand gemalten, auf der Rückseite mit handgeschriebenen Titeletiketten versehenen und mit alten Fundstücken aus dem Dachboden der Moses-Farm gerahmten Bilder in seine Galerie schaffen. Sein Urteil fällt positiv aus: Noch mehr als die gekonnte Maltechnik der Künstlerin ist es die Authentizität der Motive, die Kallir überzeugt. In seinem sieben Jahre später erscheinenden Buch über Grandma Moses wird er es in die Worte fassen:
Es ist zu erkennen, daß sie immer ein eigenes Erlebnis beschreiben wollte. Was sie schildert, ist immer etwas, an dem sie selber teilgenommen hat. Ob das Bild nun einen Waschtag oder einen Sonntag darstellt, immer ist es ihr »Waschtag«, ihr »Sonntag«. Auch wenn Grandma Moses die Vorlage zu einem Gemälde einem Druck, einer Zeitschrift oder einer Tageszeitung entnommen hat, hat sie sich bemüht, keine bloße Kopie herzustellen, sondern das Motiv in etwas Eigenes zu verwandeln.
Am 9. Oktober 1940, einen Monat nach Grandma Moses’ 80. Geburtstag, wird in der New Yorker Galerie St. Etienne die Ausstellung »What a Farm Wife Painted« eröffnet. Gezeigt werden 34 kleinformatige und drei größere Bilder. Statt eines Katalogs gibt es nur eine mit der Schreibmaschine getippte Liste der Bildtitel. Die Einladung, zur Vernissage nach New York zu kommen, lehnt Mrs. Moses mit der Begründung ab, wozu solle sie in den Zug steigen, sie kenne ihre Bilder doch ohnedies. In vielen Zeitungen erscheinen Berichte – sie sind durchwegs zustimmend. Von Zitaten der wichtigsten läßt Otto Kallir einen Handzettel drucken. Der Kritiker der »New York Herald Tribune« geht auch auf Herkunft und Lebensgeschichte der Künstlerin ein und erwähnt in diesem Zusammenhang den Kosenamen, unter dem Anna Mary Moses geborene Robertson in ihrer engeren Heimat bekannt ist. Von diesem Tag an heißt sie für alle Welt Grandma Moses.
Die ausgeschlagene New-York-Visite holt sie übrigens einige Zeit später nach: Als das Kaufhaus Gimbel’s sich für eine Thanksgiving-Feier Mitte November ihre in Manhattan lagernden Bilder ausborgt, reist die Achtzigjährige in Begleitung der Drugstore-Besitzerin aus ihrem Heimatdorf in die Millionenstadt. Um ihrem ersten großen Auftritt vor Publikum einen besonderen Kick zu geben, rät man ihr, hausgemachte Marmelade und selbstgebackenes Brot mitzubringen. Auch mit ihrem Rednerdebüt, das sie mit größter Unbefangenheit hinter sich bringt, erobert sie die Herzen der Ausstellungsbesucher im Sturm. Sie wird dar -über später berichten:
Irgendjemand überreichte mir eines dieser Old-Lady-Sträußchen, und eine zweite Person befestigte an meinem Jäckchen einen Gegenstand, der sich wie ein schwarzer Käfer anfühlte – es war ein Mikrophon.
Als sie mit ihrer Speech fertig ist, winkt sie den Zuhörern zum Abschied mit ihrem Taschentuch zu; alle sind gerührt, die versammelte Menge bricht in Jubel aus.
Zu der Biographie, die ihr Entdecker Otto Kallir – eingeleitet von einem Vorwort aus der Feder des berühmten Romanautors Louis Bromfield – 1946 herausbringt, steuert Grandma Moses ein paar Kapitel selbstverfaßter Lebenserinnerungen bei.
Um die in Geldangelegenheiten Ahnungslose vor Übervorteilung durch clevere Geschäftemacher zu schützen, rät man ihr, die Hilfe eines Anwaltes in Anspruch zu nehmen, der vor allem über die korrekte Abrechnung beim Verkauf der inzwischen in den Handel gelangten und nach ihren Bildern angefertigten Gruß- und Weihnachtskarten wacht. Daß ihr dafür eigene Reproduktionsgebühren zustehen, muß man ihr erst umständlich klarmachen. Den ersten Scheck, den sie für die Nutzung dieser »Nebenrechte« empfangen hat, hat sie noch entrüstet zurückgeschickt – mit der Begründung, sie habe doch bereits beim Verkauf der betreffenden Bilder ihren Anteil kassiert … 1950 kommt ein an ihrem Wohnort Eagle Bridge gedrehter Grandma-Moses-Dokumentarfilm in die amerikanischen Kinos. Bei der Feier zur Überreichung einer vom »Women’s National Press Club« gestifteten Auszeichnung lernt die 88-Jährige sogar den amtierenden Präsidenten Harry Truman kennen, und auch bei dieser Gelegenheit – im steifen Milieu der Hauptstadt Washington – verblüfft sie die Anwesenden mit ihrer Natürlichkeit. Als mitten während der Zeremonie ein heftiges Gewitter losbricht, läßt sie sich von Mister President mit der Zusicherung beruhigen, im Weißen Haus könne ihr nichts zustoßen, der massive Bau verfüge über erstklassige Blitzableiter. Und als sie gefragt wird, ob sie vielleicht noch irgendeinen Wunsch habe, bittet sie den für sein Hobby bekannten Truman, sich ans Klavier zu setzen und ein Stück für sie zu spielen. Amerikas Nummer eins tut wie ihm geheißen und wählt für seinen Beitrag ein Menuett von Paderewski.
Grandma Moses’ Rückkehr in ihr Heimatdorf gestaltet sich zu einem Triumph sondergleichen. An die achthundert Menschen, das Doppelte der Einwohnerzahl von Eagle Bridge, strömen auf den Platz vorm Kriegerdenkmal und huldigen ihrer berühmten Mitbürgerin mit Blasmusik und Gesang, die Schulkinder überreichen Blumen.
Inzwischen ist der Ruf der malenden Großmutter aus dem Osten der USA auch nach Europa gedrungen: Die vom US-Information-Center unter Mithilfe der diversen diplomatischen Vertretungen organisierte, aus fünfzig Gemälden bestehende Wanderausstellung wird von Metropole zu Metropole geschickt; auch Salzburg und Wien sind unter den ersten überseeischen Städten, die Grandma Moses’ Werk kennenlernen.
1951 übersiedelt sie in das neue Haus, das ihr die beiden älteren Söhne gebaut haben. Bei der Planung hat man auf die nun doch schon eingeschränkte Beweglichkeit der Neunzigjährigen Bedacht genommen: Alle Räume sind ebenerdig. Tochter Winona nimmt ihr die Sekretariatsarbeit ab, führt über alle noch entstehenden Bilder sowie über den Verbleib der früheren Buch und tippt außerdem die Diktate ins reine, die für die 1952 in Druck gehende Autobiographie »My Life’s History« bestimmt sind. Auch um die Erledigung der eingehenden Bestellungen kümmert sich Winona. Aus ihren Aufzeichnungen geht hervor, daß sich Grandma Moses bei der Festsetzung der Preise ausschließlich an den Bildformaten orientiert: je größer, desto teurer …
Grandma Moses überrascht ihre Mitwelt nicht nur mit ihrem ungebremsten künstlerischen Tatendrang, sondern auch mit ihrer stabilen Gesundheit und ihrer fast schwankungsfreien Konstitution. Vor keiner Strapaze scheut sie zurück – weder vor der Einladung, ein großformatiges Bild vor laufender Fernsehkamera zu malen, noch vor dem Auftrag, wenige Monate vor ihrem 100. Geburtstag das in ihrer Heimat sehr populäre Kindergedicht »The Night before Christmas« zu illustrieren. Die Arbeit an diesem (letzten) Buchprojekt geht ihr schon deshalb leicht von der Hand, weil sie nach wie vor den Verstext auswendig weiß.
Auch die Feiern zu ihrem hundertsten Geburtstag am 7. September 1960 übersteht sie ohne Schaden. Allerdings hat man die Zahl der Reporter, die um ein Interview mit der Jubilarin angesucht haben, auf einige wenige eingeschränkt. Joy Miller von der Agentur »Associated Press« ist eine dieser Auserwählten. Ihr Bericht wird in allen großen Zeitungen des Landes abgedruckt. Hier ein Auszug:
In der Sofaecke ihres Wohnzimmers sitzend, sieht Grandma Moses sehr klein aus. Sie trägt ein blaues Kleid und eine rosa Strickjacke. Um den Hals hat sie ein schwarzes Bändchen. Ihre arthritischen Hände sind im Schoß gefaltet. Zögernd nähert man sich ihr. Wie soll man sie anreden? Wäre es zu dreist, sie ›Grandma‹ zu nennen? Soll man sehr laut sprechen? Aber sie hat den Besuch längst entdeckt. Ihr Gesicht leuchtet in schelmischem Lächeln auf. Ihre hellbraunen Augen blicken munter hinter den Brillengläsern. Ihr Händedruck ist erstaunlich kraftvoll. Wie sie da über dies und jenes plaudert, offenbart sich das Wesen einer durch und durch außergewöhnlichen Frau: gütig, humorvoll, völlig natürlich und vor allem unbeugsam.
Erst sechs Monate vor ihrem Tod legt Grandma Moses Pinsel und Farbtopf aus der Hand; ihrem letzten Bild gibt sie den Titel »Der Regenbogen«; es ist 40 x 61 Zentimeter groß und trägt die Nummer 1997. Kurz darauf, am 18. Juli 1961, übersiedelt die Hundertjährige in das Pflegeheim des Nachbarortes Hoosick Falls. Hätte man, um sie zu schonen, nicht ihr Malzeug weggesperrt, würde sie wohl auch jetzt nach Pinsel und Palette greifen. Grandma Moses ist nicht glücklich an diesem für sie fremden Ort. Als ihr langjähriger Hausarzt, Dr. Clayton Shaw, sie im Altersheim besucht, seine Patientin abhorchen will und sein Stethoskop nicht findet, leistet sich die Hundertjährige einen letzten, für sie typischen Scherz. Voller Schalk blickt sie auf und sagt zum Onkel Doktor gewandt: »Mein lieber Shaw, Sie suchen Ihr Stethoskop? Ich habe es versteckt und behalte es als Pfand. Ich rücke es Ihnen erst heraus, wenn Sie mich nach Eagle Bridge zurückgebracht haben. In mein Haus.«
Am 13. Dezember 1961 schläft die zuletzt kaum noch Bewegungsfähige für immer ein. Drei Tage darauf wird sie auf dem Friedhof von Hoosick Falls an der Seite ihres vor 34 Jahren verstorbenen Mannes Thomas Salmon Moses beigesetzt. Präsident John F. Kennedy holt in seinem landesweit verbreiteten Nachruf weit aus: Er fühlte sich bei Leben und Werk von Grandma Moses an den »Geist der frühen Pioniere der Vereinigten Staaten von Amerika« erinnert. Und damit diese Erinnerung auch für künftige Generationen erhalten bleibt, erwirbt Sohn Forrest das ehemalige Schulhaus von Eagle Bridge, das Anna Mary Robertson als Kind besucht hat, und gestaltet es zu einem Museum um, das 1966 in die Ortschaft Bennington verlegt und fortan auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Unter den zahlreichen in dem einzimmerigen Gebäude zur Schau gestellten Memorabilien ist das alte Ladenschild des Drugstores von Eagle Bridge eines der rührendsten: Hier, im Schaufenster der Mrs. Thomas, Seite an Seite mit Seifenschachteln, Mottenkugeln und Aspirintabletten, ist vor 28 Jahren Grandma Moses entdeckt worden.
Fachwechsel
Ihrer Mutter bleibt nichts anderes übrig, als eines Tages sämtliche Spiegel im Haus zu verhängen. Wie sonst soll man dem Fratz seine krankhafte Eitelkeit austreiben? Olga ist zu dieser Zeit fünf Jahre alt; ob im Stiegenhaus, in der Diele oder im Kinderzimmer – überall überprüft sie ihr Äußeres. »Du sollst nicht dauernd in den Spiegel schauen!« mahnt sie die um eine normale Entwicklung ihrer Kinder bemühte Mutter.
Eine von Klein-Olgas Pflichten ist es, jeden Abend vor dem Schlafengehen die auf die einzelnen Räume der Wohnung verteilten Schnittblumen einzusammeln und in eine gemeinsame Vase zu stecken, damit sie die Nacht über nicht so »allein« sind, sondern – wie Mama sich ausdrückt – miteinander kuscheln können.
Auf diese Weise gelingt es Olga tagtäglich, für einen Moment ins »Allerheiligste« vorzudringen: Mutters Schlafzimmer. Was sie dort – auf dem Toilettetisch – an Wunderdingen erblickt, zieht das gefallsüchtige Persönchen voll in seinen Bann: all die Parfumflakons, Schminktiegel, Cremedosen und Puderschachteln, die da in bunter Vielfalt zum Gebrauch bereitstehen. Manches davon kommt ihr besonders geheimnisvoll vor – etwa der Haferbrei, den sich Mama unter Beimengung von Topfen, Eigelb, Kräuterabsud und Gurkenscheiben angerührt hat. »Das sind doch Dinge, die in die Küche gehören und nicht ins Schlafzimmer?« fragt sie erstaunt und verlangt nach einer Erklärung. Mutters knappe Antwort: »Geduld, mein Kind. Wozu das gut ist, wirst du schon noch früh genug erfahren. Jetzt wasch dir erst einmal die Ohren – und dann marsch, ab ins Bett!«
Eines Morgens – Olga geht schon in die Schule – hat sie sich verschlafen und muß sich beeilen, rechtzeitig zum Unterricht zu erscheinen. Rasch noch ein prüfender Blick in den Spiegel – da sieht sie, daß ihr Kleid einen häßlichen großen Fleck hat. Zum Umkleiden ist die Zeit zu knapp, also greift sie kurzerhand nach der Schere und schneidet – schwupp, schwupp – den Fleck heraus. Am Abend entdeckt die Mutter das Loch in Olgas Kleid. Doch statt die Vandalin zurechtzuweisen, verordnet sie ihr die erste Näh- und Stopfstunde ihres Lebens. »Es hat mir nicht geschadet!« wird Olga Tschechowa später über die Lehren urteilen, die sie unter Mutters Anleitung aus ihren Jugendsünden gezogen hat, und läßt dabei anklingen, daß sie ohne diese strenge Erziehung zu Reinlichkeit und Ordnungssinn wohl kaum imstande gewesen wäre, fünfzig Jahre später die Schönheitspflege zu ihrem Beruf zu machen.
Doch hübsch der Reihe nach. Olga – mit vollem Namen Olga Konstantinowna Tschechowa – kommt am 14. April 1897 in der Kaukasusstadt Alexandropol, dem heutigen Gümri, zur Welt. Der Vater ist Ingenieur und wird es unter dem Zaren bis zum Eisenbahnminister bringen. Eine ihrer Tanten ist mit dem russischen Dichter Anton Tschechow verheiratet. Die Mutter ist eine kunstbegeisterte, vor allem der Musik hingegebene Frau. Eines der drei Kinder, Olgas jüngerer Bruder Leo, wird später Komponist werden.
Die Familie ist abwechselnd in Tiflis und Moskau ansässig; während der St. Petersburger Jahre darf Olga mit den Zarenkindern spielen und lernt sowohl den Dichterfürsten Leo Tolstoi wie den »Wunderheiler« Rasputin kennen. Als sie mit siebzehn die Schule absolviert, erwacht in ihr – angeregt durch das Beispiel einer schauspielernden Tante – der Wunsch, zum Theater zu gehen. Kein Geringerer als der berühmte Moskauer Regisseur Konstantin Stanislawski ist ihr Lehrer; ihre ersten Auftritte mit einer Wanderbühne führen sie kreuz und quer durchs Land.
Nach der Oktoberrevolution mit all ihren dramatischen Folgen brechen für eine großbürgerliche Familie wie die Tschechows harte Zeiten an: Die 23-jährige Olga nützt die ihr 1920 erteilte Ausreisegenehmigung dazu, sich nach Deutschland abzusetzen. Sie erlernt die Sprache ihres Gastlandes, schlägt sich mit Gelegenheitsarbeiten – unter anderem als Plakatmalerin – durch und kommt mit Berliner Theaterleuten in Kontakt. Der Mann, der ihr die erste Chance gibt, ihr schauspielerisches Talent unter Beweis zu stellen, ist der Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau, der gerade im Begriff ist, seinen Stummfilm »Schloß Vogelöd« zu besetzen. Olga Tschechowa erhält die weibliche Hauptrolle, Heinrich George, Fritz Kortner und Hermann Thimig sind ihre Partner.
Es ist der Beginn einer großen Karriere, die die ebenso bildschöne wie ausdrucksstarke Exilrussin von Berlin nach Paris und von London nach Hollywood führen wird. Auch bei einem der ersten deutschen Tonfilme – »Die Drei von der Tankstelle« mit Lilian Harvey, Heinz Rühmann und Willy Fritsch – ist Olga Tschechowa mit von der Partie. In »Liebelei« spielt sie 1933 an der Seite von Paul Hörbiger und Magda Schneider, 1934 in »Maskerade« an der Seite von Paula Wessely und 1939 in »Bel Ami« an der Seite von Willi Forst.
Obwohl ihr Beruf dem von Filmatelier zu Filmatelier eilenden Kinostar kaum Zeit dafür läßt, nützt Olga Tschechowa einen ihrer Paris-Aufenthalte dazu, für eine Weile auch einer zweiten Neigung nachzugeben: Sie besucht 1936 einen Kosmetikkurs an der Université de Beauté und schließt ihn mit einem Diplom ab. Daran gewöhnt, von den Masken- und Kostümbildnerinnen oft stundenlang für ihre Filmrollen »fit« gemacht zu werden, denkt sie bei diesem Pariser »Ausflug« in die Welt der Kosmetik eigentlich nur an ihr eigenes Äußeres und dessen Vervollkommnung und nicht im mindesten an die Möglichkeit, sich eines Tages selber in diesem Metier zu versuchen und ihre hier gewonnenen Kenntnisse an andere weiterzugeben. Aber sie wird es, wenn sie nach 1945 tatsächlich in diesen Zweitberuf einsteigen wird, nicht zu bereuen haben, daß sie bei den Pariser Fachleuten ihr Handwerk erlernt hat …
Olga Tschechowas Filmkarriere bricht zwar auch jetzt keineswegs ab: Allein in den Fünfzigerjahren bringt sie es auf weitere 14 Rollen. Andererseits ist sie Realistin genug, um sich darüber im Klaren zu sein, daß ihre Zeit vor der Kamera begrenzt ist. »Eine junge, eine neue Generation wächst nach«, sinniert sie in ihrem 1952 in Buchform erscheinenden Lebensrückblick, »eine Generation, die von Älteren schon deshalb nichts hält, weil sie eben älter sind oder alt.« Hinzu kommt, daß sich ihre materielle Situation mittlerweile gewaltig verschlechtert hat: Olga Tschechowa hat sich von falschen Beratern eine Hypothek auf ihren Besitz aufschwatzen lassen, die sie nun, nach der Währungsreform von 1948, in harter D-Mark abtragen muß. Auch ihr Plan, sich selbständig zu machen und eine eigene Filmproduktion zu gründen, schlägt fehl: Die Firma ist nach drei Projekten pleite. Um zu Geld zu kommen, trennt sie sich von ihren Reichtümern, verkauft ihre geliebten Antiquitäten, ihre Ikonen, ihre Bibliothek. Sollte sie vielleicht das Fach wechseln und sich als »komische Alte« versuchen oder überhaupt ganz aufhören? Aber welche Berufsmöglichkeiten blieben dann noch für sie – Empfangsdame in einem aufstrebenden Unternehmen oder Wirtschafterin in einem kultivierten Haushalt?
Nichts dergleichen kann für eine so verwöhnte, so unabhängige und so selbstbewußte Frau wie Olga Tschechowa in Betracht kommen. Was aber sonst? In dieser Situation erinnert sich die inzwischen Sechzigjährige an jenen Kosmetikkurs, den sie seinerzeit, vor vielen Jahren, in Frankreich absolviert hat. Vielleicht ließe sich damit etwas anfangen? Einen eigenen Schönheitssalon zu eröffnen oder zumindest eine Art Beratungspraxis, in der Frauen mit Tipps versorgt werden, wie sie sich ihr gutes Aussehen erhalten oder ihr weniger gutes korrigieren können – das würde Olga Tschechowa reizen.
Wer sie kennt, weiß, daß diese Frau nichts für halbe Sachen ist: Olga Tschechowa entscheidet sich für eine radikale Zäsur, verkauft ihr Haus im Berliner Bezirk Kladow und übersiedelt nach München. Mitten im Zentrum der zu dieser Zeit prächtig florierenden Bayern-Metropole findet sie die für ihre Zwecke geeignete Lokalität; mit Hilfe des erfahrenen, aus Rußland stammenden und in London wirkenden Biologen Professor Bogomoletz entwickelt sie ihr eigenes Behandlungsprogramm. Für die Regeneration der Körperzellen – so lautet ihr Credo – genügt nicht die Anwendung kosmetischer Substanzen: »Die Patientin muß auch selber aktiv mitarbeiten – zum Beispiel mit möglichst giftfreier Ernährung.«
Die Person, von deren Erfahrungen sie dabei am meisten profitiert, ist Olga Tschechowa selbst: »Ich bin mein Leben lang in der Öffentlichkeit gestanden, mußte schon von Berufs wegen immer gut aussehen – egal, wie stark meine Haut durch Schminken und Abschminken strapaziert wurde.«
Jetzt also geht es darum, dieses Wissen an andere weiterzugeben. In ihrem Freundes- und Bekanntenkreis finden sich ohne Mühe Versuchskaninchen, an denen sie die Wirkung ihrer selbstgemachten Cremes und Masken erproben kann. Vor allem junge Menschen, die unter entwicklungsbedingten Hautstörungen leiden, sind dankbar für Frau Tschechowas Ratschläge.
Der »Betrieb« fängt klein an: Nur eine ausgebildete Kosmetikerin und eine Praktikantin stehen ihr zur Seite, um die hoffentlich recht bald und reichlich eintreffende Klientel zu bedienen. Gespannt wartet man auf die ersten Damen. Doch welche Überraschung: Zwei hochbetagte Herren machen den Anfang! Und was ist deren Begehr? Sie verlangen nach Fußpflege! Sie sind, wie sich schon nach kurzem Wortwechsel herausstellt, Fans des Filmstars Olga Tschechowa, für die es eine besondere Auszeichnung wäre, von ihrem Idol persönlich von ihren Hühneraugen befreit zu werden …
Zum Glück bleibt es nicht bei diesen beiden, und zum Glück bleibt es auch nicht beim »Nebenfach« Pediküre. Frauen jeden Alters strömen in Olga Tschechowas Studio und vertrauen der »Chefin« ihre Sorgen an. Daß sie bei ihr nicht einfach nur mit Präparaten »abgespeist«, sondern auch zu Selbstdisziplin im Sinne der modernen Ganzheitskosmetik »erzogen« werden, spricht sich in der Münchner Damenwelt herum: Olga Tschechowas Schönheitssalon erweist sich schon nach wenigen Jahren als zu klein. Außerdem meldet die Hausbesitzerin für die vier angemieteten Räume – Behandlungszimmer, Labor, Küche und Wohnzimmer – Eigenbedarf an. Doch auch die Übersiedlung an die neue Adresse ist nicht von Dauer: Das Viertel, in dem Olga Tschechowa ihre Arbeit fortsetzen will, ist ihrer Klientel zu laut. Hinzu kommt, daß sie für die Herstellung, Lagerung und Auslieferung ihrer unter Aufsicht eines fest angestellten Chemikers entwickelten Präparate mehr Platz braucht.
Um das Kapital für die Vergrößerung ihres Salons und die Aufstockung ihres Personals aufzubringen, trennt sich Olga Tschechowa von den letzten Resten ihrer Schmuck- und Antiquitätensammlung. 1955 geht die frisch gegründete Olga-Tschechowa-Kosmetik OHG in Betrieb. Die Belegschaft wächst mit den Jahren auf über hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Waren ihre ersten Klienten noch Kinobesucher, die sie zum Großteil von ihren alten Filmen her kannten, oder auch Kollegen (wie der Schauspieler Hubert von Meyerinck), die mit ihr seinerzeit vor der Kamera gestanden sind, so hat sie es nun mit einem Massenpublikum zu tun, das mit dem Namen Olga Tschechowa nur noch Begriffe wie Hautpflege und Schönheitsgymnastik, wie Schlankheitsdiät und Naturkost verbindet.
Während die in München verbleibende Zentrale des Unternehmens weiter ausgebaut wird, wagt sie Filialgründungen in Berlin, Helsinki und Mailand. Auf dem Kosmetikkongreß von Venedig wird Olga Tschechowa der Grand Prix zuerkannt; mit der Rezeptsammlung »Deine Schönheit – Dein Geheimnis« steigt sie in den Buchmarkt ein; und dem ihr 1962 verliehenen »Filmband in Gold« folgt zehn Jahre darauf eine Auszeichnung, die auch ihr Wirken in ihrem Zweitberuf einschließt: das deutsche Bundesverdienstkreuz. Da Olga Tschechowa ihr reiches Wissen um Körperpflege und Gesunderhaltung nicht nur für die ihrer Klienten, sondern auch für die eigene Lebensführung nutzt, erreicht sie das schöne Alter von knapp 83 Jahren. Die gebürtige Russin stirbt am 9. März 1980 in ihrer Wahlheimat Bayern und wird auf dem Friedhof von Gräfelfing bei München beigesetzt.
»Nichts bleibt immer so …«
Es muß um die Mitte der Siebzigerjahre gewesen sein: Der Tukan-Kreis, ein renommierter Organisator literarischer Soireen im damaligen München, hatte mich zu einer Lesung eingeladen. Die Veranstaltung fand in einem der Säle des eleganten Hotels Regina statt, es ging um eines meiner ersten Bücher, und ich durfte mich über eine ebenso zahlreiche wie verständige Zuhörerschaft freuen. Als ich mich nach getaner Arbeit dem von meinem Verlag bereitgestellten Bücherstand zuwandte, um den diversen Signierwünschen nachzukommen, schwirrte eine nicht mehr ganz junge Fotoreporterin um mich und meine Klientel herum und drückte aus den verschiedensten Blickwinkeln auf den Auslöser. Ich fühlte mich geschmeichelt von dem medialen Interesse, kümmerte mich aber ansonsten nicht weiter um die mir fremde, schätzungsweise sechzig Jahre alte Blondine. Erst, als eine der Zuhörerinnen mich mit bedeutungsvollem Augenaufschlag fragte, ob ich wisse, wer da mit seiner Kamera am Werk sei, nahm ich die Reporterin etwas näher ins Visier, und da auf einmal kam mir das Gesicht bekannt vor. »Ja, das ist doch«, fragte ich erstaunt, »das ist doch …«
»Richtig!«, hörte ich mein Gegenüber antworten. »Kristina Söderbaum!«
Rasch klärte sich die Sache auf: Die aus Schweden stammende und im Deutschland der Dreißiger- und Vierzigerjahre zum Filmstar avancierte Schauspielerin mit dem weißblonden Haarschopf und den wasserblauen Augen, seit 1945 durch ihre Verstrickungen in den nationalsozialistischen Kulturbetrieb von den Medien geächtet, hatte sich in München, wo sie – als mittellose Witwe des berüchtigten Filmregisseurs Veit Harlan – nach einem neuen Beruf umsehen müssen. Und dieser neue Beruf war: Fotoreporterin! Kristina Söderbaum versorgte seit Mitte der Sechzigerjahre Zeitungen und Magazine, aber auch eine Reihe anderer Auftraggeber mit aktuellen Schnappschüssen, insbesondere mit Porträts von Schauspielern und anderen Persönlichkeiten des Kulturlebens. Auf diese Weise war sie auch auf meine Lesung aufmerksam geworden – wohl in der Hoffnung, dabei auf einen Autor zu treffen, der noch von sich reden machen und dessen Konterfei daher künftig begehrt sein würde.