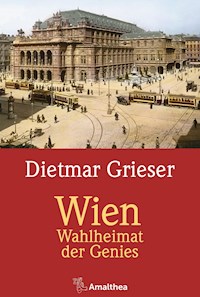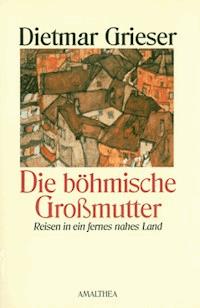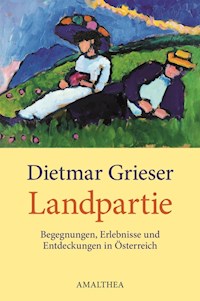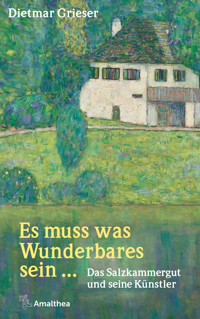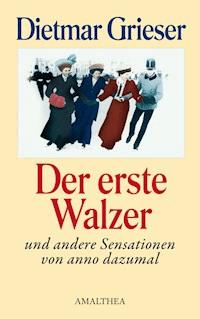
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein nostalgischer Streifzug durch die österreichische Geschichte: 50 "Premieren" in Wort und Bild – vom ersten Papstbesuch bis zum ersten Opernball, vom ersten Sparbüchl bis zum ersten Toto-Zwölfer, von der ersten Muttertagsfeier bis zur ersten Schönheitskönigin vom ersten Fußballmatch bis zum ersten Fernsehquiz. Auf alle Fragen nach den österreichischen "Anfängen" weiß Autor Dietmar Grieser die Antwort – ob es um den Christbaum geht oder um die Geburtsstunde des Radios, um den Wiener Bürgermeister oder den Salzburger "Jedermann", um Retortenbaby oder Nylonstrumpf, um Computer oder Fertigteilhaus, um die erste Erdölbohrung oder das erste Neujahrskonzert …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietmar Grieser
Der erste Walzer
und andere Sensationenvon anno dazumal
Besuchen Sie uns im Internet unter amalthea.at
1. Auflage Juni 2007
2. Auflage September 2007
© 2007 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Kurt Hamtil, verlagsbüro wien
Umschlagmotiv: Auf dem Eise. Photographie um 1900.
© IMAGNO/Austrian Archives, Wien
Herstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger
& Karl Schaumann GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der 11/14 Punkt New Caledonia
Druck und Bindung: CPI Moravia Books GmbH
Printed in the EU
ISBN 978-3-85002-606-2
eISBN 978-3-903083-91-2
Für Waldemar
Inhalt
Vorwort
Die schönste Frau der Welt
Bomben auf Venedig
Das achtzehnte Kind
Bürgermeister von Habsburgs Gnaden
»Aufs zärtlichste umarmet, geküsset und gesegnet …«
Taler, Daalder, Dollar
Die Geburtsstunde des Schillings
»Einlagsbuch« Nr. 1
Zehn Kreuzer pro Woche
Cornflakes, Corned Beef, Erdnußbutter
Der erste »Zwölfer«
Ein Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän vom Rhein
Lokführer im Frack
Eine Taube macht noch keinen Sommer
Die Freudenmädchen aus der Hohenstaufengasse
Ohne »poetischen Schminck«
Der Daguerre von Wien
Das Fräulein vom Amt
»Zerstört es nicht!«
Bei offenem Fenster
Märchen aus dem Automaten
Ein Stammkunde namens Beethoven
Großmutters »gesunder« Kochtopf
Die Explosion von Egbell
Das Mailüfterl
Wetterfrosch und Sterngucker
Chicago-Berlin-Ischl
Eine Couch wie jede andere
Slatan, das Retortenbaby
Der weiße Traum
Ein dreifaches »Hurra!«
Die Kicker von der Kuglerwiese
87 Minuten Mozart
»Ekstase« und die Folgen
Weltnachrichten im Wochentakt
Mischkulanz und Elferfrage
Die Krawatten der Kroaten
»Ich, Anna Csillag …«
Ein Strumpf geht um die Welt
Der erste Christbaum
Lieb Mütterlein
»Rüstet euch!«
Hutschen, Schlitten, Ringelspiel
Kaiserliches Hochzeitsgeschenk
Nur für Chinesen
Hüpfen, stampfen, wirbeln
Goldner Klang in dunkler Zeit
»Alles Walzer!«
Mit »Jedermann« fing’s an
Die Stadt der Novak, Sokol, Kratochwil
Vorwort
Es geistert durch alle Ortschroniken, durch alle Reiseführer, durch alle Fremdenverkehrsprospekte der USA: das Wörtchen first. Jedes Gemeinwesen zwischen Miami und Seattle, das auf sich hält, trachtet mit historischen Events zu prunken, die sich auf seinem Boden zugetragen haben: Die Eröffnung des ersten Sklavenmarktes, die Jungfernfahrt des ersten Raddampfers, die Grundsteinlegung des ersten Wolkenkratzers.
Im French Quarter von New Orleans kann der durstige Tourist in jenem Saloon einkehren, in dem der erste Cocktail gemixt worden ist; in Chicago erinnert eine Gedenktafel an die Würstchenbude, in der vor mehr als 150 Jahren der Hot Dog kreiert wurde; und in Philadelphia wartet auf den patriotisch gestimmten Besucher das Haus der Flickschneiderin Betsy Ross, die im Rufe steht, die erste US-Flagge genäht zu haben.
Je mehr Firsts eine Ortschaft vorzuweisen hat, desto höher ihr Ansehen. Das schlägt sich auch in der Sprache nieder: Anders als im Deutschen steht im Englischen das Wort first im Range eines Substantivs. Erstling wäre eine denkbare (aber unzulängliche) Übersetzung.
Die Sucht der Amerikaner, sich und ihr Land mit Firsts zu schmücken, erklärt sich aus ihrer vergleichsweise jungen Geschichte: Man möchte mit Old Europe, wo alles um so vieles früher angefangen hat, nach Kräften mithalten.
Österreich mit seiner überreichen Vergangenheit hat es da leichter (und schwerer zugleich). Leichter: Wie viele der großen Errungenschaften aus alter Zeit haben hierzulande ihren Ursprung!
Schwerer: Es sind ihrer so viele, daß sich jeder, der den Versuch unternimmt, dieses Kapitel der Kulturgeschichte aufzuarbeiten, auf eine winzig kleine, zwangsläufig subjektive Auswahl beschränken muß.
Mit einer solchen Auswahl wartet das hier vorliegende Buch auf, wobei das Altbekannte zugunsten des bisher Unerforschten ausgespart bleibt. Weder Ressels Schiffsschraube noch Maderspergers Nähmaschine, weder Kaplan-Turbine noch Mälzel-Metronom bilden das Thema, sondern Novitäten wie das erste österreichische Sparbuch und der erste österreichische Totoschein, Ereignisse wie der erste Papstbesuch auf österreichischem Boden, der erste Opernball und die Kür der (aus Wien stammenden) ersten »Miss Welt«, die Einführung des Muttertages und die Gründung der Salzburger Festspiele, die erste Erdölbohrung, das erste Fußballmatch und das erste Retortenbaby, Errungenschaften wie Nylonstrumpf und CARE-Paket, wie Wochenschau und Fernsehquiz. Und vieles vieles mehr.
Dietmar Grieser
Wien, im Juni 2007
Die schönste Frau der Welt
Zweimal hat Österreich die »Miss World« gestellt: 1969 mit der Steirerin Eva Rueber-Staier und 1987 mit der Wienerin Ulla Weigerstorfer. Daß es jedoch bereits 1929 einen Wettbewerb gegeben hat, aus dem eine Österreicherin als »schönste Frau der Welt« hervorgegangen ist, ist heute vergessen. Sie hieß Lisl Goldarbeiter, entstammte einem einfachen Wiener Bürgerhaus, war zum Zeitpunkt ihrer Kür neunzehn Jahre alt und hatte nur einen einzigen Makel: Die Ärmste lispelte.
Es ist das Jahr, in dem das Luftschiff »Graf Zeppelin« zum ersten Mal über Wien kreist; Marianne Hainisch, die Mutter des vormaligen Bundespräsidenten, gründet die »Österreichische Frauenpartei«, im Schönbrunner Schloßtheater wird das Max-Reinhardt-Seminar eröffnet, der spätere Wiener Bürgermeister Leopold Gratz und der Maler Arik Brauer erblicken das Licht der Welt. Unter den großen Toten des Jahres ragen der Dichter Hugo von Hofmannsthal und der Kinderarzt Clemens Pirquet hervor (auf den der Begriff »Allergie« zurückgeht).
Mitte Jänner 1929 erfährt die Öffentlichkeit zum ersten Mal von einer weltweit veranstalteten Schönheitskonkurrenz, für die im Vorjahr in Paris die ersten Vorbereitungen getroffen worden sind. Das multinational zusammengesetzte Komitee einigt sich auf folgende Vorgangsweise: Zunächst bestimmt jedes der Teilnehmerländer seine eigene Kandidatin, dann wird unter diesen die »Miss Europa« ausgewählt, und aus der in Amerika durchgeführten Endrunde geht schließlich die »Miss Universum« hervor. Die Organisation des Spektakels liegt in den Händen der Presse:
In England ist es das Boulevardblatt »Daily Mail«, in Frankreich die Pariser Tageszeitung »Le Journal«, in Österreich das »Neue Wiener Tagblatt« (zu dessen Mitarbeitern so klangvolle Namen wie Hermann Bahr, Franz Karl Ginzkey, Heinrich Kralik, Franz Theodor Csokor, Erwin Rainalter und Eduard Pötzl zählen).
Über die Startrunde zur Wahl der »Miss Austria« lesen wir auf der Titelseite des »Neuen Wiener Tagblatts«:
»Welchen Ansturm gab es da auf unsere Redaktion! Täglich brachte die Post ganze Stöße von Photographien: blonde und brünette Bewerberinnen, Madonnenzauber und rassige Pikanterie – jeder Typ von Frauenschönheit war vertreten, 1283 Konkurrentinnen insgesamt. Und aus dieser ungeheuren Zahl bestimmte eine Jury 43 Damen für die engere Wahl.«
Im Rahmen eines Fünf-Uhr-Tees im Hotel Imperial waltet die Jury, der unter anderem die Staatsopernsängerin Margit Schenker-Angerer, der Maler Carry Hauser und der französische Botschafter, Graf Clauzel, angehören, ihres Amtes und trifft in dreistündiger Beratung »mit größter Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit« ihre mit Spannung erwartete Entscheidung. Kommt es unter den Jurymitgliedern zu »Kontroversen«, so wird die betreffende Kandidatin ein weiteres Mal ins »Beratungszimmer« gebeten; schließlich steht – mit zehn von insgesamt dreizehn Stimmen – die Siegerin fest: Es ist die neunzehnjährige Tochter des Wiener Kaufmanns Karl Goldarbeiter, der in der Wipplingerstraße im I. Bezirk ein Geschäft für Ledergalanteriewaren betreibt. Auch Lisl, die die Handelsschule absolviert hat, hilft in der elterlichen Firma mit. Die Wohnung der dreiköpfigen Familie befindet sich in der Freilagergasse im Bezirk Leopoldstadt, nahe dem Praterstern.
Schon in den ersten Zeitungsberichten über die frischgebackene »Miss Austria« wird deren dezentes Auftreten lobend hervorgehoben: Lisl Goldarbeiter komme »ohne Puder, ohne Schminke, ohne Lippenstift« aus. Und erst recht sittsam geht’s beim Posieren vor den strengen Augen der Jury zu: Keine Spur von Fleischbeschau, »Pin up« ist noch ein Fremdwort. Man muß ihn zwei Mal lesen, den Bericht im »Neuen Wiener Tagblatt«, so antiquiert mutet er aus heutiger Sicht an:
»Das Bild eines italienischen Renaissancemeisters – so erschien uns das Antlitz Lisl Goldarbeiters. Von klassischer Schönheit ihre Gesichtszüge, blau die Augen, die ernst und klug zu blicken wissen, die Nase zart und gerade, halblang das schöne braune Haar.« Bescheiden, ja karg auch der »Lohn«, der einer »Miss Austria« des Jahres 1929 für ihren Triumph winkt: Maler bieten sich an, die Auserwählte zu porträtieren; der Bildhauer Anselm Zinsler (der später unter anderem den Auftrag erhalten wird, die Grabmalplastik für die Schauspielerin Adele Sandrock zu entwerfen) fertigt eine madonnenartige Büste der Siegerin an; die Schriftstellervereinigung Concordia drängt auf Mitwirkung bei einer ihrer kommenden Veranstaltungen.
Dafür hat Lisl Goldarbeiter allerdings keine Zeit: In Paris wartet bereits die nächste Runde auf sie – die Wahl zur »Miss Europa«. Hier schafft sie zwar nur den zweiten Platz, da jedoch die Siegerin, eine Mitbewerberin aus Budapest, noch vor dem US-Finale aussteigt, empfängt die nachrückende »Miss Austria« den Gratisfahrschein für den Transatlantikdampfer in die Neue Welt und darf sich – in Begleitung ihrer Mutter – in der texanischen Hafenstadt Galveston der dortigen Jury zur Wahl der »Miss Univers« stellen.
Am 12. Juni 1929 kann das »Neue Wiener Tagblatt« auf seiner Titelseite verkünden:
»Fräulein Lisl Goldarbeiter (Österreich) ist gestern abend im Internationalen Schönheitswettbewerb zur Miss Univers gekrönt worden. Von den sieben Richtern stimmten sechs für sie. Es waren elf Konkurrentinnen, darunter Miss England und Miss Amerika. Fräulein Goldarbeiter wird den Preis von 2000 Dollar erhalten – und zwar nicht nur ihrer Schönheit, sondern auch ihrer vornehmen Erscheinung wegen. Mit gesenkten Augen nahm sie den Spruch der Jury entgegen.«
Es spricht für ihr durch und durch vernünftiges Wesen, daß sie ihr Prämiengeld nicht für irgendwelchen modischen Schnickschnack verwenden, sondern in die Installierung einer Wasserleitung in Mutters Küche investieren wird: Familie Goldarbeiter mußte sich bisher mit einer Bassenawohnung begnügen.
Die stolzerfüllte Berichterstattung der österreichischen Presse sorgt dafür, daß der frischgebackenen »Miss Univers« auch bei ihrer Rückkehr nach Wien der ihr gemäße Empfang zuteil wird. Trotz der späten Stunde – der »Pariser Schnellzug« trifft um 22 Uhr auf dem Westbahnhof ein – hat sich eine »vieltausendköpfige Menge« eingefunden, die in »stürmischen Jubel« ausbricht. Die Deutschmeisterkapelle intoniert die Bundeshymne, hunderte begeisterte Zaungäste folgen der von den Steyr-Werken zur Verfügung gestellten Limousine auf der Fahrt zum Hotel Imperial. Wieder und wieder erhebt sich die mit einem leichten braunen Seidenmantel und dazu passendem Strohhut Bekleidete von ihrem Sitz und winkt den Umstehenden zu; ein »starkes Wacheaufgebot« sorgt dafür, daß Fräulein Goldarbeiter unbehindert die Fragen der sie umdrängenden Reporter beantworten kann. Herrlich, so schwärmt sie, seien die drei Monate in New York, New Orleans und Galveston, auf den Kanarischen Inseln und auf Kuba, in Le Havre, Vichy und Paris gewesen. Aber das Allerschönste für sie sei doch, nun wieder in der Heimat zu sein. Was sie jetzt tun werde? »Ich weiß es nicht. Zuerst einmal will ich mich ausruhen.«
Nun, eine Neunzehnjährige ist rasch wieder bei Kräften, und diese Kräfte braucht sie auch: Die Leute vom Film haben allerlei mit ihr vor. Die Nr. 1 unter den Wiener Produktionsfirmen, die Sascha-Film (die vor zwei Jahren – mit »Café Electric« – Marlene Dietrich zu ihrem Kinodebüt verholfen hat) bittet Lisl Goldarbeiter zu Probeaufnahmen ins Sieveringer Atelier.
Was das Schauspielerische betrifft, ist man durchaus hoffnungsvoll, nur mit der Stimme hapert es: Die Kandidatin hat einen Sprachfehler. Ein paar Jahre früher, und das Manko wäre kein Manko gewesen. Doch in der Zwischenzeit hat der Ton- den Stummfilm abgelöst, und so bleibt es bei einem einzigen Versuch: Lisl Goldarbeiter erhält eine kleine Rolle in einem Film, der zum 60. Geburtstag von Franz Lehár gedreht wird. In einem überschwenglichen Dankbrief zeigt sich der Meister von der anmutigen Debütantin hell entzückt.
Daß aus der »Miss Univers« kein Kinostar werden kann, stört sie selber allerdings nicht im geringsten: Lisl zieht sich ins Privatleben zurück, heiratet am 5. August 1930 den Wiener Krawattenfabrikanten Fritz Spielmann.
Alles deutet auf eine glänzende Partie hin: Der Bugatti-Fahrer und Rennstallbesitzer Spielmann verwöhnt seine Braut mit allem erdenklichen Luxus, die Flitterwochen verbringt man in Cannes. Perlen, Pelze und extravagante Hüte zählen zu ihrem nunmehrigen Outfit, zum Opernball erscheint Lisl in einer Traumrobe aus Samt und Hermelin.
Doch das Glück ist von kurzer Dauer: Gatte Fritz ist ein leidenschaftlicher Spieler, nach nur zwei Jahren Ehe ist sein Vermögen aufgebraucht, sein Erbe verspielt. Man taucht in Preßburg unter, später in Paris, schließlich wieder in Preßburg. Und als es 1938 für den Juden Fritz Spielmann und die Halbjüdin Lisl Goldarbeiter in der nunmehr von den Nationalsozialisten beherrschten Heimat gefährlich wird, flieht das Paar nach Brüssel. Zu allem Unglück verfällt Spielmann aufs neue seiner Spielleidenschaft: Tief enttäuscht wendet sich Lisl von ihrem Mann ab, und während er sich nach Südafrika (und später nach China) absetzt, kehrt sie zu ihren Eltern nach Wien zurück und übersiedelt mit ihnen zu den ungarischen Verwandten nach Szeged.
Nach dem Krieg geht Lisl Goldarbeiter eine neue Ehe ein, heiratet ihren ungarischen Cousin Marci, der sie schon in jungen Jahren heftig umworben hat, und erreicht als nunmehrige Frau Tänzer das stattliche Alter von 88 Jahren. Noch die letzten Fotos, die von ihr gemacht werden, lassen erahnen, daß sie vorzeiten die schönste Frau der Welt gewesen ist.
Bomben auf Venedig
Er ist knapp 65, als ihn Kaiser Franz I. nach Mailand beordert und ihm das Kommando über die österreichischen Truppen in Oberitalien überträgt. Andere treten in diesem Alter in den Ruhestand – für Johann Josef Wenzel Graf Radetzky ist es der Auftakt für weitere 26 Jahre im Dienste Seiner Majestät.
Es sind keine leichten Jahre: Seitdem auf dem Wiener Kongreß die Unabhängigkeit der Italiener aufgehoben und das Königreich Lombardei-Venetien Österreich einverleibt worden ist, schwelt von Mailand bis Venedig der Haß auf Wien, und er konzentriert sich vor allem auf den Mann, der in den annektierten Gebieten für Ruhe und Ordnung sorgen soll. »Italien ist für mich nur ein geographischer Begriff!« hat Metternich verkündet, und Feldmarschall Radetzky obliegt es, mit seinem 109 000 Mann starken Heer den immer wieder aufflammenden Widerstand gegen die österreichische Hegemonie zu brechen.
1848/49 sind die eigentlichen Jahre der Bewährung für den inzwischen zweiundachtzigjährigen Radetzky: Es gelingt ihm, sowohl die Sardinier wie die Piemontesen zu bezwingen. Ob Santa Lucia, Curtatone, Vicenza oder Custozza – sämtliche großen Schlachten entscheidet der greise Heeresführer für sich. »In deinem Lager ist Österreich!« jubelt ihm Grillparzer zu, und Johann Strauß Vater huldigt ihm mit dem Radetzkymarsch.
Wo sich’s zuletzt nochmals kräftig spießt, ist Venedig: Seit März 1848 hält nun schon der Aufstand gegen die österreichischen »Eindringlinge« an, und »Nonno« Radetzky (wie die Italiener den Verhaßten mit ihrer Vokabel für »Großvater« verhöhnen) antwortet mit Belagerung. Der Einsatz ist gigantisch: 635 Geschütze bieten die k.k. Truppen auf, um den Widerstand zu brechen, 20 000 Granaten und 57 000 Hohlkugeln werden abgeschossen, 8000 Zentner Pulver aus 243 000 Schrotbüchsen. Die Feldakten verzeichnen den Verlust von fast 8000 Soldaten: Wer nicht im offenen Kampf fällt, stirbt am Lagunenfieber. Zwischen Oktober 1848 und August 1849 sind es 62 300 Kranke oder Verwundete, die in die Spitäler von Venedig und Umgebung eingeliefert werden.
In dieser verzweifelten Situation, die es gebietet, jedes erdenkliche Mittel zur Niederschlagung des Aufruhrs einzusetzen, erproben die Österreicher zum ersten Mal in der Geschichte des Militärwesens etwas, was man in späteren Jahren »Luftkrieg« nennen wird: Sie werfen über der belagerten Stadt Bomben ab. Franz Uchatius heißt der 37 Jahre alte, aus dem niederösterreichischen Theresienfeld stammende Artillerieoffizier, der da am 2. Juli 1849 in Venedig zum ersten Mal den Versuch unternimmt, »mittels unbemannter Luftballons Hohlgeschosse auszuwerfen«. Absolvent des Instituts für Chemie und Physik am Wiener Polytechnikum, hat der erfindungsreiche Waffentechniker eine Zeit lang in einer Geschützfabrik gearbeitet und auch bei der Planung des Wiener Arsenals mitgewirkt; jetzt verbeißt er sich in die Konstruktion von Büchsen, die mit einer Ladung von 600 Bleikugeln gefüllt sind und von Heißluftballons aus 3500 Klafter Höhe abgeworfen werden sollen.
Der erste Versuch, noch von Land aus unternommen, schlägt fehl; beim zweiten wechselt man aufs Wasser und läßt die Ballons vom Dampfschiff »Vulcan« aufsteigen. Doch die heikle Prozedur scheitert abermals. War es beim ersten Probelauf die ungünstige Luftströmung, die einen zielgenauen Abwurf der »Bomben« erschwerte, so ist es beim zweiten eine nicht einkalkulierte »Nebenwirkung«: Das Feuer bringt nicht nur die Ballonladungen zur Explosion, sondern auch die Ballons selbst. Zwar treffen die Geschosse ihr Ziel (den Lido das eine, den Giardino publico das zweite), doch die Fluggeräte gehen in Flammen auf und stürzen samt den mit Kohlensäure gefüllten Abschußöfen zu Boden.
In den Frontberichten, die im Jahr darauf unter dem Titel »Kriegsbegebenheiten bei der kaiserlich österreichischen Armee in Italien vor Venedig« im Verlag der k.k. Hof- und Staatsdruckerei in Buchform erscheinen, findet das blamable Experiment fast nur als Fußnote Erwähnung; kleinlaut redet man sich auf »die damalige stürmische Witterung« und auf »die dringend notwendige anderweitige Verwendung des Dampfers ›Vulcan‹« aus. Verschämt schließt der Bericht über Österreichs kläglichen Einstieg in den »Luftkrieg« mit den Worten: »So konnte man sich von dieser Erfindung keine nutzbare Anwendung versprechen.« Die Rückgewinnung Venedigs muß also mit herkömmlichen militärischen Mitteln erkämpft werden. Doch bevor Radetzky den Befehl zur Belagerung der von den Aufständischen kontrollierten Stadt erteilt, versucht er es noch einmal im Guten. Mit einem leidenschaftlichen Appell soll das Ruder herumgerissen werden: »Bewohner Venedigs, ich will mit Euch als Vater reden. Es ist nun ein volles Jahr unter Aufruhr und anarchistischer Erhebung verflossen, und was sind die düsteren Folgen davon? Der öffentliche Schatz ist erschöpft, das Vermögen der Privaten verloren, Eure blühende Stadt in die äußerste Not versetzt.«
Doch die von den Revolutionären eingesetzte Stadtregierung stellt sich taub, will von Unterwerfung, von der Übergabe der Befestigungen, der Flotte und der Waffen nichts wissen. »Zu sehr«, so wird Radetzky später in seinen »Erinnerungen« festhalten, »waren sie in ihren Träumen von der alten Herrlichkeit der Republik befangen.«
So müssen also die Waffen entscheiden. Am 22. August 1849 ist das Ziel erreicht: Venedig kapituliert, die österreichischen Truppen ziehen in die Lagunenstadt ein, der Podestà (Bürgermeister) muß schweren Herzens dem mit der schwierigen Operation betrauten General Haynau die Goldenen Schlüssel der »Serenissima« ausfolgen.
Tenor der bitter-grimmigen Bilanz, mit der die österreichischen Kriegsberichterstatter das Kapitel Venedig abschließen: Wie leicht hättet Ihr Euch dies alles ersparen können! Im Wortlaut: »Dies waren die traurigen Folgen eines bewaffneten Aufstandes, welcher mit Undank gegen die wohlmeinendsten Zugeständnisse eines gütigen Monarchen begann, durch Fanatismus, Unverstand und Bosheit fortgesetzt wurde und eine im schönsten Wiederaufblühen begriffene Stadt in kurzer Zeit wieder an den Abgrund des Verderbens brachte.«
Keine Vokabel ist den Schreibern des Wiener Pressehauptquartiers zu drastisch, um Verantwortungslosigkeit und Schuld des Gegners anzuprangern:
»Ein schauderhaftes Bild menschlicher Verirrung, das als warnendes Beispiel dafür dienen möge, wie tief eine Stadt herabsinken kann, die den Weg der Loyalität und Treue verläßt und sich zum Spielballe der Leidenschaften einiger von Ehrgeiz und Gewinnsucht verblendeter Menschen hingibt.«
Und wie erlebt Radetzky selber, der von seinem Mailänder Hauptquartier aus die Geschicke der österreichischen Truppen lenkt, seinen hart errungenen Sieg? Triumphgeheul ist seine Sache nicht. Jede Verhängung des Standrechtes, jede Hinrichtung gegnerischer Offiziere und Soldaten stürzt den greisen Feldmarschall in schwerste Gewissenskonflikte. Gegen den Willen seiner eigenen Offiziere läßt er jugendliche Demonstranten laufen, und auch einer Reihe italienischer Geistlicher, die sich mit Feuerüberfällen auf österreichische Patrouillen hervorgetan haben, schenkt er das Leben, indem er sich mit ihrer Strafversetzung in entlegenere Gemeinden begnügt.
Ja, er hat es nicht leicht auf seinem Posten als Generalgouverneur von Lombardo-Venetien: Anarchistische Elemente bewerfen Radetzkys Soldaten, wo immer sich diese blicken lassen, mit Pflastersteinen und Ziegelbrocken; andere streuen, um den Widerstand gegen die »nordischen Barbaren« anzufeuern, das Gerücht aus, die Österreicher stächen ihren Gefangenen die Augen aus; und eine besonders fanatische Dame der Mailänder Gesellschaft, die zu einem Galadiner geladen ist, läßt sich, als ihr einer der Lakaien das Menü servieren will, zu dem Ausruf hinreißen: »Danke, ich habe keinen Appetit – es sei denn, man kredenzt mir das gebratene Herz eines Österreichers.«
Geradezu groteske Formen nimmt der Haß auf die Radetzky-Truppen an, als im Frühjahr 1848 in Mailand der sogenannte »Zigarrenrummel« losbricht. Da die noch von Kaiser Josef II. als Staatsmonopol ins Leben gerufene k.k. Tabakregie einen bedeutenden Einnahmeposten im Staatshaushalt darstellt, ist das Rauchen in diesen Tagen äußerster finanzieller Bedrängnis zur patriotischen Pflicht geworden. Um den österreichischen Fiskus zu schwächen, rufen umgekehrt die Anführer des »Risorgimento« alle Italiener zum Raucherstreik auf. Scharen jugendlicher Patrioten ziehen durch die Stadt und schlagen jedem, den sie mit einer brennenden Zigarre oder Zigarette antreffen, den Glimmstengel aus der Hand. Die Folge: Die Straßen von Mailand sind mit Tschicks übersät, und kaum jemand traut sich noch in eine k.k. Tabaktrafik.
Aber auch die Gegenreaktion bleibt nicht aus: Die plötzlich unverkäuflich gewordenen Lagerbestände der Tabakregie wandern in die Militärverpflegungsmagazine und werden gratis an die Soldaten verteilt – mit dem Befehl, sich in den Straßen von Mailand nie anders als rauchend blicken zu lassen. Wie Kappenrosette und Seitengewehr gehört also von Stund an auch die demonstrativ zur Schau gestellte Virginia zur vorschriftsmäßigen Adjustierung jedes anständigen österreichischen Soldaten …
Wie es Feldmarschall Radetzky selber damit hält, ist nicht überliefert. Auch in seinen letzten Lebensjahren – einundneunzigjährig stirbt er am 5. Jänner 1858 in der Villa Reale in Mailand – wird der alte Recke als außerordentlich genügsam geschildert. Kammerdiener Karl Ferschel, der ihm den Haushalt führt, hat nur dafür Sorge zu tragen, daß in ausreichender Menge die Leibspeise Tirolerknödel auf den Tisch kommt, und von Tochter »Fritzi«, der er laufend Straßburger Pasteten, erlesene Kompotte und prämierte toskanische Weine an ihren Wohnsitz Ödenburg schicken läßt, erbittet er sich als Gegengabe lediglich frischen Liptauer.
Den ihm vom Kaiser zuerkannten Ruhesitz auf Schloß Unterthurn bei Laibach kann er nicht mehr genießen, und auch von den 200 000 Gulden, mit denen ihm der Fiskus den Dank für seine 72 Dienstjahre abstattet, bleibt ihm persönlich kein Groschen: Radetzkys miserabel wirtschaftende Ehefrau hat hinter seinem Rücken derart gigantische Schulden angehäuft, daß er das Angebot des Wiener Hofes, als erster und einziger NichtHabsburger in der Kaisergruft beigesetzt zu werden, ausschlagen und seine sterblichen Überreste dem millionenschweren Kriegslieferanten Pargfrieder testamentarisch vermachen muß, der sich mit der Errichtung eines »Heldenberges« auf seinem niederösterreichischen Besitz Schloß Wetzdorf einen Lebenstraum erfüllt. Kaiser Franz Joseph – als der letzte der insgesamt fünf Monarchen, denen Johann Joseph Wenzel von Radetzky im Laufe seines langen Lebens gedient hat – begleitet den Sarg seines Paladins bis in die Gruft – eine Auszeichnung, die vor ihm keinem zweiten Feldherrn zuteil geworden ist.
Das achtzehnte Kind
Ich bin seitens meiner Leserschaft verschiedentlich gerügt worden, daß ich es in meinem Buch »Die böhmische Großmutter« verabsäumt hätte, auch auf Karl Renner hinzuweisen. Der erste Staatskanzler der Republik Österreich stelle ja geradezu den Prototyp jenes Wieners dar, dessen Wurzeln im heutigen Tschechien liegen: Unter-Tannowitz, das nunmehrige Dolní Dujanovice, ist sein Geburtsort, und hier, acht Kilometer nördlich der südmährischen Kreisstadt Mikulov/Nikolsburg, hat er seine Kindheit verbracht und die Schule besucht.
Es ist wahr: Karl Renner ist mir bei meiner Spurensuche jenseits der österreichisch-tschechischen Staatsgrenze durch die Lappen gegangen. Ich will also Buße tun und das Versäumte nachholen, und da Renner nicht nur zu den Gründerfiguren der Ersten Republik zählt, sondern auch nach 1945 – und zwar sowohl als Regierungschef wie als Bundespräsident – Geschichte geschrieben hat, paßt er vorzüglich in das hier vorliegende Buch, das die diversen österreichischen »Erstlinge« zum Thema hat.
Ein Ausflug in die strittige Region, zwei Autostunden von Wien, lohnt sich allemal: Die Fahrt führt durch eine anmutige Landschaft aus Sonnenblumenfeldern und Weingärten; uralte Marterln und verwitterte Kellerstraßen säumen den Weg. Mikulov mit seinem hochaufragenden Schloß, seiner mächtigen Pestsäule, seinem von barocken Laubenhäusern umstandenen Marktplatz und den Überresten des Judenviertels ist ebenso eine Besichtigung wert wie die üppigen Parkanlagen des ehemaligen Liechtenstein-Schlosses Eisgrub/Lednice, das vor allem für seine historischen Gewächshäuser, für seine von Johann Bernhard Fischer von Erlach erbaute Reithalle und für sein 1797 in Erinnerung an die Türkenkriege errichtetes, 63 Meter hohes Minarett berühmt ist. Ferdinand Raimund hat den Ort in einer der Figuren seines Zaubermärchens »Der Bauer als Millionär«, dem kauzigen »Vetter aus Eisgrub«, verewigt, und Franz Grill-parzer hat dem über und über mit exotischen Pflanzen angefüllten Treibhaus mit dem Vierzeiler gehuldigt:
Regen läßt auf Glas sich hören,
scharfer Wind fällt schneidend ein;
ein Gewächshaus war mein Heim,
und mein Indien liegt in Mähren.
Mit solchen Reizen kann Karl Renners Geburtsort Unter-Tannowitz nicht aufwarten: Es ist ein Marktflecken, dem man noch immer die Mühe ansieht, sich von den Verwahrlosungen der KP-Ära zu erholen. Der Tourist, der nach altösterreichischer Nostalgik Ausschau hält, bleibt auf die Speisekarte des »Restau-race Praha« angewiesen, auf der er Gerichte wie »Rostbraten auf Wildschützenart«, »Omas wohlriechendes Kotelett« oder »Leckerbissen Karls IV.« findet. Zweisprachig auch das am ehemaligen Dorfanger errichtete Mahnmal »zum ewigen Gedenken an alle Gefangenen und Opfer des I. und II. Weltkrieges«; vertraute Heilige wie Florian und Nepomuk bewachen das den Dorfbach überquerende Brücklein; die die durchwegs namenlosen Straßen säumenden Häuser müssen mit den alten Katasternummern auskommen.
Was fast unverändert an seinem angestammten Platz steht, ist die Volksschule, in der der kleinwüchsige und unterernährte Keuschlersohn Karl Renner zwischen 1876 und 1881 seinen ersten Unterricht empfangen (und in der dritten Klasse – anläßlich der Vermählung von Kronprinz Rudolf – sein erstes Gedicht zu Papier gebracht) hat. Ansonsten: die auf einer kleinen Anhöhe stehende Pfarrkirche, die steinernen Überreste des alten Prangers, eine Weinhandlung, eine bescheidene Fremdenpension, ein moderner Supermarkt mit dem traditionellen Konsum-Emblem.
Das attraktivste Gebäude aus jüngster Zeit, mit seinen postmodernen Strukturen aus Spiegelglas und Stahlbeton kraß aus der Reihe tanzend, befindet sich in einer der Straßen am südlichen Ortsrand; die Aufschrift »Dum Dr. Karla Rennera« verrät, daß an dieser Stelle einst jenes Ganzlahnhaus Nr. 258 gestanden ist, in dem der berühmteste Sohn von Unter-Tannowitz seine ersten Lebensjahre verbracht hat. Es ist ein mit allen neuzeitlichen Einrichtungen – Vortragssaal, Tagungsräume, Bibliothek – ausgestattetes Veranstaltungszentrum, das dem Kulturaustausch zwischen Österreich und Tschechien dient, und damit dies vorrangig im Zeichen Karl Renners und der von ihm mitbegründeten Sozialdemokratie geschieht, ist in einem der Gänge eine Bronzebüste der Widmungsfigur aufgestellt, ja sogar ein aus Überbleibseln des Originalbaues – Mauerreste, ein Stückchen Ziegeldach, ein halber Türstock – gefertigtes Konstrukt in den modernen Baukörper eingefügt.
Die junge Frau, eine der wenigen Deutschsprechenden im Ort, die mich durch das 1990, also zum 120. Geburtstag Karl Renners errichtete Anwesen führt, schwankt in ihren Kommentaren zwischen Stolz und Enttäuschung: Das für das kleine Dolní Dujano-vice fast zu luxuriöse »Dum Dr. Karla Rennera« werde viel zu wenig genützt, stehe die meiste Zeit leer. Auch die beiden Bibliothekarinnen, die ich beim gemütlichen Kaffeeplausch antreffe, machen mir nicht den Eindruck übermäßiger Inanspruchnahme. Umso mehr freut es sie, mich mit der reichlich vorhandenen Renner-Literatur versorgen zu können; zur Schließung meiner diesbezüglichen Wissenslücken ziehe ich mich in eines der auch an diesem Tag leerstehenden Sitzungszimmer zurück.
Es hat seinen besonderen Reiz, sich in die Lebensgeschichte eines Menschen zu vertiefen, wenn man die dazugehörigen Örtlichkeiten dicht vor Augen hat. Hier also ist am 14. Dezember 1870 Karl Matthias Renner auf die Welt gekommen – als achtzehntes und letztes Kind seiner Eltern. Man muß es wieder und wieder lesen, um es für keinen Druckfehler zu halten: Achtzehn Mal kommt Mutter Renner nieder. Noch als halbes Kind ist die als einfältig und lammfromm Beschriebene mit dem Kleinbauern Matthäus Renner verheiratet worden; auch während ihrer unablässigen Schwangerschaften muß sie bei der Arbeit in Stall und Feld mit anpacken. Ihr Los wird noch schwerer, seitdem es mit dem Hof bergab geht: Vater Renner, nicht der Geschickteste im Wirtschaften, muß einen Acker nach dem anderen abstoßen, die Familie muß mit dem Existenzminimum auskommen.
Daß der kleine Karl, schon in jüngsten Jahren seinen Geschwistern in punkto Auffassungsgabe und Lerneifer weit voraus, trotz der drückenden Not im Elternhaus aufs Gymnasium geschickt wird, grenzt an ein Wunder. Er besteht die Aufnahmsprüfung, kommt bei einer Familie in der acht Kilometer entfernten Kreisstadt Nikolsburg in Kost. Doch schon bald geht den Eltern das Mietgeld für die Unterkunft ihres Jüngsten aus: Zweimal täglich und bei jedem Wetter muß der Bub den anderthalbstündigen Schulweg zu Fuß zurücklegen.
Ebendieser Schulweg ist es, der den Heranwachsenden eines Tages – es ist im Frühjahr 1883 – zum ersten Mal mit sozialistischem Gedankengut in Berührung bringt: Der ahnungslose Bauernbub macht unterwegs die Bekanntschaft eines arbeitslosen Handwerksburschen, der sich auf Stellungssuche befindet. Es ist ein Buchbindergeselle aus Schlesien, der, von Ort zu Ort wandernd, jetzt in Südmähren sein Glück versucht. Er begnügt sich nicht damit, seinem Gegenüber sein bitteres Los zu schildern, sondern macht ihm auch den Kopf heiß mit flammenden Reden gegen die ausbeuterischen Kapitalisten, und als es einige Zeit später noch zu der Begegnung mit einem sächsischen Schlossergehilfen kommt, der, gleichfalls auf der Walz, den Vierzehnjährigen mit den Parolen der sich nach und nach formierenden Arbeiterbewegung konfrontiert, beginnt im jungen Karl Renner jenes Bewußtsein zu keimen, das ihn in späteren Jahren zum leidenschaftlichen Vorkämpfer für die Besserstellung des Proletariats machen wird.
Noch auf dem Gymnasium in Nikolsburg setzt er die ersten Schritte für diesen seinen künftigen Lebensweg: Eben noch ein eifriger Ministrant und Chorsänger, beginnt er sich von der katholischen Kirche abzuwenden und vertieft sich in andere Religionen, liest Bücher über den Buddhismus, verschlingt die Werke sozialkritischer Autoren wie Henrik Ibsen, Emile Zola und Gerhart Hauptmann, setzt sich mit Nietzsche auseinander, erhebt Lessings »Nathan« zu seinem Credo.
Nicht nur, um sich das dringend nötige Taschengeld zu verdienen, sondern auch aus Solidarität mit dem Hungerleiderdasein der allenthalben anzutreffenden Taglöhner hilft er da und dort in Werkstätten aus und macht sich bei der Erntearbeit nützlich; gleichzeitig legt er, um sein intellektuelles Rüstzeug zu mehren, den gewohnten ländlichen Dialekt ab und bemüht sich, Hochdeutsch zu sprechen – und dies umso mehr, als er nun auch zu schreiben beginnt, Lyrik zunächst, doch bald auch die ersten »Memoranden« zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterschaft.
Der eigentliche Wendepunkt in der geistigen Entwicklung des jungen Karl Renner tritt im Mai 1885 ein, als es im Elternhaus zur Katastrophe kommt: Der Besitz in Unter-Tannowitz muß versteigert werden, Vater und Mutter bleibt nur noch der Umzug ins Armenhaus. Zornbebend lehnt sich der Fünfzehnjährige gegen dieses Unrecht auf: Er gelobt, niemals wieder in seinen Geburtsort zurückzukehren.
Als Karl Renner nach der Matura, die er mit Auszeichnung besteht, nach Wien übersiedelt und – nach Ableistung seines Militärdienstes als Einjährig-Freiwilliger – sein Universitätsstudium aufnimmt, ist sein künftiger Berufsweg bereits klar vorgezeichnet: Ob als Hilfskraft in der Parlamentsbibliothek, als Mitarbeiter der Genossenschaftsbewegung, als Reichsratsabgeordneter oder als Verfasser staatspolitischer Schriften, fortan wird er nur noch einerSache dienen: der Stärkung der Sozialdemokratie.
Mit dem Zusammenbruch der Monarchie im November 1918 sieht sich Dr. jur. Karl Renner am Ziel: Er wird am 15. März 1919 zum Staatskanzler der Ersten Republik gewählt, führt noch im selben Jahr die deutschösterreichische Delegation zu den Friedensverhandlungen nach Saint-Germain, arbeitet an der provisorischen Verfassung, an der neuen Wahlordnung und an der aktuellen Gesetzgebung mit. Das »Spiel« wiederholt sich nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches im Frühjahr 1945: Wieder ist Karl Renner der Mann der ersten Stunde, übernimmt in der provisorischen Dreiparteienregierung die Kanzlerfunktion und ist zwischen 1945 und 1950 auch der erste Bundespräsident der wiedererstandenen Republik Österreich.
Bürgermeister von Habsburgs Gnaden
Das Wort »Bürgermeister« taucht hierzulande erstmals in einer Urkunde aus dem Jahr 1340 auf. Vorher hält man sich strikt ans Lateinische, bezeichnet das Stadtoberhaupt von Wien als »magister civium«. Das aus dieser Zeit erhalten gebliebene Dokument ist mit dem 22. August 1282 datiert; der darin genannte Chunradus dictus Pullo – auf deutsch: Konrad Poll – wäre demnach der erste Amtsträger, der mit der Würde eines Wiener Bürgermeisters ausgestattet worden ist.
Viel ist es nicht, was wir über ihn wissen. Versuchen wir, das Wenige, das uns die Chroniken überliefern, zusammenzukratzen. Und verlieren wir dabei nicht aus dem Auge, daß das damalige Wien mit dem heutigen in keiner Weise vergleichbar ist. Die Stadt zählt nicht einmal 20 000 Einwohner; ihre Zentren bilden die Burg (wovon sich übrigens der Begriff »Bürgermeister« ableitet), die dem heiligen Ruprecht geweihte Hauptkirche sowie die Filialkirchen von St. Peter und Maria am Gestade, weiters ein Friedhof, ein Marktplatz und ein Donauhafen. Verteidigungsmauern umschließen den mittelalterlichen Stadtkern. Dem aufstrebenden Bürgertum wird es erstmals gestattet, zweistöckige Häuser zu errichten; in der Vorweihnachtszeit nimmt auch bereits ein Vorläufer der später so populären Christkindlmärkte Gestalt an.
Seit dem 26. August 1278, da Böhmenkönig Ottokar II. bei der Schlacht von Dürnkrut nicht nur seine Macht, sondern auch sein leibliches Leben eingebüßt hat, sind in den österreichischen Erblanden die Habsburger am Ruder: Rudolf I. bestellt seinen ältesten Sohn Albrecht zum Reichsverweser.
Ein Bürgermeister hat da nur wenig zu vermelden: Die städtische Autonomie hängt noch ganz von der Willkür des Landesherrn ab. Wer gegen die fürstlichen Gnaden allzu keck aufmuckt, muß mit Sanktionen rechnen: Zwei von Polls Nachfolgern auf dem Bürgermeistersessel, Konrad Vorlauf und Wolfgang Holzer, landen auf dem Schafott. Mit eigenen »Treubriefen« lassen sich die Habsburger die unumschränkte Loyalität der städtischen Ratsherren bescheinigen; auch Bürgermeister Poll kann nur so lange seines Amtes walten, wie er das Vertrauen der Obrigkeit genießt.
Das ist immerhin fast zwanzig Jahre lang der Fall – bis zu seinem irgendwann zwischen 1305 und 1307 eintretenden Tod (Genaueres wissen wir auch da nicht). Konrad Poll muß jedoch seine Arbeit zur allgemeinen Zufriedenheit verrichtet und sich einen guten Namen gemacht haben, sonst würden nicht auch sein Sohn Niklas und sein Enkel Berthold in späteren Jahren das Amt des Wiener Bürgermeisters bekleidet haben.
Die Polls sind Zuzügler, stammen aus Bayern, gelangen Mitte des 13. Jahrhunderts aus dem Regensburger in den Wiener Raum. Als angesehene Patrizier führen sie selbstverständlich ein eigenes Familienwappen; es zeigt – in Anspielung auf pullus, die lateinische Version ihres Namens – eine Henne. Dasselbe Motiv ziert auch ihr Siegel, mit dem alle einschlägigen Urkunden beglaubigt und alle für den Versand bestimmten Schriftstücke verschlossen werden.
Der Ort im Süden von Wien, an dem sich Vater Poll und die Seinen niederlassen, ist Vöslau, und hier kommt um 1240 Sohn Konrad zur Welt. Dreißig Jahre später wird nach Wien übersiedelt, Wohnhaus und Garten befinden sich am alten Fleischmarkt, zu ihren Besitzungen zählt außerdem ein Lehen in der Wachau. Konrad heiratet die Tochter eines wohlhabenden Handelsherrn aus dem Rheinland namens Seifried Leubel und erbt auf diesem Wege dessen zwischen Lugeck und Fleischmarkt gelegene Wiener Niederlassung (die in späterer Zeit den beziehungsvollen Namen Kölnerhof erhalten wird).
Konrad Poll erfüllt also alle Bedingungen für den Aufstieg zum Wiener Ratsherrn: Er gehört dem »Geldadel« an, verfügt über reichen Haus- und Grundbesitz, ist finanziell unabhängig. Das ist deshalb von Wichtigkeit, weil die Spitzenposten in der städtischen Verwaltung zu dieser Zeit nur geringfügig dotiert sind. Zwar stehen dem Bürgermeister und seinen Ratsherren eine Reihe von Privilegien zu, darunter das sogenannte »WeihnachtsKleinod« in Gestalt eines vergoldeten Trinkbechers, ein »Pfingstgewand« und ein alljährlich während der Fastenzeit ausgeschüttetes »Hausengeld«, doch handelt es sich bei alledem eher um symbolische Ehrenbezeugungen als um Unterhaltsleistungen. Auch für den Aufwand bei den Ratssitzungen muß der »magister civium« selber aufkommen: Da in den Aufzeichnungen aus jener Zeit nichts über Versammlungsorte zu lesen ist und der Bau des Alten Rathauses erst in die Amtsperiode seines Nachfolgers fällt, ist anzunehmen, daß Konrad Poll die turnusmäßigen Ratssitzungen in den eigenen vier Wänden abhält.
Zwei markante Ereignisse fallen in Polls Amtszeit. Da ist einmal die mit 12. Februar 1296 datierte Verleihung eines neuen Stadtrechtes, das die Beziehungen zwischen Wien und dem Landesfürsten regelt. An die Stelle des vormals dominierenden Stadtrichters tritt ein Kollegium freigewählter Stadträte – mit dem Bürgermeister an der Spitze. Allzu viel zu sagen haben die Herren allerdings nicht: Die städtische Autonomie bleibt im wesentlichen auf Marktaufsicht und Polizeiangelegenheiten beschränkt. Kein Wunder, daß die von Herzog Albrecht Geknebelten über die landesfürstliche Übermacht murren und mehr als einmal die »Schwaben« (wie das Schmähwort für die aus dem Alemannischen stammenden Habsburger lautet) zum Teufel wünschen.
Das zweite Ereignis, das mit dem Namen Konrad Poll verbunden ist, ist die Erweiterung der Stephanskirche. Der 1147 geweihte romanische Bau hat sich mit den Jahren als zu klein erwiesen, soll durch einen gotischen Zubau ausgedehnt werden. Um den dafür nötigen Platz zu schaffen, kauft man dem Stift Zwettl ein in dessen Besitz befindliches Grundstück ab; außerdem wird der dem Gotteshaus vorgelagerte Roßmarkt in die Gegend der heutigen Renngasse verlegt.
Bezüglich Bürgermeister Polls weiteren Wirkens tappen wir im Dunkeln: Die Quellen sind dürftig, und da sich auch kein Porträt von ihm erhalten hat, sind wir hinsichtlich seiner äußeren Erscheinung auf unsere Phantasie angewiesen. Nicht einmal sein genaues Sterbedatum steht fest. Nur aus dem Umstand, daß Irmgard Poll, seine zweite Frau, in einem Eintrag aus dem Jahr 1307 als Witwe bezeichnet wird, die zu Ehren des Verstorbenen eine Gedenkfeier im Stift Heiligenkreuz abhalten läßt, ist zu schließen, daß Wiens erster Bürgermeister jedenfalls ein Alter von höchstens 67 Jahren erreicht hat.