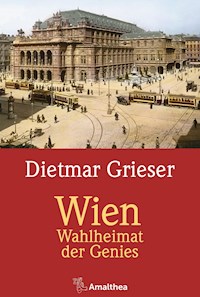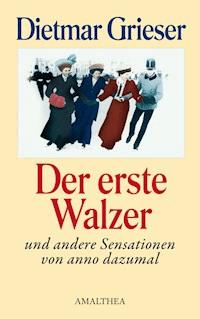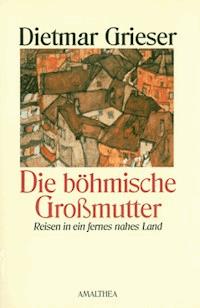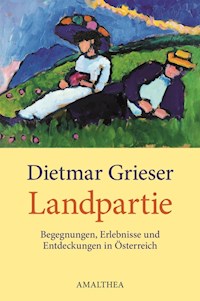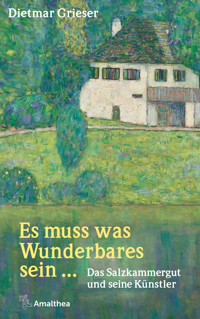Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tierische Kultfiguren aus Geschichte und Literatur, Musik und Film In 28 fesselnden Kapiteln porträtiert Dietmar Grieser Tiere, die es zu etwas "gebracht" haben – zu einem Namen, zu Ruhm, vielleicht gar zu literarischer Verewigung: Der Chow-Chow, der Sigmund Freud als Ordinationshilfe diente Das wahre Leben der "Cats" Gazellen für Sisi Kreiskys Boxer und Loriots Mops Streit um den Doppeladler War Tolstoj in seinem "ersten" Leben ein Pferd? Eine Fülle verblüffender Entdeckungen – ein Buch, das zum Nachdenken über das Verhältnis von Mensch und Tier anregt und das vor allem viel viel Spaß macht. Mit zahlreichen Abbildungen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietmar Grieser
Geliebtes Geschöpf
Dietmar Grieser
Geliebtes
Geschöpf
Tiere, die Geschichte machten
Mit 30 Abbildungen
AMALTHEA
Für Fabian
Besuchen Sie uns im Internet unter: www.amalthea.at
© 2016 by Amalthea Signum Verlag, WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEATUmschlagbild: August Macke, Zoologischer Garten I, 1912© Erich Lessing/picturedesk.com
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 11,15/14,91 pt New Caledonia
ISBN 978-3-99050-045-3
eISBN 978-3-903083-28-8
Zwar hat auch ihm das Glück sich hold erwiesen, denn schöner stirbt ein Solcher, den im Leben ein unvergänglicher Gesang gepriesen.
Thomas Manns Grabinschrift für seinen Hund Bauschan
Inhalt
Vorwort
Große Namen
Am liebsten ein Chow-Chow
»Therapiehunde« à la Sigmund Freud
Die sanften Riesen
Zu Besuch im ehemaligen k. k. Hofgestüt von Kladrub
Gazellen für Sisi
Der Schah von Persien auf Staatsbesuch in Wien
Kreiskys Boxer und Napoleons Hengst
Tiere machen Politik
Lolita und die Schmetterlinge
Vladimir Nabokov auf der Pirsch
Zwei Rippen
Leo Perutz und seine Hunde
Das sprechende Pferd
Wie Hans Fallada zu seinem Künstlernamen gelangt ist
Von Künstlerhand
Ohne Adler geht es nicht
Das österreichische Staatswappen
Was sucht ein Schwein im Stephansdom?
Antonius, der erste Mönch
Möglich, aber sinnlos
Loriot über das Leben mit und ohne Mops
Heilige Kannibalin
Bernhard Hollemann und die Mantis
Verschollen
Franz Marcs Meisterwerk »Der Turm der blauen Pferde«
Vorhang auf
Breiter Flügel, spitzes Ohr
Fledermaus & Batman
Bremen in Wien
Wer ist der vierte Stadtmusikant?
Wie nenne ich meine Katze?
Die wundersame Entstehungsgeschichte des Musicals »Cats«
Rin Tin Tin recte Apollo
Von Zweibrücken nach Hollywood
Für Kinder zwischen 8 und 80
Die Sendung mit der Maus
Erinnerungen
Alle meine Tiere
Von Mäusen und Maikäfern, von gefräßigen Fröschen und störrischen Ziegen und von einem Dackel namens Aufsicht
Vatis Muscheln
Eine Zwischenbilanz
Für Dascha
Wie ein neugeborener West Highland White Terrier einen Buchbestseller lanciert
Die literarischen Urbilder
Geliebter Zögling
E. T. A. Hoffmanns Todesanzeige für Kater Murr
»Du mußt ein Pferd gewesen sein!«
Tolstoj und der »Leinwandmesser«
Der zensurierte Drache
Schwierigkeiten mit Schiller
Ausgebootet
Felix Salten und sein »Bambi«
Die Biene war eine Ameise
Waldemar Bonsels und sein »Vorgänger« Bernd Isemann
Zwölf Flaschen Schnaps
Auf den Spuren von »Krambambuli«
Doktor Dolittle und der Erste Weltkrieg
Hugh Lofting und die Liebe zur Kreatur
Den Kindern von New York
Die zwei Leben des Bären Pu
Dank
Bild- und Textnachweis
Personenregister
Vorwort
Ich schwor es mir zu, nicht zu vergessen euch,Nichtige Tierchen ihr, deren Geschick mich traf.Wenn meine Seele einst nichts als Gedächtnis sein wird,Will ich euch beide vor unsern Schöpfer tragen.
Franz Werfel. Ein Gedenkblatt des Dichters für seine geliebten Katzen. Ein schöner, für manches Ohr vielleicht auch etwas pathetischer Vers. Aus seiner Biographie wissen wir, daß Werfel zu Gelübden neigte. Hatte er nicht nach seinem Lourdes-Erlebnis vom Sommer 1940 das Versprechen abgegeben, im Falle seiner Rettung vor den deutschen Invasionstruppen einen Roman über die Marienerscheinungen in dem südfranzösischen Wallfahrtsort zu schreiben? Schon ein Jahr nach der geglückten Flucht über die Pyrenäen erschien »Das Lied von Bernadette«. Man darf also annehmen, daß der Gefühlsmensch und Glaubensfanatiker Werfel auch das Gelöbnis eingelöst hat, in seiner Zwiesprache mit Gott der geliebten Haustiere zu gedenken.
Und nun, nach dem feierlichen Schwur des österreichischen Dichters, die nüchterne Stimme des britischen Realpolitikers: Winston Churchills. Der große Staatsmann geht das Thema Mensch und Tier gänzlich anders an – locker, heiter, mit einem kräftigen Schuß Sarkasmus: »Katzen blicken auf dich herab, Hunde schauen zu dir auf, nur Schweine betrachten dich als ihresgleichen.«
Im vorliegenden Buch gehen wir einen Schritt weiter, belassen es nicht bei individuellem Treueschwur oder generalisierender Bewertung, sondern wenden uns – im Blick auf eine Reihe großer Namen aus der Kulturgeschichte – jenen Geschöpfen zu, die es im Umgang mit dem Menschen »zu etwas gebracht haben«: zu einem Namen, zu Ruhm, vielleicht gar zu literarischer Verewigung.
Die Liste ist lang: Sie reicht von Sigmund Freuds »Sprechstundenhilfe«, der Chow-Chow-Hündin Jofie, über das Urbild von Marie von Ebner-Eschenbachs Romanfigur Krambambuli bis zu Meister Loriots Mops- und Kanzler Kreiskys Boxer-Kult, von den Schmetterlingsjagden des »Lolita«-Autors Vladimir Nabokov über die hochpoetische Entstehungsgeschichte des Musicals »Cats« bis zu der Frage, wieso der heilige Antonius von Ägypten auf seiner Stele im Wiener Stephansdom nicht von einem Raben, einem Lamm oder einem Kamel begleitet ist, sondern – von einem Schwein. Auch das Schicksal des »Turms der blauen Pferde« wird uns beschäftigen: Franz Marcs Meisterwerk gilt seit 1945 als verschollen, ist eines der berühmtesten Beispiele unter jenen Millionenschätzen, die wie vom Erdboden verschwunden sind. Und auch die eigenen »tierischen« Erfahrungen des Autors sollten in einem Buch wie diesem ihren Platz haben – vom »Maikäfer flieg«-Erlebnis des Schulbuben bis zum Fernsehkonsumenten unserer Tage, der noch mit achtzig bei der »Sendung mit der Maus« sein Gerät einschaltet. Doch bevor sich die Tore öffnen zu unserer Menagerie, noch ein letztes Mal die Stimme Franz Werfels: »Nichtige Tierchen ihr, deren Geschick mich traf.«
Dietmar Grieser
Große Namen
Am liebsten ein Chow-Chow
»Therapiehunde« à la Sigmund Freud
Als Sigmund Freud im September 1939 dreiundachtzigjährig stirbt, hinterläßt er nicht nur eine große Familie, sondern auch zwei Hunde. Der Rüde Lün ist der zweite und letzte in der Reihe der von ihm so besonders geliebten Chow-Chows. Vor einiger Zeit hat sich Freuds Menagerie im Londoner Exil auch noch um einen Pekinesen namens Jumbo vermehrt. Tochter Anna, der vor allem die Betreuung des Nachlasses und die zügige Weiterführung der Arbeit ihres Vaters obliegt, trifft Vorkehrungen, daß auch für das Wohl der beiden Hundewaisen gesorgt ist. Damit das Hauspersonal in Maresfield Gardens Nr. 20 für den Fall des Abgangs der langjährigen, aus dem Salzburgischen stammenden und mit der Familie nach England emigrierten »Perle« Paula Fichtl über die Bedürfnisse von Lün und Jumbo instruiert ist, tippt die vierundvierzigjährige Anna Freud einen Speisezettel in ihre Schreibmaschine, selbstverständlich in ihrer neuen Umgangssprache Englisch. Für die Morgenfütterung sind Milch und Schwarzbrottoast vorgesehen, dazu ein Teelöffel Lebertran, zwei Tropfen Heilbuttöl sowie Beigaben von Calcium und Phosphat. Die zweite Mahlzeit besteht aus zwei Unzen gekochtem Faschierten oder Fisch, desgleichen die um Gemüse ergänzte dritte, wobei darauf zu achten ist, daß darin »nothing fibrous« enthalten ist, also keine Fasern. Erst zum Tagesabschluß wird’s karger: Kuchen oder Keks.
In Sigmund Freuds Leben haben zu allen Zeiten Hunde eine besondere Rolle gespielt. Man braucht nur einen Blick auf die seinen Schreibtisch zierende Artefaktensammlung zu werfen: Unter den bronzenen Statuetten, Gipsfiguren und Vasen, die dem Herrn Professor bei seiner Arbeit als Stimulantien dienen, findet sich auch die Miniaturskulptur eines jener kurzschnäuzigen Fo-Hunde, die im alten China als heilig gegolten und die Pforten der Tempel bewacht haben.
1891 haben die Freuds ihre Wohnung in der Wiener Berggasse Nr. 19 bezogen. Der Vierbeiner, den sie 1925 anschaffen, ist ein Schäferhund, der auf den Namen Wolf hört; er soll Tochter Anna, das jüngste der sechs Kinder, bei ihren abendlichen Spaziergängen beschützen, die sie meist allein zu unternehmen pflegt. Für den eigenen »Bedarf« wählt Freud einen Chow-Chow, den ihm Annas Freundin Dorothy Burlington zum Geschenk gemacht hat. Die Tochter des New Yorker Nobeljuweliers und Millionärs Louis Comfort Tiffany ist mit ihren vier Kindern aus den USA nach Wien übersiedelt, um mit den Mitteln der Psychoanalyse Rettung aus ihrer gescheiterten Ehe mit dem zeitweise geistesgestörten Dr. Robert Burlington zu finden. Dorothy ist eine begeisterte Chow-Chow-Züchterin.
Welch enge Verbindung Freud in den folgenden Jahren mit Jofie – so der Name der Hündin – eingehen wird, kann sich zu diesem Zeitpunkt niemand, auch nicht der Herr Professor selbst, vorstellen. Das gute Tier legt sich ihm, wenn er das Arbeitszimmer betritt, unter dem Schreibtisch zu Füßen und läßt sich von ihm, so oft er von seinen Büchern oder Manuskripten aufschaut, streicheln. Nach den Mahlzeiten, bei denen der seit seiner Krebserkrankung Appetitlose nur mäßig zulangt, darf Jofie die Reste verzehren – sehr zum Verdruß der Ehefrau Martha, die sich nichts aus Haustieren macht und schon gar nichts aus Hunden, die ihr fürchterlich auf die Nerven gehen. Doch angesichts des autokratischen Lebensstils ihres Mannes bleibt der fünf Jahre Jüngeren nichts anderes übrig, als sich wortlos zu fügen.
Prof. Freud mit »Sprechstundenhilfe« Jofie
Auch im Behandlungszimmer ist Hündin Jofie stets mit von der Partie, wenn der Begründer der Psychoanalyse seine Patientinnen (und in geringerer Zahl Patienten) zur Sitzung empfängt. Für gewöhnlich verharrt das ruhige und gegenüber Fremden distanzierte Tier bewegungslos neben dem Sessel seines Herrls. Nur bei Besuchern oder Patienten, von denen sich Jofie unwillig schnüffelnd oder gar knurrend abwendet, ist Gefahr im Verzug: Gefahr, daß der Herr Professor das Signal »aufnimmt« und in die Beurteilung des Betreffenden einbezieht. »Wen die Jofie nicht mag«, so zitiert Haushälterin Paula Fichtl ihren Dienstgeber, »bei dem stimmt etwas nicht.« Und natürlich, so fährt sie fort, »hat die Jofie immer recht gehabt.« Sind die zwischen Arzt und Patient vereinbarten 50 Minuten um, erhebt sich Freuds vierbeinige »Assistentin« von ihrem Sitzplatz und kündigt auf diese Weise das Ende der Sitzung an.
Wenn die Familie von Mai bis Oktober aus der Stadtwohnung ins Sommerquartier im Vorortbezirk Pötzleinsdorf übersiedelt, genießt die blauzüngige Hündin mit dem zimtfarbenen Fell den Auslauf im weitläufigen Park, den sie nur dann fluchtartig verläßt, wenn ein Gewitter aufzieht. Ist sie vom Regen überrascht worden, besteht Frau Martha darauf, daß das Tier bei der Rückkehr ins Haus eingeseift und einer gründlichen Waschung unterzogen wird. Was Sigmund Freud gar nicht ausstehen kann, sind Versuche, Jofie zu albernen Späßchen zu »mißbrauchen« – so etwa, als Haushälterin Paula dem Chow-Chow einmal einen Pullover überzieht und ein Mützchen aufsetzt. »Das Tier ist doch kein Mensch!« weist Freud die Übermütige streng zurecht.
Schlimm wird es für Freud, als 1937 die schon fast blinde Jofie schwer erkrankt: Der Tierarzt diagnostiziert Krebs: Der Chow-Chow muß eingeschläfert werden. Der Schmerz über den herben Verlust läßt sich nur überwinden, indem ein Ersatz ins Haus kommt. Es ist abermals ein Exemplar jener altchinesischen Rasse, die in ihrer Urheimat »Löwenhund« genannt wird (und der unter vielen anderen auch Queen Victoria seinerzeit verfallen war). Lün, der Neue, ist ein kräftiger Rüde, den Freud schon vor einigen Jahren aufnehmen wollte, um Jofie mit einem Gefährten zu versorgen, doch da die beiden nicht von ihrem ständigen Raufen abließen, mußte zuerst noch Jofies Tod abgewartet werden.
Nun aber sind die gewohnten Verhältnisse wiederhergestellt: Auch Lün genießt die uneingeschränkte Zuneigung seines Herrls, er wird Freud um viele Jahre überleben. Sogar auf dem schweren Weg ins Exil begleitet das gute Tier die seit Österreichs »Anschluß« an Nazi-Deutschland in der Heimat verpönte Familie. Als Freud am Abend des 10. März 1938 durch den Telefonanruf eines Freundes erfährt, daß am folgenden Tag Adolf Hitler in Wien eintreffen wird, bekommt auch Lün die gedrückte Stimmung zu spüren, die in der Berggasse 19 ausbricht. Statt das Nachtmahl anzurühren, wendet sich Freud seinem vierbeinigen Hausgenossen zu und versucht mit einer Überdosis Streicheln die eigene Nervosität zu bannen.
Im Orientexpress Richtung Paris, den die vierköpfige Reisegesellschaft am Morgen des Pfingstsamstags auf dem Wiener Westbahnhof besteigt, sind zwei Abteile reserviert; in dem des Herrn Professor, seiner Frau und Tochter Anna nimmt selbstverständlich auch der Hund Platz. Die Weiterfahrt von Paris nach Calais und das Umsteigen in die Eisenbahnfähre nach Dover verlaufen ohne Zwischenfälle: Die Freuds reisen mit Diplomatenpaß, können ohne Zollformalitäten den Boden des Vereinigten Königreichs betreten. Umso härter trifft es den Zweiundachtzigjährigen, daß sein Chow-Chow den strengen englischen Einreisebestimmungen gemäß in Quarantäne muß. Sechs Monate werden Herr und Hund voneinander getrennt sein; ein Glück nur, daß man den im Tierasyl in South Kensington eingesperrten Lün von der Wohnung aus, die die Familie Freud im Stadtteil St. John’s Wood bezogen hat, besuchen kann. Der Chow Chow stößt erst im Laufe des Dezember, als die Freuds in ihr neues und endgültiges Heim im Villenviertel Maresfield übersiedelt sind, wieder zu den Seinen. Der inzwischen todkranke Professor lebt durch die Nähe des geliebten Tieres, dem sich unterdessen ein zweiter Hund, der Pekinese Jumbo, hinzugesellt hat, sichtlich auf. Nur, als sich im Februar 1939 die Anzeichen für Freuds nahendes Ende mehren, hat der Patient damit fertigzuwerden, daß Liebling Lün immer häufiger dessen Nähe meidet: Der Geruch des mittlerweile offenen Krebsherdes vertreibt das Tier aus der Nähe des todgeweihten Herrls. Schon Monate vor Sigmund Freuds Ableben am 23. September 1939 geht die Obsorge für die »Waisen« Lün und Jumbo zu gleichen Teilen auf Tochter Anna und Haushälterin Paula über.
Von einer schriftlichen Würdigung seiner vierbeinigen Gefährten, wie sie etwa in Gestalt von Thomas Manns berühmtem Porträt seines Lieblingshundes Bauschan, der Erzählung »Herr und Hund«, vorliegt, ist seitens Sigmund Freud nichts bekannt. Umso mehr hat sich die Wissenschaft des Themas angenommen. Über das heutige Allgemeinwissen hinaus, wonach der Umgang mit Haustieren und insbesondere mit Hunden von heilsamer Wirkung sein, ja bei kranken und vereinsamten alten Menschen geradezu Wunder wirken und nicht zuletzt den Massenverbrauch von Antidepressiva eindämmen kann, hat sich in den Disziplinen Psychologie, Psychiatrie und Psychoanalyse schon vor Jahrzehnten eine eigene Fachrichtung etabliert, die die diesbezüglichen Erkenntnisse therapeutisch zu nützen weiß. Nicht nur die Sigmund Freud Privatuniversität in Wien bietet im Rahmen des Psychologiestudiums ein Zusatzmodul »Tiergestützte Therapie und Coaching« an. Und der Österreichische Tierschutzverein, dem Freud seinerzeit angehört hat, erinnert bei jeder sich bietenden Gelegenheit voll Stolz daran, daß sein prominentestes Mitglied die Arbeit der Jugendgruppe »Blaues Kreuz« mit eigenen Kursen zum Thema »Therapiehund« unterstützt hat. Wolf, Jofie, Lün und Jumbo haben ihm dazu das Material geliefert.
Die sanften Riesen
Zu Besuch im ehemaligen k. k. Hofgestüt von Kladrub
Donnerstag, 30. November 1916. Österreich trägt den vorletzten Monarchen seiner Geschichte zu Grabe. Vor neun Tagen ist der Sechsundachtzigjährige in seinem Nachtgemach in Schloß Schönbrunn sanft entschlafen; nun geben die Spitzen seines Reiches, Delegationen aus aller Herren Ländern und nicht zuletzt sein Volk Kaiser Franz Joseph I. das letzte Geleit. Seit den späten Vormittagsstunden ist halb Wien auf den Beinen: Man will sich einen günstigen Aussichtspunkt sichern, wenn nach 14 Uhr der Trauerkondukt durch die Straßen der Innenstadt zieht. Es ist eine Zeremonie von unüberbietbarer Erhabenheit, von einzigartiger Dimension. Leiblakaien tragen den Sarg mit dem Leichnam über die Botschafterstiege zur nahen Hofburgkapelle, wo die Einsegnung erfolgt; dann führt der Weg in den Schweizerhof, wo der riesige schwarzlackierte Leichenwagen bereitsteht. 1876/77 hat die k. k. Hofsattlerei das prunkvolle Gefährt hergestellt, dessen Baldachin mit Krone und Adler verziert ist. Nur drei Mal ist es bis jetzt benützt worden: bei den Beisetzungen von Kaiserinwitwe Maria Anna, Kronprinz Rudolf und Kaiserin Elisabeth.
Unter dem feierlichen Geläut sämtlicher Kirchenglocken der Stadt wird der Sarg auf den Leichenwagen gehoben, das Gespann aus acht schwarzgeschirrten Rappen setzt sich in Bewegung, um die lange Strecke über Inneren Burghof, Heldenplatz, Ringstraße, Schwarzenbergplatz, Aspernplatz, Quai und Rotenturmstraße zum Stephansdom zurückzulegen, wo Kardinal Piffl eine zweite Einsegnung vornimmt. Dann das letzte Stück Strecke in Richtung Kapuzinerkirche: Kärntnerstraße, Kupferschmiedgasse, Neuer Markt. Vor dem schwarzverhängten Portal hält der Zug an, der Sarg wird vom Leichenwagen gehoben, Pater Guardian und der gesamte Kapuzinerkonvent geben dem Verstorbenen das Geleit zu dem im Inneren der Kirche errichteten Katafalk, Sänger der Hofmusikkapelle intonieren das »Libera«.
Vor der Pforte zur Gruft dann das berühmte Ritual: Der Obersthofmeister klopft mit umflortem Stab an das verriegelte Tor und verlangt Einlaß.
»Wer ist da?« fragt Pater Guardian.
»Seine Majestät, der Allerdurchlauchtigste Kaiser Franz Joseph.«
»Ignosco. Den kenne ich nicht.«
»Der Kaiser von Österreich und Apostolische König von Ungarn.«
Habsburgischer Pompe funèbre: Rappen aus dem Hofgestüt Kladrub ziehen Kaiser Franz Josephs Leichenwagen.
Wieder die gleiche Antwort: »Ignosco. Den kenne ich nicht.«
Ein drittes Mal ertönt das Klopfen an die unverändert verschlossene Pforte.
»Wer verlangt Einlaß?«
»Ein sündiger Mensch, unser Bruder Franz Joseph.«
Nun endlich geht das Tor auf, ehrerbietig nehmen die Kapuzinermönche den Leichnam in ihre Obhut. Kaiser Karl und Kaiserin Zita, die den Trauerkondukt angeführt haben, verlassen die Kirche und begeben sich zurück in die Hofburg; auch die vieltausendköpfige Trauergemeinde und die die Straßen und Plätze ringsum bevölkernde Menschenmenge lösen sich auf, der über mehrere Stunden eingestellte Straßenbahn- und Stellwagenverkehr nimmt den Betrieb wieder auf. Der Leichenwagen mit seinem grandiosen Achtergespann aus schwarzgeschirrten Rappen rollt zurück in die Hofburg.
Es ist das vorletzte Mal, daß er in Funktion getreten ist; nur am 1. April 1989, über zweiundsiebzig Jahre später, wird der kaiserliche Leichenwagen noch ein Mal aus der Remise geholt werden: wenn Kaiserin Zita in der Kapuzinergruft beigesetzt wird. Seitdem ist er außer Dienst gestellt, das republikanische Österreich bedarf seiner nicht mehr, als Museumsstück bildet er eine der Attraktionen der Wagenburg von Schönbrunn.
Es ist deren Kustoden hoch anzurechnen, daß sie bei der Auswahl ihrer Exponate nicht verabsäumt haben, auch jener »Mitwirkenden« des habsburgischen Pompe funèbre zu gedenken, ohne deren Einsatz der kaiserliche Leichenwagen keinen Schritt von der Stelle gekommen wäre: der Pferde, die ihn unter den bewundernden Blicken der Wiener in prunkvollem Achtergespann durch die Straßen der Stadt gezogen haben.
Ich spreche von dem 1853 im Auftrag des Hofes angefertigten Ölgemälde, das an einer der Wände der Wagenburg prangt und den Blick freigibt auf das k. k. Hofgestüt von Kladrub, wo seit den Tagen Kaiser Rudolfs II., also seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, die Zugpferde für die Karossen der Habsburger gezüchtet werden: die Schimmel- und Rappenhengste der bei den Trauerkondukten eingesetzten Achterzüge und die hellbraunen Halbblüter für die Ausfahrten der übrigen Hofwagen. Daß die »Kladruber« schon damals – und erst recht heute – im Schatten der berühmteren Lipizzaner stehen, ist eine der vielen Ungerechtigkeiten dieser Welt; nehmen wir das im Jahr 2004 begangene 425-Jahr-Jubiläum des Gestüts von Kladrub zum Anlaß, den »sanften Riesen« aus Ostböhmen, wie man die edlen Tiere immer wieder genannt hat, unsere Reverenz zu erweisen.
Schon Pardubitz, wo ich auf dem Weg nach Kladrub Zwischenstation mache, ist ein Mekka für Pferdefreunde: Die 100 000 Einwohner zählende Hauptstadt Ostböhmens, gut 200 Kilometer nördlich von Wien und 75 Kilometer östlich von Prag, ist berühmt für ihr alljährlich veranstaltetes Steeplechase, das als das älteste und schwierigste Hindernisrennen auf dem Kontinent gilt. Mich aber zieht es an die »Quelle«: Ich will den Ort kennenlernen, aus dem die Pferde für die königlichen Gespanne kommen, den Ort, wo sie geboren, aufgezogen und trainiert werden – im Frühjahr 2004 hat man sie im Fernsehen bewundern können, als sie das dänische Kronprinzenpaar anläßlich seiner Vermählung im offenen Landauer durch die Straßen von Kopenhagen gezogen haben.
Ich folge der Straße in Richtung Kolin, hinter der Ortschaft Prelouc biege ich nach rechts ab, überquere die Brücke der an dieser Stelle schmalen Elbe und sehe schon von weitem die ersten Koppeln mit den still weidenden Tieren, die – ähnlich den Lipizzanern – schwarz auf die Welt kommen und mit zunehmendem Alter Grautöne annehmen, um schließlich im makellosesten Weiß zu glänzen: ein Bild, das nicht nur das Herz der Pferdenarren höher schlagen läßt.
Schon der Blick auf die Pforte des im Jahr 2002 in den Rang eines Nationalen Kulturdenkmals der Tschechischen Republik erhobenen Gestüts, wo ich von Lenka Gotthardová, der jungen Direktorin, freundlichst erwartet werde, bestätigt, was in allen Prospekttexten betont wird: In Kladrub ist die Zeit stehengeblieben. Das unter Maria Theresia erbaute Schlößchen samt angeschlossener Kirche erstrahlt in aufgefrischtem Kaisergelb, die über das 3000 Hektar große Areal verstreuten Farmen tragen nach wie vor Namen wie »Franzenshof« und »Josefshof«, und unter den Tafeln, die über Identität und Abstammung der einzelnen Tiere Auskunft geben, finde ich nicht nur solche mit Aufschriften wie Generale, Favory und Libanon, sondern auch einen Rudolfo, ja sogar einen »Almhirt«. In den Repräsentationsräumen hinter dem Verwaltungstrakt hängen die Porträts des Gestütgründers Rudolf II. und Maria Theresias an den Wänden; Gemälde erinnern daran, daß auch Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Sisi in Kladrub zu Gast gewesen sind.
Ich bin in guten Händen: Zuzana, die in Prag Zoologie studiert hat und in Kladrub unter anderem für Öffentlichkeitsarbeit und Außenkontakte zuständig ist, übernimmt die Führung. Verschmitzt lächelnd überprüft sie mein Schuhwerk: Pferdeställe und Reithallen sind keine Ballsäle. Die meisten Tiere sind zur Zeit meines Besuches draußen auf ihren Weidegründen; die wenigen, die sich in ihren Boxen aufhalten, wenden sich neugierig dem Gast zu – und noch neugieriger dem Pfleger, der frisches Futter austeilt oder nach dem Brauseschlauch für die morgendliche Dusche greift. Es ist ein heißer Sommertag: Das Reinlichkeitsbad bringt zugleich Abkühlung.
Nach der Feuersbrunst von 1757, der große Teile des Gestüts zum Opfer gefallen sind, hat Kaiser Josef II. sämtliche Einrichtungen erneuern lassen: Ich stapfe über den Strohteppich der Mutter-Kind-Halle, werfe einen Blick in die Veterinärstation, nur das Haus mit den Quartieren für die rund hundertzwanzig Beschäftigten ist ein moderner Zweckbau. Die schnurgerade vom Hauptplatz wegstrebenden Alleen zu den einzelnen Höfen haben eine Länge von zweieinhalb Kilometern – eine von ihnen führt in den Nachbarort Reˇcaný mit seiner Bahnstation: Hier wurde, wenn hoher Besuch vom Wiener Hof ins Haus stand, der Ankömmling in großem Stil mit der Kutsche eingeholt.
Nebenbei erfahre ich alles über Tagwerk und Jahrespensum der »sanften Riesen«: Dreimal täglich werden sie gefüttert, mit vier Jahren setzt das Training ein, die »Prüfungsfächer« umfassen Sattel, Kutsche und Schwergewicht. Letzteres ist für das künftige Zugtier die wichtigste Bewährungsprobe: Durchschnittlich 90 Prozent der Kandidaten bestehen sie mit Bravour. So viel Aufwand hat natürlich seinen Preis: Mit mindestens 10 000 Euro muß der heutige Käufer rechnen, der sich für einen Kladruber interessiert. Der »Vorrat« ist ausreichend: An die fünfzig Fohlen sind es in der Regel, die pro Jahr zu dem Grundbestand der rund dreihundert ausgewachsenen Pferde hinzukommen.
Angefangen hat das Ganze im Jahr 1579: Kaiser Rudolf II., dem altspanischen Hofzeremoniell besonders verbunden, führt aus Spanien und Italien hochwertige Pferde ein und siedelt sie in den abgelegenen Ländereien um Kladrub an, um ein Gala-Zugtier für die kaiserlichen Karossen züchten zu lassen. Die neue Rasse gedeiht so prächtig, daß es unter Leopold I. bereits dreihundert Mutterstuten und dreißig Beschäler sind, die sich in dem ostböhmischen Hofgestüt tummeln. Für Wien wird eine Reserve von sechzehn Rappen und sechzehn Schimmeln »abgezweigt«, und das bedeutet bei Wagenpferden: sechzehn Paare, die in puncto Größe und Gestalt, Bewegung und Geschwindigkeit, Temperament und Charakter perfekt zueinanderpassen müssen. »In Anbetracht des harten Wiener Granitpflasters«, so lese ich in einem 1890 erschienenen Leitfaden zur Aufzucht der Kladruber Rasse, sind »knochenstarke Beine und feste Hufe« eine wichtige Voraussetzung. Und weiter: »Wagenpferde müssen sicher und vollkommen in Gehorsam sein, ruhig stehen und besonders beim Stadtdienste leicht und gut wenden.«
Am Wiener Hof legt man auch diesbezüglich größten Wert auf würdevolles Gebaren – im Gegensatz zum forschen Preußen, wo Kaiser Wilhelm es vorzieht, mit seinen Orloff-Trabern im Eilschritt nach Potsdam zu sausen. »Kaiser Franz Joseph hingegen«, so drückt es einer der früheren Gestütsleiter von Kladrub aus, »ließ die Pferde gemächlich und pompös agieren, damit das Volk, wenn es ihnen vom Straßenrand aus zuschaute, ja vielleicht stundenlang auf ihr Erscheinen gewartet hatte, das erhabene Schauspiel in aller Ruhe genießen konnte.«
Nichts bleibt in Kladrub dem Zufall überlassen; die 1890 im nahen Pardubitz veröffentlichte »Instruktion zur Belehrung der Chargen und Stationsleiter in den k. k. Staats-Hengsten-Depots« schreibt bis ins kleinste Detail »Stallordnung, Wartung und Pflege« vor. Greifen wir ein Beispiel heraus, das Tränken:«
»Zum Tränken der Hengste ist frisches Brunnenwasser zu verwenden, doch dürfen die Tiere niemals im erhitzten Zustande getränkt werden. Ist das Wasser sehr kalt, so ist es dadurch zu mildern, daß es eine Stunde vor dem Verabreichen im Tränkgefäße im Stalle stehengelassen wird. Auch ist, um das gierige Saufen zu verhindern, eine Handvoll Heu auf das Wasser zu legen.«
Noch strenger die Regeln in Sachen Fortpflanzung:
»Das Belegen der Stuten darf erst beginnen, wenn die Hengste vom Ausreiten zurückgekehrt, gut abgeputzt und ausgeruht sind. Eine halbe Stunde vor dem Mittagsfutter ist mit dem Belegen zu endigen. Des Nachmittags dürfen nur solche Hengste zum Belegen verwendet werden, die entweder bei einfachen Sprüngen des Vormittags nicht gedeckt haben oder denen zwei Sprünge des Tages erlaubt sind.«
Wie geht es nach dem Zusammenbruch der Monarchie mit dem vormaligen k. k. Hofgestüt weiter? Mehr schlecht als recht: Die edlen Tiere kämpfen um ihr Überleben, mit nur je sechzehn Stuten und zwei Beschälern beider Farbschläge, also Schimmel und Rappen, wird mühsam versucht, den Zuchtbetrieb aufrechtzuerhalten. Ein Fanatiker, der es auf die radikale Ausmerzung aller »österreichischen Überbleibsel« abgesehen hat, läßt sich dazu hinreißen, die beiden Schimmelhengste zu vergiften.
Das Desaster ist vollkommen, als man zwischen 1924 und 1929 dem Ruf der heimischen Bauern nach kräftigen Ackergäulen nachzukommen versucht und schwere Oldenburger nach Kladrub holt. Erst 1941 kann mit der Regenerierung der Rappen begonnen werden; auch gelingt es trotz der deutschen Besatzung, die Tiere von der Front fernzuhalten.
Neue Gefahr für die Erhaltung der Kladruber droht nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Kommunisten die Macht im Land übernehmen: Aus dem Gestüt wird ein landwirtschaftlicher Großbetrieb, der vor allem die Rinder- und Schweinezucht forciert. Immerhin gelingt es den verantwortungsbewußten Männern an der Spitze des Unternehmens, die zuständigen staatlichen Instanzen davon zu überzeugen, daß es zu den nationalen Pflichten gehört, die »einzige bodenständige Pferderasse« zu erhalten, und so muß man, als sich mit der Wende von 1989 ein neuer Aufschwung für Kladrub abzeichnet, nicht gerade bei null anfangen.
Heute erlebt der Besucher das Národní hřebčin als gutfunktionierenden Staatsbetrieb, der unter keinen Umständen privatisiert werden darf; das Landwirtschaftsministerium der Tschechischen Republik, dem er unterstellt ist, hat ihn zum nationalen Kulturdenkmal erklärt, zur »Gen-Reserve« in Sachen Pferdezucht. Geht eines der zum Verkauf freigegebenen Tiere ins Ausland, müssen zwei Ministerien in Prag ihre Zustimmung erteilen. »Es ist fast so wie bei der Veräußerung eines kostbaren alten Gemäldes aus einem der großen Museen«, sagt einer der internationalen Experten, der es wissen muß, und er fügt hinzu: »Das Altkladruber Pferd von heute unterscheidet sich in nichts von seinem Vorgänger aus dem 16. Jahrhundert, wie man ihn auf den historischen Darstellungen abgebildet findet.«
Zwar machen die Kladruber auch als Reit- und Dressurpferde Furore, doch ihre eigentliche Stärke ist und bleibt das Gespann. Der Besucher, der nicht das Glück hat, einem der großen Turniere beiwohnen zu können, die mehrmals im Jahr an Ort und Stelle stattfinden, kann sich zumindest bei einer der Kutschfahrten, die das Gestüt – je nach Wunsch zweispännig oder vierspännig – anbietet, von Schönheit und Talent der »sanften Riesen« überzeugen, und fällt sein Aufenthalt in die kalte Jahreszeit, kann er von der Karosse auf den Schlitten umsteigen.
Den Gast, der aus Österreich anreist, erwartet eine zusätzliche Freude: In Kladrub ist nichts von jenen Vorbehalten zu spüren, die noch immer in vielen Teilen des heutigen Tschechien gegenüber der »alten Zeit« gehegt werden, als hier noch der Kaiser im fernen Wien den Ton angegeben hat. »Herzlich willkommen« lese ich auf der am Eingang des Gestüts angebrachten Tafel, die den Besucher über die Besichtigungstermine informiert, und ich lese es nicht nur in Tschechisch und in Englisch, sondern auch in makellosem Deutsch.
Gazellen für Sisi
Der Schah von Persien auf Staatsbesuch in Wien
Die Zeit der großen Staatsbesuche ist vorbei, und gar etwas so Bombastisches wie das Zehn-Tage-Spektakel vom Sommer 1873, als Nasreddin Schah, der »Herr des Morgenlandes«, das sechs Monate lang im Weltausstellungstaumel liegende Wien beehrt, kann sich heute nur noch vorstellen, wer über eine blühende Phantasie à la Tausend und eine Nacht verfügt. Es ist das erste Mal, daß Persiens Souverän seinen Fuß auf europäischen Boden setzt: Via Rußland, Deutschland, England, Frankreich, die Schweiz und Italien anreisend, trifft der Zweiundvierzigjährige am 30. Juli im Land der »ungläubigen« Österreicher ein.
Gewohnt, daß alles nach seinem Willen geht, ist er schon indigniert, daß er sich einem penibel eingehaltenen Fahrplan unterwerfen muß: Punkt 19 Uhr rollt der kaiserliche Hofzug im Bahnhof Penzing ein; dem hundertfünfzigköpfigen Gefolge fährt eine zweite Garnitur hinterdrein, die das Gepäck und die Menagerie heranschafft: Pferde und Hunde, Hammel und Hühner, dazu das Gastgeschenk für Sisi – vier Gazellen.
Die zahlreichen Schaulustigen, die der Begrüßung durch Kaiser Franz Joseph beiwohnen, kommen voll auf ihre Rechnung: Statt mit Knöpfen ist die Uniform des Schah mit Diamanten und Rubinen besetzt. Die persische Nationalhymne, die am Perron erklingt, ist allerdings österreichischer Eigenbau: Ursprünglich von Militärkapellmeister Leitermayer zusammenphantasiert (weil Persien zu dieser Zeit noch über keine eigene verfügt), fällt dessen »Persischer Marsch« so schaurig aus, daß Johann Strauß allerhöchsten Auftrag erhält, eilends einen zweiten zu komponieren.
Nach kurzem Aufenthalt geht’s weiter – mit der Verbindungsbahn nach Laxenburg. Im Blauen Hof, jenem Trakt des kaiserlichen Sommersitzes, den einst Maria Theresia für ihren Gebrauch hat adaptieren lassen (und der heute das Internationale Institut für angewandte Systemanalyse beherbergt), soll Österreichs Staatsgast logieren. Kronprinz Rudolf, der hier vor 15 Jahren zur Welt gekommen ist, steht im vordersten Glied des Empfangskomitees: Wenn sich das Haupt des Erhabenen zum Stirnkuß über ihn beugt, muß sich der junge Thronfolger beherrschen, daß ihn nicht das Kitzeln des monströsen Schnurrbartes aus dem Konzept bringt.
Schlimmes bahnt sich derweil in den benachbarten Gemächern an: Die Dienerschaft des »Lieblings der Sonne« ist dabei, Schloß Laxenburg nach ihren Vorstellungen umzumodeln. Alle Pölster werden flachgetreten, alle Teppiche durch eigene ersetzt, in einem der Kabinette werden die fürs leibliche Wohl des »Königs der Könige« bestimmten Hammel nach mohammedanischem Ritus geschlachtet und nebenan bei offenem Feuer gebraten. Auch die drei Hühner, die der Schah allmorgendlich eigenhändig abzumurksen pflegt, hinterlassen Spuren – ganz zu schweigen von den Vorhängen, an denen sich die Domestiken die fettigen Finger abwischen. Ungeniert vor aller Augen (und stehend) verrichtet man die große Notdurft – in eigens mitgeführten Klosetts. Kaiserin Elisabeth, die anderntags beim Diner in Schönbrunn größte Mühe hat, angesichts all der barbarischen Faux pas der Gäste Haltung zu bewahren, nimmt Reißaus und fährt zu ihrer fünfjährigen Tochter Valerie auf die Rax.
Am vierten Tag – es ist der 2. August – begleitet Franz Joseph den ein Jahr Jüngeren in den Prater. Der von zehn Equipagen gefolgte sechsspännige Galawagen, mit dem die Strecke vom Südbahnhof zum Weltausstellungsareal zurückgelegt wird, hält zunächst vor dem Kaiserpavillon, wo gemeinsam das Déjeuner eingenommen wird; dann geht’s weiter zur Rotunde, bei deren Betreten Glockengeläut und Orgelspiel erklingen, dazu das tausendstimmige »Vivat!« der Besucher. Beim Durchschreiten der einzelnen Abteilungen – die persische ist ein nach Nasreddins eigenen Entwürfen errichtetes Prunkzelt – folgen ihm fünf Diener mit dem »Allernötigsten«: einem roten Sonnenschirm, einem brillantenbesetzten Operngucker, einer vergoldeten Teekanne, einer zinnernen Kohlenpfanne, einer Teppichtasche, einer Wasserpfeife sowie einem Behälter unbekannten Inhalts. Ermattet der gesegnete Leib, so werden ihm zum Ausrasten Sitzlager bereitet und Unmengen Gefrorenes gereicht.
Nasreddin Schah (hier bei einer Kahnpartie in Laxenburg) ist ein schlechter Schütze: Seine »Jagdbeute« hat einer der Diener heimlich auf dem Wochenmarkt erstanden …
Geldgierige Wiener Matronen drängen sich an den Gast heran, ihm ihre Töchter für seinen Harem feilzubieten, und gar der geschäftstüchtigen Kaufleute, Fabrikanten, Juweliere, Bankiers und Erfinder, die an den verbleibenden Tagen um Audienz ansuchen, ist und ist kein Ende. Aus ihren Träumen vom großen Geld werden sie erst später jäh erwachen, wenn sie erkennen müssen, daß orientalische Potentaten es gewohnt sind, geschenkt zu erhalten, was ihnen ins Auge sticht. Ein großer Teil der Lieferantenrechnungen bleibt unbeglichen, und die Diamanten der meisten vom Schatzmeister ausgestreuten Orden sind in Wirklichkeit aus Glas.
An der Ballettsoirée, zu der der Kaiser in die Hofoper lädt, interessieren den Schah nur die Beine der Tänzerinnen; Pferderennen und Hofjagd langweilen ihn; und zum Abschiedsempfang in Schönbrunn erscheint er mit zweistündiger Verspätung, weil sein Leibastrologe die offizielle Beginnzeit für »ungünstig« erklärt hat. Nur die Truppenparade auf der Schmelz, bei der zwanzigtausend Mann in Galauniform an ihm vorbeidefilieren und über hunderttausend Zaungäste jubeln, ist nach seinem Geschmack.
Am 8. August 1873 tritt Nasreddin Schah, von Kaiser Franz Joseph mit zwölf Kisten feinsten Porzellans beschenkt, die Heimreise an – in Laxenburg können die Reinigungs-, Aufräumungs- und Instandsetzungsarbeiten beginnen …
Kreiskys Boxer und Napoleons Hengst
Tiere machen Politik
Die Geschichte ist oft und oft erzählt worden, am exaktesten von Hans Werner Scheidl in seinem Standardwerk »Der wahre Kreisky«. Februar 1981. Schon seit Monaten tagt im österreichischen Parlament der Untersuchungsausschuß, der den Finanzskandal rund um den Bau des Wiener Allgemeinen Krankenhauses aufklären soll. Die ÖVP will neue Zeugen laden, die SPÖ lehnt ab. Da reißt dem Chef der bürgerlichen Partei, Alois Mock, der Geduldsfaden: Er beschwert sich bei Bundespräsident Kirchschläger über den Starrsinn der Regierungspartei. Darüber gerät nun wieder der Bundeskanzler in Rage: Der Bundespräsident, so wettert Kreisky in einem Interview mit den »Salzburger Nachrichten«, dürfe unter keinen Umständen als eine Art »Justizkanzler« mißbraucht werden.
Beim darauffolgenden Pressefoyer legt Kreisky noch einmal nach: Er sehe die Gefahr einer Wiederkehr der schlimmen Dreißigerjahre. »Ich habe die damaligen Justiztricks genau in Erinnerung, ich kann nicht früh genug warnen vor einer Wiederholung.« Einer der Journalisten in der Runde kontert dem Kanzler, von einer solchen Gefahr könne doch im heutigen Österreich keine Rede sein. Darauf Kreisky: »Und das sagen Sie angesichts des gestrigen Putschversuchs in Spanien?« Der Journalist – es ist der Militärexperte (und spätere Buchautor) Gerhard Vogl – läßt nicht locker: »Aber wir sind hier nicht in Spanien, Herr Bundeskanzler, die politische Situation in Österreich ist doch eine völlig andere.«
Jetzt platzt dem Choleriker Kreisky endgültig der Kragen. Er maßregelt seinen Widerpart mit den Worten: »Lernen Sie Geschichte, Herr Reporter!« Daß er sich dabei nicht dem eigentlichen »Sünder« Gerhard Vogl zuwendet, sondern irrtümlich dem neben diesem stehenden Kollegen Ulrich Brunner (der zu dieser Zeit für das sozialistische Zentralorgan »Arbeiter-Zeitung« (AZ) arbeitet und später die Leitung des ORF-Landesstudios Burgenland übernehmen wird), kann nichts daran ändern, daß es nicht Vogl, sondern Brunner sein wird, der fortan mit dem Vorfall identifiziert werden, ja damit in die österreichische Mediengeschichte eingehen wird.
Die Angelegenheit könnte damit für alle Zeiten erledigt sein, kämen nicht immer wieder unter den Kreisky-Kennern (und Kreisky-Kritikern) Spekulationen auf, die Verwechslung der beiden Journalisten sei keineswegs ein Zufall gewesen, sondern ein ganz bewußter Racheakt des »Sonnenkönigs«. Kreisky könnte sich bei seiner wutschäumenden Zurechtweisung an einen etliche Zeit zurückliegenden Vorfall erinnert haben, in dessen Mittelpunkt AZ-Redakteur Ulrich Brunner gestanden sei. Kreisky hatte die Führungsgarnitur des unter dramatischem Auflagenschwund leidenden Parteiorgans zu einem Gespräch im Garten seiner Döblinger Villa eingeladen. Der Kanzler saß in seiner Hollywoodschaukel, im Halbrund um ihn die versammelten AZ-Redakteure, unter ihnen Ulrich Brunner. Und mittendrin, wie es im Hause Kreisky üblich war, dessen Hunde: die Boxer Goliath und Bianca. Goliath, der schwarze Rüde, machte sich während des Gesprächs, offensichtlich um eine Streicheleinheit bemüht, an Brunner heran, machte sich an dessen Hosenbein zu schaffen und sabberte dabei mit seinen triefenden Lefzen den schönen Anzug des Gastes an. Brunner versuchte, das »lästige« Tier unauffällig wegzuschubsen, und als dies mißlang, wurde es ihm zu bunt, und er herrschte Goliath mit den unüberhörbaren Worten »Schleich dich!« an. Mehr brauchte es nicht, um den in seine beiden Hunde vernarrten Kanzler in Rage zu bringen: Kreisky unterbrach seinen Monolog (über seine Zeit als Kriegsberichterstatter im Finnischen Winterkrieg) und durchbohrte Brunner mit einem giftigen, strafenden Blick. Ob es nun in den Bereich der gut erfundenen Anekdoten fällt oder aber tatsächlich der Wirklichkeit entspricht: Ulrich Brunner war von Stund an bei Kreisky in Ungnade gefallen und mußte darauf gefaßt sein, daß dieser eines Tages mit dem vermeintlichen »Hundefeind« abrechnen würde …
Ja, Kreisky und seine Hunde – eine lange Geschichte! Schon im Wiener Elternhaus in der Schönbrunnerstraße lernt der Heranwachsende mit Vierbeinern umzugehen. Ein Foto aus jener Zeit zeigt den Sechzehnjährigen mit einem der Dobermänner, die im Haus des Generaldirektors der Österreichischen Wollindustrie AG, Max Kreisky, die bevorzugte Rasse sind. Auch während der Sommerferien, die die Familie in der Villa der Großeltern im mährischen Trebitsch verbringt, sind die dortigen Hunde Brunos liebste Spielgefährten. Köchin Julie und Dienstmädchen Marie, ein böhmisches Geschwisterpaar, mit denen die Eltern tschechisch sprechen, kümmern sich, wenn man wieder in Wien ist, um die verwöhnten Vierbeiner. So ergeben sind sie den beiden Dobermännern, daß sie ihnen auch die verwegensten Streiche durchgehen lassen – so etwa, als sich diese während eines Opernbesuchs der Eltern in deren Bett legen und, vom Hauspersonal entdeckt und aus dem Schlafzimmer verjagt, vor Schreck (oder aus Protest?) darauf vergessen, daß sie streng erzogen und selbstverständlich stubenrein sind. Geht das Kindermädchen mit den Hunden in den Beserlpark nahe der Mollardschule, die Klein-Bruno seit September 1916 besucht, darf sich der knapp Sechsjährige der Äußerlpartie anschließen und das »Kommando« übernehmen. Die bildhübsche Julie hat Wichtigeres zu tun: Sie hält auf einer der Parkbänke nach Kavalieren Ausschau, meistens tschechischstämmigen Soldaten, die zwecks Rekonvaleszenz im nahen Militärspital einquartiert sind.
Der junge Kreisky – damals noch mit Dobermann
Mit Jagdhunden bekommt es Jüngling Bruno regelmäßig zu tun, wenn er bei Onkel Rudolf in Böhmen zu Besuch ist und dieser mit seinen Kumpanen auf die Pirsch geht. »Die Ausfahrt mit kleinen Jagdwägelchen«, so wird er Jahrzehnte später in seinen Memoiren schreiben,