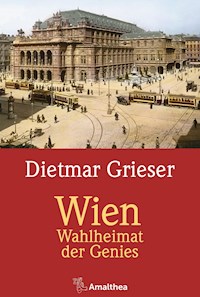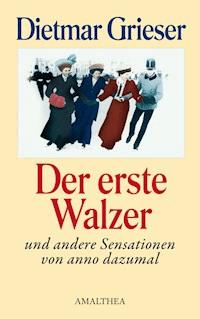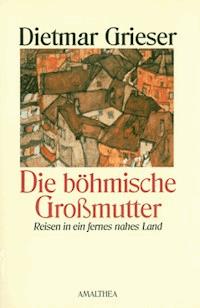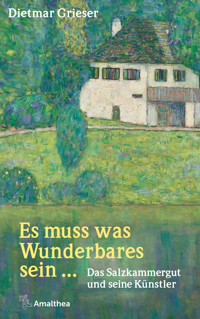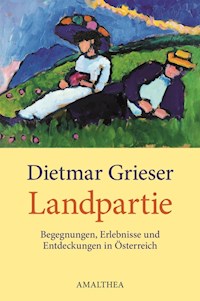
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wien ist sein Ehebund, die Länder sind seine "Panscherln". In den 56 Jahren, die Dietmar Grieser nun in Österreich lebt, ist er viel herumgekommen - auf seine Weise: auf Landpartien, im Urlaub, zu Recherchen, als Vortragsreisender. Gut gelaunt berichtet er von den schönsten, berührendsten und vergnüglichsten Erlebnissen in seiner Wahlheimat: von Begegnungen mit Dichtern, Malern und Theaterleuten, von seinen Streifzügen durch die Tierwelt am Neusiedlersee und vom Scheitern einer Weinreise durch die Südsteiermark. Wir begleiten ihn zur "Hitler-Kirche" von Graz, besuchen ungewöhnliche Jahrmärkte und makabre Begräbnisse, erfahren vom "Raub" einer Kaiserstatue in Wiener Neustadt und einem spektakulären Mordfall im Ausseerland. Amüsante Reminiszenzen, köstliche Geschichten, die bestätigen: Österreich ist einfach anders.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietmar Grieser
Landpartie
Dietmar Grieser
Landpartie
Begegnungen, Erlebnisse,Entdeckungen in Österreich
Mit 26 Abbildungen
Der Abdruck S. 113f. erfolgt mit freundlicher Genehmigungdes Picus Verlag, Wien, aus: Martin Leidenfrost: »Die Welt hinter Wien«,Wien: Picus Verlag, 2008, S. 224f.
Besuchen Sie uns im Internet unter:www.amalthea.at
© 2013 by Amalthea Signum Verlag, WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Silvia Wahrstätter, vielseitig.co.atUmschlagmotiv: Gabriele Münter, »Jawlensky und Werefkin«,Städtische Galerie im Lenbachhaus, MünchenSatz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 11,25/15 Punkt New CaledoniaPrinted in the EUISBN 978-3-85002-839-4eISBN 978-3-902862-43-3
Für Bernd
Inhalt
Vorwort
Erlebnisse
Franzl
Keine Rückkehr nach Wagrain
Ein dunkler Punkt
Trappe, Sessel, Ananas
Die Marillen der Frau Colocotroni
Pompe macabre
Es wird kein Wein sein …
8.14 Uhr, Gleis 7
Noblesse und Diskretion
Zweitwohnsitz
Begegnungen
Neues aus der Szene
»Nur Lumpe sind bescheiden …«
Im frei gewählten Exil
Meine Freunde, die Poeten
Hollemann von A bis Z
Entdeckungen
Sozialbau à la Maria Theresia
Der Doppelgängervon Wiener Neustadt
H & M
Die Schuhschachteln des GendarmenAlois Mayrhuber
Erfahrungen
Autor auf Tour
Lob der Provinz (inklusive Tadel)
Kindermund
Bauernmarkt
Jenseits der Grenzen
Von Seebarn nach Lubowitz
Vaters Typoskript
Anhang
Personenregister
Bildnachweis
Vorwort
Wien ist der Ehebund, die Länder sind die »Pantscherln«. Was wiegt schwerer – die unverbrüchliche Treue zum Lebenspartner oder der Reiz der Liebelei, der »Kitzel« der Affäre, der Eskapade, des Seitensprungs?
Sechsundfünfzig Jahre sind wir nun beisammen, die Bundeshauptstadt und ich; die diamantene Hochzeit naht mit Riesenschritten. An Belegen für die Beständigkeit, Intensität und »Ergiebigkeit« meiner Beziehung zu Wien fehlt es nicht: In mehreren meiner Bücher habe ich Zeugnis abgelegt über all das, was ich meiner Wahlheimat Wien verdanke.
Aber Wahlheimat – gehören da nicht auch Graz und Innsbruck dazu, Villach, Salzburg, Linz? Auch dort habe ich mich viel und gerne umgetan. Und was ist mit den zahllosen kleinen und kleinsten Ortschaften »draußen«, die ich aufgesucht, die Täler, Berge und Gewässer, an denen ich mich aufgehalten, die Menschen in der sogenannten Provinz, die ich kennengelernt, von denen ich profitiert, die ich liebgewonnen habe?
Ich gebe zu, ich bin kein Naturmensch, kein Landfreak, kein Stadtflüchtling, auch kein Häuselbauer, schon gar nicht Wanderbursche oder Alpinist. Aber durchstreift habe ich sie der Reihe nach alle – die österreichischen Bundesländer. Nur eben auf meine Weise: auf Landpartien, im Urlaub, zu Recherchen für meine Bücher, als Vortragsreisender. Etliche meiner Werke sind ganzen Landschaften gewidmet: dem Salzkammergut (»Nachsommertraum«) oder Südtirol (»Im Rosengarten«). In Niederösterreich und Oberösterreich, im Burgenland und in der Steiermark bin ich auf der Suche nach den »Schauplätzen österreichischer Dichtung« fündig geworden; für »Stifters Rosenhaus und Kafkas Schloß«, »Die böhmische Großmutter« und »Der Onkel aus Preßburg« war ich grenzüberschreitend unterwegs.
Und an manchen der Orte, an denen ich länger verweilt, Land und Leute kennengelernt und neue Freundschaften geschlossen habe, wurde sogar der Wunsch geäußert, ich möge doch eines Tages auch über sie ein Buch schreiben. Ein eigenes Werk über Feldkirch oder Jennersdorf, über Illmitz oder Matrei? Ich mußte sie allesamt enttäuschen: Da wurde meine Leistungsfähigkeit überschätzt. Wie sollte ich es schaffen, mich in so viele, so unterschiedliche Milieus einzuleben, mir deren Besonderheiten zu eigen zu machen, sie in aller Form zu porträtieren?
Was jedoch blieb und was es in der Tat verdiente, festgehalten zu werden, sind jene vielen kleinen Begebenheiten und Begegnungen zwischen Bregenz und Mattersburg, zwischen Waldviertel und Hoanzenland, die sich meinem Langzeitgedächtnis eingeprägt haben, und von ihnen soll in diesem Buch die Rede sein: Berührendes und Groteskes, Belustigendes und Makabres, Menschliches und Allzumenschliches (und zum Glück kaum Unmenschliches). Es sind Geschichten, die eines gemeinsam haben: Sie spielen allesamt in dem Land, dem ich seit meinem vierundzwanzigsten Lebensjahr angehöre: Österreich. Mögen sie ihm ein wenig von jener Zuneigung zurückgeben, die ich selber in diesen sechsundfünfzig Jahren in meiner Wahlheimat erfahren habe.
Erlebnisse
Franzl
In den zwanzig Jahren zwischen 1958 und seinem frühen Tod 1978 unternahm ich mit Franz Hrastnik zahlreiche Reisen, von denen der Arbeitswütige stets mit einer Fülle von Ölbildern, Aquarellen und Schwarzweißzeichnungen heimkehrte. Seine nach außen hin sichtbaren Erfolge feierte er zwar als Schriftsteller, doch sein eigentliches, sein spezifisches Talent war das Malen und Zeichnen. In einigen seiner Bücher konnte Hrastnik diese Doppelbegabung geschickt bündeln – etwa in den Satiresammlungen »Filmverdrehbuch« und »Opernkonserve«. Vor allem letztere, eine geglückte Kombination von Karikaturen und Spottversen auf die Klassiker der Opernliteratur, erlebte mehrere Auflagen. Noch heute kann ich einige dieser Gedichte, die bei aller Respektlosigkeit und Drastik doch immer auch Franzls große Liebe zur Gattung Oper verrieten, auswendig aufsagen – etwa den Zweizeiler
Liegt es wirklich am Onassis,daß die Callas jetzt so blaß is?
Unter den Wiener Lokalen, die wir zu jener Zeit nach getaner Arbeit gern aufsuchten, war der Urbani-Keller im I. Bezirk einer unserer Favoriten. Wieder einmal hatten wir uns in dem urigen Lokal nahe der Kirche Am Hof zu einer wein seligen Runde eingefunden; Erlauer Stierblut war die Sorte, der wir besonders zusprachen. Am Nebentisch saßen zwei junge Männer, die sich angeregt miteinander unterhielten; sie waren so laut, daß man sie fast hätte ermahnen müssen, sich zu mäßigen.
Noch schlimmer wurde es, als einer der beiden sich plötzlich anschickte, Gedichte zu deklamieren. Franzl und ich verstanden unser eigenes Wort nicht mehr – so temperamentvoll, ja geradezu bühnenreif legte sich unser Tischnachbar ins Zeug, und sein Gegenüber lauschte andächtig, reagierte mit schrillen Lachsalven, spendete heftigen Applaus. Gerade als Franzl, selber ein Temperamentsbündel sondergleichen, ja der geborene Streithansl, Anstalten traf, dem Lärm ein Ende zu machen und die beiden Burschen zur Ordnung zu rufen, hielt er unvermittelt inne, und sein eben noch zornerfüllter Blick hellte sich schlagartig auf. »Hörst du, was der Kerl da von sich gibt?« fragte er mich und fuhr, ebenso überrascht wie entzückt, fort: »Das ist doch meine ›Opernkonserve‹!«
Franzl riß es vom Sessel, außer sich vor Freude eilte er an den Nebentisch, gab sich dem Rezitator als Autor dessen, was da gerade lautstark den Urbani-Keller erfüllte, zu erkennen und schloß den vermeintlichen Störenfried enthusiastisch in die Arme. Fast noch größer die Freude auf der Gegenseite: »Was – Sie sind der Hrastnik? Ich kann die ganze ›Opernkon-serve‹ auswendig, es ist mein Lieblingsbuch!«
Nun war es an der Zeit, daß sich auch der Rezitator zu erkennen gab: Es war Heinz Holecek, der später berühmte Baßbariton der Wiener Staatsoper, zu dieser Zeit Anfang zwanzig und noch am Beginn seiner Karriere. Zwei leidenschaftliche Opernfans hatten sich in diesem denkwürdigen Augenblick gefunden: der Bühnenprofi und der »Schreibtischtäter«. Heinz Holecek und Franz Hrastnik wurden Freunde fürs Leben.
Unsere gemeinsamen Reisen führten Franzl und mich in viele Länder, mehrere Kontinente. Aber auch innerhalb Österreichs begleitete ich den fünfundzwanzig Jahre Älteren an manche der Orte, an denen er seine Bilder malte. Die Österreichische Fremdenverkehrswerbung hatte ihn gleich nach dem Krieg für eine Plakatserie nach Melk und Hallstatt, nach Graz und Innsbruck, nach Mariazell und Heiligenblut geschickt; nun traf er seine eigene Wahl, nahm auf jeden unserer Ausflüge sein Malzeug mit, kehrte mit reicher Beute heim. Wenn ich heute Bilanz ziehe über meine Ortskenntnisse von meiner Wahlheimat Österreich, denke ich dankbar an jene zwanzig Jahre zurück, da sich mir an Franz Hrastniks Seite die Besonderheiten und Schönheiten dieses Landes erschlossen.
Fast immer ging es dabei abenteuerlich zu: Franzl war ein Bohemien reinsten Wassers, ein »Urviech«, auch im Umgang mit seinen Mitmenschen ein absolut unberechenbares Original. Ich selber, eher von der bedächtigen Art, immer auf Ausgleich bedacht, mußte mich an Franzls »Kontrastprogramm« erst gewöhnen, genoß es dann aber umso mehr, nahm sogar mit der Zeit manche von seinen Unarten selber an – ich denke, es hat mir nicht geschadet.
Was ich nicht von ihm angenommen habe, waren seine Eßsitten. Mit Schrecken erinnere ich mich daran, wie er in den Landgasthöfen, in denen wir während der Malpausen einkehrten, gierig nach der Maggi-Flasche griff, um die auf dem Tisch bereitgestellten Semmeln auseinanderzubrechen und mit der (von mir verabscheuten) Suppenwürze zu tränken – es war seine heißgeliebte »Vorspeise«. Und war die gebakkene Leber, die zu seinen Leibgerichten zählte, gut geraten, bestellte er unverzüglich eine zweite Portion, auch wenn er, mittlerweile längst gesättigt, keinen Bissen davon anrührte. Franzl war maßlos, unbeherrscht, spontan.
Einmal fuhren wir nach Krems. Es war kurz vor der Zeit, da die berühmte Minoritenkirche im Ortsteil Stein »verweltlicht« und in ein Ausstellungszentrum umgewandelt wurde. Wir wollten das spätromanische Architekturjuwel besichtigen, näherten uns dem eindrucksvollen Bau, die Kirchentür stand weit offen. Wie oftmals auf unseren Ausflugsfahrten, hatte Franzl auch diesmal seinen Dackel mitgebracht. Er liebte den Hund abgöttisch, verwöhnte Waldi nach Strich und Faden, duldete nicht den geringsten Angriff auf das verzogene Tier. Gasthäuser oder Geschäfte, die keine Hunde zuließen, wurden von ihm gemieden, Passanten, die sich an Waldis Gebell stießen, zur Rede gestellt, Ordnungshüter, die Beißkorb und Leine reklamierten, verscheucht.
Hier aber, am Portal der Minoritenkirche zu Stein, stieß der in der Durchsetzung »seiner« Hunderechte sonst so erfolgreiche Franzl zum ersten Mal an seine Grenzen: Der Mesner wies ihn brüsk ab, bestand (selbstverständlich) darauf, daß Waldi draußenblieb. Mein Vorschlag, die Besichtigung der Kirche einzeln vorzunehmen, wurde von Franzl abgeschmettert, und so machte ich mich nolens volens ohne ihn auf den Weg. »Geh nur!« sagte er schnippisch, und es war ihm anzumerken, daß er in meinem Alleingang ein Zeichen von Charakterschwäche, wenn nicht Treuebruch sah.
Als ich eine Viertelstunde später zurückkehrte, fand ich den eben noch wutschnaubenden Franzl in Hochstimmung vor. Er saß auf einer der steinernen Stufen vorm Portal, an seiner Seite Waldi, beide glückselig. Und er berichtete, was während meiner Abwesenheit geschehen war: Eine Kirchgängerin, vom Anblick des Idylls gerührt, hatte Franzl für einen Bettler gehalten und Herrl und Hund ein Trinkgeld zugesteckt. Daß er die 5 Schilling widerspruchslos, ja dankbar einsteckte, war in seinen Augen der gerechte Ausgleich für die vorangegangene »Brüskierung« durch den hundefeindlichen Mesner. Ja, so war er, der Franzl.
Sommer 1966, Franzl und ich waren nach Salzburg gereist. Ich schrieb für »meine« deutschen Zeitungen und Rundfunkstationen Festspielberichte, er malte. Es war nicht das erste Mal, daß wir zu dieser Art von Kooperation die Salzachstadt aufgesucht hatten. Aber diesmal hatte Franzl, der schon wiederholt Szenerie und Betrieb der Festspielstadt in Zeichnungen und Aquarellen eingefangen hatte, eine ganz besondere Mission: Er wollte das nächtliche, nur von der aktuellen Festspielbeleuchtung erhellte Salzburg im Bild festhalten.
Alles war für das große Werk vorbereitet: die 90 mal 60 Zentimeter große Leinwand, die Pinsel, die Ölfarben. Besonders für die zu erwartenden dunklen Töne war großzügig vorgesorgt: viel Tiefblau, viel Schwarz. Auch die für ihn günstigste Perspektive hatte er rasch gefunden: Franzl würde seine Staffelei am Elisabethkai aufstellen, dicht am rechten Salzachufer, unmittelbar hinter dem Café Bazar.
Sofort nach Eintritt der Dämmerung machte sich der Künstler ans Werk. Daß er an dieser exponierten Stelle nicht störungsfrei würde arbeiten können, nahm er in Kauf: Noch war die Stadt voll von Festspielbesuchern und Touristen, im und um das »Bazar« herrschte reger Betrieb. Das größere Problem, das es zu bewältigen galt, war die Zeiteinteilung: Franzl mußte unter allen Umständen noch in dieser Nacht mit seinem Bild fertigwerden. Er wollte es unbedingt in einem Zug malen, am folgenden Abend würde die Stimmung mit großer Wahrscheinlichkeit eine andere sein, Lichteinfall und Farbenspiel von denen des Vortags abweichen. Außerdem mußte er am nächsten Morgen die Rückreise nach Wien antreten, wo ein unaufschiebbarer Termin auf ihn wartete.
Franzl legte sich also mächtig ins Zeug. Die Umrisse waren rasch skizziert, bald konnten die ersten Farben aufgetragen werden. Fluß und Ufer nahmen Gestalt an, desgleichen die Bauten: Kollegienkirche und Spital der Barmherzigen Brüder, Rathaus und Dom, im Bildhintergrund die Feste Hohensalzburg und über allem der tiefschwarze Nachthimmel.
Meine Aufgabe bestand darin, Franzl während seiner Arbeit mit Kaffee und Tabak zu versorgen; der freundliche Kellner des »Bazar« stellte neben der Staffelei einen kleinen Tisch auf, servierte liebevoll das Gewünschte. Als das Bild etwa zur Hälfte fertig war, blickte ich auf die Uhr: Die Zeit würde verdammt knapp werden. Franzl sollte von der in mir aufkommenden Nervosität nichts bemerken, jedes noch so sanfte Drängen würde ihn nur aus dem Konzept bringen. Diskret erkundigte ich mich beim Kellner, wie lange die Festbeleuchtung der Stadt, die ein unverzichtbarer Bestandteil von Franzls Bildmotiv war, eingeschaltet bleiben würde. Ich erschrak: nur bis punkt Mitternacht, keine Minute länger. Würde es Franzl bis dahin schaffen?
»Salzburg bei Nacht« –ein beherzter Kaffeehauskellner greift ein …
Die Uhr schlug elf – es blieb also nur noch eine Stunde Zeit, und noch fehlten die Kaimauer, das Ufergebüsch, der Turm der Franziskanerkirche. Ausgeschlossen, daß Franzl bis Mitternacht mit seiner Arbeit fertigwerden würde; mindestens eine weitere Stunde wäre vonnöten, um »Salzburg bei Nacht« zu vollenden.
Ich teilte dem Kellner des »Bazar«, der bereits seine letzten Gäste verabschiedete, die Tische abräumte und zur Tagesabrechnung schritt, meine Besorgnis mit. Anders als »normale« Kellner, denen die Sperrstunde heilig ist, die auf oftmals barsche Weise späte Gäste abwimmeln oder einfach brüsk das Licht abdrehen, schien dieser (an dessen Namen ich mich heute leider nicht mehr erinnere) für die Nöte des vor seinen Augen wild drauflos Pinselnden Verständnis, ja mit dessen Zwangslage geradezu Mitleid zu haben, und so ereignete sich etwas, das sich wohl noch nie im österreichischen Kunstbetrieb ereignet hat: Der Ober griff zum Telefon, rief die Salzburger Stadtwerke an, ließ sich mit dem diensthabenden, für die Festbeleuchtung zuständigen Ingenieur verbinden, schilderte ihm Franzls verzweifelte Situation und – fand mit seiner verwegenen Bitte, in dieser Nacht die Lichter ausnahmsweise um eine Stunde später abzudrehen, tatsächlich Gehör. Dank des beherzten Eingreifens eines kunstsinnigen Kaffeehauskellners und der spontanen Einsicht einer gutwilligen, unbürokratischen Behörde konnte Franz Hrastnik in aller Ruhe sein »Salzburg bei Nacht« fertigstellen – und das, ohne daß es auch nur mit einem Schilling sein Budget belastet hätte. Der Herr Ober weigerte sich standhaft, das ihm gebührende Extratrinkgeld anzunehmen, und auch die Salzburger Stadtwerke schickten dem am nächsten Morgen Abreisenden keine Stromrechnung hinterher (die er sowieso niemals hätte begleichen können). Eine Festspielstadt, die wahrlich ihres Namens würdig war!
Keine Rückkehr nach Wagrain
Eigentlich waren Hermann Hesse und Thomas Wolfe meine literarischen Hausgötter zu jener Zeit; über Stefan Zweigs Novelle »Die Augen des ewigen Bruders« hatte ich im Jahr davor meine Abiturarbeit geschrieben. Zweibrücken, wo die Familie damals lebte, gehörte zur Französischen Zone Deutschlands. Wir hatten also in den Schulen das französische Benotungssystem. Ich bekam achtzehn Punkte für meinen Aufsatz, die Höchstnote zwanzig wurde so gut wie nie vergeben.
Wie es dazu kam, daß ich damals – ich war gerade neunzehn geworden – auch Waggerl las, kann ich mir heute nur schwer erklären. Ich hatte keinerlei Beziehung zur sogenannten Heimatliteratur, las weder Rosegger noch Gotthelf oder Löns; Genres wie Naturlyrik oder gar Kalendergeschichten strafte ich mit jugendlicher Verachtung.
Es muß mit meiner ersten Österreichreise zusammengehängt haben. Ich hatte kurz vor Beginn meines Universitätsstudiums eines der gerade in den Handel gekommenen Mopeds erworben und war damit aus der Saarpfalz in Richtung Salzburg aufgebrochen. In den dortigen Buchhandlungen stieß ich zum ersten Mal auf den Namen Karl Heinrich Waggerl, sah auf den Ladentischen große Stapel des »Wiesenbuchs«, des »Heiteren Herbariums«, des »Wagrainer Tagebuchs«. Von jedem der Titel, darunter auch die Romane »Das Jahr des Herrn« und »Brot«, waren einige Exemplare bereits vom Autor vorsigniert, und als ich auf der Weiterfahrt nach Bischofshofen erfuhr, daß Waggerl keine 20 Kilometer von dort entfernt lebte, entschloß ich mich kurzerhand zu einem Abstecher nach Wagrain, um dem mir bis dato fremden Dichter meine Aufwartung zu machen und ihm die in aller Eile erworbenen Bücher zum Signieren vorzulegen.
Waggerls Wohnort Wagrain gefiel mir, mühelos fand ich das stattliche Haus mit dem in voller Blüte stehenden Vorgärtchen, klopfte an die Tür, eine freundliche Frau um die fünfzig ließ mich ein. Edith Waggerl, im Dorf allgemein Dita gerufen, erklärte bedauernd, ihr Mann sei momentan verreist – Karl Heinrich Waggerl, damals fünfundfünfzig Jahre alt, nutzte jede freie Minute, um mit seinen Lesern zusammenzutreffen, unternahm Vortragsfahrten und Signierstunden, häufig in Begleitung von Musikern, die sein Programm mit ländlichen Weisen umrahmten.
Edith Waggerl lud mich ein, in der sogenannten »Stube« Platz zu nehmen, zeigte mir das Arbeitszimmer des Dichters, etliche seiner Kunstgegenstände, die Kammer, in der er seinen handwerklichen Hobbys des Zeichnens und Buchbindens nachging, und als sie meine Enttäuschung darüber wahrnahm, ihn nicht persönlich angetroffen zu haben, lud sie mich ein, die mitgebrachten Bücher dazulassen, ihr Mann werde sie nach seiner Rückkehr verläßlich signieren und mir nach Deutschland nachsenden, ich möge nur meine Adresse hinterlassen.
Wenige Wochen später traf in Münster, wo ich inzwischen mein Hochschulstudium aufgenommen hatte, Post aus Österreich ein. Es war ein dickes Päckchen, alle fünf Bücher nicht nur mit »Karl Heinrich Waggerl«, sondern auch mit »Dietmar Grieser« signiert – die einen mit »herzlichen Grüßen«, die anderen »zur freundlichen Erinnerung«. Erst jetzt wurde mir klar, welche Last ich in meiner Unbedarftheit dem Dichter zugemutet hatte – nämlich ein Päckchen zu schnüren, es zur Post zu bringen und es auf seine Kosten zu frankieren.
Tief beschämt setzte ich einen Dankbrief auf; Waggerl, damals auf der Höhe seines Ruhms, hatte in mir allein durch seine Liebenswürdigkeit einen weiteren Fan gewonnen.
Es kam die Zeit, wo ich ihn aus den Augen verlor, ich las nunmehr andere Autoren, gewichtigere, schwierigere, und als ich vier Jahre später von Deutschland nach Österreich übersiedelte, war meine Waggerl-Phase nur mehr eine blasse Erinnerung. Nun seiner Heimatregion Salzburg um vieles näher, entging mir außerdem nicht, wie sehr der Dichter der »Fröhlichen Armut« in der Zwischenzeit zum lautstark propagierten Markenartikel geworden war; auch der Widerspruch zwischen der in seinen Büchern vorgelebten eremitenhaften Genügsamkeit und der schrillen Betriebsamkeit seiner Massenauftritte mit Adventsprogrammen wie »Und es begab sich …« oder »Die stillste Zeit im Jahr« entfremdete mich seiner Kunst.
Karl Heinrich Waggerl erfüllt Signierwünsche
Karl Heinrich Waggerl trat erst wieder in mein Leben, als er tot war. Am 4. November 1973 war er – fünf Wochen vor seinem 76. Geburtstag – im Krankenhaus der Pongauer Marktgemeinde Schwarzach, nur wenige Kilometer von seinem geliebten Wagrain entfernt, verstorben; im Waggerl-Haus, das noch zu seinen Lebzeiten eine vielbesuchte Pilgerstätte geworden war, kehrte Stille ein, Witwe Edith wachte bis zu ihrem eigenen Ableben im November 1990 über den schönen Besitz.
Waggerls Todesjahr 1973 fiel mit einem Datum zusammen, das für meine eigene berufliche Entwicklung von größter Tragweite war: Der S. Fischer Verlag in Frankfurt am Main brachte mein erstes eigenes Buch heraus: »Vom Schloß Gripsholm zum River Kwai«. Es folgten Titel wie »Schauplätze der Weltliteratur«, »Piroschka, Sorbas und Co.« und »Irdische Götter«. 1981 fand ich ein weiteres, ein neues Thema, das mich faszinierte: Wie wär’s, wenn ich versuchte, mit den Witwen der berühmten Dichter in Kontakt zu treten, sie an ihren Lebensorten aufzusuchen, zum Sprechen zu bringen und zu porträtieren? Nicht, daß sie, die Erbinnen und Nachlaßverwalterinnen ihrer Gefährten, immer auch deren berufenste Interpreten sein müßten. Aber ihr Erfahrungspotential aus einem in vielen Fällen langen Leben an der Seite des betreffenden Dichters – dies einzufangen und festzuhalten, könnte, so fand ich, eine lohnende Aufgabe sein. Unter welchen Freuden und Schmerzen die Arbeiten ihrer Männer entstanden waren, niemand vermöchte besser und authentischer davon Zeugnis abzulegen als sie: Es waren auch ihre Freuden und Schmerzen. »Musen leben länger« nannte ich mein Projekt. Postskripta zur Biographie der Literaten.
Die Arbeit lief gut an, ich traf mich mit Mary Tucholsky und Ilse Benn, Alessandra di Lampedusa empfing mich in ihrem Palast in Palermo, Alice Herdan-Zuckmayer in ihrem Chalet in Saas-Fee, Anna Ditzen-Fallada stand mir in ihrem DDR-Retiro im Mecklenburgischen Rede und Antwort, Erich Kästners Lebensgefährtin Luiselotte Enderle in der Kästner-Villa in München-Bogenhausen. Für die Österreich-Kapitel meines Buches stellten sich mir Maria von Doderer, Giselle Celan und Marietta Torberg zur Verfügung – da wäre, stellvertretend für die Sparte Heimatkunst, die seit acht Jahren verwitwete Edith Waggerl eine vortreffliche Ergänzung gewesen.
Ich fragte also brieflich bei ihr an, schlug ihr ein Treffen in Wagrain vor, wo sie und ihr Mann dreiundfünfzig Jahre miteinander unter einem Dach gelebt hatten. Ich machte mir allerdings wenig Hoffnung auf eine Zusage. Drei Gründe sprachen dagegen, daß mich Edith Waggerl zu einem Gespräch vorlassen würde. Da war zunächst einmal das Gerücht, das sich noch zu des Autors Lebzeiten in Österreich verbreitet hatte: Waggerl habe über viele Jahre eine enge Beziehung zu einer anderen Frau unterhalten, seine Ehe habe zuletzt nur noch auf dem Papier bestanden. Dann die ebenfalls nicht zum Verstummen zu bringenden Berichte über Waggerls Unfalltod: Sie, Gattin Edith, sei es gewesen, die an jenem Novembertag des Jahres 1973 das Unglücksauto gelenkt und somit mit großer Wahrscheinlichkeit das Ableben ihres Mannes verursacht habe. Und schließlich die Sache mit seiner politischen Vergangenheit …
Im Zuge der durch die sogenannte Waldheim-Debatte in Gang gesetzten Aufarbeitung des österreichischen NS-»Erbes« war ans Tageslicht gekommen, daß der am 10. Dezember 1897 in Bad Gastein Geborene stärker als zunächst angenommen ins Hitler-System verstrickt gewesen war. Zwischen 1912 und 1915 in Salzburg zum Lehrer ausgebildet, mit achtzehn zum Kriegsdienst einberufen, nach seiner Entlassung aus der Gefangenschaft zur Behandlung in die Lungenheilstätte Grafenhof (in der Jahrzehnte später auch Thomas Bernhard Patient war) eingeliefert, konnte Waggerl seinen Schuldienst nur eingeschränkt ausüben, mußte ihn 1922 sogar gänzlich einstellen und brachte sich und die ihm inzwischen angetraute Edith mit allerlei Gelegenheitsarbeiten durch – als Buchbinder, Versicherungsagent, Reklamezeichner, Werbetexter und Bauarbeiter.
Sein schriftstellerisches Debüt fiel in das Jahr 1928; dem Abdruck einer seiner Erzählungen in der Münchner Zeitschrift »Jugend« folgte 1930 die Veröffentlichung des ersten Buches im renommierten Insel-Verlag – es war der Roman »Brot«.
Neue Hoffnung für sein literarisches Fortkommen schöpfte der inzwischen Einundvierzigjährige aus der Zuwendung zum von Deutschland nach Österreich überschwappenden Nationalsozialismus: Er begrüßte den »Anschluß«, trat der Partei bei, ließ sich zum »Landesobmann der Schriftsteller im NS-Gau Salzburg« nominieren und übte nach Kriegsbeginn für die Dauer von acht Monaten sogar das Amt des Bürgermeisters aus. Was man Waggerl später ebenfalls vorhielt, war sein Naheverhältnis zu dem Schriftstellerkollegen Karl Springenschmid, der für die Salzburger Bücherverbrennung vom 30. April 1938 verantwortlich gewesen war.
Es brauchte allerdings lange Zeit, bis Karl Heinrich Waggerls Verstrickungen ins NS-Regime zum Gegenstand öffentlicher Diskussionen wurden. 1945 aus dem Kriegsdienst zurückkehrend, den er zuletzt als Kommandeur einer Dolmetscherkompanie absolviert hatte, ging Waggerl nunmehr ganz in seinem Metier als Buchautor, Funk- und Filmmitarbeiter und Rezitator auf; auch Auszeichnungen wie der Trakl-Preis und der Österreichische Staatspreis trugen zur Festigung seines Erfolges bei, der ihn weit über seinen Tod im Jahr 1973 hinaus zu einem der populärsten und bestverdienenden Schriftsteller des Landes machte. Nicht nur die Fülle seiner neuen beziehungsweise frisch aufgelegten alten Bücher, sondern auch seine umfangreiche Vortragstätigkeit, die es ihm leicht machte, sogar Massenveranstaltungssäle wie die Wiener Stadthalle bis auf den letzten Platz zu füllen, waren der Schutzschirm, der Waggerls braune Vergangenheit bis weit über die unmittelbare Nachkriegszeit hinaus zudeckte.
1986, dreizehn Jahre nach Waggerls Tod, brach die Waldheim-Krise aus: Der ehemalige UNO-Generalsekretär war zum Bundespräsidenten der Republik Österreich gewählt worden. Einem Flächenbrand gleich wurden nun auch andere NS-Belastete in die lautstark geführte Diskussion um Österreichs Anteil am Hitler-Terror einbezogen, darunter Waggerl.
Auch für Witwe Edith, die seine Erbin und Nachlaßverwalterin war, brach damit eine neue Zeit an – und keine leichte. Es war also abzusehen, daß ich mit meinem Wunsch, von der inzwischen Hochbetagten in Wagrain empfangen zu werden, mit ihr ins Gespräch zu kommen und sie in meinem Buch »Musen leben länger« zu porträtieren, wenig Glück haben würde. Und so war es denn auch: Edith antwortete mir auf meinen Brief – freundlich ablehnend. Betrogene Ehefrau, mutmaßliche Verkehrsunfallverursacherin und Nachlaßverwalterin eines politisch Verfemten – keine günstigen Voraussetzungen für ein Künstlerwitweninterview, wie ich es im Sinn gehabt hatte. Den Plan einer zweiten Reise nach Wagrain (wo das 1776 erbaute Waggerl-Haus 1975 in den Besitz der Gemeinde übergegangen war und heute, die dunklen Seiten der Dichterbiographie durchaus nicht ausblendend, als Waggerl-Museum geführt wird) konnte ich mir aus dem Kopf schlagen. Für mein Projekt »Musen leben länger« mußte ich mich jedenfalls nach einer anderen Kandidatin umsehen.
Ein dunkler Punkt
Zell am See kann nichts dafür, daß ich es so konsequent meide, als wäre die Perle des Pinzgaus in Wahrheit ein verruchter Ort, abscheulich, ungastlich, ein Hort des Bösen. Nur ein einziges Mal bin ich dort gewesen, und auch das nur für wenige Stunden: Es war eine Einladung zu einer Schullesung am örtlichen Gymnasium, und da es sich um eine dichtgedrängte Vortragsreise handelte, bei der ein Termin auf den anderen folgte, fuhr ich noch am selben Tag weiter zur nächsten Station. Die Möglichkeit, der berühmten Pfeilerbasilika einen Besuch abzustatten, im Zeller See ein Bad zu nehmen oder gar mit der Seilschwebebahn auf die Schmittenhöhe zu fahren, ließ ich ungenützt – nichts wie weg!
Auch in späteren Jahren hielt ich mich von Zell am See fern: Der von Sommerfrischlern wie Wintersportlern gleichermaßen gepriesene Ort zwischen Salzburg und Innsbruck übte auf mich keinerlei Reiz aus, und auch im fortgeschrittenen Alter, wo sich manche noch so festsitzenden Abneigungen zu lockern oder aufzulösen pflegen, hielt ich an meinem Vorurteil fest.
Erna Dworschak, die mit mir befreundete Seniorchefin des seinerzeit führenden Wiener Energiekonzerns »Kraft und Wärme«, lud mich Jahr für Jahr zu einem Besuch an ihrem Witwensitz ein; die Dworschaks hatten in Zell am See ein prachtvolles Anwesen, das mit allen erdenklichen Freizeitattraktionen lockte. Doch ich lehnte regelmäßig ab; immer wieder flüchtete ich mich in neue Ausreden, es war schon eine einzige Peinlichkeit, und als die alte Dame schließlich eines Tages starb, war ich bei aller Trauer um die Hochverehrte froh, fortan von dem Druck befreit zu sein, mein Versprechen einlösen und ihr in ihrem geliebten Sommerquartier meine Aufwartung machen zu müssen.
Den Gründen für meine manifeste, für jeden Kenner von Land und Leuten unverständliche Zell-Phobie nachzuforschen, wäre eine lohnende Aufgabe für einen Tiefenpsychologen – ich will versuchen, das Phänomen mit meinen eigenen Worten zu erhellen. Die Sache ging auf ein Kriegsereignis zurück oder genauer: auf ein Ereignis während der Kriegszeit. Meine Familie lebte damals im oberschlesischen Leobschütz, einer Kleinstadt nahe Ratibor und Troppau. Mein Vater, gebürtiger Saarpfälzer mit Tiroler Wurzeln, war 1936 mit Frau und Kindern in die Heimat meiner Mutter übersiedelt, die in Leobschütz das seit dem Tod ihres Vaters halb leerstehende Elternhaus geerbt hatte.
Ich war damals zwei Jahre alt, meine beiden Brüder vier beziehungsweise sechs. Zwei Gründe waren dafür ausschlaggebend, daß ich, der Jüngste, dem Haushalt meiner Großmutter zugeteilt wurde. Zum einen wurde es durch die drei Kinder in der im Obergeschoß gelegenen Wohnung meiner Eltern eng, umgekehrt war meine im Parterre lebende frischverwitwete Großmutter lebhaft daran interessiert, ihre nunmehrige Einsamkeit mit einem kleinen Hausgenossen zu teilen. Die Wahl fiel auf mich: Ich als der Jüngste wurde für die folgenden Jahre an Großmutter Anna »abgetreten«.
Die Lösung schien für alle Beteiligten ideal. Meine Mutter, auch durch das anhaltende Nervenleiden meines Vaters übermäßig in Anspruch genommen, war über jede noch so geringe Entlastung ihres Haushalts froh; zugleich blieb meiner erst zweiundsechzig Jahre alten Großmutter das Alleinsein erspart.
Auch für mich hatte die »Teilung« der Familie durchaus Vorteile: Während im elterlichen Haushalt schon bald die Einschränkungen der Vorkriegszeit zu spüren waren und das Essen knapp wurde, war Großmutters Speisekammer mit nahrhaften Vorräten gefüllt, die noch bis in die Kriegsjahre hinein vorhielten. Es ging mir also – objektiv betrachtet – besser als meinen Brüdern, die mir denn auch meinen Sonderstatus unverhohlen neideten und mich als »Nanna-Kindl« verhöhnten. Sie taten dies umso mehr, als Großmutter Anna, eine zu Strenge, ja Herrschsucht neigende Frau, sich im Umgang mit uns Buben einer Art Zweiklassenjustiz befleißigte: Die anderen zwei, zugegebenermaßen »schlimmer« als ich, waren in ihren Augen die Bösen, ich, von Natur aus unterwürfiger, der Gute.
Es kam der Krieg, die Einschränkungen – Stichwort Lebensmittelkarte – nahmen weiter zu. Auch die Bewegungsfreiheit ließ nach, ein Tagesausflug nach Jägerndorf, das heute tschechische Krnov, war schon das Höchste an Reiseabenteuer. Nur ein einziges Mal – es war im Sommer 1941 – gelang es meinem Vater, für seine Familie etwas »Größeres« zu organisieren und einen Reisegutschein der NS-Freizeitorganisation »Kraft durch Freude« zu ergattern. Das begehrte Papier beinhaltete die Bahnfahrt 2. Klasse zum begünstigten Familientarif, dazu ein hübsches Quartier für zwei Wochen am Zielort. Ob für letzteren mehrere Varianten zur Wahl standen, weiß ich heute, zweiundsiebzig Jahre danach, nicht mehr. Nur eines weiß ich: Es war ein Urlaubsort in Österreich, das seit dem »Anschluß« Ostmark hieß. Sein Name: Zell am See.
Das schöne Zell am See kann nichts dafür …
Die Eltern trafen die nötigen Vorbereitungen, Landkarten wurden studiert, Koffer gepackt, für jeden der Buben ein Rucksack bereitgelegt. Auch Großmutter Anna beteiligte sich an den Aktivitäten: Sie, eine Köchin von hohen Gnaden, war für die Zubereitung des Reiseproviants zuständig.
Schon da hätte mir auffallen müssen, daß es nicht drei, sondern nur zwei Butterbrotdosen und auch nicht drei, sondern nur zwei Thermosflaschen waren, die mit Schinkensemmeln beziehungsweise Limonade gefüllt wurden. Und erst recht hätte mich das betretene Schweigen meiner Eltern stutzig machen müssen, mit dem sie allen meinen Fragen nach Details der bevorstehenden Reise auszuweichen versuchten.
Die schreckliche Wahrheit erfuhr ich erst wenige Tage vor der Abreise: Großmutter Anna, um die Sicherheit ihres Schützlings besorgt, hatte über den Kopf meiner Eltern hinweg entschieden, daß ich, der ihr anvertraute jüngste von uns drei Buben, von dem Abenteuer ausgeschlossen bleiben sollte. Ich mit meinen damals sieben Jahren sei dafür noch zu klein, bedürfe äußerster Schonung, würde von dem Zusammensein mit meinen »wilden« Geschwistern bleibenden Schaden davontragen, müsse unter allen Umständen daheimbleiben.