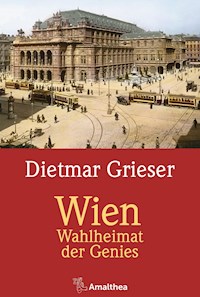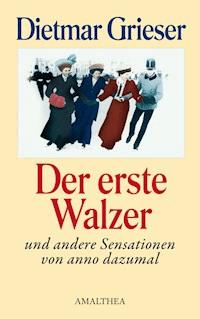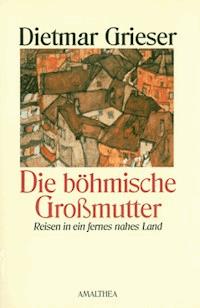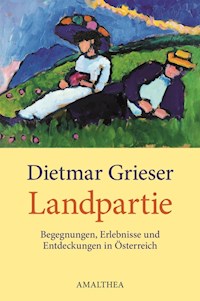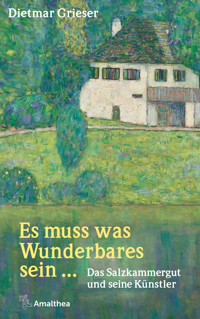Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Beste aus 30 Jahren vom »begnadeten Erzähler vieler köstlicher Geschichten" (Frankfurter Allgemeine Zeitung) Unternehmen Sie mit Literaturdetektiv Dietmar Grieser einen Spaziergang durch die Kulturgeschichte, durch sein eindrucksvolles literarisches Gesamtwerk. Erinnern Sie sich an Bucherfolge wie »Schauplätze der Weltliteratur", »Wien – Wahlheimat der Genies" und »Kein Bett wie jedes andere" – bis hin zu seinem Bestseller »Die böhmische Großmutter". Dieses Lesebuch bietet gleichermaßen nostalgisches Wiederlesen wie beglückendes Neuentdecken. Das besondere Geschenk für alle, die Dietmar Griesers Werke in einer kompakten Auswahl kennen lernen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietmar Grieserfür Kenner
Das Lesebuch
Besuchen Sie uns im Internet unter amalthea.at
© 2006 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Kurt Hamtil, verlagsbüro wien
Umschlagmotiv: »La Liseuse« von
Pierre-Auguste Renoir, 1874–1876
Herstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 10,5/14 Punkt New Caledonia
Druck und Binden: Ueberreuter Buchproduktion, Korneuburg
Printed in Austria
ISBN 978-3-85002-558-4
eISBN 978-3-903083-97-4
Meinen treuen Lesern –herzlichst
Inhalt
Der Siebenschläfer
Vorwort von Günther Nenning
Dietmar Grieser auf den Spuren bekannter Romanfiguren
Im Haus des kleinen Prinzen
James Bond jagt nicht nur Verbrecher, sondern auch Kolibris
Dietmar Grieser auf den Spuren österreichischer Musikgenies
Die Marseillaise von Ruppersthal
Der Ölberg von Hohenseibersdorf
»Aufhören, das ist ja furchtbar!«
Dietmar Grieser auf den Spuren bewegender Schicksale
Eine Liebe in Wien
»Unsereins hat nur ein Eckchen in der Welt …«
Dietmar Grieser auf Österreichs Spuren in der Welt
Vogelstimmen – vom Blatt
Vom Ladenschwengel zum Meisterregisseur
Austerlitz alias Astaire
»Kinder, ihr müßt in die Welt hinaus!«
Dietmar Grieser auf den Spuren später Lieben
»Keine Liebschaft war es nicht …«
»Auf Händen müßt ihr ihn tragen!«
»Für dich erblühend in Wonne …«
»Ein wunderbares Wesen …«
Je ne regrette rien
Dietmar Grieser auf den Spuren der österreichischen Geschichte
»Es ist gern geschehn …«
Auf stillen Praterpfaden
Fensterplatz
Ein tolles Weib
Ein Bettgeher namens Josip Broz
Der Sieben-Tage-Bürgermeister
Dietmar Grieser auf den Spuren großer Denker und Dichter
Madame Benvenistis milde Gabe
Ausgebootet
Wie nenne ich meine Katze?
Dr. Dolittle und der Erste Weltkrieg
Dietmar Grieser auf den Spuren österreichischer Erfindungen
»Mit den Fingern, Majestät!«
Mit den Waffen einer Frau
Dietmar Grieser auf den Spuren berühmter literarischer Schauplätze
Jedem sein Rosenhaus
Der desinfizierte Zauberberg
Dichters Dienstmann
Dietmar Grieser auf den Spuren berühmter Erben
Die gleichsam geronnene Zeit
Mehr Herdan oder mehr Zuckmayer?
Wiedergeburt einer Göttin
»OK, das stimmt doch gar nicht!«
Dietmar Grieser auf den Spuren seiner Leser
Tatort Buchhandlung
Tatort Vortragssaal
Der Siebenschläfer
Vorwort von Günther Nenning
Ich fahre zeitig auf Urlaub. Vorsaison, billiger, und ich möchte dem Fremdenverkehr entgehen. Natürlich ist das vergeblich. Was macht man in so einem Fall? Ich bin ein moderner Mensch, ich frage einen Experten.
Dietmar Grieser ist ein hochrangiger Experte für bzw. gegen Fremdenverkehr, hochrangiger Autor vieler guter Bücher über das, was er »Literaturtourismus« nennt: Man soll das Land, die Leute, die Geschichte kennen – und nicht auf die »Touristiker« hereinfallen.
Grieser ist ein Mann, den zu loben sich lohnt. Jede noch so schöne – oder schön gewesene – Gegend wird gräulich fremdenverkehrt. Ist das unsere Zukunft? Gibt es nur noch Bücher, in denen das Land und die Leute, die Geschichte und die Gegenwart vierfärbig vertouristelt wird? Nein, es gibt Dietmar Grieser.
Es gibt ihn und möge es ihn noch lange geben und mögen noch recht viele Griesers nachwachsen. Das wünsch ich mir und uns allen tourismusgeschädigten Europäern. Wie kommen wir denn dazu? Alles, was recht ist! Aber zuviel ist zuviel!
Grieser ist das hochwirksame Gegengift gegen die Fremdenverkehrsvergiftung. Ich feiere ihn ganz rücksichtslos – weil der Aufstand gegen die Verhäßlichung unserer europäischen, alpinen, heimischen Schönheiten nötig ist. Fremdenfeindlichkeit ist streng verboten, Fremdenverkehrsfeindlichkeit ist erlaubt.
Grieser ist kein vermummtes Widerstands-Dummi. Er ist offen für das Reisen, aber mit Hirn und Herz, und macht daraus Best- und Longseller. »Wien – Wahlheimat der Genies«. »Stifters Rosenhaus und Kafkas Schloß«. »Alle Wege führen nach Wien«. »Schauplätze der Literatur«.
Alles amüsant zu lesen, gepflegte Sprache, unheimliche Orts-, Geschichts- und Literaturkenntnis. Worüber Grieser schreibt, dort möchte man gern hinfahren. Er ist ein bekennender Antitourismuswolf im Literaturtourismusschafspelz. Derselbe, der einem so Lust macht aufs Herumreisen, derselbe antwortet auf die Interview-Frage »Wie lautet Ihr Lebensmotto?« verschmitzt mit Pascal, dem großen alten Querdenker:
»Der Welt bliebe unendlich viel Unglück erspart, wenn alle Menschen auf ihren Zimmern blieben.« – Darauf besteht keine Aussicht. Wenn sie aber, diese Eichhörnchen in der Mobilitätstrommel, in ihren Zimmern Grieser lesen und dann erst losreisen, wohlunterrichtet und wohlunterhalten – dann sind sie schutzgeimpft gegen Verblödung durch Tourismus.
»In welcher Zeit hätten Sie gern gelebt?« – Grieser: »Bin mit heute ganz zufrieden.« – Der Hannoveraner, ja, unglaublich, von dort ist er gebürtig (1934), aber wenigstens hat er Tiroler Vorfahren; der geständige Hannoveraner also hat sehr gut wienerisch gelernt. Denn »ich bin ganz zufrieden« – heißt auf wienerisch ja überhaupt nicht »ganz, gänzlich, zur Gänze«. Im Gegenteil, es schwingt die Sehnsucht mit, die vernünftige, moderate Sehnsucht nach nur noch viel mehr Zufriedenheit.
No ja, schlecht geht’s ihm ja nicht, dem großen Erfolgsautor. Er ist gesund. Frage: »Ihr liebster Sport?« – Antwort: »Sport – was ist das?« Er hat seine Lieblingsplätze: »Im Frühjahr in Wien, im Sommer auf Madeira, im Herbst in Muskat, im Winter in Südtirol.« – Wo Muskat ist, weiß ich nicht. Ich halte es für eine Nuß. Aber er wird sicher ein schönes Buch darüber schreiben.
Natürlich ist er Professor h. c. Natürlich macht er Fernsehserien. Natürlich ist er Mitglied des PEN-Clubs und Inhaber fast aller Preise. Natürlich zählt das nicht soviel. Es zählt vielmehr: seine unerschöpfliche Neugier; seine Lust, am Großen das Kleine, Geheime aufzuspüren, weil es das eigentlich Wichtige ist; seine Rastlosigkeit, gepaart mit Gelassenheit.
Im Interview antwortet Grieser auf die Frage »Welches Tier wären Sie gerne?« – »Siebenschläfer«. Siehe, der rastlos schreibende Reisende hielte gern sieben Monate Winterschlaf jährlich. Der Siebenschläfer hat große Augen, mit denen er in den restlichen fünf Monaten des Jahres die Welt genau besieht.
Wien, im März 2006
Dietmar Grieser auf den Spuren bekannter Romanfiguren
Im Haus des kleinen Prinzen
Nicht, »daß es uns schützt und wärmt«, macht das Wunderbare eines Hauses aus. Auch nicht der »Stolz des Besitzes«. Sondern, »daß es tief im Herzen jene dunkle Masse sammelt, aus der wie Quellen die Träume entspringen«.
Kein Haus ist dieser Idealvorstellung, die Antoine de Saint-Exupéry in seinem Buch »Wind, Sand und Sterne« formuliert hat, so nahe gekommen wie jener weltentrückte Landsitz an der äußersten Südspitze der Halbinsel Eaton’s Neck, wo er im Herbst des Exiljahres 1942 sein Weltraummärchen vom »Kleinen Prinzen« geträumt und geschrieben und gezeichnet hat. »Es war der beste Schreibplatz meines Lebens«, hat er wenig später selber bestätigt, »der vollkommene Zufluchtsort.« André Maurois, der Freund und Kollege, der wiederholt in Bevin House zu Gast gewesen ist, hat sich über den Riesenbesitz am Meer, versteckt in Wald und Schilf, nicht genug wundern können: »Es war, als brauchte er leere Zimmer für seine Phantome.«
Noch heute, wo die Räume inzwischen von Kindergeplärr erfüllt sind und vom Stimmengewirr eines vielköpfigen griechisch-amerikanischen Familienclans, wirkt das Haus unterbelegt. Damals, zu Saint-Exupérys Zeiten, war man zu zweit: der Dichter und Consuelo, seine Frau. Abgeschirmt von jeglicher Nachbarschaft; nur sein Verleger, einige wenige gute Freunde und das War Department in Washington kannten die Adresse. Und für den Fall, daß sich doch einmal ein telephonischer Zudringling zu Wort melden sollte, hatte der Hausherr (der, »um sein Französisch nicht zu versauen«, ohne die Landessprache auszukommen pflegte) die Kurzformel »Not at home« einstudiert. Viel mehr Erfolg war der Englischlehrerin aus dem nahen Northport, die »Tonio« (wie seine Frau ihn rief) ein paar Mal zum Unterricht herüberkommen ließ, nicht beschieden gewesen. Wenn er zum Shopping nach Manhattan hineinfuhr und seine Wahl getroffen hatte, rief er von dem jeweiligen Geschäft aus einen seiner französischen Freunde an und bat ihn, zu dolmetschen, und dem Taxifahrer drückte er einfach einen Adreßzettel in die Hand. Widerstand gegen Fremdsprachen hatte er schon als Kind geübt: als man ihm gegen seinen Willen Deutschunterricht erteilen wollte. »Ein Schriftsteller hat darauf zu achten, daß seine Sprache von fremden Einflüssen verschont bleibt.«
Als im November 1942 die »New York Times« dem berühmten Gast ihre Spalten öffnete und dessen »Offenen Brief an die Franzosen in aller Welt« abdruckte, setzte man nicht weniger als vier First-class-Übersetzer auf den Text an, und derjenige, der Saint-Exupérys Stil am besten traf, wurde schließlich verwendet.
Lokaltermin in Bevin House. Der Nahverkehrszug der Long Island Rail Road (zu deren Netz auch Max Frischs Montauk zählt) bringt mich in etwas mehr als einer Stunde von der Madison Square Station im Herzen Manhattans nach Northport. Es ist eines der typischen Sommerfrischestädtchen vor den Toren der Millionenstadt: Strandpark mit Musikpavillon, Jachthafen mit Lobster-Restaurant, ein paar Antiquitätenläden und Boutiquen, der Rest die rasenumsäumten, weißgestrichenen Holzhäuser der New Yorker mit Zweitwohnsitz. Die E. T.-Plastikpuppe im Schaufenster eines Spielzeuggeschäfts an der Main Street wirkt für einen, der hinter dem kleinen Prinzen her ist, doppelt ernüchternd: ein Krüppel aus Kitsch und Kommerz. Wie sehr die Fernsehmythen unsere Vorstellungswelt beherrschen, sehe ich an dem eleganten Taxichauffeur mit dem Silberhaar, der mich vom Bahnhof zur ehemaligen Saint-Exupéry-Residenz bringt: Blake Carrington, wie er im Buche (der Serie »Der Denver-Clan/Dynasty«) steht. Kann man einem so mondänen Mannsbild Trinkgeld geben?
Der Weg durch den Ort bis zu der ihm vorgelagerten Halbinsel Eaton’s Neck zieht sich: dicht aneinandergedrängt die Wochenendhäuser von Asharoken Beach. Erst, wo die schmale Straße zum denkmalgeschützten Leuchtturm abzweigt und wo bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts die Matinnecock-Indianer gesiedelt haben, ehe ihnen Theophilus Eaton, nachmals Gouverneur von Connecticut, den Boden abkaufte, wird’s exklusiver: tief im Ulmengehölz versteckte Landhäuser, das meiste aus neuerer Zeit. Als Saint-Exupéry hier den »Kleinen Prinzen« schrieb, war er der einzige Siedler weit und breit und die kurvenreiche Bevin Road noch eine ungepflasterte Privatstraße ohne Hausnummern. Heute teilen sich mehrere proprietors das kleine Zipfelchen Land zwischen Duck Harbor und Northport Bay; die Nr. 76 gehört seit einigen Jahren dem Manhattaner Bauunternehmer Nikos Kefalidis.
Meinem Besuch in den geheiligten Hallen gehen vorsorgliche Telefonate zwischen Wien und New York voraus. Der Hausherr ist, wie ich es nicht anders erwarte, unabkömmlich; umso liebenswürdiger empfängt mich seine junge Frau. Mrs. Laura Kefalidis praktiziert amerikanische hospitality: Alle Türen stehen mir offen, ich darf mich vollkommen frei bewegen. Für die Führung durchs Haus steht sie selber zur Verfügung, für Park und Strand der Gärtner. Das Studio mit Erker und Meeresblick, in dem sich Saint-Exupéry von Mitternacht bis Morgengrauen einbunkerte und bei Unmengen schwarzen Kaffees Stöße von amerikanischem Onion Skin Paper mit den Abenteuern des kleinen Prinzen vollschrieb, ist heute das Spielzimmer der Kefalidis-Kinder, und da der »Kleine Prinz«, längst auch dramatisiert (und zur gleichen Zeit, als ich mich in Amerika aufhalte, über das Kabelprogramm von »Nickelodeon« als TV-Cartoon ausgestrahlt), zu Mrs. Kefalidis’ Lieblingsbüchern zählt, wird das Kasperltheater, das den Raum dominiert, vielleicht sogar eines Tages als Saint-Exupéry-Bühne erprobt werden.
Die Fotos von Bevin House, die, akkurat gerahmt, auf einem der Flure hängen, stammen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg: An den berühmten Insassen von 1942 erinnert nichts als das Anwesen selbst. Das breit hingelagerte dreistöckige Landhaus mit der säulengestützten offenen Veranda und dem großzügig angelegten Dachgarten ist von seinen neuen Besitzern auf Hochglanz gebracht – der literarische Spurensucher, der sich wohl ein wenig mehr Patina wünschte, schwankt zwischen Bewunderung und Enttäuschung. Um das heutige Erscheinungsbild von Bevin House zumindest mit ein wenig Atmosphäre von einst anzureichern, muß ich also die Damen der Northport Historical Society bemühen, die vor einigen Jahren in ihrem Museum an der Main Street, drinnen im Ort, eine Ausstellung über »Famous Neighbours« veranstaltet haben. Da war natürlich – neben Herman Wouk und Jack Kerouac, die gleichfalls vorübergehend in Northport gewohnt haben – auch von Saint-Exupéry und der »Geburtsstätte« des »Kleinen Prinzen« die Rede: von der Farm des Unabhängigkeitskämpfers Jon Sloss Hobart, die der Schiffsbauer Cornelius De Lamater in einen Landsitz umwandelte; von dessen Enkel Sydney Bevin, der im Herbst 1942 das ererbte Anwesen an die Saint-Exupérys vermietete; von der sparsamen, ganz aufs rein Praktische beschränkten Möblierung der Räume; von den damals auch hier spürbaren Kriegsverhältnissen: reduzierter Straßenbeleuchtung und abendlicher Fensterverdunkelung, strenger Benzinrationierung, verstärkten Polizeipatrouillen; von den Gästen, die Saint-Ex (wie ihn seine Freunde zu nennen pflegten) ihre Aufwartung machten: dem Schriftstellerkollegen André Maurois, dem Maler Max Ernst, dem Dirigenten Pierre Monteux und dem Schweizer Kulturhistoriker Denis de Rougemont, der ihm bei den Zeichnungen für den »Kleinen Prinzen« Modell stand – und das mitunter mitten in der Nacht, vom Hausherrn bei »Bedarf« rücksichtslos aus dem Schlaf geweckt; von Consuelo, Saint-Exupérys kapriziöser Frau, und der katastrophalen Ehe der beiden; von Hannibal, dem Dobermannhund, der den Besitz bewachte; von der Haushälterin, die die Exzentrik ihrer Dienstgeber mehr als einmal an den Rand der Verzweiflung brachte; und von der Englischlehrerin Adèle Breaux, die sich von ihrem störrischen Schüler nur deshalb so geduldig demütigen ließ, weil sie als Saint-Exupéry-Fan seinen Büchern (und wohl auch seiner männlichen Ausstrahlung) verfallen war. Daß sie dreißig Jahre später ihre Erlebnisse in Bevin House – magere elf dem Dichter abgetrotzte Unterrichtsstunden, ein paar Einladungen zu Tee oder Dinner und gelegentliche flüchtige Einblicke in den Entstehungsprozeß des »Kleinen Prinzen« – ein Buch schreiben würde, an dem auch die offiziellen Saint-Exupéry-Biographen nicht würden vorbeigehen können, ahnte Miss Breaux damals gewiß nicht …
Wie ist es überhaupt dazu gekommen, daß Antoine de Saint-Exupéry sein populärstes Werk, die Geschichte von der Freundschaft des einsamen kleinen Weltraumflüchtlings und des in der Wüste notgelandeten Piloten, die in fünfzig Sprachen (darunter auch Latein!) übersetzt worden, in vier Millionen Exemplaren verbreitet und bis heute so etwas wie ein Kultbuch geblieben ist (dessen 200 000 Käufer pro Jahr sich notabene aus allen Altersstufen rekrutieren), in Amerika geschrieben hat?
1939, Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Der ehemalige Militärflieger Antoine de Saint-Exupéry, Jahrgang 1900, einem alten südfranzösischen Grafengeschlecht aus der Gegend um Lyon entstammend, gibt seinen Job als Zivilpilot im Postdienst und als Flughafenchef auf und meldet sich wieder bei seiner alten Einheit. Trotz bereits überschrittener Altersgrenze erhält er die Zulassung: Der passionierte Pilot, der mit seinen autobiographischen Büchern »Südkurier«, »Nachtflug« und »Wind, Sand und Sterne« längst auch ein berühmter Autor ist, findet bei Feindbeobachtungsflügen Verwendung. Als die Deutschen Frankreich besetzen, verschafft er sich ein US-Visum und geht nach Amerika ins Exil. Bedingung für seine Aufenthaltserlaubnis: Er muß, wann immer es das War Department in Washington von ihm verlangt, der US-Air Force zur Identifizierung von Luftaufnahmen zur Verfügung stehen, die von Beobachtungsflugzeugen der Alliierten über Nordafrika gemacht werden. Seit seiner Tätigkeit als Pilot auf der Strecke Toulouse-Casablanca-Dakar und als Flughafendirektor von Cap Juby gilt er als Experte, der sogar das eintönigste Wüstenpanorama »entschlüsseln« kann. Seine »Einsätze« in Washington erfolgen ohne Vormeldung, je nach momentanem Bedarf, und sehen vor, daß er jederzeit telefonisch erreichbar ist, auf der Stelle seine Arbeit (also das Schreiben) unterbricht und mit dem nächsterreichbaren Zug in die Hauptstadt fährt.
Die erste Zeit in New York wohnt er im Hotel: im Ritz Carlton. Dann zieht er in ein Apartment am Südende des Central Park um. Einundzwanzigster Stock – das ist ganz nach seinem Geschmack: dem Himmel näher. Nur im Hochsommer wird die Hitze von New York unerträglich, und Frau Consuelo sieht sich nach einem Landsitz um. Das Haus in Westport, Connecticut, erweist sich als wenig glückliche Wahl: Man zieht wieder um. Und diesmal ist es das Richtige: Bevin House, Eaton’s Neck, Long Island. »Ich hatte mit einer Hütte gerechnet, und dann war’s der Palast von Versailles.«
In diesem »Palast von Versailles«, der Saint-Exupérys Englischlehrerin, die Frankreich-Kennerin Adèle Breaux, an das Schloß seiner Kindheit erinnert: den elterlichen Besitz Saint Maurice de Remens, in dessen nächster Nähe sich dem Zwölfjährigen zum erstenmal sein Lebenstraum vom Fliegen erfüllt (an der Seite des Flugpioniers Védrines), ereignet sich jenes Wunder aus Imagination und Inspiration, dessen Resultat »Der kleine Prinz« ist. Es ist ein doppeltes Wunder: Der versierte Reporter (dessen Bücher allerdings immer auch stark reflektierende Züge aufweisen) meistert nicht nur auf Anhieb die Kunstform des Märchens, sondern entledigt sich auch mit Bravour des ebenso kühnen wie klugen Verlagsauftrags, selber die Illustrationen beizusteuern, obwohl dies absolut nicht sein Metier ist und Saint-Exupérys diesbezügliche Ausbildung sich auf den Zeichenunterricht im Gymnasium beschränkt.
Gewiß, da gibt’s schon vorher, noch in den Frankreich- und Nordafrika-Jahren, die ersten flüchtigen Skizzen des kleinen Gesellen – auf Zettel und Speisekarten fetzt er sie hin, wenn er im Restaurant aufs Essen wartet oder im Fliegercamp auf seine Maschine. Es ist schon der gleiche Junge im overallartigen Dress, mit der blonden Mähne und mit vor Staunen weitaufgerissenen Augen – einmal auf einer Bergspitze sitzend, einmal von einer Wolke aus ins Weltall blickend, oft auch einfach nur einem Schmetterling nachjagend. Seine Kriegskameraden, mit denen er sich zum Schachspiel trifft, zu Domino und Poker, erkundigen sich bei ihm, was es denn mit dieser immer wiederkehrenden Figur für eine Bewandtnis habe, die er mitunter auch in Buchwidmungen einfügt und in Freundesbriefen. Saint-Ex gibt nur sehr verschwommen Auskunft: Der kleine Kerl gehe ihm eben im Kopf herum, er symbolisiere die Träume, denen der Mensch nachlaufe, c’est tout.
Als Antoine de Saint-Exupéry im Sommer 1942 in nächster Nähe seiner New Yorker Wohnung, im Café Arnold am Columbus Circle, mit seinem amerikanischen Verleger, Curtis Hitchcock, zu einer Unterredung zusammentrifft, kommt er wieder einmal ins Kritzeln – beiläufig und selbstvergessen, auf der Papierserviette, die neben seinem Gedeck liegt. Und wieder ist es dieser sonderbare kleine Junge, den er da mit ein paar Bleistiftstrichen zu flüchtigem Leben erweckt. Das Motiv hat etwas eindringlich Melancholisches, deutet auf Einsamkeit hin und auf Traurigkeit – Hitchcock greift das Thema auf und läßt nicht eher locker, als bis ihm sein Autor Rede und Antwort steht. Wäre das denn nicht etwas für ein Kinderbuch? Für ein modernes Märchen – vom Autor selbst illustriert?
Saint-Exupéry erschrickt: An so etwas hat er nie gedacht. Aber er läßt sich überreden. Und macht sich, als er einige Wochen später in Bevin House auf Long Island seine ideale Traumwerkstatt gefunden hat, an die Arbeit. Nacht für Nacht – wie ein Besessener schreibt er die Geschichte vom kleinen Prinzen nieder, der von Planet zu Planet eilt, von Enttäuschung zu Enttäuschung, und schließlich in der Einsamkeit der Wüste mit einem notgelandeten Piloten Freundschaft schließt.
Das »Material« für sein Märchen hat er im Überfluß zur Hand: Da sind die eigenen Wunschträume des passionierten Fliegers, der, seitdem er diesen Beruf ausübt, in Kontinenten und Kosmen zu denken gewohnt ist; da ist die Erinnerung an seine Notlandung in der Sahara, die ihn, zusammen mit einem Techniker, fünf Tage lang ohne Nahrung durch die Wüste irren ließ, bis die beiden von einer Karawane entdeckt und gerettet wurden; da tauchen die Bilder der Kindheit wieder auf – »Mondgucker« nannten sie ihn schon, als er noch zur Schule ging. Und das lautlose Verschwinden des kleinen Erdengastes am Schluß der Geschichte – ist es nicht wie eine makabre Vorwegnahme von Saint-Exupérys eigenem Exodus, der ein Jahr nach Erscheinen des »Kleinen Prinzen«, nun wieder bei seiner alten Fliegereinheit in Nordafrika, zu einem letzten Beobachtungsflug aufsteigt, von dem er – ohne daß sein Ende je genau geklärt worden wäre – nicht mehr zurückkehrt?
Die Amerikaner, die den »Kleinen Prinzen« noch vor den Franzosen kennenlernen (1943 erscheint in New York die englische Übersetzung, erst 1945 in Paris das französische Original, ganz zu schweigen von Deutschland, wo darüber noch weitere fünf Jahre vergehen), fördern noch manches andere Realitätspartikel zutage: Wer den Autor auch im strengsten New Yorker Winter, bei 15 Grad unter Null, niemals einen Mantel tragen sah, immer nur jenen gewissen langen Schal überm Jackett, der auch dem kleinen Prinzen bei fast allen seinen Abenteuern um den Hals flattert, wird auf Schritt und Tritt auf autobiographische Anspielungen stoßen, und wer gar in die mehr als schwierige Ehe der Saint-Exupérys Einblick gehabt hat, wird in der Parabel von der stolzen und eitlen Rose, deretwegen der kleine Prinz von seinem Planeten Reißaus nimmt, unweigerlich an Consuelo erinnert werden und an die Probleme, die die beiden – vor allem in ihren New Yorker Exiljahren – miteinander gehabt haben.
In Eaton’s Neck auf Long Island, wo »Der kleine Prinz« entsteht, bleibt Saint-Exupéry, solange es die Witterung zuläßt. Immer wieder verlängert er seinen Aufenthalt in Bevin House, das er so sehr liebt wie keinen Wohnsitz vorher und nachher. Nach der Rückkehr nach Manhattan wechselt er noch einmal die Adresse: Beekman Place an der East Side. Es ist ein exklusives Logis – einer der Vormieter war die Filmschauspielerin Ethel Barrymore. Heute im Schatten des UNO-Hauptquartiers, das gleich daneben in die Skyline ragt, ist die einst berühmte Aussicht nunmehr durch häßliche Industrieanlagen verdorben, und auf den Parkbänken an der Waterfront schlafen die Obdachlosen ihren Rausch aus.
Schon seit einiger Zeit unternimmt Saint-Exupéry alles Erdenkliche, um wieder nach Nordafrika zurückzugelangen und an der Seite seiner Waffenbrüder am Endkampf gegen Hitlerdeutschland teilzunehmen. Amerika bedeutet für ihn doppeltes Exil: fern der Sprachheimat und fern dem Fliegerhimmel. Endlich, am 15. März 1943, erhält er die Ausreisepapiere; die Kostümwerkstätten der Metropolitan Opera fertigen ihm im Eiltempo eine Privatuniform an. Vier Tage vor seiner Einschiffung nach Algier feiert die »New York Herald Tribune Weekly Book Review« das Erscheinen der Erstausgabe des »Kleinen Prinzen« – Rezensentin ist jene Pamela Travers, deren Weltbestseller »Mary Poppins« Saint-Exupéry bei jeder Gelegenheit als das gelungenste Kinderbuch seiner Zeit gepriesen hat.
In großer Hast nimmt der Dichter von seinen Freunden in Amerika Abschied. Silvia Hamilton Reinhardt, die er im Hause seines englischen Übersetzers Lewis Galantière kennengelernt hat und die ihm eine goldene Erkennungsmarke mit fix und fertig eingravierten Daten (inklusive Blutgruppe) zum Geschenk macht, empfängt als Gegengabe seine alte Zeiss Ikon und das Ur-Manuskript des »Petit Prince«.
Die 175 Blatt Dünnpost mit den Text- und Bildentwürfen, zum Teil unvollständig, zum Teil aber auch (der verschiedenen Versionen wegen) doppelt, sind seit 1968 im Besitz der New Yorker Pierpont Morgan Library, und Kurator Herbert Cahoon, der der Autographensammlung des altehrwürdigen Instituts an der Madison Avenue vorsteht, erteilt mir die mit vielerlei Formalitäten verbundene Erlaubnis, den kostbaren Schatz einzusehen. Über drei Schreibmaschinenseiten erstrecken sich die Benützerbedingungen, an meinem Platz im Reading Room wird eine Filzdecke ausgebreitet, sodann die Schachtel mit dem »working manuscript« herbeigeschafft, und ich darf unter Aufsicht (und unter genauer Anleitung, wie beim Umblättern der Seiten vorzugehen sei) meine Studien beginnen.
Unter solch dramatischen Umständen geriete ich wohl auch bei einem weniger wertvollen Manuskript, als es dieses ist, in einen Zustand mystischer Erregung. Da ist die kaum entzifferbare Handschrift des Dichters: winzigklein und sprunghaft, zuerst Bleistift, dann braune Tinte. Da sind die Flecken, die den Kaffeetrinker, die angebrannten Ränder, die den Zigarettenraucher verraten. Da ist die zerknüllte und mühsam wieder glattgestrichene Farbskizze: ein offensichtlich verworfener Versuch, der schon im Papierkorb gelandet war. Daneben anderes, das in der Endfassung unter den Tisch fiel: ein Bild des gestrandeten Piloten, ganz klein das havarierte Flugzeug im Hintergrund. Oder der unheimliche Affenbrotbaum – noch drastischer, noch gewalttätiger als im Buch den Planeten des Kleinen Prinzen umklammernd.
Niemals habe ich Stefan Zweigs Ergriffenheit beim Betrachten von Autographen, seine wortreiche Beschwörung jener »geheimnisvollen Sekunde des Übergangs«, da eine Verszeile oder ein Prosasatz »aus der Intuition eines Genies durch graphische Fixierung ins Irdische tritt«, stärker nachempfunden als in diesem Augenblick – hier im Reading Room der Pierpont Morgan Library in New York. Und auch Albert Einsteins Urteil über den »Kleinen Prinzen« will mir auf einmal gar nicht mehr so bombastisch erscheinen: »Saint-Exupéry ist einer der Männer, die die Welt retten könnten. Denn er ist beides in einem: Mathematiker und Poet.«
Aus: Die kleinen Helden, 1987
James Bond jagt nicht nur Verbrecher, sondern auch Kolibris
Herbst 1960. Der Londoner Verlag William Collins Sons & Co. hat von dem Standardwerk »Die Vogelwelt der Karibik«, das er seit 24 Jahren in seinem Programm hat, eine auf den jüngsten Stand gebrachte Neuauflage herausgegeben; nun erhält der Autor die ersten Rezensionen, die sich in der Presseabteilung angesammelt haben. Das dicke Kuvert mit den Zeitungsausschnitten geht nach Amerika: Der Adressat ist Kurator für Vogelkunde an der Akademie für Naturwissenschaften in Philadelphia. Sein Name: James Bond.
Der Sechzigjährige, der in Cambridge studiert und acht Jahre seines Lebens in England zugebracht hat, ist die Nr. 1 unter den Ornithologen der Region Kleine Antillen, Große Antillen und Bahamas; nicht weniger als 429 Vogelarten hat er unter die Lupe genommen, und darunter sind etliche, die er entdeckt und als erster beobachtet und beschrieben hat.
Professor Bond, ganz und gar der Typ des in seinen Forschungsgegenstand vernarrten Gelehrten, ist mit der Schriftstellerin Mary Wickham verheiratet, die, ebenso wie er aus Philadelphia stammend, für Magazine wie »The Ladies’ Home Journal«, »Town and Country« und »The Forum« Gedichte und Kurzgeschichten verfaßt. Und sie ist es auch, die ihrem Mann – vor allem, wenn er auf Exkursion außer Landes weilt – die Post besorgt, die Korrespondenz abnimmt.
Auch der soeben eingelangte Verlagsbrief aus England geht zuerst durch ihre Hand. Mrs. Bond findet vorderhand nichts Auffälliges an den paar Ausschnitten, die sie da dem Umschlag entnimmt: Rezensionen aus ornithologischen Fachpublikationen – ihr Mann wird sich freuen, daß auch die Neuauflage seines Buches ein so lebhaftes Echo auslöst. Nur einer der Artikel macht sie stutzig: Es ist eine Glosse aus der Londoner »Sunday Times«, deren Autor sich darüber erstaunt zeigt, »daß James Bond sich nun auch als Vogelkundler entpuppt hat«.
Mrs. Bond schüttelt den Kopf: Was um Himmels willen sollte daran so überraschend sein? Ist ihr Mann nicht seit einem Vierteljahrhundert ornithologisch tätig, ja als Koryphäe seines Faches weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus etabliert und anerkannt? Mrs. Bond liest also weiter. Aber auch aus dem P.S., mit dem der ominöse Beitrag endet, wird sie nicht klug: »Irrtum!« schreibt der Verfasser in seinem Nachsatz. »Soeben entdecke ich, daß es sich bei dem Mann, der das Buch »Birds of the West Indies« geschrieben hat, um einen ganz anderenJames Bond handelt: um den Kurator für Vogelkunde an der Akademie für Naturwissenschaften in Philadelphia.« Und dann der Schlußsatz: »Sorry for the mistake.«
Was für ein »mistake«?
Auch Professor Bond, den seine sichtlich irritierte Gattin daraufhin zu Rate zieht, kann sich auf das Geschreibsel der »Sunday Times« keinen Reim machen. Erst eine Begegnung mit dem US-Vertreter des Verlages Collins, der sich zufällig in Philadelphia aufhält und zu einem Gedankenaustausch mit Mr. und Mrs. Bond zusammentrifft, bringt Licht in die rätselvolle Angelegenheit: Ein englischer Krimi-Autor namens Ian Fleming habe seit einiger Zeit riesigen Erfolg mit Romanen rund um einen Geheimdienstagenten, dessen Code 007 laute und dessen bürgerlicher Name James Bond.
Das Ehepaar Bond in Philadelphia hat keinen Zugang zu dieser Art von Literatur, liest prinzipiell keine Krimis, weiß also auch nichts von der stetig wachsenden Popularität dieser angeblich so exzentrischen Romanfigur, amüsiert sich jedoch über die zufällige Namensgleichheit und läßt im übrigen das Ganze auf sich beruhen. Auch die Lektüre eines der Fleming-Bücher – es ist der Band »James Bond jagt Dr. No« –, der man sich, nun doch neugierig geworden, unterzieht, hat lediglich zur Folge, daß Mrs. Bond ihren Spaß daran hat, die irrwitzigen Abenteuer des Romanhelden mit dem beschaulichen Zoologen-Alltag ihres Mannes zu vergleichen: Welch ein Glück, daß »ihr« James Bond nur hinter Kolibris und Flamingos her ist und nicht wie sein fiktiver Namensvetter hinter einem Monster wie diesem gemeingefährlichen Wissenschaftler Dr. No, der sich anschickt, mit Hilfe radioaktiver Strahlen das amerikanische Raumfahrtprogramm zu zerstören.
Die Angelegenheit, von den Bonds in Philadelphia bald schon wieder vergessen, nimmt eine neue Wendung, als im Jahr darauf unser US-Ornithologe von einer seiner Forschungsreisen zurückkehrt und seine Frau die von unterwegs mitgebrachten Filme zum Entwickeln bringt. Mrs. Bond zählt zu den Stammkunden in Dedaker’s Camera Shop; der Verkäufer in dem kleinen Laden glaubt ihr also eine Freude zu machen, als er sie mit den Worten begrüßt:
»Haben Sie schon den Artikel über Ihren Mann gelesen? Toll!«
»Was für einen Artikel?«
»Na, im ›Playboy‹!«
Mrs. Bond weiß von keinem Artikel im »Playboy« – das ganze Blatt ist ihr fremd. Nun aber doch mißtrauisch geworden, besorgt sie sich besagte Ausgabe, blättert mit spitzen Fingern das Heft durch und stößt tatsächlich, mittendrin zwischen all den schrillen Nuditäten, auf ein Interview mit James-Bond-Autor Ian Fleming, in dem dieser über die Herkunft des Namens seines Romanhelden Auskunft gibt. Und was bekommt Mary Wickham Bond da zu lesen? Sie kann es kaum fassen: Ian Fleming habe, als er sich daranmachte, seinen ersten James-Bond-Roman zu schreiben und über einen passenden Namen für seine Titelfigur nachzudenken, das Buch »Birds of the West Indies« von einem gewissen James Bond in die Hand bekommen und sich spontan entschlossen, auf dessen Namen zurückzugreifen.
Mrs. Bond weiht ihren Mann in den Vorgang ein, man schwankt zwischen Erstaunen und Entrüstung, erwägt sogar eine Klage wegen Rufschädigung – und entscheidet sich letztendlich doch dafür, die Sache von der heiteren Seite zu nehmen. Eines allerdings kann sich Mrs. Bond nicht verkneifen: Sie schreibt dem Autor, der da so locker mit fremden Identitäten umspringt, einen Brief. Und bekommt Antwort! Zwar nicht gerade prompt, doch dafür um so zerknirschter und devoter: Jawohl, er sei sich im klaren darüber, daß er die Zustimmung des »wirklichen« James Bond hätte einholen müssen, er entschuldige sich vieltausendmal für seinen frechen Übergriff, räume dem solcherart Brüskierten im Gegenzug das Recht ein, seinerseits mit dem Namen Fleming nach Belieben zu verfahren, etwa wenn er bei der Bezeichnung einer von ihm entdeckten besonders ekelhaften Vogelart in Verlegenheit geraten sollte, und lade ihn im übrigen als Feriengast in sein Haus auf Jamaika ein, wo man alles tun werde, den James Bond Nr. 1 an der Geburtsstätte von James Bond Nr. 2 zu verwöhnen und zu versöhnen.
Was sollte da zu versöhnen sein? Die Bonds sind ihrem Verbal-Parasiten keineswegs gram, sondern zeigen sich von dessen Eingeständnis im Gegenteil »immensely amused«. Und was das Verwöhnen betrifft, so kommen ihm haufenweise andere zuvor. Der erste, der den Professor aus Philadelphia von seiner ihm plötzlich zugewachsenen Prominenz profitieren läßt, ist ein Zollbeamter im Hafen von Southampton: Als der pfiffige Staatsdiener an den Koffern, die er gerade abfertigen will, den berühmten Namen prangen sieht, salutiert er ehrfürchtig und läßt den Ankömmling unkontrolliert durch. Und der Kollege in Jamaika, wo Professor Bond einige Zeit später ebenfalls den Zoll passiert, stellt zwar die üblichen Fragen, pointiert sie jedoch auf seine Weise. Es entwickelt sich folgender Dialog:
»Etwas zu verzollen, Sir?«
»Nein.«
»Keine Zigaretten? Kein Whisky?«
»Nein.«
»Und Feuerwaffen?«
»Nein«, antwortet Professor Bond, der inzwischen gleichfalls seine Lektion gelernt hat, und fügt, indem er auf jene Körperpartie deutet, an der 007 sein Schulterhalfter zu tragen pflegt, mit breitem Grinsen hinzu:
»Und wenn ich eine hätte, sie wäre ganz gewiß nicht im Koffer.«
Weitere Beweise seiner Auserwähltheit erhält Professor Bond an den New Yorker Theaterkassen: Selbst bei Vorstellungen, die auf Monate hinaus ausverkauft sind, ist, sobald er seinen Namen nennt, im Handumdrehen ein Platz für ihn frei.
Zu einer momentanen Verstimmung kommt es allerdings eines Tages doch noch, und daran ist ein Artikel in dem renommierten Magazin »The New Yorker« schuld, in dem 007-Autor Ian Fleming, abermals nach der Herkunft des Namens seines Superhelden befragt, antwortet:
»Ich wollte, daß die Figur hinter einem möglichst nichtssagenden Namen zurücktritt. Da kam mir dieses Buch über die Vogelwelt der Karibik in die Hand, und als ich den Namen des Autors las, wußte ich sofort: Das ist es, was ich suche. James Bond – wohl der ödeste und langweiligste Name, der mir jemals untergekommen ist.«
Das sollte Ian Fleming wirklich dem Reporter gesagt haben? Bei den Bonds in Philadelphia läutet das Telephon Sturm: Freunde, die dem öffentlich Geschmähten dringend anraten, den unverschämten Kerl zu verklagen. Doch James und Gattin Mary Wickham Bond wählen einen anderen Weg, den Konflikt auszutragen: Im Februar 1964 wieder einmal für ein paar Tage auf Jamaika zu Gast, entschließen sie sich, der seinerzeit brieflich ausgesprochenen Einladung Folge zu leisten, machen sich auf die Suche nach dem an der Nordküste der Insel gelegenen Fleming-Besitz »Goldeneye« und drücken, dortselbst angelangt, auf den Knopf der Türglocke. Eine farbige Bedienstete öffnet und fragt, wen sie melden kann. »Mr. und Mrs. James Bond!« lautet die knappe Antwort. Als habe sie es mit einer Geistererscheinung zu tun, stürzt die verschreckte Person ins Hausinnere, und wenige Augenblicke später steht den Ankömmlingen ein vor Liebenswürdigkeit dahinschmelzender Ian Fleming gegenüber. Im Nu löst sich die Spannung, die über der Szene liegt, in Heiterkeit auf. Nein, so erkennt Ian Fleming auf den ersten Blick, so schaut keiner aus, der im nächsten Moment eine Schußwaffe zückt und drauflosballert.
»Wir möchten nur den Ort kennenlernen, an dem James Bond entstanden ist.«
Mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung bittet Fleming seine Gäste ins Haus. »Kürzlich«, so schlägt seine anfängliche Betretenheit sogleich in Übermut um, »erhielt ich Post von einem weiteren James Bond. Er lebe in Sussex, habe vor zu heiraten, und erlaube sich anzufragen, mit welchen Hochzeitsgeschenken er von mir zu rechnen habe. Ich überwies ihm 10 Pfund.«
Der weitere Verlauf der denkwürdigen Begegnung vom 5. Februar 1964 ist rasch erzählt: Die Gäste werden durchs Haus geführt, man nimmt gemeinsam ein vergnügliches Mittagsmahl ein, und da sich zufällig zur selben Zeit ein Team des Kanadischen Fernsehens auf dem Fleming-Besitz aufhält, das mit dem Hausherrn ein Interview drehen will, nützen alle Beteiligten die einmalige Gelegenheit und bringen nicht nur den Schöpfer, sondern auch den Namensgeber des Geheimagenten 007 ins Bild. Fleming wird die Ausstrahlung dieses Filmdokuments übrigens nicht mehr erleben: Sechs Monate darauf, am 12. August 1964, stirbt der erst Sechsundfünfzigjährige an Herzversagen. Die Widmung, die er seinem Gast in das noch druckfrische Exemplar des jüngsten Bond-Romans kritzelt, ist eine seiner letzten handschriftlichen Äußerungen; sie lautet:
Wer ist dieser »Dieb«, den sein Geschöpf 007 James Bond zu einem der bestverdienenden Schriftsteller der Welt gemacht hat?
Am 28. Mai 1908 kommt er als einer von drei Söhnen des Unterhausabgeordneten Major Valentine Fleming in London zur Welt; von der Mutter weiß man nur, daß sie eine belesene Frau von stupender Schönheit ist, die mit ihren Kindern Großes vorhat. Ian besucht das strenge Knabeninternat von Eton sowie die Militärakademie in Sandhurst. Doch bevor er sich, um sich auf die Diplomatenlaufbahn vorzubereiten, an den Universitäten von München und Genf zum Psychologiestudium einschreibt, nimmt sich ein in dem Tiroler Wintersportort Kitzbühel residierendes Pädagogenpaar aus England des Achtzehnjährigen an: Ernan Forbes Dennis und Phyllis Bottome halten im Tennerhof deutsche Sprachkurse ab, die allerdings weit mehr sind als dies, fast so etwas wie jenes humanistische Allround-Training, das man in späteren Jahren Studium generale nennen wird.
Aus der Bibliothek des Tennerhofs leiht sich Ian die Werke von Kafka, Musil und Zweig, von Schnitzler, Rilke, Werfel und Hofmannsthal aus, er lernt die Zeichenkunst solcher Größen wie Kokoschka und Kubin kennen, in der Auseinandersetzung mit den Lehren Alfred Adlers gelingt es dem frustrierten Wirrkopf, seine Minderwertigkeitskomplexe abzubauen. Mit den in Kitzbühel gewonnenen Freunden beiderlei Geschlechts trifft man sich im populären Café Reisch, im Sommer geht man im Schwarzsee schwimmen und klettert aufs Kitzbüheler Horn, im Winter wird Ski gefahren.
Auch zu seinen ersten Schreibversuchen – es ist die Kurzgeschichte »Death on Two Occasions« – kommt es im Laufe seines Kitzbühel-Jahres, und das Erlebnis eines Lawinenabgangs, das um ein Haar tödlich für Ian Fleming ausgeht, wird ihn 36 Jahre später sogar zu einer der Szenen seines James-Bond-Romans »On Her Majesty’s Secret Service« inspirieren. Noch auf der Höhe seines Ruhms als Weltbestsellerautor wird Ian Fleming von jener »golden time« seiner Jugendjahre schwärmen, die er 1926/27 in den Tiroler Alpen zugebracht hat.
Wieder zurück in England, absolviert Ian die Aufnahmeprüfung für den diplomatischen Dienst, doch obwohl er unter den 62 Bewerbern den 25. Platz erreicht, bleibt ihm das Auswärtige Amt verschlossen, und so wendet er sich statt dessen dem Journalismus zu. Vier Jahre im Sold der Nachrichtenagentur Reuters, berichtet er unter anderem, seine Russischkenntnisse nutzend, über einen Moskauer Spionageprozeß; nur mit seinem Wunsch, von Stalin zu einem Interview empfangen zu werden, blitzt er ab. Nach Zwischenspielen im Bankgeschäft – zuerst als Wertpapierhändler, dann als Börsenmakler – ergreift der inzwischen Einunddreißigjährige die Chance, sich in jenem Metier zu bewähren, das die Voraussetzungen für seine spätere Schriftstellerkarriere schafft: Der Freiwilligen-Reservist der Britischen Marine – gerade eben ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen – wird im Range eines Leutnants zum persönlichen Assistenten von Konteradmiral Godfrey berufen, der die Leitung des Marine-Geheimdienstes innehat …
Flemings Dienstsitz ist das Whitehall-Building in der Londoner City, sein Büro der Room 39, seine Code-Nummer die 17 F, seine Aufgabe der weitere Ausbau des Nachrichtendienstes sowie die Ausbildung von Sonderkommandos für Geheimeinsätze in feindlichen Territorien. Als der Krieg vorüber ist, kehrt der nunmehrige Mittdreißiger ins Zivilleben zurück und übernimmt zunächst die Leitung des Auslandsressorts beim Kemsley Zeitungskonzern, bevor er für einige Jahre zur »Sunday Times« wechselt.
Am 24. März 1952 in den Stand der Ehe tretend, teilt Fleming sein Leben von nun an zwischen London und Jamaika auf, wo er seit 1946 ein Haus besitzt. Wenn man ihm glauben darf, ist es vor allem die Angst vor dem Verlust des Junggesellendaseins, was ihn zum Bücherschreiben treibt: Die intensive Versenkung in die Geheimdienstwelt des Superagenten 007 soll ihm jenen Freiraum sichern, den er durch den neuen Status bedroht sieht. Fleming setzt sich im Arbeitszimmer seines Hauses an die zwanzig Jahre alte Reiseschreibmaschine, spannt ein Blatt feinsten Foliopapiers ein und beginnt seinen ersten James-Bond-Roman: »Casino Royale«. Jeden Tag von 9 bis 12 brütet er über dem Manuskript, nach dem Lunch geht er schwimmen und/oder fischen – von seinem Besitz »Goldeneye« ist es nur wenige Schritte zum Nordufer der Jamaika Bay.
Gut ein Jahr darauf erscheint das Buch, doch der Absatz läßt zu wünschen übrig: Von der englischen Erstausgabe werden 8000, von der amerikanischen gar nur 4000 Stück verkauft – gerade genug, daß man sich einmal im Jahr (so vertraut er mit bitterer Ironie seinem Tagebuch an) ein Spargelessen leisten kann. Der große Durchbruch kommt erst mit dem Film: Ian Fleming gibt 1960 dem Drängen des Produzententeams Broccoli-Saltzman nach, seine Stoffe – inzwischen sind auch die Romane »Leben und sterben lassen«, »Mondblitz«, »Diamantenfieber«, »Liebesgrüße aus Moskau« und »James Bond jagt Dr. No« erschienen – für Hollywood freizugeben.
Hat der »Daily Express« schon bisher jedes der Fleming-Bücher in Fortsetzungen vorabgedruckt, so veranstaltet nun Englands auflagenstärkste Tageszeitung eine Leserumfrage, um den Hauptdarsteller des ersten James-Bond-Films zu küren. Zehn junge Schauspieler stehen zur Wahl, sechs Millionen »Daily-Express«-Leser geben ihre Stimme ab, die große Mehrheit votiert für den dreißig Jahre alten Sean Connery, einen ehemaligen schottischen Lastwagenchauffeur, der als Chorist in dem Musical »South Pacific« und mit Hauptrollen in ein paar B-Pictures der 20th Century Fox erste bescheidene Erfolge vorzuweisen hat.
Alles Weitere ist heute Filmgeschichte: James Bond wird zum Kino-Hit, ja zur Kultfigur einer ganzen Generation – und Ian Fleming, ihr Schöpfer, zum Erfolgsautor, dessen nach und nach dreizehn 007-Bücher zu seinen Lebzeiten 25 Millionen Mal verkauft und damit neben den Schallplatten der Beatles zu einem der größten britischen Exportschlager werden.
Präsident Kennedy läßt verlauten, er habe jederzeit einen James Bond auf dem Nachttisch liegen (desgleichen – welch makabre Pointe! – sein Mörder Harvey Lee Oswald); der Bond-Stil beeinflußt die Herrenmode ebenso wie das Champagner- und Wodka-Geschäft, der 007-Diplomatenkoffer ist im Winter 1964 das meistverkaufte Weihnachtsgeschenk. Der »Goldfinger«-Film (dessen Riesenerfolg Fleming selber übrigens nicht mehr erlebt) läuft in einem New Yorker Kino 24 Stunden am Tag – nur von kurzen Pausen unterbrochen, in denen die Popcornreste aus dem Saal gefegt werden; kein Geringerer als der spätere italienische Starautor Umberto Eco widmet den »Erzählerischen Strukturen in Flemings Werk« eine umfangreiche wissenschaftliche Untersuchung, und Fleming selber tauscht seine alte Reiseschreibmaschine gegen ein eigens für ihn angefertigtes vergoldetes Exemplar (das, dreißig Jahre nach seinem Tod, auf einer Versteigerung im Londoner Auktionshaus Christie’s für stolze 56 000 Pfund in die Hände eines Sammlers übergehen wird).
Natürlich gibt es auch kritische Stimmen, und pikanterweise ist es ausgerechnet Terence Young, Regisseur der ersten James-Bond-Filme, der das Geschöpf seines Freundes Fleming einen »abscheulichen Kerl« findet, »der bei der SS hätte Karriere machen können«. Ein Rohling gegenüber unbewaffneten Männern und ein Schuft gegenüber vertrauensseligen Frauen, heimse er dafür, daß er von seiner Lizenz zum Töten nach Herzenslust Gebrauch mache, auch noch königliche Orden ein. »Außerdem habe ich Bond niemals ein Buch lesen, ein Konzert besuchen oder ins Theater gehen sehen. Er ist in meinen Augen ein geistig minderbemitteltes Individuum, ein totaler Banause.«
Ganz anders sieht das klarerweise Ian Fleming: Zumindest in punkto Hobbys hat der Autor viel zuviel von sich selbst in diesen 007 projiziert, als daß er zu ihm auf Distanz gehen könnte, ohne sich lächerlich zu machen. So wie Bond liebt Fleming blaue Anzüge und haßt Schnürschuhe, schwört auf Golfspiel und Unterwassertauchen (wofür er eigens bei Meister Jacques Cousteau Unterricht genommen hat), macht sich nichts aus Blumen, fährt schnelle Autos, raucht täglich sechzig eigens für ihn gemischte Zigaretten, hat ein Faible für asiatische Frauen, mischt sich seinen Martini nach dem gleichen Rezept, und dafür, daß er am Spieltisch des Kasinos von Estoril (wo er während des Krieges gegen eine Phalanx deutscher Spione antritt) kläglich verliert, rächt er sich, indem er James Bond beim Bakkarat in Royale-les Eaux um so schamloser abkassieren läßt.
Freilich – ein Banause (Regisseur Terence Youngs Hauptvorwurf gegen 007) ist Ian Fleming nicht: Schöngeist durch und durch, der einen nicht unbeträchtlichen Teil seiner Einkünfte in seine Privatbibliothek steckt, kann er auf Erstausgaben von Einstein, Curie, Röntgen, Kipling, Lilienthal und Marx verweisen, und die vielen Sachfehler, die seinen eigenen Werken angelastet werden, sind nicht etwa Ausfluß mangelnder Bildung, sondern voll beabsichtigt: »Dann schreiben die Leute nämlich wütende Protestbriefe, und mein Verleger sieht, wie wichtig ich bin.«
Soviel zu Flemings »Eigenanteil« an der Charakterzeichnung seiner Titelfigur. Aber da sind auch noch eine Menge anderer Urbilder im Spiel, und die haben fast durchwegs mit Flemings Vergangenheit als Geheimdienstmann bei der Royal Navy zu tun. Da ist zum Beispiel Captain Dunstan Curtis, der beim Überfall der Deutschen auf Algier die feindlichen Codes knackt; Captain Wilfred Dunderdale, der im Ersten Weltkrieg mit seinem perfekten Russisch die Ost-Agenten austrickst; der jugoslawische Doppelspion Dusko Popov, der den Amerikanern den japanischen Luftangriff auf Pearl Harbor voraussagt; und schließlich der schon zu gemeinsamen Etoner Schülerzeiten mit Fleming befreundete schottische Abenteurer Ivar Bryce, der im Auftrag der Alliierten im Berliner Luxushotel Adlon die Nazi-Größen bespitzelt und in Südamerika ein Informationsnetz aufbaut.
Auch bei vielen anderen Figuren der James-Bond-Bücher schöpft Ian Fleming aus Selbsterlebtem – greifen wir nur zwei heraus: Hinter Miss Moneypenny, der herbliebenswürdigen Vorzimmerdame jenes Büros, in dem 007 seine Aufträge entgegennimmt, verbirgt sich die 1908 in Bukarest geborene Vera Maria Rosenberg, die während des Zweiten Weltkriegs die Frankreich-Abteilung des Secret Service leitet, und als nach Erscheinen des »Goldfinger«-Romans das Gerücht aufkommt, Fleming habe die Gestalt dieses Jahrhundertverbrechers mit gewissen Zügen des amerikanischen Edelmetallkönigs Charles W. Engelhard ausgestattet, muß der Autor sogar eine Weile davor zittern, wegen Ehrabschneidung vor Gericht zitiert zu werden. Doch Mister Engelhard ist ein Mann von souveränem Humor, läßt über seine Konzernzentrale verlautbaren, er fühle sich im Gegenteil geschmeichelt, in die Literatur eingegangen zu sein, und als er eines schönen Tages für seinen Privat-Jet eine neue Stewardess engagiert, gibt er der jungen Dame spontan den Namen der abtrünnigen Goldfinger-Pilotin Pussy Galore. In der Welt der Krimis ist eben alles, wahrhaftig alles möglich …
Aus: Sie haben wirklich gelebt, 2001
Dietmar Grieser auf den Spuren österreichischer Musikgenies
Die Marseillaise von Ruppersthal
Ignaz Pleyel
Wißbegierige Anrainer der Ignaz-Pleyel-Gasse in Inzersdorf bleiben ganz auf sich gestellt: Keine Zusatztafel, die sie – wie in vielen anderen Wiener Straßen Usus – über Identität und Bedeutung des Namensgebers aufklärt.
Paris ist anders. Der Flaneur, der mit der Rue Pleyel im Arrondissement Reuilly nichts anfangen kann, weiß zumindest, daß die »Salle Pleyel« am Faubourg St. Honoré die berühmteste und mit ihren 3000 Plätzen größte Konzerthalle der Stadt ist; wer an der Station Carrefour-Pleyel in die Métro einsteigt, kann sich unschwer auf die mit Notenbeispielen dekorierten Perrons einen Reim machen, und seitdem das Österreichische Kulturinstitut bei der Verwaltung des Pariser Prominentenfriedhofs Père Lachaise die Anbringung einer Zusatzplakette am Sockel des Pleyel-Grabmals durchgesetzt hat, ist für jedermann sichtbar, daß der 1831 hier Bestattete ein »Autrichien« gewesen ist: »Né à Ruppersthal«.
Ruppersthal im Weinviertel, Ortsteil von Großweikersdorf, 583 Einwohner, 500 000 Liter Grüner Veltliner pro Jahr. Spätestens seit der Sonderbriefmarke des Jahres 1994, der Aufführung des Festspiels »Pleyel, der vergessene Sohn unserer Heimat«, dem auf einer ORF-CD festgehaltenen Millenniumskonzert in der Pfarrkirche und der Eröffnung des Pleyel-Museums in der ehemaligen Dorfschule weiß jeder Ruppersthaler, wer da vor über 200 Jahren (so der Titel einer der vielen Gedenkveranstaltungen) »von Niederösterreich in die Welt« hinausgezogen ist.
Martin Pleyl (er noch ohne das polyglotte e zwischen dem y und dem l) ist Schulmeister, Organist und Mesner in einer Person. Auch Sohn Ignaz zählt zu seinen Zöglingen. Von Mutter Anna Theresia wird gemunkelt, sie sei eine wegen eines amourösen Fehltritts von der Familie verstoßene Gräfin Schallenberg. Wie auch immer: Der am 18. Juni 1757 zur Welt gekommene Ignaz zeigt musikalisches Talent, die Eltern schicken ihn zur Ausbildung nach Wien. Der Dittersdorf-Adept Johann Baptist Vanhal, sein erster Lehrer, kann seine Gönner, die Grafen Erdödy, dazu überreden, das junge Genie der Obhut der Esterhazys in Eisenstadt anzuvertrauen – satte 100 Louisdor pro Jahr lassen sie sich »Lehre und Pension« bei »Papa Haydn« kosten. Auch Meister Gluck spart, als ihm die ersten Kompositionen des Neunzehnjährigen vorgelegt werden, nicht mit (kritischem) Lob: »Junger Freund, Sie haben gelernt, Noten aufs Papier zu setzen. Nun müssen Sie nur noch lernen, die überflüssigen wieder zu streichen.« Und der ein Jahr ältere Mozart schreibt an seinen Vater: »Seine Quartette sind sehr angenehm. Wenn Du sie noch nicht kennst, such sie zu bekommen, es ist der Mühe wert.«
1783 wird im Straßburger Münster eine Stelle frei, der Sechsundzwanzigjährige übersiedelt als Adjunkt des Domkapellmeisters ins Elsaß. Noch bevor er dessen Nachfolge antritt, hat er die Staatsbürgerschaft gewechselt: Aus dem Österreicher Pleyl wird der Franzose Pleyel. Als die Revolution ausbricht, hilft ihm das freilich wenig: Als Landsmann der verhaßten Königin Marie Antoinette kann er sich der Guillotine nur entziehen, indem er lautstark den neuen Herren huldigt und für eine der Revolutionsfeiern eine »Hymne à la Liberté« schreibt. Seinen kirchlichen Posten ist er dennoch los: Die Domgottesdienste sind eingestellt, Kardinal Rohan flieht ins Exil, Pleyel selber weicht nach London aus, wo inzwischen auch sein Lehrer Haydn konzertiert.
Als er die Zeit gekommen sieht, einen Neuanfang in Straßburg zu riskieren, landet Pleyel im Kerker. Und um der abermals drohenden Hinrichtung zu entgehen, komponiert er binnen einer Woche, von zwei Gendarmen Tag und Nacht bewacht, eine achtstündige Revolutionsmusik, deren monströse Pathetik – unter Einsatz von Kirchenglocken, Massenchören und Schlachtenlärm – die Republikaner derart begeistert, daß sie ihren Schöpfer in die »Ehrenliste der Revolutionskünstler« aufnehmen. Daß er vermutlich auch die Musik für die Marseillaise beigesteuert hat, kann er freilich nicht auf seine Fahne heften: Das ursprünglich den Soldaten der Rhein-Armee zugedachte Kampflied geht auf einen blutrünstigen Text des Straßburger Pionierhauptmanns Rouget de Lisle zurück, und mit dem ist Pleyel zwar gut Freund, wohnt mit ihm im selben Haus und hat auch schon eines seiner früheren Werke vertont, aber daß die Noten zu »Allons, enfants de la patrie« nicht von einem Franzosen, sondern von einem Ausländer stammen sollen, ist allseits unzumutbar, und so bleibt es wohl für alle Zeiten dabei: Textdichter Rouget de Lisle, obzwar in punkto Musik nur als exzellenter Sänger und Geiger ausgewiesen, hat auch die Melodie der Nationalhymne geschrieben.
Das zweite Leben des Ignaz Pleyl alias Ignace Pleyel setzt 1795 mit seiner Übersiedlung nach Paris ein: Der Achtunddreißigjährige, dessen Sinfonien, Streichquartette und Opern nun immer seltener aufgeführt werden, gründet einen Musikverlag mit eigener Notenstecherei, steigt in den Instrumentenhandel ein und errichtet eine Klavierfabrik, deren Ruhm schon bald den Ruhm des Komponisten gleichen Namens übertreffen wird. Mit der Übergabe des florierenden Unternehmens an seinen Sohn Camille anno 1824 zieht sich der inzwischen Siebenundsechzigjährige auf sein Landgut in der Nähe von Paris zurück, wo er am 14. November 1831 stirbt.
Der Junior, mit Hector Berlioz’ Exbraut Marie Félicité Denise Moke, einer zu ihrer Zeit berühmten Konzertpianistin, verehelicht, hinterläßt keinen männlichen Erben: Der Name Pleyel bleibt nur mehr als Taufpate des führenden Pariser Konzertsaals erhalten und als Klaviermarke. Heute werden die schon von Chopin, Rubinstein und Saint Saëns hochgeschätzten Pleyel-Flügel in einer Werkstätte der südostfranzösischen Provinzstadt Alès hergestellt – und das auch nur, weil sich das Nachfolgeunternehmen des »Autrichien« mit einer Zusatzproduktion von Radio- und Fernsehgeräten über Wasser hält.
Aus: Heimat bist du großer Namen, 2000
Der Ölberg von Hohenseibersdorf
225 Jahre hat er Wind und Wetter getrotzt, zuletzt auch noch den Gefährdungen durch die schweren Maschinen des landwirtschaftlichen Kollektivbetriebs, die während der KP-Ära auf den Feldern ringsum im Einsatz waren, um dem kargen Boden neue Frucht abzugewinnen. Doch außer ein paar Schrammen hat er kaum etwas abbekommen, und auch die brüchigen Stellen an Einfriedung und Sockel gehen nicht auf gewaltsame Eingriffe von Menschenhand zurück, sondern auf das unterirdische Rumoren des Wurzelwerks vom benachbarten Baumriesen. Man wird es also wohl ein Wunder nennen dürfen, daß der steinerne Christus auf dem Ölberg zwischen Mährisch Neudorf und Hohenseibersdorf so gut wie unangefochten die Jahrhunderte überdauert hat, und seitdem der Steinmetz aus dem Tal am Werk ist, die ärgsten Schäden zu beheben, scheint auch seine weitere Zukunft gesichert.
Das einzige an Reparatur, was von Zeit zu Zeit anfällt, ist das behutsame Nachziehen der Schriftzeichen, die über Herkunft und Widmung des Monuments Auskunft geben, und das ist schon deshalb von Bedeutung, weil es nicht irgendein gottesfürchtiger Anonymus gewesen ist, der sich hier als Stifter hervorgetan hat, sondern Franz Schuberts Großvater: der Bauer Carl Schubert aus dem nahen Neudorf im Kreis Mährisch Schönberg. »Aufgerichtet von einem unwürdigen Liebhaber«, lesen wir auf einer der Schrifttafeln, die die mannshohe Statue umkleiden, und wir lesen es mit Rührung. Ein »unwürdiger Liebhaber« des Herrn Jesus Christus – schöner kann man es wohl kaum ausdrücken, als dies der siebenundfünfzigjährige Carl Schubert sieben Jahre vor seinem Tod getan hat.
Er ist kein Krösus, der aus dem Vollen schöpft, sondern ein Landwirt wie viele andere. Was ihn von diesen unterscheidet, ist lediglich sein Mut, gegen die Willkür der Obrigkeit aufzubegehren, die, wenn es ihr nötig erscheint, mit aller Härte die Leibeigenschaft ihrer Untergebenen verteidigt. Bei den Martern des Ölberg-Christus, die er dem Steinmetz darzustellen aufträgt, mag Carl Schubert tief im Innersten also wohl auch an sein eigenes Los und an das seiner Zeitgenossen denken: Der Boden, den er zu bewirtschaften hat, ist steinig, das Klima auf den in 600 Meter Seehöhe gelegenen Feldern an den Ausläufern des Altvatergebirges rauh, das Regiment der Grundherren, die über Wohl und Wehe der 42 Häuser und 253 Einwohner von Neudorf wachen, streng. Sein Sohn Franz Theodor, eines von elf Kindern und zu dieser Zeit ein Bursche von siebzehn Jahren, wird mit einundzwanzig den elterlichen Hof verlassen und im fernen Wien jene Elisabeth Vietz ehelichen, die am 31. Jänner 1797 ein Genie zur Welt bringt: den Komponisten Franz Schubert.