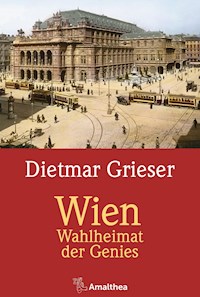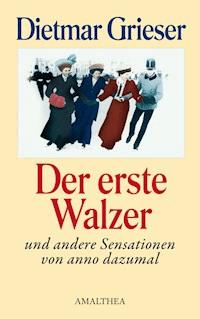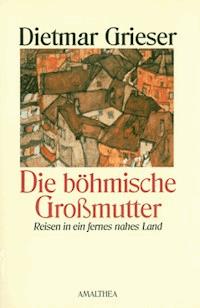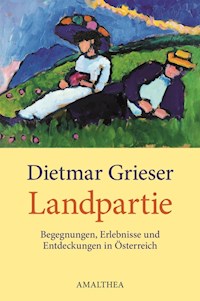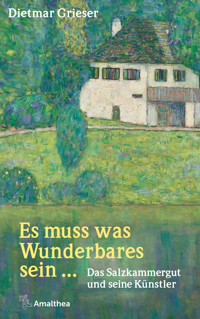Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Auf dieses Buch, das sich die Wiederentdeckung eines stolzen Olymps bedeutender Österreicherinnen und Österreicher zum Ziel gesetzt hat, haben die Leser seit Jahren gewartet. Es schließt an Dietmar Griesers Bestseller "Heimat bist du großer Namen" und "Wien – Wahlheimat der Genies" an und überrascht mit ebenso informativen wie unterhaltsamen Porträts jener heute Vergessenen, die zu ihrer Zeit Außerordentliches geleistet haben: vom Erfinder der Postkarte, der Mund-zu-Mund-Beatmung und der Frankfurter Würstel über den Entdecker der "Venus von Willendorf", den Schöpfer des Meinl-Mohren und den legendären "Goldfüllfederkönig" bis zu herausragenden Frauengestalten wie der Beethoven-Muse Therese von Malfatti, der Schriftstellerin Sir Galahad und der Gandhi-Gefährtin Mirabehn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietmar Grieser
Verborgener Ruhm
Österreichs heimliche Genies
Besuchen Sie uns im Internet unter amalthea.at
1. Auflage Februar 20042. Auflage März 2004
© 2004 by Amalthea Signum Verlag, WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Wolfgang HeinzelHerstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 11/14 Punkt New CaledoniaDruck und Bindung: Ueberreuter Buchproduktion, KorneuburgPrinted in AustriaISBN 3-85002-508-XeISBN 978-3-903083-89-9
Für Erika
Inhalt
Vorwort
Für EliseDie Beethoven-Vertraute Therese von Malfatti
Geierwally wider WillenDie Malerin Anna Stainer-Knittel
Rote MadonnaDie Volksbildnerin Emma Adler
Keine Feministin wie jede andereDie Schriftstellerin Sir Galahad alias Bertha Eckstein-Diener
»Ich war Königin am Nil …«Die Weltbürgerin Djavidan Hanum, geb. May Gräfin Török von Szendrö
Von Beethoven zu Gandhi und wieder zu BeethovenDie Philanthropin Mirabehn
»Unsereins hat nur ein Eckchen in der Welt …«Alban Bergs Tochter Albine Scheuchl
»Dein ist mein ganzes Herz …«Die Auswanderin Gertrude Wagner
Watschen von MozartDer Komponist Franz Xaver Süßmayr
»Gott erhalte …«Der Hymnendichter Lorenz Leopold Haschka
Ein verirrter RadfahrerDer Restaurator Victor Jasper
Kein Mohr wie jeder andereDer Gebrauchsgraphiker Joseph Binder
»Jetzt no d’ Reblaus …«Der Karikaturist Hanns Erich Köhler
Platane, Roßkastanie und KartoffelDer Botaniker Carolus Clusius
Vogelstimmen – vom BlattDer Naturforscher Thaddäus Haenke
Kniefall im WüstensandDer Botaniker Friedrich Welwitsch
Kafka war sein HörerDer Kriminologe Hanns Gross
Ein tolles WeibDer Urgeschichtsforscher Josef Bayer
Erstes OpferDer Raumfahrtpionier Max Valier
Kampf den Geldfälschern!Der Erfinder Jakob Degen
»Mit den Fingern, Majestät!«Der Fleischhauer Johann Georg Lahner
Das MetronomDer Erfinder Johann Nepomuk Mälzel
Regenmantel, Gummistiefel, MiederDer Fabrikant Johann Nepomuk Reithoffer
Sechzehn mal so hellDer Erfinder Joseph Petzval
Alphabet für TaubblindeDer Sprachschöpfer Heinrich Landesmann alias Hieronymus Lorm
»Über eine neue Art der Correspondenz mittelst der Post …«Der Erfinder Emanuel Herrmann
VerschollenDer Filmproduzent Anton Kolm
Ohne WorteDer Volksbildner Otto Neurath
Vater der Shopping CenterDer Architekt Victor Gruen
Lange vor PorscheDer Autokonstrukteur Béla Barényi
»Bitte sehr, bitte gleich!«Der Komiker Carl Blasel
Wasser, Sonne, Sand und LuftDer Naturheiler Florian Berndl
Mit allen Mitteln»Goldfüllfederkönig« Ernst Winkler
April 1945Der Sieben-Tage-Bürgermeister Rudolf Prikryl
Genie und KetzerDer Geigenbauer Jacob Stainer
Ein Sponsor von FormatDer Bauunternehmer Antonio Gabrielli
Ein verbesserungsbedürftiges WeihnachtsgeschenkDer Spielzeugfabrikant Johann Korbuly
Honorar: ein VaterunserDer Armenarzt Dr. Ladislaus Batthyány
Von Mund zu MundDer Mediziner Dr. Peter Safar
»Vom Gehänge flott ins Tal zu gleiten …«Die Skipioniere Max Kleinoscheg und Toni Schruf
Literaturverzeichnis
Vorwort
Verborgener Ruhm« – das ist wie alles relativ. Der eine ist, was unsere heimlichen Genies betrifft, mehr bewandert, der andere weniger. Auch über deren Nationalität im strengen Sinne läßt sich da und dort streiten; sie sind dann jedenfalls, ob Zuzügler oder bloß Auftragnehmer, durch ihr Wirken zu Österreichern geworden.
In einigen Fällen wird der geneigte Leser wohl auch in inhaltlicher Hinsicht ein Auge zudrücken müssen: Die China-Auswanderin Gertrud Wagner und die Alban-Berg-Tochter Albine Scheuchl sind nur im Sinne ihrer beispiellosen Überlebenskunst unter die »Genies« zu reihen, der Naturapostel Florian Berndl und der Restaurator Victor Jasper müssen sich mit der Gattungsbezeichnung »Sonderling« begnügen, und der selbsternannte »Goldfüllfederkönig« Ernst Winkler ist überhaupt eine anrüchige Person.
Noch etwas ist, bevor Sie sich den in diesem Buch versammelten Porträts zuwenden, klarzustellen: Es geht bei diesem Unternehmen nicht um einen Akt vaterländischen Auftrumpfens – etwa in dem Sinne: Seht her, was für tolle Burschen wir doch sind! Übertriebener Patriotismus ist auch meine Sache nicht, obwohl ich als bekennender Wahlösterreicher diesbezüglich mehr Spielraum habe als der Alteingesessene.
Worum also geht es in diesem Buch? Um Vervollständigung. Muß der Kanon der berühmten Österreicher, deren Namen wir auf Anhieb aufzählen können, immer auf Mozart, Nestroy, Klimt und Freud beschränkt bleiben? Nicht nur, um als Kandidat beim »Millionenspiel« bestehen zu können, sollten wir bei der Frage nach Leben und Werk von Franz Xaver Süßmayr, Friedrich Welwitsch oder Ladislaus Batthyány nicht gleich ins Schlingern geraten.
Ob wir es Nachhilfeunterricht in Staatsbürgerkunde nennen wollen oder schlicht einen Beitrag zur Allgemeinbildung: Schauen wir uns im imaginären Ruhmeshain jener heute Vergessenen um, die zu ihrer Zeit so Bedeutendes geleistet haben, daß dies in vielen Fällen bis in unsere Tage nachwirkt.
Ein paar Beispiele, bunt gemischt: Wer ist es, der die Postkarte erfunden hat, das Metronom, das Piktogramm, die Mund-zu-Mund-Beatmung, das Shopping Center, die Frankfurter Würstel, den einst in keinem Kinderzimmer fehlenden Spielzeugbaukasten »Matador«? Wer hat die »Venus von Willendorf« entdeckt, wer hat die »österreichische Stradivari« gebaut, wer hat den Text zu Haydns »Gott erhalte« verfaßt, wer hat den Meinl-Mohren kreiert, wer die berühmte Reblaus-Karikatur aus dem Staatsvertragsjahr 1955? Was hat es mit der legendären »Geierwally« für eine Bewandtnis, mit der Mahatma-Gandhi-Gefährtin Mira-behn? Wer verbirgt sich hinter Beethovens »Elise«, wer hinter der ägyptischen Vizekönigin Djavidan Hanum, wer hinter dem sonderbaren Pseudonym Sir Galahad? Wieso hat Wien anno 1945 einen Bürgermeister gehabt, der nur sieben Tage amtiert hat? Wer hat den ersten österreichischen Spielfilm gedreht, wer hat Jahre vor Ferdinand Porsche die Konstruktionspläne für den Volkswagen entwickelt, welcher Unternehmer hat sich, lange bevor der Begriff in Umlauf gekommen ist, als »Sponsor« einen Namen gemacht, auf wessen kriminologische »Vorarbeit« geht der Welterfolg des »Kommissar Rex« zurück?
Es sind allesamt Österreicher. Doch Österreicher, die kaum einer kennt. Lassen Sie sich überraschen!
Schließlich noch ein Wort zum Aufbau des Buches. Wie bei allen kulturgeschichtlichen Themen sind auch bei diesem die Männer in der Überzahl. Um dieses Ungleichgewicht zumindest optisch zurechtzurücken, stelle ich die von mir porträtierten Frauengestalten demonstrativ an den Anfang des Buches. Muß ich mich schon der Übermacht des sogenannten starken Geschlechtes beugen, will ich mich nicht auch noch dem Vorwurf aussetzen, gegenüber dem sogenannten schwachen ungalant zu sein.
Dietmar Grieser
Für Elise
Die Beethoven-Vertraute Therese von Malfatti
Für Elise« – wer kennt sie nicht, Beethovens Klavierminiatur in a-Moll? Nur aus übergroßem Respekt vor dem Meister scheuen wir davor zurück, das häßliche Wort »Gassenhauer« in den Mund zu nehmen. Freuen wir uns statt dessen, daß das 1810 entstandene »Albumblatt«, das die Musikfeinspitze geringschätzig der Gattung »Bagatelle« zurechnen, auch den blutigen Anfänger in die Lage versetzt, sich an Beethoven zu versuchen. In Heumanns »Kunterbunter Spielkiste beliebter klassischer Melodien in leichter bis leichtester Fassung« steht es neben dem »Wiegenlied« von Johannes Brahms und Robert Schumanns »Träumerei«. Was seinen festen Platz im Kinderzimmer hat, kommt für den Konzertprofi höchstens als Zugabe in Betracht, obwohl auch er, unterdrückt er nur seine Vorbehalte gegen alles allzu Populäre und Abgespielte, aus dem 3-Minuten-Opus manches an Virtuosität herausholen könnte. Immerhin – Brendel und Buchbinder, Kempff und Ashkenazy waren sich nicht zu gut dafür, »Für Elise« sogar auf Schallplatte und/oder CD einzuspielen.
Eine andere Frage, die sich freilich weder der AnfängerDreikäsehoch noch der Meisterpianist zu stellen pflegt, ist die Frage nach der Identität der Widmungsträgerin: Wer ist sie eigentlich, diese Elise? Hat es sie tatsächlich gegeben?
Ja, hat es. Nur hieß sie nicht Elise. Sondern Therese. Als man 1867, vierzig Jahre nach Beethovens Tod, daranging, das Stück zum Druck zu befördern und somit für die Öffentlichkeit freizugeben, ereignete sich ein folgenschwerer Fehler: Beim Entziffern der kaum leserlichen Handschrift des Meisters deutete man den Namenszug, der in Wahrheit »Therese« heißen sollte, leichtfertig als »Elise«, und dabei ist es – überhaupt, nachdem das Originalmanuskript in Verlust geraten war – geblieben. Dabei hätte man sich nur die Mühe zu machen brauchen, die Entstehungsgeschichte des vielgeliebten, vielgeschmähten Werkchens aufzuhellen.
Bald zehn Jahre ist es her, daß sich Beethovens Gehörschwäche zum erstenmal bemerkbar gemacht hat. Nun, Ende Oktober 1808, kommt auch noch hinzu, daß sich bei dem knapp Achtunddreißigjährigen eine gewisse Wien-Müdigkeit einstellt: Der König von Westfalen, Napoleons jüngster Bruder Jérôme Bonaparte, hat die Absicht geäußert, Beethoven als Kapellmeister an seinen Hof zu berufen. Ein Sendbote trifft in Wien ein, der ihn mit dem Offert eines Gehalts von 600 Golddukaten nach Kassel locken soll.
Die durchwegs habsburgtreuen Wiener Mäzene schrecken auf, als sie erfahren müssen, ihr Schützling habe ernstlich vor, auf das Angebot aus dem Norden einzugehen: Es muß also gehandelt werden – und zwar rasch. Tatsächlich gelingt es Erzherzog Rudolph sowie den Fürsten Lobkowitz und Kinsky, den Wankelmütigen von dem fatalen Schritt abzuhalten und weiterhin an seine Wahlheimat zu binden. Am 1. März 1809 wird der entsprechende Vertrag unterzeichnet: Er sieht – »auf Lebenslänge« – die Zahlung einer Jahresrente von 4000 Gulden vor; Beethoven spekuliert außerdem auf Stellung und Titel eines kaiserlichen Kapellmeisters.
Unter den Freunden, die sich sogleich ans Werk machen, für Beethovens Verbleib in Wien die nötigen Konzepte zu erstellen, tun sich in erster Linie Gräfin Anna Marie Erdödy, die ihn gegenwärtig im Pasqualati-Haus auf der Mölkerbastei beherbergt, der Cellist Nikolaus von Zmeskall und ganz besonders Ignaz Freiherr von Gleichenstein hervor, letzterer übrigens unter ausdrücklichem Hinweis auf Beethovens »Patriotismus für sein zweites Vaterland«.
Gleichenstein, fast so etwas wie sein Sekretär, macht sich dem Meister schon seit Jahren nützlich, indem er ihn im Umgang mit den Verlegern berät, ihm die Geschäftskorrespondenz aufsetzt und überhaupt jede erdenkliche Gefälligkeit erweist. Der »liederliche Baron«, wie Beethoven ihn scherzweise nennt, sei zwar »kein Kenner von Musik, aber doch ein Freund alles Schönen und Guten«. Da ist es kein Wunder, daß er, dem selber so wenig Glück beschieden ist im Anknüpfen dauerhafter Beziehungen zum anderen Geschlecht, Freund Gleichenstein auch als Postillon d’amour einspannt. »Nun kannst Du mir helfen eine Frau suchen, wenn Du eine schöne findest, die vielleicht meinen Harmonien zuweilen einen Seufzer schenkt«, schreibt er ihm am 12. März 1809 nach Freiburg, wo sich Gleichenstein momentan aufhält, um auf seinen dortigen Besitzungen nach dem Rechten zu sehen.
Der acht Jahre Jüngere, ein ebenso lebhafter wie charmanter Mann, ist seit kurzem mit Nanette von Malfatti verlobt, einer der beiden Töchter des Gutsherrn Jakob Friedrich von Malfatti, der den Sommer über samt Familie auf seinen Besitzungen in Walkersdorf bei Krems residiert und nur die Wintermonate in Wien verbringt.
Mit den Malfattis, die ursprünglich in der Toskana beheimatet sind, pflegt auch Beethoven Umgang: Dr. Johann Malfatti, der jüngere Bruder des Genannten, ein hochangesehener Mediziner, der später unter anderem Erzherzogin Beatrix von Este und Erzherzog Carl zu seinen Patienten zählen, den kränkelnden Herzog von Reichstadt betreuen, die Wiener Medizinische Gesellschaft gründen, als Autor eines »Entwurfs einer Pathogenie« hervortreten und während des Wiener Kongresses eine wichtige gesellschaftliche Rolle spielen wird, ist seit 1808 auch Beethovens Leibarzt.
Ob es diese Verbindung ist oder aber Baron Gleichensteins bevorstehende Vermählung mit Nanette, was Beethoven auch privat den Zutritt zu den Malfattis eröffnet – gleichviel: Der Neununddreißigjährige macht zu Beginn des Jahres 1810 die Bekanntschaft von Nanettes Schwester Therese, erteilt der Talentierten wohl auch gelegentlich Klavierunterricht, und vor allem: Er verliebt sich in die 21 Jahre Jüngere. Von der Hofschauspielerin Antonie Adamberger als »eines der schönsten Mädchen von Wien« beschrieben, ist Therese ein kluges Persönchen von feurigem Temperament, eine brünette Erscheinung mit dunklen Augen und dunklem Teint, dem Charakter nach freilich auch »ein wenig flüchtig, alles im Leben leicht behandelnd«.
Als Gleichenstein im April 1810 ein Treffen mit seiner Braut Nanette, deren Schwester Therese und dem in letztere frisch verliebten Beethoven arrangiert, gibt dieser in einem Dankbillett an den Freund nicht nur seiner Vorfreude auf das gemeinsame Mahl im Praterlokal »Zum Wilden Mann« Ausdruck, sondern fügt ausdrücklich hinzu: »Dafür muß ich mich auch erst noch harnischen.« Beethoven, normalerweise sein Äußeres vernachlässigend, wirft sich also in Schale.
Noch ist es freilich nur die Musik, die den Meister mit seiner jugendlichen Schülerin verbindet: Die von ihr selbst begonnene Kopie des Mignon-Liedes wird von Beethoven vervollständigt und mit dem Begleittext versehen: »Die Verschönerungen der Fräulein Therese in diesem Lied hat der Autor gewagt, an das Tageslicht zu befördern.« Auch, daß er ihr eine eigene Komposition widmet (ebenjenes Klavierstück »Für Therese«, das später irrtümlich einer »Elise« zugeordnet werden wird), ist noch keineswegs als direkte Liebeserklärung anzusehen: »Albumblätter« wie dieses sind in jenen Tagen gang und gäbe. Der insgeheim Angebeteten offen seine Gefühle zu bekunden, fehlt es Beethoven an Mut. Da muß – wie so oft schon – wieder einmal Freund Gleichenstein einspringen.
Gänzlich untätig bleibt der Meister dennoch nicht: Beethoven erneuert seine Garderobe, schickt Gleichenstein einen ansehnlichen Geldbetrag, damit er ihm »Leinwand oder Bengalen für Hemden und wenigstens ein halbes Dutzend Halstücher« kaufe, bestellt bei einem der besten Schneider Wiens mehrere Anzüge, borgt sich von Freund Zmeskall, weil »der meinige gebrochen« ist, dessen Wandspiegel aus und schreibt seinem Jugendfreund Franz Gerhard Wegeler nach Koblenz, er möge »die Reise nach Bonn machen«, um ihm, »was nur immer für Unkosten dabei sind«, den Taufschein zu beschaffen. Mit einem Wort: Beethoven trifft – wohl zum erstenmal in seinem Leben – Hochzeitsvorbereitungen.
Die Familie Malfatti ist unterdessen – wie alljährlich um diese Zeit – von ihrem Wiener Winterquartier wieder aufs Land hinaus gezogen; Briefe nach Walkersdorf sind also nun die einzige Verbindung zu der Angebeteten. Ende Mai 1810 schreibt er ihr aus Wien:
»Ich lebe sehr einsam und still. Obschon hier oder da mich Lichter aufwecken möchten, so ist doch eine unausfüllbare Lücke, seit Sie alle fort von hier sind, in mir entstanden, worüber selbst meine Kunst, die mir sonst so getreu ist, noch keinen Triumph hat erhalten können.«
Umso heftiger seine Hoffnung, Therese bald nachreisen und ihr im Kreise der Ihren seine Aufwartung machen zu können: »Wie froh bin ich, einmal in Gebüschen, Wäldern, unter Bäumen, Kräutern, Felsen wandeln zu können. Kein Mensch kann das Land so lieben wie ich – geben doch Wälder, Bäume, Felsen den Widerhall, den der Mensch wünscht.«
Daß er sich diese »Glückseligkeit«, auf die er sich »kindlich freut«, nicht vor Juni verschaffen kann, liegt daran, daß Beethoven erst noch die Uraufführung seiner EgmontMusik am Hoftheater abwarten muß. Auch liegt noch keinerlei Einladung aus Walkersdorf vor, die wohl nur – man ist sehr standesbewußt im Hause Malfatti – von Thereses Eltern ausgesprochen werden kann. Zur Überbrückung der Wartezeit schickt er der Verehrten Noten:
»Vergessen Sie doch ja nicht in Ansehung Ihrer Beschäftigungen das Klavier oder überhaupt die Musik im ganzen genommen. Sie haben so schönes Talent dazu.«
Gleichzeitig kündigt er an, ihr in Bälde »einige andere Kompositionen von mir« zu schicken. Auch empfiehlt er Therese die Lektüre von Goethes »Wilhelm Meister« und des »von Schlegel übersetzten Shakespeare«. Um ihr nur ja nicht zur Last zu fallen, schränkt er ein:
»Vielleicht sehen Sie mich an einem frühen Morgen auf eine halbe Stunde bei Ihnen – und wieder fort. Sie sehen, daß ich Ihnen die kürzeste Langeweile bereiten will.«
Natürlich ist sich Beethoven darüber im klaren, daß er zur Realisierung seiner Wünsche nicht nur auf Thereses Gunst, sondern vielleicht noch mehr auf die ihrer Eltern angewiesen ist:
»Empfehlen Sie mich dem Wohlwollen Ihres Vaters, Ihrer Mutter, obschon ich mit Recht noch keinen Anspruch drauf machen kann.«
Auch in der Schlußformel des Briefes klingen Zweifel an, wenn nicht gar ein Anflug von Resignation:
»Leben Sie nun wohl, verehrte Therese. Ich wünsche Ihnen alles, was im Leben gut und schön ist. Erinnern Sie sich meiner und gern. Seien Sie überzeugt, niemand kann Ihr Leben froher, glücklicher wissen wollen als ich – und selbst dann, wenn Sie gar keinen Anteil nehmen an Ihrem ergebensten Diener und Freunde …«
Gleichzeitig schaltet er ein weiteres Mal Freund Gleichenstein ein; ihm schreibt er:
»Hier die Sonate, die ich der Therese versprochen. Da ich sie heute nicht sehen kann, so übergib sie ihr. Empfehl mich ihnen allen. Mir ist so wohl bei ihnen allen; es ist, als könnten die Wunden, wodurch mir böse Menschen die Seele zerrissen haben, durch sie geheilt werden. Ich danke Dir, guter Gleichenstein, daß Du mich dorthin gebracht hast.«
Doch der »gute Gleichenstein« scheint mit seiner Mission, in Beethovens Namen bei den Malfattis um die Hand ihrer Tochter Therese anzuhalten, zu scheitern. Beethovens nächster Brief an ihn drückt die ganze Verzweiflung aus, die die offensichtlich barsche Zurückweisung des Brautwerbers bei ihm ausgelöst hat:
»Deine Nachricht stürzte mich aus den Regionen des Glücks wieder tief herab. Ich kann also nur wieder in meinem eigenen Busen einen Anlehnungspunkt suchen. Nein, nichts als Wunden hat die Freundschaft und ihr ähnliche Gefühle für mich. So sei es denn! Für Dich, armer Beethoven, gibt es kein Glück von außen. Du mußt Dir alles in Dir selbst erschaffen, nur in der idealen Welt findest Du Freunde.«
Die Enttäuschung geht so tief, daß sie sogar Beethovens Beziehung zu Gleichenstein vorübergehend belastet. Und muß es ihn nicht tatsächlich doppelt schmerzen, daß das Glück, das ihm selber versagt bleibt, umso ungetrübter dem Freund zuteil wird? Zwar zieht sich auch dessen Verlobungszeit länger hin als gewünscht, aber im Jahr darauf ist es dann doch so weit, daß Baron Ignaz von Gleichenstein endlich mit Thereses Schwester Nanette vor den Traualtar treten kann. Therese selber muß noch fünf Jahre warten, bis die Eltern in eine Eheschließung ihrer Erstgeborenen einwilligen: Sie heiratet 1816 den Hofrat Baron Johann Wilhelm von Drosdick. Ihren abgewiesenen Brautwerber Beethoven überlebt sie um 24 Jahre; am 27. April 1851 stirbt sie sechzigjährig in Wien.
Geierwally wider Willen
Die Malerin Anna Stainer-Knittel
Am 22. Juni 1863 erscheint in der »Tiroler Volks- und Schützenzeitung« ein Bericht »aus dem Lechthale«; sein Wortlaut:
»Die vaterländische Künstlerin Anna Knittel von Untergiblen, deren Leistungen als Malerin bereits rühmend erwähnt worden sind, hat jüngst ein gefährliches Jagdabenteuer bestanden, ein Abenteuer, in welches sonst nur kühne Jäger sich einzulassen gewohnt sind. Am 11. Juni morgens holte nämlich dieselbe einen jungen Steinadler aus dem Horste einer wohl 90 Klafter hohen überragenden Felswand auf der Alpe Sax. Glücklich hatte sie des Adlers Nest erreicht und war schon mehrere Klafter an dem Seile, an welchem sie über die Felswand hinabgelassen worden war, in die Höhe gezogen, als sich ein ungeheures Felsstück, an das sie mit dem Fuße stieß, plötzlich ablöste und mit furchtbarem Getöse in den Abgrund stürzte. Glücklicherweise wurde die kühn in der Luft schwebende Adlerjägerin vom abgelösten Gestein nur am rechten Arme leicht verletzt und erreichte sonst wohlbehalten mit ihrer Beute den festen Boden. Jetzt ist sie wieder vollkommen hergestellt und lebt in künstlerischer Thätigkeit, von welcher wir demnächst die Vollendung eines trefflichen Stückes erwarten können.«
Das »treffliche Stück«, das die dreiundzwanzigjährige Volksmalerin aus dem Tiroler Oberland in Arbeit hat, kann ebensogut eine ländliche Szene wie ein Familienporträt oder eine jener Berglandschaften sein, für die sie seit einiger Zeit in ihrem Heimatort Elbigenalp bekannt ist. Auch im Jahr darauf verbringt Anna Knittel so manchen Tag vor ihrer Staffelei, und diesmal ist es sie selbst, die sie mit Pinsel und Palette in einem 174 mal 123 Zentimeter großen Ölbild festhält: In Erinnerung an ihr Bravourstück vom vergangenen Sommer zaubert Nanno, wie sie von ihrer Familie gerufen wird, ihr waghalsiges Abenteuer mit dem aus seinem Nest »entführten« Adlerjungen auf die Leinwand.
Unsere Künstlerin ist selig vor Glück, wenn sich für ihre Werke Käufer finden. Noch mehr als der Erlös freut sie nämlich die Anerkennung, die sich darin ausdrückt: Professionelles Malen ist zu dieser Zeit eine Domäne der Männer, die Frau hat ihren Platz am Küchenherd und im Kindbett. Daß Anna Knittel mit ihrer Kunst Anklang findet, ja sogar gute Geschäfte macht, erfüllt sie also mit Stolz. Dieses ihrer Ölgemälde, im Sommer 1864 entstanden, gibt sie allerdings nicht aus der Hand: Es bleibt ihr persönlichstes Eigentum. Und auch, als sie einige Jahre später, als jungverheiratete Frau nunmehr in Innsbruck ansässig, das »Adlerbild« im Schaufenster ihres Mannes, des Gipsfigurenformers und Andenkenhändlers Engelbert Stainer, ausstellt, denkt sie keinen Augenblick an Verkauf: Es soll nur als Blickfang dienen, soll Laufkunden in den Laden locken.
Eine, die solcherart auf die Kunst der nunmehrigen Anna Stainer-Knittel aufmerksam, ja vom Anblick der dramatischen Szene des von Frauenhand aus dem Felsnest geholten Jungadlers zutiefst aufgewühlt wird, daraufhin Erkundigungen nach dem realen Hintergrund des Motivs anstellt und schließlich aus dem Munde der Heldin selber von deren lebensgefährlicher Aktion erfährt, ist die Münchner Romanautorin Wilhelmine von Hillern. Die vier Jahre Ältere, die es als Touristin häufig nach Tirol zieht, weilt wieder einmal für ein paar Tage in Innsbruck; blitzschnell erkennt sie, daß in der Geschichte der Adlerjägerin Anna Stainer-Knittel ein Romanstoff von enormer Brisanz schlummert. Schon ihre Bücher »Doppelleben«, »Ein Arzt der Seele« und »Aus eigener Kraft« haben mehrere Auflagen erlebt; um wieviel mehr noch müßte da das schaurig-schöne Drama von der Bergmaid, die mit ihrem Mut selbst die kühnsten Mannskerle aussticht, bei ihren Leserinnen einschlagen!
Wilhelmine von Hillern, als Schriftstellerin an der Seite eines badischen Gerichtspräsidenten und Kammerherrn selber ein frühes Beispiel geglückter weiblicher Emanzipation, versteht sich auf ihr Metier: In dichterischer Freiheit macht sie aus dem Adler einen Geier und aus der Anna eine Wally, auch die näheren Lebensumstände des Prototyps verändert sie nach ihren Vorstellungen, und aus dem zu dieser Zeit noch touristisch unentdeckten Lechtal verlegt sie den Ort der Handlung ins bekanntere Ötztal. 1875 erscheint »Die Geier-Wally« erstmals als Fortsetzungsroman in der »Deutschen Rundschau«, die auch Größen wie Theodor Storm, Theodor Fontane und Gottfried Keller zu ihren Mitarbeitern zählt. Damit wird zugleich der Weg frei für die Buchfassung: Wilhelmine von Hillerns Heimatroman aus den österreichischen Bergen wird ein Langzeiterfolg, dem Übersetzungen in mehrere Fremdsprachen sowie eine von der Autorin selbst angefertigte Bühnenversion folgen, die ihrerseits bald zum Standardprogramm aller Tiroler Volksbühnen zählt.
Spätestens im Jänner 1892, als die »Geier-Wally« unter dem Namen »La Wally« auch die Opernbühne erobert, steht fest, daß sich die Geschichte der Lechtalerin Anna Stainer-Knit-tel zur weit über den Originalschauplatz Tirol hinaus verbreiteten Legende, ja zum Mythos verselbständigt hat: Der im Sommer 1888 von der Mailänder Zeitschrift »La Perseveranza« abgedruckte Fortsetzungsroman »La Wally dell’ Avvoltoio« hat den vierunddreißigjährigen, aus dem toskanischen Lucca stammenden Komponisten Alfredo Catalani auf die Idee gebracht, den brisanten Stoff zu vertonen. Luigi Illica, bald auch einer der geschätztesten Librettisten Giacomo Puccinis, schreibt das Textbuch, Bühnenausstatter und Kostümbildner reisen, um der Inszenierung ein Höchstmaß an »verismo« zu verleihen, zu einem Lokalaugenschein in die Tiroler Berge, und kein Geringerer als Arturo Toscanini studiert die Musik ein: Die Uraufführung am Opernhaus von Turin wird ein triumphaler Erfolg. Noch 1968, sechsundsiebzig Jahre nach der Entstehung des Werkes, nehmen Renata Tebaldi und Mario del Monaco »La Wally« auf Schallplatte auf, und auch die Wiederentdeckung der im deutschen Sprachraum lange vergessenen Catalani-Oper (bei den Bregenzer Festspielen des Jahres 1990) geht dem Publikum unter die Haut. Daß sie es dabei mit einer trotz aller künstlerischen Verfremdung »wahren« Geschichte zu tun haben, erfahren die Zuschauer, denen Wilhelmine von Hillerns Romanbestseller von 1875 kein Begriff mehr ist, erst aus dem Programmheft.
Nur ihre Eltern oder Großeltern würden sich vielleicht an zwei Kinofilme aus den Jahren 1921 bzw. 1940 erinnern, die beide – und ebenfalls mit durchschlagendem Erfolg – die Geierwally-Story nacherzählt haben: ersterer, noch ohne Sprechton, mit Henny Porten in der Hauptrolle, letzterer mit der einundzwanzigjährigen Heidemarie Hatheyer, für die die Verkörperung der Titelfigur der Durchbruch zur Starkarriere ist. Die gebürtige Villacherin, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf den renommiertesten deutschen und Schweizer Bühnen Furore machen, zeitweilig dem Ensemble des Wiener Burgtheaters angehören und eine der »Jedermann«-Buhlschaften der Salzburger Festspiele sein wird, legt sich bei den Dreharbeiten im Ötztal, bei denen Mitglieder der berühmten Tiroler Exlbühne sowie eine große Zahl von Laiendarstellern mitwirken, so sehr ins Zeug, daß sie sich nachher, um sich von den mehrmonatigen Strapazen bei Kälte, Schnee und Sturm zu erholen, in Sanatoriumspflege begeben muß.
Daß die Figur der Geierwally auch in Zukunft durch die Köpfe der Drehbuchautoren und Bühnenschriftsteller geistern wird, beweisen das Kino-Remake von 1956, für das Barbara Rütting vor die Kamera geholt wird, sowie zwei neuere Theaterfassungen, für die der Tiroler Felix Mitterer und der Steirer Reinhard P. Gruber verantwortlich zeichnen. Sogar die moderne Tourismuswerbung greift bei ihrem Bemühen, Tirol als »starkes Land« darzustellen, eines Tages auf das bewährte Motiv zurück.
Bei so vielfältiger Ausschlachtung des Geierwally-Themas ist es kein Wunder, daß sich die Kopien mehr und mehr vom Original entfernen, ja das eigentliche Urbild der Figur bald kaum noch zu erkennen ist. Anna Stainer-Knittel, die ein Alter von knapp 75 erreicht, also noch zu Lebzeiten – zumindest teilweise – Zeuge ihrer ausschweifenden medialen Nutzung wird, mag sich darüber ihre eigenen Gedanken gemacht haben, und vielleicht findet sich manches davon sogar in ihren Lebenserinnerungen wieder, die sie auf Drängen ihrer Familie handschriftlich niedergelegt hat. Eines jedenfalls steht fest: Das Abenteuer mit dem ausgehobenen Adlernest in der wenige Kilometer von ihrem Heimatort entfernten Saxenwand, das so viele Schriftsteller und Filmleute, ja sogar einen Opernkomponisten um den Schlaf gebracht hat, ist für sie selber nicht viel mehr als eine Episode. Anna Stainer-Knittel sieht sich am Ende ihrer Tage – sie stirbt am 28. Februar 1915 in dem Inntaler Industrieort Wattens – keineswegs als jene heroische Amazone, die dem starken Geschlecht vorexerziert, wie man die Jungtiere der bergbäuerlichen Schafherden davor schützt, von Raubvögeln »gerissen« zu werden, sondern einzig und allein als Kunstmalerin, die es mit ihren Landschaftsbildern, ihren Porträts und ihren Blumenstilleben zu einigem Erfolg gebracht, ja mit den Erlösen aus ihrer Kunst sogar wesentlich zum Lebensunterhalt ihrer mehrköpfigen Familie beigetragen hat.
Das Zeichnen »nach der Natur« ist schon in jüngsten Jahren eine von »Nannos« Lieblingsbeschäftigungen. Während ihre Geschwister der Mutter beim Kochen und Backen und dem Vater bei der Feldarbeit und beim Stallausmisten zur Hand gehen, zieht sich die am 28. Juli 1840 als Tochter des Lechtaler Büchsenmachers Joseph Anton Knittel Geborene schon als Schulmädchen mit Zeichenblock und Feder in die versteckten Winkel des Hauses zurück, um sich ganz dem »Bilderlmalen« hinzugeben. Immerhin sind die Eltern verständnisvoll genug, die Heranwachsende in die Zeichenschule des im Nachbarort wirkenden Lithographen Anton Falger zu schicken, und der ist es, der das außergewöhnliche Talent seines bald zur Lieblingsschülerin avancierenden Schützlings erkennt und Anna zwecks weiterer Vervollkommnung zu einem Studium an der Münchner Akademie der Bildenden Künste rät.
Das ist allerdings leichter gesagt als getan: Musentempel wie dieser sind um 1859 (dem Jahr, da Anna aus ihrem Tiroler Bergdorf in die bayerische Landeshauptstadt zieht) dem weiblichen Geschlecht noch verschlossen; der Neunzehnjährigen bleibt nichts anderes übrig, als in der »Vorschule« der Akademie noch einmal ganz von vorne anzufangen – und das »als einziges Frauenzimmer unter lauter Herren«. Da aber insbesondere ihre Porträtmalerei schon zu dieser Zeit einen Höchstgrad an Reife erreicht hat, ist Anna Knittel, als sie vier Jahre darauf in die Heimat zurückkehrt, eine gefragte Künstlerin, der es nicht an ehrenvollen Aufträgen mangelt: Das Ferdinandeum, die führende Kunstsammlung Tirols, kauft eines ihrer Selbstbildnisse an, und die Innsbrucker Schützengilde bestellt bei ihr großformatige Porträts von Erzherzog Karl Ludwig und Generalfeldmarschall Radetzky. In ihrer Münchner Zeit noch von der Hand in den Mund lebend, steht sie nunmehr auf eigenen Beinen, und als sie weitere vier Jahre später – gegen den Willen des Vaters – den Gipsformer Engelbert Stainer ehelicht, geht es der inzwischen Siebenundzwanzigjährigen keineswegs um Versorgung: Es ist eine Liebesheirat (und wird eine Liebesheirat bleiben bis ans Ende ihrer Tage).
Die Porträtfotos aus dieser Zeit zeigen eine selbstbewußte junge Frau, deren Kurzhaarschnitt einer ungeheuerlichen Provokation gleichkommt. Nur, als sie darangeht, an ihrem nunmehrigen Wohnsitz Innsbruck eine Zeichen- und Malschule ins Leben zu rufen, stößt Anna Stainer-Knittel an die Grenzen ihres emanzipatorischen Eifers: An ihren Kursen dürfen ausschließlich weibliche Schüler teilnehmen.
Ein weiteres Problem, das ihre künstlerische Bewegungsfreiheit einengt, rührt vom nunmehrigen Aufkommen der Photographie: Statt dem Porträtmaler Modell zu sitzen, gebietet es die Zeitmode, sich im Atelier des Photographen ablichten zu lassen. Auch für eine Könnerin wie Anna Stainer-Knittel werden die einschlägigen Aufträge also rarer und rarer. Der Ausweg, den sie aus der neuen Situation sucht und findet, erweist sich allerdings als glückliche Fügung: Sie sattelt auf Blumenmalerei um und gewinnt auf diesem Gebiet – Motto: »Ein Blumenstrauß, der nie verwelkt!« – nicht nur neue Kundschaft, sondern ungeahnte Popularität.
Einmal – es ist um die Jahreswende 1870/71 – kommt es allerdings doch noch zu einem spektakulären Porträtauftrag: Kaiser Franz Joseph will – auf dem Weg von Wien nach Meran, wo ein Kurzbesuch bei Kaiserin Elisabeth und Töchterchen Valerie ansteht – einen Zwischenaufenthalt in Innsbruck einlegen. Die Schützen und Jäger der Tiroler Landeshauptstadt rüsten zu einem Festabend für Seine Majestät, die Redoutensäle werden mit Tannengrün, Geweihen und Jagdgerät geschmückt. Jetzt braucht man nur noch ein repräsentatives Konterfei des hohen Gastes: Anna Stainer-Knittel wird aufgefordert, binnen weniger Tage ein lebensgroßes Porträt des Kaisers anzufertigen. Als Vorlage dient ihr ein Stich des Wiener Hofmalers Franz Schrotzberg. Das 240 mal 170 Zentimeter große Ölbild wird nicht nur angemessen honoriert, sondern allseits gewürdigt, und was für die kaisertreue Künstlerin vielleicht der höchste Lohn ist: Anna Stainer-Knittel, in ihr schönstes Trachtengewand gehüllt, wird Franz Joseph I. vorgestellt. Auch er spart nicht mit Lob für das wohlgelungene Werk und fragt die Dreißigjährige, ob sie denn öfter zu Pinsel und Palette greife. Ihre selbstbewußte Antwort: »Sehr wohl, Majestät. Malen ist mein Beruf.«
Andere, die dies längst erkannt haben, sorgen dafür, daß endlich auch das Ausland auf das Werk der Frau aus den Tiroler Bergen aufmerksam wird, und dafür bietet sich keine bessere Gelegenheit als die Wiener Weltausstellung von 1873: Das Bild »Rautenpflückende Lechtalerinnen« erhält nicht nur (übrigens in nächster Nachbarschaft von Makarts berühmtem Gemälde »Venedig huldigt Catarina Cornaro«) einen hervorragenden Platz im Wiener Künstlerhaus, sondern wird zum Spitzenpreis von 55 Gulden nach England verkauft. Um diesbezüglich keinen falschen Verdacht aufkommen zu lassen, sei in aller Klarheit festgestellt: Was beim Zustandekommen der genannten Transaktion den Ausschlag gibt, ist einzig und allein die Qualität des Bildes und keineswegs die Berühmtheit von Anna Stainer-Knittels Alter ego als »Adler-Bezwingerin«: Von einer »Geierwally« hat der aus London angereiste Käufer nie etwas gehört.
Rote Madonna
Die Volksbildnerin Emma Adler
Emma Adler – ist das nicht diese in jungen Jahren bildhübsche Person, die für die Madonna an der Altarwand der Pfarrkirche von Nußdorf am Attersee Modell gestanden ist?
Das ist sie auch. Aber eben nur auch. Es ist an der Zeit, sich um ein vollständigeres Bild dieser in vieler Hinsicht ungewöhnlichen Frau zu bemühen.
Fangen wir dennoch mit dieser Geschichte an. Sie ist es schließlich, die die Gattin des österreichischen Sozialistenführers Victor Adler berühmt gemacht hat, und eine schöne Geschichte ist es obendrein.
Seit 1879 sind die beiden miteinander verheiratet – sie ist zu dieser Zeit zwanzig, er sieben Jahre älter.
Ab 1886 reist die Familie regelmäßig in das kleine Salzkammergutdorf Parschallen zur Sommerfrische. Besonders die Kinder genießen die Freuden des Landlebens. Da die Adlers aber einen großen Freundeskreis haben, mit dem man sich auch während der Ferien trifft, muß Frau Emmas Haushalt stets für Gäste gerüstet sein, die anständig zu bewirten sind. Das ist im kleinen Parschallen, das zu dieser Zeit nur aus fünf einfachen Bauernhöfen besteht, nicht ganz leicht. »Weit und breit«, so wird Emma Adler später in ihren tagebuchartig angelegten Erinnerungen festhalten, »war nichts zu bekommen. Im Ort selbst wuchs außer Getreide nichts – nur ein paar armselige Zwetschkenbäume, die wenig Früchte abwarfen. So schickten wir vor unserer Abreise aufs Land Fässer und Kisten voraus, die mit Kolonialwaren gefüllt waren.«
Die frischen Lebensmittel holt man sich vom Greißler im drei Kilometer entfernten Nachbarort Nußdorf. Ist es ein größerer Transport, so rückt der Hausherr persönlich aus, schnallt sich den Rucksack über und kehrt schwerbepackt heim. Kleinere Lasten übernimmt seine Frau. Und bei einem dieser Einkaufsgänge – es ist im Sommer 1887 – wird Emma Adler, die ihrer Attraktivität wegen auch von den Einheimischen geachtete Achtundzwanzigjährige, von einem Fremden angesprochen, der sich als akademischer Maler zu erkennen gibt und gerade den Auftrag erhalten hat, für die Nußdorfer Kirche ein neues Marienbild anzufertigen. Für den Jesusknaben hat er unter den Dorfkindern unschwer das geeignete Modell gefunden, jetzt braucht er bloß noch eine Madonna. Ob sie, die schöne Fremde, vielleicht so freundlich wäre, ihm für ein paar Porträtsitzungen zur Verfügung zu stehen?
Emma Adler, einerseits geschmeichelt, andererseits – als bekennende Jüdin und Sozialistin – voller Zweifel, ob sie recht daran tue, auf ein solches Angebot einzugehen, bittet um Bedenkzeit und bespricht die Angelegenheit mit ihrem Mann. Victor Adler, der sich seinerseits nach der Heirat hat taufen und auch die Kinder in die protestantische Kirche hat aufnehmen lassen, um ihnen »die blödsinnigen Scherereien zu ersparen, die in Österreich Konfessionslosigkeit herbeiführt«, hat keine Bedenken, und so kann Meister Emanuel Oberhauser – so der Name des Künstlers – ans Werk gehen und sein Marienbild malen: mit Emma Adler als Modell.
Anders denken darüber die strenggläubigen Einheimischen; Emma Adler berichtet in ihren autobiographischen Aufzeichnungen:
»Als das fertige Bild den Altar schmückte, waren die Bauern entrüstet und riefen: ›Des is’ ja d’ Adlerin und nit an Eichtel die Muttergottes!‹«
Heute, 117 Jahre nach dem unerhörten »Frevel«, eine Andersgläubige und obendrein Exponentin der »linken Reichshälfte« für eine katholische Devotionalie einzuspannen, hat die seinerzeitige Affäre nur noch Kuriositätswert, und diejenigen, die davon wissen, versäumen bei ihrem Attersee-Aufenthalt nicht, der Nußdorfer Pfarrkirche einen Besuch abzustatten und den »Stein des Anstoßes«, der nach wie vor seinen angestammten Platz an der Wand des linken Seitenaltars einnimmt, zu bestaunen.
Wer sich damit nicht begnügt, sondern mehr über Emma Adler wissen will, ist auf die einschlägigen Bibliotheken angewiesen, und siehe da, er wird Leben und Werk einer Frau kennenlernen, die es in der Tat wert ist, der Vergessenheit entrissen zu werden …
Im ungarischen Debrecen, das sowohl während der Revolution von 1848/49 wie auch nach dem Einmarsch der Sowjets 1944/45 vorübergehend Regierungssitz (und geschichtlich Uninteressierten zumindest durch eine nach ihm benannte, auch in Österreich populäre Wurstsorte vertraut) ist, kommt Emma Braun 1859 zur Welt. Der Vater ist im Eisenbahnbau tätig; ein Muster an Disziplin und Ehrgeiz, findet man ihn während der warmen Jahreszeit schon um 4 Uhr morgens an seinem Arbeitsplatz, wo er die Errichtung der wichtigen Bahnstrecke nach Budapest beaufsichtigt. Auch von seinen sieben Kindern erwartet der Herrisch-Strenge überdurchschnittlichen Fleiß.
Sohn Heinrich, Emmas Lieblingsbruder, wird es später bis zum führenden Publizisten der deutschen Sozialdemokratie bringen; einer seiner Mitschüler am Akademischen Gymnasium in Wien ist Sigmund Freud. Und er, Heinrich Braun, ist es auch, der Emmas Ehe »stiftet«: Nur zwei Männer, so sagt er, seien seiner ebenso schönen wie klugen Schwester würdig – Friedrich Nietzsche und Victor Adler. Daß es letzterer ist, der das »Rennen« macht, hat Bruder Heinrich eingefädelt: Der Prager Millionärssohn und nunmehrige Jungarzt für Neurologie Victor Adler, sieben Jahre älter als Emma, lernt seine künftige Frau beim gemeinsamen Musizieren kennen. Sie sitzt am Klavier und spielt Beethoven, er blättert die Noten um. Auch Goethe ist ein Thema, das die beiden jungen Menschen miteinander verbindet. 1878 wird geheiratet.
Als sich Victor Adler der Politik zuwendet, wird Emma seine engste und eifrigste Mitstreiterin. Während er sein gesamtes elterliches Erbe in die noch junge Arbeiterbewegung steckt, nimmt sie, die gleichfalls aus wohlhabenden Verhältnissen kommt, jedwede Entbehrung auf sich, um dem von ihrem Mann vorgegebenen Ziel zu dienen: Als am 1. Mai 1890 die Wiener Arbeiter zum Mai-Aufmarsch in den Prater strömen, steckt sie ihre Kinder ins Bett und schließt sich dem Demonstrationszug an.
Umfassend gebildet und in mehreren Fremdsprachen sattelfest, macht sich Emma Adler mit Vorträgen und Sprachkursen im »Arbeiter-Bildungsverein« nützlich. Außerdem redigiert sie die Jugendbeilage der »Arbeiter-Zeitung«, gibt Sammelwerke wie »Bücher der Jugend« heraus, übersetzt englische, italienische und russische Belletristik ins Deutsche, schreibt Abhandlungen über »Die Frauen der Großen Französischen Revolution« und über »Goethe und die Frau von Stein«. Auch ihre Erfahrungen mit dem Armeleuteleben der Attersee-Bauern, das sie während des alljährlichen Urlaubs im kleinen Parschallen kennengelernt hat, finden ihren Niederschlag in einer ihrer zahlreichen Veröffentlichungen: Emma Adlers Studie »Bauerndasein« erscheint 1898 im österreichischen »Arbeiter-Kalender«.
Schon zuvor hat sie in einem Aufruf die Werktätigen ihres Landes dazu animiert, zur Feder zu greifen und über ihr Leben zu berichten. »Es wird die Leser«, so schreibt sie im Vorwort des auf diese Weise zustandekommenden Sammelbandes, »gewiß interessieren, zu erfahren, wie Leute, die schon in frühester Kindheit den Kampf ums Dasein aufnehmen mußten und nicht einmal die geringe Schulbildung der heutigen Proletarierjugend genossen haben, es dazu gebracht haben, ihre Gedanken so frisch mitzuteilen, daß diese Beiträge zu den besten des Buches gehören.« Eine Spinnerin, ein Schneider, ein Weber und ein Glasschleifer debütieren unter ihrer Anleitung als Autoren.
Nur ihre eigenen Probleme behält Emma Adler für sich: Als Marie, eines ihrer drei Kinder aus der Ehe mit Victor Adler, zum Dauerfall für die Psychiatrie wird, verfällt auch sie in schwerste Depressionen. Zwei Selbstmordversuche sind die Folge: Seit dem 11. November 1918 Witwe, will sich die auch über die Gewalttat ihres Sohnes Friedrich Verzweifelte (der am 21. Oktober 1916 aus Protest gegen dessen Kriegspolitik den amtierenden Ministerpräsidenten Graf Stürkh erschossen hat) aus dem Fenster stürzen.
Gleichwohl wird sie ihren Lebensabend – Emma Adler stirbt am 23. Februar 1935 im Alter von 75 Jahren – an der Seite ihres Sohnes im Schweizer Exil zubringen: Der zum Tod verurteilte Friedrich Adler ist nach dem Zusammenbruch der Habsburger-Monarchie amnestiert worden und hat sich als Sekretär der Sozialistischen Internationale in Zürich niedergelassen.
In ihrem Testament äußert Emma Adler die Befürchtung, sie könnte als Gattin des prominenten Politikers Victor Adler nach ihrem eigenen Hinscheiden ebenfalls »in Wort und Schrift verherrlicht«, ja mit »Tugenden und Talenten« ausgestattet werden, die sie »nie besessen« habe. Um dies zu vermeiden, verfüge sie, »in Ruhe und wortlos der Erde übergeben zu werden«. Ihrem Wunsch wird entsprochen: Die Beisetzung auf dem Zürcher Friedhof Rehalp findet in aller Stille statt.
Keine Feministin wie jede andere
Die Schriftstellerin Sir Galahad alias Bertha Eckstein-Diener
Sir Galahad, so weiß jeder, der beim Thema Artus-Sage gut aufgepaßt hat, ist jener makellose Gralsritter, den Lancelot mit seiner Elaine gezeugt hat: eine Art englisches Gegenstück zu »unserem« Parsifal. Schwer vorstellbar, daß diese mythische Lichtgestalt zur Feder gegriffen und eigene Werke hinterlassen haben sollte. Ist er nicht überhaupt nur eine mittelalterliche Phantasiefigur, von der keinerlei reale Lebensdaten überliefert sind? Und doch: Jedem einigermaßen bewanderten Buchhändler ist der wohlklingende Name geläufig, und der Kollege von der Antiquariatsabteilung wird dem Kunden vielleicht sogar eine ganze Reihe von Titeln vorlegen, die Sir Galahad zum Autor haben – zumindest den Longseller »Mütter und Amazonen«. Des Rätsels Lösung: Sir Galahad ist ein Pseudonym. Ein Pseudonym, hinter dem sich übrigens kein Sir verbirgt, sondern – eine Lady. Ihr wirklicher Name: Bertha Eckstein. Oder, wenn man ihren Mädchennamen vorzieht, Bertha Diener.
Zum erstenmal taucht der Name Sir Galahad anno 1910 auf dem Buchmarkt auf, als die geheimnisvolle Autorin eine deutsche Übersetzung der Schriften des amerikanischen Essayisten Prentice Mulford vorlegt. »Der Unfug des Lebens und des Sterbens« ist eine originelle Kombination von neuplatonischer Philosophie und witziger Zivilisationskritik: genau das Richtige für die sechsunddreißigjährige Wienerin, deren ganzes Interesse der vergleichenden Kulturgeschichte gilt. Drei Jahre darauf debütiert sie mit ihrem ersten eigenen Werk: »Im Palast des Monos« ist eine romanhafte Aufarbeitung der kretischen Ausgrabungen des berühmten englischen Archäologen Sir Arthur Evans. Es folgen 1920 die autobiographischen Aufzeichnungen »Die Kegelschnitte Gottes«, 1925 ein mit Größen wie Dostojewski und Tolstoi rabiat abrechnender »Idiotenführer durch die russische Literatur« und schließlich 1932 ihr Hauptwerk »Mütter und Amazonen«.