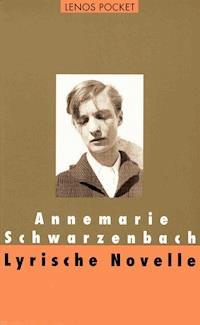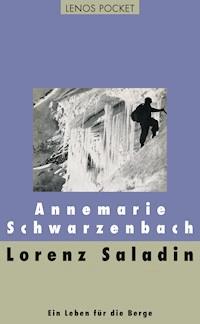Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kampa Pocket
- Sprache: Deutsch
Drückend heiß ist es im Sommer in Teheran, und so flieht die Erzählerin gemeinsam mit einigen Freunden hinaus in die Hochebene. Sie war schon immer auf der Flucht, auf der Flucht vor der bürgerlichen Gesellschaft und einer Existenz, die sie als einengend empfand. Seit Jahren reist sie um die Welt - auf der Suche nach ihrer eigenen Identität. Doch in der fremden, stillen Landschaft Persiens holt sie die Trauer ein. Sie ist nicht allein und doch schrecklich einsam. Nachts kann sie nicht schlafen, fühlt sich ausgeliefert, der Freiheit, die sie doch immer angestrebt hat, nicht gewachsen. Sie will ihre Vergangenheit, ihre Kindheit in der Schweiz vergessen, und sehnt sich doch danach zurück. In ihrem stark autographisch gefärbtem Roman, erstmals 1939 erschienen, beleuchtet Annemarie Schwarzenbach die Abgründe und Widersprüche ihres eigenen Lebens. Gegenwart und Vergangenheit, Traum und Wirklichkeit vermengen sich in diesem herzzerreißenden, hochlyrischen Buch, das heute als moderner Klassiker der deutschsprachigen Literatur gefeiert wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Annemarie Schwarzenbach
Das glückliche Tal
Kampa
1
Unsere Zelte stehen auf einer Grasbank am Ufer des Lahr-Flusses. Der Talboden liegt zweitausendfünfhundert Meter über Meer – noch dreißig Meter höher, wenn man vom Spiegel des Kaspischen Meeres aus rechnet, welches uns viel näher ist als der Persische Golf. Zweitausendfünfhundert Meter – das klingt schon beträchtlich, aber in Wirklichkeit bedeutet es wenig; denn ringsum sehen wir Berge und Ketten, die unser Tal mächtig überragen. Es sind graue Höhenzüge, zum Teil mit steil emporsteigenden Felswänden, aus brüchigem, wild zerrissenem Gestein, zum Teil lange, sanft hingelagerte Halden. Steht man irgendwo in der Mitte einer solchen Halde – und wir gehen nicht selten hinauf, um die Steinböcke zu beobachten, oder einfach, um dem dumpfen Schlaf unter dem Zeltdach zu entfliehen –, dann kann man deutlich das unaufhörliche Rieseln des Gerölls hören. Dieses monotone, sehr leise Rieseln ist das einzige Geräusch in der Einöde, außer dem Brausen eines unsichtbaren Windes, der in weiter Ferne über die Kämme streichen muss, oder gar über die heiße Ebene, tief unten, die durch eine ganze Reihe namenloser Pässe und Saumpfade von unserem Tal getrennt ist. Ich kenne kein unerträglicheres Geräusch als das nie versiegende Rieseln der großen Halden, ja, es übertrifft an Schrecklichkeit sogar das nächtliche Dröhnen der Karawanenglocken in der Ebene, dem ich hier glücklich entflohen bin. Im Sommer bringen die Karawanen den heißen Tag in einer Stadt oder in einem Khan zu und brechen erst mit der Dämmerung auf, wenn der Wind ein wenig kühler wird. Da ich mehrere Monate in einer Baracke gewohnt habe, die nur durch eine Gartenmauer aus Lehm von der alten Karawanenspur zwischen Teheran und Veramin getrennt war, hörte ich das dumpfe Dröhnen der Glocken, die heiseren Schreie der Treiber und die kleine, hell bimmelnde Glocke am Hals des Leitesels jeden Abend, und noch bis in den Traum hinein – trotzdem konnte ich mich nie daran gewöhnen. Hier oben habe ich sozusagen meine ungestörte Nachtruhe; denn Kamele ziehen selten durch dieses Tal und gewiss nicht des Nachts, wenn schneidende Kälte herrscht. Aber es gibt auch andere Geräusche. Manchmal ängstigt mich das rasche, eilige Gurgeln des Flusswassers, das sich unter den Uferbänken hindurchwindet, über Kiesel stolpert – und ich meine sogar, die verzweifelten Luftsprünge von Forellen zu hören. Oder der Wind wird stärker, dieser fürchterliche Höhenwind, der noch den Staubgeruch der verbrannten Ebene hierherauf trägt und in der Dunkelheit an den Seilen unserer Zelte reißt. Aber, wie gesagt, weitaus am schlimmsten ist das unaufhörliche Rieseln der großen Halden. Man sollte sich nie in das Geröll hinaufwagen. Man tut es doch immer wieder.
Und bleibt man dann stehen, einen Augenblick nur, um Atem zu schöpfen, dann meint man zuerst sein eigenes, rasch schlagendes Herz zu hören. Aber das ist schon verstummt, und was man immer noch hört – jetzt deutlich, unmissverständlich –, das sind die rieselnden Halden. Man sieht sich unwillkürlich um, als erwarte man Hilfe. Weithin ist, was man erblickt, nur die graue und dabei merkwürdig milde Einöde. Unten der Fluss – ein schmales Band – und die grünen Pferdeweiden, die weißen Zelte, gegenüber am anderen Ufer das Tschaikhane, niedrig, fast versteckt in der Mulde vor dem Anstieg des Afjé-Passes, der Rauch dringt aus der Türe und windet sich an der silbergrauen Felswand empor. Ein wenig flussabwärts die Zelte der Nomaden, aus schwarzem Ziegenfilz, davor die rot leuchtenden Röcke der Frauen und ihre blitzenden Kupferkessel. Alles so winzig wie Spielzeug, auch die Schafherden, auch die weidenden Pferde des Schahs. Der Fluss verschwindet hinter den Schwarzklippen – viel weiter sind wir auch beim Forellenfischen noch nicht gekommen. Aber das Lahr-Tal ist damit noch längst nicht zu Ende; wissen wir überhaupt, wohin es führt? Hinunter nach Mazanderan, in das Teufelsland am Kaspischen Meer, sagen die Nomaden. Mazanderan – wunderbar ist der Klang dieses Namens! Dort herrschen Dschungel, Urwald, Reisfelder, Wasserbüffel auf melancholischen Dünen, Feuchtigkeit, Malaria. In Gilan, der westlichen Nachbarprovinz, werden die Reisfelder auf Befehl des Schahs trockengelegt, und Chinesen lehren den Malaria-Bauern die schwierige Kunst der Teekultur. Der Tee von Gilan schmeckt nach Stroh, der Reis aus Mazanderan riecht nach getrocknetem Mist. In den kleinen Küstenstädten, in Pehlevi, in Meshed-i-Sehr, wohnen die russischen Kaviarfischer. Im Osten beginnen die Steppen, Weideplätze der pendinischen und Theke-Turkmenen, mit ihren roten und kamelhaarbraunen Teppichen, ihren bunten Zeltstreifen und Satteltaschen. Sie züchten die schönsten und schnellsten Pferde des Ostens. Ihre Buben, sechsjährig, achtjährig, reiten sie in den großen Steppenrennen, die im Herbst stattfinden. Im Hafen Krasnovodsk beginnt die russische Bahn, ein einsamer Schienenstrang, der durch die Steppe läuft: nach Merw, nach Buchara, Samarkand. Da sind wir schon nahe bei den lockenhaarigen Tadschiken, schon bald auf den Pamir-Höhen und an der Grenze des Himmelsgebirges. Oh, Magie der Namen! Oh, Städte Asiens, leuchtende Kuppeln über dem Niemandsland, oh, jähe Hoffnungen! Schlägt dein Herz wieder?
Am Talausgang – dort, wo wir seinen Ausgang vermuten – erhebt sich der glatte Kegel des Riesen, die unerreichbare, unberührbare Pyramide des Demawend: Sein Leib ist jetzt, im späten Sommer, gestreift wie der eines Zebras. Die Lava macht sich breit zwischen dem schmelzenden Schnee. Sein Haupt aber ist immer von strahlender Wolkenweiße und sendet selbst in der Nacht sein Licht aus, das wie die Milchstraße sanft den Himmel erhellt. Wir sind an seinen herrlichen Anblick gewöhnt – wie man sich in diesem Land gewöhnt an Ausblicke, Staub, Kamelglocken, Fieber, an den Ablauf der Stunden, an Morgen und Abend, und zu leben versucht, jeder, wie er es vermag. Und den Demawend sehen wir, wo immer wir uns hinwenden: wenn wir morgens das Zelt verlassen, wenn wir dem Fluss entlangwaten bis hinunter zu den Schwarzklippen, wenn wir stattdessen flussaufwärts gehen und den Graskessel erreichen, wo Kamele weiden und Ziegen und fettschwänzige Schafe.
Einmal bin ich zu einem Ruinenhügel geritten, der viele Stunden von hier entfernt in einem runden Talgrund liegt und noch von keinen Grabräubern, von keines Menschen Fuß berührt wurde. Den Nomaden bedeutet er nichts; denn kein Grashalm wächst auf seiner nackten, von einem wohl tausendjährigen Tod gezeichneten Oberfläche. Ich stieg hinauf, kehrte dem starken Wind den Rücken: Da erhob sich, in wunderbarer Ferne, wieder das weiße Haupt.
Heute ist es von einer leichten Wolke verhüllt – oder sind es Schwefeldämpfe? Aber der Krater ist längst erloschen. Selbst die Assyrer, welche berichteten, dass das fremde Volk der Meder sich bis zum Fuße des Bikni-Berges ausdehne, wussten nicht, dass es ein Feuer speiender Berg sei. Seit dreitausend Jahren schon ist er erloschen! Seit Menschengedenken!
Wie ich hinüberschaue zum Demawend, den ich aus langer Gewohnheit kenne und gewiss auch verehre, weil sein Haupt den Himmel berührt und sein Fuß unsichtbar ist, da vermischen sich meine Herzschläge wieder mit dem unaufhörlichen Rieseln. Ich werde ruhiger. Über mir heben die Felskämme zu glänzen an, die die Halden krönen, aller Schwere entblößt, und wenn mir auch nicht leicht zumute wird, so gewinnt doch das eben noch unerträgliche Geräusch die Qualität einer großen Stille.
Wir nennen dieses Tal manchmal »Ende der Welt«, weil es hoch über den Hochflächen der Welt liegt, weit von den begangenen Ebenenstraßen; keine Karawanenspur verbindet es auch nur mit der Wüste und den Toren ihrer Totenstädte Kerbela und Nejaf, wo es von geschäftigen Menschen wimmelt – Gebirgszüge ohne Ende trennen es vom Meer. Wohl trifft man da und dort auf einen Pfad; aber niemand außer den Nomaden weiß, wohin diese Pfade führen. Und es ist noch zu bezweifeln, ob die Nomaden es wissen, obwohl sie es sind, die im Lauf der Jahrhunderte die Spuren getreten haben; denn sie wandern geduldig mit ihren Herden und folgen den Jahreszeiten oder den Weideplätzen, bis der Kreislauf sich schließt und sie, in den ersten Tagen des Sommers, wieder hier eintreffen. Nein, sie kennen kein Ziel, und ihr Blick, wenn er über die Rücken ihrer Kamele streift und vielleicht weit darüber hinaus schon beim Demawend anlangt, ist von einer Ergebenheit, die Enge und Weite hinnimmt, von einer Geduld, die uns im Innersten erschreckt. Sie fürchten zweifellos den Tod nicht.
Sehen sie den Demawend? Erkennen sie, wie sein glatter Kegel den Talausgang versperrt? Merken sie nicht, dass er, wenn man versucht, ihm näher auf den schneegestreiften Leib zu rücken, sich sachte weghebt und entfernt wie der Mond?
Wahrscheinlich würden sie antworten: »Man kann seinen Fuß umgehen.«
Was liegt hinter seinem Fuß?
Sie würden den Kopf schütteln über eine solche Frage.
Man sagt, die Nomaden rauchen kein Opium. Wenn man drüben im kleinen Tschaikhane, wo die Männer um den Samowar sitzen, den süßlichen Opiumgeruch zu spüren glaubt, der die Erinnerung an die Khans der Karawanenstraßen und an die Teehäuser der Städte wachruft, so braucht man nur genauer hinzusehen: Auf den Lehmbänken neben dem Herd, in der dunkelsten Ecke, hockt ein Soldat, einer der Pferdehüter des Schahs, die Bluse offen, die Schuhe neben sich, und raucht. Es ist besser, nicht zu genau hinzuschauen. Der Wirt stellt sich in den Weg und murmelt: »Er ist krank.« Das sagt er zu uns, den Faranghi, den Fremden. Und ringsum Schweigen, die Männer saugen ihren Tee durch ein Stückchen Zucker und wenden nicht einmal den Kopf. Wir aber sollten uns hüten – schon werden Erinnerungen wach. Wir sollten die Gesichter der Opiumraucher meiden, und die süßlichen Gerüche – den des Tschaikhanes, und den des mit Staub aus der Ebene gesättigten Windes, und die heiseren Stimmen der persischen Soldaten, und die Wärme, die der Samowar ausströmt, und noch den Rauch der Holzkohle, der die Augen beizt – kurz, alles Lebendige, alles, was man früher gekannt hat, alles, was die Ferne wachruft.
Die Ferne existiert nicht; denn wir können nicht höher steigen, nicht hoch genug, um über unser Tal hinwegzublicken, und über die Felsen und Schutthänge, die es begrenzen. Einmal – es ist lange her – lehrte man uns, die Erdkarte zu lesen, da wimmelte es von Namen, von Meeren und Flüssen, von großen Straßen, welche die großen Städte miteinander verbinden. Man lehrte uns auch, wie viel Menschen in diesen Städten und in jedem Land leben, wie sie miteinander Handel treiben und Krieg führen, wie sie siegen und unterjochen und besiegt werden im Lauf der Jahrhunderte, und endlich lehrte man uns: »Sie leben heute noch.« Um die Mittagszeit schreien sie an der Börse von Paris und Wallstreet, spät in der Nacht drängen sie sich in den Basaren von Istanbul; am frühen Morgen herrscht geschäftiges Treiben in den Khans von Taschkent, und tagaus, tagein werden die Toten begraben. Woher die Beweise nehmen? Die Zeitungen, die Radiomeldungen durchkreuzen die Welt. Wer am Morgen in Zürich erwacht, weiß, wie viel Tote heute Nacht in Abessinien, in Barcelona, in Shansi. Auch die Börse funktioniert, wenn nicht zum Frieden auf Erden beitragend, so doch den Menschen zum Wohlgefallen.
Aber hier oben, im Tal am Ende der Welt, gibt es keine Zeitungen, und wir haben vergessen, ein Radio zu installieren. Ich für meinen Teil habe schon damals, als ich die Namen der Städte lernen musste, an ihrer Existenz gezweifelt. Ich dachte darüber nach und kam zu dem Schluss: Es ist wie im Kino. Da zeigt man uns auch, sehr schnell hintereinander, die Schauplätze und Kriegsschauplätze, und jemand, dessen glatt rasiertes Gesicht einen Augenblick auf die Leinwand geworfen wird, erklärt uns dazu: Der Sieger im Marathonlauf, gestern aufgenommen, die Gefangenen in China, soeben exekutiert, Kirschblüte in Japan und an der Donau, Einzug des Diktators, jubelnde Volksmassen, Friede auf Erden, zwei Arme greifen um den Erdball und reichen sich die Hand, obwohl die Kugel sich in rasender Geschwindigkeit dreht. – Was weiß jener Herr davon, der so geläufig spricht? – Frieren jetzt in dieser Minute irgendwo Soldaten in ihrem Biwak und putzen ihre Gewehre, um keinen Arrest zu bekommen? Wird gerade jetzt, in dieser Stunde, irgendwo eine Glocke geläutet? Gehen die Gefangenen im Kreis? – »Träum nicht«, sagte der Lehrer, »alles zu seiner Zeit, jetzt haben wir Erdkunde. In welchen Staaten gibt es Ölfelder?« Ich antwortete: »Mexiko, Rumänien, Oklahoma, Baku …« – »Baku ist kein Staat«, sagte der Herr Lehrer, und er hatte recht, und ich durfte mich setzen. Jetzt weiß ich besser Bescheid als er; denn ich war in Baku, und ich würde ihn fragen: »Wie war es doch, damals, mit Baku?«
Wie war es mit Baku …
An einem kalten Abend verließen wir den Kaviarhafen Pehlevi, die trostlose Küste Persiens, auf einem kleinen Dampfer, an dessen Heck eine verblasste, sturmzerfetzte rote Fahne wehte. Das Stampfen der Maschine, Dröhnen, Krachen, Klirren und Rollen verursachten mir schwere Träume. Am nächsten Morgen ging ich an Deck und sah die graue, bewegte Kaspi-See, den wehenden Nebel, den wolkenbestürmten Himmel, lastendes Grau und Leere, bis im Norden ein kahler Hügel aus den Wogen stieg, auf seinem Rücken kahle Bäume – ein schwarzer, offenbar verkohlter Wald. Der Kapitän klärte mich auf: die Öltürme von Baku …
Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Ich war in Baku und in vielen anderen Städten. Ich lernte herbe Enttäuschungen kennen. Ich träume nicht mehr auf der Schulbank. Und doch, wer zwingt mich, an die Existenz eines einziges Dorfes zu glauben, das ich auf der Landkarte verzeichnet finde?
Ach, die Namen erreichen, die Mauern berühren und durch die Gassen gehen, meinen Schritt auf dem Pflaster hallen und mein Herz schlagen hören!
Das ist das Geheimnis: Ich weiß nicht, was außerhalb von mir existiert. Ich bin unschuldig, solange ich den geweihten Ort, geweihten, magischen Namen nicht erreiche. Am Ende des Raumes, am Ende der verrinnenden Zeit, ich zweifle nicht, da leuchten die goldenen Kuppeln im Abendschein. Aber was bedeutet es, hier und dort, gleichzeitig – und wo ich bin, hier oder dort, sei dem Zufall meines Willens überlassen? – Ach, den Boden betreten, ihn durch meinen Atem lebendig machen! Ach, Wirklichkeit, Wirklichkeit!
Ich habe mich, seitdem ich ein Kind war, nicht verändert: die gleichen Sehnsüchte, die gleichen Zweifel. Nur bin ich jetzt auf der Hut. Damals waren alle Wege offen – warum ließ ich es mir nicht daran genügen, warum musste ich so hartnäckig den Umwegen, Irrwegen folgen –, und alle endeten hier oben, in diesem »Glücklichen Tal«, aus dem es keine Rückkehr mehr gibt.
Persien? – Fremde? – Ich trete aus der niedrigen Tür des Tschaikhanes – ich könnte auf einer Schafalp sein, hoch oben am Julier-Pass. So denke ich, beim Anblick der grünen Matten – aber was sollen solche Vergleiche!
Sie sind nur Umwege der Erinnerungen, Schleichwege des Heimwehs – und dieses Wort möchte ich schon gar nicht laut werden lassen. – Wir haben in Persien gelernt, uns vor unnötigen Kämpfen zu hüten. Man sollte sich seine Feinde wählen wie seine Ziele: den Kräften gemäß, über die man verfügt. – »Man soll wissen, was man will.« – Man soll, man will – aber was weiß man? – Unfruchtbare Formel der Unfreiheit! Ihr gehorchend, entschlossen wir uns, noch auf der Schulbank: vorbei die Zeit der Abenteuer, der Spiele mit dem Feuer, der kindlich-schmerzlichen Amouren, der großen Ambitionen: eine Uhr als Geschenk zur Konfirmation – und wir waren erwachsen. Einer wollte Kapitän werden auf dem Zürichsee – er galt immer schon als Sonderling –, ein anderer legte die Flugzeugmodelle weg, die er mit Geschick verfertigt hatte, und trat als Lehrling ein in eine Reparaturwerkstätte – denn Talente setzen sich durch, und wer ein Häkchen werden will, den muss man nicht erst mahnen.
Ach, ich bin, während ich so schreibe, von Spott und zynischer Gesinnung weit entfernt – sie würden zu nichts anderem taugen, als ein gekränktes und ohnmächtiges Herz zum Schweigen zu bringen. Hoffentlich kennen sie solche Schmerzen nicht, der Kapitän und der Automechaniker: Das Leben in der zivilisierten Welt bietet ja andere Hilfsmittel, um unbequeme und gefährliche Stimmen verstummen zu lassen: ordentlicher Lebenswandel, Mahlzeiten, Pflichten, Familienleben und Todesfälle, Tageszeitung, Gerichtsverhandlung, geselliges Zusammensein alter Klassenkameraden, Unglücksfälle und Verbrechen, Dichterehrung, Nationalgefühl und Bildung, Kirchenbesuch und »Wehrt den Landesfeinden«, und ein Fußballspiel am siebenten Tag; alles Anregung und Ablenkung, bis das Gewissen versenkt ist in der stillen Bucht und der ungestillte, ewig jugendliche Drang des Menschenherzens verebbt in schöner Bescheidenheit.
Oh, Selbstzufriedenheit, wahre Weisheit, rechtzeitig zu erkaufen um einen angemessenen Preis! Kein Opfer zu gering! Einen Entschluss fassen zu können, ehe es zu spät ist! Gut gewählt ist halb gewonnen!
Ich war frei, durfte wählen! Archäologie, Reise und Abenteuer, Fundstätten auf den Alexander-Routen, den Trümmerfeldern Asiens – »Istanbul, Archäologisches Institut«: die erste Adresse der Ferne. Unvergessliche Stunde des Aufbruchs! Das Leben stand auf der Schwelle des Schlafwagens, der mich durch die Balkanländer trug – Länder, gehüllt in Dämmerung, Hirtentrauer auf gelben Hügeln … Ich aber kannte die Bedeutung der Worte nicht, »Freiheit« und »Unfreiheit«, sie konnten mir nichts anhaben. Da glänzten im Morgenlicht die Mauern des alten Byzanz, die Kuppeln Konstantinopels, die Kupferdächer des Basars von Stambul, und auf dem leuchtenden Meer fuhren Schiffe mit rostbraunen Segeln: nach Zypern, nach Ägypten, Griechenland, an die Küsten des glücklichen Arabiens …
Hätte ich wissen müssen, wohin die Wege meiner Freiheit führen? – Hätte ich es wissen müssen?
Oh, Freiheit, Freiheit!
Alle Wege, welche ich auch ging, welchen ich auch entging, endeten hier, in diesem Tal, das keinen Ausgang mehr hat und deshalb schon dem Ort des Todes ähnlich und den Feldern der Engel benachbart sein muss …
Die Dunkelheit sinkt jetzt herab wie eine Wolke, die Felswand schimmert, der Fluss spiegelt sie, drüben heben sich deutlich unsere weißen Zelte ab. Ich gehe zum Ufer hinunter, im tiefen Gras liegt ein Fohlen, die zierlichen Hufe gekreuzt. Und ringsum auf dem Talboden, vom Ufer bis zur Felswand, stehen im Schlaf die Pferde des Schahs.
2
Diese Nächte sind endlos! Die Qual dieser Tage ist nicht mehr erträglich! Auf was habe ich, früher, gehofft, als ich die Morgendämmerung ungeduldig erwartete?