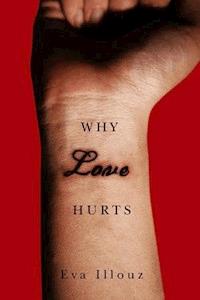13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Glück lässt sich lernen. Das will uns die boomende Glücksindustrie weismachen. Und so explodiert seit den neunziger Jahren die Zahl der Glücksseminare, Glücksratgeber und Happiness-Indizes. Heute liegt es an uns selbst, negative Gefühle zu blockieren, uns selbst zu optimieren und Achtsamkeit zu praktizieren. Dann – so das Heilsversprechen – kommt auch das Glück. Doch was bedeutet es für unsere Gesellschaft, wenn der Staat sich zunehmend nicht mehr für soziale Gerechtigkeit oder ein funktionierendes Gesundheitssystem zuständig fühlt und den Bürgerinnen und Bürgern einer ultra-individualistischen Gesellschaft die gesamte Verantwortung für das eigene Schicksal übertragen wird?
Die israelische Soziologin Eva Illouz und der spanische Psychologe Edgar Cabanas beschreiben in ihrem scharfsinnigen Essay erstmals das gefährliche Potential, das sich hinter der millionenschweren Glücksindustrie verbirgt – und zeigen auf, wer die Nutznießer und wer die Verlierer dieses vermeintlich positiven Trends sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Edgar Cabanas
Eva Illouz
Das Glücksdiktat
Und wie es unser Leben beherrscht
Aus dem Englischen von Michael Adrian
Suhrkamp
Jara gewidmet, für ihre grenzenlose Liebe, ihren Weitblick und ihren beispielhaften Sinn für Gerechtigkeit.
Edgar Cabanas
Dem Andenken meines Vaters gewidmet, Emile-Haïm, dem Gerechtigkeit wichtiger war als Glück.
Und meinen Kindern, Nathanaël, Immanuel und Amitaï, die mir viel mehr geben als Glück.
Eva Illouz
Inhalt
Einleitung
Nicht alles, was glänzt, ist Gold
Zum Aufbau des Buches
1 Die Experten wachen über uns
Die positiven Träume des Martin Seligman
Ein teures Monument
Ein angekündigtes Bündnis
Make Psychology Great Again
Die Experten wissen es am besten
Ein offensichtliches und messbares Gut
Ein Gefühlsbarometer
Die Technokratie des Glücks
2 Die Wiederbelebung des Individualismus
Glück und Neoliberalismus
Positive Psychologie und Individualismus
Die Glücksformel
Die 40-Prozent-Lösung
Der Rückzug in die innere Zitadelle
Achtsamkeits-AG
Glück: die massive Rückkehr des Individualismus
Erziehung zum Glück
Auftritt des glücklichen Schülers
Eine hartnäckige Ideologie
3 Die Arbeit der Positivität
Im Vorzimmer glücklicher Organisationen
Die auf den Kopf gestellte Bedürfnispyramide oder Glück als Voraussetzung für Erfolg
Das psychologische Glückskapital
Positives Organisationsverhalten
Permanente Flexibilität
Autonomie, noch so ein Paradox
Glück als Grundvoraussetzung
4 Glückliches Ego zu verkaufen
Steuere deine Gefühle!
Glück zur Gewohnheit machen
App-Happy
Sei du selbst!
Authentizität als Persönlichkeitsmerkmal
Handle mit deiner Authentizität: Menschen als Marken
Authentizität 2.0
Und blühe auf!
Ein neuer Typ von »Glücksgestörtem«: der permanente Selbsterschaffer
Entwickle dein bestmögliches Selbst!
5 Die neue Norm des Glücks
Ein Wiedersehen mit dem Durchschnittsmenschen
Ein falscher Gegensatz
Don’t worry, be resilient
Sinnloses Leid
Schluss
Anhang
Danksagung
Anmerkungen
Einleitung
Gab es je eine freundlichere Apokalypse?
Philip Rieff, The Triumph of the Therapeutic1
Der Hollywoodfilm The Pursuit of Happyness (Das Streben nach Glück, Regie: Gabriele Muccino) war 2006 ein weltweiter Kassenerfolg und spielte insgesamt 307 Millionen US-Dollar ein. Der Film beruht auf den Memoiren von Christopher Gardner, einem afroamerikanischen Handelsvertreter aus der unteren Mittelschicht, der sich aus ärmlichen Verhältnissen zum erfolgreichen Geschäftsmann, Börsenmakler und Motivationsredner hocharbeitet. Die Geschichte spielt in den frühen 1980er Jahren. Präsident Ronald Reagan hat im Fernsehen schlechte Wirtschaftsdaten verkündet – düstere Aussichten für Gardner und seine Frau Linda, die alle Mühe haben, sich und ihren fünfjährigen Sohn über Wasser zu halten. Das Geld reicht kaum für Miete und Kinderhort, Gardner aber bleibt trotzdem optimistisch. Er ist hartnäckig, talentiert und möchte im Job unbedingt nach oben.
Eines Tages steht er vor einer der renommiertesten Maklergesellschaften des Landes und schaut den Brokern dabei zu, wie sie in den Feierabend ziehen: »Alle sahen so wahnsinnig glücklich aus«, erinnert er sich später. »Warum konnte ich nicht so aussehen?« Jetzt hat Gardner ein Ziel: Er will Börsenmakler in dieser Firma werden und schafft es mit Charme und sozialem Geschick, dort ein unbezahltes Praktikum zu ergattern. Linda jedoch unterstützt ihn nicht in seinem Traum. Als er ihr von seinen Zielen berichtet, erwidert sie sarkastisch: »Wieso nicht gleich Astronaut?« Linda wird im Film als ewige Nörglerin und Pessimistin dargestellt, das genaue Gegenteil ihres Mannes. Und sie wirft hin, verlässt die Familie in dem Moment, als es scheinbar schlimmer nicht mehr kommen kann. Ohne ihre finanzielle Unterstützung ist Gardner völlig ruiniert. Er und sein Sohn fliegen erst aus der Wohnung, dann aus einem Motel und müssen schließlich in einer Obdachlosenunterkunft Zuflucht suchen.
Gardner lässt sich aber nicht unterkriegen. Bei den Leitern des Ausbildungsprogramms und seinen Ivy-League-Konkurrenten versucht er den Schein des Erfolges zu wahren. Dafür arbeitet er Tag und Nacht in zwei Jobs, büffelt für die Abschlussprüfung und kümmert sich obendrein noch liebevoll um sein Kind. Gardner ist entschlossen: »Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. […] Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. […] Wenn du was willst, dann mach es. Basta«, sagt der Vater beim Basketballspielen zu seinem Sohn. Gardner gehört zu den besten Absolventen des Programms und bekommt schließlich seinen Traumjob. »Dieser Abschnitt meines Lebens, dieser klitzekleine Abschnitt, heißt Glückseligkeit« (»this is happiness« im Original), behauptet er am Ende des Films.
Der weltweite Erfolg des Films zeigt deutlich, welchen Raum das Ideal des Glücks und das Streben nach Glück in unserem Leben einnimmt. Das Glück ist allgegenwärtig: im Fernsehen, im Radio, in Büchern und Zeitschriften, im Fitnessstudio, beim Essen und in Ernährungsratgebern, im Krankenhaus, bei der Arbeit, im Krieg, in Schulen und Universitäten, in der Technologie, im Internet, auf dem Sportplatz, zu Hause, in der Politik und natürlich in den Regalen der Geschäfte.
Das Glück hat unsere kulturellen Vorstellungswelten tiefgreifend beeinflusst, es ist heute im Alltag präsent bis über die Grenze des Erträglichen hinaus. Kurz vor dem Jahr 2000 führte Amazon noch dreihundert Bücher mit dem Wort »happiness« im Titel; heute sind es über zweitausend. Eine einfache Suche im Netz ergibt hunderttausende Treffer, von den täglichen Tweets, Instagram- und Facebook-Posts gar nicht erst zu reden. Wer wollte noch bezweifeln, dass die Vorstellung von Glück zu einem grundlegenden Bestandteil dessen geworden ist, wie wir uns selbst und die Welt verstehen und deuten? So vertraut und natürlich ist der Begriff, dass es einigermaßen abwegig, ja dreist anmuten mag, ihn in Frage zu stellen.
Doch hat die Idee des Glücks in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur enorme Prominenz erlangt, wir verstehen heutzutage auch etwas ganz anderes darunter als früher. Wir glauben nicht mehr, dass Glück etwas mit Schicksal, Lebensumständen oder der Abwesenheit von Leid zu tun hat, dass es ein tugendhaftes Leben krönt oder einfältigen Menschen mageren Trost gewährt. Nein, Glück gilt in unseren Zeiten vielmehr als eine Geisteshaltung, die sich willentlich herbeiführen lässt, als Resultat der Mobilisierung unserer inneren Stärken und unseres »wahren Selbst«, als einziges Ziel, das anzustreben sich lohnt, als der Maßstab, an dem wir den Wert unserer Biographien, die Größe unserer Erfolge und Niederlagen sowie den Stand unserer psychischen und emotionalen Entwicklung messen müssen.
Vor allem aber stellt sich das Glück heute als das zentrale Merkmal unseres Idealbilds vom guten Bürger dar. In dieser Hinsicht ist Gardners Geschichte besonders interessant: Einer der reizvollsten Aspekte an The Pursuit of Happyness ist ja nicht, was der Film über das Glück an sich zu sagen hat, sondern was er über den Typus Bürger verrät, der es »zu Recht« erlangt.2 Glück meint hier weniger irgendeine Vorstellung von Glück als vielmehr eine bestimmte Art von Person, nämlich eine individualistische Person, die sich selbst treu bleibt, Rückschläge verkraftet und die Initiative ergreift, die optimistisch und von hoher emotionaler Intelligenz ist. In diesem Sinn präsentiert der Film Gardner als perfekte Verkörperung der glücklichen Person und macht das Glück gleichzeitig zum roten Faden einer beispielhaften Geschichte, die vorführt, wie man sein »Ich« an bestimmten anthropologischen Vorannahmen, ideologischen Werten und politischen Tugenden ausrichtet und entsprechend mobilisiert.
Die Geschichte des echten Christopher Gardner war mit dem Film nicht zu Ende. Sie fand ihre Fortsetzung in den Medien, die sich für sein Leben interessierten, weil sie sein Potenzial erkannten, Millionen von Menschen für die Idee zu begeistern, dass Reichtum und Armut, Erfolg und Scheitern, Glück und Unglück letztlich eine Frage der Wahl seien. Im Entstehungsjahr des Films erklärte Will Smith, der Gardner spielt, in einer Reihe von Interviews, er möge Gardner, weil »er den amerikanischen Traum verkörpert«. Als Gast in der Oprah-Winfrey-Show sagte der Schauspieler sogar: »Was Amerika verspricht, ist eine so großartige Idee, weil es das einzige Land auf der Welt ist, in dem Chris Gardner existieren könnte«. Er erwähnte freilich nicht, dass Fälle wie der Gardners in Nordamerika genauso ungewöhnlich sind wie im Rest der Welt. Er ließ völlig außer Acht, dass die Vereinigten Staaten eines der Länder mit der größten sozialen Ungleichheit und Ausgrenzung auf der Welt sind3 und damit eines, in dem gerade Wohlstand und soziale Aufwärtsmobilität für die Mehrheit der Bevölkerung kaum realistische Optionen darstellen. Wie Smith ebenso wenig thematisierte, ist es tief im kulturellen und nationalen Unbewussten der USA verankert, dass Gewinner und Verlierer selbst für ihr Schicksal verantwortlich sind. Diese meritokratische Voraussetzung gilt heutzutage in praktisch allen westlichen Ländern, in denen die persönliche Situation des oder der Einzelnen zunehmend als eine Frage des individuellen Verdienstes betrachtet wird, nicht mehr als Folge struktureller Prozesse.4 Der Film ist ein typisches Beispiel für diese Mentalität: Gardner wird als Selfmademan schlechthin gezeichnet und sein Leben als ein sozialdarwinistischer Kampf um den sozialen Aufstieg, an dessen Ende eine klare Botschaft steht: Die Meritokratie funktioniert, weil sich Hartnäckigkeit und persönlicher Einsatz immer auszahlen.
Der Erfolg des Films verhalf dem echten Christopher Gardner zu weltweiter Bekanntheit. In den folgenden Jahren gab er hunderte von Interviews, in denen er das Geheimnis seines Wegs zum Glück lüftete und erklärte, warum sich »Happyness« im Filmtitel mit »y« statt mit »i« schreibt: »Das ›y‹ ist dazu da, um uns alle daran zu erinnern, dass Sie (you) darüber entscheiden, welches Leben Sie führen, dass es einzig und allein in Ihrer Verantwortung liegt. Niemand wird Ihnen zu Hilfe kommen. Das müssen Sie schon selber tun.« So entdeckte Gardner, der vom erfolgreichen Börsenhändler zum hochbezahlten Motivationsredner umsattelte, seine wahre Mission: der Welt die frohe, am eigenen Leib erfahrene Lektion zu vermitteln, dass der Mensch die Kraft hat, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen und widrige Umstände in Wachstums- und Erfolgschancen zu verwandeln. 2010 wurde er zum »Glücksbotschafter« der AARP (American Association of Retired Persons) ernannt, einer gemeinnützigen Organisation mit 38 Millionen Mitgliedern. Also widmete sich Gardner mit vollem Elan der Aufgabe, eine simple Botschaft zu verbreiten: So wie das menschliche Ich geprägt, gestaltet und verändert werden kann, wenn man nur über den Willen und das entsprechende praktische Wissen dazu verfügt, kann auch das Glück gestaltet, gelehrt und gelernt werden.
Diese Botschaft war allerdings zumindest auch paradox. Im selben Moment, in dem er einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Glück und persönlicher Verantwortung herstellt (»Sie entscheiden, einzig und allein in Ihrer Verantwortung«), argumentiert er für die Notwendigkeit von Experten wie ihm selbst, die den Menschen bei ihrer Glückssuche den Weg weisen. Gardner hatte sich zweifellos in dem zeitlosen Paradox verfangen, welches im Mythos der persönlichen Neuschöpfung liegt und besagt, dass selbst die Selfmade-Personen sich nicht einfach so selbst verwirklichen, sondern der Anleitung und Orientierungshilfe bedürfen. Neu waren Gardners Ansichten in keiner Weise: Er reaktivierte lediglich eine tief in der Gesellschaft verankerte Tradition, in der sich ideologische, spirituelle und populärkulturelle Merkmale zu einem Gemisch verbinden, das wiederum schon seit langer Zeit einen mächtigen Markt bedient. In diesem Markt werden Lebensgeschichten der Selbstveränderung, Erlösung und des persönlichen Triumphs vertrieben und verkauft, eine Art Gefühlspornographie, deren Zweck es ist, den Blick zu prägen, den Menschen auf sich und ihre Umgebung werfen. Diese exemplarischen Biographien, die den Leuten beibringen sollen, was sie werden müssen, um glücklich zu sein, sind in der Tat eine Konstante in der amerikanischen Populärkultur, die sich über Oprah Winfrey in den 1990ern zu Norman Vincent Peale in den 1950ern, Horatio Alger gegen Ende des 19. Jahrhunderts und Samuel Smiles in den 1850er Jahren zurückverfolgen lässt.5
In Wirklichkeit ist das Streben nach Glück nicht nur eines der charakteristischsten Merkmale der nordamerikanischen Kultur, sondern auch eine ihrer maßgeblichen politischen Leitideen. Die Vereinigten Staaten haben dieses »Streben« in alle vier Himmelsrichtungen gepredigt und verbreitet. Sie konnten sich dafür auf eine Vielzahl nichtpolitischer Akteure stützten, zu denen die Verfasser von Selbsthilferatgebern, Coaching-Experten, Geschäftsleute, Stiftungen und andere Privatorganisationen, Hollywood, Talkshows, Stars und Sternchen sowie – natürlich – Psychologen zählten. Erst in jüngster Zeit jedoch hat sich die Suche nach dem Glück von einer typisch amerikanischen politischen Leitidee in eine weltweite Milliardenindustrie verwandelt, die in unmittelbarer Nachbarschaft (und im besten Einvernehmen) mit den harten empirischen Wissenschaften operiert.
Wäre The Pursuit of Happyness in den 1990er Jahren gedreht worden, hätte der Film wahrscheinlich kaum jemanden groß interessiert; der Markt war damals sowohl im Sachbuchbereich als auch im Genre des kitschigen Hollywooddramas bereits übersättigt mit Produkten dieses Genres, die uns die Geschichte eines persönlichen Triumphes verkaufen. Zu Beginn dieses Jahrhunderts aber änderte sich die Lage. Ab 1998 setzte es sich die neue, mit enormen amerikanischen Finanzmitteln ausgestattete Positive Psychologie und Glücksforschung zur Aufgabe, der Welt zu erklären, warum das Streben nach Glück nicht nur für Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten, in deren Verfassung es ja steht, eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Diesen Psychologen zufolge unterliegen alle Individuen von Natur aus dem Drang, glücklich sein zu wollen, so dass man dieses Streben nicht nur als natürlich, sondern auch als höchsten Ausdruck menschlicher Erfüllung sehen sollte. Die psychologische Wissenschaft, so wurde behauptet, hat bereits einige der entscheidenden Faktoren bestimmt, die Menschen dabei helfen können, ein glücklicheres Leben zu führen, und jeder sollte von ihren Entdeckungen profitieren können, wenn er sich nur an die unkomplizierten, aber wissenschaftlich bewiesenen Expertinnenratschläge hielt. Die Idee war sicher nicht neu, kam aber aus den Hauptquartieren der psychologischen Wissenschaft und schien daher ernst zu nehmen zu sein. In wenigen Jahren gelang dieser Bewegung, was davor noch niemand geschafft hatte: Sie brachte das Glück an die Spitze der universitären Prioritätenliste und zumindest weit nach oben auf der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Tagesordnung zahlreicher Länder.
Dank der Positiven Psychologie galt Glück schon bald nicht mehr als vage Vorstellung, utopisches Ziel oder unerreichbarer persönlicher Luxus. Es wurde vielmehr zu einer allgemeinen Zielsetzung, zu einem messbaren Konzept, das es erlaubte, die nötigen psychologischen Voraussetzungen für ein gesundes, erfolgreiches und optimal funktionierendes Individuum zu definieren. Dabei zeigte sich freilich, dass diese Eigenschaften – wenig überraschend – ziemlich genau jenen von Personen wie Gardner aus The Pursuit of Happyness entsprachen. Ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz, Autonomie, Selbstachtung, Optimismus, Resilienz und Eigenmotivation erklärten die Vertreterinnen der Positiven Psychologie zu den typischen psychologischen Eigenschaften von eigenständigen, authentischen und aufblühenden Personen, die im Allgemeinen auch glücklicher, gesünder und persönlich erfolgreicher seien. Tatsächlich gleicht das Ideal des glücklichen Menschen demjenigen Gardners so sehr, dass man den Film völlig zu Recht als ein Aushängeschild der Positiven Psychologie bezeichnet hat.
Mit dem Erscheinen der Positiven Psychologie auf der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bühne geschah etwas Bemerkenswertes: Gardners mehr oder minder erbauliche Predigten mit dem Tenor, man solle aufstehen und sein Leben selbst in die Hand nehmen, verwandelten sich in eine wissenschaftliche Wahrheit. Vertreter der Positiven Psychologie verhalfen mächtigen Institutionen, den wichtigsten multinationalen Konzernen und einer milliardenschweren globalen Industrie zu vermeintlich objektiver wissenschaftlicher Legitimität. Und diese Industrie will dieselbe einfache Idee vermarkten und verkaufen, die Gardner in seinen Motivationsvorträgen anpreist: Jeder und jede Einzelne kann sein Leben neu erfinden und das Beste aus sich machen, wenn er oder sie nur positiv auf sich selbst und das eigene Umfeld blickt. Für viele war das Streben nach Glück damit zu einer ernsthaften Sache geworden, deren wissenschaftliche Behandlung zweifellos von enormem gesellschaftlichem und psychologischem Nutzen wäre. Für viele andere jedoch waren diese Anmaßungen der Positiven Psychologie nichts als falscher Schein: All die schönen Versprechungen von der Selbstverwirklichung und der Verbesserung der Gesellschaft sollten theoretisch wie praktisch verschleiern, wie es um den grundlegend apologetischen Charakter, die beunruhigenden Anwendungsbereiche und die umstrittenen Effekte der ganzen Angelegenheit bestellt ist.
Die Befürchtungen der Skeptikerinnen und Kritikerinnen haben sich im Verlauf der Jahre als berechtigt erwiesen. Nicht alles, was am Glück glänzt, ist Gold, und wir sollten uns dieser wissenschaftlichen Disziplin und ihren verführerischen Versprechungen mit Vorsicht nähern.
Nicht alles, was glänzt, ist Gold
Es stellt sich daher die Frage: Ist das Glück wirklich das größte aller Ziele, nach dem wir alle streben sollten? Vielleicht. Doch mit Blick auf den Diskurs der Glücksforscher sollten wir kritisch sein. Das vorliegende Buch richtet sich nicht gegen das Glück als solches, sondern gegen die allzu simple, aber weitverbreitete Vorstellung vom »guten Leben«, die diese Wissenschaft predigt. Menschen dabei zu helfen, sich besser zu fühlen, ist ohne Frage löblich. Doch die von ihr angepriesene Idee des Glücks ist äußerst beschränkt, ihre Deutungsansprüche sind fragwürdig, und ebenso sind auch die Ergebnisse dieser Wissenschaft widersprüchlich und die sich daraus ergebenden Konsequenzen fatal.
Unsere Vorbehalte stützen wir auf erkenntnistheoretische, soziologische, phänomenologische und moralische Erwägungen. Die erste Ebene bezeichnen wir als erkenntnistheoretisch, weil wir nach der grundsätzlichen Berechtigung der Glücksforschung als Wissenschaft fragen – und im weiteren Sinne nach der Legitimität des Glücksbegriffs als eines wissenschaftlichen und objektiven Begriffs. Um es freiheraus zu sagen: Die Glücksforschung ist eine Pseudowissenschaft, deren Postulate und Logik sich durchweg als fehlerhaft erweisen. Der pragmatistische Philosoph Charles Peirce hat einmal gesagt, eine Argumentationskette sei nur so stark wie ihr schwächstes Glied; die Glückswissenschaft jedoch stützt sich auf zahllose Annahmen, die jeder Grundlage entbehren. Ebenso weist sie theoretische Ungereimtheiten, methodische Mängel, unbewiesene Resultate und darüber hinaus ethnozentrische und übertriebene Verallgemeinerungen auf. Es verbietet sich also von selbst, unkritisch zu akzeptieren, was diese Disziplin als wahr und objektiv ausgibt.
Unser zweiter Vorbehalt ist soziologischer Natur. Unabhängig von der Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Glücksforschung ist es unerlässlich zu analysieren, welche gesellschaftlichen Akteure die Idee des Glücks für sich nutzen, welchen Interessen und ideologischen Annahmen diese Idee dient und worin die wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen ihrer breitflächigen Anwendung in der Gesellschaft bestehen. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass die wissenschaftliche Behandlung des Glücks und die Glücksindustrie, die um sie herum entstanden ist und gedeiht, ganz erheblich dazu beitragen, die Annahme durchzusetzen, Reichtum und Armut, Erfolg und Scheitern, Gesundheit und Krankheit lägen allein in unserer eigenen Verantwortung. Damit wird zugleich der Vorstellung Vorschub geleistet, es gebe keine strukturellen Probleme, sondern ausschließlich psychologische Defizite, es gebe also, um es mit Margaret Thatchers von Friedrich Hayek inspiriertem Ausspruch zu sagen, keine Gesellschaft, sondern nur Individuen. Die Vorstellung von Glück, wie sie heute von den entsprechenden Forschern und Experten formuliert und gesellschaftlich umgesetzt wird, dient dabei zuallererst der Propagierung ebenjener Werte, die für die weltweite neoliberale Revolution Pate standen. Diese wurde seit den 1950er Jahren von Ökonomen der Chicagoer Schule und anderen neoliberalen Wirtschaftswissenschaftlern vorangetrieben. Ihnen gelang es, die Welt davon zu überzeugen, dass die individuelle Glückssuche die lohnendste und einzig realistische Alternative zur Suche nach dem guten Leben für alle darstellt. Thatcher selbst hat es 1981 in einem Interview mit der Sunday Times gesagt: »Mich ärgert an der ganzen politischen Ausrichtung der letzten dreißig Jahre, dass sie immer auf die kollektivistische Gesellschaft abzielte. Die Menschen haben die persönliche Gesellschaft vergessen. […] [D]ie Wirtschaft zu verändern, ist das Mittel, um diesen Denkansatz zu verändern. […] Die Wirtschaft ist die Methode; das Ziel ist es, die Seele zu verändern.«6 Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Streben nach Glück, wie es die Glücksforschung versteht, nicht das höchste und unhinterfragbare Gut ist, das wir alle suchen sollten. Es symbolisiert vielmehr den Triumph der persönlichen (therapeutischen, individualistischen, atomisierten) Gesellschaft über die kollektive Gesellschaft.
Eine dritte Reihe von Einwänden berührt die phänomenologische Ebene. Hiermit ist die Tatsache gemeint, dass die Wissenschaft vom Glück ihre Ziele nicht nur oft verfehlt, sondern auch viele uneingestandene, unerwünschte und paradoxe Folgen haben kann. Gewiss handeln die therapeutischen Erzählungen, auf die die Glücksforschung ihr Angebot von Wohlbefinden und persönlicher Erfüllung stützt, von genau denselben persönlichen Defiziten – mangelnder Authentizität und Selbstverwirklichung –, für die sie Heilung verspricht. Glück erscheint hier als ein zwingend gebotenes, aber flüchtiges Ziel ohne klaren Endpunkt, das deshalb neue »Glückssucher« und »Happychonder« hervorbringt, die ängstlich auf ihr Selbst fixiert und permanent mit dem Versuch beschäftigt sind, ihre psychischen Macken zu beseitigen, sich zu verändern und zu verbessern. Dies macht Glück zweifellos zur perfekten Ware auf einem Markt, der bestens von der Normalisierung unserer Obsession lebt, die wir im Umgang mit unserer körperlichen und geistigen Gesundheit pflegen. Doch wendet sich diese Besessenheit leicht gegen genau die Menschen, die ihre Hoffnungen in die vielen Arten von Glückstherapien, -produkten und -dienstleistungen setzen, welche Forscher, Spezialisten und selbsternannte Wellness-Experten im Angebot haben.
Schließlich kritisieren wir die Glücksforschung noch auf einer moralischen Ebene, auf der es uns um die Beziehung von Glück und Leid geht. Dadurch, dass sie Glück und Positivität mit Produktivität, Güte, ja selbst Normalität gleichsetzt – und Unglück mit dem genauen Gegenteil von all dem –, zwingt sie uns dazu, uns zwischen Leid und Wohlbefinden zu entscheiden. Eine solche Alternative setzt jedoch voraus, dass wir immer die Wahl haben und immer über mehrere Optionen verfügen, dass Positivität und Negativität diametral entgegengesetzte Pole sind und dass wir das Leiden ein für alle Mal aus unserem Leben verbannen können. Tragödien sind zweifellos unvermeidlich; dennoch besteht die Glücksforschung darauf, Leid und Glück seien eine Frage der persönlichen Wahl. Wer ein Ungemach nicht als Gelegenheit und Mittel zu seinem persönlichen Wachstum nutzt, setzt sich so dem Verdacht aus, sein eigenes Unglück herbeizuwünschen und zu verdienen, wie auch immer seine oder ihre persönlichen Umstände aussehen. Am Ende bleibt uns also kaum eine Wahl: Die Wissenschaft vom Glück nötigt uns nicht nur, glücklich zu sein, sondern macht uns auch noch für unsere Unfähigkeit verantwortlich, ein erfolgreicheres und erfüllteres Leben zu führen, als wir es tun.
Zum Aufbau des Buches
Das erste Kapitel behandelt das Verhältnis von Glück und Politik. Es zeichnet zunächst die Entstehung und Ausbreitung der beiden einflussreichsten Felder der wissenschaftlichen Erforschung des Glücks seit der Jahrhundertwende nach: der Positiven Psychologie und der Glücksökonomie. Unser Interesse gilt dabei den Gründungszielen, methodischen Grundannahmen, der gesellschaftlichen und akademischen Ausbreitung sowie dem institutionellen Einfluss beider Felder. Anschließend zeigen wir, dass die Glücksforschung bis in Politik und Verwaltung vorgedrungen ist. Dadurch, dass sie Glück als eine objektive und messbare Variable darstellt, hat sie aus diesem ein zentrales, legitimes Kriterium für wichtige politische Entscheidungen gemacht. Ein solches Kriterium erlaubt es, den gesellschaftlichen Fortschritt eines Landes zu bestimmen und zudem umstrittene ideologische und moralische Themen (etwa das der Ungleichheit) auf technokratische Weise abzuhandeln, die sich moralischer Beurteilung entzieht.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Zusammenhang zwischen Glück und der Ideologie des Neoliberalismus. Die Idee des Glücks eignet sich besonders gut dafür, den für das neoliberale Denken so zentralen Individualismus unter Bezugnahme auf scheinbar unideologische Begriffe zu rechtfertigen – und zwar durch den so maßgeblichen wie neutralisierenden Diskurs der positiven Wissenschaft. Wir betrachten zunächst die Literatur der Positiven Psychologie, um zu zeigen, wie sehr sich diese Bewegung durch individualistische Vorannahmen und ein verengtes Verständnis des Sozialen auszeichnet. Im nächsten Schritt weisen wir nach, dass es der Positiven Psychologie zwar gelingen mag, die Sehnsucht der Menschen nach Lösungen für sich zu mobilisieren, zumal in unseren unsicheren Zeiten. Die Glücksrezepte jedoch, die sie anzubieten hat, tragen eher dazu bei, genau jene Unzufriedenheit zu erzeugen und zu verstärken, die zu heilen sie verspricht. Wir beschließen das Kapitel mit einer kritischen Anmerkung zur Einführung des Glücks in den Bereich der Bildung.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Frage der Arbeitsorganisation. Wir zeigen, in welchem Maß die Investition ins eigene Glück für die Beschäftigten zu einer unabdingbaren Voraussetzung geworden ist, den sich stets verändernden Anforderungen der neuen Arbeitswelt zu genügen. Wir wollen nachweisen, dass die Glücksforschung ältere psychologische Modelle des Arbeitsverhaltens durch einen neuen Diskurs zur Umgestaltung der Identität der Beschäftigten ersetzt. Dieser ermöglicht es Organisationen, die Verhaltensmuster, das Selbstwertgefühl und die persönlichen Aussichten ihrer Mitarbeiter besser auf die wechselnden Erfordernisse der organisatorischen Kontrolle, Flexibilität und Machtverteilung im Unternehmen abzustimmen. Wir beleuchten darüber hinaus, wie das Vokabular und die Techniken des Glücks dazu beitragen, dass sich die Beschäftigten in die Unternehmenskultur einfügen und in Konformismus üben; wie sie positive Gefühle ausbeuten und in den Dienst der Produktivität stellen; und wie sie es erlauben, die Lasten der Marktunsicherheit, mangelnder Beschäftigungsmöglichkeiten, struktureller Machtlosigkeit und zunehmender Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt allein den Beschäftigten aufzubürden.
Im vierten Kapitel analysieren wir Glück als eine Ware. Wir zeichnen nach, wie das Glück im 21. Jahrhundert zum Fetischprodukt einer milliardenschweren weltweiten Industrie geworden ist, die positive Therapien, Selbsthilferatgeber, Coaching und professionelle Beratung, Smartphone-Apps und Methoden zur Selbstoptimierung feilbietet. Glück hat sich zu einer Reihe von »Gefühlswaren« (emodities) diversifiziert – Dienstleistungen, Therapien und Produkten, die eine emotionale Veränderung verheißen und bewirken.7 Solche Gefühlswaren nehmen verschlungene Wege: Oft tauchen sie erstmals als theoretische Größen in universitären Fachbereichen auf, um sich aber alsbald unterschiedlichen Märkten anzudienen – in deren Mittelpunkt Unternehmen, Forschungsfonds oder die Lebensstilindustrie stehen können. Emotionale Selbststeuerung, das Streben nach Authentizität und individueller Entfaltung bringen das Selbst nicht nur dazu, permanent an sich zu arbeiten, sie erlauben es darüber hinaus unterschiedlichen Akteuren, Gefühlswaren im Gesellschaftskörper zirkulieren zu lassen.
Das fünfte Kapitel greift Argumentationsstränge der vorangegangenen auf, um zu zeigen, dass sich der wissenschaftliche Glücksdiskurs mehr und mehr die Sprache der Funktionalität aneignet. Jene Sprache also, in deren Rahmen sowohl die psychologischen als auch die gesellschaftlichen Standards und Erwartungen definiert werden, an denen Verhaltensweisen, Handlungen und Empfindungen gemessen werden. Damit stellt die Glücksforschung zunehmend maßgebliche Kriterien zur Bewertung dessen auf, was als ein gesundes, anpassungsfähiges und sogar normales Individuum gelten kann. Das Kapitel analysiert zunächst die strenge Unterscheidung, die Vertreterinnen der Glücksforschung zwischen positiven und negativen Gefühlen vornehmen und von der sie ausgehen, wenn sie den Begriff der »Durchschnittsperson« neu fassen. Wir stellen diese Unterscheidung in Frage, indem wir einige ihrer Tücken aus soziologischer Perspektive betrachten. Anschließend beschäftigen wir uns mit dem Verhältnis von Glück und Leid und beschließen das Buch mit einer kritischen Besinnung auf die Gefahren, die darin liegen, Leid als etwas Zweckbezogenes, Vermeidbares und letztlich Nutzloses zu betrachten.
Das vorliegende Buch möchte zu der derzeit lebhaft geführten Debatte über das Glück aus einer kritischen soziologischen Perspektive beitragen. Es baut auf unseren früheren Arbeiten zu den Feldern der Emotionen, des Neoliberalismus und der therapeutischen Kultur auf,8 erweitert einige dort entfaltete Argumentationen und bringt neue Ideen insbesondere zum Verhältnis zwischen dem Streben nach Glück und den Formen der Machtausübung in neoliberalen kapitalistischen Gesellschaften ins Spiel. Von einem »Glücksdiktat« sprechen wir, weil wir vor allem die neuen Zwangsstrategien, politischen Weichenstellungen, Managementstile, individuellen Obsessionen und Gefühlshierarchien aufzeigen möchten, die sich neben einem neuen Begriff von Staatsbürgerschaft im Zeitalter des Glücks herausgebildet haben. Am Ende geben wir eine eher persönliche Einschätzung vom Glück und seinen verkürzten Versprechungen.
In den letzten Jahren haben sich zahllose Arbeiten von Soziologinnen, Philosophinnen, Anthropologinnen, Psychologinnen, Journalistinnen und Historikerinnen kritisch mit der Glücksthematik befasst. Zu den bekanntesten – die auch das vorliegende Buch inspiriert haben – zählen die Schriften von Barbara Ehrenreich und Barbara Held über die Tyrannei des positiven Denkens,9 Sam Binkleys und William Davies’ Untersuchungen zum Verhältnis von Glück und Markt10 sowie die Überlegungen von Carl Cederström und André Spicer über die Wellness-Ideologie.11 Da Glück ein umstrittener Begriff von notorischem kulturellem, gesellschaftlichem, politischem und wirtschaftlichem Einfluss bleibt, dürfte sich daran einstweilen auch kaum etwas ändern.
1Die Experten wachen über uns
»Wir leben in einer Epoche, die vom Kult der Psyche aufgezehrt wird. In einer Gesellschaft, die durchzogen ist von rassistischen, sexistischen und Klassenspaltungen, hält uns trotz allem ein Evangelium des psychischen Glücks zusammen. Ob reich oder arm, schwarz oder weiß, Mann oder Frau, hetero- oder homosexuell, wir alle teilen den Glauben, dass Gefühle sakrosankt sind und die Rettung in der Selbstachtung liegt, dass Glück das eigentliche Ziel ist und die psychische Heilung der Weg dorthin.«
Eva S. Moskowitz, In Therapy We Trust1
Die positiven Träume des Martin Seligman
»Ich habe eine Aufgabe«,2 erklärte Martin Seligman ein Jahr vor seiner Bewerbung um die Präsidentschaft der American Psychological Association (APA), des mit über 117 500 Mitgliedern größten Berufsverbands für Psychologen in den Vereinigten Staaten.3 Zwar wusste Seligman nicht genau, worin diese Aufgabe bestand, er war sich aber sicher, dass er es herausfinden würde, sobald er gewählt wäre.4 Manches hatte er zwar schon im Sinn: die Verdopplung des Etats für die Erforschung der seelischen Gesundheit, die Ausweitung der Angewandten Psychologie vor allem auf den Bereich der Prävention und die Abkehr vom überholten, negativen Krankheitsmodell der klinischen Psychologie. »Aber das ist nicht der tiefere Grund« dessen, was ihn umtrieb, wie er wohl wusste.5 Er hatte ein ehrgeizigeres Ziel. Seligman suchte nach einer neuen psychologischen Sicht auf die menschliche Natur, die der Psychologie neues Leben einhauchen und sowohl ihren Zuständigkeitsbereich als auch ihren Einfluss vergrößern könnte.
Seine »Erleuchtung«, um mit seinen eigenen Worten zu sprechen, kam ihm einige Monate nach seiner »überraschenden« Wahl zum Vorsitzenden der APA im Jahr 1998. Als er beim Jäten seine fünfjährige Tochter Nikki dafür schalt, Unkraut in die Luft zu werfen, entgegnete ihm diese: »Daddy, erinnerst du dich an die Zeit vor meinem fünften Geburtstag? Bis dahin habe ich jeden Tag geweint. An meinem fünften Geburtstag habe ich beschlossen, nie mehr zu weinen. Das war das Schwerste, was ich jemals getan habe. Und wenn ich mit dem Weinen aufhören kann, dann kannst auch du aufhören, immer so ein Meckerfritze zu sein.«6 Für Seligman »hatte Nikki den Nagel auf den Kopf getroffen«. Er begriff plötzlich, dass »Nikki großzuziehen nichts damit zu tun hat, ihre Fehler und Schwächen zu korrigieren«. Es ging vielmehr darum, »jene früh gereifte Stärke« zu fördern.7 Wie so viele Eltern bei ihren Kindern tat die Psychologie Unrecht daran, ihre Aufmerksamkeit auf die negativen Züge zu richten, statt sich auf die positiven Eigenschaften der Menschen zu konzentrieren und ihnen dabei zu helfen, ihr Potenzial vollständig zu entfalten. »Das war nicht weniger als eine Offenbarung für mich«, behauptete Seligman in seinem Gründungsmanifest der Positiven Psychologie, das 2000 im Fachblatt American Psychologist erschien.8 »Eine weniger geheimnisvolle Weise«, die Entstehung der Positiven Psychologie zu erklären, habe er nicht zu bieten. In einer Art Offenbarungsgeschichte, wie sie charismatische religiöse Führer gerne ihren Anhängern erzählen, behauptete Seligman: »Ich habe die Positive Psychologie nicht gewählt, sie hat mich gerufen. […] Die Positive Psychologie hat mich gerufen, so wie Moses aus dem brennenden Busch gerufen wurde.«9 So war sie ihm schließlich vom Himmel gefallen, seine Aufgabe: die Begründung einer neuen Wissenschaft vom Glück, die erforscht, was das Leben lebenswert macht, und sich auf die Suche nach dem psychologischen Schlüssel zum menschlichen Aufblühen begibt.
Wie es sich aber mit Offenbarungen nun einmal verhält, war das Bild, welches das Manifest von der Positiven Psychologie entwarf, reichlich vage. Der Rosinenpickerei aus evolutionären, psychologischen, neurologischen und philosophischen Behauptungen und Konzepten fehlte es an Stimmigkeit und klaren Grenzen. Es schien sich eher um eine Absichtserklärung zu handeln als um ein solides wissenschaftliches Projekt. »Wie jede Auswahl ist auch diese in gewissem Maße willkürlich und unvollständig«, gaben seine Verfasser zu, beeilten sich aber hinzuzufügen, dass sie lediglich »den Appetit der Leserschaft« auf die »Angebote dieses Forschungsfelds« anregen wollten.10 Was aber hatte das Feld zu bieten? Für viele nichts Neues: vereinzelte bekannte Behauptungen über Selbstoptimierung und Glück, gepaart mit dem tiefverwurzelten amerikanischen Glauben an die Kraft des Individuums zur Selbstbestimmung. Das Ganze kam im Gewand positivistischer Wissenschaft daher, deren Geschichte sich mühelos von der Humanistischen Psychologie der 1950er und 1960er Jahre über die Psychologien der Anpassungsfähigkeit und die Selbstwertbewegungen der 1980er und 1990er Jahre bis zur Konsolidierung der Selbsthilfekultur sowie der »Mind Cure«- und »Neugeist«-Bewegungen im gesamten 20. Jahrhundert zurückverfolgen ließe.11
Man könnte sogar sagen, dass die Positive Psychologie – wie die Hauptfigur in F. Scott Fitzgeralds Kurzgeschichte Der seltsame Fall des Benjamin Button – schon ziemlich alt auf die Welt kam. Nicht für ihre Väter freilich. Um Seligman und seinen Co-Autor Csikszentmihalyi zu zitieren, eröffnete das neuerschaffene Forschungsfeld »eine historische Gelegenheit […], ein wahrhaftes wissenschaftliches Monument zu errichten – eine Wissenschaft, die es sich zum vorrangigen Ziel setzt, zu verstehen, was das Leben lebenswert macht«.12 Positive Gefühle, die persönliche Bedeutung, die etwas für einen Menschen haben kann, Optimismus und natürlich Glück avancierten zu forschungswürdigen Gegenständen. So wurde die Positive Psychologie auf der höchsten Ebene der akademischen Psychologie optimistisch als ein neues wissenschaftliches Unternehmen angekündigt, das in der Lage sein würde, seine Resultate »auf andere Zeiten und Orte und vielleicht sogar auf alle Zeiten und Orte« auszuweiten.13 Nicht gerade ein bescheidener Anspruch.
Die Zunft reagierte mit erheblicher Skepsis auf diese Ambitionen, doch Seligman war entschlossen, seiner Aufgabe nachzukommen. In seinem Buch Learned Optimism von 1990 hatte der ehemalige Behaviorist, der sich zu diesem Zeitpunkt als Kognitionspsychologe verstand, noch geschrieben, Optimismus halte »uns manchmal davon ab, die Wirklichkeit mit der notwendigen Klarheit zu sehen«.14 Jetzt aber hatte ihn seine Erleuchtung grundstürzend verwandelt: »In diesem Moment beschloss ich mich zu ändern.«15 Seligman wollte seinen Vorschlag weder als behavioristisch noch als kognitivistisch, ja noch nicht einmal als humanistisch bezeichnen, sondern ein völlig neues Forschungsfeld eröffnen, das so viele Anhänger wie möglich anziehen sollte. Der Weg zu einer stärker positivistischen Herangehensweise an die wissenschaftliche Erforschung des Glücks war schließlich in der Psychologie bereits eingeschlagen worden, wenn auch noch zögerlich: Anfang der 1990er Jahre argumentierten Michael Argyle, Ed Diener, Ruut Veenhoven, Carol Ryff und Daniel Kahneman in ihren Arbeiten, dass die bisherigen Versuche, Glück zu verstehen, nur mäßige Ergebnisse erbracht hätten, denen es an theoretischer Schlüssigkeit und glaubwürdigen Beurteilungsverfahren mangele. Zudem seien sie überfrachtet mit Wertvorstellungen. Vor diesem Hintergrund war den Gründungsvätern der Positiven Psychologie womöglich bewusst, dass ihre Ankündigung etwas abenteuerlich klang – man könnte sie, wie sie schrieben, »für reine Fantasterei halten« –, doch beschlossen sie ihr Manifest mit der ermutigenden und zuversichtlichen Behauptung: »Die Zeit ist reif für die positive Psychologie […]. Wir sagen voraus, dass es die positive Psychologie Psychologen in diesem Jahrhundert erlauben wird, die Faktoren zu verstehen und zu konstruieren, die das Wohlergehen von Individuen, Gemeinschaften und Gesellschaften ermöglichen.«16
In den Wochen nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der APA begannen Schecks auf seinen Schreibtisch »zu flattern«, wie Seligman sich ausdrückte. »Männer mit grauen Haaren und grauen Anzügen«, die Anwälte »einer anonymen Stiftung«, die sich nur für »Gewinner« interessierte, luden Seligman in ein schickes New Yorker Büro ein und fragten ihn: »Was hat es mit dieser Positiven Psychologie auf sich?« Nachdem er ihnen die Sache zehn Minuten lang erklärt hatte, baten sie ihn um »eine dreiseitige Projektbeschreibung […]. Einen Monat später erhielt ich einen Scheck über 1,5 Millionen Dollar«, berichtet Seligman. »Aufgrund dieser Finanzierung begann die Positive Psychologie aufzublühen.«17 Tatsächlich entwickelte sich das neue Feld rasant und verfügte bereits 2002 über ein Budget von 37 Millionen Dollar. Der Moment schien gekommen, um das erste Handbook of Positive Psychology herauszubringen, das die »Unabhängigkeit des Feldes« betonen sollte. Wie die Verfasser des Kapitels »Die Zukunft der Positiven Psychologie« erklärten, sei es an der Zeit, mit der »traditionellen Psychologie«, die auf »Schwäche« und einem »pathologischen Modell« menschlichen Handelns beruhe, zu »brechen«. Ihr Handbuch »musste einfach geschrieben werden«, und die Herausgeber trumpften darin ordentlich auf: »Wir glauben […], dass die erste Phase einer wissenschaftlichen Bewegung – eine, die wir als Unabhängigkeitserklärung von dem pathologischen Modell charakterisieren würden – abgeschlossen ist.«18 Von einem weltweiten wohlgesonnenen Medienecho getragen, verbreiteten die Positiven Psychologen unter Akademikern, Fachleuten und dem allgemeinen Publikum erfolgreich die Vorstellung, dass es endlich eine neue Glücksforschung gebe, die die psychologischen Schlüssel zu Wohlbefinden, Lebenssinn und persönlichem Aufblühen schon finden würde.
Ein teures Monument
Binnen weniger Jahre knüpften die Anhänger der neuen Positiven Psychologie ein weltweites institutionelles Netz. Das rasch wachsende Angebot umfasste Master- und Promotionsstudiengänge, Preise, Stipendien und Kurse in Angewandter Positiver Psychologie, Symposien und Workshops rund um den Globus, Handbücher, Lehrbücher und Monografien sowie Blogs und Websites zur Verbreitung und Sammlung von Daten über Lebenszufriedenheit, positive Gefühle und Glück mittels Online-Fragebögen. Selbstverständlich entstanden auch diverse Fachzeitschriften, die die Forschung des Feldes dokumentieren, so das Journal of Happiness Studies (seit 2000), das Journal of Positive Psychology (2006) und das Journal of Applied Psychology – Health and Well-Being (2008). Die Positive Psychologie hatte sich ihr eigenes großes Denkmal errichtet, ganz wie von Seligman vorhergesehen. Aber wissenschaftliche Journale, globale akademische Netzwerke und ein Medienhype allein erklären einen so schnellen Erfolg noch nicht. Dafür brauchte es auch enorm viel Geld.
Förderungen und andere Formen finanzieller Unterstützung blieben nicht auf den Scheck beschränkt, der Seligman nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der APA auf den Schreibtisch geflattert war. Im Laufe der folgenden Monate und Jahre investierten zahlreiche private und öffentliche Institutionen, die sich für das neue Forschungsgebiet interessierten, großzügig in dessen Entwicklung. Bereits 2001 stattete die ultrakonservative religiöse John Templeton Foundation, die Seligman in seiner Antrittsrede mit warmen Worten bedacht hatte, den Vater der Positiven Psychologie mit 2,2 Millionen US-Dollar aus. Die Mittel dienten dazu, an der Universität von Pennsylvania das »Positive Psychology Center« einzurichten. Da sich Sir John Templeton dafür interessierte, wie geistige Selbstkontrolle es dem Einzelnen erlaubt, die eigenen Lebensumstände zu meistern und die Welt nach eigenem Gutdünken zu gestalten, war er ganz offensichtlich von Seligmans Projekt fasziniert. Tatsächlich war es kein Geringerer als Templeton selbst, der zu jenem Handbook of Positive Psychology, in dem die Unabhängigkeit des Felds erklärt wurde, das Vorwort beisteuerte: »Ich bin zuversichtlich, dass wir alle Fortschritte machen, wenn immer mehr heutige und künftige Forscher die Vision einer Positiven Psychologie erfassen und immer mehr Stiftungen und Regierungen diese bahnbrechende und segensreiche Arbeit unterstützen.« Die Stiftung finanzierte später verschiedene Projekte zur Untersuchung des Verhältnisses von positiven Gefühlen, Altern, Spiritualität und Produktivität. 2009 etwa gewährte sie Seligman eine weitere Finanzhilfe, diesmal 5,8 Millionen Dollar für weitere Studien in Positiver Neurowissenschaft sowie die Erforschung der Rolle des Glücks und der Spiritualität in einem erfolgreichen Leben.
Die Templeton-Stiftung war jedoch keinesfalls die einzige Institution in den USA, die die akademischen Bemühungen der Positiven Psychologie förderte. Im Laufe der Jahre statteten zahlreiche andere private und öffentliche, kleinere und größere Einrichtungen die neue Disziplin mit üppigen Finanzmitteln, Preisen und Stipendien aus, unter anderem die Gallup Organization, die Mayerson Foundation, der Annenberg Foundation Trust oder die Atlantic Philanthropies. Die Robert Wood Johnson Foundation etwa zahlte Seligman 2008 3,7 Millionen US-Dollar für die Erforschung des Konzepts der positiven Gesundheit. Andere Einrichtungen wie das National Institute of Aging und das National Center for Complementary and Alternative Medicine finanzierten Untersuchungen zu den Auswirkungen von Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit und Glück auf die Gesundheit und die Verhütung psychischer Erkrankungen. Auch Konzerne wie Coca-Cola griffen tief in die Tasche, weil sie hofften, die Positive Psychologie könne kostengünstige und leistungsfähige Methoden entwickeln, um die Produktivität zu steigern, arbeitsbedingte Stress- und Angstzustände abzubauen und die Beschäftigten stärker auf die jeweilige Unternehmenskultur einzustimmen. Eines der jüngsten und spektakulärsten Beispiele ist ein Programm namens Comprehensive Soldier Fitness (CSF), das die US-Armee seit 2008 für 145 Millionen US-Dollar in enger Zusammenarbeit mit Vertretern der Positiven Psychologie wie Seligman und Barbara Fredrickson durchführen ließ. 2011 stellte Seligman die Initiative in einem Sonderheft der Zeitschrift American Psychologist einem größeren Publikum vor. Soldaten und Militärpersonal in positiven Gefühlen, Glück und Sinnstiftung zu unterweisen, so schrieb er an anderer Stelle, solle »eine Streitmacht schaffen, die psychisch so stark ist wie physisch« – oder, wie er ebenfalls formulierte, »eine unbezwingbare Armee«19 (wir werden in Kapitel 5 darauf zurückkommen). Zuwendungen solcher Art blieben dabei nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Eine stetig wachsende Zahl privater und öffentlicher Institutionen von Europa bis Asien hat die Positive Psychologie gefördert; zuletzt schlossen sich auch China, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indien an.
Obwohl es nicht zu seinen ursprünglichen Zielen gehört hatte, warb Seligman bald große Summen von privater und öffentlicher Seite für Forschungen zur geistigen Gesundheit ein, schien doch das Glück ein fruchtbares und zugleich vermeintlich unergründetes Feld zu sein. Zahlreiche Fragen harrten einer Antwort: Warum sind positive Gefühle so wichtig? Wie führt man trotz aller Schwierigkeiten ein glückliches Leben? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Optimismus und sowohl Gesundheit als auch Produktivität und Leistung? Kann die Forschung den Schlüssel zum menschlichen Aufblühen finden? Mit Fragen dieser Art begannen auf einmal tausende wissenschaftliche Vorträge und Fachzeitschriften, von denen sich viele damit begnügten, die Fragen, Ergebnisse, Argumente, Gründungsmythen, Nachweise und Stilfiguren der anderen zu reproduzieren; sie vermittelten damit der Leserschaft den Eindruck einer theoretischen und begrifflichen Kohärenz und Einigkeit, die das Feld in Wirklichkeit gar nicht aufwies.
Vielleicht um diesen Mangel an Kohärenz auszugleichen, veröffentlichten Peterson und Seligman 2004 Character Strenghts and Virtues. Gedacht war dieses »Handbuch der geistigen Gesundheit«, wie die beiden Autoren es nannten, als positives Pendant zum Diagnostischen und statistischen Leitfaden psychischer Störungen (DSM) und zur Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD), den beiden weltweit wichtigsten Referenzwerken für Psychologen, Psychiater und Therapeuten. Statt psychische Störungen zu beschreiben, bietet ihr Handbuch eine allgemeine Klassifikation der menschlichen Stärken und Tugenden, um »Menschen zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen«. Darüber hinaus zielen die Autoren darauf, Forscherinnen und Spezialistinnen auf diesem Gebiet darin anzuleiten, wie sie erkennen, messen und fördern können, was an Individuen authentisch ist und ihr menschliches Wachstum fördert: »Dieses Manual konzentriert sich auf das, was positiv an Menschen ist, und besonders auf die Charakterstärken, die ein gutes Leben ermöglichen. Wir folgen dem Beispiel von DSM und ICD […] mit dem entscheidenden Unterschied, dass wir uns nicht für psychische Krankheiten, sondern für psychische Gesundheit interessieren.«20 Auch zu einem »gemeinsamen Vokabular«, das den Positiven Psychologen noch fehlte, wollen Peterson und Seligman ihrem Fach verhelfen: