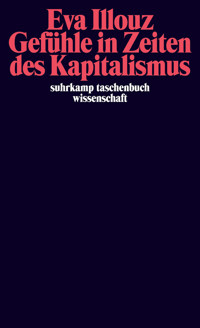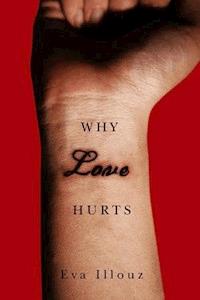17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was geht in einem Land vor, in dem Sicherheit von so überragender Bedeutung ist, dass sich eine Ärztin bereitwillig an einem Mordkomplott beteiligt, weil sie davon überzeugt ist, damit ihre Heimat zu verteidigen? Würden hochrangige israelische Politiker oder Militärs ein Mitglied einer Minderheit gegen den bloßen Verdacht des Hochverrats in Schutz nehmen? Fragen wie diesen spürt Eva Illouz in ihren Essays über Israel nach. Anhand aktueller politischer Entwicklungen und persönlicher Erfahrungen zeichnet sie ein drastisches Bild der israelischen Gesellschaft: Die zunehmende Identifikation mit Ethnie und Religion, so ihre These, droht deren liberalen Charakter zu unterwandern. Illouz’ in Israel viel beachteten und kontrovers diskutieren Texte kombinieren scharfsinnige Analysen mit einem kompromisslosen Plädoyer für eine offene Gesellschaft – eine dringend benötigte Stimme aus einer von Extremismus gezeichneten Region.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Was geht in einem Land vor, in dem Sicherheit von so überragender Bedeutung ist, dass sich eine Ärztin bereitwillig an einem Mordkomplott beteiligt, weil sie davon überzeugt ist, damit ihre Heimat zu verteidigen? Würden hochrangige israelische Politiker oder Militärs ein Mitglied einer Minderheit gegen den bloßen Verdacht des Hochverrats in Schutz nehmen? Fragen wie diesen spürt Eva Illouz in ihren Essays über Israel nach. Anhand aktueller politischer Entwicklungen und persönlicher Erfahrungen zeichnet sie ein beunruhigendes Bild der israelischen Gesellschaft: Die zunehmende Identifikation mit Ethnie und Religion, so ihre These, droht deren liberalen Charakter zu unterwandern. Illouz' in Israel viel beachtete und kontrovers diskutierte Texte kombinieren scharfsinnige Analysen mit einem kompromisslosen Plädoyer für eine offene Gesellschaft – eine dringend benötigte Stimme aus einer von Extremismus gezeichneten Region.
Eva Illouz, geboren 1961 in Marokko, ist Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Neben ihrer Arbeit als wissenschaftliche Autorin schreibt sie regelmäßig für die israelische Tageszeitung Haaretz. Im Suhrkamp Verlag sind zuletzt erschienen: Warum Liebe weh tut. Eine soziologische Erklärung (2011, st 4420 und stw 2057) und Die neue Liebesordnung. Frauen, Männer und Shades of Grey (2013).
Eva Illouz
Israel
Soziologische Essays
Aus dem Englischen vonMichael Adrian
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe der edition suhrkamp 2683.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlag gestaltet nach einem Konzept
von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-73802-3
Inhalt
Vorwort
1. Kann man eine jüdische Intellektuelle, ein jüdischer Intellektueller sein?
2. Ist Israel zu jüdisch?
3. Warum Israel keine Israelis kennt
4. Israel, ein Feudalstaat?
5. Dreyfus in Israel. Ein Gedankenexperiment
6. Ich? Eine Jüdin? Antisemitisch?
7. Die Gewohnheit des Gehorsams
8. Ein soziologisches Rätsel
9. Der Zement der ethnischen Zugehörigkeit
10. Der ethnische Verdruss
11. Diskriminierung auf Israelisch
12. Am Ende wird die Linke siegen
13. Die Dialektik der freien Meinung
14. Trauer und Hoffnung
Textnachweise
Vorwort
Michel Foucault sah die Funktion des Intellektuellen darin, »der Macht die Wahrheit« zu sagen. Die Parrhesia – wie er das nannte – ist jene Rede, die sich als »Wahrsprechen« gegenüber dem Souverän zu erkennen gibt und damit ihren Sprecher gefährdet. Foucaults Reflexionen über das Verhältnis von Wahrsprechen und Macht ließen freilich einen Fall unberücksichtigt, der schwerer zu fassen ist, und zwar den der oder des zeitgenössischen jüdischen Intellektuellen: Die Wahrheit sagen muss diese(r) nämlich gleichzeitig einem mächtigen Militärstaat, der an der Schwelle zu einer ethnischen Hegemonie steht – Israel –, und einer jüdischen Diasporagemeinschaft, die von der Erinnerung an ihre fürchterlichen Verfolgungen heimgesucht wird. Wie spricht man im selben Atemzug zu einem Souverän und zu einer Gruppe, deren Verletzlichkeitsgefühl ihre Existenz bis ins Innerste bestimmt? Muss man zu beiden sprechen? Dies sind die ernüchternden Fragen hinter der vorliegenden Sammlung von Essays, die bis auf drei hier in deutscher Übersetzung erstmals außerhalb Israels erscheinen, aber in einer Phase der Konsolidierung extrem rechter Politiken und Diskurse in Israel und für Israelis geschrieben wurden.1
Es ist noch gar nicht so lange her, da gehörte ich selbst jenen jüdischen Gemeinschaften an, die so viel von ihrer geistigen und finanziellen Energie darauf verwenden, den Staat Israel zu unterstützen und aus den quälenden Erinnerungen an die Schoah ein Bewusstsein kollektiver Identität abzuleiten. Ich war religiös und ein aktives Mitglied orthodoxer Gemeinden in Frankreich und den Vereinigten Staaten. Zugleich fühlte ich mich den Menschenrechten verpflichtet. In meiner psychischen Biographie, die sowohl eine orthodoxe Religiosität als auch ein Bekenntnis zur Verteidigung der Menschenrechte umfasste, griff beides nahtlos ineinander, ohne Widerspruch oder Konflikt – die Menschenrechte waren der natürliche Erfüllungsgehilfe der Rechte von Juden auf der ganzen Welt, während die Schoah als universelles Paradigma für den Rassenhass auf der ganzen Welt diente. Selbst jetzt, in den Eingangszeilen eines Buches, das sich kritisch mit der zeitgenössischen israelischen Gesellschaft auseinandersetzt, teile ich die nagende Sorge, die israelische Politik, wie schrecklich sie auch sein mag, könnte irgendjemandem einen Vorwand dafür liefern, das Recht der Juden auf einen eigenen Staat oder sogar ihr Existenzrecht von Neuem anzuzweifeln. Terrorangriffe auf Juden in Ländern rund um den Globus erinnern uns unheilverkündend an diese Möglichkeit. Ich identifiziere mich mit der sehr jüdischen existentiellen Beunruhigung darüber, dass das Schicksal der Juden nie geklärt, irgendwie immer neu auszuhandeln, eine offene Frage, ein möglicher Gegenstand von Einwänden durch Nichtjuden ist. Daher möchte ich eine Prämisse dieses Buches unmissverständlich klarmachen: Nicht nur haben die Juden ein Recht auf eine nationale Heimstätte, sie haben sogar ein größeres moralisches Recht darauf als die meisten anderen Völker, weil sie auf die längste und eine der leidvollsten Verfolgungsgeschichten der Menschheit zurückblicken. Ein paar Tausend Jahre Exil und unbarmherzige Verfolgungen erlegen der Welt, das heißt der nichtjüdischen Welt, die moralische Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass das Recht der Juden auf ein Territorium und nationale Souveränität niemals infrage gestellt wird.
Die Legitimität des Zionismus – als einer Bewegung, deren Absicht es war, den Juden zu Sicherheit und Würde zu verhelfen – zu bestreiten ist unmoralisch. Die politischen Fehler jener Bewegung untergraben nicht ihre moralische Intention und ihre Legitimität. Die Existenz Israels ist eine ohne Wenn und Aber.
Obwohl ich auf den folgenden Seiten eine deutliche Kritik am heutigen Israel formuliere, unterscheidet sie sich folglich erheblich von der solcher Kritiker wie Judith Butler und Shlomo Sand. Ich lehne die Auffassung ab, dass der Zionismus ein unmoralisches oder nicht notwendiges Unterfangen war und dass die Juden als Volk ihre Berufung im Exil finden müssen. Das jüdische Volk hat kulturell ungeheuer viel geleistet und einen unauslöschlichen Eindruck in der nichtjüdischen Welt hinterlassen. Jetzt aber hat es seine Formenvielfalt und seinen Inhalt im und durch den nationalen Rahmen Israels erneuert und verändert. Die folgenden Essays wurden im Engagement für eine solche Erneuerung der jüdischen Existenz geschrieben, verstanden als eine nichtreligiöse Antwort auf die Herausforderungen der Moderne und des Universalismus. Eine jüdische Kultur, Gemeinschaft, Religion oder Staatlichkeit, die sich nicht vom Universalismus und den Veränderungen der Definition von Menschheit, die mit ihm einhergingen, belehren ließe, würde nicht angemessen auf die moralischen Anforderungen der Moderne reagieren.
So ist es dieselbe nordafrikanische Immigrantin, eine in der französischen Republik aufgewachsene religiös-orthodoxe Jüdin, die heute gegen die antiuniversalistischen Grundlagen des israelischen Gemeinwesens ihre Stimme erhebt, gegen sein langsames Abdriften in eine religiöse Ethnokratie. Ich schreibe dies als Jüdin und als französische Bürgerin, die dazu erzogen wurde, die republikanischen Ideale Frankreichs wertzuschätzen und in Ehren zu halten, wie anfällig uns diese heute auch erscheinen mögen. Wenn die israelische Politik tagtäglich das Völkerrecht und die Menschenrechte missachtet, dann kann die ontologische Unsicherheit, die Juden rund um den Erdball verspüren, nicht länger als moralische Rechtfertigung für die systematische Blindheit gegenüber der massiven Erosion der Demokratie in Israel und gegenüber der moralisch sowie politisch unverantwortlichen Unterdrückung entrechteter Palästinenser dienen. Zweifellos ist die Furcht der organisierten jüdischen Gemeinden vor dem Antisemitismus berechtigt, doch darf diese Furcht nicht deren offizielle Politik sein und als Rechtfertigung für den systematischen Angriff auf diejenigen benutzt werden, die sich um die Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte und die Moralität des Staates sorgen. Wenn jemand, dem die Menschenrechte wichtig sind, damit zum Verräter an Israel und den Juden wird (wie es dieser Tage in Israel und den weltweiten jüdischen Gemeinden so häufig zu hören ist), würde dies den moralischen Bankrott des organisierten Judentums und Israels bedeuten. Die Menschenrechte sind der Mindeststandard, an dem jede Innenpolitik und jede internationale Politik gemessen werden muss – ohne Wenn und Aber. Die Tatsache, dass viele Israelis und Nichtisraelis, die die Menschenrechte in Israel verteidigen, regelmäßig verleumdet und geächtet werden, spricht dafür, dass sich sowohl die jüdischen Diasporagemeinschaften als auch Israel von internationalen Moralnormen abwenden, gerade weil diese Normen an und für sich universalistisch sind.
In gewisser Weise stehe ich als eine Israelin mit französischer Staatsbürgerschaft, die nach wie vor an die großartigen Ideale der französischen Republik glaubt und nicht weniger beunruhigt über den grassierenden Antisemitismus in der muslimischen und der westlichen Welt ist, vor einer mitunter unmöglichen kognitiven Herausforderung: Ich bin entschlossen, zwei Bilder, die sich gegenseitig ausschließen, gleichzeitig einzufangen. Nehmen wir die berühmte doppeldeutige Zeichnung mit dem Titel »Meine Frau und meine Schwiegermutter«:2
In ihr können wir sowohl eine alte Frau mit einer markanten Nase als auch eine junge Frau mit einem eindrucksvollen Kopfschmuck ausmachen. Beide sind in dem Bild zu sehen, aber nicht beide zugleich: Um die junge Frau zu erkennen, müssen wir die alte ausblenden, und umgekehrt. In meinen Augen veranschaulicht dies perfekt die Position, in der sich viele Israelis und Juden weltweit befinden: Sie können ihr Augenmerk nur auf eines der Bilder richten, sie können buchstäblich nicht beides zugleich sehen, die Verletzlichkeit der Juden und die einschüchternde Macht Israels.
Die Rolle der Intellektuellen ist es, diese konträren Bilder nebeneinanderzustellen und zwischen ihnen hin- und herzuwechseln. Ein solches Nebeneinanderstellen, ein solches Bewusstwerden für andere Möglichkeiten, dieselben Punkte und Linien zu verbinden, ändert nichts an der Pflicht, den Blick unverwandt auf eines dieser Bilder gerichtet zu halten, jenes nämlich, das am dringendsten zum Handeln auffordert, jenes, das die schiere Möglichkeit, das andere auch zu sehen, aufs Spiel zu setzen scheint. Mit einer Formulierung von W.G. Sebald können wir sagen, dass die Rolle des Intellektuellen darin besteht, einen prüfenden Blick auf die Dinge zu werfen, um »vermittels der reinen Anschauung und des reinen Denkens [zu] versuchen, das Dunkel zu durchdringen, das uns umgibt«.3 Wir befinden uns heute in einer Situation, in der der jüdische Messianismus und verschiedene Gruppierungen der extremen Rechten das von den frühen Zionisten verfolgte demokratische Projekt zu beenden drohen. In dieser Lage kann die jüdische Welt ihren Blick nicht länger davon abwenden, wie sich Israel international isoliert und wie seine politischen Entscheidungen die Legitimität des zionistischen Projekts gefährden. Zu diesen politischen Entscheidungen gehören die militärische Kolonialisierung von Gebieten, die man einer undemokratischen Herrschaft unterstellt; die Verweigerung staatsbürgerlicher Grundrechte für die Palästinenser; der zunehmend exklusive und von der Überlegenheit einer Gruppe ausgehende Charakter einer ethnischen Staatsdefinition, die Nichtjuden faktisch ausschließt und Israel in ein nichtuniversalistisches und ethnokratisches Regime verwandelt; die unerträglichen Privilegien für orthodoxe religiöse Juden sowie die Schaffung qualitativ unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen innerhalb des Staates mit ihren je eigenen Vorrechten und Pflichten; das Bollwerk der Religion gegenüber vielen rechtlichen Aspekten; die staatliche Diskriminierung vieler nichtorthodoxer Formen des Judentums einschließlich der offiziellen Diskriminierung von Frauen. Es ist fast unmöglich geworden, diese Situation zu verändern – zu viele ökonomische und ideologische Interessen tragen zur Aufrechterhaltung der gravierenden Ungleichheiten in der israelischen Gesellschaft bei.
Wir sollten jedoch die Frage stellen, warum Angehörige alteingesessener jüdischer Gemeinden auf der ganzen Welt sich weigern, das zu sehen, was für so viele innerhalb und außerhalb Israels offensichtlich ist. In zweihundert Jahren werden Historiker über genau diese Frage rätseln. Warum sind die Juden weltweit so schnell und entschlossen, wenn es darum geht, Antisemitismus zu bekämpfen, und so schwer von Begriff, wenn es um Israels eklatante und wiederholte Menschenrechtsverletzungen und seinen staatlichen Rassismus geht? Die Antwort ist einfach: Sie projizieren ihr eigenes Gefühl der Verletzlichkeit auf Israel und bedienen sich des uralten Narrativs vom »Hass der Völker«, um seinem Vorgehen Sinn abzugewinnen. Sie machen Israel so zur Verlängerung ihrer eigenen Unsicherheit, die von einem auf die Schoah konzentrierten kollektiven Gedächtnis gespeist wird, wie es ironischerweise gerade die (nichtjüdischen) Staaten pflegen, in denen die jüdischen Diasporagemeinschaften gelebt, sich entwickelt und sogar ihre Blütezeit erlebt haben. Doch auch wenn es den Anschein haben mag, dass die Diaspora und Israel durch die Vorstellung von einem »jüdischen Volk« vereint sind, so ist diese Einheit bloß symbolischer Natur. Tatsächlich befinden sie sich in entgegengesetzten existentiellen und sozialen Situationen: Wo sich die Diaspora prinzipiell unsicher fühlt, leben die Israelis in einem hyper-sicherheitsbesessenen Staat. Wo sich Erstere als Opfer sieht, verfügen Letztere über ein ausgemachtes Selbstbild der Stärke. Wo die Erstere die Menschenrechte gepriesen hat und an ihnen festhält, um ihre Existenz zu sichern, glauben Letztere – die rechten Israelis –, dass die Menschenrechte ihr Überleben gefährden. Während Erstere in einer kosmopolitischen Welt lebt, haben Letztere die ethnischen Gräben ihres Staates so vertieft, dass Israel nun sowohl wegen seiner Außenpolitik als auch wegen seines ethnisch-exklusiven Charakters isoliert wird. Die Ersetzung von Politik durch Sicherheit hat wiederum eine tiefe ontologische Unsicherheit für eine andere Gruppe geschaffen, der das Grundrecht auf Staatsbürgerschaft und damit ein Leben in Würde, Wohlstand und Sicherheit vorenthalten wird. Wo Juden auf der ganzen Welt für ihr Recht gekämpft haben, ein Leben in Sicherheit und Gleichheit mit den nichtjüdischen Bürgern zu führen, versagt ihr Schweigen faktisch anderen dieses Recht, wenn sie sich weigern, Ministerpräsident Netanjahus Politik in den besetzten Gebieten zu kritisieren und von Israel zu verlangen, dass es sich an internationale Menschenrechtsgrundsätze hält. Erst als Netanjahu die Macht des Präsidenten der Vereinigten Staaten herausforderte, begann es dem organisierten amerikanischen Judentum zu dämmern, dass mit der Politik des israelischen Ministerpräsidenten etwas nicht in Ordnung ist.
Die »Sicherheit des Staates« und die »Sicherheit der Juden« können nicht ewig als Ersatz für eine echte Politik und moralische Positionen herhalten. Dies ist die eine Prämisse, an der sich die folgenden kritischen soziologischen Essays orientieren: Was Juden in ihren jeweiligen nichtjüdischen Ländern für sich selbst gefordert haben und fordern, muss auch den arabischen und den entrechteten palästinensischen Bürgern zugestanden werden – ohne Wenn und Aber.
Für Foucault spricht jemand die Wahrheit, wenn er oder sie potentiell einen Preis dafür zu zahlen hat – ins Gefängnis kommen, gefoltert, verbannt oder getötet werden kann. Der jüdischen Gemeinschaft die Wahrheit zu sagen schließt ein anderes Risiko ein, und zwar das, auf subtile oder auch weniger subtile Weise symbolisch geächtet zu werden. Gershom Scholem tat dies bekanntlich, als er der kritischen Hannah Arendt einen Mangel an »Ahabath Israel« vorwarf, an Liebe zur jüdischen Nation und zum jüdischen Volk. Dieses Buch riskiert eine solche Anschuldigung, versteht sie aber als einen Versuch der Einschüchterung und des Mundtotmachens: Eine Person oder auch ein Kollektiv zu lieben kann unmöglich bedeuten, dass man das Unrecht akzeptiert, das sie anderen zufügen. Jemanden zu lieben bedeutet manchmal auch, ihn oder sie vor sich selbst und seiner oder ihrer eigenen Blindheit zu schützen.
In seinem Buch Zweifel und Einmischung – Gesellschaftskritik im 20. Jahrhundert vergleicht Michael Walzer die Aufgabe des kritischen öffentlichen Intellektuellen mit Hamlets Geste gegenüber seiner Mutter, als er ihr den Spiegel gibt, in dem sie sich sehen kann, so wie sie in den tiefsten Winkeln ihres Herzens wirklich ist: »Kommt, setzt Euch nieder; Ihr sollt nicht vom Platz, / Nicht gehn, bis ich Euch einen Spiegel zeige, / Worin Ihr Euer Innerstes erblickt.«4 Die Aufgabe des Kritikers, so Walzer, besteht darin, uns selbst einen Spiegel vorzuhalten, um uns an die Werte und Ideale zu erinnern, an die wir glauben und für die wir gekämpft haben. Der Zweck dieses Buches und der damit verbundenen Entscheidung, den akademischen Elfenbeinturm zu verlassen, ist kein Geringerer, als Juden auf der ganzen Welt einen Spiegel vorzuhalten, um sie an die Ideale zu erinnern, für die sie in den letzten zweihundert Jahren gekämpft haben und die dafür sorgten, dass ihre Gemeinschaften gediehen. Diese Ideale und den moralischen Kompass, den sie boten, zu vergessen heißt, die Geschichte der aufgeklärten Juden der letzten zweihundert Jahre zu verraten. Diese Geschichte ist unvollendet, solange die politischen Institutionen und die Kultur Israels nicht die universalistischen Gebote umfassen, die die Geburt aller modernen Demokratien begleitet haben. Ein jüdischer Staat, der nicht auf universeller Gerechtigkeit aufbaut, wird nicht auf die zentrale Herausforderung geantwortet haben, vor die die Moderne das jüdische Volk stellte, nämlich ihre Existenz und ihre Identität unter Einbeziehung der Forderungen des Universalismus neu zu definieren, statt diese von sich zu weisen.
Angesicht der täglichen Erinnerungen daran, dass Israel keine angemessene Antwort auf diese Herausforderung findet, entschloss ich mich, die vorliegenden soziologischen Essays für die israelische Tageszeitung Haaretz zu schreiben. Dabei habe ich mir zwei Aufgaben gestellt: Erstens wollte ich die sozialen Tiefenstrukturen hinter jenen »Ereignissen« verstehen, von denen uns tagtäglich zuhauf berichtet wird, und die zusammen die politischen Nachrichten ausmachen. Wenn die Soziologie eine Berufung hat, dann ist es die, über die journalistische Berichterstattung hinauszugehen, um die Tiefenstrukturen freizulegen, die unser Denken und unsere Solidaritätsbeziehungen ordnen. Ich bin davon überzeugt, dass dies dringend notwendig ist, zumal für all diejenigen, besonders außerhalb Israels, die mit zunehmender Irritation und Kopfschütteln die Hinwendung der israelischen Gesellschaft zu ethnokratischen und antidemokratischen Haltungen verfolgen. »Soziologischer Journalismus« oder »journalistische Soziologie« sind vermutlich die treffendsten Bezeichnungen für mein Vorgehen in diesen Artikeln.
Meine zweite Aufgabe bestand darin, Julien Bendas Appell an die Intellektuellen zu folgen und dem Universalismus verpflichtet zu bleiben. In einer Zeit, in der sich Europa mit der Herausforderung konfrontiert sieht, für eine bessere Integration seiner eigenen Minderheiten zu sorgen und seiner eigenen multikulturellen Vielfalt zu besserer Anerkennung zu verhelfen, mag ein solcher Appell verwunderlich und unangemessen wirken. Doch der Multikulturalismus ist ein Sprössling des Universalismus. Ohne diesen ergibt jener keinen Sinn. Tatsächlich ist Multikulturalismus häufig schlicht eine Entwicklung oder eine fortgeschrittene Version des Universalismus. In einem Land, das mit starken ethnischen Abgrenzungen errichtet wurde, behält der Universalismus seinen radikalen Charakter. Auch wenn das Engagement der Juden für die Aufklärung und den Universalismus der Vergangenheit anzugehören scheint, kann und muss diese Geschichte erneuert werden. Die Juden waren wahrscheinlich mehr als jede andere Gruppe an der Speerspitze des Kampfes für den Universalismus. An ihnen ist es, diese historische Allianz wiederzubeleben, um Israel einen neuen Weg aufzuzeigen.
Würde sich Israel diesem Weg verweigern und lediglich ein weiterer von Religiosität und militärischer Gewalt geprägter Staat bleiben, so bildete dies keine geringere Gefahr für seinen Fortbestand und seine moralische Kraft als die feindlichen Nationen, von denen es umringt ist. Mehr denn je müssen Israel und das Judentum heute das Erbe aufgeklärter Juden fortführen, indem sie den Universalismus zu Israels moralischem Horizont machen.
Ich danke Mattan Shachak, Daniel Gilon und Yaara Benger für ihre außergewöhnliche Hingabe bei der Recherche für diese Texte. Ganz besonders danken möchte ich der Alexander von Humboldt-Stiftung für den Anneliese Maier Research Award. Die mir bereitgestellten Mittel haben die Publikation dieser Essays ermöglicht. Es ist eine große Genugtuung, zu wissen, dass sich der Deutsche aus dem 19. Jahrhundert, dessen Namen diese Einrichtung trägt, mit Überzeugung für die Vereinigung der Wissenschaften und der Menschen eingesetzt hat. Es ist diese Vereinigung der Menschen, der dieses Buch gewidmet ist.
Anmerkung
1
Französische Übersetzungen der Texte »Dreyfus in Israel. Ein Gedankenexperiment« und »Ich? Eine Jüdin? Antisemitisch?« erschienen am 04.11.2012 bzw. 14.11.2012 in der französischen Tageszeitung Le Monde. »Die Dialektik der freien Meinung« erschien in Der Spiegel vom 10.09.2012.
2
Die Zeichnung »Meine Frau und meine Schwiegermutter« von William Ely Hill wurde zum ersten Mal am 06.11.1915 in dem US-amerikanischen Satiremagazin Puck (S.11) abgedruckt. Die Bildunterschrift lautete: »My wife and my mother-in-law. They are both in this picture – find them«.
3
W.G. Sebald, Austerlitz, München/Wien 2001, S.7.
4
William Shakespeare, Hamlet, Prinz von Dänemark, hrsg. von Dietrich Klose, übers. von August Wilhelm von Schlegel, Stuttgart 1986, S.74 (3. Aufzug, 4. Szene).
1. Kann man eine jüdische Intellektuelle, ein jüdischer Intellektueller sein?
Wie vertragen sich Vorstellungen wie die von »Ahabath Israel« oder der »Solidarität mit dem jüdischen Volk« mit dem Grundbedürfnis der Intellektuellen, Distanz zu ihrer nationalen oder religiösen Herkunftsgruppe zu halten, um sich ihre moralische Integrität zu bewahren?
In einem berühmt gewordenen Briefwechsel zwischen Gershom Scholem und Hannah Arendt beschied der Erforscher der jüdischen Mystik der politischen Theoretikerin einen Mangel an »Ahabath Israel«, an Liebe zur jüdischen Nation und zum jüdischen Volk. Was hatte Arendt getan, um sich eine derartige Injurie einzuhandeln? Sie hatte für das renommierte US-amerikanische Magazin TheNew Yorker eine Reihe von Artikeln über den Eichmann-Prozess verfasst, die 1963 auf Englisch, 1964 auf Deutsch unter dem Titel Eichmann in Jerusalem als Buch erschienen.
In ihren Reportagen, die zu den bekanntesten werden sollten, die je über eine Gerichtsverhandlung geschrieben wurden, beschuldigte Arendt die »Judenräte«, die den Nationalsozialisten geholfen hatten, und behauptete, es hätte weniger Todesopfer gegeben, wenn sich die jüdischen Gemeindevorsteher nicht zu Erfüllungsgehilfen der Nazis gemacht hätten. Dem Staat Israel wiederum warf sie vor, die Verhandlung wie einen Schauprozess zu inszenieren und die neue rechtliche Dimension zu verkennen, die Eichmanns Verbrechen darstellten. Vor allem aber schien sie Eichmann vorschnell vom »radikal Bösen« auszunehmen, da sie seine Taten als die in gewisser Weise arglose Folge seiner Unfähigkeit betrachtete, selbständig zu denken und den Charakter seiner eigenen Worte und Taten zu verstehen. (Ihre berühmte Formel von der »Banalität des Bösen« suggerierte, dass das Böse unsichtbar und allgegenwärtig sein und anstatt aus einer diabolischen psychischen Veranlagung aus gewöhnlichen Denkfehlern resultieren konnte, der Unfähigkeit, unabhängig darüber zu reflektieren, was moralisches Handeln ist, sowie der Gewohnheit, Befehle zu befolgen.) Mit anderen Worten: Statt an den Tag zu legen, was wir bei einem solchen Anlass von einer Jüdin erwartet hätten – schieres Entsetzen über Eichmanns Taten, uneingeschränktes Mitgefühl angesichts der moralischen Dilemmata der jüdischen Gemeindeführer, die es mit den Nazis zu tun hatten, Solidarität mit dem Staate Israel –, analysierte Arendt all diese Aspekte mit einem kühlen Sinn für Wahrheit und Gerechtigkeit und ließ die moralischen Kategorien, mit denen die Öffentlichkeit sie beurteilt hatte, unscharf werden.
Dies, so Scholem in einem Brief an Arendt vom 23. Juni 1963, zeige, dass sie es in ihrer intellektuellen Position an Liebe zu Israel mangeln lasse. Warum, fragte er sie,
»hinterlaesst Ihr Buch dennoch solch Gefuehl der Bitterkeit und Scham, und zwar nicht ueber das Referierte, sondern ueber die Referentin? Warum ueberdeckt Ihr Referat so weithin das darin vorgebrachte, das Sie doch mit Recht dem Nachdenken empfehlen wollten? Die Antwort, soweit ich eine habe, und die ich Ihnen gerade weil ich Sie so hoch achte, nicht unterdruecken kann, muss Ihnen sagen, was in dieser Sache zwischen uns steht. Es ist der herzlose, ja oft geradezu haemische Ton, in dem diese, uns im wirklichen Herzen unseres Lebens angehende Sache [der Holocaust], bei Ihnen abgehandelt wird. Es gibt in der juedischen Sprache etwas durchaus nicht zu definierendes und voellig konkretes, was die Juden Ahabath Israel nennen, Liebe zu den Juden. Davon ist bei Ihnen, liebe Hannah, wie bei so manchen Intellektuellen, die aus der deutschen Linken hervorgegangen sind, nichts zu merken. […] Mit dem Stil der Leichtherzigkeit, ich meine das englische flippancy, den Sie nur allzu oft in Ihrem Buche […] aufbringen, habe ich keine Sympathie. Er ist auf unvorstellbare Weise der Sache, ueber die Sie sprechen, unangemessen. Gaebe es wirklich bei solchem Anlass nicht Platz fuer das, was man mit dem bescheidenen deutschen Wort Herzenstakt nennen duerfte?« 1
Scholems Reaktion berührt den Kern dessen, was wir als das Problem der jüdischen Kritik in der Gegenwart bezeichnen können. Wie Arendt hatte auch Scholem die Idee eines binationalen Staates unterstützt; hier aber reagierte er wie andere zionistische Juden mit Entrüstung und Wut. Arendts Anklage gegen die Judenräte und Israel verstand er als Ausdruck einer unangebrachten, empörenden Distanziertheit, ja sogar als »bitterböse« und »herzlos«, wie seine Worte lauteten. Einen schlimmeren Vorwurf hätte er ihr kaum machen können. Der Ton ist also keine Frage der Meinungen (in vielem waren sich beide einig). Er ist vielmehr das, worauf wir an jenen achten, von denen wir Liebe und Hingabe erwarten.
Arendts Ton, so Scholems Auffassung, fehle eine apriorische Nähe zum jüdischen Volk. Ein derartiger Ton sei unangemessen bei Gelegenheiten, bei denen es das einzig Richtige ist, nicht die ganze Wahrheit zu sagen, weil es Momente gibt, in denen die Pflicht, die Wahrheit zu sagen, hinter einer Pflicht des Herzens, dem Herzenstakt, zurückstehen müsse. Scholem forderte keine Selbstzensur, sondern lediglich jenen Sinn für Angemessenheit, der uns auf einer Beerdigung davon abhält, über die Fehler der verstorbenen Person zu sprechen. Wo so viele noch trauern, ist sture Wahrhaftigkeit der reine Hohn.
Arendt ließ sich durch diesen Vorwurf nicht verunsichern und fand in ihrer Antwort an Scholem deutliche Worte.
»Sie haben vollkommen recht, dass ich eine solche ›Liebe‹ nicht habe, und dies aus zwei Gründen: Erstens habe ich nie in meinem Leben irgendein Volk oder Kollektiv ›geliebt‹, weder das deutsche, noch das französische, noch das amerikanische, noch etwa die Arbeiterklasse oder sonst was in dieser Preislage. Ich liebe in der Tat nur meine Freunde und bin zu aller anderen Liebe völlig unfähig. Zweitens aber wäre mir diese Liebe zu den Juden, da ich selbst jüdisch bin, suspekt. Ich liebe nicht mich selbst und nicht dasjenige, wovon ich weiss, dass es irgendwie zu meiner Substanz gehört. […] Das Grossartige dieses Volkes ist es einmal gewesen, an Gott zu glauben, und zwar in einer Weise, in der Gottvertrauen und Liebe zu Gott die Gottesfurcht bei weitem überwog. Und jetzt glaubt dieses Volk nur noch an sich? Was soll daraus werden? – – Also, in diesem Sinne ›liebe‹ ich die Juden nicht und ›glaube‹ nicht an sie.« 2
Für Arendt klang Scholems Liebe zum jüdischen Volk nach einem Aufruf zu kollektivem Narzissmus. Wir wissen, dass sie bezüglich vieler wichtiger, für ihre These über Eichmann zentraler Tatsachen falschlag; Tatsachen aber hätten an ihrem grundlegenden und tiefen Misstrauen gegen den »nichtreflexiven, sich selbst glorifizierenden Charakter von Gruppenzugehörigkeiten« nichts geändert, um eine Formulierung des Historikers Steven A. Aschheim von der Hebräischen Universität in Jerusalem zu zitieren. Obwohl beide, Scholem und Arendt, die Gruppe Brit Schalom unterstützt hatten, die sich in den zwanziger und dreißiger Jahren für eine arabisch-jüdische Koexistenz in Palästina eingesetzt hatte, waren sie uneins in der Frage, wie viel Nähe zum jüdischen Volk Arendts Tonfall verraten musste.
Um genauer zu begreifen, was uns hier nachdenklich stimmen sollte, möchte ich an eine andere Debatte erinnern, die wenige Jahre zuvor in Frankreich stattgefunden hatte und bei der ebenfalls die Position eines Intellektuellen einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hatte. Als Albert Camus 1957 in Stockholm mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, fragte ihn ein arabischer Student nach seiner Haltung zum Algerienkrieg. Camus' Antwort wurde berühmt: »In diesem Moment wirft man Bomben auf die Straßenbahnen von Algier. Meine Mutter könnte sich in einer dieser Straßenbahnen befinden. Wenn genau das Gerechtigkeit ist, dann ziehe ich meine Mutter vor.« 3
Diese Stellungnahme führte zu heftigen Reaktionen in französischen und ausländischen Intellektuellenkreisen. Norman Podhoretz, von 1960 bis 1995 Chefredakteur des US-amerikanischen Magazins Commentary, schrieb dazu später: »Als er verkündete, er zöge seine Mutter der Gerechtigkeit vor, entschied er sich, in O'Briens 4 Worten, für ›seinen eigenen Stamm‹ und gegen ein abstraktes Ideal universeller Gerechtigkeit. Eine größere Häresie gegen die Dogmen der Linken ist kaum vorstellbar.« 5
In der Tat hatten sich die öffentlichen Einmischungen von Intellektuellen seit der Dreyfus-Affäre Ende des 19. Jahrhunderts durch ihren Universalitätsanspruch definiert. Das änderte sich auch im 20. Jahrhundert nicht. Rückblickend betonte der britische Kulturhistoriker Andrew Hussey diesen Aspekt in einem Aufsatz in der britischen Literaturzeitschrift Literary Review: Camus' »leidenschaftliche Feststellung galt Generationen von Antikolonialisten und Theoretikern des Postkolonialismus – darunter Leuten wie Edward Said – als Beweis für seine Charakterschwäche und Wankelmütigkeit und damit indirekt auch für seine koloniale Arroganz gegenüber Algerien.« 6
Ich erinnere hier ausschließlich deshalb an den Fall Camus, weil sich so die Lage des heutigen jüdischen Intellektuellen im Unterschied zu der des, ich nenne ihn einmal europäischen Intellektuellen besser verstehen lässt. Was europäischen Intellektuellen immer ein Gräuel war – die eigene Gruppe und Familie gegen universelle Ansprüche zu verteidigen –, ist genau das, was üblicherweise von jüdischen Intellektuellen erwartet wird – und damit meine ich nicht einfach Intellektuelle jüdischer Herkunft, sondern jene, die sich in einem Dialog mit ihrer Gemeinschaft befinden.
Mir ist natürlich bewusst, dass sich die jüdische intellektuelle Welt durch eine große Bandbreite an Positionen auszeichnet, die von der zionistischen über die religiös-zionistische und die liberal-säkulare bis hin zur antizionistischen reichen. Und doch gibt es in dieser Vielfalt strukturelle Zwänge, Anreize und Mittel zur Abschreckung, die die Stellung des jüdischen Intellektuellen in gewisser Weise einzigartig machen. Um diese Stellung und die mit ihr verbundenen Zwänge zu verdeutlichen, werde ich mich an Julien Bendas Definition des Intellektuellen halten. In seiner Schrift Der Verrat der Intellektuellen von 1927 plädierte der französische Philosoph und Schriftsteller dafür, die Intellektuellen müssten sich über das Schlachtgewühl der gewöhnlichen Politik erheben. Distanz zur eigenen nationalen, religiösen oder ethnischen Gruppe sei Grundvoraussetzung dafür, dass der Intellektuelle seine moralische Integrität wahren könne. Diese sei schließlich, so Benda, durch universelle Werte gekennzeichnet, für die man nur einstehen könne, wenn man sich der partikularistischen, nationalen Mitgliedschaft in einer Gruppe entschlage.
Arendts Ablehnung von Ahabath Israel hat jedoch noch tiefere Gründe als ihre Abneigung gegen kollektiven Narzissmus. Eine solche Liebe bedrohte, was Arendt wie vielen anderen Denkern und Denkerinnen vor ihr als das Wesen des Denkens galt, nämlich die Unabhängigkeit des Geistes. Im oben schon zitierten Brief an Scholem erklärte sie, ohne mit ihrem Überlegenheitsgefühl hinterm Berg zu halten:
»Was Sie […] verwirrt, ist, dass meine Argumente und meine Denkweise nicht vorgesehen sind. Oder mit anderen Worten, dass ich unabhängig bin. Und damit meine ich einerseits, dass ich keiner Organisation angehöre und immer nur im eigenen Namen spreche; und andererseits, dass nur Selber-Denken fett macht und dass, was immer Sie gegen die Resultate einzuwenden haben, Sie selbige nicht verstehen werden, wenn Ihnen nicht klar ist, dass Sie auf meinem Mist gewachsen sind und niemandes sonst.« 7
Wie für viele Denker in der Tradition der Aufklärung hing auch für Arendt die Möglichkeit, die Wahrheit zu erkennen, von der Möglichkeit ab, selbständig, ungehindert durch Vorurteile und Traditionen zu denken. Diese Unabhängigkeit verlieh ihr ein entscheidendes Recht: nämlich das, nicht die besondere historische Situation des jüdischen Volkes zu thematisieren. Wenn sich wahres Denken durch seine Unabhängigkeit auszeichnet, muss es die Bedürfnisse seines Publikums oder seiner Bezugsgruppe außer Acht lassen. Im Bannkreis der Voreingenommenheiten einer Gruppe zu verharren würde die Fähigkeit der Denkerin gefährden, sich auf desinteressierte Weise von der Welt zurückzuziehen. Arendt prägte einen bemerkenswerten Ausdruck für eine solche Aktivität des Denkens, den der »desinteressierten Intelligenz«. Damit meinte sie das Vermögen, sich von seinen Selbstbestimmungen und von seiner Identität zu lösen, die Welt aus zahlreichen Perspektiven zu verstehen und zu beurteilen, also aus sich selbst herauszutreten.
Scholem hatte recht: Arendt vertrat die Position, die den europäischen jüdischen Intellektuellen am vertrautesten war. In ihrer Mehrheit hatten sie den Nationalismus abgelehnt, Universalismus und Lessings Selbstdenken 8 betrachteten sie quasi als Synonyme: Selbst zu denken bedeutete für sie, Universalist zu sein, setzte es doch die Fähigkeit voraus, die Menschheit in ihrer Gesamtheit zu sehen und zu begreifen, statt sich dem Gesichtspunkt einer bestimmten Gruppe anzuschließen. Gruppen verfolgten partikulare Interessen und konnten das scharfe Schwert der desinteressierten Intelligenz nur stumpf werden lassen.
Die Juden sahen Patriotismus und Nationalismus noch kritischer als Nichtjuden. Schließlich hatten sich beide Phänomene parallel zum Rassismus herausgebildet und entwickelt. Auch war für die Juden die Ausweitung universeller Rechte der schnellste Weg gewesen, um in ihren jeweiligen nationalen Kontexten Gleichheit zu erlangen. In den Worten des Soziologen Zygmunt Bauman: »Universalität ist der Schlachtruf der Unterprivilegierten […] [und] die Juden waren unterprivilegiert.« 9
Wie Arendt jedoch am eigenen Leibe erfahren musste, stellte sich die Frage der Gruppensolidarität für die jüdischen Intellektuellen mit neuer Dringlichkeit, und zwar aufgrund der beiden wichtigsten Ereignisse der jüdischen Geschichte im letzten Jahrtausend: des Holocaust und der Gründung des jüdischen Staates. Als imaginierte Gemeinschaft reorganisierten sich die Juden um einen neuen geographischen und politischen Mittelpunkt – Israel – sowie um eine neue Zeitachse – das Andenken an die Schoah. Dies allerdings erschwerte es den jüdischen Intellektuellen erheblich, an der bislang von ihnen vertretenen universalistischen Position festzuhalten.
Auch wenn manche Juden ihrer Gesinnung treu blieben, sah sich dieser Universalismus ab den sechziger Jahren mit den in hohem Maße partikularistischen Anforderungen des Staates Israel und der Pflege der kollektiven Erinnerung an die Schoah konfrontiert. Beides erneuerte, ja verschärfte die Ansprüche, die Ahabath Israel an die Intellektuellen stellt. Wie der französische Historiker Pierre Birnbaum schrieb: »[Eine] lange Geschichte kommt wahrscheinlich an ihr Ende: die des Zusammentreffens der Juden und einer streng universalistisch verstandenen Aufklärung.«10
Arendts Weigerung, auf die Bedürfnisse ihrer Gruppe einzugehen, und der Zorn, den ihre Positionen hervorriefen, bilden nur einen von vielen Fällen in einer langen Liste feindseliger Reaktionen der organisierten jüdischen Gemeinschaft auf Kritik.11 (Unter Kritik verstehe ich hier die durchgängige Hinterfragung der Überzeugungen und Praktiken einer Gruppe.) Tatsächlich bestand in den vergangenen dreißig Jahren eine der beliebtesten Übungen diverser Repräsentanten jüdischer und israelischer Gemeinschaften darin, die verdeckten antizionistischen oder antijüdischen Grundsätze der Kritik an Israel oder dem Einfluss jüdischer Organisationen zu entlarven. Ich behaupte nicht, dass nicht manche Kritiken an Israel antisemitisch motiviert sein können. Ich stelle lediglich fest, dass es zu einem ausgefeilten kulturellen und intellektuellen Genre in der jüdischen Welt geworden ist, Kritik unter Verdacht zu stellen.