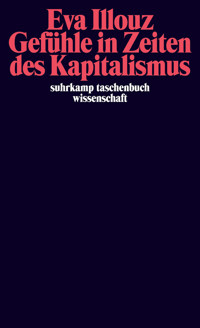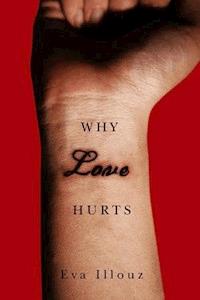21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unsere Kultur ist unendlich reich an Darstellungen und Geschichten, die vom Erscheinen der Liebe im Leben der Menschen handeln – von jenem magischen Augenblick, in dem wir wissen, dass jemand für uns bestimmt ist. Erstaunlicherweise ist sie aber eher wortkarg, wenn es um den nicht weniger mysteriösen Moment geht, in dem die Liebe endet (oder erst gar nicht beginnt).
Seit zwei Jahrzehnten beschäftigt sich Eva Illouz mit der Frage, wie der Konsumkapitalismus und die Kultur der Moderne unser Gefühls- und Liebesleben transformiert haben. Warum Liebe endet bildet den Abschluss dieses grandiosen Forschungsprojekts und zeigt, warum mit Blick auf unsere sexuellen und romantischen Beziehungen vor allem eines selbstverständlich geworden ist: sich von ihnen zu verabschieden.
Anhand einer großen Vielfalt an literarischen und geistesgeschichtlichen Quellen sowie im Rückgriff auf zahlreiche Gespräche, die sie mit Frauen und Männern aus verschiedenen Ländern geführt hat, arbeitet Illouz souverän heraus, wie es um Beziehungen in Zeiten von Speed-Dating und Tinder, von Gelegenheitssex und Körperkult bestellt ist – und warum insbesondere Frauen die Leidtragenden dieser gleichermaßen sexualisierten wie sexuell befreiten Kultur sind. Zeitgemäßer geht es nicht. Ein großer Wurf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
3Eva Illouz
Warum Liebe endet
Eine Soziologie negativer Beziehungen
Aus dem Englischen von Michael Adrian
Suhrkamp
9Für meine Söhne Netanel, Immanuel und Amitai
Für meine Mutter Alice
Für meine Geschwister Michael, Marc und Nathalie
zu denen die Liebe niemals endet
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
1. Einleitung: Von der Wahl zur Nichtwahl
Liebe als Freiheit
Das Unbehagen an einer Kritik der Freiheit
Eine Frage der Wahl
Die negative Wahl
2. Vormodernes Liebeswerben, soziale Gewissheit und die Entstehung negativer Beziehungen
Das Liebeswerben als soziologische Struktur
Die vormoderne Regulierung der Sexualität
Das Liebeswerben als vormoderne Weise der emotionalen Entscheidungsfindung
Gewissheit als soziologische Struktur
Normative Gewissheit
Existentielle Gewissheit
Ontologische Gewissheit
Evaluative Gewissheit
Prozedurale Gewissheit
Emotionale Gewissheit
Sexuelle Freiheit als Konsumfreiheit
Wie die Sexualität befreit wurde
Der Konsum als das Unbewusste der Sexualität
Sexualität als Moral, Befreiung als Macht
Eine neue soziale und sexuelle Grammatik
3. Verwirrender Sex
Die schwer fassbaren Auswirkungen der Gelegenheitssexualität
Gelegenheitssex und Ungewissheit
Ungewisse Rahmen
Die ungewisse Geographie von Beziehungen
Sexualität als Quelle von Gewissheit
Ungewissheit und negative Sozialität
4. Der Aufstieg der ontologischen Ungewissheit
Der Wert des Körpers
Symbolische und ökonomische Wertproduktion
Bewertung
Die Begegnung als evaluatives Vorstellungsgespräch
Konsumentenbewertung
Sexuelle Abwertung
Schönheit als Obsoleszenz
Abwertung durch Parzellierung
Abwertung durch die Verfeinerung des Geschmacks
Wechselnde Bezugspunkte der Bewertung
Der verworrene Status des Subjekts
5. Eine Freiheit mit vielen Grenzen
Zustimmung zu was?
Unklarer Wille
Schwankende Gefühle
Abwanderung ohne Widerspruch
Vertrauen und Ungewissheit
6. Die Scheidung als negative Beziehung
Das Ende der Liebe
Die Scheidung und die Position der Frau im emotionalen Feld
Die narrative Struktur der Trennung
Sexualität: The Great Separation
Konsumobjekte: Von Übergangs- zu Ausstiegsobjekten
Autonomie und Bindung: Das schwierige Paar
Emotionale Ontologien und nichtbindende emotionale Verträge
Emotionale Kompetenzen, Beziehungsdynamiken ‒ und Frauen
Schluss: Negative Beziehungen und die Schmetterlingspolitik des Sexes
Danksagung
Literatur
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
9
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
1.
11Einleitung: Von der Wahl zur Nichtwahl
Ich bin nur ein Chronist, meine Arbeit soll davon handeln, was es heißt, heute zu leben.
‒ Marc Quinn
Verstehen, dass man, um subversiv zu sein, vom Individuellen zum Kollektiven übergehen muss.
‒ Abd Al Malik
Ich frage [die Menschen] nicht nach dem Sozialismus, ich frage nach Liebe, Eifersucht, Kindheit und Alter. […] Das ist die einzige Möglichkeit, die Katastrophe in den Rahmen des Gewohnten zu zwingen und etwas darüber zu erzählen.
‒ Swetlana Alexijewitsch
Zu sehen, was sich vor der eigenen Nase befindet, bedarf ständiger Anstrengung.
‒ George Orwell1
Die westliche Kultur ist unendlich reich an Darstellungen und Geschichten, die vom wundersamen Erscheinen der Liebe im Leben der Menschen handeln ‒ von jenem magischen Augenblick, in dem wir wissen, dass jemand für uns bestimmt ist; vom fieberhaften Warten auf einen Anruf oder eine E-Mail; vom wohligen Schauer der Erregung, der uns beim bloßen Gedanken an ihn oder sie durchströmt. Verliebt sein heißt, zur Platonikerin zu werden: durch eine Person hindurchzusehen auf eine Idee, auf etwas im umfassenden Sinne Makelloses.2 Unzählige Romane, Gedichte und Filme lehren uns, in dieser Hinsicht Platons Schülerinnen und Schüler zu werden, unterweisen uns also in der Kunst, die Vollkommenheit zu lieben, die sich in der geliebten Person manifestiert. Erstaunlicherweise ist diese Kultur, die doch so viel über die Liebe zu sagen hat, aber eher wortkarg, wenn es um den nicht weniger 12mysteriösen Moment geht, in dem wir es vermeiden, uns zu verlieben, oder uns entlieben; in dem uns die Person, die uns schlaflose Nächte bereitete, auf einmal gleichgültig ist oder wir auf Abstand gehen zu denjenigen, die uns noch vor wenigen Monaten oder gar Stunden in helle Begeisterung versetzt haben. Dieses Schweigen ist umso verwunderlicher, als die Zahl der Beziehungen, die schon bald nach ihrem Beginn wieder enden oder irgendwann im Laufe ihrer emotionalen Entwicklung zerbrechen, schwindelerregend hoch ist. Vielleicht weiß unsere Kultur nicht, wie sie dieses Phänomen darstellen oder darüber nachdenken soll, weil wir in und durch Geschichten und Dramen leben, sich zu »entlieben« aber kein Plot mit einer klaren Struktur ist: Meistens beginnt dieser Prozess nicht mit einer Eröffnung, einer Offenbarung, sondern im Gegenteil: Manche Beziehungen schlafen ein oder lösen sich auf, noch bevor oder bald nachdem sie richtig angefangen haben, während andere einen langsamen und rätselhaften Tod sterben.
Und doch bedeutet der Vorgang, in dem Liebe endet (oder gar nicht erst richtig beginnt), aus soziologischer Perspektive sehr viel, da es hier um die Auflösung sozialer Bindungen geht, die wir seit Emile Durkheims bahnbrechender Studie Der Selbstmord womöglich als das zentrale Thema der soziologischen Forschung verstehen müssen.3 In der vernetzten Welt der Moderne aber tritt eine Anomie ‒ der Zusammenbruch der sozialen Beziehungen und des gesellschaftlichen Zusammenhalts ‒ nicht in erster Linie in Gestalt von Entfremdung oder Einsamkeit auf. Vielmehr scheint die Auflösung (potentiell oder realiter) enger und intimer Bindungen stark mit dem Wachstum (realer oder virtueller) sozialer Netzwerke, mit Technologie und einer beeindruckenden ökonomischen Beratungs- und Lebenshilfemaschinerie zusammenzuhängen: Psychologen aller Art, Talkshow-Moderatoren, die Porno- und die Sexspielzeugindustrie, die Selbsthilfebranche, Einkaufspaläste und Konsumtempel ‒ sie alle 13sorgen für den permanenten Prozess des Knüpfens und Lösens sozialer Bindungen. Begriff die Soziologie Anomie traditionell als eine Folge von Isolation und mangelnder Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft oder Religion,4 muss sie nunmehr einer schwerer fassbaren Eigenschaft sozialer Bindungen in der hyperkonnektiven Moderne Rechnung tragen: ihrer Flüchtigkeit trotz ‒ und wegen ‒ der Allgegenwart von sozialen Netzwerken, Technologie und Konsum. Das vorliegende Buch fragt nach den kulturellen und gesellschaftlichen Bedingungen, die uns ein inzwischen vertraut gewordenes Merkmal von Sex- und Liebesbeziehungen erklären: dass wir uns von ihnen verabschieden. Wenn wir uns fragen, warum Liebe endet, begeben wir uns auf ein Terrain, in dem sich besonders gut nachvollziehen lässt, wie die wechselseitige Durchdringung von Kapitalismus, Sexualität, Geschlechterverhältnissen und Technologie eine neue Form von (Nicht-)Sozialität hervorbringt.
*
Die Aufgabe, unser Sexual- und Liebesleben zu retten, zu gestalten und anzuleiten, haben wir den Psychologen anvertraut. Die Vertreter dieser Zunft konnten uns zwar mit durchaus bemerkenswertem Erfolg davon überzeugen, dass uns ihre sprachlichen und emotionalen Techniken womöglich zu einem besseren Leben verhelfen. Für das aber, was unser Liebesleben kollektiv plagt, haben sie wenig bis gar kein Verständnis gezeigt. Sicherlich weisen die unzähligen Geschichten, die im geschützten Raum der psychologischen Beratung zu hören sind, eine wiederkehrende Struktur und gemeinsame Themen auf, die über die Besonderheit der Personen, die sie erzählen, hinausweisen. Es ist ziemlich leicht, das Leitmotiv der in diesem Rahmen vorgebrachten Klagen zu erraten: Warum fällt es mir so schwer, intime Liebesbeziehungen einzugehen oder aufrechtzuerhalten? Ist diese Beziehung gut oder 14schlecht für mich? Soll ich in dieser Ehe bleiben? ‒ Diesen Fragen und ihrem nie verklingenden Echo in den allgegenwärtigen Lebenshilfeforen, Workshops und Selbsthilfebüchern ist eines gemeinsam: eine tiefe, bohrende Ungewissheit über das Gefühlsleben. Wir haben Probleme damit, unsere eigenen und die Gefühle anderer zu verstehen, und nur mit Mühe, wenn überhaupt, können wir herausfinden, wann und wo man Kompromisse machen muss oder was wir anderen beziehungsweise was diese uns schuldig sind. Wie die Psychotherapeutin Leslie Bell schrieb: »[I]n Interviews und in meiner psychotherapeutischen Praxis mit jungen Frauen habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie nicht nur stärker als je zuvor darüber verunsichert sind, wie sie das bekommen, was sie wollen, sondern auch darüber, was sie überhaupt wollen.«5 Eine solche Desorientiertheit, die in den Sprechzimmern von Psychologinnen so weit verbreitet ist wie außerhalb, wird oft als Folge der Ambivalenzen der menschlichen Seele verstanden, als Auswirkung eines verspäteten Eintritts ins Erwachsenenleben oder einer psychischen Konfusion, die von widersprüchlichen kulturellen Botschaften über Weiblichkeit hervorgerufen wird. Wie ich jedoch in diesem Buch zeigen möchte, ist emotionale Ungewissheit im Bereich von Liebe, Romantik und Sexualität die direkte soziologische Folge einer Ideologie der individuellen Wahl, die den Konsummarkt, die therapeutische Industrie und die Internettechnologie zu einem einzigen Komplex verschmolzen hat ‒ und selbst zum wichtigsten kulturellen Rahmen der Organisation von persönlicher Freiheit geworden ist. Die Art von Ungewissheit, die die zeitgenössischen Beziehungen plagt, ist ein soziologisches Phänomen: Es gab sie nicht schon immer, jedenfalls nicht in diesem Umfang; sie war nicht so weit verbreitet, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß; sie hatte nicht den Inhalt, den sie heute für Männer und Frauen hat; und zweifellos zog sie nicht die systematische Aufmerksamkeit von Experten und Wissenssystemen aller Art auf sich. Die Flüchtigkeit, die Rätsel und die Schwierigkei15ten, die so charakteristisch für viele Beziehungen sind und zugleich zu ihrer endlosen psychologischen Kommentierung Anlass bieten, sind eindeutig der Ausdruck einer allgemeinen »Ungewissheit« in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Dass so viele Menschen heutzutage unter derselben Ungewissheit leiden, ist kein Zeichen der Universalität eines selbstwidersprüchlichen Unbewussten, sondern vielmehr eines der Globalisierung der Lebensbedingungen.
Diese Studie ist ein weiterer Teil eines vor zwanzig Jahren begonnenen Forschungsprojekts zur Transformation unseres Gefühls- und Liebeslebens durch den Kapitalismus und die Kultur der Moderne. Wenn es einen Grundsatz gibt, der meine Arbeit während der vergangenen zwei Dekaden geleitet hat, dann den, dass die Analyse der Desorganisation des Privat- und Intimlebens nicht allein der Psychologie überlassen werden darf. Der immense Beitrag, den die Soziologie zu leisten vermag, besteht in ihrem Beharren darauf, dass psychische Erfahrungen ‒ Bedürfnisse, Triebe, innere Konflikte, Begierden oder Ängste ‒ die Dramen unseres kollektiven Lebens durchspielen und wiederholen; dass unsere subjektiven Erfahrungen gesellschaftliche Strukturen widerspiegeln und in Existenz halten, ja in Wirklichkeit konkrete, verkörperte, gelebte Strukturen sind. Eine nichtpsychologische Analyse unseres Innenlebens ist umso dringender geboten, als der kapitalistische Markt und die Konsumkultur uns dazu zwingen, unsere Innerlichkeit zu der einzigen Ebene unseres Daseins zu machen, die sich real anfühlt, wobei Autonomie, Freiheit und Genuss in all ihren Formen die Leitfäden einer solchen Innerlichkeit bilden.6 Während wir uns in eine Individualität, Emotionalität und Innerlichkeit zurückziehen, die uns als Schauplätze der Selbstermächtigung erscheinen mögen, schaffen und erfüllen wir ironischerweise gerade die Voraussetzungen einer ökonomischen und kapitalistischen Subjektivität, die die soziale Welt fragmentiert und ihre Objektivität unwirklich werden lässt. Aus diesem Grund ist eine soziologi16sche Kritik der Sexualität und der Gefühle entscheidend für eine Kritik des Kapitalismus selbst.
Zum vorläufigen Abschluss meiner Erforschung des Verhältnisses von Gefühlsleben, Kapitalismus und Moderne möchte ich mich stärker mit der Frage befassen, vor die sich die Philosophie des Liberalismus seit dem 19. Jahrhundert gestellt sieht: Gefährdet die Freiheit die Möglichkeit, substantielle und feste Bindungen einzugehen, insbesondere romantische? In allgemeiner Form ist diese Frage in den letzten zweihundert Jahren im Zusammenhang mit dem Niedergang der Gemeinschaft und der Zunahme an Marktbeziehungen immer wieder gestellt worden.7 Für den Bereich der Gefühle jedoch wurde sie seltener aufgeworfen, obwohl die emotionale Freiheit das Wesen der Subjektivität und Intersubjektivität auf vollkommen neue Füße gestellt hat und für die Moderne nicht weniger zentral ist als andere Formen von Freiheit. Und auch nicht weniger belastet mit Mehrdeutigkeiten und Aporien.
Liebe als Freiheit
Die Liebe, das Gefühl der Verschmelzung schlechthin, beinhaltet paradoxerweise ein Fragment der ausgedehnten und komplexen Geschichte von Autonomie und Freiheit, die zumeist in politischen Begriffen erzählt wird. Nur ein Beispiel: Das Genre der Liebeskomödie ‒ das mit Menander entstand, von den Römern mit Plautus' und Terenz' Stücken fortgesetzt wurde und in der Renaissance zu neuer Blüte fand ‒ handelte vom Anspruch junger Menschen auf Freiheit gegenüber Eltern, Lehrern und alten Männern. Während die Liebe in Indien und China in religiös modellierten Geschichten verhandelt wurde, einen festen Bestandteil im Leben der Götter bildete und nicht an sich gegen gesellschaftliche Autoritäten aufbegehrte, löste sie sich in Westeuropa und den Vereinigten Staaten (sowie in relativem, aber geringerem Maße in Ost17europa) nach und nach von der religiösen Kosmologie ab.8 Hier wurde sie von adligen Eliten kultiviert, die auf der Suche nach einem Lebensstil waren. In der Folge entwickelte sich die Liebe, die ursprünglich einmal Gott gegolten hatte,9 zum zentralen Träger für die Herausbildung des emotionalen Individualismus;10 die Gefühle richten sich nunmehr auf eine Person, deren Innerlichkeit als eine von sozialen Institutionen unabhängige erlebt wird. Allmählich behauptete sich die Liebe gegen die Regeln der Endogamie, gegen patriarchale und kirchliche Autorität sowie die Kontrolle durch die Gemeinschaft. Ein Bestseller des 18. Jahrhunderts wie Julie oder die neue Héloïse (1761) handelt vom Recht des Individuums auf seine Empfindungen und damit von dem Recht, das Objekt seiner Liebe nach eigenem Willen auszuwählen und zu heiraten. Innerlichkeit, Freiheit, Gefühle und die Möglichkeit der Wahl bildeten eine einzige Matrix, die die Ehepraktiken und die Stellung der Ehe revolutionieren sollte. In dieser neuen kulturellen und emotionalen Ordnung wurde unter dem Willen nicht mehr die Fähigkeit verstanden, die eigenen Wünsche zu regulieren (wie im Christentum), sondern genau die entgegengesetzte Fähigkeit, diesen Wünschen gemäß zu handeln und ein Objekt zu wählen, das den individuellen, dem eigenen Willen entsprungenen Gefühlen entsprach. So gesehen entwickelten sich die romantische Liebe und die Gefühle im persönlichen Bereich zur Grundlage moralischer Ansprüche auf Freiheit und Autonomie, die sich nicht weniger machtvoll zur Geltung bringen sollten als die entsprechenden Forderungen im öffentlichen und durchweg von Männern dominierten Bereich der Politik, nur dass diese Revolution ohne sichtbare Demonstrationen, Gesetzesentwürfe und Straßenkämpfe auskam. Sie wurde ebenso von Romanautorinnen, Protofeministinnen, Philosophen und Intellektuellen vorangetrieben, die über die Sexualität nachdachten, wie von einfachen Männern und Frauen. Der Anspruch auf emotionale Autonomie, der in der Liebe lag, war eine mächtige Wirkkraft für den gesell18schaftlichen Wandel und veränderte in grundlegender Weise den Prozess der Paarbildung, die Bestimmung der Ehe und die Autorität der traditionellen sozialen Agenturen.11 Während sie somit dem Anschein nach eine Sache des Privatlebens und der Gefühle war, barg die romantische Liebe in Wirklichkeit einen urpolitischen Anspruch: Das Recht, das Objekt seiner Liebe selbst zu wählen, entwickelte sich nach und nach zum Recht des Individuums, seine Gefühle als Quelle seiner Autorität zu verstehen,12 das seinerseits einen wichtigen Teil der Geschichte der Autonomie darstellt. Die Geschichte der Liebe im Westen ist somit nicht nur ein Randmotiv im großen Fresko der historischen Entfaltung der Moderne. Sie war tatsächlich ein Hauptfaktor bei der Umgestaltung des Verhältnisses der Individuen zu Ehe und Familie, die gravierende Konsequenzen für das Verhältnis nach sich zog, das die Ehe bis dahin zur Sphäre der Wirtschaft unterhalten hatte. Als der Liebe und den Gefühlen eine moralische Autorität zuerkannt wurde, veränderte dies die Ehe und damit zugleich die Muster der Reproduktion und der Sexualität, der wirtschaftlichen Akkumulation und des wirtschaftlichen Austauschs.
Das vielgestaltige Phänomen, das wir emotionale und persönliche Freiheit nennen, bildete sich mit der Etablierung einer Privatsphäre heraus, die weit weg war vom langen Arm der Gemeinschaft und der Kirche. Nach und nach wurde diese individuelle Freiheit durch den Staat und durch Gesetze zum Schutz des Persönlichkeitsrechts abgesichert; sie trug zu den kulturellen Umwälzungen bei, deren Speerspitze künstlerische Eliten und später Medienindustrien waren, und sie stützte schließlich die Formulierung des Rechts der Frau, über ihren eigenen Körper zu verfügen ‒ der zuvor nicht ihr, sondern eigentlich ihren Vormündern gehört hatte. Die emotionale Autonomie umfasst somit Behauptungen über die Freiheit der Innerlichkeit des Subjekts ebenso wie (spätere) Ansprüche auf sexuell-körperliche Freiheit, auch wenn beide Arten von Freiheit auf unterschiedliche Kulturgeschichten 19zurückblicken: Die emotionale Freiheit wurzelt in der Geschichte der Gewissensfreiheit und der Geschichte der Privatheit, während die sexuelle Freiheit ein historisches Resultat der Emanzipationsbestrebungen von Frauen sowie rechtlicher Neukonzeptionen des Körpers war. Tatsächlich verfügten Frauen bis in die jüngste Vergangenheit nicht wirklich über ihren eigenen Körper; sie konnten beispielsweise ihrem Gatten den Geschlechtsakt nicht verweigern. Die sexuelle und die emotionale Freiheit verbanden sich eng miteinander, um sich schließlich unter der breitgefassten Kategorie des Selbsteigentums wechselseitig zu stützen: »Der libertäre Grundsatz des Selbsteigentums besagt, dass jede Person die vollen und ausschließlichen Rechte der Kontrolle und des Gebrauchs ihrer selbst und ihrer Vermögen besitzt und daher niemandem einen Dienst oder ein Produkt schuldet, dem gegenüber sie sich nicht vertraglich zur Lieferung eines solchen verpflichtet hat.«13 Konkreter beinhaltete das libertäre Prinzip des Selbsteigentums die Freiheit, die eigenen Gefühle zu haben und über sie zu verfügen, aber auch die Freiheit, den eigenen Körper zu besitzen und zu kontrollieren, die später die Freiheit einschließen sollte, seine Sexualpartner selbst auszuwählen und Beziehungen nach Belieben einzugehen und zu beenden. Kurz gesagt umfasst das Selbsteigentum die Führung des eigenen Gefühls- und Sexuallebens aus dem Raum der eigenen Innerlichkeit heraus, ohne Behinderung durch die Außenwelt, so dass die eigenen Gefühle, Wünsche oder subjektiv definierten Ziele die eigenen Wahlentscheidungen und Erlebnisse bestimmen. Emotionale Freiheit ist eine besondere Form von Selbsteigentum, bei der die Gefühle die Freiheit, körperlichen Kontakt und sexuelle Beziehungen mit einer Person der eigenen emotionalen Wahl zu haben, anleiten und rechtfertigen. Diese Form des Selbsteigentums markiert den Übergang zur emotionalen Moderne, wie ich sie nennen möchte. Herausgeschält hat sich die emotionale Moderne seit dem 18. Jahrhundert, voll verwirklicht aber wurde sie erst im Anschluss an die 1960er Jahre, als 20eine sexuelle Wahl auf der Basis rein subjektiver emotionaler und hedonistischer Gründe kulturell legitimiert wurde; in ihrer neusten Gestalt zeigt sie sich heute in Form von Internet-Sexportalen und Dating-Apps.
Als einer der ersten Soziologen hat Anthony Giddens das Wesen der emotionalen Moderne herausgearbeitet. Er betrachtet Intimität als ultimativen Ausdruck der Freiheit des Individuums, seiner Loslösung aus älteren Bezugssystemen der Religion, der kulturellen Traditionen sowie der Ehe als einer Rahmenbedingung des wirtschaftlichen Überlebens.14 Für Giddens besitzen Individuen die Ressourcen, um die Fähigkeit, gleichzeitig autonom und intim zu sein, aus sich selbst heraus zu gestalten. Der Preis, der dafür zu zahlen ist, besteht ihm zufolge in einem Zustand der »ontologischen Unsicherheit«, der das Individuum in ständiger innerer Unruhe hält. Insgesamt aber bedeutet sein vieldiskutierter Begriff der »reinen Beziehung« eine deskriptive und normative Bejahung der Moderne, denn er unterstellt, dass die Intimität die zentralen Werte des modernen liberalen Subjekts in Kraft setzt: eines Subjekts, das sich seiner Rechte bewusst ist und sie zu nutzen weiß, vor allem dadurch, dass es durch einen impliziten Vertrag enge Beziehungen nach eigenem Gutdünken einzugehen und auch zu beenden vermag. Für Giddens ist das Subjekt, das eine reine Beziehung eingeht, frei; es weiß um seine Bedürfnisse und kann mit einem anderen über sie verhandeln. Die reine Beziehung ist der liberale Sozialvertrag par excellence. Auch für Axel Honneth (wie vor ihm für Hegel) verwirklicht sich Freiheit in der Beziehung zu einem anderen.15 Freiheit ist damit die normative Grundlage der Liebe und der Familie, wobei die Familie zum Ausdruck von Freiheit schlechthin wird, die sich in einer Fürsorgeeinheit verwirklicht. Giddens wie Honneth verkomplizieren das traditionelle Modell des Liberalismus, in dem das Selbst den anderen lediglich als Hindernis für die eigene Freiheit betrachtet: Für beide Denker erfährt das freie Selbst 21seine volle Verwirklichung erst durch Liebe und Intimbeziehungen.
Doch wie ich im vorliegenden Buch zeigen will, wirft dieses Modell der Freiheit neue Fragen auf. Intimität ist heute nicht mehr ‒ falls sie es je war ‒ ein Prozess zweier sich völlig bewusster Subjekte, die einen Vertrag eingehen, dessen Bedingungen sie beide kennen und akzeptieren. Vielmehr ist schon die bloße Möglichkeit, einen solchen Vertrag aufzusetzen, seine Bedingungen zu kennen und sich auf die Prozeduren seiner Erfüllung zu einigen, bedrückend ungreifbar geworden. Damit man einen Vertrag eingehen kann, muss Einigkeit über seine Bedingungen herrschen; ein Vertrag setzt einen klar definierten Willen voraus, der sich seiner Ziele bewusst ist; es muss ein Verfahren geben, um einen Vertrag zu schließen, und eine Sanktion für den Fall, dass eine der beiden Parteien gegen ihn verstößt. Und schließlich umfasst ein Vertrag definitionsgemäß Klauseln, die vor Überraschungen schützen sollen. Diese Bedingungen für vertragsbasierte Beziehungen sind heutzutage kaum mehr gegeben.
Die Institutionalisierung der sexuellen Freiheit mittels Konsumkultur und Technologie hat vielmehr den gegenteiligen Effekt gehabt: Sie hat jegliche Gewissheit über die Substanz, den Rahmen und das Ziel sexueller und emotionaler Verträge grundlegend erschüttert. All dies steht zur Disposition und ist permanent umstritten, wodurch die Metapher des Vertrags ausgesprochen unzureichend wird, um das zu erfassen, was ich die negative Struktur zeitgenössischer Beziehungen nenne ‒ die Tatsache, dass die Akteurinnen nicht wissen, wie sie die Beziehung definieren, bewerten oder führen sollen, die sie nach vorhersehbaren und tragfähigen sozialen Drehbüchern beginnen. Die sexuelle und die emotionale Freiheit haben die bloße Möglichkeit, die Bedingungen eines Verhältnisses zu definieren, zu einer offenen Frage und zu einem Problem gemacht, das gleichermaßen psychologischer wie soziologischer Natur ist. Nicht eine Vertragslogik, sondern 22eine allgemeine chronische und strukturelle Ungewissheit waltet nunmehr über die Herausbildung sexueller oder romantischer Beziehungen. Während wir gemeinhin davon ausgegangen sind, dass sich sexuelle und emotionale Freiheit wechselseitig spiegeln, dass sie einander stützen und reflektieren, möchte ich diese Annahme auf den folgenden Seiten in Zweifel ziehen und die These aufstellen, dass die emotionale und die sexuelle Freiheit unterschiedlichen institutionellen und soziologischen Entwicklungspfaden folgen. Die sexuelle Freiheit ist in unseren Tagen ein Interaktionsbereich, in dem »alles rund läuft«: Die Akteurinnen verfügen über eine Fülle an technologischen Mitteln, kulturellen Drehbüchern und Bildern, um ihr Verhalten zu steuern, Gefallen an einer Interaktion zu finden und die Grenzen dieser Interaktion festzulegen. Die Gefühle jedoch haben sich zu der Ebene des sozialen Erlebens entwickelt, die »Probleme macht«, zu einem Bereich, in dem Verwirrung, Unsicherheit und sogar Chaos herrschen.
Meine Untersuchung widmet sich der sexuellen Freiheit vermittels der Frage nach der emotionalen Erfahrung, die diese hervorruft oder nicht hervorruft. Sie kann dadurch hoffentlich das konservative Lamento über die sexuelle Freiheit ebenso weiträumig umschiffen wie ihre libertäre Verherrlichung, die sie über alle anderen Werte stellt. Ich werde mich vielmehr kritisch mit der Bedeutung der emotionalen und der sexuellen Freiheit auseinandersetzen, indem ich deren Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen empirisch untersuche. Ganz gleich, ob man sie befürwortet oder verurteilt, eignet der Freiheit eine institutionelle Struktur, die auf die Selbstverständnisse und sozialen Beziehungen der Akteure durchschlägt. Diese Auswirkungen gilt es zu analysieren, indem wir uns apriorischer Annahmen über die Vorzüge von Monogamie, Jungfräulichkeit, Kernfamilien, multiplen Orgasmen und Gruppen- oder Gelegenheitssex enthalten.
23Das Unbehagen an einer Kritik der Freiheit
Eine solche Herangehensweise wird zwangsläufig in diversen intellektuellen Kreisen Irritationen und Widerstand auslösen. Der erste Widerstand kommt von den sexuell Libertären, für die eine Kritik der (sexuellen) Freiheit bedeutet, dass man sich in einem »Stadium des hysterischen Moralismus und der reaktionären Prüderie« befindet ‒ um Camille Paglias strenge Verurteilung zu zitieren.16 Diese Position gleicht jedoch der Behauptung, eine Kritik der ökonomischen Freiheit und Deregulierung laufe auf einen Rückfall in die hysterische Forderung nach der Gründung von Kolchosen hinaus. Die Kritik der Freiheit ist und bleibt das gute Recht konservativer wie emanzipatorischer Wissenschaftlerinnen, und nichts an ihr verlangt nach einer Rückkehr zu moralischer Prüderie, Verklemmtheit oder Doppelmoral. Die kritische Befragung des gegenwärtigen Stands der emotionalen und der sexuellen Freiheit ist letztlich nichts anderes als eine Rückbesinnung auf die zentrale Frage der klassischen Soziologie: Wo verläuft die Bruchlinie zwischen Freiheit und Anomie?17 Wo endet die Freiheit und beginnt ein amoralisches Chaos? In diesem Sinne markiert meine Untersuchung über die soziale und emotionale Auswirkung der sexuellen Freiheit eine Rückkehr zum Kern von Durkheims Fragen nach dem Verhältnis von Gesellschaftsordnung und Anomie: Ich möchte wissen, wie das Eindringen des Kapitalismus in die Privatsphäre zentrale normative Prinzipien dieser Sphäre verändert und zerrüttet hat.
Ein zweiter Einwand kommt womöglich aus akademischen Disziplinen wie den Kulturwissenschaften, Queer Studies und der Geschlechterforschung, die sich traditionell mit Formen der Ausgrenzung und Entmündigung beschäftigen, Freiheit also implizit oder ausdrücklich zum Leitstern ihrer Forschung erheben. Wie Axel Honneth zu Recht behauptet, 24steht die Freiheit für uns Moderne über allen anderen Werten, auch denen der Gleichheit und der Gerechtigkeit.18 Auf je ihre Art haben libertäre Feministinnen und schwule Aktivisten (vor allem die Unterstützer der Pro-Porno-Bewegung), Literaturwissenschaftler und Philosophen die Freiheit stets als das gefährdetste Gut überhaupt betrachtet und sich deshalb davor gescheut, ihre Pathologien unter die Lupe zu nehmen, es sei denn in Form einer ermüdenden Kritik am Neoliberalismus oder in Fällen, in denen sich diese Pathologien auf einen vom Konsummarkt geförderten »Narzissmus« oder »utilitaristischen Hedonismus« beziehen lassen. Auf diese Bedenken lässt sich in zweierlei Weise antworten. Die erste Entgegnung hat exemplarisch Wendy Brown vorgebracht: »Wie sich gezeigt hat, kann die Freiheit in ihrer historischen, semiotischen und kulturellen Wandelbarkeit und politischen Unbestimmbarkeit in liberalen Regimen leicht für die zynischsten und emanzipationsfeindlichsten politischen Ziele zweckentfremdet werden.«19 Wenn das stimmt ‒ und davon bin ich überzeugt ‒, dann ist Freiheit ein soziales Arrangement, das wir stets gleichermaßen zu bewahren und zu hinterfragen haben. Die zweite Erwiderung folgt aus der ersten und ist methodologischer Natur. Gestützt auf David Bloors Prinzip der Symmetrie ‒ dem zufolge unterschiedliche Phänomene auf symmetrische Weise erforscht werden müssen, ohne dabei das Wissen vorauszusetzen, welches »gut« oder »schlecht«, »Gewinner« oder »Verlierer« ist ‒ können wir die These vertreten, dass die Freiheit sowohl in der Sphäre der Wirtschaft als auch im zwischenmenschlichen Bereich kritisch untersucht werden sollte.20 Wenn wir als kritische Wissenschaftler die zersetzenden Folgen der Freiheit im Bereich der Wirtschaftstätigkeit analysieren, gibt es keinen Grund, nicht auch in den persönlichen, emotionalen und sexuellen Sphären nach solchen Effekten zu fragen. Die neokonservativen Elogen auf den Markt und die politische Freiheit sowie die scheinbar progressive Feier der sexuellen Freiheit sollten 25gleichermaßen auf den Prüfstand gestellt werden, und zwar nicht im Namen jener Neutralität, die Richard Posner in seiner Studie Sex and Reason fordert,21 sondern im Namen eines umfassenderen Verständnisses der Folgen von Freiheit.22 Das Prinzip der Symmetrie ist aber noch in einer anderen Hinsicht relevant. Die Kritik an der gegenwärtigen Sexualisierung der Kultur kommt aus verschiedenen kulturellen Richtungen: von Asexualitätsgruppen, die sich gegen die zentrale Stellung der Sexualität in den Definitionen des gesunden Selbst wehren; von Feministinnen und Psychologinnen, die sich über die Auswirkungen der Sexualisierung der Kultur sorgen; und nicht zuletzt von christlichen Mehrheiten und (zumal muslimischen) religiösen Minderheiten in Europa und den USA. All diese Kritiken zeigen sich beunruhigt über die Sexualisierung der Kultur. Bislang sind allein feministische Forscherinnen dieser Beunruhigung nachgegangen, und Anthropologinnen wie Leila Abu-Lughod oder Saba Mahmood haben eurozentrische Modelle der sexuellen Emanzipation vom Standpunkt der Subjektivität muslimischer Frauen aus kritisiert.23 Sie laden uns dazu ein, andere Formen sexueller und emotionaler Subjektivitäten kennenzulernen. Die kritische Untersuchung der Sexualität, die dieses Buch sich vorgenommen hat, verdankt sich keinem puritanischen Impuls zu ihrer Kontrolle oder Regulierung ‒ ein solches Programm liegt mir fern ‒, sondern vielmehr dem Wunsch, unsere Überzeugungen über Sexualität und Liebe zu historisieren und zu kontextualisieren. Ich möchte verstehen, was an den kulturellen und politischen Idealen der sexuellen Moderne womöglich von ökonomischen und technologischen Kräften vereinnahmt oder entstellt worden ist, die im Widerspruch zu Idealen und Normen stehen, in denen wir Wesensmerkmale der Liebe sehen.
Ein dritter möglicher Einwand gegen meine Untersuchung hat mit der überragenden Präsenz des Werks von Michel Foucault in den Human- und Sozialwissenschaften zu tun. Sein 26ungemein einflussreiches Buch Überwachen und Strafen24 hat den Verdacht verbreitet, dass die demokratische Freiheit ein Täuschungsmanöver war, um den Prozess der Überwachung und Disziplinierung zu verschleiern, der mit neuen Formen des Wissens und der Kontrolle menschlicher Lebewesen verbunden ist. Also richteten viele Soziologen ihr Augenmerk nunmehr auf alle möglichen Überwachungsmechanismen und betrachteten die Freiheit mit Foucault als eine liberale Illusion, die von einem mächtigen System der Disziplin und Kontrolle getragen wurde. Vor diesem Hintergrund war die Freiheit an sich ein viel uninteressanteres Studienobjekt als die Illusion von Subjektivität, die sie erzeugt. Doch am Ende seines Lebens widmete sich Foucault in seinen Vorlesungen am Collège de France zunehmend dem Verhältnis von Freiheit und Gouvernementalität, also der Art und Weise, wie die Marktfreiheit ein neues Feld des Handelns definiert hatte.25 Mein Buch übernimmt die Perspektive von Foucaults Spätwerk vom Standpunkt einer Kultursoziologie der Gefühle aus.26 Ich betrachte Freiheit in der Tat als Restrukturierung eines Handlungsfelds, als mächtigsten und am weitesten verbreiteten Rahmen zur Ausrichtung unseres Moralbewusstseins, unserer Begriffe von Bildung und zwischenmenschlichen Beziehungen, der Fundamente unseres Rechtssystems, unserer Geschlechtervorstellungen und -praktiken, ja der grundsätzlichen Definition des Selbst moderner Menschen. Für eine Kultursoziologin ist Freiheit kein moralisches und politisches Ideal, das von Gerichten hochgehalten wird, sondern ein dauerhafter, tiefgreifender und weit verbreiteter kultureller Rahmen, der das Selbstverständnis moderner Menschen und ihre Beziehungen zu anderen strukturiert. Als ein Wert, der unablässig von Individuen und Institutionen gehegt wird, orientiert Freiheit eine unübersehbare Zahl an kulturellen Praktiken. Am stärksten sticht unter diesen Praktiken vielleicht die der sexuellen Subjektivität hervor, verstanden als »die Erfahrung, die eine Person von sich selbst als einem sexuellen 27Wesen hat, welches sich zu sexueller Lust und sexueller Sicherheit berechtigt fühlt, sexuell aktiv auswählt und über eine Identität als sexuelles Wesen verfügt«.27 Wo Foucault die Sexualität als eine moderne Praxis der Selbstemanzipation entlarvt, die ironischerweise die kulturelle Sexbesessenheit des Christentums fortschreibt, konzentriere ich mich auf eine andere Frage: Wie verändert die sexuelle Freiheit, die sich in Konsumverhalten und technologischen Praktiken ausdrückt, die Wahrnehmung und Praxis von Liebesbeziehungen an ihrem Beginn, in der Phase ihrer Festigung und während des gemeinsamen häuslichen Lebens?
Die Frage nach der Freiheit ist umso dringlicher geworden, als der öffentliche Diskurs und die rechtliche Organisation liberaler Gemeinwesen einen bestimmten Typ Freiheit privilegiert haben, nämlich die negative Freiheit ‒ also die Freiheit von Akteuren, ohne Behinderung durch die Außenwelt zu tun, was sie wollen, solange sie anderen nicht schaden und deren Freiheit nicht beschneiden. Eine solche Freiheit ist rechtlich garantiert und wird von vielen Institutionen gehegt und gepflegt, die unsere Rechte und Privatsphäre sichern sollen und praktisch ohne normativen Gehalt sind. Die »Leere« der negativen Freiheit aber hat einen Raum geschaffen ‒ den Raum der »Abwesenheit von Behinderung« ‒, der leicht von den Werten des kapitalistischen Marktes, der Konsumkultur und der Technologie kolonialisiert werden konnte, jener inzwischen mächtigsten institutionellen und kulturellen Arenen der modernen Gesellschaften. Wie Marx vor langer Zeit bemerkte, birgt Freiheit das Risiko, Ungleichheiten ungehindert gedeihen zu lassen. Catharine MacKinnon bringt diesen Zusammenhang auf den Punkt: »Freiheit der Gleichheit, Freiheit der Gerechtigkeit vorzuziehen, wird lediglich die Macht der Mächtigen weiter befreien.«28 Freiheit kann also Gleichheit nicht übertrumpfen, weil Ungleichheit die Möglichkeit beeinträchtigt, frei zu sein. Wenn die Heterosexualität die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern organi28siert und naturalisiert, können wir davon ausgehen, dass die Freiheit sich von einer solchen Ungleichheit nicht beunruhigen lässt, sondern sie gelassen hinnimmt und für das Natürlichste von der Welt hält. Nur selten schlägt die Freiheit in heterosexuellen Beziehungen die Ungleichheit aus dem Feld.
Die »negative Freiheit«, wie Isaiah Berlin sie bezeichnete, hat es immerhin ermöglicht, dass die Sprache und die Praktiken des Konsummarkts das Vokabular und die Grammatik der Subjektivität umgeschrieben haben. Dieselbe Sprache der Interessen, des Utilitarismus, der sofortigen Befriedigung, des egozentrierten Handelns, der Akkumulation, der Abwechslung und des Erfahrungsreichtums durchdringt heute die romantischen und sexuellen Bindungen und verlangt von uns folglich nach einer ernüchternden Analyse der Bedeutung und Auswirkungen von Freiheit. Dabei dürfen wir natürlich keinesfalls den moralischen Fortschritt in Frage stellen, den die Kämpfe der Frauen- und der LGBTQ-Bewegung gebracht haben.29 Die historischen Errungenschaften dieser Bewegungen zu befürworten und ihren Kampf fortzusetzen sollte uns allerdings nicht von einer Untersuchung der Frage abhalten, auf welchen Wegen das moralische Ideal der Freiheit historisch und empirisch in Marktformen entfaltet wurde, die sich ebenfalls auf die Freiheit berufen. Zu verstehen, wie Ideen und Werte, sobald sie einmal institutionalisiert sind, eine Entwicklung nehmen können, die nicht immer die von ihren Verfechtern beabsichtigte ist, wird uns in Wirklichkeit dabei helfen, das ursprüngliche Freiheitsideal zurückzugewinnen, das einmal der Motor dieser Bewegungen gewesen ist. Wenn der Neoliberalismus wirtschaftlichen Transaktionen jede Normativität notorisch ausgetrieben (und öffentliche Einrichtungen in gewinnorientierte Organisationen sowie das Eigeninteresse in die natürliche Epistemologie des Akteurs verwandelt) hat, dann gibt es keinen Grund, die Frage zu scheuen, ob die sexuelle Freiheit nicht ähnliche Auswirkungen auf Intimbeziehungen zeitigt. Wird nicht auch ihnen die Normativität 29ausgetrieben, wenn die selbstzentrierte Lust naturalisiert und der sexuelle Konkurrenzkampf sowie die sexuelle Akkumulation institutionalisiert werden, wenn mithin keine moralischen und ethischen Kodes mehr unsere Beziehungen regulieren? Anders gefragt: Hat sich die sexuelle Freiheit zur neoliberalen Philosophie der Privatsphäre entwickelt,30 zu einem Diskurs und einer Praxis, welche die Normativität von Beziehungen zersetzen, welche die Ethik und Technologie des Konsums als neue Form der emotionalen Selbstorganisation naturalisieren und den normativ-moralischen Kern der Intersubjektivität unverständlich werden lassen? Während Freiheit selbst ein mächtiger normativer Anspruch war, um sich der Institution von Zwangsehen oder lieblosen Ehen zu widersetzen, um das Recht auf Scheidung geltend zu machen, sein Geschlechts- und Gefühlsleben nach seinen eigenen Neigungen zu führen und allen sexuellen Minderheiten Gleichheit zu gewähren, können wir uns heute fragen, ob nicht dieselbe Freiheit die sexuellen Beziehungen von der moralischen Sprache entbunden hat, von der sie ursprünglich einmal durchdrungen waren ‒ beispielsweise indem sie sich der Sprache der Verpflichtung und Gegenseitigkeit entledigte, in der alle oder doch die meisten sozialen Interaktionen traditionell organisiert waren. So wie der zeitgenössische Monopolkapitalismus dem Geist des freien Tauschs widerspricht, der im Mittelpunkt der frühen Konzeptionen von Markt und Handel stand, so steht eine sexuelle Subjektivität im engen Kostüm der Konsum- und technologischen Kultur im Gegensatz zur Vision einer emanzipierten Sexualität als dem Herzstück der sexuellen Revolution. Denn eine solche Sexualität reproduziert am Ende zwanghaft genau die Denk- und Handlungsschemata, die die Technologie und die Ökonomie zu den unsichtbaren Gestaltern unserer sozialen Bindungen machen.
Aus einer Reihe von Gründen lässt sich dieser Frage auf dem Feld der Heterosexualität ergiebiger nachgehen als auf dem der Homosexualität. In ihrer gegenwärtigen Form ba30siert die Heterosexualität auf Geschlechterunterschieden, die zumeist als Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern funktionieren; die Heterosexualität organisiert diese Ungleichheiten in einem emotionalen System, das die Verantwortung für den Erfolg oder Misserfolg von Beziehungen der individuellen Psyche aufbürdet, und zwar vor allem jener der Frau. Freiheit führt dazu, dass emotionale Ungleichheiten unentdeckt bleiben und daher auch nicht thematisiert werden. Männer und Frauen, in erster Linie aber Frauen halten sich an ihre Psyche, um mit der symbolischen Gewalt und den Wunden zurechtzukommen, die mit solchen emotionalen Ungleichheiten einhergehen: Warum ist er so distanziert? Zeige ich mich zu bedürftig? Was muss ich tun, um ihn herumzukriegen? Was habe ich falsch gemacht, dass er sich zurückgezogen hat? All diese Fragen, die von Frauen und im Namen von Frauen gestellt werden, verweisen auf den Umstand, dass sich heterosexuelle Frauen kulturbedingt im Wesentlichen für den emotionalen Erfolg und die Pflege ihrer Beziehungen verantwortlich fühlen. Die Homosexualität hingegen übersetzt Geschlecht nicht in Unterschied und Unterschied nicht in Ungleichheit, und sie basiert auch nicht auf dem Geschlechterunterschied zwischen reproduktiver und ökonomischer Arbeit, der charakteristisch für die heterosexuelle Familie war. In diesem Sinne ist die Erforschung der Folgen der Freiheit für die Heterosexualität soziologisch von größerer Dringlichkeit: Weil sie mit der nach wie vor allgegenwärtigen und mächtigen Struktur der Geschlechterungleichheit zusammenspielt, überzieht die sexuelle Freiheit die Heterosexualität mit Widersprüchen und Krisen.31 Weil die Heterosexualität darüber hinaus eng durch das soziale System des Liebeswerbens zur Eheanbahnung reglementiert und kodifiziert war, erlaubt uns der Übergang zur emotionalen und sexuellen Freiheit den Einfluss der Freiheit auf die sexuellen Praktiken in wünschenswerter Klarheit zu erfassen. Dazu zählt insbesondere der Widerspruch, in den die Freiheit womöglich 31zur Institution der Ehe (oder Partnerschaft) geraten ist, die immer noch der Kern der Heterosexualität bildet. Die Homosexualität hingegen war bis in die jüngste Zeit eine heimliche und oppositionelle soziale Form. Deshalb war sie von Anfang an als eine Praxis der Freiheit definiert, die unvereinbar mit der Ehe war und im Gegensatz zu dieser häuslichen Institution stand, in der die Frauen benutzt und entfremdet und den Männern patriarchalische Rollen zugewiesen wurden. Obwohl ich für das vorliegende Buch vereinzelt auch Homosexuelle interviewt habe, versteht es sich insgesamt also als eine Ethnographie der Heterosexualität in einer Zeit, da diese soziale Institution unter dem Druck und Sog von Faktoren steht, die so emanzipatorisch wie reaktionär sind, so modern wie traditionell, so subjektiv wie ein Ausfluss der kapitalistischen, konsumorientierten und technologischen Kräfte unserer Gesellschaft.
Meine Herangehensweise an die emotionale und sexuelle Freiheit hebt sich von verschiedenen Formen des Libertarismus ab, für die Lust einen Endzweck des Erlebens darstellt. Für solche Libertäre ist die erstaunliche Ausweitung der Sexualität in allen Schichten der Konsumkultur ein willkommenes Zeichen dafür, dass ‒ um es mit Camille Paglias zugespitzten Worten zu sagen ‒ die populäre Kultur (samt ihrem sexuellen Gehalt) »einen Ausbruch des nie überwundenen Heidentums der westlichen Kultur« darstellt.32 Für sexuell Libertäre befreit eine durch den Konsumgütermarkt vermittelte Sexualität die sexuelle Lust, Energie und Kreativität; sie sehen in ihr gleichsam einen Appell an den Feminismus (und vermutlich auch an andere soziale Bewegungen), offen zu sein »für die düstere, verzweiflungsvolle Abgründigkeit der Kunst und der Sexualität«.33 So verführerisch eine solche Auffassung klingen mag, beruht sie doch auf der naiven Annahme, dass die treibenden Kräfte des Marktes hinter der Populärkultur faktisch eine kreative Urenergie widerspiegeln und fließen lassen, statt, nun ja, flächendeckend die Interessen großer Konzerne zu bedienen, die eine auf rascher Bedürfnis32befriedigung basierende Subjektivität zu begünstigen suchen. Ich sehe keinen überzeugenden Grund zu der Annahme, die durch den Markt erschlossenen Energien seien von Natur aus eher »heidnisch« als beispielsweise reaktionär, konformistisch oder konfus. Wie ein Queer-Theoretiker formulierte, ermöglichten Margaret Thatcher und Ronald Reagan, obwohl sie Familienwerte hochhielten, mit ihrer neoliberalen Politik der Deregulierung von Märkten in Wirklichkeit die größte sexuelle Revolution.34 »Die individuelle Freiheit kann am Markt nicht enden; wenn man die absolute Freiheit hat, zu kaufen und zu verkaufen, dann scheint es unlogisch zu sein, bei seinen Sexualpartnern, seinem sexuellen Lebensstil, seiner Identität oder seinen Fantasien irgendwo eine Grenze zu ziehen.«35
Eine Frage der Wahl
In der zeitgenössischen Sexualität kommt nicht etwa eine von der amoralischen Populärkultur freigesetzte rohe heidnische Energie zum Ausdruck. Sie ist vielmehr Träger einer Reihe von sozialen Kräften, die genau jene Werte untergraben, welche den Kampf für die sexuelle Emanzipation einmal beflügelt haben. Die Sexualität ist zu einem Feld für psychologische Humantechniken, Technologien und den Konsumentenmarkt geworden, die eines gemeinsam haben: Sie organisieren und übersetzen das Begehren und die zwischenmenschlichen Beziehungen in eine schiere Angelegenheit der individuellen Wahl. Die ‒ sexuelle, konsumbezogene oder emotionale ‒ Wahl ist das Leitmotiv, an dem sich das Selbst und der Wille in liberalen Gemeinwesen orientieren. Ein modernes oder spätmodernes Selbst zu haben heißt, von der Möglichkeit der Wahl Gebrauch zu machen und sich der subjektiven Erfahrung, dass man die Wahl hat, so oft wie möglich zu vergewissern.
Die Wahl ist der Topos des Selbst, der die Freiheit mit dem 33Bereich des Markts und dem der Gefühle verbindet; sie ist der wichtigste Modus von Subjektivität in den Sphären des Konsums und der Sexualität. Die Wahl verbindet zwei unterschiedliche Ideen, von denen sich die eine auf ein gegebenes Angebot, eine Auswahl an Gütern bezieht, während die andere den subjektiven Aspekt meint, dass sich ein Individuum mit einer Reihe von Möglichkeiten konfrontiert sieht, die von ihm eine Entscheidung, eine Auswahl verlangt. Die Wahl ist also sowohl Ausdruck einer bestimmten Gliederung der Welt, die sich als eine vorsortierte Mischung von Möglichkeiten darstellt, denen das Subjekt direkt und unvermittelt begegnet, als auch Ausdruck einer Gliederung des Willens in Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche. Ein wählender Wille ist eine bestimmte Art von deliberativem Willen, der einer Welt gegenübersteht, die wie ein Markt strukturiert zu sein scheint, das heißt als eine ausgiebige Menge von Möglichkeiten, die das Subjekt ergreifen und wählen muss, um sein Wohlbefinden, seinen Genuss oder seinen Profit sicherzustellen und zu maximieren. Aus kultursoziologischer Perspektive bietet die Wahl den besten Anknüpfungspunkt, um zu verstehen, wie sich die gewaltige Struktur des Marktes in kognitive und emotionale Eigenschaften des Handelns übersetzt. Der spezifische Wille, den eine Kultur der Wahl impliziert, hat sich unter dem Einfluss von Technologie und Konsum erheblich gewandelt und zwingt uns somit dazu, soziologische Fragen nach dem Verhältnis der Ökonomie des Begehrens zu den traditionellen Gesellschaftsstrukturen zu stellen.
Das vorliegende Buch entfaltet mithin eine Argumentation, die ich so umreißen möchte: Unter der Ägide der sexuellen Freiheit haben heterosexuelle Beziehungen die Form eines Marktes angenommen ‒ als unmittelbares Aufeinandertreffen eines emotionalen und sexuellen Angebots mit einer emotionalen und sexuellen Nachfrage.36 Beides ‒ Angebot und Nachfrage ‒ ist stark durch Objekte und Orte des Konsums sowie durch Technologie vermittelt (Kapitel 2). Se34xuelle Begegnungen, die als Markt organisiert sind, werden gleichermaßen unter dem Vorzeichen der Wahl wie unter dem der Ungewissheit erlebt. Indem sie die Individuen die Bedingungen ihrer Begegnung selbst aushandeln lässt und sie dabei kaum durch Regeln oder Verbote einschränkt, erzeugt diese Marktform eine weitverbreitete und tiefgreifende emotionale und kognitive Ungewissheit (Kapitel 3). Der Begriff des Markts ist hier nicht einfach eine ökonomische Metapher, sondern eine soziale Form, die sexuelle Begegnungen annehmen, wenn sie von der Internettechnologie und der Konsumkultur angetrieben werden. Wenn Menschen sich in einem offenen Markt begegnen, treffen sie direkt, ohne oder fast ohne menschliche Vermittler aufeinander; sie tun dies über Technologien, die auf eine Effizienzsteigerung bei der Partnersuche zielen; und sie orientieren sich dabei an vorgefertigten Skripten des Tauschs, der Zeiteffizienz sowie des hedonistischen Kalküls und entwickeln eine vergleichende Geisteshaltung ‒ all dies sind charakteristische Merkmale des fortgeschrittenen kapitalistischen Tauschs. Dieser neue sexuelle Austausch bringt insbesondere Frauen in eine zwiespältige Situation, in der sie durch ihre Sexualität zugleich ermächtigt und herabgesetzt werden (Kapitel 4), eine Ambivalenz, die damit zusammenhängt, dass sich ihr Machtzuwachs kapitalistischen Mechanismen verdankt. Die Verbindung von sexueller Freiheit, Konsumkultur und Technologie sowie eine immer noch mächtige männliche Vorherrschaft im sexuellen Bereich untergraben die Möglichkeit, einen Vertrag einzugehen und zu gestalten, mithin jene zentrale soziale Form, die Markt und Ehe angenommen haben (Kapitel 5). Beziehungen zu verlassen, unfähig oder unwillig zu sein, Beziehungen einzugehen, von einer Beziehung in die nächste zu springen, all das ist ein fester Bestandteil dieser neuen Marktförmigkeit der sexuellen Beziehungen. Die damit verbundenen Schwierigkeiten und Ungewissheiten übertragen sich auf die Institution der Ehe selbst (Kapitel 6). Eine buchstäbliche Lieblosig35keit ist das Signum einer neuen Form von Subjektivität, bei der die Wahl sowohl positiv ‒ dadurch, etwas zu wünschen, zu begehren ‒ als auch negativ ausgeübt wird: indem man sich selbst durch die wiederholte Vermeidung oder Ablehnung von Beziehungen definiert, weil man zu verwirrt oder zwiespältig ist, um zu begehren; weil man so viele Erfahrungen sammeln möchte, dass die Wahl ihre emotionale und kognitive Bedeutung verliert; weil man reihenweise Beziehungen beendet und zerstört, um so das Selbst und seine Autonomie zu behaupten. Lieb- oder vielleicht besser Liebeslosigkeit ist also gleichzeitig eine Form von Subjektivität ‒ auf der Ebene, wer wir sind und wie wir uns verhalten ‒ und ein gesellschaftlicher Prozess, in dem sich der tiefe Einfluss des Kapitalismus auf die sozialen Beziehungen spiegelt.
*
In Krieg und Frieden erkundigt sich Fürst Andrej im Gespräch mit Pierre Besuchow, dem zentralen Protagonisten des Romans, »nach längerem Schweigen: ›Nun, wie sieht's aus, hast du dich endlich für irgend etwas entschieden? Gardekavallerie, oder wirst du Diplomat?‹«37 In seiner Formulierung ist die Wahl eine Alternative zwischen zwei klaren Optionen, die der Person, welche die Wahl zu treffen hat, und dem außenstehenden Beobachter bekannt sind. Sie ist ein Akt mit eindeutigen Grenzen: Eine Option zu wählen heißt automatisch, die anderen auszuschließen. Auch setzt Fürst Andrejs Frage etwas voraus, was für viele Ökonomen und Psychologen eine Wahl ausmacht, nämlich dass sie eine Frage der persönlichen Präferenzen und der Information ist. Damit Pierre seinen Beruf wählen kann, muss er einfach von der (universellen) Fähigkeit Gebrauch machen, sich seine eigenen Präferenzen vor Augen zu führen und zu hierarchisieren, um herauszufinden, ob er die Kunst des Krieges oder die der Diplomatie bevorzugt, zwei sauber und klar unterschiedene 36Optionen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts haben Soziologen einem solchen Verständnis des menschlichen Handelns widersprochen und argumentiert, Menschen seien Gewohnheitstiere und eher normativ konformistisch, als dass sie wohlüberlegte Entscheidungen träfen. So witzelte James Duesenberry einmal: »In der Wirtschaftswissenschaft dreht sich alles darum, wie Menschen eine Wahl treffen; in der Soziologie dreht sich alles darum, dass sie keine Wahl haben.«38 Doch übersahen die Soziologen dabei vielleicht, was Ökonomen und Psychologen unwissentlich erfassten: dass der Kapitalismus viele Schauplätze des sozialen Lebens in Märkte und das soziale Handeln in eine reflexive Wahl und Entscheidungsfindung verwandelt hat. Dadurch ist die Wahl zu einer entscheidenden neuen sozialen Form geworden, durch die und in der die moderne Subjektivität sich selbst in den meisten, wenn nicht allen Aspekten ihres Lebens versteht und verwirklicht.39 Wir können ohne Übertreibung sagen, dass das moderne Subjekt erwachsen wird, indem es sich in der Fähigkeit übt, mit Blick auf eine Vielzahl von Dingen bewusste Entscheidungen zu treffen: Seine Kleidungs- und Musikvorlieben, sein Schul- oder Hochschulabschluss und Beruf, Anzahl und Geschlecht seiner Sexualpartner, sein eigenes Geschlecht, seine engen und nicht so engen Freunde, all dies ist »gewählt«, ist Resultat reflexiv begleiteter Akte bewusster Entscheidung. In ihrer Befürchtung, dass es eine naive und voluntaristische Billigung rationalen Handelns wäre, wenn sie sich die Idee der Wahl auf ihre Fahnen schrieben, blendeten die Soziologen die Tatsache völlig aus, dass die Wahl nicht nur zu einem Aspekt der Subjektivität geworden war, sondern auch zu einem Mittel, um Handeln zu institutionalisieren. Sie versteiften sich vielmehr darauf, Wahlfreiheit als eine Säule der kapitalistischen Ideologie zu sehen, als falsche epistemologische Prämisse der Wirtschaftswissenschaften, als Flaggschiff des Liberalismus, als biographische Illusion, erzeugt von den psychologischen Wissenschaften, oder als zentrale kulturelle Struktur von Ver37braucherwünschen. Die Perspektive, die ich hier einnehme, ist eine andere: Zwar hat die Soziologie einen Datenbestand zusammengetragen, der klarerweise zeigt, dass die Zwänge von Klasse und Geschlecht jede Wahl von innen heraus steuern und strukturieren, doch es bleibt eine Tatsache, dass die Wahl, wie illusorisch sie auch sei, ein grundsätzlicher Modus ist, in dem sich moderne Subjekte zu ihrer sozialen Umwelt und zu sich selbst verhalten. Die Wahl strukturiert Modi sozialer Verständlichkeit. Das »reife und gesunde Selbst« beispielsweise entwickelt die Fähigkeit, emotional reife und authentische Entscheidungen zu treffen, zwanghafte, suchterzeugende Verhaltensweisen hingegen zu meiden und sie in eine frei gewählte, informierte, selbstbewusste Emotionalität zu transformieren. Der Feminismus stellte sich als eine Politik der Wahl dar. Stephenie Meyer, Verfasserin der weltweit erfolgreichen Twilight-Serie, formuliert es auf ihrer offiziellen Website bündig: »[D]ie Grundlage des Feminismus ist dies: wählen zu können. Der Kern des Antifeminismus besteht umgekehrt darin, einer Frau zu sagen, dass sie etwas nicht tun kann, bloß weil sie eine Frau ist ‒ ihr speziell aufgrund ihres Geschlechts eine beliebige Wahlmöglichkeit zu nehmen.«40 »Pro-Choice« ist sogar der Name einer der wichtigsten feministischen Bewegungen. Die Konsumkultur, wohl der Dreh- und Angelpunkt der modernen Identität, basiert beinahe selbstverständlich auf der unablässigen Praxis des Vergleichens und Wählens. Selbst wenn Wahlentscheidungen in der Praxis begrenzt und determiniert sind, bleibt doch unbenommen, dass ein Gutteil des modernen Lebens als Ergebnis subjektiver Wahl erfahren und stilisiert wird, und dies beeinflusst auf signifikante Weise, wie Menschen ihre eigene Subjektivität entwickeln und erleben. Die Wahl ist also eine der zentralen kulturellen Erzählungen des modernen Menschen. Wenn sie sich in den diversen Institutionen der Ehe, der Arbeit, des Konsums und der Politik zum wichtigsten Medium von Subjektivität entwickelt hat und darüber entscheidet, wie Men38schen in diese Institutionen eintreten und ihre Zugehörigkeit zu ihnen erfahren, dann ist die Wahl an sich zu einer Kategorie geworden, die eine soziologische Erforschung verdient ‒ zu einer eigenständigen Form des Handelns, die von kulturellen Rahmenbedingungen durchsetzt ist, deren hervorstechendste »Freiheit« und »Autonomie« heißen. Die institutionalisierte Freiheit produziert eine schier endlose Reihe von Möglichkeiten in den Bereichen des Konsums, der Ideen, Geschmäcker, Beziehungen und zwingt so das Selbst dazu, seine Selbstdefinition durch unzählige Akte der Wahl zu leisten und geltend zu machen ‒ Akte, die über unterschiedliche und fest umrissene kognitive und emotionale Stile verfügen (die Wahl eines Partners oder eines Berufs impliziert heute unterschiedliche kognitive Strategien). Die Wahlfreiheit ist somit nicht nur eine weitverbreitete Ideologie, wie Renata Salecl überzeugend gezeigt hat,41 sondern ein echter konkreter Effekt der Institutionalisierung von Autonomie in den meisten sozialen Institutionen (Schule, Markt, Recht, Konsummarkt) und politischen Bewegungen (Feminismus, Schwulenrechte, Transgender). Die Wahl ist ein praktisches Verhältnis, das man zu sich selbst einnimmt und in dessen Rahmen man versucht, dem eigenen »wahren« und »idealen« Selbst gemäß zu leben, indem man (durch einen Hochschulabschluss, eine Schönheitsoperation, die Änderung seiner sexuellen Orientierung) den Determinismus von Klasse, Alter oder Geschlecht transzendiert und überwindet.
Unter dem Einfluss des ökonomischen Denkens sind wir zumeist an positiven Akten der Wahl interessiert, an »Entscheidungsfindungen«. Dadurch ist unserer Aufmerksamkeit ein weitaus bedeutenderer Aspekt der Wahl entgangen, nämlich die negative Wahl: die Verweigerung, Vermeidung oder Aufkündigung von Bindungen, Verstrickungen und Beziehungen im Namen von Freiheit und Selbstverwirklichung. Die intellektuelle (und kulturelle) Situation war zu Beginn des 20. Jahrhunderts offensichtlich eine andere, als Denker wie 39Sigmund Freud und Emile Durkheim über »negative Beziehungen« forschten, Freud unter dem Stichwort des Todestriebs und Durkheim unter dem der Anomie. 1920 setzte sich Freud in der Abhandlung Jenseits des Lustprinzips mit dem Zwang auseinander, Unlusterfahrungen im Geiste zu wiederholen und durchzuspielen, eine Wiederholung, die bis zur Selbstzerstörung des Subjekts führen konnte, zur Unfähigkeit, in vollem Maße Beziehungen einzugehen oder aufrechtzuerhalten. Einige Jahre zuvor, nämlich 1897, hatte Durkheim den von mir bereits erwähnten soziologischen Gründungstext Der Selbstmord veröffentlicht, der sich als eine Untersuchung negativer Beziehungen, einer Geselligkeit auf dem Rückzug verstehen lässt, einer Annullierung der sozialen Zugehörigkeit. Freud wie Durkheim erfassten auf einen Schlag zwei gegensätzliche Prinzipien, das der Sozialität und das der Antisozialität, als miteinander verflochten. Ich folge ihren Fußstapfen, ohne dabei jedoch Antisozialität in einem essentialistischen Sinne zu verstehen. Vielmehr erforsche ich die Antisozialität oder negative Geselligkeit als einen Ausdruck der zeitgenössischen Ideologien der Freiheit, der Technologien der Wahl und des fortgeschrittenen Konsumkapitalismus, ja als integralen Bestandteil des vom Kapitalismus entfalteten symbolischen Imaginären. In der neoliberalen sexuellen Subjektivität wird negative Geselligkeit nicht als ein negativer Geisteszustand erfahren, der von Angst, Todesgedanken oder Gefühlen der Isolation geprägt wäre, sondern als das, was Günther Anders die »selbstbewusste Freiheit« nannte, eine Freiheit, in der das Selbst sich selbst behauptet, indem es andere negiert oder ignoriert.42 Die selbstbewusste Freiheit ist vielleicht die häufigste Form von Freiheit in persönlichen Beziehungen. Wie ich zeigen werde, weist sie sämtliche moralischen Mehrdeutigkeiten der Freiheit in der Institution der Heterosexualität auf.
40Die negative Wahl
Für die Zeit vom 16. bis zum 20. Jahrhundert konstatieren die Soziologen der Moderne die Ausbreitung der Kultivierung neuer Beziehungsformen auf alle gesellschaftlichen Gruppen. Dazu zählen, um nur einige zu nennen, die Liebesheirat, die selbstlose oder uneigennützige Freundschaft, das mitfühlende Verhältnis zum Fremden und die nationale Solidarität. All diese Formen können gleichermaßen als neue soziale Verhältnisse, neue Institutionen und neue Gefühle bezeichnet werden, und sie beruhen durchweg auf einer Wahl. In der frühen Neuzeit wurde somit die Freiheit (zu wählen) institutionalisiert, und die Individuen erfuhren ihre Freiheit in der Verfeinerung der Praxis des Wählens, die als eine emotionale erlebt wurde. Die Bande der »Freundschaft«, der »romantischen Liebe« und der »Ehe«, aber auch die »Scheidung« waren eigenständige, klar umrissene soziale Formen, die spezifische Gefühle und Namen für diese Gefühle enthielten. Die Soziologie studierte sie als genau bestimmbare, relativ stabile empirische Beziehungen mit phänomenologisch beschreibbaren Eigenschaften. Im Unterschied dazu scheint unsere hyperkonnektive Moderne von der Herausbildung gleichsam stellvertretender oder negativer Bindungen bestimmt zu sein: One-Night-Stand, Spontanfick, Abschleppen, Seitensprung, Fickbeziehung, Freundschaft Plus (friends with benefits), Gelegenheitssex, Casual Dating, Cybersex sind nur einige der Bezeichnungen für Verhältnisse, die definitionsgemäß kurzlebig sind und ohne oder mit nur geringer Beteiligung des Selbst auskommen. Sie sind oft gefühllos und von selbstzweckhaftem Hedonismus geprägt und haben den Geschlechtsakt als vornehmliches oder einziges Ziel. In der vernetzten Moderne wird die Nichtherausbildung von Bindungen zu einem soziologischen Phänomen an sich, zu einer eigenständigen sozialen und epistemischen Kategorie.43 War die Früh- und Hoch41moderne geprägt durch den Kampf um bestimmte Formen der Sozialität, in denen Liebe, Freundschaft und Sexualität von moralischen und gesellschaftlichen Einschränkungen befreit wären, scheinen sich die Gefühlserlebnisse in der vernetzten Moderne den Bezeichnungen von Gefühlen und Verhältnissen zu entziehen, die wir aus Zeiten mit stabileren Bindungen geerbt haben. Die zeitgenössischen Beziehungen gehen zu Ende, in die Brüche, verlieren ihren Reiz oder ihren Sinn und folgen einer Dynamik der positiven und negativen Wahl, die Bindungen und Nichtbindungen miteinander verschränkt.
Diese Dynamik ist es letztlich, die ich in Warum Liebe endet erhellen möchte, im Anschluss an meine frühere Auseinandersetzung mit dem Zusammenwirken von Liebe, Wahlfreiheit und der Kultur des Kapitalismus.44 Doch während ich in der vorangegangenen Untersuchung ein Licht auf die Veränderungen geworfen habe, die den eigentlichen Begriff und die Struktur der Partnerwahl betreffen, konzentriere ich mich hier auf eine andere und neue Kategorie des Wählens ‒ die Entscheidung nämlich, sich nicht (oder dagegen) zu entscheiden ‒, eine Form der Wahl, die auf die diversen Freiheitskämpfe der vergangenen zweihundert Jahre folgt. Kämpften die Akteure während der Entstehung der Moderne für ihr Recht, eine von Beschränkungen der Gemeinschaft oder Gesellschaft unbehinderte Sexualität zu leben, so betrachten sie es in der zeitgenössischen Moderne als selbstverständlich, dass die Sexualität eine Wahlmöglichkeit und ein Recht von unstrittiger und unbestreitbarer Geltung ist (mit Ausnahme vielleicht der Homosexuellenehe, der letzten Front des alten Kampfes). Man übt seine Freiheit ohne Unterlass durch das Recht aus, sich nicht zu binden oder sich aus Beziehungen zu lösen, einen Prozess, den wir als »Wahl der Nichtwahl« bezeichnen können: in jedem beliebigen Stadium aus einer Beziehung aussteigen zu können.
Ich gehe zwar nicht von einem einfachen und direkten Kausalverhältnis aus, aber die Analogie zwischen der Ge42schichte des Kapitalismus und jener der romantischen Formen ist doch augenfällig. In seiner modernen Phase hat der Kapitalismus solche ökonomischen Formen angenommen wie das bürokratisch-arbeitsteilige managergesteuerte Unternehmen, die GmbH, die internationalen Finanzmärkte und den Handelsvertrag. Für diese ökonomischen Formen sind Hierarchie, Kontrolle und Vertrag zentral. Sie spiegelten sich in einem Verständnis von Liebe als Vertragsverhältnis wider, das freiwillig eingegangen wird, durch ethische Regeln Verbindlichkeit herstellt, von offensichtlichem Nutzen ist sowie langfristige Strategien und Investitionen verlangt. Versicherungsunternehmen waren maßgebliche Institutionen dafür, Risiken zu minimieren. Sie agierten als Dritte zwischen zwei Vertragspartnern und erhöhten so die Verlässlichkeit des Handelsvertrags. Diese soziale Organisation des Kapitalismus ist zu einem verzweigten globalen Netzwerk mit breitgestreutem Eigentum und diffuser Kontrolle mutiert, einer neuen Form von Kapitalismus, die heute durch Mechanismen wie Arbeitszeitflexibilität und die Auslagerung von Tätigkeiten neue Formen der Unverbindlichkeit hervorbringt. Sie gehen einher mit einer schwachen sozialen Absicherung und einem Bruch der Loyalitätsbeziehung zwischen Arbeitnehmerin und Arbeitsplatz sowohl auf gesetzlicher Ebene als auch durch Praktiken, die die Verpflichtung der Unternehmen gegenüber ihren Belegschaften dramatisch verringert haben. Der zeitgenössische Kapitalismus hat zudem Instrumente entwickelt, um von Ungewissheit zu profitieren, beispielsweise Derivate, und lässt darüber hinaus den Wert bestimmter Güter durch die Einrichtung von »Spotmärkten« ungewiss werden, weil dort die Preise unentwegt an die Nachfrage angepasst werden, also Ungewissheit im selben Moment erzeugt und zu Profitzwecken genutzt wird. Praktiken der Nichtbindung und Nichtwahl erlauben den raschen Rücktritt von einer Transaktion und die rasche Neufestsetzung der Preise ‒ Praktiken, die die schnelle Erzeugung und den schnellen Bruch von Loyali43täten ebenso ermöglichen wie die rasche Erneuerung und Veränderung von Produktionslinien sowie die ungehinderte Entlassung der Belegschaft. All dies sind Praktiken der Nichtwahl. Aus der Wahl, die das frühe Motto des »soliden Kapitalismus« war, ist mithin eine Nichtwahl geworden, die Praxis der fortwährenden Anpassung der eigenen Präferenzen »auf Sicht« ‒ statt ganz grundsätzlich Beziehungen einzugehen, zu pflegen und sich für sie zu engagieren, ob ökonomische oder romantische. Diese Praktiken der Nichtwahl sind in irgendeiner Weise mit intensiv kalkulierenden Strategien der Risikoeinschätzung verbunden.