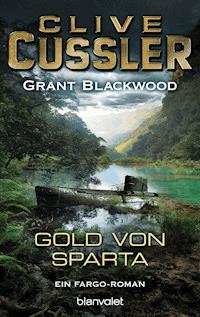
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Fargo-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Die Schatzjäger Sam und Remi Fargo erforschen die Sümpfe um den Pocomoke River in Delaware. Niemals hätten sie damit gerechnet, hier ein deutsches U-Boot aus dem zweiten Weltkrieg zu entdecken. Im Inneren finden sie eine Weinflasche, die aus einem Set von zwölf Flaschen stammt, das einst Napoleon Bonaparte gehörte. Fasziniert von ihrem Fund beschließen die Fargos, auch den Rest der Sammlung aufzuspüren. Doch auch der Milliardär Hadoin Bondaruk ist an ihrem Fund interessiert – und an dem sagenhaften Schatz, zu dem er führt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
& Grant Blackwood
Das Gold von Sparta
Roman
Aus dem Englischen von Michael Kubiak
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Spartan Gold« bei Putnam, New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © 2009 by Sandecker, RLLLP
All rights reserved by the Proprietor throughout the world
By arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176-0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Redaktion: Jörn Rauser
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-15183-6
www.blanvalet.de
Prolog
Großer Sankt Bernard, Walliser Alpen Mai 1800
Ein Windstoß peitschte den Schnee um die Beine des Hengstes, der auf den Namen Styrie hörte, und so schnaubte er nervös, tänzelte an den Rand des schmalen Pfades, bis der Reiter mehrmals mit der Zunge schnalzte und ihn beruhigte. Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen, klappte den Kragen seines Überziehers hoch und kniff die Augen vor dem Schneeregen zusammen. Im Osten konnte er undeutlich die viertausendachthundert Meter hohe, gezackte Silhouette des Mont Blanc erkennen.
Er beugte sich im Sattel nach vorn und tätschelte Styries Hals. »Du hast schon viel Schlimmeres erlebt, mon ami.«
Styrie, ein Araberhengst, den Napoleon zwei Jahre zuvor von seinem Ägypten-Feldzug mitgebracht hatte, mochte zwar ein hervorragendes Schlachtross sein, die Kälte und der Schnee entsprachen aber ganz und gar nicht seiner Natur. In der Wüste geboren und aufgewachsen, war Styrie eher daran gewöhnt, von Sand, aber nicht von Eis überschüttet zu werden.
Napoleon wandte sich um und winkte seinem Helfer, Constant, der gut drei Meter hinter ihm stand und einige Maultiere an einer Leine führte. Und hinter ihm, auf mehrere Kilometer des windumtosten Weges gestreckt, folgten die vierzigtausend Soldaten von Napoleons Reservearmee mitsamt ihren Pferden, Maultieren und Munitionskisten.
Constant band das erste Maultier los und eilte vor. Napoleon reichte ihm Styries Zügel, stieg dann aus dem Sattel und vertrat sich die Beine im knietiefen Schnee.
»Gönnen wir ihm eine Ruhepause«, sagte er. »Ich glaube, es ist dieses Hufeisen, das ihm wieder Probleme macht.«
»Ich kümmere mich darum, mon général.« In der Heimat bevorzugte Napoleon den Titel Erster Konsul, doch während eines Feldzugs ließ er sich mit General anreden. Er atmete die kalte Luft tief ein, dann drückte er sich seinen blauen Zweispitz fester auf den Kopf und blickte zu den Granittürmen hinauf, die über ihnen aufragten.
»Ein richtig schöner Tag, nicht wahr, Constant?«
»Wenn Sie es sagen, mon général«, brummte der Diener.
Napoleon lächelte versonnen. Constant, der ihm seit vielen Jahren zu Diensten war, gehörte zu den wenigen Untergebenen, denen er ein kleines Maß an Spott durchaus nachsah. Immerhin, dachte er, Constant war schon ein alter Mann. Die Kälte drang ihm sicher bis in die Knochen.
Napoleon Bonaparte war mittelgroß, hatte einen kräftigen Hals und breite Schultern. Seine Adlernase beherrschte eine energische Mundpartie, ein kantiges Kinn – seine Augen zeigten ein durchdringendes Grau und schienen alles und jeden in seiner näheren Umgebung zu sezieren.
»Gibt es irgendeine Nachricht von Laurent?«, wollte er von Constant wissen.
»Nein, mon général.«
Général de Division, oder Generalmajor, Arnaud Laurent, einer von Napoleons getreuesten Kommandeuren und engsten Freunden, hatte am vorangegangenen Tag mit einem Trupp Soldaten eine Erkundungstour zum Gebirgspass unternommen. Es war zwar höchst unwahrscheinlich, dass sie hier auf einen Feind treffen würden, aber Napoleon hatte schon vor langer Zeit gelernt, stets auf das Unmögliche vorbereitet zu sein. Zu viele große Männer waren auf Grund falscher Mutmaßungen gestürzt worden. Hier hingegen zählten eher das Wetter und das Terrain zu ihren schlimmsten Feinden.
Mit knapp zweitausendfünfhundert Metern Meereshöhe galt der Große Sankt Bernhard seit Jahrhunderten als eine wichtige Passstraße für Reisende. Im Grenzgebiet von Schweiz, Italien und Frankreich gelegen, waren die Walliser Alpen, als deren wichtigster Pass der Große Sankt Bernhard bezeichnet wurde, bereits von zahlreichen Armeen überwunden worden: 390 v. Chr. von den Galliern auf ihrem Feldzug, um Rom zu zerstören; von Hannibal mit seinen Elefanten im Jahr 217 v. Chr.; und um 800 n. Chr. dann von Karl dem Großen, als er nach seiner Krönung in Rom als erster Kaiser des Heiligen Römischen Reiches nach Hause zurückkehrte.
Eine wahrlich ruhmreiche Gesellschaft, dachte Napoleon. Sogar einer seiner Vorgänger, Pippin der Kleine, König von Frankreich, hatte im Jahr 755 auf seinem Weg nach Italien – um mit Papst Stefan II. zusammenzutreffen – die Walliser Alpen überquert.
Aber wo andere Könige in ihrem Streben nach Größe gescheitert waren, werde ich siegreich sein, dachte er weiter. Sein Reich würde erblühen und die wildesten Träume all jener noch übertreffen, die vor ihm geherrscht hatten. Nichts würde sich ihm in den Weg stellen. Keine Armeen, nicht einmal das Wetter, auch kein Berg – und ganz gewiss keine österreichischen Emporkömmlinge.
Ein Jahr zuvor, während er und seine Armee Ägypten unterwarfen, hatten die Österreicher die Dreistigkeit besessen, das italienische Gebiet einzunehmen, das Frankreich im Friedensvertrag von Campo Formio zugesprochen worden war. Ihr Sieg sollte allerdings nicht von langer Dauer sein. Weder würden sie nämlich so früh im Jahr mit einem Angriff rechnen, noch könnten sie sich gewiss vorstellen, dass eine Armee versuchen mochte, die Walliser Alpen im Winter zu überqueren. Und dies aus gutem Grund.
Mit ihren steilen Felswänden und tiefen Schluchten waren die Walliser Alpen ja schon für Alleinreisende ein geografischer Albtraum, besonders aber für eine Armee von vierzigtausend Soldaten. Seit dem September versank der Pass unter zehn Metern Schnee, und zwar bei Temperaturen, die so gut wie ständig unter dem Gefrierpunkt lagen. Schneewechten, so hoch wie zehn Männer, überragten sie auf Schritt und Tritt und drohten sie und ihre Pferde unter sich zu begraben. Selbst an sonnigen Tagen verhüllte ein dichter Nebel das Gelände bis in den Nachmittag hinein. Stürme brachen ohne Vorwarnung los und konnten einen bis dahin ruhigen Tag in ein tobendes Inferno aus Schnee und Eis verwandeln, in dem ihre Sicht nicht mehr als einen Meter weit reichte. Das Entsetzlichste aber waren die Lawinen – Schneewalzen, manchmal einen halben Kilometer breit, die sich über die Berghänge ergossen und jeden zu verschlingen drohten, der das Pech hatte, ihren Weg zu kreuzen. Bisher war Gott immerhin so gnädig gewesen, die Armee Napoleons weitgehend zu verschonen, was soviel bedeutete wie: bis auf zweihundert Männer.
Er wandte sich an Constant. »Wo ist der Bericht des Quartiermeisters?«
»Ich habe ihn hier, mon général.« Der Diener zog ein Bündel Papiere aus seinem Mantel und reichte es Napoleon, der die Zahlen mit einem schnellen Blick überflog. Wahrlich, eine Armee konnte nur mit vollem Magen kämpfen. Bisher hatten seine Männer 19817 Flaschen Wein, eine Tonne Käse und 1700 Pfund Fleisch konsumiert.
Vor ihnen, unterhalb des Passes, erklang ein Ruf, der von den Vorreitern kam: »Laurent, Laurent …!«
»Na endlich«, murmelte Napoleon.
Eine Gruppe von zwölf Reitern tauchte aus dem Schneetreiben auf. Ebenso wie sein Kommandeur waren es vorbildliche Soldaten, sogar die besten, über die er verfügen konnte. Niemand saß gebeugt im Sattel, alle hielten sich kerzengerade, das Kinn entschlossen vorgereckt. Generalmajor Laurent zügelte sein Pferd vor Napoleon, salutierte und saß ab. Napoleon umarmte ihn, dann trat er zurück und winkte Constant, der sogleich herbeieilte und Laurent eine Flasche Branntwein reichte. Laurent trank einen Schluck, dann einen zweiten und gab die Flasche zurück.
Napoleon sagte: »Berichten Sie, alter Freund.«
»Wir sind zehn Kilometer weit geritten. Keine Spur von feindlichen Streitkräften. Das Wetter bessert sich in den tieferen Regionen, auch wird die Schneedecke dünner. Ab hier wird der Weg leichter.«
»Gut … sehr gut.«
»Da ist noch etwas Interessantes«, sagte Laurent, fasste Napoleon am Ellbogen und führte ihn ein Stück beiseite. »Wir haben etwas gefunden, mon général.«
»Würden Sie mir die Art Ihres Fundes vielleicht näher erläutern?«
»Es wäre besser, wenn Sie selbst einen Blick darauf werfen würden.«
Napoleon studierte Laurents Miene. In seinen Augen lag ein kaum unterdrücktes Glänzen gespannter Vorfreude. Er kannte Laurent, seit sie beide sechzehn Jahre alt waren und als Leutnants in der La Fére Artillerie gedient hatten. Laurent neigte weder zu Übertreibungen, noch war er leicht aus der Ruhe zu bringen. Was auch immer er gefunden haben mochte, es musste etwas Bedeutendes sein.
»Wie weit?«, fragte Napoleon.
»Es ist ein Ritt von etwa vier Stunden.«
Napoleon blickte zum Himmel. Es war bereits vorgerückter Nachmittag. Über den Bergspitzen zeichnete sich ein Streifen dunkler Wolken ab. Ein Sturm kündigte sich an. »Nun gut«, sagte er und klopfte Laurent auf die Schulter. »Wir reiten bei Tagesanbruch los.«
Wie üblich schlief Napoleon fünf Stunden und stand um sechs Uhr morgens, also noch vor Tagesanbruch, auf. Er frühstückte und las dann die im Laufe der Nacht eingetroffenen Depeschen seiner Unterführer, während er eine Tasse bitteren schwarzen Tees trank. Laurent erschien um kurz vor sieben Uhr mit seinem Reitertrupp, dann ritten sie ins Tal hinab, wobei sie dem Weg folgten, auf dem Laurent am Vortag gekommen war.
Der Sturm der vorangegangenen Nacht hatte zwar nur wenig Schnee ergeben, aber der heftige Wind hatte frische Verwehungen geschaffen: senkrecht aufragende weiße Mauern, die um Napoleon und seine Reiter herum eine tiefe Schlucht bildeten. Der Atem der Pferde trieb in Dampfschwaden durch die eisige Morgenluft, und bei jedem Schritt wurden Schneewolken aufgewirbelt. Napoleon ließ Styries Zügel locker und vertraute darauf, dass sich der Araberhengst seinen Weg selbst suchte, während er selbst fasziniert die Schneeverwehungen betrachtete, deren Wände der Wind zu Wirbeln und Wellen geformt hatte.
»Ein wenig unheimlich, nicht wahr, mon général?«, sagte Laurent.
»Es ist sehr ruhig«, murmelte Napoleon. »Eine solche Stille habe ich noch nie erlebt.«
»Es ist wunderschön«, pflichtete ihm Laurent bei. »Und gefährlich.«
Wie ein Schlachtfeld, dachte Napoleon. Außer vielleicht in seinem Bett und zusammen mit Josephine fühlte sich Napoleon auf einem Schlachtfeld heimischer als sonst irgendwo. Das Donnern der Kanonen, das Krachen der Musketen, der stechende Geruch von Schwarzpulver in der Luft … all das liebte er. Und in ein paar Tagen, dachte er, sobald wir diese verdammten Berge hinter uns gelassen haben … Er musste unwillkürlich lächeln.
Weiter vorn stieß der führende Reiter eine geballte Faust in die Luft und gab das Zeichen zum Anhalten. Napoleon beobachtete, wie sich der Mann aus dem Sattel schwang und durch den knietiefen Schnee stapfte. Er hatte den Kopf in den Nacken gelegt und suchte die Wände der Schneeverwehungen ab, dann verschwand er um eine Wegbiegung.
»Wonach hält er Ausschau?«, fragte Napoleon.
»Die Morgendämmerung ist die gefährlichste Zeit für Lawinen«, erwiderte Laurent. »Über Nacht härtet der Wind die oberste Schneeschicht zu einer festen Decke, während der Pulverschnee darunter weich bleibt. Wenn die Sonne auf die Schale trifft, beginnt sie aufzutauen. Oft ist die einzige Warnung ein ganz bestimmtes Geräusch oder ein Ton – so als würde Gott im Himmel seine Stimme erheben.«
Nach ein paar Minuten kam der führende Reiter zurück. Er gab Laurent ein Zeichen, dass alles klar sei, dann bestieg er wieder sein Pferd und setzte den Weg fort.
Sie ritten zwei weitere Stunden und folgten dem gewundenen Verlauf des Tals, das zu den Vorbergen hinunterführte. Schon bald gelangten sie in eine enge Schlucht aus grauem Granit, mit Blankeis bedeckt. Der führende Reiter ließ wieder anhalten und saß ab. Laurent tat das Gleiche, gefolgt von Napoleon.
Napoleon blickte sich um. »Ist es hier?«
Sein Generalmajor lächelte verschmitzt. »Dort, mon général.« Laurent hakte zwei Öllampen von seinem Sattel los. »Folgen Sie mir.«
Sie gingen den Weg hinunter und kamen an den sechs Pferden der Vorhut vorbei, deren Reiter vor ihrem General Haltung annahmen. Napoleon nickte jedem Soldaten nacheinander ernst zu, bis sie die Spitze der Kolonne erreichten, wo er und Laurent stehen blieben. Einige Minuten verstrichen, dann erschien ein Soldat – der führende Reiter – hinter einem Felsvorsprung zu ihrer Linken und stapfte durch den tiefen Schnee auf sie zu.
Laurent stellte vor: »Mon général, sicher erinnern Sie sich an Sergeant Pelletier.«
»Natürlich«, erwiderte Napoleon. »Ich stehe Ihnen zur Verfügung, Pelletier. Gehen Sie voraus.«
Pelletier salutierte, nahm ein zusammengerolltes Seil vom Sattel seines Pferdes und ging auf dem Weg zurück, den er soeben von den brusthohen Schneeverwehungen freigeräumt hatte. Er stieg den Abhang zur Basis einer senkrechten Granitwand hinauf, ging dort parallel zu ihr etwa fünfzig Meter weit und blieb vor einer rechtwinkelig in den Fels getriebenen Nische stehen.
»Sehr interessant, Laurent. Und was soll das sein, was ich da vor mir sehe?«, fragte Napoleon.
Laurent nickte Pelletier zu, der mit seiner Muskete wie mit einer Keule ausholte und den Kolben gegen den Fels schmetterte. Anstelle des üblichen Krachens von Holz auf Stein hörte Napoleon das Klirren von Eis. Pelletier schlug noch vier Mal zu, bis ein vertikaler Riss im Eis erschien. Er war gut einen halben Meter breit und fast zwei Meter hoch.
Napoleon blickte hinein, konnte außer tiefer Dunkelheit jedoch nichts sehen.
»Soweit wir feststellen können«, erklärte Laurent, »ist der Eingang von dichtem Buschwerk zugewuchert, und im Winter verschwindet er hinter hohen Schneewehen. Ich vermute, dass sich irgendwo da drin so etwas wie eine Wasserquelle befindet, was die Eisschicht auf dem Gestein erklären würde. Wahrscheinlich entsteht sie jede Nacht aufs Neue.«
»Interessant. Und wer hat diese Nische gefunden?«
»Das war ich, mon général«, antwortete Pelletier. »Wir haben angehalten, um den Pferden eine kurze Rast zu gönnen, und ich musste … nun ja, ich hatte ein Bedürfnis …«
»Ich verstehe, Sergeant, fahren Sie bitte fort.«
»Also gut, ich nehme an, ich bin ein wenig zu weit gewandert, général. Als ich fertig war, lehnte ich mich an den Felsen, um mich ein wenig zu sammeln, als die Eiswand plötzlich hinter mir nachgab. Ich ging ein Stück hinein und dachte mir nicht viel dabei, bis ich es sah … Nun, schauen Sie es sich mit eigenen Augen an, mon général.«
Napoleon wandte sich an Laurent. »Waren Sie drin?«
»Ja, mon général. Ich und Sergeant Pelletier. Niemand sonst.«
»Sehr gut, Laurent. Gehen Sie voraus, ich folge Ihnen.«
Der Höhlengang setzte sich weitere fünf Meter fort und wurde dabei immer enger und niedriger, so dass sie gezwungen waren, sich in zunehmend geduckter Haltung fortzubewegen. Plötzlich weitete sich der Tunnel, und Napoleon fand sich in einer Höhle wieder. Da sie vor ihm eingetreten waren, machten ihm Laurent und Pelletier Platz und hoben dann ihre Laternen so hoch, dass ihr flackerndes gelbliches Licht die Wände erhellte.
Mit einer Grundfläche von gut siebzehn mal zwanzig Metern stellte die Höhle einen regelrechten Eispalast dar. Die Wände und der Boden waren mit einer glitzernden Schicht bedeckt, die an einigen Stellen meterdick, an anderen jedoch so dünn zu sein schien, dass Napoleon den matten Schatten von grauem Felsgestein darunter erkennen konnte. Glitzernde Stalaktiten hingen stellenweise so tief von der Decke herab, dass sie mit den vom Boden aufragenden Stalagmiten verschmolzen und gemeinsam stundenglasförmige Eisskulpturen bildeten. Anders als an den Wänden und auf dem Boden war das Eis an der Decke jedoch aufgeraut und reflektierte das Licht der Laternen wie ein mit Sternen übersäter Himmel. Irgendwo tief in der Höhle erklang ein Geräusch von tropfendem Wasser, und noch weiter entfernt war das leise Pfeifen des Windes zu hören.
»Überwältigend«, murmelte Napoleon.
»Und das hier hat Pelletier gleich hinter dem Eingang entdeckt«, sagte Laurent und ging auf die Höhlenwand zu. Napoleon folgte ihm zu einer Stelle, an der Laurent mit seiner Laterne einen Gegenstand beleuchtete, der auf dem Boden lag. Es war ein Schild.
Knapp zwei Meter hoch und gut einen halben Meter breit, dabei geformt wie die Zahl 8, bestand er aus Weidengeflecht und war mit Leder überzogen, das mit verblichenen roten und schwarzen Quadraten bemalt war.
»Der ist uralt«, murmelte Napoleon.
»Mindestens zweitausend Jahre, würde ich schätzen«, bemerkte Laurent. »Ich weiß zwar, was Geschichte betrifft, gewiss nicht sehr gut Bescheid und habe sicherlich auch einiges vergessen, aber ich glaube doch, dieser Schild wird Gerron genannt. Er wurde von der leichten persischen Infanterie benutzt.«
»Mon dieu …«
»Da ist noch mehr, mon général. Hier entlang.«
Indem er sich seinen Weg durch den Wald von Stalaktiten suchte, führte ihn Laurent in den hinteren Teil der Höhle und dort zu einem anderen Tunneleingang, der oval und etwa einen Meter dreißig hoch war.
Hinter ihnen hatte Pelletier das Seil auf den Boden fallen lassen und war im Laternenschein bereits damit beschäftigt, eines seiner Enden um die Basis eines der Stalaktiten zu knoten.
»Gehen wir hinunter?«, fragte Napoleon. »In diesen Höllenschlund?«
»Heute nicht, mon général«, antwortete Laurent. »Wir gehen lieber nur hinüber.«
Laurent leuchtete mit seiner Laterne in den Tunnel. Ein paar Schritte entfernt befand sich eine Eisbrücke, kaum einen halben Meter breit, die sich über eine tiefe Spalte spannte und dann in einem anderen Tunnel verschwand.
»Waren Sie schon drüben?«, wollte Napoleon wissen.
»Sie ist ziemlich stabil. Außerdem befindet sich unter dem Eis solider Fels. Trotzdem kann man nicht vorsichtig genug sein.«
Er band das Seil zuerst um Napoleons Taille, dann um seine eigene. Pelletier zog noch einmal probeweise am festgeknoteten Ende, dann nickte er Laurent zu. Dieser meinte: »Achten Sie darauf, wohin Sie treten, mon général.« Dann drang er in den Tunnel ein. Napoleon wartete einen kurzen Augenblick und folgte ihm schließlich.
Sie tasteten sich möglichst vorsichtig über die Felsspalte. Auf halbem Weg blickte Napoleon zur Seite und in die Tiefe, sah dort aber nichts anderes als jene unergründliche Schwärze, in der sich die bläulich schimmernden Eiswände verloren.
Nach einiger Zeit erreichten sie die gegenüberliegende Seite. Sie folgten dem nächsten Tunnel, der gut sechs Meter weit einen Zickzackkurs beschrieb, und gelangten in eine weitere Eishöhle, die zwar deutlich kleiner als die erste, dafür aber mit einer hohen gewölbten Decke versehen war. Die Laterne emporhaltend, ging Laurent bis in die Mitte der Höhle und blieb neben zwei offensichtlich mit Eis umhüllten Stalagmiten stehen. Beide waren ungefähr vier Meter hoch und an den Spitzen abgebrochen.
An einen von diesen trat Napoleon näher heran. Und blieb jäh stehen. Er verengte die Augen zu Schlitzen. Das war kein Stalagmit, erkannte er, sondern eine solide Säule aus Eis. Er stützte sich mit einer Hand dagegen und nahm sie genau in Augenschein.
Aus dem Eis sah ihn das goldene Gesicht einer Frau an.
1
Großer Pocomoke-Sumpf, MarylandGegenwart
Sam Fargo kam aus der Hocke hoch und blickte zu seiner Frau hinüber, die bis zur Hüfte in klebrigem schwarzem Morast stand. Ihre hellgelbe Wathose ließ ihr glänzendes kastanienbraunes Haar reizvoll zur Geltung kommen. Sie spürte seinen Blick, wandte sich zu ihm um, spitzte die Lippen und pustete eine Haarsträhne von ihrer Wange. »Und was gibt es da zu lachen, Fargo?«, fragte sie.
Als sie die Wathose anzog, hatte er den Fehler gemacht, die Bemerkung fallen zu lassen, sie sehe wie der Gorton’s Fisherman aus, was ihm einen vernichtenden Blick eingebracht hatte. Er hatte dem Vergleich schnell noch ein sexy hinzugefügt, aber dies hatte keine nennenswerte Wirkung mehr gehabt.
»Du«, erwiderte er jetzt. »Du siehst wunderschön aus – Longstreet.« Wenn sich Remi ärgerte, dann nannte sie ihn bei seinem Nachnamen. Er revanchierte sich auf ähnliche Weise mit ihrem Mädchennamen.
Sie hielt die Arme hoch, die bis zu den Ellbogen mit Matsch beschmiert waren, und sagte darauf mit einem nur unzureichend unterdrückten Lächeln: »Du bist verrückt. Mein Gesicht ist von Mücken zerstochen, und mein Haar klebt völlig verschwitzt an meinem Kopf.« Sie kratzte sich am Kinn und hinterließ dabei einen Schmutzstreifen auf der Haut.
»Das steigert deinen Charme beträchtlich.«
»Lügner.«
Trotz des Ausdrucks von Abscheu in ihrem Gesicht wusste Sam, dass Remi eine Mitstreiterin war, die ihresgleichen suchte. Sobald sie einmal ein Ziel ins Auge gefasst hatte, würde sie kein noch so intensives Unbehagen davon abhalten, es auch zu erreichen.
»Na ja«, sagte sie. »Ich muss schon zugeben, dass du selbst … auch ziemlich flott aussiehst.«
Sam tippte gegen die Krempe seines abgenutzten Panamahutes, dann kehrte er wieder zu seiner Arbeit zurück, die darin bestand, den Schlamm um einen versunkenen Holzgegenstand herum zu entfernen, von dem er hoffte, dass er sich als Teil einer Kiste herausstellen würde.
Seit drei Tagen wateten sie durch den Sumpf und suchten nach dem einen Hinweis, der vielleicht den Beweis lieferte, dass ihr ganzes Unterfangen doch nicht sinnlos war. Keinem von ihnen machte es etwas aus, einem Phantom hinterherzujagen – bei der Schatzsuche gehörte so etwas zum Alltag –, aber es war immer besser, das Phantom am Ende auch zu erwischen.
In diesem Fall stammte das in Frage kommende Phantom aus einer obskuren Legende. Während in der nahe gelegenen Chesapeake Bay sowie in der Delaware Bay an die viertausend Schiffswracks auf dem Meeresgrund liegen sollten, befand sich der Preis, dem Sam und Remi nachjagten, an Land. Einen Monat zuvor hatte ihnen Ted Frobisher, ein anderer Schatzsucher, der sich vor nicht allzu langer Zeit zur Ruhe gesetzt hatte, um sich intensiver um seinen Antiquitätenladen in Princess Anne zu kümmern, eine Brosche von höchst interessanter Herkunft geschickt.
Das birnenförmige Schmuckstück aus Gold und Jade sollte einst einer einheimischen Frau namens Henrietta Bronson, einem der ersten Opfer der berüchtigten Gesetzlosen Martha Patty (alias Lucretia) Cannon, gehört haben.
Der Überlieferung zufolge war Martha Cannon eine harte, skrupellose Frau, die um 1820 nicht nur die ländlichen Regionen an der Grenze zwischen Delaware und Maryland mit ihrer Bande unsicher gemacht und Reiche wie Arme beraubt und ermordet hatte, sondern außerdem in einem Ort namens Johnson’s Corner, der heute Reliance hieß, eine Pension betrieb.
Martha Cannon lockte Reisende in ihr Etablissement, bewirtete sie und bot ihnen Unterkunft, bevor sie ihre Gäste dann nächtens ermordete. Sie schaffte die Leichen in den Keller des Hauses, nahm ihnen sämtliche Wertsachen ab und stapelte sie in einer Ecke wie Klafterholz auf, bis sie genügend Opfer gesammelt hatte, um diese mit einem Pferdewagen in einen Wald in der Nähe zu transportieren, wo sie sie dann verscharrte. So grässlich allein das schon war, sollte Martha Cannon später auch noch das gestehen, was viele als ihr abscheulichstes Verbrechen betrachteten.
Martha Cannon richtete etwas ein, das viele einheimische Historiker eine umgekehrte Untergrundbahn getauft hatten. Sie fing befreite Sklaven aus den Südstaaten ab und sperrte sie gefesselt und geknebelt in den zahlreichen geheimen Räumen der Pension sowie in ihrem behelfsmäßigen Kellerverlies ein, ehe sie sie des Nachts nach Cannon’s Ferry brachte, wo sie verkauft und auf Schiffe geladen wurden, die dann Kurs auf die Sklavenmärkte Georgias nahmen.
Im Jahr 1829 entdeckte ein Arbeiter, während er eins der Felder, die zu Martha Cannons Besitz gehörten, pflügte, mehrere halbverweste Leichen. Martha Cannon wurde in vier Fällen des Mordes angeklagt, für schuldig befunden und zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt. Vier Jahre später starb sie in ihrer Zelle an einer Arsenvergiftung, die sie – wovon die meisten überzeugt waren – selbst herbeigeführt hatte.
In den darauffolgenden Jahren wurden Martha Cannons Verbrechen und ihr Tod zunehmend zu einem Mythos, der von der Behauptung, dass Martha Cannon aus dem Gefängnis ausgebrochen sei und noch bis weit in die neunziger Jahre gemordet und Raubzüge veranstaltet habe, bis zu Geschichten reichte, ihr Geist spuke noch immer auf der Delmarva-Halbinsel herum und lauere ahnungslosen Wanderern auf. Was die Leute jedoch niemals in Frage stellten, war, dass Martha Cannons Beute – von der sie Berichten zufolge nur einen Bruchteil verbraucht hatte – niemals gefunden worden war. Schätzungen zufolge belief sich der aktuelle Wert des Schatzes auf einen Betrag zwischen $ 100000 und $ 400000.
Sam und Remi kannten die Legende von Patty Cannons Schatz natürlich, aber da ihnen zuverlässige Hinweise auf seine Existenz fehlten, hatten sie die Pläne für eine eventuelle Suche vorläufig noch im Ordner demnächst zu erledigender Projekte abgeheftet. Nach dem Auftauchen von Henrietta Bronsons Brosche und einem genauen Datum, an dem sie mit ihrer Suche beginnen konnten, hatten sie sich entschieden, die Herausforderung anzunehmen.
Nach einer eingehenden Begutachtung der historischen Topografie des Pocomoke-Sumpfs und der Kartografisierung von Martha Cannons angeblichen Verstecken in Relation zum Fundort der Brosche engten sie ihren Suchbereich auf ein drei Quadratkilometer großes Gebiet ein, das sich zum größten Teil über das Sumpfgebiet erstreckte und aus einem Labyrinth von mit Moos bewucherten Zypressen und mit Büschen zugewachsenen Sumpflöchern bestand. Ihre Recherchen hatten ergeben, dass sich in diesem Gebiet, das um 1820 noch völlig trocken gewesen war, eines von Martha Cannons Geheimverstecken, eine baufällige Bretterbude, befand.
Ihr Interesse für Martha Cannons Schatz hatte nichts mit seinem Geldwert zu tun – zumindest soweit es seine Verwendung für ihre eigenen Belange betraf. Als sie zum ersten Mal von der Geschichte erfuhren, waren sich Sam und Remi darin einig, dass – wenn sie jemals das Glück haben sollten, den Schatz zu finden – er zum größten Teil dem National Underground Railroad Freedom Center in Cincinnati gespendet werden würde, eine Ironie, von der sie sicher waren, dass sie Martha Cannon, wenn sie noch am Leben wäre, in rasende Wut versetzen würde. Oder dass sie, wenn sie ein wenig Glück hätten, wenigstens ihren Geist erzürnen würde.
»Remi, wie ging noch mal dieses Gedicht? … Das über Martha Cannon, meine ich«, rief Sam. Remi hatte ein nahezu fotografisches Gedächtnis für Details, ganz gleich ob nebensächlich oder relevant.
Sie überlegte kurz, dann zitierte sie:
»Halt den Mund,
Schlaf schnell ein.
Old Patty Ridenour holt dich herein.
Schnappt sich mit ihrer Bande
Ganz gleich ob Sklave oder frei geboren.
Reitet bei Tag und Nacht,
Hat allen den Tod geschworen.«
»Ja, das ist es«, erwiderte Sam.
Um sie herum ragten die freiliegenden Wurzelstränge der Zypressen wie abgetrennte Klauen riesiger geflügelter Dinosaurier aus dem Wasser. In der vorangegangenen Woche war ein Sturm über die Halbinsel hinweggejagt und hatte Berge von abgebrochenen Ästen zurückgelassen, die an hastig errichtete Biberdämme erinnerten. Über ihnen erklang im Laubdach der Bäume eine Symphonie aus Vogelschreien, Insektensummen und schlagenden Flügeln. Gelegentlich identifizierte Sam, dessen Hobby Singvögel waren, ein Zwitschern und nannte Remi den Namen des Vogels. Dafür belohnte sie ihn jedes Mal mit einem Lächeln und sagte: »Das ist wirklich nett von dir.«
Sam fand, dass ihm diese Übung dabei half, nach Gehör Klavier zu spielen, eine Technik, die er seiner Mutter abgeschaut hatte. Remi wiederum konnte ganz gut Violine spielen, was sie bei ihren regelmäßigen Stegreif-Duetten auch immer wieder bewies.
Trotz seiner Ingenieursausbildung war Sam ein intuitiver Denker, der sich vorwiegend auf seine rechte Gehirnhälfte verließ, während Remi, eine am Boston College ausgebildete Anthropologin und Historikerin, eher die logischen Denkprozesse der linken Gehirnhälfte bevorzugte. Während diese Gegensätzlichkeit sie einerseits zu einem ausgeglichenen Paar machte, das liebenswürdig miteinander umging, führte sie andererseits zu heftigen Debatten zum Beispiel darüber, wodurch die englische Reformation ausgelöst worden war oder welcher Schauspieler James Bond am besten dargestellt habe oder wie Vivaldis Orchesterkomposition Sommer am besten interpretiert würde. Meistens endeten die Diskussionen mit schallendem Gelächter und einer weiterhin andauernden freundschaftlichen Uneinigkeit.
Vornübergebeugt tastete Sam mit der Hand im Wasser herum, fuhr mit den Fingern über das Holz, bis er auf etwas Metallenes stieß – etwas mit einem u-förmigen Bogen und einem quadratischen Korpus.
Ein Vorhängeschloss, dachte er, während Visionen von einer uralten, mit Muscheln bewachsenen Schließe durch seinen Kopf wirbelten. »Ich hab hier was«, verkündete er.
Remi drehte sich zu ihm um und zog die ebenfalls mit Schlamm besudelten Arme aus dem Wasser.
»Hah!« Sam zog es heraus. Während der Morast davon herabrutschte und mit einem leisen Platschen im Wasser versank, gewahrte er Rost und ein silbriges Funkeln, dann einige erhabene Buchstaben …
M-A-S-T-E-R-L-O-C-K.
»Und?«, fragte Remi mit unverhohlener Skepsis in der Stimme. Sie war schon an Sams manchmal verfrühte Begeisterung gewöhnt.
»Meine Liebe, ich habe soeben ein echtes Master-Vorhängeschloss von circa 1970 gefunden«, erwiderte er, dann hievte er das Stück Holz, an dem das Schloss befestigt war, aus dem Wasser. »Mit dem Schloss sieht das Ding wie ein alter Türpfosten aus.« Er ließ seinen Fund wieder zurück ins Wasser fallen und richtete sich dann mit einem leisen Stöhnen auf.
Remi lächelte ihn an. »Mein unerschütterlicher Schatzsucher. Immerhin ist es mehr, als ich gefunden habe.«
Sam blickte auf seine Uhr, eine Timex Expedition, die er nur bei solchen Unternehmungen trug. »Sechs Uhr«, sagte er. »Sollen wir allmählich Feierabend machen?«
Remi fuhr mit der zu einer Kelle gewölbten Hand über den gegenüberliegenden Unterarm, wischte eine Ladung Schlamm ab und lächelte ihn strahlend an. »Ich dachte schon, du würdest niemals fragen.«
Sie sammelten ihr Gepäck ein und marschierten den knappen Kilometer zurück zu ihrem Boot, das sie an einem aus dem Erdboden ragenden Zypressenstumpf festgebunden hatten. Sam löste die Leine und schob das Boot vor sich her in tieferes Wasser, bis es ihm bis zur Taille reichte, während Remi wiederholt an der Starterleine des Motors zog. Hustend erwachte die Maschine zum Leben, und Sam kletterte ins Boot.
Remi lenkte den Bug in den Kanal und gab Gas. Die nächste Stadt und ihre Operationsbasis war Snow Hill, fünf Kilometer den Pocomoke River hinauf. Die Frühstückspension, die sie ausgewählt hatten, verfügte über einen überraschend gediegenen Weinkeller und servierte eine Krabbensuppe, die Remi beim Abendessen am Tag zuvor in einen wahren kulinarischen Freudentaumel versetzt hatte.
Schweigend glitten sie durch das Wasser, halb eingelullt vom leisen Blubbern des Motors, und blickten zum Blätterdach hinauf. Plötzlich wandte sich Sam auf seinem Sitz um und blickte nach rechts.
»Remi, fahr mal langsamer.«
Sie nahm das Gas zurück. »Was ist?«
Er holte ein Fernglas aus seinem Rucksack und setzte es an die Augen. In fünfzig Metern Entfernung klaffte am Ufer eine Lücke im Laubwerk – ein weiterer versteckter Kanal unter den Dutzenden, die sie bereits gesehen hatten. Die Einfahrt war teilweise durch ein Gewirr aus abgebrochenen Ästen versperrt, die der Sturm dort angeweht hatte.
»Was hast du gesehen?«, fragte sie wieder.
»Irgendetwas … ich weiß es auch nicht«, murmelte er. »Ich dachte, ich hätte so was wie eine gleichmäßige Linie wahrgenommen, eine Kurve oder so. Es sah nicht aus, als wäre es natürlichen Ursprungs. Kannst du mich mal hinbringen?«
Sie betätigte das Steuerruder und lenkte das Boot in die Einfahrt des Kanals. »Sam, halluzinierst du? Hast du heute schon genug getrunken?«
Er nickte und achtete nur auf den Kanal und seine Umgebung. »Mehr als genug sogar.«
Mit einem leisen Knirschen schob sich der Bug des Bootes in den Asthaufen. Der Seitenarm war mit fast zwanzig Metern breiter, als es auf den ersten Blick zu erkennen gewesen war. Sam schlang die Bootsleine um einen der dickeren Äste, dann schwang er die Beine über den Bootsrand und ließ sich ins Wasser rollen.
»Sam, was hast du vor?«
»Ich bin gleich wieder zurück. Bleib hier.«
»Einen Teufel werde ich tun.«
Bevor sie noch mehr sagen konnte, holte Sam tief Luft, tauchte ins Wasser und verschwand. Zwanzig Sekunden später hörte Remi ein Plätschern auf der anderen Seite des Asthaufens, gefolgt von einem zischenden Laut, als Sam abermals seine Lunge voll Luft sog.
Sie rief: »Sam, bist du …«
»Alles okay. Ich bin in einer Minute zurück.«
Aus einer Minute wurden zwei, dann drei. Schließlich rief Sam durch den Laubvorhang: »Remi, kannst du bitte zu mir kommen?«
Sie hörte den spitzbübischen Unterton in seiner Stimme und dachte schon Oh, Boy. Sie liebte diese manchmal kaum zu zügelnde Abenteuerlust ihres Mannes, träumte jedoch auch schon davon, wie angenehm eine heiße Dusche in diesem Augenblick wäre. »Was ist los?«, wollte sie wissen.
»Ich brauch dich hier.«
»Sam, ich bin gerade dabei, wieder trocken zu werden. Kannst du nicht …«
»Nein, das hier willst du dir ganz sicher ansehen. Vertrau mir.«
Remi seufzte, dann ließ sie sich über den Bootsrand ins Wasser gleiten. Zehn Sekunden später befand sie sich wassertretend neben ihm. Die Bäume zu beiden Seiten des Kanals bildeten ein nahezu lückenloses Dach über dem Wasser und schufen so eine Art grünen Tunnel. Hier und da drangen Sonnenstrahlen bis auf die teilweise mit Algen bedeckte Wasseroberfläche.
»Hi, nett von dir, dass du gekommen bist«, sagte er grinsend und hauchte ihr einen Kuss auf die Wange.
»Okay, du Schlaumeier, was sollen wir …«
Er klopfte mit den Fingerknöcheln gegen den verformten Balken, um den er einen Arm geschlungen hatte, doch statt eines dumpfen Lautes hörte sie ein metallisches Gongen.
»Was ist das?«
»Das weiß ich noch nicht. Ein Teil von – keine Ahnung, welcher Teil. Ich muss erst runtergehen und versuchen hineinzukommen.«
»Teil von was? Und in was willst du hinein?«
»Hier entlang, komm mit.«
Sam ergriff ihre Hand und schwamm tiefer in den Kanal hinein und dann um eine Biegung herum, hinter der sich der Wasserlauf bis auf fünf Meter verengte. Er hielt an und deutete auf einen mit Schlingpflanzen überwucherten Zypressenstamm nicht weit vom Ufer. »Dort. Siehst du es?«
Sie kniff die Augen zusammen und legte den Kopf erst nach links, dann nach rechts. »Nein. Was soll ich sehen?«
»Diesen Ast, der aus dem Wasser ragt und dessen Ende einem T gleicht …«
»Okay, ich sehe ihn.«
»Schau ganz genau hin. Kneif die Augen zusammen. Das hilft.«
Sie folgte seinem Rat, verengte die Augen, bis ihr Gehirn allmählich registrierte, was ihre Augen da erblickten. Es verschlug ihr den Atem. »Gütiger Himmel, ist das ein … das kann doch nicht sein!«
Sam nickte. Sein Grinsen reichte von einem Ohr bis zum anderen. »Doch. Das ist es. Das, meine Liebe, ist das Periskop eines U-Bootes.«
2
Sewastopol, Ukraine
Hadeon Bondaruk stand an den deckenhohen Fenstern seines Arbeitszimmers und blickte aufs Schwarze Meer hinaus. In seinem Arbeitszimmer war es dunkel. Das einzige Licht kam von den gedämpften Deckenlampen, die die Ecken des Raumes sparsam erhellten. Die Nacht hatte sich auf die Halbinsel Krim herabgesenkt, doch im Westen, über der rumänischen und der bulgarischen Küste, konnte er, beleuchtet von den letzten Strahlen der untergehenden Sonne, einen Streifen Gewitterwolken erkennen, die nach Norden über das Wasser zogen. Alle paar Sekunden zuckten Blitze aus den Wolkenbergen über den Horizont. In einer Stunde wäre das Gewitter hier, und Gott möge dann denen helfen, die töricht genug waren, sich auf dem Schwarzen Meer von einem Unwetter überraschen zu lassen.
Oder, dachte Bondaruk, möge Gott ihnen auch nicht helfen. Es war ja egal. Unwetter und Krankheiten und, ja, sogar Kriege waren die Mittel der Natur, um eine Auslese zu treffen und die Herde zu verkleinern. Er hatte wenig für Leute übrig, die nicht genügend Vernunft oder Kraft besaßen, sich vor den Gefahren des Lebens zu schützen. Es war eine Lektion, die er einmal als kleiner Junge gelernt und die er dann nie wieder vergessen hatte.
Bondaruk war 1960 in einem Dorf südlich von Aschgabat, Turkmenistan, hoch oben im Kopet-Dag-Gebirge geboren worden. Seine Mutter und sein Vater und deren Eltern hatten als Bauern und Schäfer in jener geografischen Grauzone zwischen dem Iran und der damaligen Sowjetunion gelebt. Wie alle Bewohner des Kopet-Dag-Gebirges waren sie zäh und selbstständig und pochten auch mit Nachdruck auf ihre Unabhängigkeit, indem sie sich keiner der beiden Nationen zugehörig fühlten. Der Kalte Krieg hatte jedoch andere Pläne mit Bondaruk und seiner Familie.
Im Zuge der iranischen Revolution von 1979 und der Absetzung des Schah hatte die Sowjetunion weitere militärische Einheiten in das Grenzgebiet nördlich des Iran entsandt, und Bondaruk, damals neunzehn Jahre alt, hatte miterleben müssen, wie die Unabhängigkeit seines Dorfes mehr und mehr beschnitten wurde, als Stützpunkte der Roten Armee und Raketenabwehrstellungen in ihrer einst so friedlichen Bergheimat eingerichtet wurden.
Das sowjetische Militär behandelte die im Kopet-Dag-Gebirge ansässige Bevölkerung wie unzivilisierte Wilde, zog wie eine Landplage durch die Dörfer, requirierte Lebensmittel und Frauen, machte zum Vergnügen Jagd auf das Vieh und trieb iranische revolutionäre Elemente zu Massenerschießungen zusammen. Es war völlig egal, dass Bondaruk und seine Leute so gut wie nichts von der Welt dort draußen oder auch von Politik wussten. Ihre muslimische Religion und die geografische Nähe zum Iran machten sie bereits verdächtig.
Ein Jahr später erschienen zwei Kampfpanzer zusammen mit zwei Kompanien Soldaten der Roten Armee am Dorfrand. Ein Soldatentrupp war in der vorangegangenen Nacht in einen Hinterhalt geraten, berichtete der Kommandant Bondaruk und den anderen Dorfbewohnern. Acht Männer waren dabei ums Leben gekommen. Man hatte ihnen die Kehlen durchgeschnitten und sie ihrer Kleidung, der Waffen und sämtlicher persönlicher Habe beraubt. Die Dorfältesten hätten fünf Minuten Zeit, die Verantwortlichen zu benennen, sonst müsse die gesamte Dorfgemeinschaft dafür büßen.
Bondaruk hatte schon davon gehört, dass turkmenische Widerstandskämpfer auf dem Land von iranischen Kommandoeinheiten unterstützt wurden, doch soweit er wusste, waren keine Dorfbewohner daran beteiligt. Da er die Schuldigen nicht präsentieren konnte, flehte der Dorfhäuptling den sowjetischen Kommandeur um Gnade an und wurde für seine Mühe erschossen. Während der nächsten Stunde beharkten die Panzer das Dorf mit Granaten, bis es vollständig in Trümmern lag und brannte. In dem Durcheinander wurde Bondaruk von seiner Familie getrennt. Er und eine Handvoll Jungen zogen sich tiefer in die Berge zurück – weit genug, um vor den Soldaten sicher zu sein, aber immer noch nahe genug, um während der Nacht beobachten zu können, wie ihr Dorf dem Erdboden gleichgemacht wurde. Am nächsten Tag kehrten sie in das Dorf zurück und begannen mit der Suche nach Überlebenden. Sie fanden allerdings mehr Tote als Lebende, darunter auch Bondaruks Familie, die in der Moschee Schutz gesucht hatte und unter deren Trümmern begraben wurde.
Irgendetwas in ihm veränderte sich schlagartig, als hätte Gott vor seinem alten Leben einen dunklen Vorhang heruntergelassen. Er sammelte die stärksten und wehrhaftesten Dorfbewohner, Männer wie Frauen, um sich und zog mit ihnen in die Berge, um fortan das Leben von Partisanen zu führen.
Innerhalb eines halben Jahres war Bondaruk nicht nur in eine Führungsposition unter seinen Mitkämpfern aufgestiegen, sondern auch zu einer Legende unter der turkmenischen Landbevölkerung geworden. Bondaruks Kämpfer schlugen stets in den Nächten zu, überfielen sowjetische Patrouillen und Lastwagenkonvois, um sich kurz darauf wie Gespenster ins Kopet-Dag-Gebirge zurückzuziehen. Ein Jahr nach der Zerstörung seines Dorfes wurde eine Belohnung auf Bondaruks Kopf ausgesetzt. Er war der sowjetischen Führung in Moskau aufgefallen, die mittlerweile nicht nur in einen heftigen Konflikt mit dem Islam verwickelt war, sondern in Afghanistan Krieg führte und sich nun auch noch mit turkmenischen Guerillas herumschlagen musste.
Kurz nach seinem zwanzigsten Geburtstag erhielt Bondaruk die Nachricht, dass iranische Geheimdienstagenten verbreiten ließen, seine Kopet-Dag-Kämpfer hätten in Teheran einen Verbündeten, wenn er nur bereit wäre, mit ihnen zu verhandeln, was er schließlich in einem kleinen Café vor den Toren Aschgabats tat.
Der Mann, mit dem Bondaruk zusammentraf, entpuppte sich als ein Oberst der iranischen paramilitärischen Eliteorganisation, den Pasdaran oder auch Revolutionswächtern. Der Oberst bot Bondaruk und seinen Männern Waffen, Munition, eine Ausbildung und wichtige Nachschubgüter für seinen Kampf gegen die Sowjets an. Wachsam hatte Bondaruk nach einem Hintertürchen in diesem Angebot gesucht – diesem einen entscheidenden Vorbehalt, der dafür sorgen könnte, dass die Unterdrückung in Zukunft nicht mehr von den Sowjets, sondern von den Iranern ausging. Einen solchen Vorbehalt gebe es nicht, wurde ihm versichert. Wir haben gemeinsame Vorfahren, einen gemeinsamen Glauben und ein gemeinsames Anliegen. Was brauchten sie also noch mehr, das sie verband? Bondaruk nahm das Angebot an, und während der folgenden fünf Jahre zermürbten er und seine Kämpfer unter Führung des iranischen Obersts die sowjetischen Besatzer.
So befriedigend dies für Bondaruk auch sein mochte, so war es letztlich doch seine Beziehung zu dem Oberst, die den größten Einfluss auf ihn ausübte. Offenbar war dieser Oberst früher einmal ein Lehrer für persische Geschichte gewesen, ehe er in den Dienst der Revolution berufen worden war. Das Persische Reich, so erklärte er, bestehe schon seit über dreitausend Jahren und habe sich in seiner Blütezeit über das Kaspische und das Schwarze Meer, Griechenland, Nordafrika und einen großen Teil des Vorderen Orients erstreckt. Tatsächlich, so erfuhr Bondaruk, wäre Xerxes der Erste – oder auch Xerxes der Große –, der in Griechenland eingedrungen war und die Spartaner in der Schlacht bei den Thermopylen besiegt hatte, in dem Gebirge geboren worden, das Bondaruk als seine Heimat betrachtete. Außerdem sollte er im Kopet-Dag-Gebirge Dutzende von Nachkommen gezeugt haben.
Dies war ein Gedanke, der Bondaruk eigentlich niemals aus dem Kopf ging, während er und seine Guerillas weiterhin die Sowjets in Atem hielten, bis sich, 1990, zehn Jahre nachdem sie ins Kopet-Dag-Gebirge vorgedrungen war, die Rote Armee endlich von der Grenze zurückzog. Kurz danach brach die Sowjetunion endgültig zusammen.
Nachdem der Kampf ein Ende gefunden hatte und er nicht daran dachte, zurückzukehren und ein gewöhnlicher Schäfer zu werden, zog Bondaruk, unterstützt von seinem iranischen Freund, dem Oberst, nach Sewastopol, das sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zum Wilden Westen des Schwarzmeer-Beckens entwickelt hatte. Dort sicherten ihm seine naturgegebenen Führungsqualitäten und sein freizügiger Einsatz von Brutalität und Gewalt sehr schnell einen festen Platz auf dem ukrainischen schwarzen Markt und später in der ukrainischen Krasnaya Mafiya, auch Rote Mafia genannt. Im Alter von fünfunddreißig Jahren hatte Hadeon Bondaruk die Kontrolle über praktisch sämtliche kriminellen Unternehmungen in der Ukraine inne und war zudem mehrfacher Millionär.
Nachdem er seine Position, was Macht und Reichtum betraf, gesichert hatte, fasste Bondaruk eine Idee ins Auge, die schon seit vielen Jahren in seinem Kopf herumgeisterte. War Xerxes der Große tatsächlich im Kopet-Dag-Gebirge, seiner geliebten Heimat, geboren und aufgezogen worden? Hatten er und Xerxes, als Jungen durch Jahrhunderte voneinander getrennt, möglicherweise die gleichen Wege benutzt und sich an den gleichen Gebirgspanoramen ergötzt? Wäre es dann nicht möglich, dass er selbst ein Abkömmling persischer Könige war?
Diese Frage zu beantworten dauerte fünf Jahre, und es waren Millionen Dollar sowie ein umfangreicher Stab von Historikern, Archäologen und Ahnenforschern nötig, um jeden Zweifel zu beseitigen. Aber als er seinen vierzigsten Geburtstag feierte, konnte sich Hadeon Bondaruk ganz sicher sein. Er war tatsächlich ein direkter Nachfahr von Xerxes dem Ersten, Herrscher des Achämenidenreiches.
Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich Bondaruks Neugier zu einer Obsession für alles Persische. Er nutzte seinen enormen Reichtum und Einfluss, um eine Sammlung persischer Artefakte anzulegen: vom Trinkbecher, der bei den Hochzeitsfeierlichkeiten von Kyaxares II. verwendet wurde, über einen Altarstein, der während der sassanidischen Dynastie bei zoroastrischen Ritualen benutzt wurde, bis hin zu dem mit Edelsteinen besetzten Gerron-Schild, der einst von Xerxes selbst getragen worden war, nämlich während der Schlacht bei den Thermopylen.
Und seine Sammlung war nahezu komplett. Bis auf eine einzige, aber offenkundige Ausnahme, so ermahnte er sich ständig. Sein persönliches Museum, das er sich in seinem Wohnsitz eingerichtet hatte, war von erhabener Schönheit, die er mit niemandem teilte, zum einen, da ihm niemand ihrer würdig schien, vorwiegend aber deshalb, weil die Sammlung noch nicht vollständig war.
Noch nicht, dachte er jetzt. Schon sehr bald würde er das ändern.
Wie auf ein Stichwort öffnete sich die Tür seines Arbeitszimmers, und sein persönlicher Diener trat ein. »Entschuldigen Sie, Chef.«
Bondaruk wandte sich um. »Was ist los?«
»Ein Anruf für Sie. Mr. Archipow.«
»Stellen Sie ihn durch.«
Der Diener ging hinaus und schloss leise die Tür hinter sich. Wenige Sekunden später trillerte das Telefon auf Bondaruks Schreibtisch. Er nahm den Hörer ab. »Sagen Sie mir, dass Sie gute Nachrichten für mich haben, Grigori.«
»Die habe ich tatsächlich. Meinen Gewährsleuten zufolge betreibt der Mann in der Gegend einen Antiquitätenladen. Die Website, auf der er das Bild veröffentlicht hat, gilt als ein bedeutendes Forum für Antiquitätenhändler und Schatzsucher.«
»Und gibt es schon Interessenten für die Scherbe?«
»Einige, aber es ist nichts Ernsthaftes dabei. Bislang herrscht die Meinung vor, dass es sich lediglich um das Fragment einer zerbrochenen Flasche handelt, mehr nicht.«
»Gut. Wo sind Sie?«
»In New York. Und gerade dabei, jeden Moment in meine Maschine einzusteigen.«
Dies quittierte Bondaruk mit einem Lächeln. »Stets bereit, die Initiative zu ergreifen. Das gefällt mir.«
»Das ist es ja auch schließlich, wofür Sie mich bezahlen«, antwortete der Russe.
»Und wenn Sie es schaffen, dieses Stück zu erwerben, dann erwartet Sie ein großzügiger Bonus. Wie wollen Sie mit dem Mann, diesem Antiquitätenhändler, verfahren?«
Der Russe hielt für einen Augenblick inne, und Bondaruk konnte vor seinem geistigen Auge das grausame Lächeln sehen, das jetzt um Archipows Lippen spielte.
»Ich finde, der direkte Weg ist stets der beste, meinen Sie nicht?«
Bondaruk wusste, dass sich Archipow bestens auskannte, was Direktheit und das Erzielen schneller Ergebnisse betraf. Der ehemalige russische Speznas war clever, skrupellos und unbarmherzig. In den zwölf Jahren, die er nun schon in Bondaruks Diensten stand, hatte Archipow bei keiner Mission versagt, ganz gleich wie schmutzig sie auch gewesen war.
»Doch, das meine ich«, erwiderte Bondaruk. »Ich überlasse es Ihnen. Gehen Sie nur so diskret wie möglich vor.«
»Das tue ich doch immer.«
Was durchaus der Wahrheit entsprach. Sehr viele von Bondaruks Feinden waren nämlich, wie die Ermittlungen der zuständigen Behörden ergeben hatten, einfach vom Erdboden verschwunden.
»Rufen Sie mich an, sobald Sie Bescheid wissen.«
»Das tue ich.«
Bondaruk wollte schon auflegen, als ihm noch eine weitere Frage durch den Kopf ging. »Nur aus Neugier, Grigori, wo befindet sich der Laden dieses Mannes? Irgendwo in der Nähe des Ortes, den wir vermutet haben?«
»Sehr nah dran. In einer kleinen Stadt namens Princess Anne.«
3
Snow Hill, Maryland
Sam Fargo stand am Fuß der Treppe, lehnte am Geländer, hatte die Füße übereinandergeschlagen und die Arme vor der Brust verschränkt. Remi verspätete sich wie üblich, da sie im letzten Augenblick noch entschieden hatte, dass ihr schwarzes Donna-Karan-Kleid für das Restaurant ein wenig zu elegant sei, und war deshalb in ihr Zimmer zurückgekehrt, um sich umzuziehen. Sam sah abermals auf die Uhr. Er machte sich weniger Sorgen wegen ihrer Reservierung als wegen seines leeren Magens, der sich immer wieder durch ein lautes Knurren bemerkbar machte, seit sie in die Frühstückspension zurückgekehrt waren.
Die Eingangshalle der Herberge wirkte mit ihrer Einrichtung im amerikanischen Shabby-Chic-Stil und zahlreichen Landschaftsaquarellen einheimischer Künstler, die die Wände zierten, fast übertrieben heimelig. Im offenen Kamin knisterte ein Feuer, und aus versteckten Lautsprechern drangen die leisen Klänge irischer Volksmusik.
Sam hörte ein Knarren auf der Treppe und blickte rechtzeitig hoch, um Remi die Stufen herunterkommen zu sehen. Jetzt trug sie eine cremefarbene Ralph-Lauren-Hose, einen Rollkragenpullover aus Kaschmir und über den Schultern einen rostfarbenen Schal. Ihr kastanienbraunes Haar hatte sie zu einem losen Pferdeschwanz zusammengerafft, aus dem sich einige Strähnen befreit hatten und ihren schlanken Hals berührten.
»Es tut mir wirklich leid, aber ist es meine Schuld, dass wir so spät dran sind?«, fragte sie und ergriff den Arm, den er ihr anbot, als sie das Ende der Treppe erreichte.
Sam starrte ihr einige Sekunden lang wortlos entgegen, dann räusperte er sich. »Wenn ich dich ansehe, habe ich immer Angst, dass die Zeit ganz stehen bleibt.«
»Ach, sei doch still.«
Der Druck ihrer Hand um seinen Oberarm strafte ihre Worte Lügen und verriet ihm, dass sein Kompliment, so abgedroschen es auch geklungen haben mochte, seine Wirkung bei ihr nicht verfehlt hatte.
»Fahren wir, oder gehen wir?«, fragte sie.
»Wir gehen. Es ist doch eine wunderschöne Nacht.«
»Außerdem verringert sich für dich das Risiko, dir einen weiteren Strafzettel einzuhandeln.«
Während der Fahrt in die Stadt hatte Sam ihrem gemieteten BMW nämlich ein wenig zu heftig die Sporen gegeben, was dem örtlichen Sheriff, der hinter einer Reklametafel am Straßenrand soeben sein Mittagessen hatte einnehmen und gerade in ein Salamisandwich beißen wollen, ziemlich gründlich die Laune verdarb.
»Das auch«, gab Sam ihr recht.
Eine frühlingshafte Kühle lag in der Luft, aber sie war gar nicht unangenehm, und aus den Büschen am Straßenrand drang der quakende Gesang der Frösche zu ihnen. Das Restaurant, das einem Einheimischen gehörte, auf italienische Küche spezialisiert war und dies auch mit einem grün-weiß karierten Vordach signalisierte, lag nur zwei Blocks entfernt. Sie brauchten lediglich fünf Minuten bis dorthin. Sobald sie Platz genommen hatten, vertieften sie sich in die Weinkarte und entschieden sich für einen französischen Bordeaux aus der Gegend um Barsac.
»Also«, sagte Remi, »wie sicher bist du dir?«
»Du meinst bei diesem Du-weißt-schon-was?«, flüsterte Sam verschwörerisch.
»Ich denke, du kannst das Wort ruhig aussprechen, Sam. Ich bezweifle, dass sich irgendjemand dafür interessiert.«
Er lächelte. »Bei dem U-Boot also. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Wir müssen natürlich irgendwie dort hinunter, aber ich kann mir nichts anderes vorstellen.«
»Aber was hat es hier zu suchen? So weit flussaufwärts?«
»Das ist das Rätsel, das wir lösen müssen, nicht wahr?«
»Und was ist mit Patty Cannon?«
»Sie kann noch ein paar Tage warten. Wir identifizieren das U-Boot, überlassen es Selma und den anderen, das Rätsel zu lösen, und kehren dann zu unserer soziopathisch-mörderischen Sklavenhändlerin zurück.«
Remi ließ sich das kurz durch den Kopf gehen, dann zuckte sie die Achseln. »Warum nicht? Das Leben ist so kurz.«
Selma Wondrash, die sich gewöhnlich wie ein Armeeausbilder aufführte, leitete Sams und Remis Rechercheteam in San Diego, das aus drei Personen bestand. Selma war verwitwet. Ihren Ehemann, einen Testpiloten der Air Force, hatte sie zehn Jahre zuvor bei einem Flugzeugabsturz verloren. Sie hatten sich Anfang der 1990er in Budapest kennengelernt, damals war sie eine Universitätsstudentin und er ein Kampfflieger auf Urlaub gewesen. Obgleich sie schon seit fünfzehn Jahren in den Vereinigten Staaten lebte, hatte Selma ihren Akzent niemals ganz verloren.
Nachdem sie ihr Studium in Georgetown absolviert hatte und eingebürgert worden war, arbeitete sie zuerst in der Abteilung für Handschriften und alte Drucke der Kongressbibliothek, bis Sam und Remi sie von dort weglockten. Mehr noch denn als Leiterin der Rechercheabteilung hatte sich Selma als Reiseagentin und Logistikspezialistin bewährt und konnte sie mit militärischer Präzision und Zuverlässigkeit von einem Ort zum anderen bringen.
Während Sam und Remi den forscherischen Aspekt ihres Arbeitsgebietes liebten, waren Selma und ihr Team darin geradezu fanatisch und lebten für diese eine verborgene Tatsache, diese eine vage Spur, dieses eine unlösbar erscheinende Rätsel, auf das sie im Zuge eines Jobs immer wieder stießen. Öfter als sie zählen konnten, hatten Selma und ihr Team verhindert, dass eine Nachforschung in die Irre führte.
Natürlich war Job nicht ganz die richtige Bezeichnung für das, was Sam und Remi taten. Für sie ging es nie um ein Honorar, sondern sie interessierten sich mehr für das Abenteuer und dafür, dass die Fargo Foundation gedieh. Die Stiftung, die ihre Spenden zwischen dem Tierschutz, dem Naturschutz und dem Schutz benachteiligter und missbrauchter Kinder aufteilte, war während der letzten zehn Jahre sprunghaft gewachsen und hatte im vorangegangenen Jahr fast fünf Millionen Dollar für eine ganze Reihe von Organisationen gespendet. Ein großer Teil dieses Geldes stammte von Sam und Remi persönlich, der Rest kam von privaten Spendern. Wohl oder übel riefen ihre Heldentaten nicht selten ein lautes Medienecho hervor, welches wiederum reiche und prominente Wohltäter anlockte.
Dass Sam und Remi stets das tun durften, was sie am meisten liebten, war eine Gunst, die sie nicht als selbstverständlich betrachteten, nachdem sie beide hart gearbeitet hatten, um diesen Platz in ihrem Leben zu besetzen.
Remis Vater, mittlerweile im Ruhestand, hatte als Bauunternehmer entlang der Küste von Neuengland Luxussommerhäuser errichtet; ihre Mutter, eine Kinderärztin, war außerdem die Autorin mehrerer Bestseller über Kindeserziehung. Indem sie in die Fußstapfen ihres Vaters trat, hatte Remi die gleiche Alma Mater, das Boston College, besucht und mit einem Master-Diplom in Anthropologie und Geschichte – mit dem Schwerpunkt auf den Handelsrouten des Altertums – abgeschlossen.
Sams Vater, der ein paar Jahre zuvor gestorben war, hatte als leitender Ingenieur in den Diensten der NASA gestanden und am Mercury-, Gemini- und Apollo-Programm mitgearbeitet. Außerdem sammelte er seltene Bücher, eine Liebe, mit der er Sam schon in früher Jugend angesteckt hatte. Sams Mutter, Eunice, wohnte in Key West, wo sie, obwohl sie schon fast siebzig Jahre alt war, ein Charterschiff lenkte und für Tauchfahrten oder Hochseeangel-Trips vermietete.
Ebenso wie Remi war Sam dem Beispiel seines Vaters gefolgt, wenn auch nicht in der Auswahl seiner Ausbildungsstätte, sondern seines Fachgebiets. Er hatte am Caltech ein mit summa cum laude bewertetes Ingenieursdiplom sowie eine Handvoll Trophäen als Angehöriger des Lacrosse-Teams und der dortigen Fußballmannschaft errungen.
Während seiner letzten Studienmonate am Caltech war Sam von einem Mann angesprochen worden, der, wie er später in Erfahrung bringen sollte, zur DARPA, der Defense Advanced Research Projects Agency, gehörte. Hier entwickelte und testete die Regierung die neuesten und wichtigsten Spielzeuge sowohl für das Militär als auch für den Geheimdienst. Das angebotene Gehalt lag zwar weit unter dem, was er im zivilen Bereich hätte verdienen können, doch die Aussicht, an neuen technischen Entwicklungen mitarbeiten und gleichzeitig seinem eigenen Land dienen zu können, machte Sam die Entscheidung leicht.
Nach sieben Jahren Tätigkeit bei der DARPA schied er mit der Gewissheit, einige seiner wildesten Ideen in die Realität umgesetzt zu haben, aus dem Dienst aus und ging nach Kalifornien zurück. Dort lernten sich Sam und Remi zwei Wochen später kennen: im Lighthouse, einem Jazzclub in Hermosa Beach. Sam hatte sich in den Club verirrt, um ein Bier zu trinken, und Remi feierte dort gerade den Abschluss einer erfolgreichen Suchexpedition, in deren Verlauf sie die Gerüchte von einem nicht weit von Abalone Cove versunkenen spanischen Schiff verfolgt hatte.
Obwohl keiner von ihnen ihr erstes Zusammentreffen mit der Beschreibung Liebe auf den ersten Blick glorifizierte, waren sich beide darin einig, dass sie einander von Anfang an verdammt sicher gewesen seien. Ein halbes Jahr später heirateten sie dort, und zwar ganz genauso, wie sie sich kennengelernt hatten, nämlich im Rahmen einer kleinen Zeremonie im Lighthouse.
Auf Remis Betreiben hin stürzte sich Sam kopfüber in sein eigenes Unternehmen. Und bereits im ersten Geschäftsjahr stießen sie mit einem Scanner auf Argonlaser-Basis, der auf große Entfernungen Metallvorkommen und -legierungen von Gold und Silber bis hin zu Platin und Palladium aufspüren und genau identifizieren konnte, auf eine nahezu unerschöpfliche Goldader. Schatzsucher, Universitäten, Industriekonzerne und Bergbaufirmen rissen sich darum, Sams Erfindung nutzen zu können. Innerhalb von zwei Jahren konnte die Fargo Group einen jährlichen Nettogewinn von drei Millionen Dollar verzeichnen, und schon nach vier Jahren meldeten die ersten Weltkonzerne ihr Interesse an dieser Erfindung an. Sam und Remi akzeptierten das höchste Gebot, verkauften die Firma für eine Summe, die ihnen garantierte, in ihrem ganzen Leben nicht mehr arbeiten zu müssen, und hatten es bisher nicht bereut.
»Ich habe ein wenig recherchiert, während du unter der Dusche warst«, sagte Sam. »Nach dem, was ich in Erfahrung bringen konnte, haben wir offenbar einen sensationellen Fund gemacht.«
Der Kellner erschien, stellte einen Korb mit warmen Ciabattascheiben und eine Schale mit Pasolivio-Öl auf ihren Tisch und nahm ihre Bestellungen entgegen. Als Vorspeise wünschten sie sich Calamari in Pfeffersauce und Steinpilze. Als Hauptgericht wählte Sam Spaghetti mit in Pesto gedünsteten Jacobsmuscheln und Hummerschwänzen, während sich Remi für mit Shrimps und Krabben gefüllte Ravioli in Basilikum-Sahnesauce entschied.
»Was meinst du?«, fragte Remi. »Ist ein U-Boot im Prinzip nicht so wie das andere?«
»Lieber Himmel, Frau, nicht so laut«, sagte Sam und spielte den Schockierten.
Während Remis Stärken Anthropologie und Frühgeschichte waren, interessierte sich Sam brennend für die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, eine weitere Leidenschaft, die er von seinem Vater geerbt hatte, der während des Inselfeldzugs der Vereinigten Staaten im Pazifik als Marineinfanterist gedient hatte. Dass sich Remi nicht dafür interessierte, wer genau die Bismarck versenkt hatte oder weshalb die Ardennenschlacht eine so wichtige Rolle für den Kriegsverlauf spielte, war etwas, das Sam immer wieder in Erstaunen versetzte.
Remi war eine Anthropologin und Historikerin, die ihresgleichen suchte, aber sie neigte zu einer analytischen Herangehensweise an die Dinge, während für Sam Geschichte immer aus Storys über reale Personen bestand. Remi sezierte, während Sam träumte.
»Entschuldige den Fauxpas«, sagte Remi.
»Längst geschehen. Folgendes ergibt sich: Angesichts der Breite und Tiefe des Kanals haben wir es so gut wie sicher nicht mit einem Unterseeboot normaler Größe zu tun. Außerdem sah das Periskop viel zu klein aus.«
»Demnach ist es ein Mini-U-Boot.«
»Richtig. Aber das Periskop war ziemlich bewachsen und verkrustet, was das Ergebnis von einigen Jahrzehnten sein dürfte, würde ich schätzen. Und noch ein Punkt: Soweit ich weiß, verfügen zivile U-Boote – für Forschungs- oder Kartografierungsaufgaben oder was auch immer – nicht über Periskope.«
»Demnach ist es ein militärisches Schiff«, sagte Remi.
»Das muss es sein.«
»Also, ein militärisches Mini-U-Boot dreißig Kilometer flussaufwärts im Pocomoke River …«, murmelte Remi. »Okay, ich gebe es zu. Du hast mein Interesse geweckt.«
Sam lächelte sie an. »So gefällst du mir. Also, was hältst du davon? Nach dem Abendessen fahren wir nach Princess Anne rüber und hören uns mal an, was Ted dazu zu sagen hat. Er hat schon mehr Legenden über diese Gegend vergessen, als die meisten Leute hier jemals kennen werden. Falls jemand irgendeine Idee hat, was dieses Ding dort zu suchen haben könnte, dann dürfte er es sein.«
»Ich weiß nicht … Es ist schon spät, und du weißt, wie sehr Ted unangekündigte Besuche hasst.«
Trotz seines Genies und seiner bestens kaschierten Weichherzigkeit war Ted Frobisher nicht gerade als kontaktfreudig zu bezeichnen. Sein Laden lebte keineswegs von seinem freundlichen Umgang mit den Kunden, sondern vielmehr von dem Umfang seines Wissens und einem ausgeprägten Geschäftssinn.
Sam meinte grinsend: »Eine kleine Überraschung wird ihm ganz guttun.«
4
Nach dem Dessert, einem Tiramisu, das ihnen kurzzeitig den Atem raubte, kehrten sie zum B & B zurück, holten die BMW-Schlüssel aus dem Zimmer und brachen nach Princess Anne auf. Auf dem Highway 12 fuhren sie nach Nordwesten und bogen an der Peripherie von Salisbury auf den Highway 13 in Richtung Süden ab. Regenwolken waren an dem klaren Abendhimmel aufgezogen, und ein leichter Nieselregen benetzte die Windschutzscheibe.
Remi runzelte die Stirn. »Mir kommt es so vor, als fährst du mal wieder zu schnell.« Sie genoss zwar den Luxus des BMW, jedoch nicht die Rennfahrerambitionen, die er bei ihrem Ehemann zu wecken pflegte.
»Ich halte mich genau an das Tempolimit. Keine Sorge, Remi. Hab ich schon jemals einen Unfall gebaut?«
»Na ja, da war doch irgendwas in Mumbai …«
»O nein. Wenn du dich erinnern willst, waren die Reifen so gut wie blank, und wir wurden von einem Verrückten in einem sehr großen Kipplaster verfolgt. Außerdem habe ich keinen Unfall verursacht. Ich wurde nur … abgedrängt.«
»So kann man es auch sehen, ja.«
»Das ist eine sehr genaue Beschreibung des Tathergangs, würde ich sagen.«
»Okay, dann war da aber noch diese Sache in Schottland …«
»Zugegeben, das war meine Schuld.«
»Ärgere dich nicht, Sam. Dieses Torfmoor ist quasi aus dem Nichts vor uns aufgetaucht.«
»Sehr witzig.«
»Du hast uns immerhin wieder rausbugsiert, und das alleine zählt doch.«
Das hatte er wirklich getan. Mit Hilfe eines kurzen Seils, eines Wagenhebers, eines Baumstumpfs und eines dicken Astes als Hebel – sowie der Anwendung einiger physikalischer Grundgesetze.
Schweigend fuhren sie weiter und betrachteten die vorbeigleitende dunkle Landschaft, bis die Lichter von Princess Anne in knapp einem Kilometer Entfernung vor ihnen erschienen. Benannt nach der Tochter König Georges II., verzeichnete die Stadt – oder der Weiler, wie zahlreiche Einheimische den Flecken lieber nannten – eine Bevölkerung von 2.200 Seelen, die Studenten nicht mitgezählt, die die University of Maryland Eastern Shore als ihre zeitweilige Heimat betrachteten. Während ihres ersten Abstechers hierher vor einigen Jahren waren Sam und Remi übereingekommen, dass man sich, gäbe es keine Autos auf den Straßen und kein elektrisches Licht, in die vorrevolutionäre Zeit Marylands zurückversetzt fühlen konnte, so idyllisch wirkten größere Teile des Weilers Princess Anne.
Sam fuhr auf dem Highway 13 ins Stadtzentrum, bog nach Osten auf die Mount Vernon Road ab und folgte ihr anderthalb Kilometer, bis er die East Ridge Road erreichte. Nun befanden sie sich am Rand von Princess Anne. Frobishers Laden, dessen zweite Etage ihm als Wohnung diente, lag knapp fünfhundert Meter von der Straße entfernt am Ende einer mit Ahornbäumen gesäumten Zufahrt.
Als Sam die Einfahrt erreichte, verließ gerade eine schwarze Buick-Lucerne-Limousine die Zufahrt und entfernte sich nach Süden in Richtung Mount Vernon Road. Als die Scheinwerfer des BMW die Windschutzscheibe des vorbeifahrenden Wagens erhellten, erhaschte Sam einen kurzen Blick auf Ted Frobisher, der auf dem Beifahrersitz saß.
»Das war er«, stellte Remi fest.
»Ja, ich weiß«, murmelte Sam nachdenklich.
»Was ist los?«
»Keine Ahnung … sein Gesicht kam mir irgendwie seltsam vor.«
»Was meinst du?«
»Er sah … ängstlich aus …«
»Ted Frobisher sieht immer ängstlich aus. Oder verärgert. Das sind seine einzigen beiden Gesichtsausdrücke, wie du weißt.«
»Ja, ja, kann schon sein«, murmelte Sam, setzte mit dem BMW rückwärts in die Einfahrt und folgte dann dem Lucerne.
»Du liebe Güte«, sagte Remi, »jetzt geht das schon wieder los.«
»Trag’s mit Fassung. Wahrscheinlich ist es ja gar nichts.«
»Also gut. Aber wenn sie vor einem IHOP-Restaurant Halt machen, dann versprich mir, dass du umkehrst und den armen Mann in Ruhe lässt.«
»Abgemacht.«
Der Lucerne hielt nicht vor einem IHOP, und er blieb auch nicht allzu lange auf der Hauptstraße, sondern bog nach ein paar Kilometern in die Black Road ein. Eine Straßenbeleuchtung gab es hier längst nicht mehr, und Sam und Remi rollten durch die tiefste Dunkelheit. Das anfängliche Nieseln hatte sich in einen stetigen Regen verwandelt, gegen den die Scheibenwischer des BMW mit einem rhythmischen Quietschen ankämpften.
»Wie ist deine Nachtsicht?«, fragte Sam.
»Gut … weshalb?«
Anstelle einer Antwort schaltete Sam die Scheinwerfer des BMW aus und beschleunigte, um die Distanz zu den Rücklichtern des Lucerne zu verringern.





























