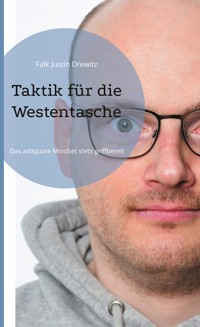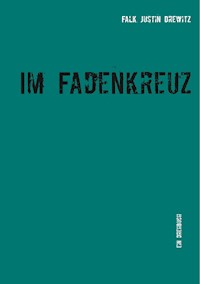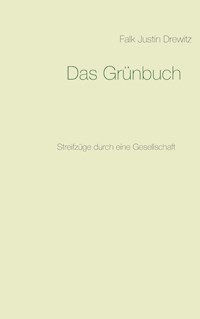
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Grünbuch ist ein gesellschaftskritischer Essay, der seine Leser zum Nachdenken provozieren möchte. In welcher Gesellschaft leben wir heute? Was überhaupt ist Gesellschaft und wie können wir sie mitgestalten und uns unseres eigenen mündigen Verstandes bedienen? Der Autor wirft diese und andere Fragen in den Raum und bittet zum Diskurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
"Keine Begeisterung sollte größer sein, als die nüchterne Leidenschaft zur praktischen Vernunft."
Helmut Schmidt, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland vom 6.
Mai 1974 bis zum 1. Oktober 1982
"Die Dinge anders zu betrachten (...) das ist der Beginn soziologischen Denkens."i (Heinz Abels)
„Es ist die vornehmste Aufgabe des Soziologen: Sand in gut geölte Getriebe gesellschaftlicher (und theoretischer) Verhältnisse zu werfen, auf dass es kräftig knirsche […]“ii
(Bruno Hildenbrand)
Dem engsten Kreis und dessen Keimzelle gewidmet.
Inhaltsverzeichnis
Zu Beginn
Ein Vorwort
Momentaufnahme 1: Jeder hat sie
Momentaufnahme 2: Kopfkino
Momentaufnahme 3: Der Aufbruch
Momentaufnahme 4: Totale Television
Momentaufnahme 5: Flasche mit „V“
Momentaufnahme 6: Vize-Egos – oder wie nutzt man Medien heute?
Momentaufnahme 7: Freundschaft – in medias res!?
Bibliografie und Endnoten
Zu Beginn
Sie lesen ein Grünbuch. Normale, klassische Grünbücher sind Bestandteil der Politikgestaltung auf der Ebene der EU (vgl. Wessels 2008). Ein solches Grünbuch formuliert bzw. enthält eine breite Palette an Ideen und ist als Denkanstoß und Diskussionsgrundlage gedacht (vgl. Benz 2007). Das vorliegende Werk versteht sich als eine Art Grünbuch, denn es will in essayistischer Form Denkanstöße und Ideen zu unserer Gesellschaft geben.
Zu diesem Zweck wurden die einzelnen Beiträge als Momentaufnahmen angelegt.
Manche sind eher kurzgehalten, kompakt und einige sind etwas länger. Teilweise gehen die einzelnen Texte aufgrund ihres Inhalts in einander über und ergänzen sich, aber dies trifft nicht für alle zu. Die einzelnen Momentaufnahmen können also durchaus in beliebiger Reihenfolge gelesen werden. Nur alle drehen sich irgendwie um das Themenfeld Gesellschaft.
Dementsprechend hat die hier vorgelegte Analyse größtenteils exploratorischen Charakter und verzichtet somit auf jeglichen Anspruch der Vollständigkeit.
Der Autor im Jahr 2016
Ein Vorwort
Dieses Essay wurde im Verlauf der letzten 6 Jahre in lockerer Abfolge geschrieben. Also entstand dieses Büchlein nicht direkt in einem Guss, sondern wurde in mehreren Etappen abgefasst. Immer dann, wenn es etwas zu notieren galt, erfolgte der Griff zur Kladde. Eine logische Konsequenz dieses Arbeitsprozesses besteht darin, dass die meisten Beispiele jeweils im Kontext ihrer damaligen Aktualität zu sehen sind, aber partiell wird auch durchaus erkennbar, dass manche der angesprochenen Aspekte wenig oder auch nichts von ihrem Gehalt und der damit einhergehenden Relevanz eingebüßt haben.
Band 1 ist somit vorgelegt und an der Fortsetzung wird bereits gearbeitet, aber mehr wird noch nicht verraten.
Der Autor im Oktober 2016
Momentaufnahme 1: Jeder hat sie
Sie kennen sie. Ihr Nachbar. Ihr Partner, Ihre Freunde und auch Ihre Feinde kennen sie. Jeder kennt sie. Alle haben eine. Irgendwie, irgendwo. Die Rede ist von der eigenen Sippe. Alle Menschen haben ihre jeweilige Sippe. Dies ist ein weltweites Phänomen und vielleicht eins der wenigen Dinge, was alle Menschen gemeinsam haben. Egal, ob Europäer, Amerikaner, Afrikaner, Araber oder Asiate.
Die Familie bzw. Sippe ist etwas, was sich niemand aussuchen kann. Dies gilt jedenfalls für die ersten Jahre einer jeden menschlichen Laufbahn auf Erden, denn jeder einzelne Mensch wird in seine Abstammungsfamilie hineingeboren. Das war so in den ersten Jahrhunderten der Menschheitsgeschichte und es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Der Mensch kann inzwischen immer mehr und in den unterschiedlichsten Bereichen beeinflussen und gegebenenfalls eingreifen.
Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten, jedes Zeitalter hat seine eigenen Fortschritte, aber bis zum eigenen jeweiligen Ursprung eines Menschen reicht der lange und länger werdende Arm des Fortschritts nicht. Oder konnten Sie sich eine Geburtsfamilie, die Wurzeln ihrer Existenz auswählen?
Ja, Sie konnten vielleicht das Milieu ihrer Sippe verlassen und aufsteigen, aber Hand aufs Herz und mal ehrlich, die Familie, in der ein jeder von uns mit dem Zeitpunkt seiner eigenen Geburt gelandet ist, stellt sich als Ergebnis des Zufalls dariii.
Keine Panik, dies hier hat nichts mit dem althergebrachten Gedanken des Klassenkampfs zu tun, denn Aufstieg ist möglich. Nur nicht zu Beginn. Und selbst später kann der gesellschaftliche Aufstieg dennoch an gewisse Grenzen stoßen. Dies lässt sich erkennen, wenn man sich der Frage nach den Aufstiegschancen aus der Perspektive der soziologischen Eliten-Forschung nähert.iv
Am Anfang sind (alle) Babys gleich. Zwar kann sich die Elterngeneration der nächsten Generation ihre Kinder heutzutage mittels modernster medizinischer Methoden „aussuchen“ (pränatale Diagnostik und Reproduktionsmedizin machen es möglich), aber seine eigenen Erzeuger bzw. (leiblichen) Eltern konnte sich kein Mitglied dieser Elternbaureihe auswählen. Fakt bleibt Fakt. Jedenfalls bis das Gegenteil bewiesen istv. Auch hier.
Wie ist das nun also mit der Keimzelle des eigenen Vorhandenseins? Auf jeden Fall heterogen und eigentlich nicht (mehr) einfach zu beantworten, denn familiale Formen, Ausprägungen und Beziehungskonstellationen haben sich durch die Jahrhunderte und Jahrzehnte hindurch gewandelt und teilweise gar neu entworfen. Wahlverwandtschaften ergeben sich meist später, wenn die Abkömmlinge einer Familie ins eigene Leben starten und wenn sie dann ihrerseits eine Sippe gegründet bzw. erfolgreich erweitert haben, beginnt der gleiche Kreislauf für die nächste Generation auf ein Neuesvi. Familien sind und waren die Keimzelle einer Gemeinschaft. In Gemeinschaft und Gesellschaft formulierte der Soziologe Ferdinand Tönnies seine „Grundbegriffe der reinen Soziologie“vii und eben zu jenen zählt er auch den Gemeinschaftsbegriff. Tönnies differenziert innerhalb seiner Definition des Begriffes von Gemeinschaft und notiert:
[…] „Denn die Gemeinschaft des Blutes als Einheit des Wesens, entwickelt und besondert sich zur Gemeinschaft des Ortes, die im Zusammenwohnen ihren unmittelbaren Ausdruck hat, und diese wiederum zur Gemeinschaft des Geistes als dem bloßen Miteinander-Wirken und Walten in der gleichen Richtung, im gleichen Sinne. Gemeinschaft des Ortes kann als Zusammenhang des animalischen Lebens, wie die des Geistes als Zusammenhang des mentalen Lebens begriffen werden, die letztere daher in ihrer Verbindung mit den früheren, als die eigentlich menschliche und höchste Art der Gemeinschaft.
[…] Wo immer Menschen in organischer Weise durch ihre Willen miteinander verbunden sind und einander bejahen, da ist Gemeinschaft von der einen oder der anderen Art vorhanden […] Und so mögen als durchaus verständliche Namen dieser ihrer ursprünglichen Arten nebeneinander betrachtet werden 1) Verwandtschaft, 2) Nachbarschaft, 3) Freundschaft. […]“ (Tönnies 1963, §6., S. 14-15).
Momentaufnahme 2: Kopfkino
Er drückte den Zigarillo in den Aschenbecher und griff zum Mineralwasser mit Eiswürfeln und den üblichen Pfefferminzblättern.
Dann stand er auf und trat ans Fenster. Es regnete. Seine Hand angelte in der Hosentasche nach der Schachtel und zog einen neuen Glimmstängel hervor. Die Schachtel war zur Hälfte schon leer. Für Pessimisten war dieses kleine Ding aus Pappe und Zellophan zur Hälfte leer, aber für Optimisten war sie halbvoll.
Es ist genauso wie mit dem Glas oder den beiden Fröschen im Milchkrug, dachte er sich und entflammte die gerollten Tabakblätter zwischen seinen Fingern. Seine Blicke wanderten zur Uhr an der Wand.
Einst war dieses Land das Land der blühenden Landschaften gewesen. Heute, heute blühten die Bäume seltener und – in übertragenem Sinne – auch nicht in allen Regionen des bundesrepublikanischen Staatsgebietes. Gut, wir waren relativ lang „Exportweltmeister“ gewesen und der Export der deutschen Wirtschaft steuerte heute inzwischen fast die Hälfte des Sozialproduktes bzw. des Volkseinkommens bei, aber wie lange noch?viii
Die weltweite Finanzkriseix hatte vor der Bundesrepublik Deutschland und ihren europäischen Nachbarn keine Notbremsungx gemacht. Die Konsequenzen waren bis ins Jetzt hinein noch wahrnehmbar.
Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute und ihre sogenannten Wirtschaftsweisen aktualisierten regelmäßig ihre – teilweise düsteren oder realistischen – Konjunkturgutachten, Statistiken und Umfragen, die in ihren Analysen und Ergebnissen den jeweils gegebenen Zustand des Auslastungsgrades der Produktionskapazitäten der europäischen und/oder deutschen Volkswirtschaft(en) mit belastbarem Datenmaterial unterfütterten bzw. abbildeten , um dadurch den Akteuren im (wirtschafts-und finanzpolitischen) Politikbetrieb hin und wieder schonungslos die nüchternen Zahlen zu offenbaren. Für die Bundesrepublik Deutschland erforschten beispielsweise die Ökonomen des ifo-Instituts regelmäßig das sogenannte „Geschäftsklima“ und der gleichnamige Index wurde in und von fast allen großen Medien routiniert zitiert.
Einige Wirtschaftswissenschaftler forderten (zu Beginn der Krise) die zügige Neuauflage von Bretton Woods, diese amerikanische Kleinstadt war 1944 Gastgeber einer Konferenz der damals führenden internationalen Finanzexperten.
Das Treffen diente erfolgreich der Einführung einer, damals neuen, (und heute dringend wieder erforderlichen) Weltwirtschaftsordnung und auch der IMF wurde infolge der Konferenz in Bretton Woods ins Leben gerufen, um die internationale monetäre Zusammenarbeit und die Stabilität der Wechselkurse sowie die Kreditvergabe (bei Zahlungsbilanzschwierigkeiten der Mitgliedsstaaten des IMF) und die Verwaltung eben jener Kredite zu organisieren und zu koordinierenxi.
Selbst das Land der vormals unbegrenzten Möglichkeiten lieh sich heutzutage beim früheren Klassenfeindxii enorme Beträgexiii.
Wir waren und sind Teil dieses immer diffiziler werdenden und weltweiten Systems, dachte Tom und seufzte.
In den täglichen Abendnachrichten schien eine Wortgruppe die Hauptrolle ergriffen zu haben.
Man sprach von Krisen in den unterschiedlichsten Bereichen, Rationalisierungen, Einsparungen, Kosten- und Gewinnoptimierung. Außerdem von Bankenpleiten in den USA, Kurzarbeit, dem katastrophalen Zustand des Bildungsbereichs rund um den Bologna-Prozess und neuerdings auch von Stabilitätsfonds, der Verhinderung von Staatspleiten und den Unsummen, die dem (deutschen) Fiskus durch Steuerhinterziehung vorenthalten wurden. Die schwarz-gelbe Koalition - unter Bundeskanzlerin Angela Merkel - stritt um Elterngeld, Frauenquote, Mindestlohn und Mütterrente. Bis zur Bundestagwahl 2013 und dann verschwand die FDP in den Tiefen der Bedeutungslosigkeit, aber die Themen blieben der zukünftigen Regierung schwarzroter Färbung erhalten, denn langweilig wurde es im politischen Berlin nie. Monate zuvor und so zwischendurch sahen sich die Kanzlerin und ihr damaliger Verteidigungsminister auch noch mit den Entwicklungen rund um die Drohne „Euro Hawk“xiv konfrontiert. International rückte seinerzeit die Causa rund um den US-Amerikaner Edward Snowden – samt ihrer diversen Facetten – zunehmend ins Blickfeld von Politik, Medien und Zivilgesellschaft.xv Auch der russische Neo-Zar Putin wusste sich immer wieder geschickt einzumischen.
Die Welt wurde von Tag zu Tag größer und dennoch rückten alle Erdenbewohner immer enger zusammen und dies mit allen positiven Errungenschaften und nun auch erkennbaren Nebenwirkungen.