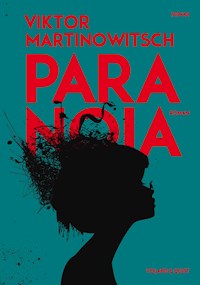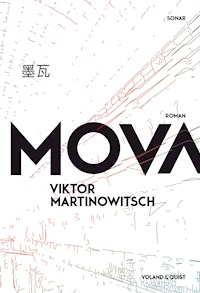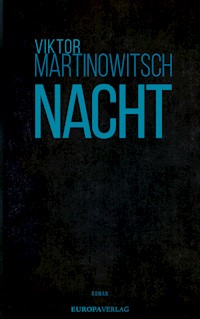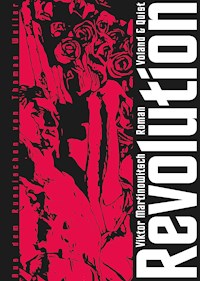Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Voland & Quist
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Minsk, Sommer 2020: Während auf den Straßen Massenproteste gegen Lukaschenkos Regime toben, beginnt Matwej im Theater die Proben zu einem Stück über den Inquisitionsprozess gegen Jeanne d'Arc. Als plötzlich seine ehemalige Lehrerin inhaftiert wird und ihr Kater Heidegger zu verhungern droht, erklärt Matwej sich bereit, Heidegger zu retten. Dabei stolpert er unverschuldet zwischen die Fronten von Protestierenden und Staatsmacht. Unterwegs begegnet er der menschgewordenen Revolution in Form der Punk-Poetin Lady Di. Ihr Mittel des Widerstands? Worte. Ein bewegender Roman über die Kraft der Sprache und den Versuch, im Angesicht der Unterdrückung Mensch zu bleiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sonar 43
Viktor Martinowitsch (auch: Victor Martinovich), 1977 in Belarus geboren, studierte Journalistik in Minsk und lehrt heute Politikwissenschaften an der Europäischen Humanistischen Universität in Vilnius. Er schreibt regelmäßig für ZEIT online. Martinowitsch wurde bekannt mit dem Roman »Paranoia« (2014), der in Belarus nach Erscheinen inoffiziell verboten wurde. 2012 erhielt Martinowitsch den Maksim-Bahdanowitsch-Preis. Zuletzt erschien bei Voland & Quist »Revolution« (2021).
Thomas Weiler wurde 1978 im Schwarzwald geboren. Seit seinem Übersetzerstudium in Leipzig, Berlin und St. Petersburg übersetzt und vermittelt er Belletristik und Kinderliteratur aus dem Polnischen, Russischen und Belarussischen. 2017 erhielt er den Deutschen Jugendliteraturpreis, 2019 den Karl-Dedecius-Preis, 2024 wurde er mit dem Paul-Celan-Preis und der August-Wilhelm-von-Schlegel-Gastprofessur für Poetik der Übersetzung geehrt. Er lebt mit seiner Familie in Markkleeberg bei Leipzig. Bei Voland & Quist erschienen seine Übersetzungen von Viktor Martinowitsch, Ziemowit Szczerek und Alhierd Bacharević. 2025 erhielt er den Preis der Leipziger Buchmesse (Übersetzung).
Viktor Martinowitsch
Das Gute siegt
Originaltitel: Добро побеждает всегда, übersetzt aus dem Manuskript
© Viktor Martinowitsch, 2023
Deutsche Erstausgabe
© Verlag Voland & Quist GmbH, Berlin und Dresden 2025
Lektorat: Kristina Wengorz
Umschlaggestaltung: HawaiiF3
Satz: Fred Uhde
Druck und Bindung: BALTO print, Litauen
ISBN 978-3-86391-455-4
Verlag Voland & Quist GmbH
Gleditschstr. 66
D-10781 Berlin
www.voland-quist.de
INHALT
Das Gute siegt
Episode I 23.08.2020
Episode II 05.10.2020
Episode III 25.02.2021
Epilog 05.03.2022
Das Gute siegt
Sämtliche Gegebenheiten und Figuren in diesem Text sind frei erfunden, etwaige Ähnlichkeiten mit der Realität sind reiner Zufall. So schreiben diejenigen, die denken, mit dieser hübschen kleinen Beschwörungsformel wären sie gefeit gegen ein Wiedererkennen im Kopf der Leser. Aber wenn sie das schreiben, muss man das Gegenteil davon lesen. Dann schreib ich das mal auch, als ginge ich davon aus, mein Leser sei so dumm, mir zu glauben.
Wie ist das, zu wissen, dass der Text, den du schreibst, nicht veröffentlicht werden wird? Nicht hier, weil der letzte nicht staatliche Verlag vor zwei Wochen dichtgemacht wurde und der Inhaber ganz froh war, lediglich dichtgemacht worden zu sein und nicht fünf Tage Einzelzelle zu bekommen, anders als der liquidierte Verleger vor ihm. Nicht dort, weil wir dort jetzt Ungeheuer sind.
Als man uns hätte helfen müssen, haben sie uns bedauert.
Nun, da wir zu bedauern sind, hassen sie uns.
Ghosten uns.
Canceln uns.
Victim blaming, das überall glatt durchgeht.
Außerdem weiß ich nicht, ob ich mich trauen würde, es auch nur im engsten Freundeskreis zu zeigen. Jeder von ihnen könnte einen anonymen Bot der Dreibuchstabenorganisation anschreiben und sich so die Rehabilitierung und/oder eine Rückfahrkarte sichern.
Wenn du dich damit abgefunden hast, nur für dich zu schreiben, für die Schublade, das Grab, für den Sarg, kommt als Erstes die Freiheit. Endlich brauchst du keinen Schulterblick mehr. Musst das Geschriebene nicht mehr auf seine Veröffentlichbarkeit hin abklopfen. Alles scheißegal. Ich bin mein eigener Zensor, mein eigenes MinInform. Ich erklär mich selber zum ausländischen Agenten, wenn das aus Stilgründen erforderlich ist.
Scheißegal.
Dieser Text ist eine Flaschenpost, die ich in den Fluss der Zeit werfe. Ist der Text schlecht, geht er unter, und kein Mensch wird sich an die hier niedergeschriebenen Offenbarungen erinnern. Hat der Text aber einen Wert, gerät er schon in die rechten Hände. Das Wort stirbt nicht. Das Wort ist überhaupt die mächtigste Waffe im Universum.
Darum geht es auch im Grunde.
Falls das Geschriebene stark ist, wird mein Wort selbst dann noch zu hören sein, wenn sie die heute sichtbare Welt endgültig ausgelöscht haben. Sie sind schon dabei, es hat schon begonnen, denn wo früher einmal Spiegel diese Realität reflektierten, hängen jetzt bloß noch Platzhalter mit dem Hinweis »Die vorliegende Ressource befindet sich auf dem Index der Sperrung unterliegender Inhalte«. (Macht ist in erster Linie Gusseisenstilistik, Baby.)
Was verleiht einem Text Stärke? Wahrheit. Ein Wort, so alt und komisch, dass es fast keine Bedeutung mehr hat. Wahrheit. Wahrhaftigkeit. Aletheia. Das Nicht-Verborgene. Enthält ein Text keine Wahrheit, gerät er schnell in Vergessenheit, selbst wenn er vorgibt, publizistisch glaubwürdig und sachlich-dokumentarisch zu sein.
Wann hat das alles angefangen? Es wird wohl im September jenes Jahres gewesen sein. Oder doch erst im Oktober? Es gab schon sehr viele Festnahmen damals. Also eher im Oktober.
Polina Mendoza schrieb einen Facebook-Post. Ich kann ihn auswendig: »Als Kindern hat man uns beigebracht zu unterscheiden, was Gut und Böse ist. Darin bestand unsere Erziehung. In Gedichtzeilen wie ›Was bedeutet das denn: gut, und was ist das: schlecht?‹ In Zeichentrickfilmen mit Dialogen wie: ›Was willst du werden, wenn du groß bist?‹ – ›Gut.‹ So sind wir erwachsen geworden. Und gut. Musterschülerinnen und -schüler mit von lichter Zukunft erfüllten Augen. Gelandet in einer Welt, in der dann aber das Böse regierte. Das wahre, biblische, nicht das antike, sondern tatsächlich das biblische Böse. Gewalt gegen Schwache. Versiegelte Lippen. Eine Verlogenheit, so hemdsärmelig wie ein Dieb, der dir die Uhr andrehen will, die er dir vorher geklaut hat. Und alle, die dagegen angehen wollten, haben sie schon plattgemacht. Bildgewaltig, vor laufender Kamera. Weil tatsächlich in dieser Welt das Gute immer verliert. So will es das Böse mit seinen Gesetzen. Und die Erwachsenen wussten das. Und haben uns komischerweise das Gute gelehrt.«
Binnen acht Stunden hatte der Post zweitausendvierhundert Likes und wurde dreihundertfünfzigmal geteilt. Und das nicht, weil die Mendoza den Text mit einem Foto von sich im Kleopatrakostüm aus der Schlussszene von Shakespeares Antonius und Kleopatra versehen hatte. Während der Frühjahrssaison war sie so in der ganzen Stadt plakatiert gewesen: Pfauenfederkrone, goldenes Kleid, der blasierte Monolog mit der Schlange in der Hand, im Profil zum Zuschauer gesprochen, die lächerliche Soroka-Übersetzung für diese Inszenierung, im Saal kein Lachen, kein Hauch: »Und ich werd sehn, wie dann ein Knab in Flittchenpose mir meine Majestät zerquäkt« – und Tod und Sex und Schönheit. Aber diesmal war der Mendoza-Post stärker als die Mendoza-Schönheit. Normalerweise war es andersherum.
Nach acht Stunden hatte das Bezirksgericht des Krasnoswjosdny-Rayon die von der Nutzerin Mendoza_1987 erstellte »Informationsmitteilung im Netzwerk ›Facebook‹, beginnend mit ›Als Kindern hat man uns beigebracht zu unterscheiden …‹ und endend mit ›… komischerweise das Gute gelehrt‹, 966 Zeichen inklusive Leeranschläge«, in das staatliche Register extremistischer Materialien aufgenommen. Fünfzehn Tage Haft fürs Teilen, fünf Tage fürs Liken.
Eine Stunde später hatte der Post noch zweihundert Likes und sechzehn Geteilt-Meldungen, woraus sich exakte soziologische Rückschlüsse auf die Zahl der Mendoza-Follower ziehen ließen, die sich zu diesem Zeitpunkt außer Landes befanden.
Die Regentin Oberägyptens selbst rannte derweil durchs Theater, klimperte mit den falschen Wimpern, schlug sich die Hände vors Gesicht und flüsterte: »Ogottogott, jetzt buchten sie mich garantiert ein.«
Aber sie entfernte den Post die ganze Nacht nicht, sie war überzeugt, die Prima würden sie nicht anrühren, der Prima würden sie das durchgehen lassen, was ja auch so war. Dann war der Post verschwunden – und mit ihm, so schien es, auch das Problem.
Nun, da ich, wir mir scheint, beides kenne, Gut und Böse, möchte ich zum Thema zurückkehren. Zum besseren Verständnis für den künftigen Regisseur: Ich bin in diesem Stück weder Protagonist noch Antagonist. Ich bin der Chor. Der gemäß antiker Tradition vor Beginn der Handlung die Fabel kurz zusammenfasst. Und jetzt viel Spaß mit der Katharsis.
Episode I23.08.2020
Kurt Vonnegut hat mal geschrieben, als Schriftsteller hast du es schwer, den Punkt im Leben eines Helden zu finden, nach dem der Held kein Held mehr ist, sondern bloß noch eine Type, für sich allein unterwegs, ohne Bedeutung für die Fabel. Ein gewisser Prozentsatz an Schriftstellern bringt seine Schützlinge vorsorglich ins Grab. Unter die Erde mit dem Kerl, Haken dran. Aber wenn die Fabel keine tragischen Wendungen vorsieht, wo macht man dann einen Punkt? Bei der Hochzeit? Der Geburt der Kinder? Der Enkel? Der Kinder der Enkel? Wie kriegst du einen Knopf dran? Dass sich nicht noch irgendein Depp Hoffnungen auf ein Sequel macht?
Wenn du über meine Stadt schreibst, liegt das Problem woanders. Nicht die Sequels sind das Problem. Das Problem sind die Prequels. Wir stecken in einer dermaßen seltsamen Gegenwart, dass der ein oder andere bei den Mammuts nach ihren Wurzeln gräbt. In mittelalterliche Fürstentümer zurückschaut, die Renaissance und den Großen Nordischen Krieg. Ich bin von der Langmut des Lesers nicht überzeugt genug, um hier von Kolyma – Heimat unserer Angst anzufangen. Oder von Berija und Zanawa. Obwohl es die beiden sicher gebraucht hat.
Ich werde nicht erzählen, wie sie mich, Matwej Alfejew, bei den Pionieren aufgenommen haben. Dabei gehöre ich zu der Generation, deren Angehörige noch Pioniere wurden, aber keine Komsomolzen mehr – die Epoche tat so, als hätte sie ihr Ende erreicht.
Ich werde meine Erzählung nicht 1994 beginnen, als der angetrunkene Zar der Sowjetunion seinen Legaten hierher entsandte. Auch nicht 1996, als Moskau sich damit abfand, dass der Legat deutlich stärker, findiger und weitsichtiger war als diejenigen, die ihn ernannt hatten, und nun in Ewigkeit regieren kann. Auch nicht 1999, als der angetrunkene sowjetische Zar die Planeten und Sternbilder mit dem nüchternen und konzentrierten Imperator bekannt machte, der seither und bis in alle Ewigkeit genauso mit uns ist wie die Sowjetunion, Kolyma und die Pioniere.
Ich springe mit einem winzigen Fußfehler in die Vergangenheit. Was unverständlich bleibt, erkläre ich unterwegs.
23. August 2020, 9.30 Uhr. Der vorletzte Sonntag vor Beginn der neuen Spielzeit. Am Tisch: ich, eine schwere, gusseiserne Kanne Oolong-Tee mit Milch, der Ausdruck des Romuald-Yehudis-Stückes Das irdische Gericht und mein Mobiltelefon. Heute Nachmittag steht die erste Leseprobe an. Am 26. November, in dreizehn Wochen, ist Premiere. Der Tee ist schon kalt und unangenehm bitter. Vom Tee kriegt man Kohldampf, aber ich weiß aus Erfahrung, wenn ich mir jetzt ein Sandwich mit dem kalten Broiler von gestern reinziehe, werd ich bloß müde und krieg das Stück nicht gelesen. Genau wie gestern (Kurvenverlauf: Tee, noch ein Tee, noch ein Tee, Bärenhunger, Pelmeni Marke »Fleischtäschlein«, Trägheit, Sofa mit Manuskript, Schlaf, schlechtes Gewissen, Dose Bier, nächste Dose Bier, Spaziergang in die Innenstadt, Bar 1863, Bar 1991, Bar Bar, Broiler aus der Feinkostabteilung im Riga, hektisches Mahl über der Spüle aus Geschirrspargründen, Schlaf). Das Stück liegt seit einer Woche auf dem Tisch, über das yehudistisch lange Personenverzeichnis bin ich immer noch nicht hinausgekommen.
Schuld daran ist natürlich nicht der Tee.
Schuld daran ist das Gerät neben dem Stück. Die bittere Frucht des Rückzugs der Designer von der Oberfläche der Dinge hin zum programmierten Innenleben: ein Smartphone, von anderen Smartphones derselben Preisklasse durch nichts zu unterscheiden. Auf dem matten Display ein Icon, ein weißes, abgeschrägtes Dreieck. Die Designer wollten, dass es wie ein Papierflieger aussieht, aber es erinnert mehr an die Spitze eines Speers. Eines Speers, der jetzt schon drei Monate die Realität dieser Stadt durchbohrt. Die App, ein Messenger, ist ein bisschen besser geschützt als WhatsApp und ein bisschen schlechter als Signal. Eben aufgrund des zuletzt erwähnten Umstands bekommen alle, die Signal installieren wollen, einfach keine Authentifizierungscodes mehr – eine simple Möglichkeit, einer Nation, die ihre Privatgespräche hinter blickdichten Vorhängen verbergen will, ein Schnippchen zu schlagen. Diese Codes werden von Mobilfunkanbietern verschickt, die eine Lizenz zu verlieren haben. Aber der Speer hat es auch in sich: Zwei-Faktor-Authentifizierung, eine Verschlüsselung, für die sich Spezialisten aus aller Welt brennend interessieren, geheime Chats, die im Anschluss verschwinden, die Möglichkeit, seine Nachrichten vom Gerät des Empfängers zu entfernen. Die meisten Menschen westlich von Brest haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht, weshalb man seine Nachrichten vom Gerät des Empfängers entfernen können sollte.
Die App heißt Telega, und in dieser App läuft nun schon seit Monaten eine spannende Serie über das Leben von zehn Millionen Menschen. Eine Serie, bei der du einfach nicht abschalten kannst, du bist nämlich eine der handelnden Personen. Und sobald du vergisst, dich durch die fünf Nachrichtenkanäle zu scrollen, die alle dreißig Sekunden aktualisiert werden, ruft dich garantiert ein Kumpel an und brüllt ins Telefon: »Hast du die Nachrichten gelesen? Krass, oder? Und jetzt? Ernsthaft weg von hier?« Telega nicht zu lesen, heißt, den Moment zu verpassen, da sich das gestern noch Erlaubte in einen Anlass zur Vernehmung verwandelt hat.
Angeblich war der Iran vor 1979 ein moderner laizistischer Staat. Angeblich gab es in Teheran vor 1979 Cocktailbars, Kinos und nach der Pariser Mode gekleidete Schönheiten auf den Straßen. Bei uns gab es auch Kinos, die mehr zeigten als Filme von vorgestern. Alles gab es bei uns: Mit dem Zug konnte man nach Paris oder Berlin fahren, direkt vom Zentralbahnhof, mit dem Flieger war man in drei Stunden in Florenz. Die Jugend diskutierte bei einem Kokosmilch-Raf über die Vorzüge eines fünfjährigen Toyota RAV4 im Vergleich zu einem fabrikneuen Hyundai Creta. Seit dem Frühjahr gähnt eine Kluft in unserem Auenland. Die Tische von den Freisitzen sind in den Orkus gerutscht, Häuser zusammengeklappt, aber ungeachtet der sich durch Glas brennenden Lavaspritzer gab es noch Optimisten, die der Meinung waren, es ginge nicht ab-, sondern aufwärts.
Natürlich lesen manche statt Telega kraj.by, ein Oldschool-Nachrichtenportal, das sorgsam »heikle Themen« umschifft und die Katastrophe in der Stadt ohne Ausrufezeichen beschreibt. Diese Leser wollen sich ihr seelisches Gleichgewicht bewahren, sie glauben, wenn sie nicht aus dem Fenster sehen, geht die Druckwelle der atomaren Explosion an ihnen vorbei. Solche Leute werden übrigens als Erste geholt.
Am Telega-Speer verletzt man sich leicht. Täglich werden zwei, drei der frechsten Kanäle auf die Extremistenliste gesetzt. Eine falsche Bewegung, ein zufälliger Klick auf »Beitreten«, und du gehst garantiert für fünfzehn Tage in Arrest. Deshalb hantieren wir nur ganz vorsichtig mit Telega: von der Hauptseite, wo nur die richtigen, die patriotischen Kanäle versammelt sind, in die Ecke, zum Lupensymbol und von dort in die Welt der bitteren Wahrheit, nach einer Struktur, die man nur im Kopf speichern darf.
Das Verbotene zu verfolgen, ist ungefähr so interessant, wie sich live am Bildschirm anzusehen, wie sie dir Nieren, Leber, Herz und Lunge entfernen. Dauerschwindel. Tiefschwarze Bewusstlosigkeit. Tod auf der Zunge. Doomscrolling. Du legst das Telefon beiseite und kommst über Stunden nicht runter, musst immer weiter darüber nachdenken, was du gerade gelesen hast. Da war eine Person. Wohnte in einem anständigen Haus mit drei Aufgängen. Roter Backstein. Kleinwüchsige Kiefern. Landschaftsgärtner. Jetzt sitzt sie im Untersuchungsgefängnis, und die richtigen Kanäle belegen sie mit den hinterletzten Ausdrücken. Und da war noch eine Person. Literaturnobelpreis. Jetzt verhören sie sie vor dem Untersuchungskomitee. Ursachen und Unterbau verblassen vor diesem Kaleidoskop – ganze Schichten der dir bekannten Welt stapeln sich wie Tetrisbausteine.
Wenn es schlimm kommt, kannst du einen der »Analysten« öffnen, die immer so tun, als hätten sie es schon gewusst und sogar vorhergesagt, wenngleich ihre Prognosen nie eintreffen. Mein Favorit ist Sascha Zok, ein übermütiger Moskauer Springinsfeld, der, sich den Bart kraulend, uns schon seit drei Monaten einzureden versucht, dass in allernächster Zeit ein Wiedergänger von George Washington mit einem durchsichtigen elektrischen Stuhl vom Himmel herabsteigen, alle Feinde der Demokratie einäschern und an die Freunde der Demokratie je ein Bündel Dollars und einen Kredit für den Kauf eines Tesla verteilen wird. Wenn wieder mal einer verhaftet wird, den Zok zuvor als Geistesgiganten bezeichnet hat, der nicht verhaftet werden könne (er ist ja mit Roisman befreundet!), und Zok in den Kommentaren an seine Prognosen erinnert und darin angemerkt wird, der Geistesgigant sei womöglich Zoks Gerede von seiner Unverwundbarkeit auf den Leim gegangen, verfällt Zok in das immer gleiche Gejammer, die Bewohner unserer Stadt und unseres gesamten rückständigen Landes verstünden nichts von Liberalismus und könnten nicht für ihre Interessen einstehen. Aber das hauptsächliche Produkt Zoks ist nicht Bitterkeit, auch nicht der Vorwurf der Versündigung und der Unterversorgung mit den Segnungen des Liberalismus, sondern Trost. Zok hat wie andere Diagnostiker auch frühzeitig gespürt: Wenn er den Verlauf der Krankheit nun einmal nicht korrekt vorauszusagen, geschweige denn sie zu heilen vermag, muss er ein anderes Produkt verkaufen – Hoffnung.
Der Legat ist schwer krank und liegt im Sterben, mhm. Die Wirtschaft übersteht den nächsten Tag nicht mehr. Ein Riesenkomplott wird dafür sorgen, dass die Freiheitsstatue sich losreißt, über den Ozean geflogen kommt und mitsamt Insel auf dem Komsomolskoje-See wassern wird. Zwei Millionen Aufrufe, entspricht der Einwohnerzahl unserer Stadt, vier Werbeblöcke auf eine zwanzigminütige Sendung. Mehr Hoffnung. Schaut Zok, und ihr sollt getröstet werden.
Die zugelassenen Telega-Kanäle sind nicht so frech. Als hätten sie sich noch nicht entscheiden können, was sie verkaufen sollen. Da ist zum Beispiel Semjon Teftel, dem Anschein nach ein Durchschnittsbürger, einer von nebenan. Einer von der Sorte, bei dem du den Blick abwendest, wenn du ihm im Aufzug begegnest, um bloß nicht angesprochen zu werden. Kräftig entwickelte Ohren. Fleischige Lippen, die eine ungewisse Anzahl Zähne zu verbergen wissen. Aber sobald Semjon mit den Ohren zu wackeln beginnt und Content absondert, wird es öde. Feinde haben unser Land umstellt. Sie fühlen ihm auf den Zahn (Semjons Zunge schiebt sich in die Lücke anstelle des Eckzahns unten links). Der Ami. Amiland. Lesben und Schwule. Gayropa. Der Majdan hat keine Chance, wir haben eine verlässliche Stütze in Gestalt des Legaten. Die Anzahl von Teftels Zähnen scheint jedes Mal wieder anders zu sein, diese Fluktuation zu beobachten, hat auch ihren Reiz.
Dann gibt es Warwara Worona, eine ausgemachte Schönheit mit buschigen Augenbrauen. Da sie weiß, dass die Brauen das Wichtigste an ihrer Erscheinung sind, spricht sie ihre Abonnenten über die Brauen an. Wenn Warwara von den jungfräulichen Reizen unseres Landes spricht, auf die es Unholde aus dem Westen abgesehen hätten, bilden sie ein Dächlein, sie formieren sich zum Trichter, wenn Warwara Zorn simuliert, und sie driften auseinander wie zwei einander ausweichende Frachtschiffe, wenn die Worona vom Ausmaß der geplanten Verbrechen derjenigen erzählt, die aktuell wieder festgenommen wurden. Man könnte ihr ewig zusehen, hätte sie nicht die Angewohnheit, immer wieder kurz auf die Uhr zu schielen – als müsste sie überprüfen, dass die bezahlte Zeit noch nicht um ist. Sobald du dir vorstellst, wie sie mitten in der schönsten Bettszene heimlich ihr Handgelenk checkt, ist der Zauber der Brauen dahin.
Dann ist da noch ihre Freundin, Swetlana Borosda, eine Meisterin im seltenen Fach der diplomatischen Provokation. Sie geht nur auf Sendung, wenn mal wieder ein Grüppchen verschreckter Botschafter europäischer Länder versucht, in eine Gerichtsverhandlung gegen politische Gefangene zu kommen. In Begleitung Warwaras oder sogar Teftels, manchmal auch ganz allein, mit drei Personenschützern und zwei Milizionären, geht die Borosda auf die Diplomaten los wie der Hecht auf den Gründling.
»Sagen Sie, was mischen Sie sich in die inneren Angelegenheiten unseres Landes ein?«, ruft die Borosda den steifen Rücken zu. »Sie wollen nicht antworten auf meine Fragen? Sie achten die Redefreiheit nicht? Sie mögen unser Land nicht und auch nicht unsere vollkommen unabhängigen Videoblogger, wie ich eine bin? Wieso sind Sie dann hier? Gehen Sie bei sich zu Hause auch zu solchen Prozessen? Nein? Hallo, ich rede mit Ihnen! Ich bin eine Frau, mein Bester, Sie werden einer Frau doch wohl antworten können? Ihrer Frau antworten Sie wohl auch nicht? Wie? Das ist nun das ›Gespräch‹, das wir führen konnten«, schließt sie, breitet die Arme aus, und ihre Blicke suchen, suchen nach den Personenschützern, denn ringsum sind Passanten mit Augen und Gesichtern, in denen so manches zu lesen ist.
Dann ist da noch Serjosha Nimoi, ein stiller Alki im grauen Pullunder, der aus Nimois Barthaaren gewebt sein könnte. Er faselt irgendwas in die Kamera, nimmt manchmal die Arme zu Hilfe, ist aber stets bemüht, sie nicht zu weit von dem Gestell zu entfernen, auf dem normalerweise seine Ellbogen ruhen. Damit er nicht umkippt. Mit ihm kann man sogar Mitleid haben.
Und mitunter hat man den Eindruck, diese armen Teufel habe man allein nach dem Prinzip »unmögliche Familiennamen« ins Körbchen der dürftigen Telegram-Sendungen gesammelt. Im Fernsehen bringen ihre Sendungen keinerlei Quote, aber bei YouTube und Telega kommen sie auf Zehntausende Aufrufe von Leuten, die gerne gesenkte Daumen verteilen.
Ich habe mich durch die Nachrichten gescrollt, die auf Telega über Nacht aufgelaufen sind (Verhaftungen, Verhaftungen, »nächtliche Proteste« in den verbotenen Kanälen, »nächtliche Unruhen« in den erlaubten; eine Sascha-Zok-Sendung »Was wir tun werden, wenn wir gesiegt haben«). Ich habe an meinem Tee genippt, um das Telefon aus der Hand zu legen und mich endlich dem Stück zu widmen. Das hatte ich wirklich vor. Ich hatte das Telefon sogar schon auf Armlänge von mir weggeschoben. Und die Hand gelöst, ich berührte es nur noch mit den Fingerspitzen. In dem Moment, als ich mit einem energischen Ruck auch noch die Fingerspitzen losreißen wollte, plingte das Telefon. Und es war kein einfaches Plingen, sondern ein höchst seltener Klingelton: die ersten drei Töne von Beethovens Für Elise. Diesen Klingelton hatte ich für eine zwanzig Personen starke Telegram-Gruppe eingestellt, für »Schüler JuI«. JuI ist Julianna Iossifowna, Dozentin für Kulturphilosophie an der Kunstakademie. Ich hatte diese Einrichtung schon vor fünf Jahren verlassen, verspürte aber wie die anderen JuI-Zöglinge immer noch die Notwendigkeit, von Zeit zu Zeit die Ausrichtung meines ethischen Kompasses mit JuI abzugleichen. Wir blieben in Verbindung, Menschen, die bei Julianna gelernt hatten, und ab und an schaute auch die Primadonna selbst im Chat vorbei und teilte irgendwelche Nichtigkeiten mit uns. Zum Beispiel, dass Wes Andersons The Life Aquatic with Steve Zissou immer besser werde, je öfter man ihn anschaue. Einmal im Halbjahr lud sie uns alle zum Tee in ihre Wohnung. Der obligatorische Aprikosenkuchen zum Tee war genauso unvergleichlich wie der Anderson-Streifen.
Ich liebe meine Eltern, die mich in einem Provinznest sechzig Kilometer von der Hauptstadt entfernt großgezogen haben. Ihr Leben lang haben sie in anstrengenden, schlecht bezahlten Stellungen hart gearbeitet und mir genug mitgegeben, damit ich an die führende Theaterschule des Landes gehen konnte. Aber wir haben uns nie über Gut und Böse unterhalten. Oder über schön und hässlich. Diese Kategorien gab es für sie nicht. Sie hatten »richtig« und »falsch«. Eine Stunde im Theaterstudio im Haus der Kultur versäumt – »falsch«. Eine Urkunde vom Bezirkstheaterwettbewerb nach Hause gebracht – »richtig«. Wofür es die Urkunde gegeben und wen genau ich bei dieser Studentenaufführung gespielt hatte, kam erst als zehnte Frage. Sie zu stellen war »falsch«. Deshalb erzählte ich als Student allen, dass ich meine Erziehung Julianna Iossifowna verdankte. Auch das ist übrigens »falsch« meinen liebenden Eltern gegenüber. Ich sage das heute nicht mehr. Erzogen haben mich Mama und Papa, und ich liebe sie. Julianna Iossifowna hat mich erwachsen werden lassen. Sie gab mir Bücher aus ihrer Bibliothek und unterhielt sich mit mir, wenn ich sie gelesen hatte.
Als sie bei den Proben zum Diplomstück Orpheus hörte, wie ich den Abschied von Eurydike mit meinem atemlosen Solo ausleuchten wollte (sechs Jahre Musikschule in der Flötenklasse), nahm sie mich mit in die Fakultät und sprach mit mir über Musik, bis es dunkel war.
Eine Woche später brachte sie von einer Konferenz in Warschau eine erlesene Prachtausgabe von Glucks Orpheus und Eurydike inklusive Partitur und Libretto mit und überreichte sie mir mit einem Vortrag über Authentizität: »Pass auf, Matwejuschka, hier wird die Partie des Orpheus von einem Countertenor ausgeführt, wie von Gluck vorgesehen, bevor sich der Simplifizierer Berlioz einmischte. Such immer nach der Urfassung und spiel dein Solo nicht, als stünde die Lehrerin mit dem Lineal neben dir.«
Ich hörte die Oper dreimal durch, vertiefte mich, da ich das Solo nicht finden konnte, in die Partitur, entdeckte ganz oben den Hinweis, dass in dieser raren Ausgabe die Erstfassung der Oper wiedergegeben wird, wie sie vor der Erweiterung des Librettos 1771 inszeniert worden war, deshalb konnte man hier lange auf das Flötensolo warten – es war erst nachträglich geschrieben worden.
Die Box liegt immer noch in meiner Schreibtischschublade – eine kostbare Erinnerung an einen Authentizitätsvortrag, der sich selbst annulliert hat.
Ich ging auf Telega und entdeckte eine blinkende 1 in der Chatzeile »Schüler JuI«. Eine neue Nachricht. Von der Nutzerin Mendoza_1987.
»Leute, sie waren bei Julianna Iossifowna.«
Wie die Zeit die Sprache verändert. Noch vor einem halben Jahr hätten wir wissen wollen: Wer war da? Und wo genau? Vielleicht waren die Dachdecker bei ihr auf der Datscha? Oder die Elektriker in ihrem Büro an der Uni, die Steckdose reparieren, wegen der der Wasserkocher nicht ging? Heute haben wir an diesen Satz mit dem nackten Pronomen und dem blassen Verb keinerlei Fragen mehr. Erstens bedeutet das »sie waren bei«, dass sie sie zu Hause verhaftet haben. Wenn jemand von der Straße weg verhaftet wird, heißt es nämlich »mitgenommen«. »Sie haben Nikolai mitgenommen.« »Mitgenommen« ist weniger schlimm als »waren bei«. Weil dieses Gewesensein für eine Durchsuchung der Wohnung steht. Bei Arrest für Verwaltungsdelikte (fünfzehn Tage) wird nicht durchsucht. Also geht es hier um Strafrecht mit der Aussicht auf mehrere Jahre.
»Fuck« – eine Nachricht von Anti_Anton, meinem Kommilitonen Anton Antipenko, der nach dem Studium als Redakteur zu kraj.by gegangen ist.
»Wann?« – eine Nachricht von Aniuta_TUZ, der Malvina am Theater für junge Zuschauer, meiner lieblichen Snegurotschka. Der Engel mit den zarten Schultern und der herausfordernden Hüfte hat im Mai beschlossen, einem anderen Burschen ein Märchen zu bescheren. Es tut fast nicht mehr weh, ihr Foto anzuschauen.
»Donnerstag. Oder Freitag. Jedenfalls nicht vor Dienstag« – Mendoza_1987. »Dienstag haben wir noch telefoniert. Ogottogott, jetzt kommen sie mich holen, oder? Dienstag hab ich mit ihr telefoniert.«
»Polina, woher kommt die Info?« – Anti_Anton.
»100pro-Info. Woher, sag ich nicht.« – Mendoza_1987.
Keine Nachfragen, allen ist klar, woher die Info kommt. Die Fangemeinde unserer Kleopatra ist soziografisch sehr heterogen. Unsere Kleopatra hat zehn Jahre vor mir ihre Erziehung bei Julianna Iossifowna genossen. Unsere Kleopatra war es auch, die diese Telega-Gruppe gegründet hat. Unsere Kleopatra braucht sich keine Gedanken zu machen, denn diejenigen, vor denen alle Angst haben, passen gut auf sie auf. Als unsere Kleopatra ihren Facebook-Post über Gut und Böse absetzte, stützte sie sich auf eine Formulierung von Hannah Arendt, die sie bei Julianna Iossifowna gehört hatte: »Der Mensch benötigt Bildung, um Gut und Böse unterscheiden zu können.«
»Paragraf, Auflagen, mögliches Strafmaß?« – Anti_Anton.
»Keine Ahnung, echt.«
Das bedeutet, der Fan, der der Prima von der Verhaftung erzählt hat, stammt nicht aus der Behörde, die da gewesen ist.
»Heidegger!« – Aniuta_TUZ.
»Shit« – Anti_Anton. »Shit, Heidegger!«.
»Irgendwas bekannt?« – Aniuta_TUZ.
»Keine Ahnung, null. Und keine Anlaufstelle.« – Mendoza_1987.
»Wie lang kann er ohne Wasser?« – Aniuta_TUZ. Malvina war schon immer ein liebes, mitfühlendes Wesen.
»Ich denk an Futter, nicht an Wasser.« – Anti_Anton. »Ist doch Heidegger.«
Nicht witzig.
»Drei Tage ohne Wasser, schreibt das Internet.« – Mendoza_1987.
»Wenn sie Donnerstag oder Freitag gekommen sind, lebt er noch.« Der Pragmatiker Anton. »Ansonsten finito. Sommer heiß.«
»Wer fährt?« – Aniuta_TUZ. »Ich kann nicht, ihr wisst schon.«
Keine Frage. Anjuta kann nicht. Anjuta ist schwanger. Nicht von mir.
»Schrödingers Heidegger«, kalauert Anti_Anton.
»Nicht wizig.« Die Mendoza verschluckt in der Aufregung ein t.
»Ich geh«, schreiben meine Finger. Eine Sekunde Verzögerung vor dem Senden. Ein Blick auf die launischen Lippen von Anjutas Avatar. Aber es ist nicht ihretwegen. Nicht ihretwegen. Julianna Iossifowna liebt Heidegger. Ich liebe Julianna Iossifowna. Ich muss fahren. Senden.
Like.
Like.
Like.
Like.
Like.
Mehr Likes als Gesprächsteilnehmer. Sieben, acht, zehn.
»Hat jemand den Schlüssel?«, frage ich nach. »Polina, du hast bei ihr Blumen gegossen, als sie im Juni weg war.«
»Nein, hab ich zurückgegeben« – Mendoza_1987. »Haustürcode ist acht fünf null.«
Acht. Fünf. Null. Ich schaltete meine Memoriersuperkraft ein – ohne die hat man es schwer auf der Bühne. Acht fünf: das Jahr der Perestroika. Null – die Annullierung der Perestroika, die wir gerade erleben. Die Annullierung der Perestroika. Acht. Fünf. Null. Sitzt!
»Schlüssel hat scheints keiner.« – Anton.
»Und jetzt?« Mir ist ehrlich unklar, wie ich zu Heidegger kommen soll.
»Vielleicht ist offen.« – Pasha_Trxtr. Noch ein JuI-Schüler. Noch ein Kollege von Polina und mir. Pascha Trickster. Die ewige Komödienbesetzung. Der Narr mit dem tragischen Schicksal.
»Sieh mal nach«, schlag ich Pascha vor.
Bei Pascha geht das. Pascha nimmt so was nicht krumm. Pascha hängt, der Dreipunkt erscheint, er schreibt was, dann ist er weg. Er kommt wieder, ist wieder weg. Pascha wird nicht hingehen. Pascha ist kein Held. Pascha ist der Trickster.
»Ich komm klar«, verspreche ich.
Ich stelle mir vor, wie Anjutas Mundwinkel zucken. Ein Anpacker. Ein Klarkommer. Was wäre der ein guter Vater geworden. Hätte er eine Chance bekommen. Hätte man ihm nicht die Entscheidung abgenommen, wer Vater wird und wer selber noch ein kleiner Junge ist.
»Shit!« – Anti_Anton. »Telefon und Tablet haben sie ihr auch abgenommen?«
»Nein, Antocha, sie zockt in ihrer Zelle Bubbles«, macht Pasha_ Trxtr einen auf sarkastisch.
»JuI ist in diesem Chat. Alle Nachrichten gelesen.« – Anti_Anton.
Ich klicke den letzten Satz an. Julia_Josef: zwei Häkchen, Nachricht gesehen. Ich klicke auf meinen »Ich geh«-Satz. Julia_Josef: Like. Fremde kalte Fingerspitzen laufen mir den Rücken runter.
»Raus aus dem Gespräch. Zackig.« – Anti_Anton.
Ich steige aus. Schon blinkt die Einladung in den nächsten Chat, aber mit neunzehn statt zwanzig Teilnehmern.
»Ein Schnüffler, was meint ihr? Oder ist JuIs Tochter von dem Account in Deutschland aus rein?« Ich treff die Tastenbilder nicht, schreib es zweimal neu.
»Sie hat keinen Kontakt zur Tochter. Garantiert nicht die Tochter.« – Polina.
»Ziemlich klarer Fall.« – Pasha_Trxtr.
»Matwejuschka, pass gut auf dich auf.« – Aniuta_TUZ.
Live hat sie mich nie Matwejuschka genannt. Und auch jetzt ist das nicht an mich gerichtet. Der »Matwejuschka« ist für die anderen: So bin ich, wir haben uns getrennt, aber ich bin immer noch mit diesem mutigen Burschen befreundet.
»Heidegger geschnappt und ab durch die Höfe«, rät Anti_Anton. »Und sieh dich vorher um. Dass du nicht dem Liker in die Arme läufst.«
»Ich komm klar.« Kurz und knackig. Eine Erwachsenenantwort. Ich bin sechsundzwanzig und ein erwachsener Mensch.
»Ich hol einen Anwalt ran. Guter Mann. Wenn er was raushat, schreib ich. Matwej, gib Bescheid, wenn du gehst. Oder wir sehen uns im Parkett.«
Ach ja. Das Parkett. Heute ist Leseprobe für das Stück. Das Stück, das ich nicht gelesen habe.
»Geht klar, bin dran.« Noch ein paar solcher Floskeln, und mein Timbre sinkt um drei Oktaven, tiefe Cowboyfalten durchfurchen mein Gesicht, und an der Hüfte klebt das Holster mit dem Colt.
Ich schalte ab. Überlege noch zu googeln, was einem für das illegale Betreten einer Wohnung blüht, in der eine Durchsuchung stattgefunden hat. Läuft das noch unter versuchtem Einbruchdiebstahl oder ist das schon was Ernsteres? Versuchte Beweismittelunterdrückung zum Beispiel? Ich spiele mit meinem Telefon herum und stecke es dann in die Tasche. Allein die Suchanfrage in meinem Browserverlauf könnte schon als Vorsatz gewertet werden. Ich bin ein Dummkopf. Ich geh Heidegger retten. Und vielleicht noch Blumen gießen. Es besteht ja auch noch die Möglichkeit, dass der Genosse Ermittler meinen Satz nicht deshalb gelikt hat, weil er mich für einen klinischen Idioten hält, sondern, weil er den Impuls zur Unterstützung meines Nächsten positiv begleiten will. Das ist nicht auszuschließen. Bravo, Matwej Alfejew, geh hin, rette Heidegger, die Organe stehen hinter dir. Wenn wir könnten, Genosse, wenn wir nicht so viel damit zu tun hätten, Volksfeinde ausfindig zu machen, würden wir uns selbst um Heidegger kümmern. Und die Blumen gießen.
Ich stehe vom Tisch auf. Das Zimmerchen ist lichtdurchflutet. Ein Plattenbausegment in einem sowjetischen Modulbau, eines von Hunderttausenden. Wie viel Mühe mussten die Sowjetmenschen doch aufwenden für ein Leben, das sich von dem ihrer Nachbarn unterschied, da selbst der dreiarmige Lüster, der Schrank mit dem Kristall und der Zuschnitt des Badezimmers mit Tubenarsenal und Sanitärtechnik identisch waren? Die Realität, in die diese Wohnung aus dem sowjetischen Paradies herausgetrieben ist, hat die Zahnpastatuben und Shampooflaschen etwas aufgehübscht: Sie sind nicht mehr grau, sondern himbeer- und smaragdfarben. Weiter zu gehen und noch etwas mit dem Himmel zu veranstalten, mit der Aussicht vor dem Fenster, den Gedanken, die einem angesichts des Himmels oder der Aussicht kommen, übersteigt die Möglichkeiten der Realität. Ich wohne an der Metrostation Puschkinskaja, vor meinen Fenstern liegt ein belebter Kreisverkehr, umstellt von den gleichen Plattenbauten, gestützt auf die gleichen Pappeln mit dem gleichen Kronenschnitt, den man ihnen seit Jahrzehnten verpasst, damit nicht die Schönheit eines aufgerichteten Baumes die Betonmoderne verdirbt.
Im Schrank hängen zwei Hemden und Anjutas Bluse. Meine drei Hemden wasche ich nacheinander von Hand, um mir nicht die Waschmaschine kaufen zu müssen, die meine Vermieterin mir zu stellen sich weigert. Anjutas Bluse hebe ich auf in der Absicht, eines Tages ins Theater zu gehen und sie ihr zurückzugeben. Wie lange sie noch auf die Bühne kann, ist unklar. Däumelinchen mit Bauch ist für junge Zuschauer ein zweifelhafter Anblick.
Ich schlüpfe in die Jeans, die mir im Sommer immer enger vorkommt als im Winter. Einmal umgeschaut: nichts vergessen? Mein Blick bleibt an dem nicht gelesenen Stück hängen. Ich überlege, ob ich es nicht mitnehmen sollte, um Montecchi zu demonstrieren, dass ich mich selbst bei meinen Fahrten durch die Stadt nicht vom Text trenne. Aber mein innerer Genosse Ermittler lässt mich wissen, sollten sie mich in der Wohnung hochnehmen, würde ein Ausdruck mit dem Titel Das irdische Gericht mein Schicksal nicht gerade erleichtern. Zumal, wenn der Autor Romuald Yehudis heißt.
Aus dem zweiten Stock die Treppe runter, im Laufschritt, um die Wette mit dem hicksenden Fahrstuhl. Generationen von Sowjetmenschen haben im Fahrstuhl so viel Alkohol getrunken, in aller Eile, bevor sie durch die Tür zur bösen Gattin mussten, dass der Fahrstuhl selber mit der Zeit einen sitzen hatte und chronischen Schluckauf bekam. Die Straße umfängt einen mit Augustaufguss. Grelles Sonnenlicht erfüllt die Seele mit Freude, aber diese Freude hat genau wie mein Ausflug selbst einen bitteren Beigeschmack: Ziel meiner Unternehmung ist das Eindringen in eine fremde Wohnung mit dem Risiko, geschnappt zu werden, die Augustsonne kündet angesichts des herbstlich zusammengekrümmten Kastanienlaubs schon von baldigem Frost und schneespuckenden Autos. Die Unterführung, bewacht von alten Weiblein, die aus Pappkartons ihre Datschenernte verkaufen, die Eingangstür zur Metro, der Menschlichkeitstest an den Passagieren: Man drückt die Tür mit beiden Händen auf, zwängt sich hindurch und denkt an seinen Hintermann oder auch nicht. Ist es ein Mensch, hältst du die Tür auf und lächelst. Ist es keiner, lässt du die zentnerschwere Tür in deinen Hintermann krachen, der jault erschlagen auf und hält die Tür selber nicht. Und gleich die Kontrolle des Türempfängers: Sagt er Danke, ist er ein Mensch, nimmt er es als gegeben hin, ist er ein Wilder. Und heute ist ein guter Tag, weil der Jugendliche vor mir die Tür aufgehalten und die alte Frau nach mir sich bedankt und gelächelt hat, und dieses Fest der Menschlichkeit trifft nun auf den Rahmen des Metalldetektors und einen Mann in dunkelblauer Uniform, der sich Leute aus dem Strom zur Durchsuchung herausfischt. Heut ist hier Alarm, heut kontrollieren sie zu dritt, und auch in der Metro sind mehr als sonst. Die Schulterklappen, Uniformen, die dich professionell musternden Blicke, die Hinweisschilder in dieser speziellen Sprache (»Der Bombenscherz hat Konsequenzen – ohne Witz«) machen dir ein flaues Gefühl im Magen. Der Security-Check ist eine diplomatische Vertretung Seiner Majestät des Regimes, eine Erinnerung daran, dass das Gefängnis gleich nebenan ist und du Wurm darauf gefasst sein musst, den Inhalt deines Rucksacks, deines Gehirns, deiner Seele, deines Herzens durchleuchten zu lassen und scherzfrei sämtliche Fragen zu den Inhalten deines Ichs zu beantworten.
Der Zug fährt ein, dröhnend wie eine zum Bombenabwurf niedergehende Junkers. Ich drücke mich an die Trennwand und zücke mein Telefon: Ich muss nachsehen, ob die Station Jakub-Kolas-Platz, an der Julianna Iossifowna wohnt, nicht gesperrt ist. Es gibt Empfang im Tunnel, aber das Internet hängt – gerade mal elf Uhr, und sie stören schon das Netz. Heute ist Sonntag, mittags beginnt das, was die richtigen Telegram-Kanäle »Massenunruhen« nennen und die falschen »Massenproteste«.
In dieser Haltung, starrer Blick auf das eingefrorene Display, überraschte mich die Truppe.
Sie stiegen an der Kalwarijskaja ein. Oder an der Molodjoshnaja? Zu viert: drei Jungs und ein Mädel. Anders als die sonstige Menge, die ganz gezielt in Rot und Weiß gekleidet war, trugen sie dunkle Farben. Das Mädel hatte einen langen schwarzen Staubmantel an. Die Haare gefärbt wie ein Krähenflügel, sogar mit einem leichten Blauschimmer. Üppige Schminke, hauptsächlich Weiß, eine dicke Schicht, um die Mimik auszuschalten; die Augen dunkel umrandet, schwarze Brauen und Wimpern. Ob sie Lippenstift trug, weiß ich nicht mehr. Eher nicht. Ich kenne diesen Style, so schminkt man sich, bevor man auf die Bühne geht, nicht zu Schönheitszwecken, sondern um sich zu verändern, um dieses Wesen zu werden, das spielt. Jedes Detail ihrer Garderobe, jeder Lidstrich sprach von Subkultur, Otaku oder so. Aber alles zusammengenommen konnte unmöglich Cosplay sein, es schrie nach Authentizität. Wenn sie denn eine Superheldin verkörperte, dann die, die sie selber war. Nach zehn Sekunden nahm man ihr Erscheinungsbild nicht mehr als ungewöhnlich wahr, selbst die schneeweiße Haut wirkte schon natürlich. Sie drängten in den Waggon, die Jungs bildeten einen Kreis und schoben die Fahrgäste sanft von ihrer Freundin weg.
Einer mit schwerer Halskette und Lippenpiercing musterte das Publikum mit irrem Blick und brüllte dann über das Lärmen des beschleunigenden Zuges hinweg: »Liebe Fahrgäste! Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit für eine szenische Miniatur, bestehend aus der Deklamation von Poesie! Halten Sie bitte Ihre Bargeldbestände bereit, um uns in unserer berauschenden Leidenschaft zu unterstützen, die Dichter und Straßenkünstler nährt: Alkoholismus! Achtung! Zahlungen mittels Karte oder Telefon werden nicht akzeptiert, da unser Lesegerät von den staatlichen Organen nicht zertifiziert wurde!«
Es fiel mir damals nicht gleich auf, aber jetzt erinnere ich mich: Er war angetrunken und brüllte tatsächlich, gab alles, sein Nacken legte sich in Falten, damit aus der Kehle genug Geräusch kam, den donnernden Zug zu übertönen.
Als aber das Mädel die Gedichte losließ, sprach sie und schrie nicht. Sie sprach, und ihre Stimme war wunderbar zu hören in meinem Winkel des Waggons, obwohl der Zug auf seinem Gleis dahinjagte. Sie trug zwei oder drei Stationen lang vor. Nach den ersten Zeilen vergaß ich alles um mich herum und achtete nicht mehr auf die Ansagen. Die Gedichte hatten eine hypnotische Kraft und teilten dir genau das mit, was dir gerade im Kopf herumging. Woran hatte ich in dem Moment gedacht? An meine Angst, an die Liebe, an das gestörte Netz und davon ausgehend an Freiheit und irgendwie auch an Einsamkeit. Und genau davon sprach sie. Von Angst. Vom Drachen, der frisst und frisst und dem wir selber unsere Freunde und Freundinnen zuführen. Von der Freiheit und ihrer Begleiterin und Ursache: der Einsamkeit. Von der Liebe, die dir die Freiheit nimmt, dich aber freier macht. Aber auch von der Metro, vom Augusttag, von der Sonne, die Schnee atmet – in ihren Gedichten war alles, das gesamte Universum, nicht gereimt, aber rhythmisch stampfend wie das Herz. Das letzte habe ich mir eingeprägt. Es war ein Gedicht über das Wort, darüber, dass früher die Sonne durch das Wort gebannt wurde und die Sterne sich vor ihm angstvoll an den Mond drängten, Zahlen gab es für das niedre Leben, die feinste Sinn-Nuancen wiedergeben konnten, und da, da, da haben wir das Wort eingeschränkt, in die armen Schranken der Natur gewiesen.
Was mich angeht: Mich verzauberten nicht nur die von ihr vorgetragenen Zeilen, ich war erschüttert von ihrer Darbietung, ich konnte nicht begreifen, wie sie es schaffte, so zu klingen, als hätte sie einen Verstärker mit Zweihundertfünfzig-Watt-Boxen eingebaut. Aber der gesamte Waggon hörte ihr zu, löste sich von den toten Telefonen und stand mit offenem Mund da. Wir wären wohl noch bis zur Endstation Mogiljowskaja so weitergefahren, hätte nicht, als der Zug an der leeren Station Nemiga, statt zu halten, Fahrt aufnahm, die müde Stimme des Schaffners über Lautsprecher angesagt: »Achtung. Die Stationen Nemiga und Oktjabrskaja werden nicht bedient. Nächster Halt: Perwomaiskaja.«
Da der Waggon noch immer in ihrem Bann stand, gab es kein genervtes Stöhnen, alle lauschten in der Erwartung, sie werde fortfahren. Aber ihre Kompagnons zogen hippe Leinenbeutel aus der Tasche, hielten sie auf und nickten dem mit dem Lippenpiercing zu.
»Liebe Fahrgäste! Seien Sie aufmerksam und umsichtig!«, grölte der übermütig. »Holen Sie nur Ihre eigenen Geldmittel aus den Portemonnaies! Verzichten Sie auf finanzielle Zuwendungen an uns, die Sie auf illegalen Wegen erworben oder auf die Sie keine Einkommensteuer oder Sozialabgaben entrichtet haben! Geld auf die Hand, Pech in der Liebe!«
Der Zug hielt an der Perwomaiskaja, die Leute traten respektvoll zur Seite, damit die Rezitatorin und ihre Begleiter aussteigen konnten, dann strömten sie hinterdrein. Es sah aus, als wollten heute alle zu den Stationen Nemiga und Oktjabrskaja fahren. Ich legte einen Zahn zu und schob mich durch bis zu dem mit dem Piercing. Aber er scherte sich nicht um mich, mit beiden Händen im Beutel zählte er konzentriert die zusammengekommenen Scheine. Also ging ich zu dem Mädel und wollte ihr die zehn Rubel in die Hand drücken. Sie verzog abschätzig das Gesicht und deutete mit dem Kinn zu ihren Assistenten. Einer von ihnen kam angetänzelt und nahm mit einem zerfließenden Lächeln meine milde Gabe entgegen.
Die junge Dame hatte es eilig und gab deutlich zu verstehen, dass sie kein Gespräch wünschte, aber ich schloss doch zu ihr auf und fragte in ihren Rücken: »Waren das Ihre? Von Ihnen, ja?«
»Was?«, fragte sie zurück, ohne stehen zu bleiben oder sich umzudrehen.
»Das, was Sie rezitiert haben. Über die Freiheit. Über die Angst. Über das Wort.«
»Das Letzte war nicht von mir. Gumiljow. Les ich jedes Mal, gehört zum Ritual. Aber alles andere ist von mir, ja.«
»Entschuldigung, ich bin Schauspieler, ich wollte nur sagen, Sie sind ziemlich krass. Wie kriegen Sie so ein Volumen hin?«
»Was?«, fragte sie wieder matt zurück.
»Ihr Volumen. Lautstärke meine ich, aber es ist ja nicht die Lautstärke.«
»Wenn du glaubst, was du sagst, wirst du auch gehört.« Sie zuckte mit den Achseln. »Mehr Volumen ist nicht.«
»Und ihr seid Straßendichter, ja?« Ich ließ nicht locker.
»Ich schon. Die nicht.« Sie warf einen Blick zurück auf ihre Suite. »Die haben sich letzte Nacht an mich drangehängt, als ich in der Sybizkaja vorgetragen habe. Haben für mich Geld zusammengeschnorrt und mir einen Döner spendiert. Und sich betrunken. Ist für mich in Ordnung. Einer ist hier gemeldet, da kehren wir jetzt ein, pennen. Ich bin drei Tage auf den Beinen.«
»Fahren Sie noch weiter?«, fragte ich und registrierte, wie verkrampft alle meine Fragen waren.
»Nein. Ich bleib wohl erst mal hier. Hier gibt es was zu tun.«
»Darf ich fragen, wie Sie heißen?«, fragte ich vorsichtig. Und als ich sah, wie sie eine Braue in die Stirn zog, schob ich schnell nach: »Damit ich Ihre Gedichte lesen kann, im Netz.«
»Lady Di«, lautete ihre Antwort.
»Lady Di?«, fragte ich nach. »Ist das Ihr Pseudonym? Wieso Lady Di?«
»Weil.« Sie blieb stehen und wandte sich zu mir um. »Ich bin auch eine tote Prinzessin.«
Ich nickte grinsend, aber sie schaute ganz ernst. Streng sogar. So streng, dass ich mein Grinsen verschluckte und ins Schleudern kam. Als hätte ich ein Sakrileg begangen. Hm. Tote Prinzessin. Wie war das zu verstehen? Doch die Subkultur? Irgendein Anime über eine tote Schöne, in dem sie »lebte«? Stopp, sagte ich mir mit Julianna-Iossifowna-Stimme. Wieso sieht sich der moderne Mensch, sobald er dem Ungewöhnlichen begegnet, sofort nach Anime oder Marvel um? Sie schaute immer noch, und ich wusste nicht wohin mit meinen Augen unter diesem ihrem Blick.
»Wovor hast du Angst?«, fragte sie unvermittelt.
»Wie jetzt?«
»Du hast doch Angst.« Unwillig gab sie mir einen Wink, ich solle ihre Zeit nicht vergeuden. »Du hast Angst, das sehe ich.«
»Vierundsechzig Rubel, Lady Di!«, vermeldete hinter uns der Kerl mit dem Piercing. »Vielleicht holen wir noch ein paar Bierchen? Den Rest liefern wir ab, großes Musketierehrenwort!«
Sie schenkte der Suite keinerlei Beachtung.
»Ich hab tatsächlich …«, fing ich zögernd an, mir fehlten die Worte zur Beantwortung dieser so simplen und so konkreten Frage. »Bin tatsächlich ein bisschen … in Sorge. Weil ich gerade unterwegs bin zu … einem Ort … wo man …«
»Wieso gehst du dorthin?«, fiel sie mir ins Wort.
»Jemand holen.« Kurze Fragen waren leichter zu beantworten. »Es geht um Leben und Tod.«
»Um Leben und Tod. Dieser Jemand stirbt also, wenn du ihm nicht hilfst, richtig?«
Die Situation warf bei ihr keine größeren Fragen auf. Als wäre sie Teil der Chatgruppe »Schüler JuI«.
»Er stirbt. Verdurstet und verhungert. Er ist ziemlich verfressen.«
»Du tust ein gutes Werk. Wieso hast du Angst?«, fragte sie wieder matt.
»Weil das böse enden kann.«
»Ein gutes Werk kann nicht böse enden«, sagte sie mit Nachdruck. »Ein gutes Werk kann nur gut enden. Deshalb, erstens: keine Angst. Alles wird gut. Zweitens: keine Angst. Keine Angst. Zu keiner Zeit und vor nichts. Angst ist eine Dämonin aus einer anderen Welt. Nicht aus der Welt der Lebenden. Sie ist hierher gesandt, um die Menschen zu Teufeln zu machen. So werden sie selbst zu Quellen der Angst. Keine Angst.«
»Aber …«
Ich wollte noch etwas sagen, verstummte aber unter ihrem Blick.
»Geh. Ich find dich abends wieder.« Sie schnippte mit den Fingern nach ihren alkoholischen Begleitern und entschlüpfte dem Tunnel.
»Goodbye, Lady Di!«, rief ich der Gestalt hinterher.
Ich bekam nicht mal mehr ein Nicken.
Ich überquerte die Swislotsch auf der Fußgängerbrücke und gelangte so an einen jener verborgenen Orte, an denen meine Stadt mit sich selbst Verstecken spielt. Bröckelnde Stalinbauten mit alten Mütterchen aus der Zeit der letzten Volkskommissare befanden sich dort in unmittelbarer Nachbarschaft zu mondänen Neubauten, in denen staatlichen Aufträgen zugeneigte Unternehmer lebten. Männer mit Trägheit im Blick und Eisen in der Stimme. Ein Bau wirkte wie der in die Vergangenheit geworfene Schatten eines anderen. Man wusste nur nicht so genau, welcher: Waren Stalinismus und Volkskommissare hier nun Vergangenheit oder Zukunft? Hatte man die Unternehmer schon entkulakisiert, oder würde man das erst tun? Durch die Kastanien schimmerte die aus Laub gewobene Silhouette des von den Chinesen erbauten Hotel Peking. Es hatte den großen, den Investoren zugesagten Touristenansturm nie erlebt. Die erste, damals noch fast spielerische Runde politischer Eiszeit hatte genügt. Das Hotel blieb ein Gespenst einer nicht eingetroffenen Zukunft. Oder einer nicht ins Plusquamperfekt gesetzten Vergangenheit. Und dahinter lagen Quadratkilometer verlassener Depots und Fabriken. Brachen, eingezäunt mit sowjetischen Betonplatten. Verstaubte Kletten. Der Geruch von der Sonne aufgeheizten Sandes. Innerste Innenstadt. Das Wesen dessen, was geschieht, wenn man beschließt, nichts zu ändern. In der Hoffnung, die Sowjetunion würde schon von selbst sprießen. Eine Stadt der mit dem Skalpell durchkreuzten Schicksalslinien.
Auf meinem Weg durch die orwellschen Brachen querte ich noch einmal den gewundenen Flusslauf und verlor mich in Gedanken. Meine Füße brachten mich von allein zur richtigen Adresse, während ich darüber nachdachte, dass Julianna Iossifowna einer Kriminellen nicht nur nicht ähnlich sah. Sie hatte geradezu etwas von einer Antikriminellen. Ihre gesamte Erscheinung verkörperte die Idee der ontologischen Unzulässigkeit des Verbrechens. Verabsolutierte Hilflosigkeit. Güte aus allen Poren. Julianna Iossifowna. Übergewicht. Das Gesicht der guten Hexe aus einem skandinavischen Märchen. Vier Jahre vor der Pensionierung. Professorin für Kulturphilosophie an der Kunstakademie. Promoviert über Dante. Weshalb sollten sie bei ihr gewesen sein? Weil sie Expertin für die Hölle und ihr allzu nah gekommen war?
Aber nein.
In den vergangenen zwanzig Jahren haben wir so viele strahlende Karrieren jäh abbrechen, so viele allseits beliebte Figuren hinter Stacheldraht verschwinden sehen, dass wir uns die Frage nach dem Warum abgewöhnt haben. Ohne warum. Einfach so. Lady Di hatte vom Drachen gesprochen. Ja, der Drache frisst die Menschen nicht, weil sie schlecht wären oder sich etwas hätten zuschulden kommen lassen. Der Drache frisst, weil er Hunger hat. Ganz einfach.
In unserem Fall frisst der Drache nicht »wegen«, sondern »weil«. Laterale Logik. Da gibt es zum Beispiel einen Mann mit Trägheit im Blick und Eisen in der Stimme. Und er hat zum Beispiel zwei Milliarden Dollar. Zwei Milliarden Dollar hat er nicht etwa, weil er so ein genialer Trader ist. Sondern weil man ihm mit roten Fähnchen sein Terrain abgesteckt hat, zum Beispiel eine Kette von Discountern, wo man sonst niemanden reingelassen hat. Wer trotzdem ankommt, wird an die Krokodile von der Finanzpolizei verfüttert. Und nehmen wir nun an, das Land braucht dringend zwei Milliarden Dollar. Soll das Land nun etwa einen Termin im Vorzimmer dieses Mannes mit Trägheit im Blick zu bekommen versuchen? Ihn anbetteln? Sich erniedrigen? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich sollte das Land das tun. Aber hier können sie so etwas nicht. Deshalb wird der Mann zum Drachen geschickt, sein Imperium wird an Araber verkauft, die das mit der lateralen Logik noch nicht durchstiegen haben, nach anderthalb Jahren hat der Ärmste dann aus dem Knast heraus die hundert Millionen für seine Freilassung zusammengekratzt. Man spricht dabei nie von »freikaufen«, »freikaufen« kommt im Staatswortschatz nicht vor. Und er wird freigelassen. Und er fängt, wenn er dumm ist, das nächste Unternehmen an. Weil er denkt, er hätte letztes Mal etwas nicht richtig verstanden. Man hätte ihn tatsächlich »wegen« etwas einkassiert, das in der Anklageschrift stand. Die Unterbewertung des Einkaufspreises für Agrarerzeugnisse zum Beispiel (was immer das heißen mag). Oder die versuchte Bestechung einer Amtsperson, die eng geführt von Spezialisten den Mann in ein Café begleitet hat, vor die Überwachungskamera (die Tüte mit den markierten Scheinen war rechtzeitig zu Füßen der beiden platziert worden).
Aber, Teufel noch mal! Julianna Iossifowna! Wie konnte sie innerhalb dieser Logik von Interesse sein?
Worin bestand ihr Nährwert?
Die zwei Milliarden hat sie nicht. Das symbolische Gewicht einer solchen Verhaftung ist minimal: Sie tritt selten öffentlich auf, sie ist nicht mal bei Facebook. Warum also? Wenn sie so eine Sache ins Laufen bringen, wird dem normalen Zuschauer eine ältere intelligente Frau doch leidtun. Der ideelle Nutzen ist gleich null. Der ökonomische sowieso.
Geruch nach frisch gereinigtem Asphalt. Die blauen Schatten von Linden und Kastanien fassen den Haferkeks von einem Platz ein. Ein kümmerlicher Springbrunnen vor dem dezenten Denkmal des Mannes, der den Namen meines Landes in der gesamten Sowjetunion zum Klingen gebracht hat. Sodass sowjetische Akteure, als die Union zeitweise zerbrochen war, auf die Idee verfielen, das Lied eines einzelnen, unabhängigen Landes zu singen. Seither strampeln wir.
Auf den Stufen vor der Philharmonie steht eine Menschenmenge, Julianna Iossifownas Wohnung liegt auf der rechten Seite, beim Café, ich muss da also sowieso vorbei. Ich komme näher. Viele feierliche Gesichter. Diejenigen, die weggehen, haben verheulte Augen. Was geht da vor? Eine heimliche Beerdigung? Der graue Stuck des Musenhortes will an griechische Apollotempel erinnern und kaschieren, dass es sich um einen Typenbau handelt, sie stehen in Gebietshauptstädten von Wladiwostok bis Chişinău. Unterm Vordach steht in zwei Reihen ein Chor. Die Leute sind in Weiß gekleidet. Hinterm Chor, rechts des Haupteingangs, im »sweet spot« – Robert Bauman. Die Violine unterm Kinn, den Bogen erhoben. Ein Virtuose, dem das schwedische Königspaar bei der Nobelpreiszeremonie applaudiert hat. Konzerte in den besten Häusern Europas. Keine Auftritte in der Heimat in den vergangenen zwanzig Jahren. Warum auch immer.
Und da ist er nun. Im Rücken des Chores. Graue Koteletten, die grauen Augenbrauen steil aufgestellt – dieses Gesicht kennt das ganze Land. Es wird still. Selbst das Gehupe der Autos verstummt, der Boulevard ist noch nicht gesperrt, obwohl es darauf hinauslaufen wird. Und in diesen Moment schwereloser Stille hinein spielt Baumans Violine den ersten Ton. Ich bin eigentlich unterwegs. Seitlich, im Rücken der Leute, zum Haus von Julianna Iossifowna. Mir steht der Sinn nicht nach Musik. Nicht nach Bauman. Heidegger ist dran. Aber als ich diesen ersten Ton höre und erkenne, bin ich wie erstarrt. Ich vergesse zu atmen. Ich begreife, warum diejenigen, die von der Philharmonie weggegangen sind, geweint haben. Es ist dasselbe Gefühl wie bei den Gedichten von Lady Di: Das ist meins, das handelt von mir, das spielt in meinem Kopf, nur für mich. Nur ich verstehe es. Und die Geige spinnt den Faden weiter. Jeder Ton klingt einleuchtend, zerschneidet die erhitzte Luft und erfüllt sie mit Güte. Der »sweet spot« nutzt die Resonanz des Gebäudes, die Wände singen mit, der Boden. Es ist das »Erbarme dich« aus Bachs Matthäus-Passion. Als ich das Gefühl habe, meine Füße hätten sich vom Erdboden gelöst, setzt der Chor ein.
Über diesen Einfall lässt sich trefflich streiten – das »Erbarme dich« ist eine Arie für Alt solo, eine einzige weibliche Stimme wendet sich innig zu Gott, und das hat seinen Sinn. Es ist ein Gebet. Und ein Gebet kann nicht aufrichtig und kollektiv zugleich sein. Aber hier klingt der gesamte Chor wie eine Altstimme. Solistisch. Eins geworden. Nichts Individuelles sticht da heraus, sie ist ausgewogen und dabei voller Leben. Der Chor fleht. Erbarme dich, mein Gott. Wir sind nun alle eine Stimme, eine Lunge, eine Kehle, ein Stimmband. Alle zehn Millionen, die in diesem Land leben. Alle zwei Millionen in der Stadt. Erbarme dich über mich alle und uns alle. Die wir hier versammelt sind. Alle, die sich noch versammeln werden. Erbarme dich, denn wir wissen, es droht Unheil. Es wird schlimm. Es wird viel Kummer und viele Tränen geben. Erbarme dich und behüte. Und alle wischen sich die Augen. Männer blicken zu Boden – bei gesenktem Kopf fließen die Tränen in heißen Rinnsalen beiderseits der Nase, verharren für einen Augenblick an der Oberlippe und fallen unbemerkt, und man kann sogar schniefen, niemand merkt es, und selbst wenn, es ist nicht peinlich. Überhaupt nicht.
Als der Vortrag geendet hat und Applaus donnert, trete ich hundert Schritte von der Menge zurück. Chor und Virtuose bleiben an ihrem Platz – sie werden das »Erbarme dich« heute wieder und wieder intonieren.
Der Hauseingang neben dem von Julianna Iossifowna. Das Café mit den Plastiktischen. Ich nehme einen Americano – ach, wie vermisse ich die Zeiten, da man seinen Kaffee noch in Porzellantassen bekam und nicht im Pappbecher. Wenn man sie fragt, weshalb sie einem das Porzellan vorenthalten, halten sie einen Vortrag über Ökologie und den Einfluss von Spülmittel auf die Potenz männlicher Roter Pandas in Myanmar. Darauf kann man etwas über die Zellulose erwidern, die die Pappbecher dicht hält, und führt ein normales Gespräch, das in jeder anderen Stadt möglich ist, von San Francisco bis Warschau. Auch bei uns ging das. Auch bei uns erschienen noch vor einem halben Jahr auf kraj.by und städtischen Portalen umfangreiche Texte über ethische Pizza und Gender Porno. Aus jetziger Perspektive wirkt das lächerlich und abstrus. Jetzt haben alle andere Themen im Kopf. Ich setze mich so, dass ich die Einbahnstraße des Muljawin-Boulevards im Blick habe. Ich beobachte.
Ich interessiere mich für dunkelblaue Kleinbusse. Alle aufmerksamen Telega-Leser, also etwa drei Viertel der Einwohner unserer wunderbaren Stadt, haben innerhalb der vergangenen drei Monate eine Krankheit entwickelt, die man als Bussophobie bezeichnen könnte. Da alle »Heimsuchungen« und Festnahmen mit dem Auftauchen eines dunkelblauen Kleinbusses mit getönten Scheiben beginnen, ist das Auftauchen eines solchen Kleinbusses vor deiner Haustür in der Regel ein weitaus bedrohlicheres Omen als ein krächzender Rabe oder eine schwarze Katze, die dir über den Weg läuft. Dunkelblaue Busse können rote Nummernschilder haben, die sie als zum Innenministerium gehörig kennzeichnen. Gar keine Nummernschilder (was angesichts der gestrengen Straßenpolizei wiederum ein Hinweis auf Zugehörigkeit zum Innenministerium ist). Gewöhnliche Nummernschilder (in der ersten Zeit wurden die Kennzeichen der »bösen« Kleinbusse bei Telega veröffentlicht, dann ließ man es sein: Offenbar nahm der Außendienst jedes Mal neue Kennzeichen, ohne jedes System).
Jedenfalls parkte zehn Meter von Julianna Iossifownas Hauseingang entfernt, zwei Räder auf dem Bürgersteig, ein getönter Kleinbus im Farbton Dunkelblau. Ein Ford Transit. Mit gänzlich zivilem Kennzeichen. Den Bus umgab ein leerer Ring – die Menschen, die Bauman hören wollten, umgingen das Fahrzeug im größtmöglichen Bogen, hielten sich aber sorgsam von der Fahrbahn des Muljawin-Boulevards fern, da das Betreten auch nur mit einem Fuß als Blockierung eines Verkehrswegs interpretiert und als Argument zur Eröffnung eines Verfahrens verwendet werden konnte.
Ich trank Kaffee und schaute auf den Bus. Einerseits hätte ich schon jetzt mein Telefon zücken, mich ins WLAN des Cafés einwählen (anders als das blockierte mobile Internet, müsste das WLAN des Cafés funktionieren) und in unseren kleinen Chat schreiben können: »Aus für Heidegger. Bus vor der Tür. Abgang.« Schließlich waren der Bus plus die Nachricht, ich stiege nun in die Wohnung einer Inhaftierten ein, der quasi garantierte GAU.
Andererseits wusste ich erstens, wie sehr Julianna Iossifowna Heidegger liebte. Seit ihre Tochter nach Deutschland gegangen war, war Heidegger ihr einziger Trost. Zweitens habe ich, sagen wir mal, eine gewisse Erfahrung, was das Verhältnis zu Regisseuren angeht. Und ich weiß, wie man bei einer Premiere an den Augen der Schauspieler ablesen kann, wo sich der Regisseur befindet. Ich sah einen unscheinbaren Mann im Kurzarmhemd, der in der Toreinfahrt hinter dem Bus auf und ab ging. Schon dass er so an dieser Einfahrt klebte, ließ einen stutzig werden. Niemand würde sich freiwillig länger als zehn Sekunden in der Nähe dieses Busses aufhalten. Außerdem sah ich drei hochgewachsene junge Männer näher an der Menge vor der Philharmonie ihm immer wieder schnelle Blicke zuwerfen. Alle drei mit Mütze, alle drei mit kabellosen Ohrstöpseln. Wenn einer vorgab zu telefonieren, wandte er sich immer dem »Regisseur« zu. Aber die Hauptsache war: Die drei »im Feld« und ihr »Comandante« blickten nicht zum Hauseingang. Sie blickten in die Menge vor den Stufen. Sie waren wegen der Massenveranstaltung hier. Hielten die Namen der Chormitglieder fest. Beobachteten die Menge. Waren bereit zu eskalieren.
Pappkaffee ist Mist. Selbst guter Kaffee. Ich stand auf und ging mit federnden Schritten in Richtung Hauseingang. Er lag direkt neben der Einfahrt. Ich versuchte, den Comandante nicht anzusehen, aber er hatte einen scharfen, stechenden Blick – der ja gerade dazu führte, dass ich mich so künstlich bewegte, so angestrengt nicht zu ihm hinsah. Er griff mich aus dem Gesamtbild und gab mir Geleitschutz mit den Gewehrläufen seiner schwarzen Pupillen, und es war klar, dass er gleich am Eingang jede meiner Bewegungen verfolgen würde, Ganzkörpercheck, und wenn ihm irgendetwas komisch vorkommen sollte, würden sie mich erst mal einsacken und später auseinandernehmen (der Telega-Chat war noch nicht entfernt, die ganze Kommunikation beim ersten Öffnen der App zu sehen). Deshalb beglückwünschte ich mich feierlich zum auswendig gelernten Code und blickte ihm auf dem Weg zur Tür schließlich fest in die Augen. Mehr noch, ich nickte ihm kumpelhaft zu.
»Wieso hast du ihm zugenickt?«, fragte in mir das Wesen, das im offenen Chat mit Anjuta »Ich komm klar« geschrieben hatte.
»Gleich legt er dich um«, knurrte der Cowboy, spuckte aus dem Mundwinkel und rückte das Holster mit dem Colt zurecht.
Dort, in den Pupillen des Comandante, begegnete mir absolute Gleichgültigkeit. Er hatte kein Interesse an mir. Ich war für ihn ein wispernder Grashalm, das Piepsen einer Meise in der Kastanie. Solange der Grashalm kein Wolfsgeheul ausstieß und die Meise kein Hühnergegacker, würde er mich nicht sehen.
Ich habe genickt, weil ich so tun wollte, als hätte ich gedacht, er wär der Nachbar von obendrüber, sagte ich zu der inneren Stimme, die mich gerügt hatte. Und tippte mit sicheren Fingern den Zahlencode ein. Die Annullierung der Perestroika: eins – neun – acht – fünf – null.
Nach der Acht quäkte das Zahlenschloss und fiepte die Fehlermeldung. Der Comandante straffte sich und spießte mich auf seinen Blick. Was bist du für eine Pfeife?, sprach deutlich aus seinen Zügen. Perestroika. Ein Code mit drei Stellen, nicht fünf, fiel es mir siedend heiß ein. Ich tippte acht, fünf, null, zog an der Tür, sie gab nach. Verwirrt lächelte ich die Tür an, nach dem Motto »Gedächtnis wie ein Sieb«, ich wusste, er scannte mein Gesicht und befand über mein weiteres Schicksal, aber ich war ja bloß das Bürschlein mit dem Schifferklavier, ein Niemand, ein absoluter Niemand.
Ich schlüpfte hinter die schwere Tür ins Dunkel. Der Schließer glitt mit einem metallenen Geräusch gegen das Türfutter. Dreimal tief durchatmen. Zwei Treppen hoch. Dazwischen ein Absatz. Auf zwei alten Schemeln standen Topfpflanzen, mit denen Julianna Iossifowna das Treppenhaus verschönert hatte. Jemand musste sie gegossen haben, die Erde war feucht. Von oben, leicht gedämpft, Heideggers Gebrüll.
Julianna Iossifowna meinte, sie hätte den Kater nicht nur wegen seines Quadratschädels, der kleinen Ohren und des Schnurrbarts Heidegger getauft. Sondern auch, weil er statt »Miau« immer »Daaaasein« schreie, wenn er Hunger habe. Wir wollten ihr nicht glauben, da Heidegger jedes Mal, wenn Julianna Iossifowna uns zu sich einlud, bis obenhin abgefüllt war, sich lediglich die ihm zustehenden Streicheleinheiten abholte, um sich sodann zurückzuziehen und über das Dasein nachzudenken. Aber in den Tagen seit dem Verschwinden der treusorgenden Hand war der arme Teufel dermaßen ausgehungert, dass sich sein heideggersches Wesen offenbarte. »Dasei-n!«, maunzte er klar und deutlich, »Daaa-uau-uau-seinnnn!« Und sein Geschrei hatte etwas von Wyssozki. Als hätte der gute Wladimir Semjonowitsch beschlossen, die Gedichte des deutschen Philosophen zu vertonen.
Okay. Kater lebt. Weiter im Text. Ich ging hinauf in den ersten Stock und blieb vor der massiven Tür zu Heideggers Reich stehen. Der Kater verstummte, als er meine Schritte wahrnahm, vielleicht erkannte er sogar einen seiner zahlreichen Verehrer darin. Dann holte er tief Luft und verdüsterte das gesamte Treppenhaus mit seinem markerschütternden »Daaaaseeeeinnnn!«. An der Tür, zwischen Klingel und Angel, ein Papierstreifen, etwa handbreit. Auf dem Streifen ein Rundstempel mit dem eindeutig lesbaren Wort »Komitee«. Sonst unleserlich. Unleserlich, aber klar und deutlich welches Komitee. Jedenfalls nicht das Komitee zum Schutz des Grashüpfers. Auf dem Türspalt, etwa auf Höhe des Schlosses, prangte ein Siegel, daneben noch eines, dazwischen die Siegelschnur.