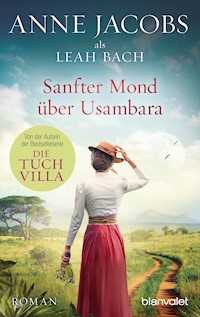9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Gutshaus-Saga
- Sprache: Deutsch
Seit Jahrhunderten in Familienhand, verloren und wiedergefunden – ein Gutshaus, eine Familie und ein dramatisches Schicksal …
Franziska kann es nicht glauben: Endlich ist sie wieder in ihrer Heimat auf Gut Dranitz. In den Wirren des zweiten Weltkriegs musste sie das herrschaftliche Anwesen im Osten verlassen. Lange gab es keinen Weg zurück. Trotzdem ließ sie die Sehnsucht nicht mehr los. Nie konnte sie die glanzvollen Zeiten vor dem Krieg vergessen, ihre Träume und Wünsche von einem Leben an der Seite ihrer großen Liebe Walter Iversen. Alles schien möglich. Doch der Krieg trennte die Liebenden und machte ihre Träume zunichte. Aber Franziska gab die Hoffnung nie auf ...
SPIEGEL-Bestsellerautorin Anne Jacobs bei Blanvalet:
Die Gutshaus-Saga:
1. Das Gutshaus. Glanzvolle Zeiten
2. Das Gutshaus. Stürmische Zeiten
3. Das Gutshaus. Zeit des Aufbruchs
Die Tuchvilla-Saga:
1. Die Tuchvilla
2. Die Töchter der Tuchvilla
3. Das Erbe der Tuchvilla
4. Rückkehr in die Tuchvilla
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Als die 70-jährige Franziska kurz nach der Wende den Ort ihrer Kindheit wiedersieht, weiß sie, dass sie für immer bleiben wird. Mit dem alten Gutshaus Dranitz in Mecklenburg-Vorpommern verbindet sie die schönsten und schlimmsten Ereignisse ihres Lebens. Seit sie es in den Kriegswirren verlassen musste, hat sie sich dorthin zurückgesehnt – nun endlich geht dieser Wunsch in Erfüllung. Gemeinsam mit ihrer Enkelin Jenny will sie das Anwesen im alten Glanz auferstehen lassen. Dabei gehen ihr immer wieder Erinnerungen an ihre unbeschwerte Kindheit durch den Kopf, an den Verlust ihrer Eltern, aber auch an ihre erste große Liebe Walter Iversen, der ihr vom Krieg genommen wurde. So glaubt sie zumindest. Als eine ehemalige Angestellte ihr erzählt, dass der totgeglaubte Walter nach dem Krieg auf der Suche nach ihr war, kann sie es kaum fassen. Könnte ihr geliebter Walter noch leben?
Autorin
Anne Jacobs begeisterte bereits mit ihrer Trilogie um Die Tuchvilla die Leser und stürmte die Bestsellerlisten. Mit Das Gutshaus knüpft sie an ihre Erfolgstrilogie an und erzählt von einem alten herrschaftlichen Gutshof in Mecklenburg-Vorpommern und vom Schicksal seiner Bewohner in bewegten Zeiten.
Weitere Informationen unter: www.anne-jacobs.net/
Von Anne Jacobs bereits erschienen:
Die Tuchvilla-Saga:
Die Tuchvilla
Die Töchter der Tuchvilla
Das Erbe der Tuchvilla
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ANNE JACOBS
Das
GUTSHAUS
Glanzvolle Zeiten
Band 1
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden.
Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Blanvalet
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Kristina Lake-Zapp
Covergestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
(© sam100; © puchan; © marilyn barbone; © Nejron Photo; © asife)
NG · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-18327-1V005
www.blanvalet.de
Franzi
November 1939
Der Frühnebel lag auf den abgeernteten Feldern wie eine milchige Schicht, waberte im Wind, ließ von Zeit zu Zeit eine Gruppe ahnungslos äsender Rehe sehen. Herbstbuntes Buschwerk ragte aus dem weißlichen Grund wie Inseln im wogenden Nebelmeer. Franziska ging als Letzte der Dreiergruppe, blieb immer wieder stehen, um die morgendliche Stimmung auf sich wirken zu lassen, die Feuchte des Nebels zu spüren, den pilzigen Geruch zu atmen, der vom Wald herüberwehte. Hinter ihnen erklangen jetzt Pferdehufe, das Gerassel einer Kutsche. Das war der Inspektor, der die »alten Herren« zum Hochsitz am Waldrand fuhr.
»Hoffentlich hat Großvater Wolfert diesmal seine Brille dabei«, sagte Jobst grinsend. »Letztes Jahr hat er lauter Streifschüsse gesetzt und einen Hund getroffen.«
Franziska schwieg – sie hatte es dem Großvater nicht verzeihen können. Ihre Hündin Maika ging seither lahm, sie hatte nur mit knapper Not überlebt, weil der Schuss ihr einen Hinterlauf zerschmettert hatte. Die beiden Geschwister mussten beiseitetreten, um die offene Kutsche mit den beiden Großvätern vorbeizulassen. Mamas Brüder, Onkel Bodo und Onkel Alwin, saßen ebenfalls im Wagen. Alle trugen regenfeste Jacken und Hüte, die schon so manche Jagd erlebt hatten. Onkel Alexander winkte ihnen zu, er war seit dem vergangenen Jahr noch dicker geworden.
»Alte Leute mit schwachen Augen sollten überhaupt nicht mehr jagen«, meinte Brigitte.
»Erklär das mal Großvater Wolfert.« Jobst lachte. »Der wird dir sagen, dass er schon Zwölfender geschossen hat, als du noch in den Windeln lagst.«
Jobst unternahm einen vorsichtigen Versuch, seiner Verlobten den Arm um die Schultern zu legen, sie entzog sich ihm jedoch mit Blick auf Franziska. Ein junges Paar durfte bis zum Hochzeitstag so gut wie niemals miteinander allein sein, daher hatte Mama dafür gesorgt, dass Franziska ihren Bruder Jobst und seine Verlobte Brigitte von Kalm als Anstandsdame begleitete.
Franziska war erst neunzehn, sie fühlte sich grauenhaft in dieser Rolle. Überhaupt mochte sie diese Treibjagden nicht, bei denen das Wild den Jägern schussgerecht vor die Flinten gehetzt wurde. Viel schöner war es, am frühen Morgen allein mit dem Vater durch den Wald zum Hochsitz zu gehen. Dann spürte man das taufeuchte Gras, roch den süßen und würzigen Atem der Pflanzen, hörte mit geschärftem Ohr den Tritt eines Rehbocks im Vorjahreslaub. Wenn nach langem Warten in der knisternd lebendigen Morgenstille ein Rudel Hirschkühe zögernd die Lichtung betrat, blickte sie in das Gesicht des Vaters, versuchte, seine Absicht zu erraten. Selten schossen sie ein Tier, fast immer saßen sie auf dem Hochsitz, um zu beobachten, den Bestand zu überwachen.
»Der Nebel hebt sich«, bemerkte Jobst. »Gott sei Dank. Sonst hätten wir einpacken können.«
Sie hatten den Waldrand erreicht und nahmen den Pfad zum Hochsitz am Kreuzweg. Es war kurz vor neun, vermutlich würde bald die Sonne durch die Wolken brechen, dann legten die Treiber los, die jetzt noch mit den Hunden an drei verschiedenen Orten warteten, bis die Jäger ihre Standorte erreicht hatten.
Jobst stieg als Erster die Leiter hoch, Brigitte folgte ihm, ergriff seinen ausgestreckten Arm und ließ sich das letzte Stück hinaufhelfen. Franzi wartete, bis beide halbwegs bequem auf der rohen Holzbank Platz genommen hatten, dann stieg auch sie hinauf in den engen Verschlag. Jobst und Brigitte luden ihre Gewehre, Franziska war ohne Jagdwaffe. Sie hatte wenig Lust, sich an der allgemeinen Schießübung zu beteiligen. Wenn nur ihren Hunden nichts passierte! Oder, was noch schlimmer war: wenn nur keiner der Treiber getroffen wurde. Das passierte immer wieder. Einer ihrer Stallknechte hatte als junger Mann einen Schuss in den Oberschenkel bekommen, ein junger Bauer sollte vor vielen Jahren sogar versehentlich erschossen worden sein. Gewiss sorgte der Gutsherr in solchen Fällen für die Verletzten und auch für die Hinterbliebenen – aber schlimm war es trotzdem und peinlich genug für den unglücklichen Schützen.
»Es geht los …«, murmelte Jobst.
Brigitte nickte. Man konnte den Lärm der Treiber und das Gekläff der Hunde in der Ferne hören. Schüsse waren zu vernehmen, es klang nach Onkel Alexanders alter Jagdbüchse, Großvater Dranitz’ Gewehr war auch dabei. Die Treiber scheuchten alles auf, was sich im Dickicht von Wald und Buschsenken versteckt gehalten hatte: Damwild, Rotwild, Füchse, Hasen, auch Schwarzwild und Rebhühner. Ein Fest für die Flinten, man freute sich das ganze Jahr darauf. Auch wurde das erlegte Wild später ehrlich unter den Jägern aufgeteilt, sodass dem ausgiebigen Jagdessen auf Gut Dranitz meist noch opulentere Mahlzeiten daheim mit guten Freunden und Verwandten folgten.
Den Hochsitz beim Kreuzweg schienen die Treiber jedoch vergessen zu haben. Trotz angespannten Wartens und intensiven Starrens ins Unterholz bemerkten sie nur zweimal eine kurze Bewegung – vermutlich Schwarzwild, das beschlossen hatte, sich besser im Dickicht zu verbergen als in wilder Panik über die Lichtung zu rennen. Sie waren schlau, die Wildschweine. Leider richteten sie in den Feldern häufig Schäden an, deshalb musste ein Teil von ihnen abgeschossen werden.
»Schade!«, seufzte Brigitte von Kalm und löste sich aus ihrer Starre. »Ich glaube, das war’s. Hoffen wir, dass die anderen mehr Jagdglück hatten.«
»Am Ende hat Franzi uns das Wild vertrieben«, scherzte Jobst. »Fräulein Diana mag es nämlich gar nicht, wenn ein Tier des Waldes geschossen wird!« Er packte seine Schwester an der Schulter und schüttelte sie sacht, genau wie er es früher als Junge so oft gemacht hatte.
Franziska stieß ihn lachend zurück. »Jetzt kann ich es euch ja verraten: Ich habe den Hochsitz mit einem Zauberbann belegt!«, rief sie ohne Rücksicht auf Brigittes gerunzelte Stirn.
Franziska mochte ihre künftige Schwägerin nicht besonders. Brigitte war eine jener Frauen, die wenig redeten, aber ganz genau wussten, was sie wollten. Wieso ihr gut aussehender älterer Bruder Jobst, der Erbe von Dranitz, sich ausgerechnet diese wenig attraktive Person ausgesucht hatte, würde sie wohl nie begreifen. Aber das war schließlich seine Angelegenheit.
Franziska stieg als Erste die Leiter hinunter und ging, ohne sich umzuschauen, mit langsamen Schritten den Waldweg in Richtung Gutshof. Sie gönnte den beiden die Gelegenheit, wenigstens kurz miteinander allein zu sein. Seit September befand sich Deutschland im Krieg, der Leutnant Jobst von Dranitz würde gleich morgen gemeinsam mit einem Kameraden gen Osten zu seinem Regiment reisen.
»Krieg oder Frieden!«, hatte Großvater Dranitz gebrüllt. »Die alten Traditionen auf Dranitz lassen wir uns nicht nehmen. Und schon gar nicht die Treibjagd.«
Kurz bevor der Waldweg in den Acker einmündete, brach ein Rudel Rothirsche aus dem Gehölz und rannte quer über den Weg auf die andere Waldseite. Franziska blieb wie gebannt stehen. Sieben Hirschkühe und mehrere halbwüchsige Kälber zogen wie ein Spuk an ihr vorüber und ließen den Waldboden für Sekunden vibrieren – ein Tanz von Kraft und Schönheit im schräg durch die Bäume fallenden Morgenlicht. Weder Jobst noch Brigitte hatten davon etwas mitbekommen, sie waren immer noch oben auf dem Hochsitz, und Franziska wollte sich besser nicht vorstellen, was die beiden dort miteinander taten.
Beim Waldrand hatten die Treiber inzwischen das erlegte Wild zusammengetragen: drei Hirsche, sechs Hirschkühe, mehrere Wildschweine – alles Bachen – sowie zwei Füchse, und den ordentlich aufgereihten leblosen Tieren den »letzten Bissen« in die Mäuler gesteckt. Die stolzen Jäger standen daneben, gestikulierten, rauchten und gratulierten einander. Als Jobst und Brigitte endlich auftauchten, wurden sie allseits bedauert, da ihnen kein einziges Wildbret vor die Flinte gekommen war. Kurz darauf bliesen die Hörner das Signal zum Ende der Jagd.
»Jetzt kommt der gemütliche Teil!«, freute sich Onkel Alexander von Hirschhausen, den Onkel Bodo und Onkel Alwin nur mit Mühe auf den Hochsitz beim Rotforst gewuchtet hatten. Einmal oben angekommen, erwies sich Alexander als ausgezeichneter Schütze. Er verfügte als Einziger über ein Bocksgewehr, das er sich in Österreich hatte anfertigen lassen.
Inspektor Schneyder kümmerte sich um den Transport der Jagdbeute, die Entlohnung der Treiber und alles andere, während die Jagdgesellschaft die inzwischen vorgefahrenen Kutschen bestieg. Nach dem anstrengenden Weidwerk galt es nun, das wohlverdiente und bekanntermaßen üppige Jagdessen im Gutshaus einzunehmen.
Schon seit Tagen waren die Vorbereitungen auf Gut Dranitz in vollem Gange. Trotz Mamas umsichtiger Planung war es jedes Jahr das gleiche aufregende Durcheinander: Mal kamen unerwartete Gäste, mal erkrankte ein Familienmitglied oder ein Angestellter, das Bier wurde nicht rechtzeitig geliefert, die Mäuse hatten einen Sack Mehl angefressen oder der Hund stahl eine der Hammelkeulen, weil das Küchenmädchen nicht aufgepasst hatte. Bekanntermaßen waren an solchen Unglücksfällen immer die Küchenmädchen oder die Burschen schuld, niemals aber die Köchin oder gar die Gutsherrin. Doch trotz aller Widrigkeiten gelang es jedes Jahr aufs Neue, die zahlreichen Verwandten und Freunde in den Räumen des Gutshauses einigermaßen bequem einzuquartieren und sie mit einem guten Frühstück zu stärken, bevor sich einige von ihnen – vor allem die männlichen Gäste – dem kräftezehrenden Vergnügen der Treibjagd widmeten. Die übrigen Gäste – meist die Damen – saßen währenddessen bei Kaffee und Gebäck zusammen und plauderten über allerlei Dinge, die besser unter Frauen beredet und beschlossen wurden. Heiratsverbindungen waren ein beliebtes Thema, genau wie bevorstehende Geburten oder das Schicksal erkrankter Familienmitglieder, aber auch Urlaubsreisen an die Ostsee oder die Frage, ob ein junges Mädel heutzutage noch in ein Pensionat gegeben werden sollte. Dem folgten unweigerlich die Klagen über die Dienstboten. Die Damen waren sich einig, dass die Hausmädchen heutzutage von unfassbarer Impertinenz waren und auch die Burschen immer frecher wurden. Hatten sie sich genügend beklagt, kamen die neuen Moden und verfallenden Sitten in der Hauptstadt Berlin zur Sprache und in diesem Jahr auch der Krieg. Doch der nur am Rande, denn da nun Polen erobert und der Vertrag von Brest-Litowsk mit den Russen geschlossen war, durfte man auf baldigen Friedensschluss hoffen. Den Westmächten hatte Hitler sowieso einen dauerhaften Frieden angeboten, das hatte in der Zeitung gestanden. Großmutter Libussa von Dranitz bedauerte jedes Jahr aufs Neue, dass die Zeiten leider nicht mehr heroisch, sondern so schrecklich prosaisch geworden seien. Weder dieser Emporkömmling Hitler noch der kleine Russe Stalin besäßen etwas von dem Herrschaftsglanz früherer Epochen, als noch die Nachkommen der englischen Königin Victoria Europa regierten und Deutschland einen Kaiser hatte.
Währenddessen wurde unten in der Küche und drüben im Saal fieberhaft gearbeitet, um das Jagdessen zur rechten Zeit servieren zu können. Längst war das Frühstücksgeschirr abgetragen, der lange Tisch fürs Festessen gedeckt und – wie es die Tradition erforderte – mit buntem Herbstlaub und Tannengrün geschmückt. Auch der große »röhrende Hirsch« aus Bronze kam wieder zu Ehren, er thronte in der Mitte des langen Tisches. Die Baronin von Dranitz selbst gab der Tafel den letzten Schliff, sie ging von Gedeck zu Gedeck, rückte das silberne Besteck gerade, drehte den grün geblümten Porzellanteller so, dass das silberfarbige Wappen auf dem Rand genau mittig war, hob hie und da eines der Weingläser aus schwerem Bleikristall an, um es gegen das Licht zu halten, und legte schließlich ein kleines Namensschild zu jedem Gedeck.
Wenn dann die ersten Jäger aus den Kutschen stiegen, beeilten sich die Damen, in die Zimmer im ersten Stock hinaufzusteigen und die für das gemeinsame Festessen passende Kleidung anzulegen. Von allen Seiten ertönten Rufe und Befehle an die mitgebrachten Dienstboten, was das Durcheinander im Haus vollends zum Chaos werden ließ. Unten im Eingang standen wohl zwanzig Paar schlammverschmierter Stiefel, die man den Herren Jägern von den Füßen gezogen hatte, oben riefen weibliche und männliche Stimmen nach warmem Wasser, einem Bügeleisen, einer Brennschere oder irgendwelchen Herztropfen. Gleichzeitig drang aus der Küche ein so überwältigend köstlicher Duft, dass allen, auch den Damen, das Wasser im Mund zusammenlief. Hanne Schramm, die Köchin auf Gut Dranitz, war eine Künstlerin – an einem Tag wie heute würde sie wieder einmal Unvergessliches auf die Tafel bringen, und wie immer würde Tante Susanne versuchen, sie dem Gut Dranitz abspenstig zu machen. Selbstverständlich ohne Erfolg – Hanne war eine treue Seele, niemals hätte sie ihre Herrschaft im Stich gelassen.
Franziska sah zuerst nach ihren Hunden, die zum Glück vollzählig von der Jagd zurückgekehrt waren. Bijoux hatte sich einen Dorn in die Pfote getreten, den sie vorsichtig herauszog. Anschließend desinfizierte sie die Wunde und stellte erleichtert fest, dass es keine weiteren Blessuren gab. Oben in ihrem Zimmer, das sie sich heute mit der kleinen Schwester Elfriede und Cousine Gerlinde teilen musste, war inzwischen ein heftiger Streit um ein Paar hellbeiger Sandalen entbrannt, die Gerlinde angeblich Elfriede für den Abend versprochen, nun aber doch lieber selber anziehen wollte. Franziska, die sechs Jahre ältere, versuchte zu schlichten, versprach Elfriede, ihr die Pumps zu leihen, die mindestens ebenso gut zu ihrem Kleid passen würden. Elfriede war ein kleiner Zankteufel, sie kreischte und spuckte Gerlinde an, und als diese nicht nachgab, warf sie ihr die Streitobjekte an den Kopf. »Dann nimm du sie halt!«, schrie sie erbost. »Ob mit oder ohne Schuhe – hässlich bist du sowieso!«
Worauf nun Gerlinde zu weinen begann und drohte, alles ihrer Mama zu erzählen.
»Jetzt zieht euch endlich fertig an«, befahl Franziska den beiden. »Unten hat Mine schon das erste Mal geläutet.«
Mine, das Hausmädchen, war die Flotteste unter den Angestellten. Sie war überall, half in der Küche und oben in den Zimmern, bügelte die Feinwäsche und wusste, wie ein festlicher Tisch gedeckt werden musste. Seit drei Jahren war sie mit dem Stellmacher Schwadke verlobt, aber sie zögerte mit der Heirat, weil sie dann ihre Stellung hätte aufkündigen müssen.
Franziska wusch sich Gesicht, Arme und Füße mit kaltem Wasser, zog das dunkelgrüne Kleid mit dem breiten Kragen an und dazu Sandalen, denn die Pumps trug nun Elfriede, obgleich sie ihr beinahe zwei Nummern zu groß waren. Elfriede war erst dreizehn und dünn wie ein Fädchen. Sie hatte blasse, sommersprossige Haut, den Kopf voller krauser, kupferroter Locken und verträumte braune Augen, die jedoch eine enorme Willenskraft ausstrahlen konnten.
Gemeinsam stiegen die drei Mädchen die Stufen hinunter, trafen dabei auf Großmutter Wolfert und Libussa von Dranitz und hakten die alten Damen unter, um ihnen das Treppengehen zu erleichtern. Rechts und links eilten geschäftig die Stubenmädchen und Hausburschen vorbei, Onkel Alexander rief in volltönendem Bass nach seiner langen Unterhose, Gerlindes Zwillingsbruder Gabriel schickte sich an, das Treppengeländer hinunterzurutschen, wurde dabei allerdings von Papa erwischt und am Hosenbund gepackt. »Wenn du dir unbedingt den Schädel aufschlagen willst, dann tu das daheim, aber nicht in meinem Haus!«, schimpfte der Baron von Dranitz und verdrehte die Augen, weil Gabriel schon wieder in Tränen ausbrach.
Es dauerte trotz Namensschildchen eine gute Weile, bis alle ihren Platz an der Tafel gefunden hatten und der Aperitif, den Großmutter Libussa immer »Vortrunk« nannte, ausgeschenkt war. Die Männer bevorzugten den »ehrlichen« Dranitzer Korn, die Damen neigten eher zu einem trockenen Sherry. Jugendliche bekamen »Gänsewein« eingeschenkt, das war reines Wasser mit einem Spritzer Zitronensaft.
Papa hatte Mitleid mit den hungrigen Gästen – er hielt seine Begrüßungsansprache und die Glückwünsche an die erfolgreichen Jäger kurz, sodass man gleich die Austernsuppe servieren konnte. Mine und Liese trugen das Essen auf, sie wurden von zwei jungen Burschen unterstützt, die Onkel Alwin aus Brandenburg mitgebracht hatte. Sie trugen eine schwarz-weiß gestreifte Livree, dazu weiße Hosen und machten ihre Sache sehr gut.
Franziska unterhielt sich mit Tante Susanne und Gerlinde, schwatzte ein wenig mit Onkel Alwin und Onkel Bodo von Wolfert. Franziskas Bruder Heinrich-Ernst, den alle nur »Heini« nannten, hatte sich mit der immer noch nörgelnden Elfriede zusammengetan, die beiden waren schon immer ein Herz und eine Seele gewesen. Am Kopfende des Tisches saßen Mama und Papa, rechts und links von ihnen die jeweiligen Großeltern, auch der alte Pastor Hansen hatte dort seinen Platz. Großmama Libussa hatte ihre einzige Tochter an ihrer Seite, die zu den Zisterzienserinnen gegangen war. Maria von Dranitz war klein und dünn, ihr von einer weißen Haube umrahmtes Gesicht hatte Ähnlichkeit mit einer Spitzmaus. Papa hatte einmal in Weinlaune gesagt, dass seine Schwester Maria im Kloster gut aufgehoben sei, sie hätte ja sowieso »keinen abgekriegt«. Heute hatte Maria die Erlaubnis zu einem Familienbesuch erhalten, allerdings nicht über Nacht, sie musste gegen sechs Uhr zurück im Kloster sein.
Zum Fischauflauf wurde ein leichter Weißwein serviert, den Franziska sehr liebte. Hatte sie ein wenig zu hastig getrunken? Sie fühlte sich schwindelig, und zugleich überkam sie ein wohliges Glücksgefühl. Lächelnd lehnte sie sich im Stuhl zurück und überließ sich den Geräuschen und Bildern. Das Stimmengewirr, aus dem immer wieder ein kräftiger Bass oder ein energischer Sopran herausstachen, die wohlige Wärme im Saal, das Funkeln der Gläser und blank geputzten Bestecke, der Duft der Hammelkeule mit Weißkohl und der gepökelten Gänsebrüste. Das Gelächter drüben bei den Brüdern von Wolfert, die mit Papa, dem Inspektor Schneyder und Onkel Alexander zusammensaßen und Jagdgeschichten zum Besten gaben. Jobst und Brigitte, die verliebte Blicke tauschten, und Mama, die sich lautstark mit Tante Irene und Großmutter Wolfert über die anstehende Renovierung des grünen Salons austauschte. All diese lauten, fröhlichen Menschen, die, angeregt von Wein und deftigen Speisen, mit rosigen Gesichtern an der langen Tafel saßen und den Saal bis in die letzte Ecke mit ihrer Lebendigkeit erfüllten. Gleich würde Großvater Dranitz aufstehen und seine gewohnte Rede auf das Vaterland und die Heimat Mecklenburg halten, dann würde er sein Glas erheben, und alle mussten auf den deutschen Kaiser trinken, der im holländischen Exil schmachtete. Auch Bodo und Alwin, die begeisterte Anhänger des Führers waren, tranken mit, weil sie dem alten Herrn nicht widersprechen mochten.
»Morgen früh wird ein Freund von mir hereinschneien, bevor wir gemeinsam losziehen«, sagte Jobst zu Tante Susanne. »Major Walter Iversen ist ein großartiger Kerl. Er wäre der richtige Ehemann für Franzi.«
Franziska lachte ihn aus und hielt Mine den Dessertteller hin, die ihn mit gebratenen Äpfeln und Preiselbeeren füllte.
»Meine lieben Freunde und Anverwandten, die ihr mein Haus mit Lärm und Frohsinn erfüllt, unsere Wintervorräte vertilgt und meinen Weinkeller leert«, begann Großvater Dranitz in diesem Moment tatsächlich.
Das war der alte Herr, wie er leibte und lebte. Gelächter und fröhliche Zurufe wurden laut, die der Großvater mit einer energischen Geste zum Schweigen brachte, um seine Rede fortzusetzen.
Franziska sah lächelnd zu ihm hinüber und fühlte sich unfassbar glücklich.
Franziska
Mai 1990
Ihre Finger umkrampften das Lenkrad, als sich ihr Wagen dem Grenzübergang näherte. »Lauenburg/Horst« hieß er. Horst. Das klang nach einem Raubvogel, der hoch oben in seinem Nest hockte und beutegierig hinabspähte …
Jetzt geht die Fantasie mit mir durch, dachte sie und schaltete den Wagen einen Gang zurück. Cornelia hat recht – ich bin zu alt für solch eine Reise. Mit siebzig lässt alles nach, der Körper will nicht mehr wie früher, der Kopf ist langsamer. Was mache ich, wenn sie mich nicht durchlassen? Oder wenn sie mich festhalten? Junker und Großgrundbesitzer hatten das Land zu verlassen. Wer trotzdem blieb, dem drohten Gefängnis und Schlimmeres.
Sie riss sich zusammen und starrte auf die schmale, asphaltierte Straße, die rechts und links von verwildertem Gestrüpp und kleinen Bäumchen gesäumt war. Grün, das jetzt im Frühjahr reichlich spross, Wildnis, die im Niemandsland gedieh, wie sie Lust hatte. Es war kurz vor neun Uhr. Eine Menge Autos kamen ihr entgegen, Trabis, Wartburgs, aber auch Westautos. Das beruhigte sie – alles war gut, die Grenze war offen, kein Grund zur Panik. Jetzt tauchten flache Gebäude auf, grau, blitzende Fenster, stahlgefasst. Der Bundesadler grüßte. Die Zollgebäude der BRD hatten etwas Verschlafenes, ein Grenzbeamter hockte hinter der Glasscheibe und trank Kaffee, ein zweiter stand draußen, winkte hie und da ein DDR-Fahrzeug heraus, ließ sich die Papiere zeigen und schwatzte mit den Insassen. Seine Stimme klang fröhlich, gönnerhaft, ab und zu lachte er. Um Franziskas weißen Astra kümmerte sich niemand – also fuhr sie langsam durch.
Auf der anderen Seite der Grenze war die Straße aus großen, hellgrauen Platten zusammengesetzt, viele waren schadhaft, zum Teil eingesunken, Pfützen standen auf der Fahrbahn. Der Wagen holperte, schwere Arbeit für die Federung. Franziska schnupperte, nahm einen stechenden Geruch wahr und schaltete die Lüftung ab. Braunkohle. Cornelia hatte gesagt, da drüben stinke alles nach Braunkohle. Sogar die Klamotten, das Essen, die Bücher. Wenn man wieder heimkomme, müsse man sofort duschen und die Haare waschen. Der Bernd aus ihrer WG habe sogar Braunkohle gerülpst. Franziskas Tochter Cornelia war vor vier Jahren zu irgendeinem Juso-Treffen nach drüben gefahren, da waren die Grenzen noch geschlossen gewesen. Viel hatte sie nicht davon erzählt, nur ein paar witzige Begebenheiten. Vermutlich war sie enttäuscht gewesen, hatte sich vom real existierenden Sozialismus mehr erwartet, eine Art Paradies auf Erden. Vielleicht wurde sie nun ja endlich klug, ihre Tochter, sah ein, dass mit dem Kommunismus kein Blumentopf zu gewinnen war. Ihre Widerborstigkeit würde sich dadurch nicht geben, die hatte tiefere Gründe. Leider. Franziska ärgerte sich inzwischen darüber, der Tochter von dieser Fahrt erzählt zu haben. Innerlich aufgewühlt, wie sie war, hatte sie sogar gehofft, Cornelia würde sie auf der Reise in die Vergangenheit begleiten. Aber das war dumm gewesen. Die Tochter hatte sich nur mit dem Zeigefinger an die Schläfe getippt.
»Du spinnst ja. In deinem Alter. Dass du mit siebzig überhaupt noch Auto fährst. Und überhaupt – das ist doch alles weg. Abgefackelt. Eingestürzt. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, Franziska!«
Damit hatte sie 1968 angefangen, als sie Abitur machte. Da sagte sie auf einmal nicht mehr »Mama« und »Paps«, sondern »Franziska« und »Ernst Wilhelm«. Damals war der Riss entstanden, der während der folgenden Jahre immer tiefer wurde. Der Riss, der Mutter und Tochter voneinander trennte. Zwei Frauen, zwei Welten, zwei Weltanschauungen.
Franziska fuhr langsam weiter. Da waren sie nun also, die Grenzanlagen der DDR. Den Turm hatte sie längst gesehen. Schlank und weiß mit einer Verdickung an der Spitze, glich er dem Krähennest auf einem Schiff. Schossen die etwa von da oben auf Flüchtlinge? Ach, jetzt doch nicht mehr. Die Grenzen waren schon seit Monaten offen. Man mochte es nur noch nicht so recht glauben.
»Grenzkontrollstelle Lauenburg« war auf dem Schild zu lesen. Die Anlage dahinter war aufwendig. Die Straße teilte sich in mehrere Fahrspuren, unter schwebenden, weißen Dachkonstruktionen befanden sich niedrige Glasbauten, in denen Grenzbeamten saßen. Grelles Flutlicht ließ jede Einzelheit an den vorüberrollenden Fahrzeugen erkennen, jeden Insassen wie auf einem Foto hervortreten, vermutlich konnten die Grenzer selbst die Staubkörner auf den Armaturen zählen. Rechts und links wurde die Anlage von gelb-weißen Gebäuden begrenzt, auch sie waren mit großen Glasflächen ausgestattet und sehr eindrucksvoll. Franziska hatte gehört, dass hier Gepäckstücke durchwühlt wurden, Autos auseinandergebaut, Gegenstände konfisziert. Vor allem wenn West-Besucher aus der DDR in die BRD zurückkehrten. Weil die Grenzer glaubten, die Wessis hätten irgendwo im Auto einen Republikflüchtling versteckt. Angeblich hatten sie auch Leibesvisitationen vorgenommen, bis in die intimsten Körperstellen. Und sie hatten Leute festgenommen. Vor allem ihre eigenen. Aber manchmal auch einen aus dem Westen …
Franziska wurde flau, obgleich sie wusste, dass das alles vorbei war. Man konnte die Grenze ungehindert passieren, es sei denn, man ließ sich mit einem Koffer voll Rauschgift oder einem Behälter Plutonium erwischen. Oder man war eine von Dranitz, die Tochter eines adeligen Junkers und brutalen Ausbeuters der abhängigen Landbevölkerung. Großer Gott – wie zynisch sie doch war!
An der Kontrollstelle herrschte zähflüssiger Verkehr, die Trabis und Wartburgs rollten einfach durch in Richtung Westen, hielten nicht einmal an, nur zwei Lastwagen standen seitlich auf einem Parkplatz und wurden untersucht. Ein stämmiger junger Grenzbeamter mit grüner Schirmmütze trat zu ihrem Opel Astra, verlangte, dass sie den Motor ausstellte, und ließ sich ihren Reisepass zeigen. Der junge Mann sah missgelaunt aus, vermutlich war er mit der politischen Entwicklung der vergangenen Monate nicht einverstanden, fürchtete um seine Machtstellung, seinen Job. Er starrte sie einen Moment lang an, verglich die vor ihm sitzende Frau mit dem Passbild in seiner Hand und meinte, sie müsse dringend das Foto erneuern lassen. Anschließend klappte er das Dokument wieder zu und reichte es ihr schweigend.
Sie nahm es an sich und griff zweimal an der neben ihr auf dem Beifahrersitz stehenden Handtasche vorbei, bis es ihr gelang, den Pass darin zu versenken. Wie albern sie sich anstellte! Ihr Herz hämmerte, als habe sie gerade einen Hundert-Meter-Sprint hinter sich gebracht. Der grünbemützte Grenzer bedeutete ihr ungeduldig, endlich weiterzufahren. Franziska ließ den Motor an, würgte ihn ab, startete zum zweiten Mal und fuhr beschämt und zornig über sich selbst in das verbotene Land hinein. Gen Osten. Zurück in die Vergangenheit.
Die Grenzer haben ihre Anweisungen, dachte sie. Keine Gespräche mit Leuten aus dem Westen. Das haben sie verinnerlicht. Auch jetzt noch. Allerdings hätte er doch ein wenig höflicher sein können. Das Foto im Reisepass war jetzt sieben Jahre alt. Damals war sie Anfang sechzig gewesen, und so sehr hatte sie sich in dieser Zeit nun auch nicht verändert. Sie war nicht groß, trug das ergraute Haar in kurzen Locken und hatte die typische Nase derer von Dranitz: schmal und ein wenig gebogen. »Edel« – das war die Bezeichnung ihrer Mutter gewesen. Irgendwo in der Vorfahrenreihe steckte ein polnischer Graf. Ernst-Wilhelm, Franziskas verstorbener Mann, hatte nur »scharf« dazu gesagt und gegrinst. Cornelia, die die Nase ihres Vaters geerbt hatte, behauptete, für die Dranitz’sche Nase brauche man einen Waffenschein. Damit hatte sie sich die Gunst ihrer Großmutter verscherzt, doch Margarethe von Dranitz hatte sowieso Ende der Sechziger das Zeitliche gesegnet.
Die Aufregung legte sich nur langsam. Franziska fuhr in einen Feldweg hinein, hielt an und suchte in ihrem Picknickkorb nach der Wasserflasche. Nach einigen großen Schlucken ging es ihr besser, der Herzschlag normalisierte sich, das Zittern verging. Die erste Hürde hatte sie genommen, zwar nicht gerade mit Bravour, aber immerhin. In Zukunft würde sie sich nicht mehr so leicht ins Bockshorn jagen lassen. Was hatte sie eigentlich zu verlieren? In ihrem Alter? Gar nichts. Sie war frei, niemand hatte ihr Vorschriften zu machen, sie war finanziell unabhängig, und sie würde tun, was sie sich vorgenommen hatte. Und wenn es enttäuschend war, niederschmetternd, desillusionierend, dann war es eben so. Dann hatte sie es aber getan. Und allein darauf kam es an.
Die Maisonne meinte es gut. Franziska öffnete die Wagentür und atmete tief die frische Landluft ein. Nun ja – es roch schon etwas nach dieser verflixten Braunkohle. Eine stechende Mischung aus Holz und schwelendem Torf. Die Wiesen standen in hellgrünem Saft, waren während der Regentage üppig hochgeschossen und glänzten jetzt im Morgenlicht. War das ein Dorf dort hinten? Oder eine Fabrik? Vielleicht auch eine dieser landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, wie nannten sie die doch gleich? LPG – »Lauter Pleite-Geier«, wie Ernst-Wilhelm einst zu scherzen pflegte. Sie nahm einen weiteren Schluck Wasser, schraubte den Deckel zu und steckte die Flasche zurück in den Korb. Den hatte sie vor Jahren von ihrem Mann zu Weihnachten bekommen – ein Picknickkorb mit Plastiktellern, Bestecken, verschließbaren Schüsseln, einer Tischdecke und passenden Stoffservietten. Ein paarmal waren sie mit Cornelia und ihren Freundinnen in den Taunus gefahren, da hatte sie am Tag zuvor Schnitzel gebraten und Kartoffelsalat gemacht. Später wollte Cornelia nicht mehr mitkommen, und Franziska fuhr mit Ernst-Wilhelm an den Rhein. Ohne Picknickkorb, zu dieser Zeit lief ihr Getränkehandel gut und sie wollten sich am Sonntag etwas gönnen. Rheinfellchen, Prinzessböhnchen und neue Kartoffeln, hinterher Eis mit heißen Himbeeren. Dazu einen trockenen Riesling.
Ernst-Wilhelm hätte vermutlich versucht, sie von dieser Fahrt abzuhalten. Er mochte es nicht, wenn sie von Gut Dranitz sprach, konnte auch das alte Foto nicht leiden, das gerahmt über dem Klavier hing. »Vorbei ist vorbei«, sagte er immer. »Wir leben hier und jetzt und wir leben nicht schlecht.«
1980 starb er an einem hinterhältigen Prostatakrebs, der zu spät entdeckt wurde. Franziska pflegte ihn ein Jahr lang, Cornelia ließ sich bis zuletzt nicht blicken. Sie steckte damals in einer schwierigen Beziehungskrise, außerdem lernte sie für ihr Staatsexamen und musste sich um ihre elfjährige Tochter kümmern. Sie kam immerhin zur Beerdigung ihres Vaters und brachte Jenny mit. Franziska sah ihre Enkeltochter damals zum ersten Mal – das Mädel hatte ein ernstes, blasses Gesicht, die Dranitz’sche Nase und kupferrote Locken. Elfriedes Haar. Franziska hütete sich, Cornelia zu sagen, dass Jenny ihrer verstorbenen Schwester ähnelte. Der Anlass des Treffens war nicht dazu angetan, und außerdem hatte Cornelia es eilig, wieder abzureisen. Sie hatte einen alten WG-Partner wiedergetroffen, und die beiden wollten »ihren Krempel zusammenwerfen«.
Franziska tat es weh, die Enkelin gleich wieder zu verlieren. Das Mädel war neugierig gewesen, hatte ihre Nähe gesucht. Vermutlich fehlte es der Kleinen an Geborgenheit, kein Wunder, wenn die Mutter sie von WG zu WG schleppte. Aber da war sie natürlich restlos altmodisch. Cornelia hatte ihr erklärt, dass Kinder Bezugspersonen brauchten, das könne jeder sein, nicht unbedingt die Eltern. Und überhaupt sei das Wichtigste zwischen Kind und Bezugsperson schon während der ersten sechs Lebenswochen passiert. Was Kinder ganz bestimmt nicht brauchten, sei ein miefiges Wohnzimmer, Stoffgardinen, Häkeldeckchen und eine überbesorgte, weil sexuell unbefriedigte Mutter. Mit Rücksicht auf den Anlass der Begegnung hatte Franziska auf eine Antwort verzichtet.
Sie musste sich nach Norden orientieren, nahm die holperige Landstraße über Camin nach Wittenburg, irrte von Dorf zu Dörfchen am Dümmer See vorbei und hatte das Gefühl, hier sei die Zeit stehengeblieben. Schön war es: blinkendes Wasser, Uferschilf, kleine Fischerboote, die auf dem See dümpelten, und das frische Lindgrün des Frühlings, das jetzt aus allen Ästen und Zweigen drängte. Wiesenblumen, gelb, lila, weiß. Wo gab es das im Westen noch? Rehe standen an den Waldrändern, ästen am späten Morgen in aller Gemütsruhe auf sprießenden Äckern, niemand störte sie, kein Spaziergänger, kein Hund, kein Jäger. Die Landschaft ihrer Kindheit. Unfassbar weit, kleine Wäldchen am Horizont, die dunkle Form der Seen, bei gutem Wetter ragten die Kirchtürme der umliegenden Dörfchen über die Hügel. So war der Blick aus ihrem Kinderzimmer gewesen.
Die Dörfer waren fast unverändert, hinzugekommen waren einige große, hässliche Bauten, die die Aufschrift »Kulturhaus« trugen. Sie passten nicht zu den niedrigen Backsteinhäusern, die meist noch wie früher mit Reet gedeckt waren. In den Bauerngärten sah man Beete mit Rüben, Sellerie, Lauch und allerlei Kräutern, außerdem ein paar Fleißige Lieschen in Töpfen auf den Fensterbrettern. Etwas verkommen wirkten die Dörfer schon. Viele Hausdächer waren eingesunken, von den Mauern der wenigen neuen Gebäude blätterte der Putz, der Anstrich der Zäune war überall verblasst. Nur selten liefen Hühner oder Ziegen auf der breiten Dorfstraße, wie es früher der Fall gewesen war. Was nicht hieß, dass Franziska diesen Zustand vermisst hätte – sie hatte als Kind erlebt, wie ihr Kutscher mit einem Bauern wegen eines totgefahrenen Huhns stritt und die beiden schließlich sogar handgreiflich wurden. Sie war damals vier oder fünf Jahre alt gewesen, und sie hatte vor den wütend schimpfenden, mit Fäusten gestikulierenden Männern solche Furcht gehabt, dass sie sich in der Kutsche unter einer Wolldecke versteckte.
Nun fuhr sie an Schwerin vorbei Richtung Osten. Auf den Straßenschildern erschienen die Ortsnamen ihrer früheren Heimat. Crivitz, Mestlin, Goldberg … Kichernd überließ sie sich ihren Erinnerungen. Da hatte die kleine Schwester Elfriede doch tatsächlich an einen goldenen Berg geglaubt und gefragt, ob man sich davon etwas abbrechen dürfe. Alle in der Kutsche hatten laut gelacht, während Friedchen erschrocken und verlegen dreinschaute. Später hatte die Mutter das Fräulein – Gott, wie hatte das Kindermädchen noch gleich geheißen? Stiller, Steltner, Sellner? –, nun, auf jeden Fall hatte Mutter es getadelt, weil es den Mädchen so viele Märchen erzählte.
Es war nicht viel los hier auf dem Land, nur hie und da entdeckte Franziska einen Traktor mit Anhänger, der irgendeine Flüssigkeit über die junge Saat sprühte. Manchmal kam ihr ein Westauto entgegen, ein Mercedes oder Audi, meistens schwarz. Im Gegensatz zu den DDR-Wagen rauschten sie angenehm leise durch die maiengrünen Alleen. Die Insassen – meist nur ein einzelner Fahrer – schienen an der aufblühenden Natur und den malerisch vernachlässigten Dörfchen wenig Interesse zu haben.
Beim Seniorenkaffee der Kirchengemeinde in Königstein hatten sie davon geredet, dass der Osten jetzt ausverkauft würde. Die Ostler gaben ihre antiken Möbel »für ’nen Appel und ’n Ei« her und bestellten sich stattdessen Sofas mit Jeansbezug bei Quelle. Früher hatte man ja Päckchen mit Kaffee, Mehl, Zucker und Wolle zum Stricken »nach drüben« in die »Ostzone« geschickt. Später schrieben einige, das hätten sie jetzt selber. Sie wollten fetzige Schnitte zum Nähen, Jeansjacken, Nutella und Prinzenrolle. So dreist waren die geworden, stellten Forderungen. Die abgelegten Kleider und Schuhe wollten sie auch nicht mehr haben.
Aber jetzt war sowieso Schluss mit den Päckchen, nun konnten die lieben Verwandten ja in den Westen fahren und sich ihre Wünsche selbst erfüllen. So mancher Westler war von Ossi-Besuch überrascht worden, es klingelte an der Tür, und Onkel Rudi aus Chemnitz stand davor, strahlte vor Wiedersehensfreude und schob seine fünfköpfige Sippe über die Schwelle. Solche Besuche konnten sich wochenlang hinziehen und die Gastgeber nervlich und finanziell bis an die Grenzen strapazieren …
Franziska hatte keinen Besuch bekommen, sie hatte auch keine Päckchen gepackt. Die von Dranitz, von Wolfert, die von Hirschhausen – es gab sie nicht mehr im Osten. Höchstens noch die früheren Angestellten, aber zu denen hatte sie nie Kontakt aufgenommen. Als ihre Mutter Margarethe noch lebte, hatte man sich zweimal in Hamburg zu Familientreffen versammelt, einige Cousins und entfernte Cousinen aus der Von-Wolfert-Sippe waren erschienen, auch der alte Alexander von Hirschhausen und der Kutscher Josef Guhl, der sie 1946 bis Hamburg begleitet hatte. Mutter hatte ihr ans Herz gelegt, die Familie trotz aller Widrigkeiten zusammenzuhalten.
»Ohne Familie bist du niemand«, hatte sie gesagt. »Über Jahrhunderte hinweg haben wir zueinander gestanden, schwere Zeiten überdauert. Wer zu Wohlstand kam, der stützte diejenigen, die in Not waren, wer Verbindungen hatte, der setzte sie für das Fortkommen der jungen Leute ein. Man muss nicht jedes Familienmitglied lieben – aber dennoch bilden sie alle zusammen eine große Gemeinschaft, einen sicheren Hort.«
Franziska hatte damals darüber gelächelt. Diese Philosophie schien ihr nicht mehr in die Zeit zu passen, schon gar nicht in das brodelnde, wimmelnde Leben der Großstadt Frankfurt. Zudem hatte Ernst-Wilhelm mit ihrer »adeligen Sippschaft« schon immer Probleme gehabt, und so hatte sie zum Kummer ihrer Mutter kein weiteres Familientreffen in Hamburg besucht. Viele hatten ohnehin nicht mehr stattgefunden – vermutlich dachten ihre Cousins und Cousinen ähnlich wie sie selbst.
Malchow. Waren an der Müritz. Die Binnenmüritz wie ein weites Meer, kleine Wellen, die ins Ufergras schwappten. Hier hatte sich kaum etwas verändert. Das Herzklopfen kehrte zurück. Unruhig krampfte Franziska die Finger ums Lenkrad, damit sie nicht zitterten. Es war nicht mehr weit.
Sie wappnete sich. Sie würde eine Enttäuschung erleben, da war sie sich ganz sicher. Die Frage war nur, wie schlimm es aussah. Möglich, dass nichts mehr übrig war. Kein Stein mehr auf dem anderen. Alles verfallen, zugewachsen, von Gestrüpp überwuchert …
Links ab Richtung Vielist, die alte Straße hoch. Ein paar Bäume am Straßenrand waren gefällt worden, Schlaglöcher reihten sich aneinander wie früher – schlimmer sogar, damals hatte man immer mal wieder Schotter hineingekippt. Erinnerungen überrollten sie wie eine gewaltige Welle. Franziska sah ein Wehrmachtsfahrzeug heranbrausen, auf dem Rücksitz saß ein Major. Er hob die Hand, um sie zu grüßen, und fort war er. Ein Phantom aus der Vergangenheit.
1945 waren sie hier mit einem Planwagen unterwegs gewesen, um vor den Russen zu fliehen. Es war ihnen nicht gelungen.
Bei der großen Kastanie rechts ab, den Feldweg zwischen blühendem Weißdorn entlang und nichts erhoffen. Sie schaffte es nicht, trat auf die Bremse und starrte auf das Schild. Schief und halb verwittert hing es noch an dem Pfosten, den der Inspektor Schneyder damals hatte erneuern lassen. Vor gut fünfzig Jahren. »G… hof Dra… tz«, entzifferte sie. Gutshof Dranitz. Immerhin – das Schild war noch da.
Langsam fuhr sie weiter. Links hätte jetzt der Park auftauchen müssen, man sah jedoch nur eine Art Waldgebiet. Alles war zugewachsen. Hie und da hatte man Bäume gefällt, die Stümpfe, von Moos bedeckt, moderten vor sich hin. Unterholz gedieh an den gelichteten Stellen, schoss üppig auf, kleine Bäumchen rivalisierten um den freien Platz. Rechts waren niedrige Backsteinhäuser zu sehen, die gehörten zum Dorf Dranitz. Die Kirche mit dem spitzen Turm, auf dem ein goldener Hahn in der Sonne geblitzt hatte, war verschwunden. Sie hatten das Christentum abgeschafft in der DDR, da brauchten sie auch keine Kirchen.
Links lichtete sich jetzt der Wald, hier musste das Tor gewesen sein. Die herrschaftliche Toreinfahrt zur Kastanienallee. Fest gemauert und hell verputzt die Pfeiler, darauf saß je eine Kugel aus Stein, die einmal goldfarbig gewesen waren. Torflügel aus aufwendig gearbeitetem Schmiedeeisen, die jedes Frühjahr entrostet und neu gestrichen werden mussten. Nichts davon war übrig geblieben. Kein Pfosten, kein Stein, auch die Kugeln hatte der Zahn der Zeit gefressen. Die schöne Kastanienallee war ebenfalls verschwunden, hinter Kiefern und Buchenstämmen erkannte sie Gebäude.
Franziska kurbelte das Fenster hinunter, dennoch brauchte sie einige Sekunden, bis sie klar sehen konnte. Da waren tatsächlich Gebäude. Kein Zweifel, sie hatten nicht alles dem Erdboden gleichgemacht. Die graue, verfallene Hausmauer links zwischen den Kiefern könnte zu dem einst so schmucken Inspektorenhäuschen gehören. Rechts davon verdeckte ein Lastwagen die Sicht, aus dem zwei Männer irgendwelche Gegenstände entluden. Sie fuhr ein Stück weiter, um bessere Sicht zu haben, dann hielt sie an.
Da war es. O Gott! Es stand noch, war nicht abgefackelt und auch nicht eingestürzt. Das Gutshaus. Kleiner als früher erschien es ihr, grauer, einfacher. Der schöne Vorbau mit den Säulen fehlte, auch die Haustür hatte man ausgetauscht, aber die Fenster und die Dachkonstruktion waren unverändert. Die beiden Kavaliershäuschen rechts und links, die früher als Unterstand für Kutschen und Automobil gedient hatten, lagen in Trümmern. Aber das Gutshaus stand.
Franziska hielt an, stellte den Motor aus, zog den Schlüssel ab und stieg aus. Ihr Herz schlug jetzt ruhig, das Zittern hatte aufgehört, ihre Schritte waren fest. Langsam, den Augenblick ihrer Heimkehr genießend, folgte sie einem schmalen Pfad, der zwischen den Bäumen hindurch zum Haus führte und den es früher nicht gegeben hatte. Hier, in diesem Gutshaus, war sie geboren, hier hatte sie mit den Geschwistern gespielt, hier hatten ihre Eltern gelebt, drüben auf dem Kirchhof waren ihre Vorfahren begraben.
Sie hatte die Sehnsucht nach diesem Ort über vierzig Jahre lang in sich getragen. Nun war sie am Ziel.
Sie gehörte hierher. Und sie würde hier bleiben, koste es, was es wolle.
»Sie wollen bestimmt in den Konsum, wie?«, fragte eine Frauenstimme. »Da müssen Sie hinten herum.«
Jenny
Juli 1990
Sie hasste diese klebrige Sommerhitze. Sie hasste das heiße, stickige Berlin. Das Architekturbüro Strassner in der Kantstraße mit den großen Fensterflächen. Sie hasste die aufgedonnerte Kollegin Angelika. Die beiden jungen Architekten Bruno und Kacpar. Wen noch? Simon natürlich. Den am meisten. Hätte sie diesen feigen Lügner doch nie kennengelernt!
Ach – eigentlich konnte sie nur sich selbst nicht leiden.
Jenny legte ein neues Blatt in den Kopierer, schloss den Deckel und drückte auf die Taste. Ein grünlich fluoreszierender Rand wanderte von einer Seite des Deckels zur anderen, gleich darauf schoss die Kopie mit einem leisen Zischen aus dem Gerät, und Jenny legte sie auf den Stapel. Es roch irgendwie komisch, ganz sicher war es nicht gesund, in dem kleinen Kopierraum zu stehen und dreißig Kopien aus dem Bauch des dicken, grauen Kastens zu ziehen.
Wenigstens hatte sie es ihm gegeben. Das Gespräch heute früh war kurz, aber deutlich gewesen. Er hatte verkündet, vor der Trennung von seiner Frau Gisela noch einmal Familienurlaub in Portugal machen zu wollen. Der Kinder wegen. Schließlich sei es das letzte Mal als Familie, das müsse sie doch einsehen. Jochen sei dreizehn und Claudia erst neun. Die beiden hätten ein Recht darauf. Das alles sei auch für ihn nicht leicht, schon weil er sich im Hotel ständig Giselas ehelichen Erwartungen ausgesetzt sähe.
»Spar dir die Erklärungen«, hatte sie in den Hörer gesagt. »Wenn du fährst, ist es endgültig aus. Das ist mein letztes Wort.«
Danach hatte sie aufgelegt. Dieser Feigling redete seit einem Jahr davon, dass seine Ehe am Ende war, aber er hatte es noch nicht fertiggebracht, sich von Gisela zu trennen. Und dieses ständige Theater mit den »armen« Kindern, die ein Recht auf ein heiles Familienleben hätten. Damit wollte er ausgerechnet ihr kommen!
Als sie neun war, hatte sie schon drei WGs hinter sich. Über das Liebesleben ihrer Mutter schwieg sie besser. Es waren ein paar ganz nette Typen dabei gewesen, aber sie hatten sich aus dem Staub gemacht wie die anderen auch. Ein Recht auf ein heiles Familienleben – pah!
Noch fünf Kopien. Drüben ratterte Angelikas Schreibmaschine, unfassbar, wie schnell sie die Briefe herunterhämmerte. Jenny selbst hatte nie richtig Schreibmaschine schreiben gelernt. Alles, was sie hier im Büro tat, hätte auch jede andere tun können. Kopien machen, Briefe eintüten und zur Post bringen, Telefonate weiterleiten, Kunden empfangen, ihnen Kaffee und Kekse bringen, hübsch aussehen, mit den Wimpern klimpern … Vielleicht hätte sie die Banklehre doch nicht schmeißen sollen, dann wäre sie jetzt schon fertig und hätte einen festen Job bei der Bank. Verdienen würde sie da allerdings nicht viel. Hier bekam sie als Mädchen für alles ein geradezu fürstliches Gehalt. Weil das Architekturbüro Simon gehörte und er das Sagen hatte.
Und wenn er trotzdem fuhr? Sich gegen sie entschied? Sie starrte auf den grünen Lichtrand, der langsam über den grauen Kasten kroch. Würde sie es aushalten, ihn zu verlieren? Nur schwer. Sie brauchte ihn. Er war ihr Geliebter und Vater zugleich. Zwanzig Jahre älter als sie, erfahren, verständnisvoll, überlegen. In seiner Nähe fühlte sie sich frei und doch geborgen, konnte offen über alles reden, sich so geben, wie sie war.
Nein, das Geld und der Job waren nicht wichtig. Sie wollte Simon haben, ganz und gar, für immer. Mit ihm leben, am Morgen neben ihm aufwachen, am Abend für ihn kochen. Sein Haus in Ordnung halten, seine Hemden bügeln, ihm neue Krawatten kaufen. So richtig die spießige Hausfrau geben, das Gegenteil von ihrer 68er-Mutter sein – genau das wollte sie. Und natürlich die Nächte mit ihm. Ohne ständig auf die Uhr zu schauen. »Ach du lieber Himmel, ich muss los! Gisela glaubt, ich hätte eine Besprechung … eine Besichtigung … ein Geschäftsessen …« Simon hatte jede Menge Lügen parat. Leider nicht nur für Gisela.
Jenny nahm das letzte Blatt von der Kopierfläche, schloss den Deckel und legte die kopierten Seiten ordentlich aufeinander. Es war schon fast Mittag. Simon hatte ab heute Urlaub, er saß jetzt hoffentlich mit seiner Gisela in der Ehekrisensitzung und würde heute Abend anrufen. Am Boden zerstört und trostbedürftig würde er fragen, ob er für eine Weile bei ihr wohnen könne. Weil seine Gisela ihn rausgeschmissen habe. Klar würde sie das tun, seine Gisela. Sie wollte das Haus, also blieb sie. Er war derjenige, der gehen musste. Jenny fand das in Ordnung so, sie wollte die Prachthütte sowieso nicht. Ein ganz normales, kleines Haus irgendwo an einem See – das reichte doch aus.
Angelika hatte aufgehört zu tippen, Jenny hörte sie angeregt mit Bruno, einem der beiden jungen Architekten, plaudern, der Wasserhahn wurde aufgedreht, vermutlich um den Behälter der Kaffeemaschine nachzufüllen. Die Geräusche kamen aus Simons Büro, also hatte Angelika Bruno hinübergelotst, und sie saßen jetzt auf dem schwarzen Ledersofa, das so angenehm körperfreundlich war. Jenny hatte damit beste Erfahrungen, vor allem nach Dienstschluss, wenn sie mit Simon allein blieb.
Kacpar Woronski trat in den Kopierraum, eine gefüllte Mappe unter dem Arm. Er war ein ungeschickter Typ, roch immer nach Schweiß, und seine schwarzen Haare sahen aus, als sei ein Rasenmäher darüber gefahren. Er kam aus Polen, sprach aber perfekt Deutsch.
»Ach«, sagte er und wurde verlegen. »Du hast noch zu tun, oder?«
»Gerade fertig. Soll ich was für dich kopieren?«
»Danke. Mach ich schon selber.«
Er legte seine Mappe auf den Tisch und klappte sie auf. Jenny erspähte Grundrisse, Seitenansichten, die Vorderperspektive eines ultramodernen Gebäudes. Utopisch wie ein schwebendes Raumschiff.
»Ist das für den Wettbewerb?«, wollte sie wissen.
Kacpars Kopf fuhr hoch, als fühle er sich ertappt. »Äh, ja …«
Aha – das waren nicht Simons, sondern seine eigenen Entwürfe. Die wollte er jetzt, wo der Chef nicht da war, rasch kopieren.
»Schaut klasse aus!«
Der junge Architekt wurde rot vor Freude, vermutlich lobte ihn sonst keiner. Jenny hatte längst gemerkt, dass Kacpar etwas draufhatte. Seine Ideen waren ungewöhnlich, manchmal verrückt, aber niemals nullachtfuffzehn. Simon hatte mal gesagt, aus dem Burschen könne etwas werden. Wenn er nur endlich mal Lebensart annehmen würde.
»Danke«, sagte Kacpar bescheiden. »Das ist für die Kongresshalle. Ich dachte, in einer Stadt wie Berlin sei es gut, fliegen zu können. Falls die Russen uns mal den Hahn zudrehen …«
Diese ständige Angst vor den Russen hatte er wohl aus Polen mitgebracht. Eine seiner Macken.
»Jetzt doch nicht mehr. Jetzt ist Gorbi an der Macht!« Jenny lachte.
Kacpar bewegte die flache Hand hin und her, als schaukele sie auf einem unruhigen Gewässer. »Bei den Russen, da weiß man nie …«
»Quatsch!« Jenny setzte sich neben seine Zeichnungen auf den Tisch und sah zu, wie er die großen Pläne mit penibler Sorgfalt in den Kopierer legte, das Gesicht zu einer angestrengten Grimasse verkniffen. Jenny sah, dass sein Hemd am Rücken und unter den Achseln dunkel vor Schweiß war. »Lebensart«, hatte Simon gesagt. Was er wirklich meinte, war etwas anderes. Die Fähigkeit, sympathisch zu wirken. Mühelos Menschen zu bezaubern, ganz gleich, was man tat oder unterließ. Eine gewisse Leichtigkeit, die man nicht erlernen konnte. Simon besaß diese Fähigkeit im Übermaß. Er glänzte auf Abendgesellschaften, bei großen Empfängen, in seinem Büro bei wichtigen Kunden. Er kannte unendlich viele Leute und nutzte diese Bekanntschaften. Die großen Aufträge bekam nicht der beste Architekt, sondern derjenige, der jemanden kannte, der jemanden kannte. Kacpar kannte niemanden, und wenn er so weitermachte, würde sich das auch nicht ändern.
»Interessierst du dich für Architektur?«, fragte er plötzlich und riss sie abrupt aus ihren Gedanken.
»Klar. Sonst wäre ich ja wohl nicht hier, oder?« Sie kicherte und kam sich dumm vor. Sie war nicht hier, weil sie sich für Architektur interessierte, das wusste sogar Kacpar.
»Willst du mal Architektur studieren?« Er sah sie mit aufmerksamen Augen an. Tiefblauen Augen. Umrandet von dunklen Wimpern.
»Nee …«
»Warum nicht?«
War das ein Verhör? Das nervte. Und dabei diese ernsthafte Miene, als gehe es um Leben und Tod. »Weil ich kein Abi hab.«
»Das kannst du nachmachen.«
Sie schwieg. Was wusste er von den hochintellektuellen, mit Hasch und LSD vollgestopften Typen aus den verschiedenen Wohngemeinschaften? Die hielten sich für den Nabel der Welt, weil sie ein Studium nach dem anderen abbrachen, Arbeitslosengeld kassierten und permanent über die Dreckskapitalisten und das ausgebeutete Proletariat herzogen. Nein, sie hatte die Schule in der elften Klasse geschmissen und eine Banklehre angefangen. »Will ich aber nicht«, sagte sie schließlich.
Er nickte. Akzeptierte ihre Antwort, auch wenn sie ihm vermutlich nicht einleuchtete. Eine Weile arbeitete er schweigend am Kopierer. Jenny beschloss, hinüber in Simons Büro zu gehen und die Kopien einzutüten.
»Schade«, sagte er, als sie vom Tisch sprang. »Ich dachte immer, du könntest mehr aus deinem Leben machen, als …« Er hielt inne, weil er sich jetzt aufs Glatteis begeben hatte. Jenny stand schon an der Tür, die Hand auf der Klinke, da sprach er es doch aus. »… als nur das Liebchen vom Chef zu sein.«
Zornerfüllt starrte sie ihn an, am liebsten hätte sie ihn geohrfeigt. »Kümmere dich um deinen eigenen Dreck, Kacpar Woronski!«, schnauzte sie und rauschte aus dem Kopierraum. Was für ein Idiot er doch war! Wenn sie das Simon erzählte, konnte Kacpar seinen Kram packen. Dann war er gefeuert. Hundertprozentig.
Jenny blieb stehen, holte tief Luft und überlegte. Nein, sie würde Simon gegenüber nichts davon erwähnen. Es war im Grunde sehr mutig von Kacpar, ihr so etwas ins Gesicht zu sagen. Der junge Architekt war kein Idiot. Er wusste, was er riskierte. War er am Ende verknallt in sie? Großer Gott – das fehlte gerade noch.
In Simons Büro brachen Angelika und Bruno ihr Gespräch sofort ab, als sie eintrat. Sie saßen dicht nebeneinander auf dem schwarzen Ledersofa und griffen rasch nach ihren Kaffeebechern, die unberührt auf dem Glastisch standen.
»Die Kaffeemaschine im Aufenthaltsraum ist nicht in Ordnung«, erklärte Angelika mit kollegialem Lächeln. »Deshalb sind wir hierher gegangen. Stört ja niemanden, oder?«
Jenny genoss ihre Macht, auch wenn sie sich eigentlich mies dabei fühlte. Die beiden wussten, dass sie sich mit ihr gutstellen mussten. »Mich stört es nicht … Machst du mir auch einen Kaffee, Geli?«
»Gern.« Angelika stand auf und machte sich an der Kaffeemaschine zu schaffen, während Jenny die Kopien ein weiteres Mal sortierte, in Umschläge steckte und die dazugehörigen Adressen aufklebte. Bruno stand ebenfalls auf, nickte Jenny zu und kehrte zurück in sein Büro. Er war ein hagerer, schweigsamer Typ aus dem Norden, arbeitete zuverlässig und war Angelika schon lange zugetan.
»Ist nicht viel los, wenn der Chef im Urlaub ist«, bemerkte Angelika und dehnte die ineinander verschränkten Finger, bis sie knackten. Ein widerliches Geräusch.
Jenny zuckte die Schultern und griff nach dem Kaffee. Angelika hatte Milch hineingetan, das Miststück. Dabei wusste sie genau, dass Jenny ihren Kaffee schwarz trank.
»Bist ja auch bald im Urlaub, nicht wahr?«, forschte Angelika weiter.
Jenny nickte. »Ab Montag …«
»Ja, richtig. Kacpar, Bruno und ich halten die Stellung. Willst du verreisen?«
»Klar. Nach Balkonien. In das Land, wo die Geranien blühen …«
»Ach. Und ich dachte, du wolltest nach Portugal …«
Simon hatte Angelika seine Familienreise buchen lassen, heimlich, hinter Jennys Rücken. »Portugal? Wie kommst du denn darauf? Wäre mir viel zu heiß da. Und immer nur Fisch essen ist auch nicht mein Ding.«
Jemand öffnete die Außentür, im Eingangsflur waren Schritte zu hören. Angelika griff eilig nach Brunos und ihrer Kaffeetasse, doch in dem Augenblick öffnete sich bereits die Bürotür, und Simon trat ein. Erstaunt zog er die Augenbrauen hoch.
»Guten Morgen, Herr Strassner«, stammelte Angelika verlegen. »Die Arbeit lässt Sie wohl nicht los! Die Kaffeemaschine im Aufenthaltsraum ist defekt, deshalb haben wir uns hier ein Tässchen zubereitet …«
Simon trug einen hellen Sommeranzug, den Jenny noch nie an ihm gesehen hatte. Teurer Schnitt, perfekter Sitz, vermutlich maßgeschneidert. Er kaufte schon lange nicht mehr von der Stange.
»Alles bestens, Frau Kammler. Ich bin gleich wieder weg.« Er lächelte Jenny an, dann wandte er sich wieder seiner Sekretärin zu. »Sie haben sicher zu tun, nicht wahr?«
»Selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen einen schönen, erholsamen Urlaub!« Eilig hielt Angelika auf die gepolsterte Tür zu und schloss diese fest hinter sich. Wer hier lauschen wollte, musste Ohren haben wie eine Fledermaus. Simon hatte diese Tür sicher nicht umsonst einbauen lassen, dachte Jenny. Er kannte seine Sekretärin.
Geschäftig stellte er nun die Aktentasche auf den Schreibtisch, sah flüchtig die Post durch und warf einen Blick auf die Umschläge, die Jenny adressiert und zugeklebt hatte. »Ich bin nur auf einen Sprung«, teilte er ihr mit. »Ich musste noch zum Frisör, weißt du …«
Sie kannte ihn viel zu gut. Die fahrigen Bewegungen, das unstete Lächeln, dieser untaugliche Versuch, etwas zu verbergen. Wie seltsam. Einem Kunden gegenüber bewahrte er in jeder Lage lächelnde Gelassenheit, doch wenn es um Gefühle ging, gelang ihm das nicht.
»Ich dachte, du wolltest mir deine Entscheidung mitteilen«, sagte sie mit fester Stimme.
Er legte die Umschläge zurück auf den Schreibtisch, stieß geräuschvoll die Luft aus und räusperte sich. »Du hast mir ein Ultimatum gestellt«, bemerkte er und warf ihr einen ironischen, leicht herablassenden Blick zu.
»Ganz richtig.«
Er lachte kurz, was eher klang wie ein verlegenes Husten.
»Darauf kann ich natürlich nicht eingehen, Schatz. Wir beide sind erwachsene Menschen, und wenn wir uns zusammentun, dann kann das nur auf freiwilliger Basis geschehen.«
»Und wann?«
Seine Anspannung löste sich, offenbar war er der Ansicht, sie bereits überzeugt zu haben. Er ging auf sie zu, lächelnd, um sie tröstend in den Arm zu nehmen, doch sie wich zurück.
»Wann? Das habe ich dir doch gesagt. Nach dem Urlaub. An Weihnachten sind wir auf Teneriffa, Schatz. Nur wir beide. Und ich werde eine wundervolle Überraschung für dich im Gepäck haben …«
Seine Nähe war verführerisch. Es wäre so leicht, sich jetzt von ihm umarmen zu lassen, sich an ihn zu schmiegen, seine warme Hand zu spüren, die über ihr Haar, ihren Rücken strich. Seine Stimme, in der Begehren und Reife mitschwangen. Doch sie hielt stand. Vielleicht lag es an Kacpars Bemerkung. »Ich dachte, du könntest mehr aus deinem Leben machen, als nur das Liebchen vom Chef zu sein.« O nein, das war nicht nur das Liebchen vom Chef. Sie war keine, mit der man Spielchen trieb.
»Wenn du aus Portugal zurückkommst, werde ich nicht mehr hier sein, Simon.«
»Bitte, Jenny, ich möchte hier im Büro keine Szene«, warnte er sie.
Auf einmal hasste sie ihn. »Ich möchte keine Szene …«, »Pass auf, dass dich niemand sieht, wenn du aus meinem Wagen steigst …«, »Ruf mich auf keinen Fall zu Hause an, ja?«. Am Anfang hatte sie es aufregend gefunden, es hatte ihr Spaß gemacht. Jetzt nicht mehr. »Wer macht eine Szene?«, fauchte sie. »Ich sag es dir in aller Ruhe: Die Entscheidung liegt bei dir.«
Er starrte sie einen Moment lang an, als sähe er sie zum ersten Mal. »Wir sehen uns dann in vierzehn Tagen, Jenny.« Energisch schloss er die Aktentasche, dann stürmte er wortlos aus dem Büro.
Gut, dachte sie. Das ist eine Antwort. Dann weiß ich jetzt, woran ich bin. Sie hörte, wie die Außentür ins Schloss fiel. Ein heftiger Schmerz stieg in ihrem Inneren auf, füllte ihre Brust aus wie eine große brennende Wunde. Du darfst jetzt nicht heulen! Auf keinen Fall! Gleich wird Angelika hereinkommen, die neugierige Funzel.
Jenny hatte Übung darin, ihren Kummer zu verstecken, schließlich hatte sie das schon als Kind gelernt. In den Wohngemeinschaften waren fast alle nett zu ihr, spielten mit ihr, gaben ihr zu essen, kümmerten sich sogar ab und an um ihre Klamotten. Auch ihre Mutter tat das. Aber Heulsusen wollte da keiner haben. Hatte schließlich jeder genug mit sich selber zu tun. Also riss sie sich zusammen und spielte die Unbefangene, bis sie pünktlich um fünf Uhr das Büro verließ.
Es ist aus, es ist aus, es ist aus … Der Satz hämmerte rhythmisch in ihrem Kopf, während sie den Wagen durch die Rushhour steuerte, an Ampeln wartete, auf die vorübereilenden Leute starrte. Ich habe es so gewollt. Habe alles auf eine Karte gesetzt und verloren. Verloren … Sie hatte Simon verloren …
Wie sie zu ihrer Wohnung gelangt war, hätte sie nicht genau sagen können, anscheinend hatte ihr roter Kadett auch ohne ihr Zutun den Weg gefunden. Kleine, einstöckige Häuschen reihten sich hier aneinander, etwas vergammelt, die Vorgärten zugewachsen. Die meisten Besitzer hatten die sechzig weit hinter sich gelassen und waren nicht bereit, noch einmal Geld in ihre Häuser zu investieren. Die Mieter sollten sich halt etwas einfallen lassen. Jenny war es recht, sie brauchte keinen Luxus, und die Nachbarn waren in Ordnung. Studenten, eine türkische Familie, zwei Schwule, die täglich ihre Betten auf dem Küchenfensterbrett lüfteten.
Drinnen war es stickig. Jenny riss die Fenster auf und warf sich auf ihr Bett. Vergrub den Kopf in den Kissen und wollte endlich heulen, doch dafür war es zu spät. Es ging nicht mehr. Eine lähmende Ruhe hatte sich in ihr breitgemacht, ein Zustand der Betäubung, als habe ihr jemand einen Gummihammer auf den Kopf geschlagen.
Wieso regte sie sich auf? Sollte er doch mit seiner Familie nach Portugal fahren. Wenn er zurückkam, wollte er die Scheidung einreichen. Weihnachten auf Teneriffa. Nur sie beide und eine wundervolle Überraschung. Damit konnte nur ein Verlobungsring gemeint sein. Sie stellte sich sein verschmitztes Gesicht vor, seine Freude, wenn sie das Päckchen öffnete und aufschrie vor Begeisterung. Wie er sie in die Arme nahm, sie küsste und zärtlich hin- und herwiegte. Wenn aus Zärtlichkeit Sinnlichkeit wurde, wenn er sie langsam auszog, ihre Haut mit der Zunge berührte …
Unter der kalten Dusche begann ihr Kopf wieder normal zu arbeiten. Wie dumm war sie eigentlich? Es war doch klar, dass er nach dem Urlaub eine neue Ausrede finden würde. Ein Kind war krank. Seine Frau trat eine Kur an. Er hatte beruflich zu viel um die Ohren, die Oma lag im Sterben …
Schluss. Aus. Ende. Er hatte seine Chance gehabt. Sie hatte sich etwas vorgemacht. Sie hatte nicht Simon geliebt, sondern eine Fantasiegestalt, und leider liebte sie die noch immer.
Jenny trat aus der Dusche, trocknete sich ab und zog T-Shirt und Slip an, dann hockte sie sich auf ihr Bett und starrte aus dem Fenster. Gegenüber auf der anderen Straßenseite befand sich eine kleine Anlage. Kinder spielten, Mütter saßen auf Bänken, alte Leute gingen mit ihren Hunden spazieren. Waren das eigentlich Buchen? Oder Eichen? Linden? Pappeln? Sie hatte keine Ahnung. Großstadtpflanze. Kennt nicht mal die wichtigsten Baumsorten. Auch sonst nicht viel. Roggen, Weizen, Gerste … Was gab es noch? Kleie, Hirse – aber die wuchs in Afrika. Wrucken …
Wrucken … Wo hatte sie dieses komische Wort gehört? Auf alle Fälle war das schon lange her. Damals war sie noch ein Kind gewesen. Wrucken. Sie war mit ihrer Mutter zu einer Beerdigung gefahren, in die Nähe von Frankfurt. Kaisersloh … Grafenstein … Königstein. Jawohl, Königstein, so hatte der Ort geheißen. Es regnete auf dem Friedhof, die schwarz gekleideten Leute hatten ihre Schirme aufgespannt. Rote und blaue und gelbe Schirme, bunte Farbkleckse zwischen den hohen Bäumen und den vielen Grabsteinen. Später waren sie bei der Großmutter zu Hause gewesen, hatten mit lauter fremden Leuten am Tisch gesessen und Kuchen gegessen. Sie hatte damals noch nie ein Haus mit Teppichen, Gardinen und richtigen Möbeln gesehen und wagte kaum aufzublicken. »Spießig«, hatte ihre Mutter gesagt. »Hast du die Häkeldeckchen gesehen? Und über dem Telefon hat sie einen Überzug aus Samt mit Goldborte.« Als Jenny erklärte, sie fände das Foto über dem Klavier schön, hatte ihre Mutter nur verächtlich geschnaubt.
Jenny konnte sich nicht mehr an das Gesicht der Großmutter erinnern. Sie war freundlich zu ihr gewesen. Und sie hatte ihr erklärt, dass auf dem Bild ein Gutshaus zu sehen sei. Sie redete dann über allerlei Dinge, die Jenny längst vergessen hatte, nur an die Wrucken konnte sie sich erinnern.
»Wrucken? Was ist das denn?«, wollte sie damals wissen.
»Rüben, Kind«, erklärte ihre Oma. »Man sagt auch Steckrüben dazu.«
Ihre Mutter hatte es eilig, wieder heimzureisen. Später hatte Jenny zweimal gefragt, ob sie Großmutter Franziska nicht mal besuchen könnten, aber ihre Mutter wollte nicht.
Nachdem Jenny die Schule geschmissen hatte, zog sie aus der WG ihrer Mutter aus, und die Verbindung zu Cornelia schlief ein. Auch Großmutter Franziska geriet in Vergessenheit. Jenny wusste nicht einmal, ob sie noch lebte.
Vielleicht wäre es gar nicht dumm, ihre Telefonnummer herauszufinden. Falls sie denn eine hatte. Immerhin war sie eine nahe Verwandte, und sie könnte sie besuchen. Für eine Weile von hier verschwinden. Simon die Kündigung auf den Tisch hauen und ab nach Königsberg … äh, Königstein. Sich sortieren. Vergessen. Pläne schmieden. Neu anfangen.
Was für eine Schnapsidee, dachte sie. Falls meine Großmutter überhaupt noch am Leben ist, wird sie vermutlich sauer auf mich sein, weil ich mich nie gemeldet habe. Und damit hätte sie leider sehr recht.