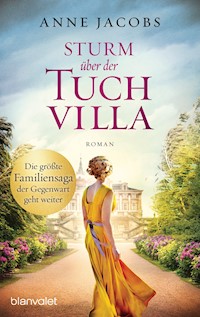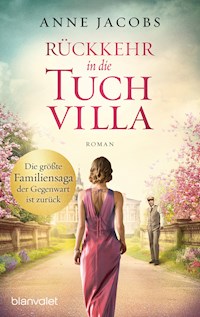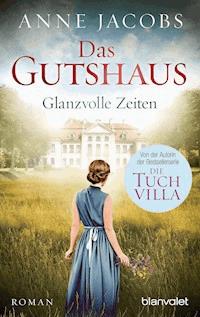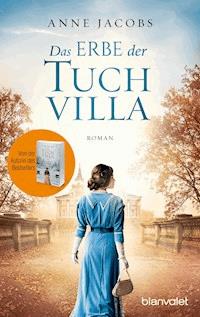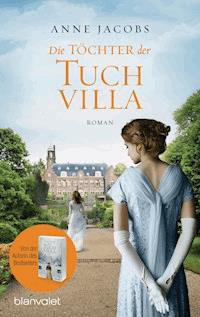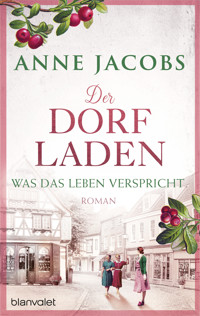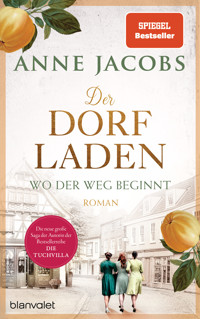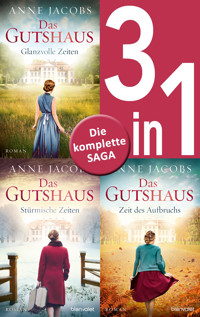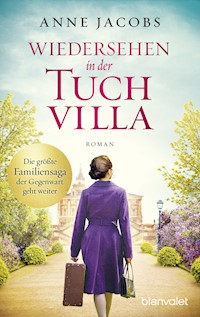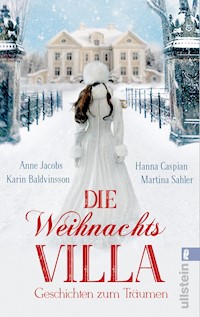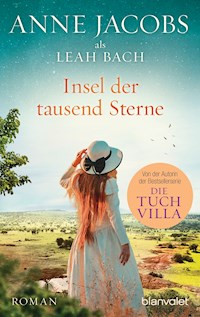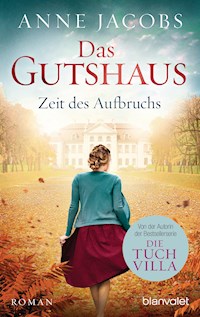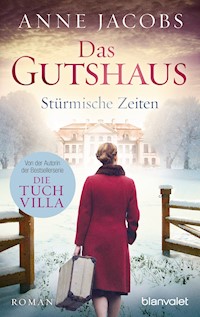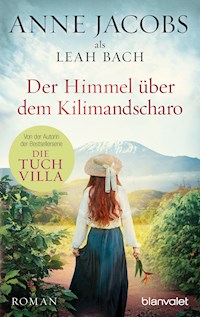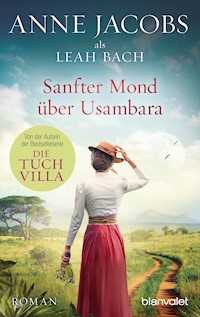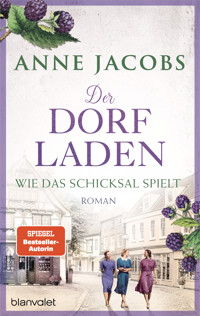
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Dorfladen-Saga
- Sprache: Deutsch
Band 3 der SPIEGEL-Bestseller-Saga: berührend, mitreißend, hervorragend recherchiert!
Dingelbach am Fuße des Taunus, 1927. Unruhige Zeiten stehen den drei Schwestern vom Dorfladen bevor. Während Frieda, die mittlere Tochter, in ihrem ersten Theaterengagement Höhen und Tiefen durchlebt, ist Ida, die jüngste, glücklich verliebt in ihren Florian und setzt damit das angestrebte Abitur aufs Spiel. Florians Nähe zur KPD erweist sich jedoch für sie beide als Desaster – Ida kehrt zurück nach Dingelbach. Hier erwartet die dritte Schwester, die brave Herta, ein uneheliches Kind, was für viel Aufruhr im Dorf sorgt. Werden die drei dennoch ihr Glück finden?
Lesen Sie auch die »Tuchvilla«-Saga und die »Gutshaus«-Reihe von SPIEGEL-Bestsellerautorin Anne Jacobs!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 860
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Newsletter-Anmeldung
Seitenliste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
Buch
Dingelbach am Fuße des Taunus, 1927. Unruhige Zeiten stehen den drei Schwestern vom Dorfladen bevor. Während Frieda, die mittlere Tochter, in ihrem ersten Theaterengagement Höhen und Tiefen durchlebt, ist Ida, die jüngste, glücklich verliebt in ihren Florian und setzt damit das angestrebte Abitur aufs Spiel. Florians Nähe zur KPD erweist sich jedoch für sie beide als Desaster – Ida kehrt zurück nach Dingelbach. Hier erwartet die dritte Schwester, die brave Herta, ein uneheliches Kind, was für viel Aufruhr im Dorf sorgt. Werden die drei dennoch ihr Glück finden?
Autorin
Anne Jacobs lebt und arbeitet in einem kleinen Ort im Taunus, wo ihr die besten Ideen für ihre Bücher kommen. Unter anderem Namen veröffentlichte sie bereits historische Romane und exotische Sagas, bis ihr mit der SPIEGEL-Bestseller-Reihe »Die Tuchvilla« der große Durchbruch gelang. Seit Jahren begeistert sie inzwischen auch Leser*innen in einem Dutzend Ländern von Frankreich bis Norwegen. Nach »Der Dorfladen – Wo der Weg beginnt« und »Der Dorfladen – Was das Leben verspricht« legt sie nun mit »Der Dorfladen – Wie das Schicksal spielt« den dritten Teil der Reihe vor.
Von Anne Jacobs bei Blanvalet erschienen:
Die Tuchvilla
Die Töchter der Tuchvilla
Das Erbe der Tuchvilla
Rückkehr in die Tuchvilla
Sturm über der Tuchvilla
Wiedersehen in der Tuchvilla
Das Gutshaus – Glanzvolle Zeiten
Das Gutshaus – Stürmische Zeiten
Das Gutshaus – Zeit des Aufbruchs
Der Dorfladen – Wo der Weg beginnt
Der Dorfladen – Was das Leben verspricht
Der Dorfladen – Wie das Schicksal spielt
Anne Jacobs
Der Dorfladen
Wie das Schicksal spielt
Roman
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2025 der Originalausgabe
by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Ulrike Strerath-Bolz
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Arcangel / Joanna Czogala; iStockphoto / ZU_09; www.buerosued.de
LH · CS
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-26252-5V002
www.blanvalet.de
Kapitel 1
1. Januar 1927
Eisig kalt ist es in der Kirche. Ida ärgert sich, dass sie nicht Mutters alte Strickjacke unter den Mantel angezogen hat. Und wollene Kniestrümpfe. Aber die kratzen erbärmlich, und so hat sie diese Baumwolldinger genommen, die aber kein bisschen wärmen. Was nicht so schlimm wäre, wenn sie die Kirche vor dem Gottesdienst anständig heizen würden, schließlich gibt es hinten bei der Treppe zur Orgel einen Ofen. Aber die Frau Pfarrer Seybold, die geizige Person, spart Holz und Kohlen für das Pfarrhaus und denkt sich, dass die Predigt ihres lieben Ehemannes den Dingelbachern schon einheizen wird.
Dabei predigt Pfarrer Seybold zu Neujahr immer das Gleiche: dass Jesus Christus in die Welt kam, um einen neuen Anfang zu machen, weil er unsere Sünden auf sich nahm und für uns gestorben ist. Ida hat sich schon als kleines Mädchen den Kopf darüber zerbrochen, warum der liebe Gott seinen eigenen Sohn so quälen muss, statt uns die Sünden gleich zu vergeben. Heute, mit fast siebzehn Jahren, ist sie mit dem Christentum fertig. Zu unlogisch. Zu weit hergeholt. Und wenn man in die Geschichte schaut, waren die Christen keineswegs anständiger als die Anhänger anderer Religionen. Eher das Gegenteil.
Die Predigt ist zu Ende – gottlob hat Pfarrer Seybold ein Einsehen gehabt und sich kurzgefasst. Jetzt kommt noch ein Kirchenlied, dann der Segen und das Orgelnachspiel. In einer der hinteren Bänke tut es einen Schlag, ein leiser Schmerzensschrei ist zu hören, dann ärgerliches Flüstern. Ida blickt sich vorsichtig um: Der Gustav Guckes ist eingeschlafen und mit dem Kopf gegen die Bank geknallt. Jetzt kriegt er dazu noch ordentlich Schelte von seiner Mutter, der Karin.
Von dem Choral »All Morgen ist ganz frisch und neu« müssen natürlich alle vier Strophen gesungen werden, darunter tut es der alte Pfarrer nicht. Zum Glück zieht Lehrer Hohnermann oben an der Orgel die Gemeinde in flottem Tempo hinter sich her, dann noch der Segen, und während des Orgelnachspiels stehen die ersten Dingelbacher schon von den Bänken auf. Man reckt die eingefrorenen Glieder, flüstert sich Bemerkungen zu, einige reden sogar laut, weil das Orgelspiel ja die Stimmen übertönt. Ida bleibt trotz der Kälte demonstrativ in der Bank sitzen. Es ist doch zum Verzweifeln: Den langweiligen Gottesdienst lassen die Dingelbacher klaglos in der Eiseskälte über sich ergehen – aber bei dem grandiosen Orgelspiel von Lehrer Hohnermann, da laufen sie weg.
»Was ist los, Ida? Da steht doch endlich auf!«, schimpft die Mutter, die nicht aus der Bank kann, weil Ida sie blockiert.
»Ich will die Musik hören!«
»Das kannst du auch beim Hinausgehen!«
»Es ist unhöflich, aufzustehen, wenn jemand musiziert!«
Jetzt wird die Mutter zornig und fasst sie fest am Arm. »Schwätz kein dumm’ Zeug! Steh auf, sonst setzt es was!«
Die Mutter ist imstande, ihr mitten in der Kirche eine Ohrfeige zu verpassen, trotz ihrer fast siebzehn Jahre. Das weiß Ida. Weil eine Mutter immer eine Mutter bleibt und eine Tochter immer eine Tochter. Ida hält noch ein paar Sekunden aus, aber weil sich Lehrer Hohnermanns Orgelstück sowieso auf das Ende zubewegt, erhebt sie sich schließlich.
»Als die Spinnereien, die städtischen!«, zischt die Mutter, als sie im Mittelgang an ihr vorbeigeht, um die Alberti Marlis zu begrüßen. Herta, die neben der Mutter gesessen hat, sagt kein Wort. Was Ida sehr verwundert, da die brave ältere Schwester sonst nie eine Gelegenheit auslässt, über sie zu lästern. Überhaupt kommt ihr Herta in letzter Zeit ungewöhnlich sanft und schweigsam vor. Vielleicht ist sie ja in sich gegangen, weil sie den Sirius Engelke nicht hat heiraten dürfen.
Draußen erwartet sie ein frostiger Neujahrsmorgen. Wolkenlos ist der Himmel, die Luft ist klar und eisig, die schräge Wintersonne lässt den Schnee glitzern, der wie ein weißes Gespinst auf den Wiesen und Feldern um das Dorf herum liegt. Die hauchdünne Schneedecke vermag die Erde nicht vor dem harten Frost zu schützen.
»Da geht das Ungeziefer kaputt«, sagen die einen zufrieden.
»Wenn nur net die Saat erfriert«, sorgen sich die anderen.
»Wenn’s endlich einmal richtig schneien wollte!«, brummt Onkel Schorsch jedes Mal, wenn er in den Dorfladen kommt.
Onkel Schorsch ist Mutters Bruder, und wenn es irgendwo etwas Neues gibt, dann ist er dabei. Jetzt hat er in einer Zeitschrift das Foto von einem Schifahrer gesehen und sich hölzerne Schibretter geschnitzt, aber er kann sie nicht ausprobieren, weil zu wenig Schnee liegt.
»Den Hals wirst du dir brechen auf deine alten Tage!«, hat die Mutter kopfschüttelnd zu ihm gesagt. Aber da hat er nur gelacht. Onkel Schorsch, der ist schon so einer! Ida kann ihn gut leiden.
Heute bleibt kaum jemand auf dem Kirchplatz stehen, um noch einen kleinen Schwatz zu halten. Einmal weil es zu kalt ist und dann auch, weil der Neujahrstag auf einen Samstag gefallen ist und man ja morgen schon wieder zum Gottesdienst gehen wird. Also eilen Frauen und Kinder heim an den warmen Ofen, während die meisten Männer dem Gasthaus »Zum Raben« zuströmen, um das neue Jahr mit einem heißen Äppler zu begrüßen. Das ist so Sitte in Dingelbach; auch, dass der Bürgermeister eine Rede hält und eine Runde spendiert, gehört dazu.
Ida geht mit den Männern mit, weil die Rabenwirtin sie gefragt hat, ob sie beim Bedienen helfen mag, sie wollt ihr auch etwas dafür zahlen. »Weil doch unsere Erna jetzt verheiratet ist und die Marie sich allweil so dabbisch anstellt«, hat die Karin Guckes zu ihr gesagt.
»Da geh nur«, hat die Mutter gemeint und ein schiefes Gesicht gezogen. »Ein paar Groschen wird sie wohl herausrücken, die Karin. Die weiß recht gut, dass die Mannsbilder länger hocken bleiben, wenn du bedienst.«
Es muss an ihren roten Haaren liegen, dass die Männer nach ihr schauen. Ida stört das, sie mag nicht angeglotzt werden wie ein Gaul auf dem Viehmarkt. Nur der Florian, der darf sie anschauen. Er soll es sogar, und er tut es auch. Im vergangenen Jahr haben sie sich häufig in Frankfurt gesehen, und seit September weiß es auch die Mutter, dass sie sich mit dem Jurastudenten Florian Häger trifft. Zuerst ist sie zornig gewesen und hat es verbieten wollen, aber Ida ist keine, der man so leicht etwas verbieten kann. Schon gar nicht den Umgang mit Florian, der so klug und zärtlich ist und mit dem sie über alles reden und streiten kann, was sie gelesen hat, worüber sie nachdenkt.
Morgen, am Sonntag, dem zweiten Januar, will er nach Dingelbach kommen, das hat er ihr vor Weihnachten versprochen. Sie haben ausgemacht, dass er dann oben auf dem Dachboden übernachten kann und sie am Montag gemeinsam nach Frankfurt fahren. Aber da hat sich die Mutter leider quergestellt.
»Auf dem Dachboden? Das geht net, da ist es viel zu kalt. Da zahl ich lieber ein Zimmer im ›Raben‹, wenn’s denn schon sein muss.«
Dass es auf dem Dachboden zu kalt wäre, ist natürlich nur ein Vorwand gewesen, das hat Ida sehr wohl verstanden. Die Mutter hat Angst, dass Ida in der Nacht zu ihm hinaufsteigen könnte, das ist der wahre Grund. Und zugegeben, Ida hat darüber nachgedacht. Aber weil es wirklich furchtbar kalt dort oben ist und der Wind durch die Ritzen pfeift, hat sie den Gedanken aufgegeben. Da treffen sie sich lieber in seinem Studentenzimmer in Frankfurt, wenn die beiden Mitbewohner mal nicht da sind.
Im »Raben« hat der Jörg Guckes gerade erst den Ofen angeheizt. Es ist noch so kalt im Gastzimmer, dass man den Atemhauch sehen kann. Aber die Dingelbacher Bauern sind nicht empfindlich. Bei denen zu Hause wird im Winter ohnehin nur die Küche geheizt, weil da ja gekocht werden muss, die Stube und die Schlafkammern bleiben kalt, und an den Fenstern wachsen die Eisblumen. So legen die meisten jetzt schon mal die Jacken ab und setzen sich an die Tische, wobei – das ist schon wahr – die beiden Tische beim Ofen am schnellsten besetzt sind. Dort hat sich auch gleich der Bürgermeister, der Otto Schütz, niedergelassen, und Onkel Schorsch, der mit dem Otto gern streitet, sitzt ihm gegenüber. Die anderen verteilen sich je nach Sympathie und Freundschaft, der Schmied Hannes Killinger tut sich mit dem Alberti Rudolf, dem Dorfheiler, zusammen, später gesellt sich auch Lehrer Hohnermann zu ihnen, der in der Kirche erst noch seine Noten forträumen und die Orgel verschließen muss. Ganz zuletzt kommt auch der alte Pfarrer Seybold in den »Raben«, um auf das Neue Jahr 1927 anzustoßen. Da stellt ihm der Guckes Jörg rasch noch einen Stuhl an den Tisch beim Bürgermeister, weil es sich so gehört, dass Pfarrer und Bürgermeister am gleichen Tisch sitzen.
Fast alle bestellen einen heißen Äppler, den die Karin Guckes in einem großen Topf auf dem Herd zubereitet, nur der Müller Alfred Dippel und der Koppel Willi wollen ein Bier, weil ihnen der Apfelwein vom »Raben« zu sauer ist. Ida hilft der Karin beim Einfüllen und schleppt ein Tablett voller dampfender Becher in den Gastraum, wo sie mit wohlwollenden und scherzhaften Bemerkungen empfangen wird.
»Dass du dir net die Finger an dene heiße Becher verbrennst, Mädsche!«
»Ei, Ida! Wann bringste mein Bier? Allweil tust de nur die andern bedienen!«
»Des Idsche. Ich weiß noch, wie sie im kurzen Röcksche durchs Dorf gelaufen ist!«
Sie kennt die Sprüche und gibt jedem die passende Antwort. Sie sind ja eher harmlose Gesellen, die Dingelbacher Bauern, so richtig boshaft ist keiner von ihnen. Höchstens der Schütz Otto, der Bürgermeister, der hat mal Frau und Kind schlimm verprügelt, aber das ist schon ein Weilchen her, und seitdem ist es mit ihm bergab gegangen. Weil er in seiner Dummheit eine junge Frau genommen hat, die ihm jetzt das Leben schwer macht. So kriegt halt jeder das, was er verdient. Oder wie die Frau Pfarrer sagen würde: »Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich klein.«
In der Küche hat die Karin den Topf auf dem Herd wieder aufgefüllt, weil sie hofft, dass der eine oder andere nachbestellt. Schließlich muss der Otto die erste Runde zahlen, und wenn sich die Gemüter unter dem Einfluss des heißen alkoholischen Getränks erhitzen, werden schon noch Bestellungen kommen. Tatsächlich ordert gleich darauf der Alberti Rudolf für jeden Tisch einen Korb Brot und dazu saure Gürkchen, und der Müller Alfred Dippel, der sonst ein ausgemachter Geizhals ist, bestellt zwei lange Hartwürste, in kleine Stückchen geschnitten. Ida sieht zu, wie sich die Karin zwei Wurststückchen in den Mund steckt, bevor sie ihr die Teller zum Austragen hinüberschiebt. Sie selbst verschmäht die Hartwurst vom Guckes Jörg, weil der seine Wutzen immer so ungeschickt absticht, dass sie durch ganze Dorf schreien. Sogar der Killinger Hannes, der Schmied, hat neulich gesagt, dass der Rabenwirt ein Tierquäler ist und er seinen Äppler lieber daheim trinkt. Was er meistens auch tut, allerdings nicht nur aus Protest wegen der Wutzen, sondern weil ihm – wie den meisten Leuten in Dingelbach – das Geld für den Wirtshausbesuch fehlt.
»Wenn’s so weitergeht«, hat die Karin Guckes neulich gemeint, »dann machen wir den ›Raben‹ zu. Das bisschen, was hier verzehrt wird, das zahlt ja kaum das elektrische Licht.«
Da hat der Otto Schütz, der Bürgermeister, sich aufgeregt und erklärt, dass das Gasthaus »Zum Raben« bleiben müsse, das sei der Guckes Jörg dem Dorf schuldig.
»Wenn es nicht einmal mehr ein Gasthaus gibt – dann ist Dingelbach am Ende!«
Die Meinungen darüber waren geteilt, weil vor allem die Frauen und auch der Pfarrer Seybold der Kirche den Vorrang vor dem Gasthaus gegeben haben, und die Kirche wird im Dorf bleiben, das ist gewiss. Aber die Wahrheit ist doch, dass es schlecht mit den Bauern in Dingelbach steht. Im vergangenen Jahr haben wieder zwei Höfe verkauft werden müssen, weil die Besitzer zu viele Schulden hatten. Es ist ein Teufelskreis, aus dem die Bauern nicht herauskommen: Viele Landarbeiter, die früher zur Erntezeit angeheuert wurden, sind in die Städte gezogen und arbeiten dort in den Fabriken. Um die Arbeit zu bewältigen, haben die Bauern Mähbinder oder Dreschmaschinen angeschafft, haben sich dabei verschuldet und gehofft, die Schulden durch den Verkauf der Erntefrucht abtragen zu können. Aber es ist anders gekommen. Vorletztes Jahr war es so heiß, dass das Korn auf den Halmen verdorrt ist, und das vergangene Jahr hat zu viel Regen gebracht, sodass ein Teil der Ernte auf den Feldern verfault ist. Wer trotz allem etwas zum Verkauf erübrigen konnte, hat kaum einen Gewinn machen können, weil die Getreidepreise im Keller sind. Billige Einfuhren aus Holland und Russland bestimmen den Markt und lassen den deutschen Bauern keine Chance.
Ida geht zwar auf die Schillerschule in Frankfurt und wird bald das Abitur ablegen, aber im Herzen ist und bleibt sie eine Dingelbacherin, und die aussichtslose Lage der Bauern macht sie wütend. Warum muss das so sein in der Welt, dass die einen kaum genug zum Leben haben und die anderen im Geld schwimmen? In Frankfurt gibt es Restaurants, da kostet ein einziges Menü mehr, als ein Bauer im ganzen Jahr verdient. Aber die meisten Bauern glauben, es sei eben auf der Welt so eingerichtet, dass die einen arme Schweine und die anderen reiche Pinkel sind. Das hätte der liebe Gott so gemacht. Ida ist da mit Florian der gleichen Ansicht: Nicht der liebe Gott, sondern die Menschen haben diese ungerechte Gesellschaftsordnung errichtet. Und genau wie Florian glaubt sie daran, dass man dies alles ändern kann.
Während sie Brotkörbe und Teller mit Essiggürkchen serviert, kann sie die Neujahrsrede vom Bürgermeister hören. Eigentlich müsste sie »Altjahresrede« heißen, denkt sie, denn er schleicht sich wie jedes Jahr um die kritischen Ereignisse herum, lobt den Zusammenhalt der Dingelbacher Bauern, zählt auf, wie viele Kinder im vergangenen Jahr geboren wurden und wie viele Hochzeiten es gegeben hat. Dann erwähnt er noch die letztjährige Kerb, wo bei der Kirchlinde so schön getanzt wurde, lobt die Musikanten und führt stolz an, dass mehrere fliegende Händler ihre Stände auf dem Kirchanger aufgebaut hätten und viele Leut aus den umliegenden Dörfern auf der Dingelbacher Kerb gewesen seien. Dass der Erwin, der Lehrbub vom Killinger Hannes, damals im Suff in den Bach gefallen ist und fast ertrunken wäre, erwähnt er nicht. Weil es halt normal ist, dass bei der Kerb ein paar Schnapsleichen anfallen. Auch dass seine junge Frau, die Marie, mit seinem Knecht Hannes getanzt und ihm schöngetan hat, lässt er verständlicherweise unter den Tisch fallen. Aber die Bauern in der Gaststube wissen es wohl und werfen sich verständnisinnige Blicke zu, während der Otto seine Lobrede auf die Dingelbacher Kerb hält. Ida tut er fast leid, weil er so verzweifelt versucht, dem vergangenen Jahr, das ein schlimmes war, noch ein wenig Glanz abzugewinnen.
»Wir Dingelbacher lassen uns net unterkriegen!«, ruft er laut und hebt seinen Becher. »Und darum trinken wir jetzt auf das neue Jahr. Von heute an wird alles besser werden, weil ich denk, dass bald die richtigen Leut an die Regierung kommen …«
Ein bisschen zittrig ist seine Stimme schon, denkt Ida. Dann muss sie schnell in die Küche laufen, weil mehrere Gäste vor leeren Krügen sitzen und nicht auf das neue Jahr anstoßen können. Die Karin füllt eifrig den heißen Äppler ab und jammert, dass die Bauern viel zu viel Zucker in das heiße Getränk rühren täten.
»Daheim schaut ihnen die Frau auf die Finger, aber hier schaufeln sie den Zucker in die Krüge, dass es nur so schäumt, die Babbsäck!«
Kaum ist das neue Jahr auf althergebrachte Weise begrüßt, da geht es schon um die »Politik«. Onkel Schorsch ergreift das Wort und preist wieder den Reichslandbund an, wo er schon seit zwei Jahren Mitglied ist.
»Früher, da sind wir ein Kaiserreich gewesen, da hat der Kaiser Wilhelm für uns alle gesorgt«, behauptet er. »Aber jetzt leben wir in einer Republik, das heißt, dass wir unser Schicksal selbst in die Hände nehmen müssen. Die Sache der Bauern muss im Reichstag vertreten werden …«
Er erntet wie erwartet nur wenig Beifall. Eigentlich denken fast alle, dass es früher unterm Kaiser besser gewesen ist, weil man da wusste, woran man ist. Aber jetzt, wo sie im Reichstag nur noch herumstreiten und keiner weiß, wer eigentlich regiert – da versteht man gar nichts mehr.
»Den Reichslandbund, den kannst du vergessen!«, schreit der Otto Schütz und haut mit der Faust auf den Tisch. »Der taugt für uns hier im Dorf gar nix. Der kümmert sich nur um die fetten Großbauern drüben im Osten, aber net um uns hier in Dingelbach …«
»Das ist doch dumm Zeug …«, widerspricht Schorsch. Aber der Otto lässt sich jetzt das Wort nicht mehr nehmen, und richtig, Ida hat es ja gewusst: Jetzt hält er seine Lobrede auf die Nationalsozialisten.
»Das sind die richtigen Leut«, sagt er. »Die sagen, dass der Bauer auf seinen Hof gehört und dass es eine Sünd und eine Schand ist, einem Landwirt seinen Besitz zu nehmen. Das sagen die, und da haben sie recht!«
Er bekommt Zuspruch. Mehrere Bauern nicken, einige trommeln sogar mit den Fäusten auf die Tische.
»Da ist was dran, Otto!«
»Wo kommen wir hin, wenn sie den Bauern das Land wegnehmen?«
»Die werden sich noch wundern!«
»Jawoll! Wenn keiner sät und erntet, dann müssen alle miteinander verhungern!«
Im Prinzip haben sie ja recht, denkt Ida. Die Leute, die das Land kaufen, lassen es meistens brach liegen, das Unkraut sprießt nach Lust und Laune, was für die Bauern eine schlimme Sache ist. Aber die Spekulanten kaufen das Land ja auch nicht, um es zu bearbeiten. Sie kaufen es, weil sie ihr Geld anlegen wollen. Dass es eine Schweinerei ist, den Bauern alles zu nehmen, ist unbestritten. Aber dass die NSDAP ihnen das Heil bringen wird, das hält Ida für unwahrscheinlich. Florian hat ihr ein Buch geliehen, das vor zwei Jahren erschienen ist. Darin beschreibt der Vorsitzende der NSDAP, dieser Adolf Hitler, wie er Deutschland aus dem Elend zur Weltmacht führen will. Sie hat es für Schwachsinn gehalten, von einem Spinner geschrieben, der unter krankhafter Selbstüberschätzung leidet. Aber Florian hat behauptet, man müsse es ernst nehmen, dieser Mann sei gefährlich.
Auch Onkel Schorsch hält nichts von der NSDAP. Er geht jetzt zum verbalen Gegenangriff über.
»Das ist eine Bonzenpartei! Die kümmern sich einen Dreck um unsereinen, das lasst euch gesagt sein. Die tun nur jedem nach dem Mund reden, weil sie gewählt werden wollen. Vor allem den Weibsbildern schmieren sie Honig um die Mäuler …«
Da hat er die große Mehrheit der Anwesenden auf seiner Seite, es wird zustimmend gebrummelt und auf die Tische getrommelt. Eine Schande sei es, ruft einer, dass in der Republik auch die Frauenspersonen wählen dürfen, wo die doch gar nichts von der Politik verstünden.
»Ich hab’s meiner Hedi verboten«, prahlt der Schmidtkunz Jochen. »Das schickt sich doch net, dass eine Bäuerin sich in die Politik einmischt.«
Der Alberti Rudolf und der Killinger Hannes sind anderer Meinung, auch Lehrer Hohnermann verteidigt das Frauenwahlrecht, und so kommt es zu zornigen Worten und sogar Beschimpfungen.
»Wo die Weibsleut regieren, da machen se Weschlappe aus uns, des ist gewiss!«
»Ei freilich. Wenn einer schon ein Hahnepampel ist wie du, da braucht’s net mehr viel!«
»Was? Hahnepampel? Wart du nur, ich komm dir gleich …«
»Bitte, liebe Freunde!«, ruft Lehrer Hohnermann entsetzt. »Wir wollen doch hier nicht ernsthaft streiten!«
Doch niemand hört auf ihn. Das liegt daran, dass Lehrer Hohnermann zwar ein liebenswerter Mensch ist, aber keiner, der sich bei den Bauern Ansehen verschaffen könnte. Der Streit geht weiter, es ist, als hätte ein plötzliches Fieber die Männer erfasst, das ihr sonst so gemächlich kreisendes Blut zum Schäumen bringt. Otto Schütz hat einen knallroten Kopf bekommen und steht von seinem Stuhl auf, Onkel Schorsch starrt ihn an wie ein wütender Stier und hat die Fäuste geballt. Drüben am Nebentisch packt der Schmidtkunz Jochen den dürren Koppel Willi beim Hemd, und der Dippel Alfred macht sich bereit, in den Kampf einzugreifen, indem er rasch noch seinen Becher leert.
Ida ist klar: Das ist nicht nur der Alkohol, da steckt mehr dahinter. Die Sorgen, das Elend, der Zorn – alles, was die Männer schon so lange mit sich herumtragen – jetzt bricht es heraus.
»Aufhören!«, kreischt die Guckes Karin, die aus der Küche gerannt kommt. Auch der Guckes Jörg, der Wirt, versucht den Streit zu schlichten, obgleich er gerade eben selbst noch laut gegen das Frauenwahlrecht gebrüllt hat. Aber jetzt hat er Angst bekommen, denn der erste Becher ist schon am Boden zerschellt.
»So gebt doch Ruh!«, ruft er verzweifelt. »Den Becher, den zahlst du mir, Alfred! Willi, mach den Stuhl net kaputt. Ja, seid ihr denn vom wilden Watz gepickt?«
Ida packt ihren Onkel Schorsch bei der Schulter, um ihn davon abzuhalten, sich auf den Schütz Otto zu stürzen, da tönt auf einmal die Stimme des Rudolf Alberti, des Dorfheilers, durch die Gaststube.
»Aufhören! Ja, seid ihr denn Kindsköpp oder erwachsene Leut?«
Der Alberti Rudolf ist einer, der macht nicht viel Wind um sich, aber er wird von allen im Dorf respektiert. Augenblicklich wird es still in der Gaststube, die Streithähne halten inne, wie aus einem bösen Traum erwacht, starren einander feindselig an, murmeln Verwünschungen und lassen schließlich voneinander ab. Ida stellt fest, dass der Koppel Willi dem Schmidtkunz Jochen das Hemd zerrissen hat; er selbst hat einen blutigen Kratzer an der Wange abbekommen. Drei Becher sind in Scherben gegangen, ein Stuhl wurde zerbrochen, auf dem Boden haben sich mehrere klebrige Apfelweinpfützen ausgebreitet.
»Da leckt mich doch alle am Arsch!«, sagt der Schütz Otto. Er muss husten.
»Fängt ja gut an, das neue Jahr!«, knurrt Onkel Schorsch.
Der Müller Dippel kann es nicht lassen, er muss noch einmal sticheln. »Und ich sag’s euch: Weil sie die Weibsleut wählen lassen, deshalb geht’s mit uns allen bergab!«
»Halt endlich dein Schandmaul!«, keift ihn die Guckes Karin, die Wirtin, an.
Der Otto geht als Erster, er legt dem Wirt zwei Scheine hin, dann nimmt er seine Joppe über und bewegt sich schwankend zum Ausgang. Die anderen sehen ihm schweigend nach, dann verabschiedet sich der Dippel Alfred als Nächster, zahlt seine Zeche und geht. Einer nach dem anderen trinken sie aus, stehen auf, und wer Geld einstecken hat, der zahlt. Drei lassen anschreiben, dagegen kann die Guckes Karin nichts tun, denn was getrunken und gegessen wurde, das kann sie nicht mehr zurückfordern. Dafür droht sie den dreien mit dem Gerichtsvollzieher, aber da den armen Kerlen das Wasser ohnehin bis zum Hals steht, macht sie damit wenig Eindruck.
Ida muss noch die Becher und Gläser waschen und hat schließlich Mühe, wenigstens eine Mark fünfzig für ihre Arbeit herauszuhandeln, denn die Guckes Karin behauptet, mehr Schaden als Gewinn gehabt zu haben, und will ihr zunächst gar nichts geben.
»Dann kannst du in Zukunft deine Gäste selber bedienen«, sagt Ida wütend. »Und im Laden erzähle ich jedem, der es hören will, dass du die Leute umsonst arbeiten lässt. Und den Äppler, den hast du verlängert, das hab ich genau gesehen …«
»So gib ihr schon ihr Geld«, hat schließlich der Guckes Jörg seine Frau angeblafft. Da hat die Karin ihr lauter Groschen und Pfennige hingelegt, aber Ida hat genau gezählt und sich erst zufriedengegeben, als es richtig war.
Mit ihrem schwer verdienten Schatz geht sie hinüber in den Dorfladen, wo die Mutter doch tatsächlich hinter dem Ladentisch steht und die Seybold’sche bedient. Obgleich heute doch der erste Januar ist und der Laden geschlossen hat. Aber die Seybold’sche denkt wohl, dass man nur einen kirchlichen Feiertag heiligen muss.
»Ach, die Ida«, sagt die Frau Pfarrer, als sie den Laden betritt. »Bist im Wirtshaus gewesen, netwahr?«
»Hab der Karin geholfen«, sagt Ida kurz angebunden und will an ihr vorbei in die Küche gehen.
Die Frau Pfarrer lächelt wissend.
»Ei, da haben die Mannsbilder sich gewiss gefreut, dass sie was Hübsches zu sehen bekommen, netwahr? Aber wie man hört, hast du dir ja schon einen Bräutigam ausgesucht, Ida. Einen Städtischen, gelle?«
Woher weiß sie von Florian? Ida wechselt einen kurzen Blick mit ihrer Mutter und begreift, dass die ebenso verblüfft ist wie sie selbst. Dann kann es nur Herta gewesen sein, die wieder einmal den Mund nicht hat halten können. Läuft herum, als könnte sie kein Wässerlein trüben, und setzt heimlich Gerüchte über ihre Schwester in die Welt!
»Ja, freilich hab ich einen Bräutigam«, verkündet Ida frech. »Mehrere sogar. Dem König von England bin ich fest versprochen. Aber weil mir der spanische König halt besser gefällt, bin ich noch net ganz entschlossen. Und dann mag ich doch unseren guten, alten Reichspräsidenten, den Hindenburg, so gern …«
Die Seybold’sche starrt sie an, als rede sie chinesisch. Dann begreift sie, dass das freche Ding sich über sie lustig macht, und zieht den Mund schmal. »Hochmut kommt allweil vor dem Fall«, sagt sie spitz. »Ich hätt dann gern noch eine Schachtel Margarine, Frau Haller. Und ein Döschen schwarze Schuhwichse, die mit dem roten Frosch drauf.«
Ida geht um den Ladentisch herum in die Küche, wo Herta beim Herd sitzt und Milchkaffee trinkt. »Da bist du ja, Idchen. Ich wärm dir gleich dein Essen auf«, sagt sie und steht eilfertig auf.
Doch Ida ist nicht gewillt, die Sache unter den Tisch fallen zu lassen. »Das mach ich schon selber«, knurrt sie die Schwester an. »Brauchst mir nicht schönzutun, wenn du hinter meinem Rücken Geschichten über mich erzählst!«
Herta leugnet heftig. Kein Wort sei ihr über die Lippen gekommen. »Das schwör ich dir. Beim Amen in der Kirche!«
»Dass du nur ja keinen Meineid schwörst, du falsche Krott!«, sagt Ida giftig.
Da fängt die Herta doch tatsächlich an zu weinen wie ein kleines Kind. So erbärmlich muss sie schluchzen, dass Ida ganz anders wird und sie den Topf mit den Erbsen mit Rauchfleisch hinauf in die Schlafkammer trägt, weil ihr in der Küche bei der heulenden Schwester der Appetit vergeht.
Oben hockt sie sich auf ihr Bett, nimmt die Decke um die Schultern und stellt den Topf zwischen die gekreuzten Knie. Mit der Herta wird es immer schlimmer, denkt sie. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, sie hätte den Sirius Engelke geheiratet, auch wenn er Schulden hat und den Weiberröcken hinterherläuft. Es ist ja auch schon passiert, dass so einer in sich gegangen ist und ein besserer Mensch wurde, weil er die richtige Frau gefunden hat. Wobei sehr fraglich ist, ob ausgerechnet Herta ein solches Wunder hätte vollbringen können.
Ida kaut das zähe Rauchfleisch und starrt nachdenklich auf die zerkrumpelte Bettdecke. Wie einsam es hier oben ist, seitdem Frieda nach Bochum ins Engagement gefahren ist. Ach, sie vermisst die Schwester sehr! Frieda ist immer munter und voller Pläne; schlüpft in verschiedene Rollen, ahmt eine Freundin nach, einen Lehrer von der Schauspielschule, sie kann sogar den Schütz Otto, den Bürgermeister, nachäffen. Als Frieda noch im Nebenbett gelegen hat, da haben sie am Abend miteinander geflüstert und gekichert. Erst wenn auch Herta zu Bett gegangen ist, mussten sie still sein, weil die brave Herta sonst nicht einschlafen kann.
Wie sie gerade die letzten Reste aus dem Topf kratzt, hört sie unten auf der Straße ein Auto hupen. Sie springt aus dem Bett, der Topf rollt auf den Fußboden, Ida steht am Fenster und schaut hinunter auf die Dorfstraße. Sie kann gerade noch sehen, wie sich Onkel Schorschs Automobil drüben beim Schützhof in Bewegung setzt. Es qualmt ordentlich aus dem Auspuff, hinten steht der Knecht Hannes vom Schützhof und scheint angeschoben zu haben. Jetzt hört sie hastige Schritte auf der Treppe, und dann stürzt Herta ganz atemlos in die Schlafkammer.
»Stell dir vor, Ida«, keucht sie. »Onkel Schorsch muss den Schütz Otto nach Königstein in die Klinik fahren. Was mit dem Herzen – es geht um Leben und Tod, hat der Alberti Rudolf gesagt. Der Hannes hat ja anspannen wollen, aber Onkel Schorsch hat gesagt, mit dem Automobil geht es schneller. Hast du jemals einen solchen Blödsinn gehört? Wo das Automobil vom Onkel Schorsch doch an jeder Ecke stehen bleibt …«
Dann rennt sie wieder nach unten, weil vor dem Dorfladen mehrere Frauen stehen und die neuesten Nachrichten verbreiten.
Kapitel 2
Mitten in der Nacht wacht Frieda auf. Das Fenster steht sperrangelweit offen, grell und riesengroß schaut der Vollmond zu ihr hinein, die Gardinen flattern im Nachtwind. Einen Moment lang liegt sie wie erstarrt in den Kissen, glaubt, ein Geist oder schlimmer noch ein Einbrecher sei in ihr Zimmerchen eingedrungen und würde gleich nach ihr greifen. Dann kehrt ihr Verstand zurück.
Es stürmt draußen, denkt sie. Ich habe das Fenster nicht richtig geschlossen, und der Wind hat es aufgedrückt. Kein Grund zur Panik. Fröstelnd steht sie auf und muss auf einen Stuhl steigen, um die beiden Fensterflügel zu schließen. Zur Sicherheit ruckelt sie noch einmal fest am Fenstergriff, dann streckt sie dem neugierigen Vollmond die Zunge heraus und zieht die Vorhänge zu. So, du Spanner. Hier gibt’s nichts mehr zu sehen. Sie hat es eilig, wieder in ihr warmes Bett zu schlüpfen und sich in die Kissen einzukuscheln. Die kalten Füße muss sie mit den Händen reiben, bis sie wieder warm sind, aber das ist sie von zu Hause gewohnt: Ein geheiztes Schlafzimmer, wie es ihre Freundin Annemarie in Frankfurt bei den Eltern hat, kennt Frieda nicht. Und überhaupt schläft man im Kalten viel besser ein. Zumindest hat das die Mutter mal gesagt.
Mit dem Einschlafen klappt es jetzt leider gar nicht. Was ganz sicher nicht an dem gerade ausgestandenen Schrecken liegt – das wäre ja lächerlich. Es sind die vielen Gedanken, die auf einmal wie ein Schwarm hungriger Saatkrähen über sie herfallen und sie wach halten.
»Nachts darfst du nicht über die Dinge nachdenken«, hat die Kollegin Lilli Serina zu ihr gesagt. »Weil du dann alles schwarzsiehst.«
Sie hat sehr über ihren eigenen, witzigen Spruch gelacht, und auch Frieda fand es lustig. Auch wenn sie bei Lilli oft nicht so wirklich weiß, ob sie etwas ernst meint oder vielleicht doch einen Scherz macht.
»Die spinnt ein bisschen«, hat ein Kollege mal zu ihr gesagt. »Aber wenn sie auf der Bühne steht, dann ist sie göttlich.«
Lilli ist im Fach »Jugendliche Salondame« engagiert und beim Bochumer Publikum sehr beliebt. Ach ja – es ist aufregend und einschüchternd zugleich, so vielen großartigen Kollegen zu begegnen. Nein, Frieda hat keine Komplexe, sie weiß, was sie wert ist und was sie kann, sie hat ihre Erfolge, und die Presse ist ihr gewogen. Zum Beispiel wurde sie in dem Theaterstück Arm wie eine Kirchenmaus von Ladislaus Fodor für ihr »keckes und rührendes Spiel« gelobt, während das Stück selbst bei der Presse eher zurückhaltend aufgenommen wurde. Und nicht zuletzt haben zahllose Kinder ihr zugejubelt, als sie in den Wochen vor Weihnachten das Märchen von Peterchens Mondfahrt aufgeführt haben, wo sie das Peterchen spielt. Was für eine schöne Rolle! Oh, sie liebt es, wie ein kleiner Junge über die Bühne zu toben und hinauf zum Mond zu fliegen, um das verlorene Beinchen des armen Maikäfers Sumsemann zurückzuholen.
Womit sie wieder bei dem Vollmond gelandet ist, der sie immer noch nicht schlafen lässt. Ärgerlich dreht sie sich im Bett auf die andere Seite, und nun fällt ihr zu ihrem Unglück ein, dass es doch schön wäre, Idas und Hertas Atemzüge neben sich zu hören. Ach, dann fühlte sie sich gleich geborgen und könnte ganz sicher einschlafen. Aber so ist es doch beängstigend still um sie herum, nur die kleine Uhr auf ihrem Nachttisch tickt, und ganz selten rattert unten auf der Straße ein Automobil vorbei.
Jetzt sind sie da, die gierigen Krähen. Die ganze Schar hat sich auf ihrem Bett niedergelassen, und in ihrem Schatten wachsen die trüben Gedanken. Ja, sie hat Heimweh. Ganz schlimmes sogar. Manchmal weint sie am Abend in ihr Kopfkissen, weil ihr die Wiesen und Felder so fehlen, das kleine Dorf mit Schulhaus und Kirche und vor allem der Dorfladen, in dem sie so oft neben der Mutter gestanden hat, um den Dingelbacher Bäuerinnen Zucker, Salz, Knöpfe und Haarnadeln und allerlei anderes Zeug zu verkaufen. Wie verrückt ist das! Als sie noch in Dingelbach gewohnt hat, war es ihr heißester Wunsch, von dort fortzukommen. Und jetzt, wo sie in einer Stadt lebt und sogar am Theater arbeiten darf – da heult sie vor Sehnsucht nach dem Dorf.
Dabei hat sie heiße Kämpfe gegen die Mutter führen müssen, um schließlich doch nach Bochum ins Engagement zu dürfen. Dass sie inzwischen volljährig ist und ihren Vertrag selbst unterschreiben darf, hat die Mutter wenig beeindruckt. Sie hat sich bis zuletzt dagegen gesperrt, dass die Tochter ganz allein in die ferne Stadt Bochum zieht, um dort in diesem Sündenbabel, am Schauspielhaus, zu arbeiten. So sind sie letztlich im Unfrieden auseinandergegangen, und die Mutter hat ihr nicht einmal Lebewohl gesagt. Nur die Schwester Ida ist mit ihr nach Frankfurt gefahren, und dort auf dem Bahnhof haben sie voneinander Abschied genommen.
»Du musst an dich glauben, Frieda. Ich weiß ganz genau, dass du einmal eine berühmte Schauspielerin sein wirst«, hat Ida ihr Mut gemacht.
Ach ja! Bekümmert dreht sie sich auf den Rücken und schaut zum Fenster hinüber, wo das Mondlicht immer noch silbrig durch die Gardine schimmert. Nicht nachdenken, sagt sie sich. Schlafen. Du musst jetzt unbedingt schlafen, morgen um zehn ist Probe, und am Abend spielen wir die »Kirchenmaus«. Da musst du ausgeschlafen sein, sonst bist du schlecht, und das Publikum ist enttäuscht …
Aber statt in den so sehnsüchtig gewünschten Schlaf zu sinken, fällt ihr nun ein, dass sie nicht einmal an Weihnachten hat nach Hause fahren können. Einmal, weil ihr das Geld dazu gefehlt hat, denn ihre Anfängergage ist winzig, aber auch, weil sie am ersten und zweiten Feiertag auf der Bühne stehen musste. Da hat sie am Heiligen Abend ganz allein in ihrem Zimmerchen gesessen und langsam und feierlich das Paket ausgepackt, das ihre Lieben daheim ihr nach Bochum geschickt hatten.
Ach, das schöne wollene Schultertuch, das Herta für sie gehäkelt hat! Ida hat ihr ein Büchlein geschenkt, in das sie ihre Ideen für neue Theaterstücke eintragen soll, und dazu einen wunderschönen silberfarbenen Drehbleistift. Und die Mutter hat ihr trotz allem zwei Räucherwürste und eine Tafel Schokolade eingepackt. Einen langen Brief mit vielen guten Wünschen haben sie dazugelegt, den auch Onkel Schorsch, Tante Lina und ihre Cousine Luise unterschrieben haben.
Luise, mit der sie früher so gern Theater gespielt hat, ist inzwischen verheiratet und Mutter von drei munteren Knaben. Ob die Mutter ihr wohl die Zeitungsausschnitte mit den Kritiken zeigt, die sie schon mehrfach nach Hause geschickt hat? Schließlich sollen alle Dingelbacher wissen, dass sie Erfolg in ihrem Beruf hat und sogar in der Zeitung steht. Damit ihnen endlich einmal das Lästern vergeht …
Dann, endlich, verwirren sich ihre Gedanken, sie sieht den bärtigen Killinger Hannes vor sich und ihre Schwester Ida, die einen Schmiedehammer in der Hand hält und damit auf den Hengst Willibald steigen will, und dabei gleitet sie unmerklich in das bunte Land der Träume. Als der boshafte Wecker sie am Morgen aus dem Schlaf reißt, ist sie todmüde.
Nur noch ein paar Minuten, denkt sie. Gleich steh ich auf …
Um Viertel vor zehn fährt sie erschrocken hoch – o Gott, sie hat verschlafen! Raus aus dem Bett, schnelle Katzenwäsche, anziehen – wieso hat sie die seidenen Strümpfe gestern nicht gewaschen? Wo sind die Schuhe? Der Mantel? Haare kämmen nicht vergessen – Himmel, die sind heute wieder besonders störrisch. Für einen Kaffee ist es zu spät, sie schließt ihr Zimmerchen ab und rennt die Treppen hinunter. Im zweiten Stock kommt ihr Opa Hinrichs mit dem Dackel entgegen, sie ruft ihm nur rasch ein »Guten Morgen« zu und prescht an den beiden vorbei.
»Nur langsam, Frollein. Sonst brechen Sie sich noch die Beine …«
Zum Glück sind es nur wenig Minuten zum Schauspielhaus, und sie kommt noch nicht einmal als Letzte zur Probe: Kollege Mayenknecht erscheint nach ihr. Er entschuldigt sich damit, dass sein Automobil nicht anspringen wollte, und bekommt prompt zu hören, dass er in Zukunft besser die Straßenbahn nehmen solle. Saladin Schmitt, der Regisseur, ist unerbittlich, er kann Unpünktlichkeit auf den Tod nicht ausstehen.
»Shakespeare«, doziert er gleich zu Anfang. »Shakespeare braucht Komödianten. Da muss mit Herz und Sinnen gespielt werden, die Freude am Spiel muss auf die Zuschauer überspringen. So wie zu Shakespeares Zeiten im alten England. Klar? Also, in diesem Sinne. Erster Akt, erste Szene. Geht mal auf eure Positionen …«
Es ist nur eine Stellprobe, ein erstes Kennenlernen der Inszenierung, man darf noch mit Textbuch antreten, was Frieda nicht nötig hat, denn sie hat Wie es euch gefällt schon in der Schauspielschule gespielt, und die Celia ist eine ihrer Lieblingsrollen. Regisseur Schmitt ist pingelig, er zeichnet die Positionen der Schauspieler mit Kreide auf den Boden der Probebühne – bis hierher und nicht weiter, das muss man demnächst »verinnerlicht« haben. Kollege Mayenknecht mosert, er würde ja nur am linken Bühnenrand agieren, da könne er gleich hinter dem Vorhang bleiben.
»Ich bin Schauspieler – ich will gesehen werden!«
»Dich übersieht schon keiner!«
»Nein, so geht das nicht …«
Frieda setzt sich resigniert auf den Bühnenboden, wo sich schon Kollegin Beate niedergelassen hat.
»Jetzt diskutieren die wieder …«, stöhnt Beate.
»Meinst du, ich könnte mir im Büro rasch nen Kaffee holen?«, überlegt Frieda, die sich ziemlich unausgeschlafen fühlt. Hunger hat sie auch.
»Nee, besser nicht«, rät ihr Beate. »Wir sind bestimmt gleich wieder dran.«
Und Beate hat recht. Mayenknecht hat einen Auftritt in Bühnenmitte herausgehandelt, der große Saladin Schmitt ist ja kein Unmensch, er hat ein Einsehen gehabt. Die Probe geht weiter, zieht sich länger hin als gedacht. Frieda ist immer froh, wenn sie dran ist, weil die Müdigkeit dann sofort verfliegt. Nur wenn sie herumhockt und den Kollegen zuschauen soll, fallen ihr fast die Augendeckel herunter.
Gegen Mittag, als ihr der Magen schon in den Kniekehlen hängt, macht Schmidt endlich Schluss. »Es wird«, knurrt er und steckt den Bleistift ein. »Ist aber noch viel zu tun.«
Beate schwärmt von dem Kostüm, das für sie genäht wird. Märchenhaft! Grün sei genau ihre Farbe. »Mit langen Tütenärmeln wie im Mittelalter. Aber der Stoff ist leicht und luftig …«
Frieda bekommt das gleiche Kleid in Dunkelrot geschneidert. Passend zu dem Kostüm ihres Partners, des ellenlangen, dünnen Alexander Collin.
»Ich glaube, das wird eine ganz tolle Sache, Friedchen«, sagt Beate. »Kommst du mit ins Café? Du siehst aus, als könntest du dringend einen Kaffee brauchen, du Ärmste.«
»Nee, heute nicht. Bis heute Abend dann …«
»Nun komm schon«, drängelt Beate und legt den Arm um sie. »Ich lad dich ein. Ich weiß doch, wie das ist, wenn man ganz am Anfang steht.«
»Lieb von dir«, wehrt sich Frieda. »Aber ich hab schlecht geschlafen und hau mich jetzt in die Falle.«
»Na, dann tu, was du nicht lassen kannst«, seufzt Beate enttäuscht. »Schlaf dich aus, damit du heute Abend etwas taugst.«
Frieda stellt den Mantelkragen hoch, weil es schon wieder schneit, und beeilt sich, das vierstöckige Wohnhaus zu erreichen, in dem sich ganz oben unterm Dach ihr Zimmerchen befindet. Nein, sie mag sich nicht aus Mitleid einen Kaffee und ein Stück Kuchen bezahlen lassen, auch wenn’s gut gemeint ist. Sie hat auch ihren Stolz. Die Straßen und Fußwege sind zwar geräumt, aber glatt, weil es in der Nacht gefroren hat, und zusätzlich haben ein paar Rangen auf dem Trottoir Schlitterbahnen angelegt. Frieda macht es nichts aus, sie nutzt eine der eisglatten Bahnen, um rascher voranzukommen, und dann muss sie sich schnell an dem eisernen Gitter festhalten, das im Torbogen des Wohnhauses angebracht ist.
»Frieda! Fräulein Haller! Um Himmels willen!«, hört sie eine erschrockene Männerstimme, die ihr gut bekannt ist.
Das kann doch gar nicht sein! Ist das wirklich Lehrer Hohnermann aus Dingelbach, der sie gerade beim Arm gefasst hat, weil er fürchtete, sie würde hinfallen? Oder sieht sie schon Gespenster?
»Was … Wie kommen Sie denn hierher?«, entfährt es ihr verblüfft.
Ist er jetzt gekränkt? Ach nein, er lacht. Weil er so viele Narben im Gesicht hat, kann man es nicht gleich erkennen. Der arme Mensch hat im Weltkrieg einen ganzen Haufen Granatsplitter abbekommen, die meisten im Gesicht.
»Das ist eine Überraschung, nicht wahr?«, meint er ein wenig verlegen. »Ich hatte heute ganz zufällig in Bochum zu tun, und da dachte ich …«
Es wird ihm bewusst, dass er sie immer noch am Arm hält, und er lässt sie rasch los.
»Da habe ich gedacht, ich schaue einmal bei Ihnen vorbei.«
»Eine großartige Idee!«, meint Frieda, die sich inzwischen gefasst hat. »Nein, ich freu mich riesig, endlich wieder jemanden aus Dingelbach zu sehen.«
»Tatsächlich?«, fragt er und lächelt, weil er spürt, dass ihre Freude ehrlich ist. »Nun, dann darf ich Sie vielleicht zum Essen ausführen? Es ist ja Mittagszeit, da wäre es doch passend.«
In der Tat stirbt sie fast vor Hunger, aber sie denkt auch daran, dass der Lehrer Hohnermann nur ein kleines Gehalt bekommt, und es ist ihr unangenehm, von ihm eingeladen zu werden. Auf der anderen Seite kann sie Johannes Hohnermann nicht so einfach in ihr Zimmer mitnehmen, um ihm dort einen Kaffee zu kochen und ihm den Rest ihrer Kekse anzubieten. Das würde ihr die Hausbesitzerin, die unten wohnt und dauernd durch ihren Türspion glotzt, übel anrechnen. Herrenbesuche sind bei einer jungen Schauspielerin stets verdächtig, auch tagsüber und nicht erst am Abend nach zehn Uhr.
»Sehr gern. Aber nur eine Kleinigkeit«, meint sie. »Kommen Sie, ich kenne ein gemütliches Gasthaus, da wird es Ihnen gefallen.«
»Die Hauptsache ist, dass es Ihnen gefällt, Frieda …«
»Sowieso. Ich bin ja ganz hibbelig vor Freude, weil Sie gekommen sind, Herr Hohnermann! Was hatten Sie denn so zufällig hier zu tun? Hat es etwas mit Ihren Kompositionen zu tun?«
Sie fasst ihn ganz ungeniert unter den Arm, was er gutmütig duldet, schlittert hin und wieder über eine glatte Stelle und redet auf ihn ein. Ach, wie schön das ist! Da ist tatsächlich ein Stück Heimat nach Bochum gekommen. Und überhaupt hat sie oft an ihn gedacht und sich gefragt, ob er wohl mit seinen Sinfonien und Orgelsonaten irgendwo erfolgreich gewesen ist. Außerdem hat er einige Texte von ihr vertont, hübsche kleine Couplets, die sie vor zwei Jahren in Dingelbach aufgeführt haben.
»Mit meinen Kompositionen? Eher nein. Ich habe einen lieben Kollegen besucht, mit dem ich seinerzeit gemeinsam studiert habe.«
»Aber Sie müssen die Sachen unbedingt an einen Musikverlag schicken! Wenn die Lieder einfach so herumliegen, kann ja jeder behaupten, er hätte sie komponiert, verstehen Sie?«
Sie erzählt ihm, dass die Aufführung von Wie es euch gefällt ebenfalls mit Musik und musikalischen Einlagen stattfinden wird und dass der Komponist persönlich kommt, um die Sachen mit ihnen einzuüben.
»Der verdient nicht schlecht daran«, behauptet sie. »Und in der Zeitung steht er dann auch. Dabei sind seine Sachen lange nicht so gut wie Ihre Musik!«
Sie hat ihn in eine schmale Seitenstraße geführt, wo es in einem Eckhaus das Gasthaus »Zum Adler« gibt, eine kleine Kneipe, die hauptsächlich von Arbeitern aufgesucht wird. Auch sie und einige ihrer Kollegen lassen sich hier ab und zu sehen, weil man preiswert und sättigend essen kann und das Bier billig ist.
Lehrer Hohnermann hat sich wohl ein luxuriöseres Gasthaus vorgestellt, denn er mustert stirnrunzelnd die schiefen Fenstersimse und den bröckelnden Putz der Hauswände.
»Hier? Aber ist das nicht ein wenig … einfach?«
»Das ist ein typisches Bochumer Gasthaus«, behauptet sie eifrig, wobei sie das Wort »Kneipe« vorsichtshalber vermeidet. »Sie wissen ja – hier in der Stadt sind Stahl und Kohle zu Hause, da legt man keinen Wert auf teuren Schnickschnack. Kommen Sie – wenn wir Glück haben, ist drinnen noch ein Tisch frei.«
Sie ist nicht sicher, ob er ihr glaubt, aber er folgt ihr willig, obgleich ihnen gleich am Eingang ein dichtes Gemisch aus Rauch, Bier, Schnaps und gekochtem Kohl entgegenschlägt. Natürlich ist es brechend voll – das hat sie schon befürchtet. Die Wirtin trägt Teller mit Eintopf und Bierkrüge aus, der Wirt steht mit hochgekrempelten Hemdsärmeln am Tresen und zapft Bier. Als er Frieda sieht, grinst er breit, wobei er oben mittig eine Zahnlücke entblößt.
»He, Elli!«, schreit er durch die Kneipe. »Den Tisch am Fenster für das Fräulein Haller vom Theater!«
Seine bessere Hälfte schaut zu Frieda und ihrem Begleiter hinüber, stellt schwungvoll den letzten Teller vor einen Gast und deutet dann mit dem Daumen nach links. Dort steht ein kleines Tischlein mit zwei Stühlen am Fenster, ein junger Mann sitzt daran, hat einen Kaffee getrunken und raucht eine Zigarette. Wie es scheint, ist er kein Stammgast, dazu ist er zu gut gekleidet. Vermutlich ist er fremd in Bochum, und der Zufall hat ihn hierhergeführt.
»Der Herr wollte gewiss gerade gehen«, sagt die stattliche Wirtin und baut sich vor ihm auf. »Macht eins zwanzig, der Kaffee.«
Der Fremde zeigt sich unwillig, hebt indigniert die Augenbrauen und fragt, ob es hier Sitte sei, die Gäste hinauszuwerfen, sobald sie ihre Bestellung verzehrt hätten.
»Überhaupt nicht«, versichert die Wirtin ungeniert. »Aber Sie wollen doch nicht, dass wir das Fräulein Haller wieder auf die Straße schicken müssen, oder?«
»Soso. Das Fräulein Haller …«
Er schaut zur Eingangstür hinüber, wo Frieda und ihr Begleiter die Verhandlung mit unguten Gefühlen verfolgen. Frieda fühlt sich von den grauen Augen des Fremden eingehend gemustert.
»Es ist wohl besser, wir gehen wieder«, meint Hohnermann leise zu ihr.
Frieda zögert noch, aber auch ihr ist es peinlich, dass die Wirtsleute ihr derart rigoros einen Tisch besorgen.
»Ja, wenn das so ist«, sagt jetzt der junge Mann drüben vernehmlich und drückt die Zigarette aus. »Dann weiche ich natürlich mit dem größten Vergnügen. Bitte sehr, verehrtes Fräulein. Der Stuhl ist noch angewärmt.«
Er steht auf, legt einige Münzen auf den Tisch, die er offenbar lose in der Jackentasche herumträgt, dann zieht er den Mantel über und nimmt seinen Hut.
»Es tut mir leid«, sagt Frieda, als er an ihnen vorüber zum Ausgang geht.
Er lächelt. Keineswegs uncharmant. Aber kühl. »Aber ich bitte Sie! Das ist doch nicht der Rede wert.«
Leicht bedrückt setzen sie sich an den Fenstertisch, den die Wirtin mit routinierten Bewegungen abräumt und sauber wischt. Tischdecken gibt es hier nicht, es wird auf dem blanken Holz serviert, auch eine Speisekarte sucht man vergeblich, nur ein Aschenbecher und ein Salzstreuer stehen dem Gast zur Verfügung.
»Was darf’s denn sein?«, fragt die Wirtin mütterlich. »Heut gibt’s Eintopf mit Rindfleisch und Erbsen oder Boulette mit Spiegelei.«
Frieda will lieber Boulette mit Ei, weil sich die Erbsen am Abend unangenehm bemerkbar machen könnten. Dazu eine Limonade und hinterher einen Kaffee. Hohnermann gönnt sich ein Bierchen zur Boulette und wird der Wirtin als »Musiker und Komponist« vorgestellt.
»Sind Sie auch am Theater?«, will die Wirtin wissen.
»Aber nein. Ich bin Lehrer und Organist.«
»Ach, so einer sind Sie …«, kommt die enttäuschte Antwort.
Frieda ärgert sich, weil Lehrer Hohnermann so gar kein Talent hat, sich bei den Leuten darzustellen. Bescheidenheit ist ja bekanntermaßen eine Zier, aber voran kommt man damit eher nicht. Ach, so ist er nun einmal, und im Grunde findet sie es ja liebenswert. Sie mag ihn überhaupt wahnsinnig gern, diesen grundehrlichen, anständigen Burschen, der sein großes Talent, die Musik, hintanstellt, um den Dingelbacher Kindern das Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen.
»Schauen Sie doch, wie hübsch das aussieht«, meint sie und weist auf das Fenster, hinter dem die Schneeflocken tanzen.
Er bestätigt dies, schaut aber kaum hin, sondern hat nur Augen für sie. Und er fragt. Ob sie zufrieden wäre? Ob das Engagement ihre Hoffnungen und Erwartungen erfüllen würde. Ob sie nette Kollegen hätte. Alles scheint ihn zu interessieren. Während sie erzählt, hört er beinahe andächtig zu, nippt an dem Bier, das die Wirtin vor ihn hingestellt hat, und fragt immer weiter.
»Hat Ihnen die Mutter nicht meine Kritiken gezeigt?«, wundert sich Frieda. »Nein? Das ist aber schade. Ja, so ist sie halt. Wahrscheinlich hat sie meine Briefe und die Zeitungsausschnitte ganz hinten in der Nachttischschublade versteckt, damit nur keiner in Dingelbach erfährt, dass die Frieda Haller in Bochum Theater spielt …«
Frieda ist jetzt in Fahrt, alle Müdigkeit ist verflogen, und sie bringt ihr Gegenüber mit ihren Geschichten immer wieder zum Lachen. Wie sie in Peterchens Mondfahrt beinahe von dem großen Eisbären heruntergefallen ist, den die Bühnenarbeiter aus Holzbalken und Plüsch gebaut haben, und wie sie in einer Aufführung ihrem Kollegen aus Versehen eine richtige Ohrfeige gegeben hat, anstatt den Schlag nur anzudeuten.
Als dann die lecker dampfenden Bouletten mit Spiegelei gebracht werden, will sie von ihm wissen, was es denn in Dingelbach an Neuigkeiten gäbe.
»Nun ja – bei uns im Dorf läuft das Leben gemächlicher«, meint er. »Zwei Hochzeiten hat es gegeben, die Erna Guckes vom ›Raben‹ hat einen Mann aus Steinbach geehelicht, und der älteste Sohn vom Dippel Alfred, der Julius, hat die Ella Schmidtkunz heimgeführt.«
Da schau her, denkt Frieda. Die Ella ist nur ein Jahr älter als ich, und auch Cousine Luise ist längst »unter der Haube«. Das würde der Mutter gewiss gefallen, wenn auch ich geheiratet hätte und als brave Ehefrau eines Dingelbacher Bauern auf dem Acker stehen würde. Aber da kann sie lange warten.
»Jung gefreit hat selten gereut«, bemerkt sie heiter. »Und was ist mit Ihnen, Herr Hohnermann? Sie müssen sich auch endlich eine Frau suchen und eine Familie gründen. So ein ewiger Junggeselle, das taugt doch nicht!«
Provozierend lächelt sie ihn an und stellt fest, dass er vor Verlegenheit rot wird. Was wegen der Narben in seinem Gesicht immer etwas seltsam ausschaut.
»Ich fürchte, mich will keine haben«, sagt er dann schmunzelnd. »Und bevor mich eine aus Mitleid nimmt, bleib ich doch lieber ledig.«
»Das glaub ich net«, beharrt sie. »Aber warten Sie, wenn Sie erst ein berühmter Komponist sind und Ihre Lieder durchs Radio kommen – dann werden Ihnen die Bräute nur so hinterherlaufen!«