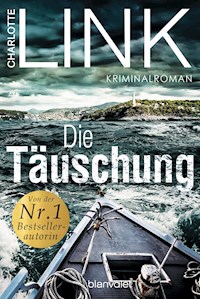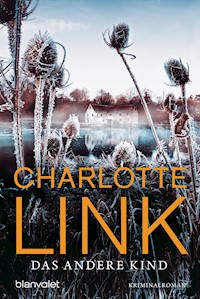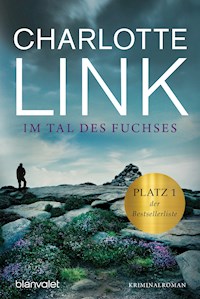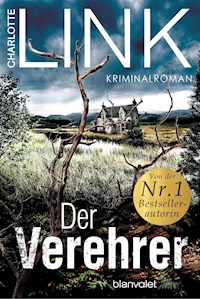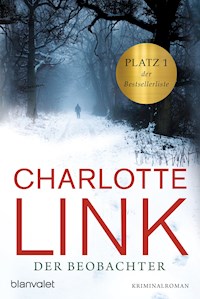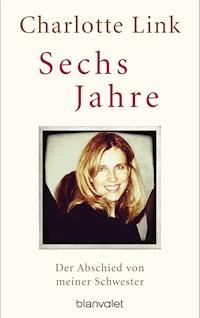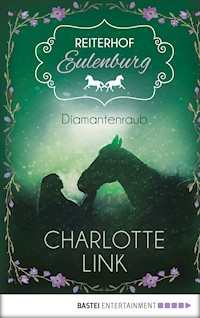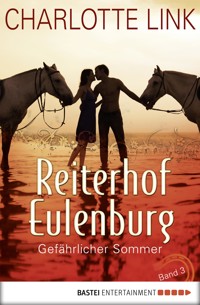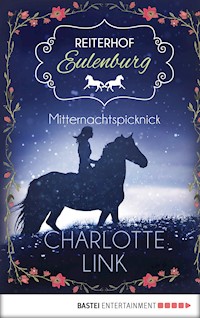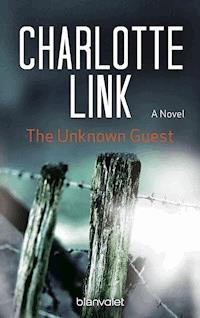Inhaltsverzeichnis
Buch
DONNERSTAG, 25. MAI 1995
FREITAG, 26. MAI 1995
SAMSTAG, 27. MAI 1995
SONNTAG, 28. MAI 1995
SONNTAG, 4. JUNI 1995
MONTAG, 5. JUNI 1995
DIENSTAG, 6. JUNI 1995
MITTWOCH, 7. JUNI 1995
DONNERSTAG, 8. JUNI 1995
FREITAG, 9. JUNI 1995
SAMSTAG, 10. JUNI 1995
MITTWOCH, 14. JUNI 1995
Bericht aus der Berliner Morgenpost vom 15. September 1999
Prolog
Copyright
Buch
Janet Beerbaum würde alles für ihre Söhne tun. Die Zwillinge Maximilian und Mario, die sich gleichen wie ein Ei dem anderen, standen schon immer im Mittelpunkt ihres Lebens. Für sie hat Janet sogar vor Jahren auf ihre große Liebe verzichtet, um den Jungen die Familie und den Vater zu erhalten. Doch eine Tragödie erschütterte damals jäh das Leben aller Familienmitglieder...
Maximilian, der die vergangenen sechs Jahre in einer psychiatrischen Klinik verbracht hat, steht kurz vor der Entlassung. Aber sein Vater Philipp weigert sich, den jungen Mann wieder in die Familie aufzunehmen. Verzweifelt fährt Janet nach London und flüchtet sich in die Arme ihres einstigen Liebhabers. Doch dann erreicht sie ein besorgter Anruf aus Deutschland: Mario ist mit seiner Freundin in die Provence gereist, um dort einen Urlaub zu zweit zu verbringen. Und Janet bricht Hals über Kopf nach Frankreich auf. Warum nur gerät sie so sehr in Panik? Werden die Schatten der Vergangenheit sie ewig verfolgen? Welches furchtbare Geheimnis teilt sie mit ihren über alles geliebten Söhnen?
Charlotte Link schreibt so gut und so britisch,daß selbst ihre englische KolleginMinette Walters vor Neid erblassen würde!SWR
Charlotte Link beweist außergewöhnliches Talentfür spannende Unterhaltung.dpa
Die Schriftstellerin Charlotte Link versteht es prachtvoll,Lebenslinien zu einem Spannungsnetz zu verknüpfen.GONG
Denn es ist hier kein Unterschied:Sie sind allzumal Sünder...(RÖM. 3,23)
DONNERSTAG, 25. MAI 1995
Das Ringlestone Inn war, wie der Wirt stolz erklärte, im Jahre 1533 erbaut worden und diente seit dem 17. Jahrhundert als Pub - und seither hatte sich kaum etwas darin verändert. Die niedrige Decke wurde von schweren, rußgeschwärzten Eichenholzbalken getragen, bleigefaßte Butzenglasscheiben setzten sich zu winzigen, in die dicken, weiß gekalkten Mauern eingelassenen Fenstern zusammen. Ein gewaltiger gemauerter Kamin empfing die Gäste gleich am Eingang mit einem prasselnden Feuer. Um von einem Raum in den nächsten zu gelangen, mußte man den Kopf einziehen und darauf achten, nicht über unvermutet auftauchende Stufen oder Bodenleisten zu stolpern. Bänke, Stühle und Tische standen dicht gedrängt, uralte Lampen schaukelten von der Decke. Niemand hätte sich ernsthaft gewundert, wäre plötzlich Oliver Cromwell hereingestapft, in Stulpenstiefeln und mit Federhut, im wehenden, schwarzen Mantel, mit wachsamem Blick, mißtrauisch, ob sich Royalisten in einem Winkel des Hauses versteckt hielten.
Auf dem Platz neben dem Haus sollten Pferde stehen, nicht Autos parken, dachte Janet, sie würden weit besser hierher passen.
Schon die ganzen letzten Stunden war sie sich vorgekommen wie in ein weit zurückliegendes Jahrhundert versetzt. Sie war von London hergefahren, hatte die Straße Richtung Dover jedoch kurz vor Rochester verlassen und war nach Süden abgebogen. Der Weg führte sie durch idyllische, vom Fortschreiten der Zeit scheinbar vergessene Dörfer, vorbei an stillen, verträumten Häusern aus elisabethanischer Zeit, die umgeben waren von moosbewachsenen, bröckeligen Mauern, entlang zugewucherter Gärten, deren Bäume über die holprige Straße hinweg Dächer aus Blättern und Zweigen bildeten. Irgendwann zeigten ihr die Schilder an, daß sie bald an der Küste landen würde, und gleichzeitig wurde ihr bewußt, daß sie seit dem knapp bemessenen Imbiß im Flugzeug am Morgen nichts mehr gegessen hatte. Sie beschloß, abseits von der Hauptstraße ein wenig kreuz und quer herumzufahren und die Augen nach einem Gasthaus offenzuhalten. Der Maiabend war hell; der Himmel war, nach einem Tag voller Regen, plötzlich leergefegt von allen Wolken und sandte eine Flut von Sonne über das feuchte, dampfende Land. Janet hatte Kent immer gemocht, sich aber selten so verzaubert gefühlt wie an diesem Abend. Ihre Sorgen hatten sich mit den Wolken aufgelöst. Für einige Stunden war sie eine Frau ohne Vergangenheit oder Zukunft, ohne Verpflichtungen, ohne Bindungen. Niemand wußte, wo sie war, niemand konnte etwas von ihr erwarten oder verlangen.
Als sie vor dem Ringlestone Inn hielt und aus dem Wagen stieg, fröstelte sie in der frischen Abendluft und hatte sich dennoch in ihrem Innern lange nicht mehr so warm gefühlt.
»Sie möchten sicher nach Folkstone?« fragte der Wirt. Janet schüttelte den Kopf. »Nein. Ich fahre wahrscheinlich heute noch nach London zurück.« Sie strich sich mit beiden Händen über die nackten Arme und wies mit einer Kopfbewegung auf den leeren Tisch vor dem Kamin. »Darf ich mich da hinsetzen?«
»Selbstverständlich.« Eifrig rückte ihr der Wirt einen Stuhl zurecht. Janet nahm Platz. Es herrschte eine brütende Hitze am Feuer, sie würde es kaum länger als eine halbe Stunde dort aushalten, aber sie konnte ihre Knochen aufwärmen, und vielleicht trockneten ihre noch immer regenfeuchten Schuhe. Sie ließ den Blick umherschweifen und stellte fest, daß sich wohl vorwiegend Leute aus den umliegenden Dörfern hier aufhielten; ältere Männer, die Bier tranken, politisierten, über die nächste Ernte fachsimpelten. Niemand beachtete Janet. Das wohlige Gefühl der Entspanntheit verstärkte sich. Sie bestellte Huhn mit Reis und ein Glas Ginger Ale und machte sich darüber her wie eine Verhungernde. Sie ließ keinen Krümel auf dem Teller zurück, und als sie fertig war, verzehrte sie zum Nachtisch noch ein Stück Kuchen. Seit Jahren litt sie an Eßstörungen, mußte häufig erbrechen, aber sie spürte, daß sie dies heute nicht zu fürchten brauchte. Sie würde alles bei sich behalten.
Als sie ihren Kaffee trank und dazu eine Zigarette rauchte, gesellte sich der Wirt zu ihr. Er war erpicht auf eine Unterhaltung und leitete sie originellerweise mit einer Bemerkung über das Wetter ein. »War wohl besseres Wetter da, wo Sie herkommen?« fragte er. Janet runzelte die Stirn.
»Weil Sie so sommerlich angezogen sind«, erklärte er.
Janet sah an sich hinunter. Kurzärmeliger Baumwollpullover, ein leichter Rock, feuchtfleckige Wildlederschuhe. Sie lachte. »Ich bin heute früh von Hamburg nach London geflogen. In Hamburg war es richtig warm.«
»Hamburg? Da war mein Vater mal nach dem Krieg!«
»Wirklich?« sagte Janet. Der Wirt sah sie strahlend an, als hätten sie gerade einen gemeinsamen Urahn ausfindig gemacht. Sie fühlte sich bemüßigt, erklärend hinzuzufügen: »Ich bin aber gebürtige Engländerin.«
»Wie lange leben Sie schon in Deutschland?«
»Seit fünfundzwanzig Jahren. Ich habe einen Deutschen geheiratet.«
Sie erschrak fast bei dieser Auskunft. Ein Vierteljahrhundert! Mit achtzehn war sie fortgegangen. Zu jung, um zu wissen, was sie tat.
»Und jetzt statten Sie der Heimat einen Besuch ab«, stellte der Wirt fest. »Es ist schön, nach Hause zu kommen, nicht? Sie stammen aus dieser Gegend?«
»Nein. Ich bin in Cambridge geboren und aufgewachsen. Und heute wollte ich eigentlich nach Edinburgh.«
»Oh...« Der Wirt zeigte sich überrascht. Es schien ihm eigentümlich, daß jemand nach Edinburgh wollte und statt dessen im Ringlestone Inn zwischen Maidstone und Canterbury im Südosten Englands landete.
Janet warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »In zehn Minuten startet mein Flugzeug von Heathrow nach Edinburgh«, sagte sie zufrieden.
»Na, den Flieger erwischen Sie nicht mehr«, meinte der Wirt und lachte etwas verlegen. Ihm ging allmählich auf, daß mit der Frau irgend etwas nicht stimmte. Er hätte nicht sagen können, was ihm dieses Gefühl gab, aber es war etwas an ihr... Sie schien entspannt, aber Angst und Unruhe lagen spürbar auf der Lauer.
»Na ja«, meinte er unsicher, »es gehen jeden Tag Flüge nach Edinburgh, nicht? Dann fliegen Sie eben morgen.«
»Ich glaube«, sagte Janet, »daß ich überhaupt nicht fliegen werde.«
Im Grunde hatte sie das schon am Vormittag beschlossen, als sie gegen zehn Uhr in London aus dem Flugzeug stieg. Sie hatte die Flüge absichtlich so gebucht, daß ihr elf Stunden Aufenthalt dazwischen blieben; dann könne sie, hatte sie Phillip, ihrem Mann, erklärt, ein ausgedehntes sightseeing in London einlegen.
»Als ob du London nicht kennen würdest wie deine Westentasche!« hatte Phillip bemerkt. »Was willst du denn noch anschauen?«
»Ich war lange nicht mehr da. Ich will einfach London atmen, riechen, fühlen.«
In Wahrheit wollte sie in den elf Stunden irgendeinen Weg finden, Edinburgh zu vermeiden.
Aus dem sightseeing wurde nichts, der Regen floß in Strömen und wurde eher heftiger, als daß er nachließ. Janet flüchtete schließlich zu Harrod’s und ließ sich durch die Stockwerke treiben. Sie kaufte Tee, Orangenmarmelade und Cookies für Phillip, eine Swatch-Uhr für Mario. Sie bezahlte ein Pfund, um Zugang zu den luxuriösen Gold- und Marmortoiletten im ersten Stock zu bekommen, und versuchte dort, sich ein wenig frisch zu machen. Der Spiegel über dem Waschbecken zeigte ihr, daß sie ziemlich zerrupft aussah. Ihre regennassen Haare kräuselten sich zu eigenwilligen Locken, ihr blasses Gesicht hatte jeden Anflug von Farbe verloren. Mit Lippenstift und Rouge polierte sie es etwas auf, aber der verhärmte, sorgenvolle Ausdruck blieb. Um ihrem Kreislauf etwas auf die Beine zu helfen, trank sie in einem Stehimbiß im Keller zwei Gläser Sekt. Danach fühlte sie sich so weit wiederhergestellt, daß sie in der Lage war, zum Flughafen zurückzufahren, ein Auto zu mieten und sich, soweit sie konnte, von der Hauptstadt zu entfernen. Der Linksverkehr bereitete ihr zunächst einige Probleme, aber als sie sich auf der Autobahn befand, wurde es besser, und später, auf den kleinen Landstraßen in Kent, fühlte sie sich schon sehr sicher. Immer wieder murmelte sie vor sich hin: »Ich muß nicht fliegen, wenn ich nicht will. Ich muß überhaupt nichts tun, was ich nicht will!«
Aber sie wünschte, sie hätte die Souveränität besessen, einfach hinzugehen und den Flug nach Edinburgh zu stornieren, anstatt sich selbst auszutricksen und etwas zu tun, das sie daran hinderte, pünktlich wieder in Heathrow zu sein. »Immer noch das kleine Mädchen, das keine Verantwortung für sein Tun und Lassen übernehmen will«, murmelte sie unzufrieden vor sich hin.
Immerhin, ihre Flucht vor der Verantwortung hatte ihr einen schönen Tag beschert. Sie war in England herumgekurvt und hatte ein bezauberndes Pub entdeckt. Dies erinnerte sie an die Zeit mit Andrew. Mit ihm war sie oft ins Blaue losgefahren und dann irgendwo eingekehrt, am liebsten in Orten, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagten.
Der Wirt hatte sich für einige Augenblicke entfernt und kehrte nun mit zwei Schnapsgläsern zurück. »Einladung des Hauses«, erklärte er. Er hob sein Glas. »Auf Ihr Wohl!«
Janet prostete ihm zu, beide leerten sie in einem Zug ihre Gläser.
»Und wann kehren Sie nach Deutschland zurück?« fragte der Wirt.
Janet zuckte mit den Schultern. »Eigentlich morgen. Aber wer weiß...« Sie vollendete den Satz nicht, und um das Thema zu wechseln, fragte sie ihrerseits zurück: »Gehört Ihnen das Ringlestone Inn?«
»Nein, nein. Ich arbeite hier nur. Ich wohne in Harrietsham.«
»Aha.«
»Ich habe eine Frau und fünf Kinder«, sagte er stolz, »das sechste ist unterwegs!«
Janet schauderte ein wenig, verbarg ihr Entsetzen jedoch.
»Ich wollte immer viele Kinder«, erklärte der Wirt. »Haben Sie Kinder?«
»Ja. Zwei.«
»Jungen oder Mädchen?«
»Zwei Jungen. Zwillinge.«
»Zwillinge!« Der Wirt war entzückt. »Das haben wir noch nicht geschafft! Wie alt sind die beiden?«
»Vierundzwanzig.«
»Was? Dafür sehen Sie viel zu jung aus!«
Janet lächelte. »Danke. Ich war neunzehn, als sie geboren wurden.«
»Und sie sehen einander wirklich gleich?«
»Völlig. Ich meine, ich kann sie natürlich auseinanderhalten. Der Ausdruck ihrer Augen, das Lachen... Ich würde sie nie verwechseln. Aber andere Leute sind unfähig, sie zu unterscheiden. Sogar ihren Vater haben sie immer wieder hinters Licht führen können.«
Der Wirt war so fasziniert und bohrte so lange nach, bis sie ihm ein Photo zeigte. Sie hatte nur eines dabei; da waren die Jungen zehn und saßen am Eßtisch im Wohnzimmer. Beide trugen die gleichen roten Rollis und blauen Jeans. Aus sanften Augen blickten sie in die Kamera. Zu sanft, wie Janet wieder einmal dachte. Zwei kleine Engel.
Der Wirt konnte sich kaum beruhigen. »Das ist nicht zu fassen! Nicht der geringste Unterschied! Guter Gott, ich würde nie wissen, wer welcher ist!«
»In der Schule wußten es die Lehrer auch nie. Einige Male haben sie mich gebeten, die beiden wenigstens unterschiedlich anzuziehen, aber da war nichts zu machen. Sie wollten immer die gleichen Sachen tragen. Sie waren...« Janet stockte, aber dann fuhr sie doch fort: »Sie fühlten sich wie ein Mensch, verstehen Sie? Ständig tauschten sie die Namen, weil sie keine Bedeutung für sie hatten. Und sie sprangen immer füreinander ein.«
Der Wirt starrte wieder auf das Bild. »Wahnsinn!« murmelte er.
»Das hier ist Maximilian«, erklärte Janet. »Und das ist Mario. Er ist fünfeinhalb Minuten älter.«
»Liebe Gesichter haben sie, nicht? Da müßten Sie mal meine fünf sehen. Rotzfreche Gören, mit allen Wassern gewaschen!«
Natürlich hatte er stapelweise Bilder dabei, die er Janet nun präsentierte. Seine drei Söhne hatten allesamt Zahnlücken und Sommersprossen, seine zwei Töchter sahen ebenfalls aus wie Jungen und streckten auf den meisten Photos die Zunge heraus. Janet fand sie ziemlich gewöhnlich und plump, aber das mochte auch daran liegen, daß die Diskrepanz zwischen diesen Kindern und ihren eigenen zu groß war und ihr dies schmerzlich auffiel. Sie sagte höflich: »Wie nett!« und: »Wirklich reizend!«, dann griff sie entschlossen nach ihrer Brieftasche und bat um die Rechnung. Der Wirt schien enttäuscht und ein wenig verstimmt, aber er kam ihrem Wunsch umgehend nach. Janet belohnte seine Freundlichkeit mit einem fürstlichen Trinkgeld, dann stand sie auf und verließ das Haus. Draußen war es jetzt richtig kalt geworden, und natürlich herrschte inzwischen tiefe Finsternis. Immerhin war der Himmel klar, und Janet hoffte, daß ihr auch unterwegs nirgendwo mehr Regen begegnen würde. Sie sah ohnehin sehr schlecht bei Nacht, und Regen machte alles noch schlimmer. Im Auto stellte sie die Heizung auf die höchste Stufe, aber das würde sich erst nach einer Weile bemerkbar machen. Sie irrte ein wenig herum, ehe sie die M 20 nach London fand, verließ sie aber gleich wieder und nahm die Landstraße Richtung Maidstone. Vielleicht würde sie dort übernachten. Das alte Gefühl der Beklommenheit holte sie wieder ein. Sie mußte Phillip anrufen, heute noch, das war klar. Sie hatte ihm versprochen, sich spätestens von Edinburgh aus zu melden. Wenn sie es nicht tat, würde er glauben, ein Unglück sei geschehen.
In Maidstone hielt sie an der ersten Telefonzelle. Sie kramte all ihr Kleingeld zusammen und wählte. Phillip mußte neben dem Telefon gesessen haben, denn er nahm nach dem ersten Klingeln ab. »Janet! Ich dachte, du meldest dich mal zwischendurch! Bist du schon in Edinburgh?«
»Nein. Phillip, ich bin in Maidstone. In Kent.«
Schweigen. Dann fragte er verwirrt: »Was?«
»Ich habe mir einen Wagen gemietet und bin ein wenig in der Gegend herumgefahren. Dabei habe ich die Zeit vergessen.«
»Das gibt’s doch nicht! Wie willst du denn jetzt rechtzeitig nach Schottland kommen? Du hast morgen früh um neun diesen Termin bei Mr.... Mr....«
»Mr. Grant.«
»Ja, Mr. Grant. Du weißt doch, wie schwer es war, dies alles zu organisieren! Janet, dieser Mann ist weiß Gott nicht angewiesen auf uns, vielleicht empfängt er dich zu einem anderen Termin gar nicht mehr... Himmel, was machen wir denn jetzt?« Er schien völlig aufgelöst. Janet warf Geld nach. Sein Entsetzen tat ihr weh. Es zeigte wieder einmal, auf welch verschiedenen Positionen sie beide standen, wie unvereinbar das war, was jeder von ihnen wollte.
»Ich konnte es nicht, Phillip«, sagte sie leise.
Aus Hamburg kam ein tiefer Seufzer. »Du hast die Maschine absichtlich versäumt, ja?«
Sie schwieg. Phillip klang verzweifelt. »Was sollen wir jetzt tun? Wir hatten doch alles besprochen! Janet, es gibt keinen anderen Ausweg. Das hattest du doch zum Schluß eingesehen!«
»Nein, das hatte ich nicht. Ich habe nachgegeben, weil du mich immer mehr unter Druck gesetzt hast.«
»Janet, Maximilian kann nicht zu uns zurücckommen! Es geht einfach nicht. Wir können diese Verantwortung nicht übernehmen, und...«
Das Telefon hatte schon zweimal eindringlich gepiept, jetzt riß die Verbindung ab. Janet hätte Geld nachwerfen können, aber sie mochte nicht. Phillip würde daheim wie ein Tiger im Zimmer hin- und hergehen und verzweifelt hoffen, daß sie erneut anriefe, und sie spürte einen Moment lang das Aufkeimen eines schlechten Gewissens, weil sie ihn in dieser aufgewühlten Verfassung hängenließ. Aber dann dachte sie trotzig, daß er es nicht anders verdient hatte. Er hatte so lange lamentiert und gestritten, bis sie nachgab; das Risiko, daß sie es sich anders überlegen könnte, wäre sie ihm erst entkommen, hätte er einkalkulieren müssen. Dann wäre er jetzt nicht aus allen Wolken gefallen.
Janet machte eine rasche Bewegung mit den Schultern, als schüttle sie eine Last ab. Dann warf sie das restliche Geld ein und wählte die Nummer von Andrew.
Phillip stand tatsächlich wie angewurzelt vor dem Telefon und wartete, daß Janet noch einmal anrufen würde. Als nach einer halben Stunde noch immer kein Klingeln ertönt war, gab er auf und ging in die Küche, nahm den Weißwein aus dem Kühlschrank und schenkte sich ein Glas ein. Entweder hatte sie kein Kleingeld mehr, oder - was wahrscheinlicher war - sie mochte sich nicht auseinandersetzen und entzog sich auf diese Weise einer Diskussion. Typisch Janet. So hatte sie es immer gemacht. Wenn die Probleme überhand nahmen, ergriff sie die Flucht, entweder ganz buchstäblich, indem sie verschwand und nicht auffindbar war, oder sie zog sich in irgendeine mysteriöse Krankheit zurück, bei der sie tatsächlich heftige Schmerzen und hohes Fieber produzierte.
»Du bist ein ewiges kleines Mädchen!« hatte Phillip sie einmal angebrüllt. »Du wartest, daß irgend jemand oder irgend etwas kommt und dich beschützt. Anstatt selber aufzustehen und die Dinge in die Hand zu nehmen!«
Er hätte wissen müssen, daß sie auch diesmal ausbrechen würde.
Müde und ausgelaugt blieb er am Küchentisch sitzen, leerte ein zweites Glas Wein und lauschte auf das zarte Rauschen, mit dem es draußen zu regnen begann. Erst als er hörte, wie leise die Haustür aufgeschlossen wurde, hob er den Kopf.
»Du mußt nicht schleichen!« rief er. »Ich bin wach!«
Mario, sein vierundzwanzigjähriger Sohn, kam in die Küche. Seine dunklen Haare waren naß vom Regen, er hielt einen tropfenden Strauß Flieder in der Hand und blickte etwas unsicher drein.
»Du wartest auf mich?« fragte er. »Ich habe Blumen gepflückt.«
Phillip sah ihn etwas verwundert an. Es war Nacht, und es regnete. »Du hast Blumen gepflückt?«
»Ich... war nicht allein.« Mario nahm eine Vase aus dem Küchenschrank, füllte sie mit Wasser und ordnete die Zweige. Er wirkte schuldbewußt, was Phillip nicht recht verstand. Er hatte also ein Mädchen kennengelerntund sich offenbar verliebt. Nur in verliebtem Zustand pflückte man nachts im Regen Blumen. Es wurde höchste Zeit, daß er sich für den weiblichen Teil der Menschheit zu interessieren begann, und trotz all seiner Sorgen verspürte Phillip Erleichterung. Er verspürte immer Erleichterung, wenn er in seiner Familie auf Anzeichen von Normalität stieß.
»Wie heißt sie?« fragte er.
»Tina. Ich... ich kenne sie schon eine Weile.«
Phillip hob die Arme. »Du mußt mir keine Erklärungen abgeben. Ich freue mich für dich, Mario!« Sein Sohn wirkte ein wenig in die Enge getrieben, und so wechselte Phillip taktvoll das Thema. »Wie spät ist es?«
»Kurz vor Mitternacht. Läßt du dich vollaufen?«
»Nein. Ich habe zwei Gläser getrunken, mehr nicht.«
»Hast du etwas von Janet gehört?« Schon mit sieben Jahren hatten Mario und Maximilian begonnen, ihre Mutter mit deren Vornamen anzureden. Janet war darüber unglücklich gewesen, aber die Zwillinge waren nicht mehr davon abgegangen. »Sie hat angerufen«, antwortete Phillip nun auf Marios Frage, »aus Maidstone. Das liegt in Kent.«
Mario starrte ihn an. »Wieso? Sie müßte doch längst in Schottland sein!«
»Sie hat es sich anders überlegt. Das heißt, vermutlich hatte sie nie wirklich vor, Mr. Grant aufzusuchen. Ich bin ein Idiot!« Phillip schlug sich mit der Faust an die Stirn. »Ich hätte auf jeden Fall selber fliegen müssen. Es war nur... du kennst ja mein miserables Englisch. Und dann noch ein wichtiger Termin im Büro... aber ich hätte es trotzdem tun müssen.«
»Und was geschieht jetzt?«
»Ich muß morgen früh Mr. Grant anrufen und ihn bitten, mir einen neuen Termin zu geben. Er hat es wirklich nicht nötig, das private Hin und Her einer deutschen Familie mitzumachen. Plätze auf der Blackstone Farm sind heiß begehrt.«
Mario ließ sich auf einen Stuhl fallen. »Vielleicht hat Janet ja recht«, meinte er, »und das Ganze ist ohnehin nichts für Max.«
»Was ist denn dann das Richtige für ihn?« fragte Phillip heftig.
»Er will nach Hause. Er will wieder mit uns leben.«
»Das geht nicht.«
»Aber ich glaube, daß...«
»Mario, es ist ausgeschlossen. Niemand kann diese Verantwortung übernehmen. Jedenfalls niemand, der nicht dafür ausgebildet ist.«
»Er ist gesund, Vater. Professor Echinger sagt...«
»Darauf verlasse ich mich nicht. Das kann niemand garantieren.«
Sie starrten einander an, Phillip aufgebracht und zutiefst beunruhigt, Mario nachdenklich und etwas traurig.
»Du wüßtest ihn am liebsten für den Rest seines Lebens hinter Schloß und Riegel, Vater, das stimmt doch«, sagte er leise.
»Wundert dich das?« fragte Phillip schroff.
Marios Stimme klang sanft. »Ich kann nicht so fühlen wie du. Er ist mein Bruder. Mein Zwillingsbruder. Manchmal vermisse ich ihn so sehr. Nachts höre ich, wie er mit mir spricht. Es bedrückt mich, daß ich ihm nicht antworten kann.«
Phillip schwieg. Schließlich sagte er: »Ich rufe trotzdem morgen früh Mr. Grant an.«
Mario nickte und stand auf. »Ich gehe schlafen. Ich habe morgen um neun die erste Vorlesung.«
»Gute Nacht«, sagte Phillip. Draußen rauschte der Regen nun stärker, schwoll zu einem Prasseln auf dem Dach an. Mario wartete noch einen Moment, aber der Vater schien bereits wieder in seinen Grübeleien zu versinken. Leise verließ er die Küche.
FREITAG, 26. MAI 1995
Tina Weiss hatte ihre Mutter kaum gekannt, und es hatte daher selten einmal einen schmerzlichen Augenblick gegeben, in dem sie wehmütig das Vorhandensein einer weiblichen Bezugsperson in ihrem Leben vermißt hätte. Ihr Vater hatte ihr Photos gezeigt, und Tina hatte die schöne, blonde Frau darauf ehrfürchtig betrachtet - ohne daß mehr als eine schattenhafte Erinnerung in ihr erwacht wäre. Sie war zweieinhalb gewesen, als Marietta Weiss an Krebs gestorben war, aber auch bis dahin war ihre Mutter selten um sie gewesen. Es gab vom Vater sorgfältig gesammelte Zeitungsausschnitte und längere Presseberichte, die sich mit der Theaterschauspielerin Marietta Weiss enthusiastisch beschäftigten.
»Sie war eine große Künstlerin«, hatte der Vater erzählt, »und deshalb war sie auch immer unterwegs. Sie hatte ein Engagement nach dem anderen. Ich habe sie angefleht, es nicht zu übertreiben, denn sie litt unter entsetzlichem Lampenfieber. Wenn sie vor den Vorhang mußte, war sie grün im Gesicht und zitterte am ganzen Körper.«
»Warum hörte sie dann nicht auf?« fragte Tina, voller Mitleid für die fremde Frau.
Michael Weiss schüttelte den Kopf. »Das konnte sie nicht. Die Leidenschaft fürs Theater hielt sie fest. Sie konnte nur dafür leben.« Leiser fuhr er fort: »Und sterben. Ihr Körper hielt die ständige Anspannung nicht aus. Schließlich hat er sich gerächt.«
Was Liebe, Fürsorge, Zuwendung anging, mußte Tina nichts entbehren. Ihr Vater überschüttete sie förmlich damit. Sie waren einander alles, und manchmal ertappte sich Tina bei dem Gedanken, daß sie sich die Anwesenheit eines dritten Menschen in dieser verschworenen Zweisamkeit gar nicht vorstellen konnte, ja sie kaum hätte ertragen können. Die Liebe des Vaters teilen? Undenkbar. Sie mochte es im Grunde schon nicht, daß eine gerahmte Photographie ihrer Mutter noch immer auf Michaels Nachttisch stand; allerdings hätte sie nicht gewagt, ihr Mißfallen zu äußern. Sie tröstete sich damit, daß keine andere Frau in sein Leben eindringen konnte, solange er sich von Marietta nicht verabschiedet hatte, und das wäre zweifellos die wahre Katastrophe gewesen. Tina zog das Bild einer Frau neben seinem Bett entschieden einer Frau aus Fleisch und Blut in seinem Bett vor.
Aber seit einiger Zeit hatte sich ihr Verhältnis getrübt. Tina kam das an diesem Freitagmorgen erneut zu Bewußtsein, als sie ihrem Vater am Frühstückstisch gegenübersaß und seine steile Unmutsfalte auf der Stirn betrachtete. Er hatte schlecht geschlafen, das war ihm anzusehen, und es hing mit seiner Tochter zusammen. Genaugenommen mit ihrer späten Heimkehr am Abend zuvor und mit der Tatsache, daß sie wieder einmal mit »diesem Mario« herumgezogen war.
»Du bist heute ziemlich schweigsam, Vater«, sagte Tina.
Michael nahm seinen Löffel und rührte etwas zu heftig in seiner Kaffeetasse herum. »Es war fast zwölf gestern, als du heimkamst«, erwiderte er.
Tina seufzte leise. »Wir haben Blumen gepflückt. Flieder. Hast du ihn im Wohnzimmer gesehen?«
»Nein.«
»Vater, Mitternacht ist nicht so spät!«
»Zu spät für ein junges Mädchen, das in drei Tagen seine mündliche Abiturprüfung hat!«
»Da mußt du dir doch keine Sorgen machen!«
Das stimmte. Ihre Noten waren immer hervorragend gewesen.
»Mir ist dieser Mario einfach suspekt, das ist es«, sagte Michael ehrlich, »du bist ohnehin zu jung für einen Freund!«
»Ich bin achtzehn. Und meine Freundinnen...« Tina stockte, entschied im letzten Moment, ihrem Vater gegenüber nicht preiszugeben, mit welch atemberaubenden Erlebnissen ihre Freundinnen prahlten. Selbst wenn die Hälfte davon erfunden war, blieb genug, um Michael tief zu schockieren und um ihr, Tina, das Gefühl zu geben, ein Gänschen zu sein, das dringend ein paar äußerst wichtige Erfahrungen schnellstens nachholen mußte.
Michael hatte den begonnenen Satz nicht registriert. Er betrachtete seine Tochter mit einem Gefühl echten Schmerzes, und für Sekunden begriff Tina, die seinem Blick standhielt, voll Mitleid, was in ihm vorging. Aber der Egoismus der Jugend brach sich umgehend wieder Bahn. Von ihrem Vater erwartete sie, daß er, reif und vernünftig, etwas tolerierte, was sie selber im umgekehrten Fall bei ihm nie akzeptiert hätte: das Ausbrechen aus ihrer beider jahrealten, zärtlichen Kameradschaft, die mit fliegenden Fahnen vollzogene Hinwendung zu einem neuen Objekt der Liebe.
Sie hatte Mario Anfang Februar kennengelernt, an einem frostig-kalten Abend, an dem eine ihrer Freundinnen sie zu der Geburtstagsparty ihres älteren Bruders eingeladen hatte. Es waren nur Studenten auf dem Fest gewesen, und Tina hatte sich sehr verloren gefühlt. Sie stand mitten im Gedränge, hielt sich an einem Glas mit Cola fest und überlegte, wie sie unauffällig verschwinden könnte, als ein junger Mann sie ansprach. Er hatte dunkle Haare und sehr dunkle Augen und war dabei auffallend blaß im Gesicht. Wie sich später herausstellte, war er vom Gastgeber, der seine Gäste offenbar aufmerksam beobachtete, leise gebeten worden, sich um die schüchterne Christina Weiss zu kümmern. Sie kamen schnell ins Gespräch, fanden bald heraus, daß sie sich beide nicht besonders gut auf dem Fest amüsierten, und beschlossen, irgendwo zusammen essen zu gehen. Als Tina schließlich nach Hause kam, war es ein Uhr. Ihr Vater stand in der Tür und war außer sich vor Zorn.
»Wir hatten halb zwölf vereinbart!« rief er, packte sie am Arm und zerrte sie herein. »Wo warst du?«
»Ich bin von einem sehr netten jungen Mann zum Essen eingeladen worden«, antwortete Tina und rieb sich ihr schmerzendes Handgelenk, »und dabei haben wir die Zeit vergessen.«
»Du wirst ihn nie wiedersehen!«
»Ich bin achtzehn, Vater«, sagte Tina und sah Michael trotzig in die Augen.
Am folgenden Abend unterzog Michael sie einem Kreuzverhör. »Wie alt ist er? Was tut er? Wie heißt er? Was machen seine Eltern?«
Tina beantwortete alle Fragen in der Hoffnung, auf diese Weise einen länger andauernden Streit mit ihrem Vater zu vermeiden. »Er heißt Mario Beerbaum. Er ist vierundzwanzig und studiert Jura.«
»Ach«, sagte Michael, der Staatsanwalt war, überrascht.
»Er ist vor sechs Jahren mit seinen Eltern von München nach Hamburg gezogen. Sie haben hier eine Steuerberatungskanzlei aufgebaut und sind recht wohlhabend.«
»Hm. Hat er Geschwister?«
»Nein.«
Nichts von alldem, das mußte Michael zugeben, klang in irgendeiner Weise argwohnerweckend. Trotzdem paßte ihm die Geschichte einfach nicht. Er weigerte sich, Mario kennenzulernen, und er litt Qualen, wenn Tina mit ihm herumzog.
»Gestern abend, während du fort warst, hat übrigens deine Tante Paula angerufen«, berichtete er nun. »Sie wollte wissen, wie es mit deinem Abitur steht.«
»Gut, wie soll es sonst stehen?« sagte Tina mißmutig. Sie mochte Tante Paula nicht besonders. Es war Michaels ältere Schwester, eine humorlose, strenge Frau, die nie geheiratet hatte. Sie lebte in Berlin und verteidigte hartnäckig die Behauptung, dort vor vierzig Jahren einen Verehrer gehabt zu haben, der unglücklicherweise an einer Lungenentzündung gestorben war, ehe er sie hatte ehelichen können. Tina bezweifelte, daß das stimmte. Ihrer Ansicht nach wollte sich Paula damit nur vor dem Makel der Altjüngferlichkeit schützen, der ihr aufgrund der knochigen Gestalt, der schmalen Lippen und der völligen Abgekehrtheit von allen irdischen Freuden ohnehin anhaftete. Bruder und Nichte behandelte sie gleichermaßen von oben herab und nörglerisch, wobei Michael jedoch begriff, daß sie trotzdem an ihnen beiden aus tiefster Seele hing. Er sah die Tragik ihres einsamen, unfrohen Lebens, während Tina sich weigerte, Verständnis für eine Frau aufzubringen, die ständig an ihr herumerzog und sie ununterbrochen kritisierte.
»Paula möchte dich nach dem Abitur zu sich nach Berlin einladen«, sagte Michael, »sie will dir Stadt und Umgebung zeigen.«
»Gott, ich kenne Berlin«, sagte Tina, »wir waren hundertmal dort!«
»Aber immer nur kurz. Und von der Umgebung kennst du gar nichts, da durfte man ja früher nie hin.«
»Vater, nein! Ich will nicht hinter diesem staubtrockenen, wandelnden Geschichtsbuch hertrotten und mir dabei auch noch dauernd sagen lassen, ich solle meine Haare anständig kämmen und nicht so enge Jeans tragen!«
»Sie meint es doch gut. Sie will dir eine Freude machen, und...«
»Es geht sowieso nicht«, unterbrach Tina hastig. Sie sah ihren Vater nicht an. »Nach dem Abi werde ich mit Mario für einige Zeit verreisen.«
Schweigen. Dann kam von Michael ein leises: »Was?«
»Es muß sein. Ich werde es tun.«
»Warum muß es sein?«
»Das verstehst du nicht«, sagte Tina kurz. Ihr Vater war der letzte Mensch, mit dem sie hätte besprechen mögen, daß sie mit Mario ein großes Problem hatte.
Das Haus war alt, vor über hundert Jahren gebaut, von außen ein behäbiges, steinernes Gebäude, innen verwinkelt, verwohnt, anheimelnd. Es stand inmitten weiter Wiesen und Weiden. Ein breiter, gepflasterter Hof lag vor dem Portal, eine Allee windgezauster Weidenbäume säumte den Weg bis hin zur Landstraße, die sich als graues Band durch die Rapsfelder schlängelte und selten einmal von einem Auto befahren wurde. Hier oben, im äußersten Norden Deutschlands, kaum zwei Kilometer von der dänischen Grenze entfernt, verliefen die Tage und Nächte ruhig. Ein paar vereinzelte Gehöfte aus roten Klinkersteinen, gescheckte Kühe auf saftig grünen Wiesen, kleine Ortschaften, in denen jeder jeden kannte. Touristen kamen eher auf der Durchfahrt hierher, wollten entweder weiter nach Skandinavien oder hinüber zu den nordfriesischen Inseln. Die verträumten kleinen Buchten entlang der Ostsee waren noch nicht wirklich entdeckt worden.
Das alte Haus war früher Mittelpunkt eines großen Gutes gewesen, aber Ställe und Scheunen hatte man inzwischen abgerissen. Die Familie, die hier residiert hatte, war zerstreut in alle Winde. Irgendwann hatte es sich für die junge Generation nicht mehr gelohnt, das feudale Herrenhaus weiterhin zu erhalten und unter ungeheurem Kostenaufwand praktisch das ganze Jahr über leerstehen zu lassen. Dann und wann war die eine oder andere Urenkelin des Erbauers hierher geflüchtet, um einen Liebeskummer zu überwinden oder sich auf ein Examen vorzubereiten; ab und zu hatte eine Familie den Sommerurlaub hier verbracht und sich gründlich gelangweilt; vereinzelt war auch der Versuch unternommen worden, Weihnachts- oder Silvesterfeiern für alle Mitglieder des Clans in den alten Räumen zu organisieren-was nie zu etwas anderem als zu handfesten Krächen und vorzeitigen Abreisen geführt hatte. Anfang der achtziger Jahre hatte man sich endlich geeinigt, das Anwesen zu verkaufen. Den Zuschlag hatte ein alleinstehender Herr, ein Professor der Psychotherapie aus Hamburg, erhalten. Der fünfzigjährige Friedrich Echinger, im richtigen Moment in den Besitz einer Erbschaft gelangt, hatte sich einen Lebenstraum erfüllt und in der nordischen Einsamkeit seine eigene Privatklinik für Nervenheilkunde und Psychotherapie gegründet. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten riß man sich inzwischen darum, hier einen Platz zu ergattern. Echinger hatte hervorragende Ärzte eingestellt, idealistische, engagierte Leute, die die Weltabgeschiedenheit dieses Ortes nicht schreckte. Die Betreuung galt als vorbildlich.
Maximilian Beerbaum stand an einem Fenster im ersten Stock und blickte hinaus in den verregneten Maitag. Gerade jetzt wurde der Regen, der die ganze Nacht vom Himmel gerauscht war, schwächer. Die Wolken rissen auf, Blau blitzte hervor. Die tropfend nassen Rapsfelder wiegten sich im leisen Wind. Die riesigen Farnblätter im Garten glänzten dunkelgrün und feucht. Mit schrillem Gesang begrüßten die Vögel die ersten tastenden Sonnenstrahlen. Ein Rotkehlchen hatte sich auf der Mauer, die den Garten umschloß, niedergelassen und pickte heftig in den Ritzen zwischen den Steinen. Die Mauer, stilvoll aus rechteckigen, feldgrauen Steinen zusammengesetzt, war drei Meter hoch und gehörte zu den wenigen Dingen, die daran erinnerten, daß man in diesem Haus nicht ohne weiteres kommen und gehen durfte.
»Es hört auf zu regnen«, sagte Maximilian und wandte sich vom Fenster ab. Professor Echinger saß in seinem schwarzen Ledersessel an der Stirnseite des Raumes, die Beine übereinandergeschlagen, die Hände auf dem Schoß gefaltet. Er betrachtete Maximilian über den schmalen Goldrand seiner Lesebrille hinweg.
»Vermutlich werden Sie dann nachher wieder zu einer Ihrer langen Wanderungen aufbrechen«, bemerkte er.
Maximilian zuckte mit den Schultern. »Ich weiß noch nicht. Als ich vor einem Jahr zum erstenmal allein und unbewacht durch die Pforte da unten gehen durfte, war es wie ein Wunder für mich. Ich konnte nicht genug davon bekommen. Durch die Wiesen streifen, an einem Teich liegen und Frösche beobachten...«
»Sie haben Ihre Freiheit sehr vermißt in all den Jahren, nicht wahr?« fragte Echinger behutsam.
Maximilian nickte. Er ging zu seinem Sessel zurück, der dem des Professors gegenüber stand, und setzte sich wieder. Er lehnte sich jedoch nicht entspannt zurück, sondern stützte beide Arme auf die Knie und den Kopf in die Hände.
»Am Anfang ging es mir sehr schlecht, das wissen Sie ja. Die ersten zwei Jahre waren... ach, vergessen wir’s lieber. Dann kam eine Phase, da war ich dankbar, hier zu sein und nicht im Gefängnis. Ich war bereit, das Gute an meiner Situation zu sehen. Aber Dankbarkeit ist kein besonders haltbares Gefühl, finden Sie nicht auch? Die Depressionen kamen nicht wieder, aber trotzdem fühlte ich mich... als sei dies hier ein Gefängnis.« Maximilian schwieg einen Moment, dann blickte er auf und sah den Professor an. »Ich hoffe, ich kränke Sie nicht mit meinen Worten?«
»Durchaus nicht«, erwiderte Echinger, »ich kann Ihre Gefühle sehr gut verstehen. Sagen Sie, was empfinden Sie, wenn Sie jetzt daran denken, nach Hause zurückzukehren?«
Maximilian lachte leise auf, erhob sich erneut und blieb hinter seinem Sessel stehen. »Nach Hause! Sie wissen doch, daß es das für mich nicht mehr gibt!«
»Die Dinge haben sich immer noch nicht geklärt?« »Mein Vater lehnt es strikt ab, mich wieder aufzunehmen. Meine Mutter ist anderer Meinung, aber sie wird sich nicht durchsetzen können. Der Platz auf dieser entsetzlichen Farm in Schottland ist mir so gut wie sicher.«
»Sie haben keinerlei Ambitionen, dorthin zu gehen?« In Maximilians Augen trat ein zynischer Ausdruck. Professor Echinger wurde sich einmal mehr bewußt, wie intelligent und wie - um das banale Wort zu gebrauchen - schön dieser junge Mann aussah. Seine Augen waren von einem so tiefen Braun, daß sie schwarz wie Kohle wirkten. Er besaß ein Lächeln, mit dem er jeden zu umarmen schien, dem er es schenkte. Zeitlebens würde er fremde Menschen in Sekundenschnelle für sich gewinnen können. Unglücklicherweise würde ihm diese Fähigkeit das Leben jedoch keineswegs leichter machen.
»Sie wissen doch, was für Leute auf dieser Farm sind? Drogenabhängige. Kriminelle. Alkoholiker. Das einfache Leben auf dem Land in einer kleinen Gemeinschaft, die Verantwortung für Tiere, die harte Arbeit auf dem Feld soll ihnen den Weg zurück ins bürgerliche Leben ermöglichen. Es mag sein, daß das manchem hilft, aber...«
»Projekte dieser Art haben sich bereits sehr bewährt.«
»Ja. Aber ich bin doch ohnehin gesund. Wozu muß ich einen Acker pflügen und auf einer Holzpritsche schlafen?«
»Die anderen jungen Leute, die dorthin kommen, sind auch nicht mehr krank«, sagte Echinger. »Es sind ehemalige Drogenabhängige. Ehemalige Alkoholiker. Ehemalige Kriminelle. Sie müssen nun lernen...«
»Ehemalige Kriminelle«, unterbrach Maximilian. »Wie ich.«
»Sie sind vierundzwanzig Jahre alt. Erwachsen. Und frei. Aufgrund mehrerer voneinander unabhängiger Gutachten hat das Landgericht die Aussetzung Ihrer Unterbringung hier bestimmt. Niemand kann Sie zwingen, irgendwohin zu gehen, wohin Sie nicht wollen. Sie unterliegen einer gewissen Kontrolle durch Ihre Führungsaufsicht, und die hat dem Schottland-Plan zwar zugestimmt, wird ihn aber nie gegen Ihren Willen durchsetzen wollen. Sie können nein sagen.«
Maximilian lächelte. »Theoretisch vielleicht. Aber wie sehen denn meine Lebensumstände aus, wenn ich diese Mauern hier verlasse? Ich habe keinen Schulabschluß, geschweige denn eine Ausbildung. Ich habe kein Geld. Dafür habe ich Papiere, die einen sechsjährigen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik belegen. Ganz abgesehen von...« Er biß sich auf die Lippen.
»Ja?« sagte Echinger.
»Das, weswegen ich überhaupt hierhergekommen bin«, sagte Maximilian leise.
Echinger schaute auf die kleine Uhr, die vor ihm auf einem Tisch stand und es ihm ermöglichte, die Zeit zu kontrollieren, ohne den Patienten nervös zu machen - wie er es mit einem Blick auf eine Armbanduhr getan hätte. »Unsere Zeit ist leider vorbei. Ich werde mit Sicherheit noch einmal mit Ihrem Vater sprechen.«
»Das wird nichts nützen. Er will mich so weit weg haben, wie es nur geht. Schottland! Eine abgelegene Farm irgendwo in der Einsamkeit. Glauben Sie, die hat er zufällig gewählt? Eigentlich ein Wunder, daß er mich nicht gleich nach Amerika schickt!« Maximilian ging zur Tür. Der Professor erhob sich, nahm die Brille ab. Es war ein Privileg, das wußte Maximilian, hier in der Klinik von Echinger selbst therapiert zu werden. Der Mann hatte hohe Qualitäten. Das Problem war, daß sein Einfluß spätestens am Ende der Auffahrtsallee seines Herrenhauses endete. Er konnte einen Patienten auf die Füße stellen, mußte ihn dann jedoch alleine laufen lassen. Maximilian hatte plötzlich das Gefühl, als lauere jenseits dieser wilden, regennassen Einsamkeit um ihn herum eine Welt, die außer Gefahr und Feindseligkeit nichts bereit hielt - und mit der er nach den Jahren der Geborgenheit nicht würde zurechtkommen können. Für Sekunden überschwemmte ihn die Panik, die er hier erst kennengelernt, gegen die er während des letzten Jahres bis zur völligen Erschöpfung gekämpft hatte. Er spürte, wie er bleich wurde. Auch dem Professor war der kritische Moment nicht entgangen.
»Ihr Bruder«, sagte er, »Ihr Zwillingsbruder... er will Sie doch zu Hause haben, oder?«
Maximilian, die Hand schon auf der Türklinke, drehte sich um. »Mario... ich weiß nicht. Er ist verändert seit einiger Zeit. Irgend etwas... er spricht nicht darüber. Ich habe das Gefühl, er entfernt sich von mir.« Er verließ den Raum, die Tür fiel hinter ihm zu.
ENDE DER LESEPROBE