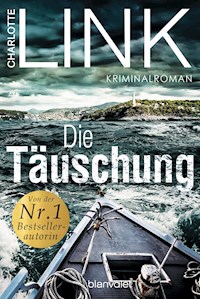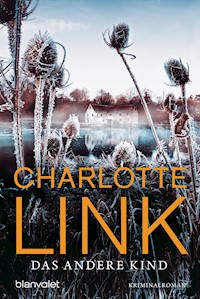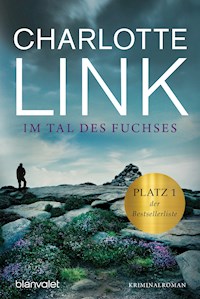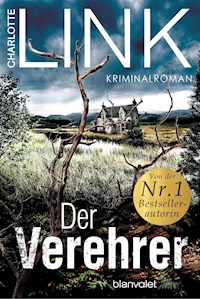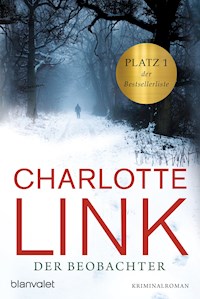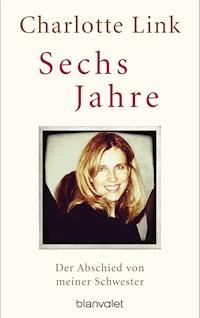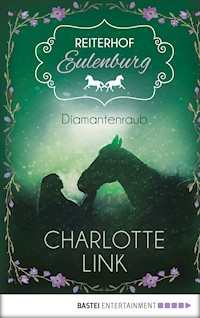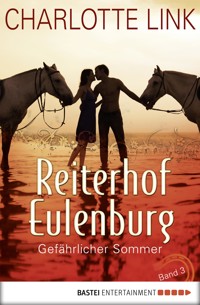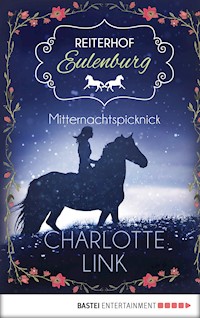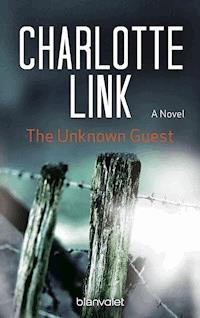9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein dunkles Geheimnis umgibt das alte Rosenzüchterhaus von Le Variouf. Alle Spuren scheinen in die Vergangenheit seiner Bewohnerinnen zu weisen. Und eines Tages gibt es erneut eine Tote in Le Variouf … Atemlose Gänsehaut bis zur letzten Seite!
Die junge Lehrerin Franca Palmer ist am Ende. Hals über Kopf verlässt sie ihr wohlsituiertes Zuhause in Berlin und flüchtet auf die Kanalinsel Guernsey. Dort mietet sie sich in einem alten Rosenzüchterhaus in Le Variouf ein, und innerhalb kurzer Zeit entwickelt sich zwischen ihr und ihrer Gastgeberin Beatrice Shaye eine seltsam distanzierte Freundschaft.
Die ältere Frau lebt auf dem Anwesen in einer undurchschaubaren Schicksalsgemeinschaft mit Helene Feldmann zusammen, die geprägt ist von Hass und Abneigung. Beide Frauen wirken auf geheimnisvolle Weise aneinander gekettet - seit dem Jahr 1945, als Beatrice während der Besetzung der Kanalinseln durch die deutschen Truppen von Helene und ihrem Mann Erich, einem hohen Offizier, wie ein eigenes Kind aufgenommen wurde und sich das Schicksal der beiden Frauen für immer wendete …
Millionen Fans sind von den fesselnden Krimis von Charlotte Link begeistert. Dunkle Geheimnisse und spannende Mordfälle erwarten Sie. Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1016
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Die junge Lehrerin Franca Palmer ist am Ende. In ihrer Ehe kriselt es, und den Anforderungen des Alltags fühlt sie sich kaum noch gewachsen. Hals über Kopf verlässt sie ihr wohlsituiertes Zuhause in Berlin und flüchtet auf die Kanalinsel Guernsey. Dort mietet sie sich in einem alten Rosenzüchterhaus in Le Variouf ein, und innerhalb kurzer Zeit entwickelt sich zwischen ihr und ihrer Gastgeberin Beatrice Shaye eine seltsam distanzierte Freundschaft. Die ältere Frau lebt auf dem Anwesen in einer undurchschaubaren Schicksalsgemeinschaft mit Helene Feldmann zusammen, die geprägt ist von Hass und Abneigung. Beide Frauen wirken auf geheimnisvolle Weise aneinandergekettet - seit dem Jahr 1945, als Beatrice während der Besetzung der Kanalinseln durch die deutschen Truppen von Helene und ihrem Mann Erich, einem hohen Offizier, wie ein eigenes Kind aufgenommen wurde. Von Anfang an rivalisierten die Feldmanns um die Gunst Beatrices, denn für seine Frau hatte Erich nichts als Verachtung übrig. So ging mit seinem Tod am 1. Mai 1945 für beide Frauen ein quälender Lebensabschnitt zu Ende. Doch trotzdem liegt weiterhin ein Schatten über dem Rosenzüchterhaus. Und eines Tages, wieder ist es der 1. Mai, gibt es erneut eine Tote in Le Variouf …
Autorin
Charlotte Link, geboren in Frankfurt/Main, ist die erfolgreichste deutsche Autorin der Gegenwart. Ihre Kriminalromane sind internationale Bestseller, auch »Die Entscheidung« und zuletzt »Die Suche« eroberten wieder auf Anhieb die SPIEGEL-Bestsellerliste. Allein in Deutschland wurden bislang über 30 Millionen Bücher von Charlotte Link verkauft; ihre Romane sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. Charlotte Link lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Frankfurt/Main.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Charlotte Link
Die Rosenzüchterin
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2010 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Getty Images (Michael Runkel; Steve Mahy/500px Prime); www.buerosued.de
NG · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-05192-1V008www.blanvalet.de
PROLOG
Manchmal konnte sie Rosen einfach nicht mehr sehen. Dann meinte sie, ihre Schönheit nicht länger ertragen zu können, den Anblick ihrer samtigen, bunten Blüten, den Hochmut, mit dem sie sich der Sonne entgegenreckten, als seien die warmen Strahlen nur für sie bestimmt und für niemanden sonst. Rosen konnten empfindlicher sein als die sprichwörtlichen Mimosen; einmal war es ihnen zu nass, dann zu kalt, zu windig oder zu heiß; sie ließen oft aus unerfindlichen Gründen die Köpfe hängen und vermittelten den Eindruck, als schickten sie sich zum Sterben an, und es kostete Mühe, Kraft und Nerven, sie daran zu hindern. Dann wieder, ebenso unerklärbar, bewiesen sie eine unerwartete Zähigkeit, behaupteten sich gegen harsche Witterung und unsachgemäße Behandlung, blühten, dufteten und wuchsen. Sie machten es niemandem leicht, der mit ihnen zu tun hatte.
Ich sollte, dachte sie, auf Rosen nicht so aggressiv reagieren. Das ist albern. Und unangemessen.
Sie hatte vierzig Jahre ihres Lebens der Rosenzucht gewidmet, aber sie hatte nie eine wirklich glückliche Hand für diese Blumen gehabt. Vermutlich lag das daran, dass sie sie nicht mochte und eigentlich immer etwas anderes hatte tun wollen. Ihr waren ein paar einigermaßen interessante Kreuzungen gelungen, Teehybriden vor allem, denn wenn überhaupt, so konnte sie diesem Rosentyp noch am ehesten etwas abgewinnen. Sie vereinten Eleganz mit einer gewissen Härte und Festigkeit – und verkauften sich gut. Irgendwie war es ihr stets gelungen, das Auskommen ihrer kleinen Familie zu sichern, aber oft hatte sie gedacht, dass sie, käme plötzlich eine gute Fee mit einem Goldschatz daher, nie wieder im Leben eine Rose anfassen würde.
Manchmal, wenn sich Beatrice Shaye mit der Erkenntnis konfrontierte, dass sie Rosen weder mochte noch wie eine wirkliche Expertin mit ihnen umzugehen verstand, fragte sie sich, was eigentlich ihrem Herzen nahestand. Sie musste sich von Zeit zu Zeit vergewissern, dass es da noch etwas gab, denn die Erkenntnis, ihr Leben einer Tätigkeit und einem Objekt gewidmet zu haben, das ihr so wenig Sympathie abringen konnte, stimmte sie manchmal traurig und ließ sie grübelnd nach einem Sinn suchen. Dabei hatte gerade sie sich stets zynisch über Sinnsucher geäußert. Den Sinn des Lebens hatte sie immer mit dem Begriff Überleben erklärt – überleben in einer schlichten, undramatischen Bedeutung. Überleben hieß, das Notwendige zu tun: aufstehen, die Arbeit verrichten, die getan werden musste, essen, trinken, zu Bett gehen und schlafen. Alles andere war schmückendes Beiwerk: der Sherry, der wie helles Gold in den Gläsern funkelte. Musik, die durch den Raum toste, das Herz schneller schlagen und das Blut leichter fließen ließ. Ein Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen konnte. Ein Sonnenuntergang über dem Meer, drüben am Pleinmont Tower, der unmittelbar an die Seele rührte. Eine Hundeschnauze, feucht und kalt und stürmisch, im Gesicht. Ein warmer, stiller Sommertag, der nur durchbrochen wurde in seiner Ruhe von den Schreien der Möwen und dem leisen Rauschen der Wellen in der Moulin Huet Bay. Heißer Fels unter nackten Füßen. Der Duft der Lavendelfelder.
Eigentlich stellten diese Dinge die Antwort auf ihre Frage dar: Sie liebte Guernsey, ihre Heimat, die Insel im Ärmelkanal. Sie liebte St. Peter Port, die malerische Hafenstadt an der Ostküste. Sie liebte die Narzissen, die im Frühjahr an allen Wegrändern blühten, liebte die wilde blaue Hyazinthe, auf die man in den lichtdurchfluteten, hellen Wäldern stieß. Sie liebte den Klippenpfad hoch über dem Meer, besonders den Teil, der vom Pleinmont Point zur Petit Bôt Bay führte. Sie liebte ihr Dorf Le Variouf, liebte ihr steinernes Haus, das ganz hoch am oberen Dorfrand lag. Sie liebte sogar die Wunden der Insel, die hässlichen Wachtürme der ehemaligen Befestigungsanlage, die von den deutschen Besatzern gebaut worden war, das trostlose, in Granit geschlagene »German Underground Hospital«, das die Zwangsarbeiter damals hatten bauen müssen, und die Bahnhöfe, die die Deutschen hatten vergrößern lassen, um das Material zum Bau ihres Westwalls transportieren zu können. Zudem liebte sie manches an dieser Landschaft, auf dieser Insel, was niemand außer ihr sah und hörte: Erinnerungen an Bilder und Stimmen, an Momente, die sich unauslöschlich in ihr Gedächtnis gebrannt hatten. Erinnerungen an über siebzig Jahre Leben, die sie fast ausschließlich hier verbracht hatte. Vielleicht stand einem Menschen nahe, was er sein Leben lang kannte. Ob gut oder schlecht, das Vertraute grub sich seinen Weg in jene Winkel des Herzens, in denen Zuneigung geboren wurde. Irgendwann fragte man nicht mehr, was man gewollt hatte; man betrachtete, was man bekommen hatte. Und fand sich damit ab.
Natürlich dachte sie ab und zu daran, wie ihr Leben in Cambridge ausgesehen hatte. An Abenden wie diesem kam ihr die alte Universitätsstadt in East Anglia besonders häufig in den Sinn. Sie hatte das Gefühl, an die tausend Mal – so wie heute – am Hafen gesessen und Sherry getrunken zu haben, und es war wie ein Sinnbild ihres Lebens – des Lebens, das sie anstelle von dem in Cambridge geführt hatte. Auch anstelle eines möglichen Lebens in Frankreich. Wenn sie damals nach dem Krieg mit Julien hätte nach Frankreich gehen können …
Aber wozu, so rief sie sich zur Ordnung, sollte sie lange überlegen? Die Dinge waren so gelaufen, wie sie vielleicht hatten laufen müssen. In jedem Leben, davon war sie überzeugt, wimmelte es von verpassten Chancen, von versäumten Gelegenheiten. Wer konnte von sich sagen, immer konsequent, zielstrebig und kompromisslos gewesen zu sein?
Sie hatte sich abgefunden mit den Fehlern und Irrtümern ihres Daseins. Sie hatte sie eingeordnet zwischen all die anderen Ereignisse, die ihr widerfahren waren, und in der Menge verloren sie sich ein wenig, wurden unauffällig und blass. Zeitweise gelang es ihr, sie völlig zu übersehen, manchmal sogar, sie zu vergessen.
In ihrem Verständnis hieß das, dass sie sich abgefunden hatte.
Nur mit den Rosen nicht.
Und nicht mit Helene.
Der Wirt vom Le Nautique in St. Peter Port näherte sich dem Tisch am Fenster, an dem die zwei alten Damen saßen.
»Zwei Sherry wie immer?«, fragte er.
Beatrice und ihre Freundin Mae sahen ihn an.
»Zwei Sherry wie immer«, erwiderte Beatrice, »und zweimal Salat. Avocado mit Orangen.«
»Sehr gerne.« Er zögerte. Er unterhielt sich gerne, und zu dieser frühen Stunde – es war noch nicht einmal sechs Uhr am Abend – hatte sich noch kein anderer Gast ins Restaurant verirrt.
»Es ist schon wieder ein Schiff gestohlen worden«, sagte er mit gedämpfter Stimme, »eine große weiße Segelyacht. Heaven Can Wait heißt sie.« Er schüttelte den Kopf. »Eigenartiger Name, nicht wahr? Aber den wird sie kaum behalten, so wenig wie ihre schöne, weiße Farbe. Wahrscheinlich haben sie sie längst umgespritzt, und sie gehört schon irgendeinem Franzosen drüben auf dem Festland.«
»Diebstähle von Yachten«, sagte Beatrice, »sind so alt wie die Inseln selbst. Es gibt sie und wird sie immer geben. Wen regt das noch wirklich auf?«
»Die Leute dürften ihre Schiffe nicht wochenlang unbeobachtet lassen«, meinte der Wirt. Er nahm einen Aschenbecher vom Nachbartisch, stellte ihn zu den beiden Damen, gleich neben die Vase mit den Rosen, die in dieser Woche den Gastraum schmückten. Er wies auf das kleine, weiße Reservierungsschild. »Ich brauche den Tisch ab neun Uhr.«
»Da sind wir längst weg.«
Das Le Nautique lag direkt am Hafen von St. Peter Port, der Hauptstadt der Insel Guernsey, und durch die zwei großen Fenster des Restaurants hatte man einen wunderschönen Blick über die zahllosen Yachten, die dort vor Anker lagen; man hatte sogar den Eindruck, zwischen all den Schiffen zu sitzen und Teil des Lebens und Treibens dort zu sein.
Man konnte vom Restaurant aus die Menschen beobachten, die über die hölzernen Stege schlenderten, konnte Kindern und Hunden beim Spielen zusehen, und man konnte schon ganz weit in der Ferne die großen Dampfer ausmachen, die Ferienreisende vom Festland brachten. Manchmal glich der Blick dem auf einem Gemälde, bunt und unwirklich. Zu schön, zu vollkommen, wie die Fotografie aus einem Reisekatalog.
Es war Montag, der 30. August, ein Abend voller Wärme und Sonne, und doch schon spürbar vom Nahen des Herbstes geprägt. Die Luft hatte nicht mehr die laue Weichheit des Sommers, sie war nun wie Kristall, kühler und frischer. Der Wind trug einen herben Geruch heran. Die Möwen schossen vom Meer zum Himmel hinauf und wieder zurück, wild schreiend, als wüssten sie, dass Herbststürme und Kälte bevorstanden, dass schwere Nebelfelder über der Insel liegen und das Fliegen beschwerlich machen würden. Der Sommer konnte noch zehn Tage oder zwei Wochen andauern. Dann wäre er unwiderruflich vorbei.
Die beiden Frauen sprachen wenig miteinander. Sie stellten übereinstimmend fest, dass der Salat wie immer ausgezeichnet war und dass nichts über einen schönen Sherry ging, vor allem dann, wenn er, so wie hier, großzügig in hohen Sektgläsern ausgeschenkt wurde. Ansonsten aber fand kaum ein Austausch zwischen ihnen statt. Beide schienen in ihre eigenen Gedanken vertieft.
Mae betrachtete Beatrice eindringlich, was sie sich erlauben konnte, da ihr Gegenüber offensichtlich nichts davon bemerkte. Sie fand, dass sich Beatrice für eine siebzigjährige Frau ganz und gar unangemessen kleidete, aber darüber hatte es zwischen ihnen schon zahllose Diskussionen gegeben, die nicht gefruchtet hatten. Sie lebte in ihren Jeans, bis diese zerschlissen waren, und trug dazu ausgeblichene T-Shirts oder unförmige Pullover, deren einziger Vorteil darin bestand, dass sie ihre Trägerin bei Wind und Wetter warm hielten. Das weiße, lockige Haar band sie meist einfach mit einem Gummiband zurück.
Mae, die gerne schmal geschnittene, helle Kostüme trug, alle vierzehn Tage zum Friseur ging und mit Make-up die Spuren des Alters zu vertuschen suchte, bemühte sich unverdrossen immer wieder, die Freundin zu einem gepflegten Äußeren zu bewegen.
»Du kannst nicht mehr herumlaufen wie ein Teenager! Wir sind beide siebzig Jahre alt und müssen diesem Umstand Rechnung tragen. Diese Jeans sind einfach zu eng, und …«
»Das wäre nur dann fatal, wenn ich fett wäre.«
»… und deine ewigen Turnschuhe sind …«
»… das Praktischste, was man tragen kann, wenn man den ganzen Tag auf den Beinen ist.«
»Dein Pullover ist voller Hundehaare«, sagte Mae anklagend und zugleich resigniert, denn sie wusste, weder an den Hundehaaren noch an den Turnschuhen, noch an den Jeans würde sich auch nur das Geringste ändern.
Heute jedoch sagte sie gar nichts. Sie war mit Beatrice befreundet, seitdem sie beide Kinder gewesen waren, und sie verfügte inzwischen über feine Antennen, was das psychische Befinden ihrer Freundin betraf. Heute, das spürte sie, war Beatrice nicht allzu gut gelaunt. Ihr gingen anscheinend unerfreuliche Gedanken durch den Kopf, und es war besser, sie nicht zusätzlich zu reizen, indem man an ihrem Aussehen herummäkelte.
Sie hat eine gute Figur, dachte Mae, das muss ihr der Neid lassen. Sie hat seit ihrem zwanzigsten Lebensjahr offensichtlich kein Gramm zugenommen. Sie wusste, dass Beatrice sich so geschmeidig bewegte, als seien die körperlichen Beschwerden des Alters eine Erfindung, die für andere gemacht war, nicht aber für sie.
Mae fiel das gestohlene Schiff wieder ein, von dem der Wirt gerade gesprochen hatte. Heaven Can Wait.
Wirklich ein seltsamer Name, dachte sie.
Beatrice schaute zum Fenster hinaus auf den Hafen und nippte dabei an ihrem Sherry. Sie sah nicht, was dort unten vor sich ging, sie war völlig versunken in ihre Gedanken.
Mae brach schließlich das Schweigen.
»Wie geht es Helene?«, fragte sie.
Beatrice zuckte mit den Schultern. »Wie immer. Sie jammert viel, aber letztlich begreift niemand, was eigentlich so schlimm ist an ihrem Dasein.«
»Vielleicht begreift sie das selber nicht so genau«, meinte Mae. »Sie hat sich nur so an das Jammern gewöhnt, dass sie damit nicht mehr aufhören kann.«
Beatrice hasste es, über Helene zu reden.
»Wie geht es Maja?«, erkundigte sie sich, um das Thema zu wechseln.
Mae wurde stets nervös, wenn man sie auf ihre Enkelin ansprach.
»Ich fürchte, sie bewegt sich in schlechter Gesellschaft«, sagte sie. »Ich sah sie neulich mit einem Mann zusammen, da schauderte es mich. Ich habe selten ein derart brutales Gesicht gesehen. Mein Gott, wie froh wäre ich, wenn es zwischen ihr und Alan endlich klappte!«
Über ihren Sohn Alan mochte Beatrice nicht reden.
»Man wird sehen«, erwiderte sie in einem Ton, der Mae unmissverständlich klarmachte, dass sie über dieses Thema nicht weiter zu sprechen wünschte.
Mae begriff dies auch sofort, und so saßen sie einander wieder schweigend gegenüber, bestellten zwei weitere Sherry und sahen hinaus in das letzte, milde Licht des vergehenden Augusttages.
Und in diesem Licht, in dieser immer rascher einfallenden Dämmerung, glaubte Beatrice plötzlich, einen Menschen zu erkennen, den sie viele Jahre zuvor zuletzt gesehen hatte. Ein Gesicht in der Menge, das ihr auffiel, das sie zusammenzucken und blass werden ließ. Es dauerte nur eine Sekunde, dann war sie schon wieder überzeugt, sich getäuscht zu haben. Aber Mae hatte die Veränderung an Beatrice bemerkt.
»Was ist los?«, fragte sie.
Beatrice runzelte die Stirn und wandte sich vom Fenster ab. Von einem Moment zum anderen war es ohnehin zu dunkel geworden, als dass sie noch etwas genau hätte wahrnehmen können.
»Ich dachte nur gerade, ich hätte jemanden gesehen …«, sagte sie.
»Wen?«
»Julien.«
»Julien? Unseren Julien?«
Es war nie unser Julien, dachte Beatrice verärgert, aber sie nahm Maes Bemerkung kommentarlos hin.
»Ja. Aber wahrscheinlich habe ich mich getäuscht. Weshalb sollte er nach Guernsey kommen?«
»Meine Güte, er muss sich sowieso sehr verändert haben«, sagte Mae, »er ist doch jetzt bald achtzig Jahre alt, oder?«
»Siebenundsiebzig.«
»Auch nicht viel besser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn überhaupt wiedererkennen würden.« Sie kicherte, und Beatrice fragte sich, was es zu kichern gab. »Und er uns zwei alte Schachteln auch nicht, fürchte ich.«
Beatrice sagte nichts, schaute nur noch einmal zum Fenster hinaus, doch selbst wenn sie überhaupt noch etwas hätte sehen können, wäre der Mann, den sie einen atemlosen Augenblick lang für Julien gehalten hatte, sicher längst in der Menge verschwunden.
Ein Irrtum, dachte sie, und wegen eines Irrtums sollte, weiß Gott, mein Herz nicht so jagen!
»Komm«, sagte sie zu Mae, »lass uns zahlen und dann nach Hause fahren. Ich bin müde.«
»In Ordnung«, sagte Mae.
ERSTER TEIL
1
Ein Morgen war wie der andere. Um sechs Uhr früh klingelte Beatrices Wecker. Sie gönnte sich fünf Minuten, in denen sie still liegen blieb, die Wärme des Bettes und die Ruhe um sich herum genoss. Eine Ruhe, die unterbrochen wurde von einigen vertrauten Geräuschen ringsum: Vogelgezwitscher aus dem Garten, manchmal, wenn der Wind günstig stand, ein leises Meeresrauschen. Irgendwo im Haus knackten ein paar Holzdielen, kratzte sich einer der Hunde, tickte eine Uhr. Dann schob sich Beatrices Schlafzimmertür einen Spalt weit auf, und Misty streckte ihre Nase hinein. Mistys Fell hatte die bleigraue Farbe des Nebels, der im Herbst über Petit Bôt Bay lag, und daher war der Name Beatrice sofort durch den Kopf geschossen, als sie den Hund als Welpen zum ersten Mal im Arm gehalten hatte. Damals bestand Misty nur aus großen, tapsigen Pfoten, aus weichem, buschigem Fell und aus lebhaften kohlschwarzen Knopfaugen. Heute hatte sie die Größe eines Kalbes.
Misty nahm Anlauf und sprang aufs Bett, das unter ihrem Gewicht schwankte und ächzte. Sie kuschelte sich in die Decken, wälzte sich auf den Rücken, streckte alle viere in die Luft und schleckte Beatrice kurz mit der Zunge über das Gesicht – ein triefend nasser, von Herzen kommender Liebesbeweis.
»Misty, runter vom Bett«, befahl Beatrice halbherzig, und Misty, die wusste, dass sie auf den Protest der Hausherrin nichts geben musste, blieb, wo sie war.
Für Beatrice waren die fünf Minuten der Beschaulichkeit vorbei. Sie stand schwungvoll auf und ignorierte, so gut sie konnte, die leichte Steifheit ihrer Gelenke, die ihr verriet, dass sie nicht mehr so jung war, wie sie sich manchmal fühlte. Sie wollte keineswegs so werden wie Mae, die sich von morgens bis abends mit ihrem Körper beschäftigte, ständig in ihn hineinlauschte und jeden dritten Tag beim Arzt saß, weil sie meinte, dass irgendetwas in ihrem Inneren nicht stimmte. Nach Beatrices Ansicht zog sie sich damit die Unpässlichkeiten überhaupt erst heran. Aber darüber hatten sie schon oft gesprochen, ohne dass eine von ihnen ihre Meinung geändert hätte. Ihre Freundschaft bestand ohnehin im Wesentlichen darin, sich gegenseitig mit kopfschüttelnder Verwunderung zu betrachten.
Während sie im Bad unter der Dusche stand, überlegte Beatrice, was sie am heutigen Tag tun würde. Sie konnte sich derlei Überlegungen inzwischen leisten, denn aus dem eigentlichen Berufsleben, das früher ihren Tagesablauf bestimmt hatte, hatte sie sich zurückgezogen. Ihren Rosengarten versorgte sie nur noch zu ihrem privaten Vergnügen, wobei das Wort »Vergnügen« den Sachverhalt nicht wirklich wiedergab. Aber die Rosen waren nun einmal da, also kümmerte sie sich auch um sie. Ab und zu, wenn jemand vorbeikam, der Rosen kaufen wollte, Touristen vor allem, gab sie noch welche ab. Aber sie inserierte nicht mehr in den einschlägigen Zeitschriften und hatte den Versand völlig eingestellt. Sie versuchte auch nicht mehr, neue Sorten heranzuzüchten. Das überließ sie anderen, und überhaupt: Es hatte ihr nie übermäßig Spaß bereitet. Wenn sie aus dem Bad kam, waren ihr meist an die hundert Dinge eingefallen, die erledigt werden mussten, und in ihren Bewegungen lagen bereits die Schnelligkeit und Ungeduld, die typisch für sie waren. Alles, was sie tat, schien sie stets in Eile zu tun, was die meisten Menschen in ihrer Umgebung als äußerst anstrengend empfanden.
Von halb sieben bis halb acht ging Beatrice mit ihren Hunden spazieren. Außer Misty gab es noch zwei weitere Mischlinge, beide groß, undefinierbar in der Zusammensetzung ihrer Rassen und wild. Beatrice liebte Hunde ausnahmslos, umgab sich jedoch am liebsten mit solchen, die die Statur von Ponys oder Kälbern hatten. Die Hunde tobten sofort los, kaum dass Beatrice ihnen die Haustür geöffnet hatte. Das Haus lag oberhalb des Dorfes Le Variouf, und man konnte von hier aus bis zum Meer blicken. Die Landschaft ringsum bestand aus weiten Wiesen, die gelegentlich von Baumgruppen durchsetzt waren. Bäche plätscherten in Richtung Meer, und an ihren Ufern standen hier und da baufällig gewordene Mühlen, die in früheren Zeiten mit Wasserkraft betrieben worden waren. Steinerne Mauern umgrenzten weitläufige Weiden, auf denen Rinder und Pferde grasten. Die Luft roch nach Salz und Wasser, nach Algen und Sand. Je näher man dem Meer kam, desto frischer wurde der Wind, desto klarer die Luft. Bald hatte Beatrice den Klippenpfad erreicht und konnte das Wasser sehen. Nur noch wenige Bäume standen hier, windzerzaust und flach. Der Weg wurde gesäumt von wilden Hecken, Stechginster-, aber auch Brombeerhecken, an denen dicke, reife Früchte hingen. Die Hunde, animiert vom Schreien der Seevögel und vom Wind in ihren Nasen, jagten laut bellend davon. Beatrice wusste, dass sie jeden Fußbreit Boden genau kannten, und machte sich wegen ihrer halsbrecherischen Sprünge keine Gedanken. Sie blieb auf der Anhöhe über dem Wasser stehen und atmete tief durch.
Obwohl es noch früh am Tag war, hatte sich die Sonne schon ein Stück über den östlichen Horizont hinaufgeschoben und warf rotgefärbte Strahlen über die Wellen. Der Septembertag war klar und würde wieder fast hochsommerlich heiß werden. Schon die ganze letzte Woche über war es ungewöhnlich warm gewesen für die Jahreszeit. Das Heidekraut an den oberen Klippen leuchtete rötlich, unten in den Buchten glänzte hell der Sand. Kormorane und Seeschwalben machten sich auf zu den ersten Beutezügen des Tages.
Beatrice setzte ihren Weg auf dem Pfad fort. Ab und zu pflückte sie im Vorbeigehen eine Brombeere, schob sie genießerisch in den Mund. In gewisser Weise war dies ein Ablenkungsmanöver. Diese Minuten des Tages, dieser Spaziergang hoch über dem Meer, gehörten zu den gefährlichsten Momenten ihres Alltags. Mit der Petit Bôt Bay, zu der dieser Weg führte, verbanden sich zu viele Erinnerungen, gute und schlechte, aber das machte fast keinen Unterschied. In den schlechten Erinnerungen lebten alte Schrecken wieder auf, und zum Teil hatten sie bis zum heutigen Tag nichts von ihrer Macht verloren. Und den guten Erinnerungen haftete die Erkenntnis der Unwiederbringlichkeit an, die Trauer darüber, dass Momente des Glücks das Leben streifen, sich aber nicht in ihm verankern können. Beatrice hatte sich jede Regung von Selbstmitleid schon vor langer Zeit verboten, aber manchmal konnte sie sich des bitteren Gedankens nicht erwehren, dass ihr das Leben nicht allzu viel Glück gebracht hatte. Wenn sie daran dachte, mit welcher Leichtigkeit und Zufriedenheit Mae immer gelebt hatte – zumindest dann, wenn sie sich nicht gerade mit eingebildeten Krankheiten oder mit düsteren Prognosen, die Zukunft der Welt betreffend, herumschlug. Mae hatte nie eine echte Tragödie durchleiden müssen; das bisher schmerzlichste Ereignis war der Tod ihres Vaters fünf Jahre zuvor gewesen: Er war, zweiundneunzigjährig, in einem schönen Altersheim bei London einem Herzschlag erlegen, und Beatrice fand, dass er einen besseren Lebensabend und einen leichteren Tod gehabt hatte als viele andere Menschen. Mae hatte den Anschein erweckt, ein Drama durchstehen zu müssen, während ihre alte Mutter, die allein in dem Heim zurückblieb, den Schicksalsschlag mit großer Würde hingenommen hatte.
Mae war von ihrem Mann auf Händen getragen worden, ihre Kinder hatten sie nie enttäuscht, und auch ihre Enkel entwickelten sich zu Prachtexemplaren. Außer Maja vielleicht, vor der kein Mann auf der Insel sicher war, aber sie mochte zu einem durchaus gefestigten Menschen werden, wenn ihre Sturm-und-Drang-Zeit erst hinter ihr lag. Nein, Mae war nie wirklich böse behandelt worden vom Leben.
Und ich?, fragte sich Beatrice. Bin ich böse behandelt worden vom Leben?
Es war die Frage, die ihr fast jedes Mal hier oben auf dem Klippenpfad durch den Kopf schoss, und sie war der Grund, weshalb Beatrice manchmal dachte, es sei besser, die Bay und ihre Umgebung zu meiden. Doch bisher war es ihr noch immer geglückt, die Frage unbeantwortet zu lassen und wieder zu verdrängen, und mit einer Art wütendem Trotz schlug sie jeden Morgen denselben Weg ein, den sie nun schon seit Jahrzehnten nahm und von dem sie sich ein paar quälender Gedankengänge wegen nicht vertreiben lassen wollte.
Sie schob die Frage nach den Widrigkeiten in ihrem Leben auch an diesem Morgen zur Seite und rief nach den Hunden – Zeit, den Rückweg anzutreten. Helene saß sicher schon aufrecht im Bett und erwartete ihren Morgentee. Beatrice wusste, wie ungeduldig sie ihrer Rückkehr vom Spaziergang entgegensah. Nicht, weil sie etwa hungrig oder durstig gewesen wäre. Aber nach einer langen Nacht gierte Helene nach einem Menschen, bei dem sie jammern und klagen konnte. Helene weinte gern und viel, und ähnlich wie Mae beschäftigte auch sie sich allzu viel mit zahlreichen Wehwehchen. Aber während Mae auch ihre sehr fröhlichen, kumpelhaften Seiten hatte, bestand Helene oft nur aus Unzufriedenheit und Genörgel.
»Kommt, Jungs«, sagte Beatrice zu den Hunden – Misty als einziges Weibchen bezog sie einfach in diesen Sammelbegriff mit ein –, »wir müssen heim und uns um Helene kümmern!«
Die Hunde schossen herbei und trabten nun im Rudel vor Beatrice her in Richtung Heimat. Hatte sie zuvor die Aussicht auf ein wildes Toben am Meer gereizt, so lockte nun die Erwartung eines üppigen Frühstücks daheim.
Sie sind immer zufrieden, dachte Beatrice, weil die ganz einfachen Dinge im Leben wichtig für sie sind. Sie stellen nichts in Frage. Sie leben einfach.
Auf dem Rückweg lief sie noch flotter als auf dem Hinweg, und als sie zu Hause ankam, hatte sie alle quälenden Gedanken abgeschüttelt.
Das Haus, gemauert aus dem bräunlichen Granit der Insel, umgeben von Rosen, Rhododendren und riesigen blauen Hortensien, lag wie ein kleines, friedvolles Paradies im Licht des Morgens. Die grünen Fensterläden standen weit offen, nur die vor Helenes Fenster im ersten Stock waren geschlossen. Es war genau halb acht. Jeder auf der Insel Guernsey hätte nach Beatrice die Uhr stellen können.
Um zehn vor acht betrat Beatrice Helenes Zimmer. Sie trug ein Tablett, auf dem eine Tasse Tee und ein Teller mit zwei Scheiben Toastbrot standen. Helene behauptete zwar stets, morgens überhaupt nichts essen zu können, aber auf geheimnisvolle Weise waren die Brote später immer verschwunden. Beatrice hatte einmal danach gefragt, und Helene hatte geantwortet, sie habe die Vögel damit gefüttert, aber Beatrice hatte das nur halb geglaubt. Helene war zart und schlank, doch sie sah keineswegs abgemagert aus, und es war klar, dass sie heimlich mehr aß, als sie zugab.
Sie hatte die Nachttischlampe eingeschaltet und saß aufrecht in ihren Kissen. Sie musste bereits im Bad gewesen sein, denn ihre Haare waren gekämmt, und auf ihren Lippen lag ein Schimmer von hellrosafarbenem Lippenstift. Gereizt fragte sich Beatrice, warum sie, wenn sie schon aufstand, nicht auch in der Lage war, Fenster und Fensterläden zu öffnen. Ihr Zimmer, dunkel, warm und stickig, erinnerte an eine Gruft, und vermutlich war dies auch genau der Eindruck, den Helene erwecken wollte. Sie war achtzig Jahre alt und konnte manchmal etwas vergesslich und konfus sein, aber sie bewies immer noch einen erstaunlichen Scharfsinn, wenn es darum ging, das Mitleid ihrer Umwelt zu erregen.
Helene wollte von morgens bis abends bedauert werden. Beatrice wusste, dass sie nicht immer so gewesen war, aber sie hatte stets den Hang gehabt, sich in ein Gefühl der Schutzlosigkeit hineinzusteigern und die Menschen um sich herum zu zwingen, ihr Mitleid und Anteilnahme entgegenzubringen und ihr hilfreich zur Seite zu stehen. Mit den Jahren hatte sich diese Neigung verfestigt, und inzwischen gab es nur noch wenige, die ihre ständige Larmoyanz ertrugen.
»Guten Morgen, Helene«, sagte Beatrice und stellte das Tablett auf einen Tisch neben das Bett. »Hast du gut geschlafen?«
Sie kannte die Antwort, und sie kam prompt. »Ich habe fast kein Auge zugetan, ehrlich gesagt. Die ganze Nacht habe ich mich herumgewälzt, ein paarmal habe ich das Licht angemacht und zu lesen versucht, aber abgespannt, wie ich zur Zeit bin, konnte ich mich einfach nicht konzentrieren, und …«
»Es ist einfach zu heiß hier drinnen«, unterbrach sie Beatrice. Schon nach einer halben Minute in der dumpf schwülen Luft des Zimmers hatte sie das Gefühl, kaum noch atmen zu können. »Warum du im Sommer bei geschlossenem Fenster schläfst, werde ich nie begreifen!«
»Es ist nicht mehr Sommer! Heute ist der 2. September!«
»Aber es ist heiß wie im Sommer!«
»Ich habe Angst, dass jemand einsteigen könnte«, sagte Helene verzagt.
Beatrice gab einen verächtlichen Laut von sich. »Also, Helene, wirklich, wie sollte das denn gehen? Da ist doch nichts, woran jemand heraufklettern könnte!«
»Die Mauer ist nicht ganz glatt. Ein geschickter Fassadenkletterer könnte …«
Beatrice öffnete das Fenster und stieß die Läden weit auf. Samtig frische Morgenluft strömte ins Zimmer. »Solange ich denken kann, schlafe ich bei offenem Fenster, Helene. Und noch nie ist irgendjemand bei mir eingestiegen. Nicht einmal in den Jahren, in denen ich jung war und es vielleicht ganz gerne gehabt hätte«, setzte sie hinzu, bemüht, durch einen Scherz den Ärger abzumildern, der wahrscheinlich in ihrer Stimme gelegen hatte.
Helene lächelte nicht. Sie kniff die Augen in der plötzlichen Helligkeit zusammen, griff nach ihrer Teetasse, nippte daran. »Was hast du heute vor?«, fragte sie.
»Ich wollte mich heute Vormittag um den Garten kümmern. Nachmittags bin ich mit Mae verabredet. In St. Peter Port.«
»Ja?« Helenes Stimme klang hoffnungsvoll. Sie wurde von Beatrice und Mae manchmal mitgenommen, wenn diese sich irgendwo auf der Insel zum Spazierengehen oder zum Einkaufen trafen, und Helene liebte es, mit Mae zusammen zu sein. Mae behandelte sie stets sehr fürsorglich, war liebevoller und warmherziger zu ihr als Beatrice. Sie erkundigte sich ausführlich nach Helenes Befinden, hörte sich geduldig alle Klagen an. Nie fuhr sie ihr gereizt über den Mund, wie Beatrice das oft tat, nie gab sie ihr das Gefühl, eine lästige alte Person zu sein, die allen nur auf die Nerven fiel. Mae war immer reizend und nett. Leider hatte selten sie zu bestimmen, was passierte; den Ton gab meist Beatrice an, und die war kaum je erpicht darauf, Helene irgendwohin mitzunehmen.
Auch jetzt erwiderte sie nichts auf das fragende »Ja?«, sondern machte sich im Zimmer zu schaffen, räumte Helenes Wäsche vom Vortag weg, suchte frische aus einer Kommode hervor und legte sie auf einem Sessel zurecht.
»Was wollt ihr denn machen in St. Peter Port?«, hakte Helene nach. »Kaffee trinken?«
»Ich fahre nie irgendwohin, um einfach nur Kaffee zu trinken, Helene, das weißt du doch!«, sagte Beatrice ungeduldig. »Nein, wir haben einfach verschiedene Dinge zu erledigen. Maja wird dabei sein, sie soll sich ein Geburtstagsgeschenk aussuchen, das Mae ihr kaufen will, und von mir soll sie auch irgendeine Kleinigkeit bekommen.«
»Maja hat doch erst nächsten Monat Geburtstag«, nörgelte Helene. Sie stand Maes Enkelin mit gemischten Gefühlen gegenüber, versuchte sich jedoch neutral zu verhalten. »Wie alt wird sie denn?«
»Zweiundzwanzig. Sie will eine Party veranstalten und möchte dafür etwas zum Anziehen haben, das so sexy ist, dass es die Männer anlockt wie Honig die Bienen – so hat sie es jedenfalls ausgedrückt.«
Helene seufzte. Für Majas promiskuitiven Lebenswandel konnte eine anständige Frau nur Verachtung übrig haben, aber manchmal entdeckte sie zu ihrer großen Verblüffung auch einen Hauch von Neid zwischen all den Schichten von Ablehnung und Entrüstung und moralischer Genugtuung darüber, dass Maja wenigstens gelegentlich die Quittung für ihre ungehemmten Ausschweifungen bekam – in Form eines blauen Auges etwa, das ihr ein gekränkter Liebhaber verpasste, oder in der eines schmerzhaften Eingriffes, mit dem sie die unerwünschten Folgen einer Liebesnacht beseitigen lassen musste. Maja hatte schon zweimal abgetrieben – jedenfalls wusste Helene von zwei Abbrüchen, es mochten aber tatsächlich auch mehr gewesen sein. Mae hatte Helene anvertraut, dass Maja Weltmeisterin darin war, die Einnahme der Pille zu vergessen. Helene sagte sich, dass auf ganz Guernsey – sowie auf den Nachbarinseln – vermutlich kein Mann zu finden war, der jemals bereit wäre, Maja zu heiraten, eine Frau, die es mit beinahe jedem Mann getrieben hatte, der ihren Weg kreuzte. Also wahrlich kein Grund, neidisch zu sein! Dennoch nagte da manchmal etwas; sie konnte sich nicht recht erklären, woher das Gefühl kam, und vielleicht wollte sie es sich auch gar nicht erklären, weil Erkenntnisse in diesen Fragen nur Schmerz bedeutet hätten. Auch wenn sie die Tatsache mit einbezog, dass sie in einer anderen Zeit jung gewesen war als Maja und dass das Leben damals nach anderen Wertvorstellungen geordnet gewesen war, so konnte sie doch dann und wann nicht anders, als Vergleiche zwischen der jungen Helene und der jungen Maja anzustellen. Und jedes Mal löste dies einen eigenartig heftigen Schmerz in ihr aus.
Du hättest mehr vom Leben haben können, wenn du dir mehr genommen hättest, hatte eine barsch klingende Stimme in ihrem Inneren einmal zu ihr gesagt, und seither war diese Stimme nie mehr ganz verstummt.
»Ich würde Maja auch gerne etwas schenken«, sagte sie nun rasch, »ich komme mit euch, und sie könnte sich etwas aussuchen.«
Beatrice seufzte; sie hatte gewusst, dass Helene es wieder einmal versuchen würde.
»Helene, du willst Maja doch gar nichts schenken, und das erwartet auch kein Mensch von dir«, sagte sie. »Du magst Maja nicht besonders, was dein gutes Recht ist, und du brauchst nicht an ihrem Geburtstag so zu tun, als ob das anders wäre.«
»Aber …«
»Du willst einfach mit, weil du wieder einmal nicht weißt, was du sonst mit dir anfangen sollst. Das ist wirklich keine gute Idee. Du weißt, wie Maja ist, wenn man ein Geschenk für sie kauft – sie jagt durch alle Geschäfte, und Mae und ich kommen kaum hinterher. Mit dir im Schlepptau wären wir völlig unbeweglich, denke nur an die vielen steilen Straßen und Treppen in St. Peter Port und an dein Rheuma!«
Helene war zusammengezuckt, und ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Du kannst wirklich sehr kalt sein, Beatrice. Warum sagst du nicht gleich, dass ich euch lästig bin?«
»Dann würdest du mich ja noch kälter finden«, entgegnete Beatrice und wandte sich zur Tür. Sie hatte alles im Zimmer einigermaßen geordnet und aufgeräumt, und es befiel sie schon wieder das Gefühl, jeden Augenblick zu ersticken, wenn sie noch länger Helenes quengeliger Stimme lauschte und in ihr blasses Gesicht blickte.
»Es wird ein sehr schöner Tag werden. Du kannst dich in den Garten setzen und lesen und dich freuen, dass du nicht in der Gegend herumlaufen musst.«
Helene kniff die Lippen zusammen. Andere Menschen sahen unsympathisch aus, wenn sie einen schmalen Mund bekamen, nicht aber Helene. Sie wirkte noch immer mitleiderregend.
»Wenn du dich schon so für Majas Geburtstag engagierst«, stieß sie hervor, »denkst du dann gelegentlich wohl auch daran, dass ich bald Geburtstag habe?«
»Das kann ich ja nun beim besten Willen nicht vergessen«, entgegnete Beatrice barsch.
Wie sollte sie auch? Sie und Helene hatten am selben Tag Geburtstag – am 5. September. Allerdings war Helene zehn Jahre früher geboren. Und überdies nicht auf Guernsey, so wie Beatrice.
Sondern in Deutschland.
Sie hatte Rindermist kommen lassen von einem Bauern aus Le Variouf. Damit wollte sie die Rosen düngen, zum letzten Mal in diesem Jahr. Rindermist eignete sich am besten, viel besser als jeder andere Dünger, den man in Geschäften kaufen konnte. Sam, der Bauer, war gleich nach dem Frühstück erschienen und hatte eine Fuhre abgeliefert. Das Zeug stank jetzt im Schuppen vor sich hin, und Beatrice hatte irgendwie keine Lust, mit der Arbeit anzufangen. Vielleicht war es einfach zu heiß. Auch Sam hatte gemeint, es werde fast unerträglich warm werden – auf jeden Fall viel zu warm für die Jahreszeit.
»Das habe ich schon beim Aufstehen gemerkt«, hatte er gesagt, den Hut aus der Stirn geschoben und sich mit einem Taschentuch den Schweiß abgewischt. »Wird verdammt heiß heute, hab ich gedacht. Und da war wenigstens noch eine Brise in der Luft. Jetzt regt sich nichts mehr, merken Sie das? Kein Windhauch, nichts! Wird hart heute mit der Arbeit!«
»Ausgerechnet heute muss ich in die Stadt«, hatte Beatrice gesagt, »aber da kann man nichts machen. Ich werde es schon überleben.«
»Klar. Sie überleben alles, Mrs. Shaye!« Er hatte gelacht und trotz der Hitze den Schnaps angenommen, den sie ihm anbot. Sam trank gerne einen kräftigen Schluck zwischendurch, aber er musste es heimlich tun, weil seine Frau schimpfte, wenn sie etwas davon mitbekam.
Beatrice musste an seine Worte denken, während sie durch den Garten wanderte, einen großen Hut zum Schutz vor der Sonne auf dem Kopf, einen Strohkorb am Arm und eine Gartenschere in der Hand, mit der sie Verblühtes abschnitt und Wildtriebe an den Rosen kappte. Eine ruhige, angenehme Beschäftigung, der Wetterlage angemessen.
Sie überleben alles, Mrs. Shaye!
Sie wusste, dass sie den Ruf hatte, unverwüstlich zu sein und sich von nichts und niemandem unterkriegen zu lassen, und manchmal wunderte sie sich über die Hartnäckigkeit, mit der ihre Umgebung an dieser Überzeugung festhielt. Sie selbst fühlte sich nicht einmal halb so stark, wie das die Menschen ringsum offensichtlich von ihr dachten. Eher hatte sie den Eindruck, dass es ihr geglückt war, einen recht stabilen Panzer um sich herum zu errichten, der allem standhielt, was von außen herandrängte, und der vor allem ihr Innenleben vor neugierigen Blicken schützte. Dort gab es, so meinte sie von Zeit zu Zeit zu spüren, noch eine Reihe Wunden, die bis heute nicht aufgehört hatten zu bluten. Das Gute war, dass offenbar wirklich niemand sie zu entdecken vermochte.
Sie schnippelte rasch und geübt an ihren Rosen herum, allerdings ohne ein einziges Wort an sie zu richten. Ihr Vater hatte immer mit den Rosen gesprochen und behauptet, dies sei außerordentlich wichtig.
»Sie sind Lebewesen. Sie brauchen Zuwendung und das Gefühl, ernst genommen und gemocht zu werden. Sie spüren genau, wenn man es gut mit ihnen meint, ihren Charakter, ihre Wesenszüge und Eigenarten respektiert. Und genauso merken sie es, wenn du sie herablassend und gleichgültig behandelst.«
Als kleines Mädchen hatte Beatrice diesen Worten andächtig gelauscht und keine Sekunde lang an ihrer Richtigkeit gezweifelt. Aber Andrew Stuart, ihr Vater, war für sie sowieso gleich nach dem lieben Gott gekommen, und es gab schlechthin nichts auf der Welt, was sie ihm nicht gläubig abgenommen hätte. In gewisser Weise war sie auch heute noch der Ansicht, dass er recht gehabt hatte, aber sie hatte seine Worte nie umsetzen können. Irgendwann, in den harten Jahren des Krieges und in den schweren Zeiten danach, war ihr die Fähigkeit abhandengekommen, seine gemütvolle, sanfte und von einer echten Liebe zur Schöpfung durchdrungene Art zu leben für sich selbst zu übernehmen. Andrew war zu verletzbar gewesen, und das konnte und wollte sie sich nicht leisten. Und irgendwie wurde sie die Vorstellung nicht los, dass ein Mensch, der mit den Rosen sprach, dem Leben die Breitseite zum Angriff bot. Es mochte eine fixe Idee sein, ein Vorurteil, nicht zu belegen, aber es bewirkte, dass sie nicht in der Lage war, auch nur ein einziges Wort an ihre Rosen zu richten. Sie hatte es seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr nicht mehr fertiggebracht. Eine Ahnung sagte ihr, es werde einem Dammbruch gleichkommen, wenn sie es tat.
Als Helene vom Haus herrief, Beatrice möge ans Telefon kommen, war sie dankbar für die Gelegenheit, ein paar Minuten lang der immer drückender werdenden Hitze zu entkommen.
»Wer ist es denn?«, fragte sie, als sie in den Flur trat. Helene, inzwischen mit einem rosafarbenen seidenen Morgenmantel bekleidet, stand vor dem Spiegel und hielt den Telefonhörer in der Hand.
»Es ist Kevin«, sagte sie, »er möchte dich etwas fragen.«
Kevin züchtete ebenfalls Rosen, stand aber im Unterschied zu Beatrice noch mitten im Geschäftsleben. Er war achtunddreißig Jahre alt und schwul, und er hing mit einer rührenden Zuneigung an den beiden alten Damen aus Le Variouf. Seine Gärtnerei lag zwanzig Autominuten entfernt an der Südwestspitze der Insel.
Kevin rief oft an; er fühlte sich häufig einsam und hatte es zu einer wirklich intakten, stabilen Partnerschaft noch nicht gebracht. Seine langjährige Beziehung zu einem jungen Mann namens Steve war gerade zerbrochen, sein gleichzeitig verlaufendes Verhältnis zu einem etwas zwielichtigen Franzosen bestand ebenfalls nicht mehr. Im Augenblick schien es niemanden für ihn zu geben. Guernsey bot wenig Möglichkeiten für Homosexuelle. Kevin träumte davon, eines Tages nach London zu ziehen und dort den »Mann fürs Leben« zu finden – wobei jeder, der ihn kannte, wusste, dass Kevin seine Insel nie verlassen würde. Und für das raue Leben in einer Großstadt war er schon gar nicht geschaffen.
Beatrice nahm Helene den Hörer aus der Hand. »Kevin? Was gibt’s? Findest du nicht auch, dass es heute viel zu heiß ist zum Arbeiten?«
»Ich kann es mir leider nicht leisten, auch nur einen Tag blauzumachen, das weißt du ja«, sagte Kevin. Er hatte eine ungewöhnlich tiefe Stimme, mit der er Frauen am Telefon halb verrückt machen konnte. »Hör zu, Beatrice, ich brauche deine Hilfe. Es ist mir wirklich peinlich, aber … könntest du mir ein wenig Geld leihen?«
»Ich?«, fragte Beatrice überrascht. Kevin pumpte sich häufig Geld, vor allem im vergangenen halben Jahr, aber er wandte sich mit diesem Problem fast immer an Helene. Sie hatte einen Narren an ihm gefressen, und er konnte sicher sein, nie mit leeren Händen davongehen zu müssen.
»Es ist mir unangenehm, schon wieder bei Helene vorstellig zu werden«, sagte Kevin unbehaglich, »sie hat mir ja gerade erst mit einer größeren Summe ausgeholfen. Ich meine, wenn du …«
»Wie viel brauchst du denn?«
Er zögerte. »Eintausend Pfund«, sagte er schließlich.
Beatrice zuckte zusammen. »Das ist ziemlich viel.«
»Ich weiß. Ich zahle es auch bestimmt zurück. Du musst dir keine Gedanken machen.«
Natürlich musste man sich bei ihm Gedanken machen. Beatrice wusste, dass Kevin Helene noch kaum je einen Penny zurückgezahlt hatte. Er hatte das Geld einfach nicht. Er hatte nie Geld.
»Du kannst die Summe haben, Kevin«, sagte sie, »und mit dem Zurückzahlen lass dir einfach Zeit. Aber ich verstehe nicht so recht, warum du immer wieder so große Summen brauchst. Laufen deine Geschäfte so schlecht?«
»Wessen Geschäfte laufen schon gut zurzeit«, meinte Kevin vage. »Die Konkurrenz ist groß, und die allgemeine wirtschaftliche Lage ist nicht allzu rosig. Außerdem habe ich zwei weitere Gewächshäuser gekauft, und bis sich die Ausgabe amortisiert, wird es eine ganze Weile dauern. Dann jedoch werde ich …«
»Schon gut. Komm morgen vorbei und hole dir einen Scheck ab.« Beatrice mochte nicht seine unhaltbaren Versprechungen hören, und sie mochte ihm auch keine Vorhaltungen machen. Ihrer Ansicht nach lebte Kevin einfach auf zu großem Fuß. Die feinen Seidenkrawatten, die Kaschmirpullover, der Champagner … All dies hatte seinen Preis.
Er wird nie auf einen grünen Zweig kommen, dachte sie.
»Du bist ein Schatz«, sagte Kevin nun voller Erleichterung. »Ich werde mich bei nächster Gelegenheit revanchieren.«
»Gern«, sagte Beatrice. Kevin revanchierte sich auf die immer gleiche Weise. Er konnte kochen wie ein Gott und eine herrliche Dinner-Atmosphäre schaffen – mit Blumen, Kerzen, Kristall und Kaminfeuer. Er liebte es, einen Gast zu umsorgen, zu verwöhnen. Häufig lud er Helene ein, aber das geschah aus einer gewissen Berechnung heraus. Zu Beatrice hingegen sagte er manchmal, sie sei die einzige Frau, in die er sich je verliebt habe.
Nachdem sie das Gespräch beendet hatten, blieb Beatrice noch einen Moment lang nachdenklich im Flur stehen. Sie fand, dass Kevin gehetzt geklungen hatte. Es schien eine Menge für ihn vom Erhalt des Geldes abzuhängen.
Hoffentlich sitzt er nicht tiefer im Schlamassel, als er zugibt, überlegte Beatrice.
»Was wollte Kevin denn?«, fragte Helene. Sie hatte sich während des Gesprächs diskret in die Küche verzogen, tauchte nun aber wieder auf und versuchte beiläufig zu erscheinen – was nicht der Wahrheit entsprach. Helene war nie beiläufig. Sie befand sich stets in einer innerlichen Habt-achtstellung, war immer wachsam, immer angestrengt, alles mitzubekommen, was im Haus vor sich ging – vor allem, was Beatrice betraf: mit wem sie sprach und worüber, mit wem sie sich traf, was sie vorhatte und warum.
»Du bist neurotisch kontrollsüchtig!«, hatte Beatrice ihr einmal entnervt entgegengeschrien, und Helene war in Tränen ausgebrochen, aber es hatte nichts geändert.
»Kevin braucht Geld«, erklärte Beatrice. Ihr war klar, dass Helene ohnehin gelauscht hatte und dass sie daher mit offenen Karten spielen konnte. »Und ich soll es ihm geben.«
»Wie viel?«
»Eintausend Pfund.«
»Eintausend Pfund?« Helene schien wirklich verblüfft. »Schon wieder?«
»Warum? Brauchte er kürzlich erst so viel?«
»Letzte Woche. Ich habe ihm letzte Woche eintausend Pfund gegeben. Wieso kommt er nicht zu mir?«
»Wahrscheinlich genau deshalb.« Beatrice versuchte, nicht allzu gereizt zu klingen, aber selbst das kurze Gespräch mit Helene entnervte sie schon. »Er will nicht schon wieder bei dir antanzen und die Hand aufhalten.«
»Wozu braucht er denn ständig so viel Geld?«
»Ich weiß es nicht. Mir ist das nicht geheuer. Ich vermute, er hat einen neuen Liebhaber, der ziemlich teuer ist. Das wäre typisch Kevin.«
»Aber warum …«
»Lieber Himmel, Helene, hör bitte auf, mir Löcher in den Bauch zu fragen! Ich weiß auch nicht, was bei Kevin los ist. Wenn du es unbedingt herausfinden willst, dann geh zu ihm und frage ihn!«
»Du redest schon wieder so gereizt mit mir!«
»Weil du immer alles wissen musst. Soll ich dir demnächst noch meine Träume aufschreiben und die Zeiten, zu denen ich auf die Toilette gehe?«
Helenes Augen füllten sich mit Tränen. »Immer bist du so hässlich zu mir! Auf Schritt und Tritt zeigst du mir, dass ich dir auf die Nerven gehe. Den ganzen Tag sitze ich da, und niemand kümmert sich um mich, und für niemanden bin ich auch nur im Geringsten wichtig. Und wenn ich dann wenigstens ein bisschen an deinem Leben teilhaben will, dann …«
Wenn Helene anfing, ihre Lebensumstände zu beklagen, konnte das endlos dauern, und es würde in einem Meer von Tränen enden. Beatrice hatte nicht den Eindruck, dies jetzt ertragen zu können.
»Helene, vielleicht sollten wir ein anderes Mal deine bedauernswerte Situation besprechen. Ich würde jetzt gerne im Garten mit den Rosen weitermachen und dann losfahren, um Mae zu treffen. Meinst du, das wäre möglich?«
Sie hatte mit jener gefährlichen Höflichkeit in Stimme und Tonfall gesprochen, von der sie wusste, dass Helene sie fürchtete. Tatsächlich biss die alte Frau sich auf die Lippen und wandte sich ab. Sie würde sich jetzt in ihr Zimmer zurückziehen und ihren Tränen dort freien Lauf lassen.
Beatrice sah ihr nach, wie sie langsam die Treppe hinaufstieg, und fragte sich, warum sie unfähig war, Mitleid für die arme, neurotische Person zu empfinden. Helene war eine tief unglückliche Frau, war es immer gewesen. Sie fand einfach keinen Frieden, nicht einmal im Alter.
Und mir gelingt es nicht, sie zu bedauern, dachte Beatrice. Und sie erschrak fast selbst, als sie unwillkürlich in Gedanken hinzufügte: Es gelingt mir nicht, weil ich sie mit jedem Tag mehr hasse.
2
Franca hatte schon im Flugzeug gewusst, dass auf dieser Reise alles schieflaufen würde. Sie hatte sich in der Maschine zunächst auf den falschen Platz gesetzt und war von dem Mann, dem der Sitz zugeteilt worden war, in einer Art angefahren worden, als habe sie sich auf völlig unverzeihliche Weise an fremdem Eigentum vergriffen. Danach war sie in der Maschine umhergeirrt, bis sich eine Stewardess ihrer erbarmt, ihre Bordkarte angesehen und sie zu ihrem Platz geleitet hatte. Einer Panikattacke nahe, war Franca in die Polster gesunken und hatte mit zitternden Fingern in ihrer Handtasche nach Tabletten gesucht, hatte die flache Schachtel schließlich gefunden und dann voller Entsetzen festgestellt, dass sie fast leer war. Das hatte es noch nie gegeben, nie war ihr so etwas passiert. Wenn sie tatsächlich einmal das Haus verließ, was selten genug vorkam, dann vergewisserte sie sich vorher ein Dutzend Mal, dass sie genügend Beruhigungsmittel eingesteckt hatte. Diesmal, zu Beginn einer längeren Reise, hatte sie das natürlich auch getan, aber sie hatte geglaubt, die zwei Blisterstreifen in der Schachtel seien voll bestückt.
Wie konnte das nur passieren?, fragte sie sich verzweifelt. Bis auf eine einzige Pille waren beide Streifen leer !
Ihr erster Impuls war, aufzuspringen und aus dem Flugzeug zu hasten. Die Maschine musste ohne sie starten, sie konnte nicht mitfliegen. Auf Guernsey, also im Ausland, würde sie die Medikamente, die sie brauchte, nicht bekommen, ganz abgesehen davon, dass sie auch kein Rezept dabeihatte. Aber da schob sich das Flugzeug schon langsam aus seiner Parkposition heraus, und Franca begriff, dass sie keine Chance mehr hatte. Sie würde nach Guernsey fliegen, und sie würde mit einer einzigen Tablette auskommen müssen.
Sie wusste inzwischen nur zu gut, dass ihre Panikattacken meist unvermittelt kamen, sie überfluteten wie eine riesenhohe Welle und sie für qualvolle, lange andauernde Minuten in einem Zustand des Entsetzens und der Verzweiflung verharren ließen. Die Panik, die sie nun im Flugzeug überfiel, hatte sie vorausgeahnt: Sie war ausgelöst worden, als der Mann, auf dessen Platz sie gelandet war, sie angeschnauzt hatte, und sie erhielt ihren entscheidenden Schub mit der Entdeckung, dass die Tablettenschachtel fast leer war. Doch obwohl Franca genau gewusst hatte, dass sie jeden Moment mit unerbittlicher Gewalt zuschlagen würde, schnappte sie fassungslos nach Luft unter der Wucht des Angriffs. In Sekundenschnelle war ihr leichter Baumwollpullover von Schweiß durchtränkt, verwandelten sich ihre Beine in Pudding, begannen Herz und Puls zu rasen, als habe sie einen Marathonlauf hinter sich. Sie fing heftig an zu frieren, wusste aber, dass das Frieren von innen kam, dass nichts auf der Welt sie würde wärmen können. Ihre Zähne schlugen kaum hörbar aufeinander. Sie wusste um ihre aschfahle Gesichtsfarbe in solchen Momenten. Sie musste aussehen wie ein Gespenst.
Neben den körperlichen Symptomen, dem Zittern, Schwitzen und gleichzeitigen Frieren, breitete sich die Angst in ihrem Inneren aus, mit der Geschwindigkeit eines Feuers in einem ausgedörrten Wald. Fast meinte sie Michael zu hören, seine genervte, ärgerliche Stimme.
»Was denn für eine Angst, Herrgott noch mal?« Das fragte er immer wieder, und offensichtlich gelang es ihr nie, ihm eine zufriedenstellende Antwort zu geben.
»Es ist nicht einfach Angst. Das Wort ist zu schwach. Es ist Panik! Aber eine unbestimmbare Panik. Ein Gefühl von Entsetzen. Von Qual. Von Ausweglosigkeit. Eine namenlose Angst, der man nichts entgegensetzen kann, weil man nicht weiß, woher sie kommt.«
»Es gibt keine namenlose Angst. Keine unbestimmbare Panik! Man muss doch wissen, wovor man Angst und Panik hat!«
»Vor allem. Vor dem Leben. Vor den Menschen. Vor der Zukunft. Alles erscheint dunkel, bedrohlich. Es ist …«
Jedes Mal waren ihre Schilderungen in Hilflosigkeit erstorben. »Michael, ich weiß es einfach nicht. Es ist schrecklich. Und ich bin völlig wehrlos.«
»Unsinn. Man ist nie völlig wehrlos. Das ist nur eine Frage des Willens. Aber du hast dich ja schon vor sehr langer Zeit auf den bequemen Standpunkt zurückgezogen, eben keinen Willen zu haben. Damit kannst du getrost die Arme hängenlassen und von einer Panik zur nächsten taumeln.«
Sie hörte seine Stimme gnadenlos auf sich einhämmern, während das Flugzeug zur Startbahn rollte und sie vergeblich versuchte, ihr Zittern und die innere Qual auf irgendeine Weise unter Kontrolle zu bringen.
Die Tablette … Sie wusste, innerhalb einer knappen Minute würde sie sich beruhigen, wenn sie sie schluckte. Aber dann war sie weg. Ihre Wirkung hielt fünf bis sechs Stunden an, höchstens. Und sie konnte Guernsey erst übermorgen wieder verlassen.
»Geht es Ihnen nicht gut?«
Sie vernahm die Stimme ihrer Nachbarin wie durch einen Nebel. Verschwommen sah sie das freundliche Gesicht einer alten Dame. Weiße Haare, gütige Augen.
»Sie haben graue Lippen und zittern wie Espenlaub. Soll ich die Stewardess rufen?«
»Nein, vielen Dank.« Jetzt nur kein Aufsehen erregen. Sie wusste aus Erfahrung, dass dies die Situation verschärfen würde. »Ich habe hier eine Tablette … Wenn ich die schlucke, geht es mir sofort besser.«
»Haben Sie Flugangst?«
»Nein … ich bin … ich habe eine verschleppte Erkältung …« Das klang sicherlich völlig unglaubhaft, aber ihr fiel in diesem Moment nichts anderes ein. Sie brauchte drei Anläufe, um die Tablette aus dem Zellophan zu drücken. Ihre Finger bebten, als sie sie in den Mund steckte. Sie bekam sie leicht ohne Wasser hinunter, das hatte sie in den vergangenen Jahren, in denen sie die Tabletten in den unmöglichsten Momenten hatte schlucken müssen, nur zu gut gelernt.
»Ich hatte schreckliche Flugangst früher«, sagte die alte Dame, die Erklärung mit der verschleppten Erkältung ignorierend. »Zeitweise bin ich in keine Maschine mehr gestiegen. Aber dann habe ich mir gesagt, dass ich es irgendwie bekämpfen muss. Meine Tochter ist auf Guernsey verheiratet. Und schließlich will ich sie und die Enkel ab und zu sehen. Mit dem Auto ist das eine sehr weite Strecke, und mit der Bahn … ach, du lieber Gott!« Sie winkte ab. »Da habe ich mir das Fliegen richtig antrainiert. Und inzwischen macht es mir überhaupt keine Probleme mehr.« Sie lächelte. »Sie werden das auch in den Griff bekommen.«
Franca schloss die Augen. Die Tablette begann bereits zu wirken. Das Zittern verebbte. Sie hörte auf zu frieren. Der Schweiß trocknete auf ihrer Haut. Die Panik versickerte langsam. Sie atmete tief durch.
»Sie bekommen wieder etwas Farbe auf den Wangen«, stellte ihre Nachbarin fest. »Diese Tabletten scheinen fantastisch zu wirken. Was ist das eigentlich?«
»Ein Baldrianpräparat.« Franca ließ die Schachtel eilig in ihrer Handtasche verschwinden. Ihr Körper entspannte sich. Sie lehnte den Kopf an die Lehne.
Sechs Stunden. Sechs Stunden, wenn sie optimistisch dachte, und Optimismus fiel ihr in dieser Phase, kurz nach der Einnahme, nicht schwer. Sechs Stunden, in denen sie Ruhe hatte.
Und dann?
Wie mache ich das morgen in der Bank, überlegte sie, wie schaffe ich es, aus dem Hotelzimmer zu kommen?
Das Abendessen und das Frühstück konnte sie ausfallen lassen und einfach im Zimmer bleiben. Wenn sie Glück hatte, gelang es ihr noch, auf dem Flughafen in St. Martin ein Sandwich zu kaufen, dann musste sie nicht allzu sehr hungern. Aber zur Bank musste sie morgen, und es war ihr ein Rätsel, wie sie diesen Gang bewältigen sollte.
Ich muss morgen darüber nachdenken, beschloss sie, vielleicht habe ich gar keine Attacke, und damit gibt es überhaupt kein Problem.
Irgendwo in einem Winkel ihres Gehirns wusste sie, dass eine Attacke kommen würde, denn es kam immer eine, aber gedämpft durch das Medikament konnte sich dieser Gedanke keinen Raum verschaffen. Ein sanfter Schleier hatte sich über ihr Empfinden gebreitet. Sie würde die Dinge einfach auf sich zukommen lassen.
Reza Karim fuchtelte aufgeregt mit den Händen und gab einen Wortschwall in seiner pakistanischen Muttersprache von sich, ehe er sich besann und in sein hartes, etwas abgehacktes Englisch zurückfiel.
»Ich weiß es nicht! Ich weiß wirklich nicht, wie das passiert sein kann. Ich habe hier keine Buchung! Mrs. Palmer, ich bin untröstlich. Kann es sein, dass Sie vergessen haben, mich zu verständigen?«
Franca hielt sich mit beiden Händen am Tresen der Rezeption fest und starrte Reza Karim hypnotisch an. »Mr. Karim, mein Mann hat das Zimmer gebucht. Vielmehr, seine Sekretärin hat es getan. Und das hat doch immer funktioniert.«
»Ja, aber ich habe diesmal keine Buchung!« Hektisch blätterte Karim in seinem Reservierungsbuch vorwärts und rückwärts. »Hier ist nichts! Hier wird alles eingetragen. Hier ist nichts!«
»Ich brauche ein Zimmer, Mr. Karim.« Sie begann zu schwitzen, aber das mochte an der Hitze liegen, die über der Insel brütete. Noch hielt die Wirkung des Tranquilizers an. Aber was, um Himmels willen, sollte sie tun, wenn sie kein Hotelzimmer bekam?
Sie war jedes Mal im St. George Inn abgestiegen, wenn sie auf Guernsey gewesen war. Eine preiswerte Absteige, und manchmal hatte sie gedacht, dass Michael ihr ruhig ein etwas feudaleres Quartier hätte spendieren können als dieses zwischen anderen Häusern eingezwängt stehende Gebäude, in dem stets abgestandener Essensgeruch zwischen den Wänden hing, der dicke weinrote Teppichboden vor Schmutz starrte, die schmale Treppe sich halsbrecherisch steil nach oben schraubte und die Badezimmer jede Andeutung von Komfort vermissen ließen – ganz abgesehen davon, dass man sich in den winzigen Zellen kaum einmal um sich selber drehen konnte und beim Haarefönen ständig mit den Ellbogen an die Wände stieß. Aber irgendwann hatte sich Franca an die stickigen Räume und an Mr. Karim gewöhnt, und Michaels Rechnung war aufgegangen: Letztlich hielt Franca an allem fest, was ihr einmal vertraut war. Selbst wenn sie sich nicht wirklich wohl fühlte in dem Hotel, so erschien es ihr doch weitaus erträglicher, einen vertrauten schrecklichen Zustand aufrechtzuerhalten, als etwas Neues zu probieren und möglicherweise an einen ungewohnten schrecklichen Umstand zu geraten.
»Natürlich brauchen Sie ein Zimmer, natürlich«, sagte Karim nun, »aber unglücklicherweise bin ich vollständig ausgebucht. Sie wissen ja, über Gästemangel konnte ich mich noch nie beklagen!« Er lachte. Franca hatte das bisher nicht gewusst, konnte es sich auch nicht vorstellen, aber sie nahm an, dass er die Wahrheit sagte, was seine augenblickliche Situation anging. Hätte er auch nur das kleinste Kellerloch noch frei gehabt, er hätte sie hineingequetscht.
»Kann ich telefonieren?«, fragte Franca.
»Selbstverständlich!« Er schob ihr den Apparat hin, ein altmodisches schwarzes Monstrum, wie es Franca nur aus nostalgischen Fernsehfilmen kannte. Sie wählte die Nummer des Labors, die Durchwahl von Michaels Büro.
Er war sogleich selbst am Telefon. »Ja?«
»Michael, ich bin es, Franca. Ich stehe hier im St. George, und stell dir vor, irgendetwas muss schiefgelaufen sein. Für mich ist kein Zimmer gebucht.«
»Das kann nicht sein.«
»Es ist so. Mr. Karim hat keinen Eintrag vorliegen.«
»Dann soll er dir eben so ein Zimmer geben.«
»Er ist ausgebucht. Es ist absolut nichts frei.«
Michael seufzte. »Das kann nicht sein!« Sein Tonfall, seine Stimme klangen, als würde er sagen: »Was hast du denn jetzt schon wieder versiebt? Gibt es denn nichts, einfach gar nichts, was du jemals richtig machst?«
Irgendwo in ihrem Körper begann ein Nerv zu vibrieren. Es war wie eine eigentümliche Art von Schmerz, jedoch nicht lokalisierbar und nicht beschreibbar. Es war, als sei dort eine Stelle über Jahre hinweg wundgerieben worden und sende nun bei der geringsten Berührung quälende Strahlen aus.
»Ich weiß nicht, ob es sein kann«, sagte sie, »aber es ist jedenfalls so. Hier ist kein Zimmer für mich gebucht.«
»Dann muss es ein Versehen sein«, meinte Michael, »ich hatte Sonia jedenfalls Bescheid gesagt.« Sonia war seine Sekretärin, und im Allgemeinen erledigte sie jeden Auftrag mit größter Gewissenhaftigkeit.
»Was soll ich denn jetzt machen?«, fragte Franca verzagt.
Michael seufzte erneut. »Du wirst dir doch wohl ein anderes Hotel suchen und dort ein Zimmer mieten können! Lieber Gott, was soll ich denn von hier aus für dich tun?«
»Michael, ich habe Angst. Ich würde am liebsten wieder zurückfliegen. Ich …« Sie zögerte, ihr Missgeschick einzugestehen, brachte die Worte dann aber doch über die Lippen: »Ich habe keine Tabletten. Ich hatte nur noch eine, und die habe ich im Flugzeug nehmen müssen. Nun weiß ich nicht …«
»Das darf doch wohl nicht wahr sein!« Wer Michael hörte, hätte meinen können, er habe es mit einer Schwachsinnigen zu tun, die ihn mehr und mehr entnervte. »Ich schicke dich nach Guernsey. Ich bezahle den Flug. Ich bitte dich einmal um etwas. Und …«
»Ich bin schon oft für dich hier gewesen.«
»Es ist aber tatsächlich auch das Einzige, was von dir verlangt wird. Es gibt sonst weiß Gott nichts, worum ich dich bitte. Die minimalsten Erwartungen und Ansprüche, die ein Mann haben kann, habe ich ja schon zurückgeschraubt. Nur um diesen einen Gefallen bitte ich dich noch – zweimal im Jahr! Und das ist jetzt auch schon zu viel? Das empfindest du jetzt auch schon als Zumutung? Dafür bist du jetzt auch schon zu fein, zu zart, zu sensibel?«
»Das habe ich doch gar nicht gesagt.« Der leise Vibrationsschmerz wurde stärker. Noch hielt die Wirkung des Medikaments an, aber Franca wusste, wenn sie das Gespräch nicht bald beendete, würde es nicht sechs Stunden dauern, bis der Zustand der Ruhe in sich zusammenbrach.
»Du wirst den Aufenthalt auf Guernsey jetzt nicht beenden! Hörst du? Du wirst morgen zur Bank gehen und erst danach zurückkommen. Wenn du nicht bis Samstag warten willst, dann versuche, einen Flug für morgen Abend zu bekommen. Aber du gehst zur Bank! Haben wir uns verstanden?«
»Ja«, hauchte sie. Sie hatte wie immer das Gefühl, unter seiner Stimme buchstäblich kleiner zu werden. So, als verliere sie tatsächlich an Zentimetern, schrumpfe in sich zusammen. Irgendwann würde sie so klein sein, dass niemand mehr sie sah. Oder sich einfach auflösen.
Michael klang nun ein wenig freundlicher. Er schien sich zu erinnern, dass ihre Paniken heftig sein konnten, und womöglich kam es ihm in den Sinn, dass es besser sein könnte, Franca ein wenig zu stabilisieren, anstatt ihr den letzten Rest Selbstvertrauen zu rauben.
»Du wirst das schon hinkriegen. Du gehst jetzt los und suchst dir eine Übernachtungsmöglichkeit. Vielleicht kann Mr. Karim dir behilflich sein. Ruf mich heute Abend an und sage mir Bescheid, ob alles geklappt hat!« Damit beendete er das Gespräch, und Franca, die noch etwas hatte sagen wollen, verschluckte ihre Worte und legte ebenfalls auf.
»Können Sie mir helfen, ein Zimmer zu finden?«, wandte sie sich an Karim.
Der kratzte sich am Kopf. »Das wird schwierig. Verdammt schwierig. Die Insel dürfte weitgehend ausgebucht sein.«